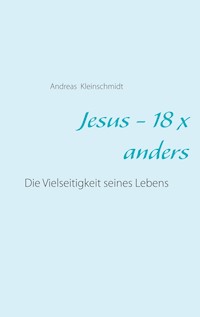Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Seelenbinder - Roman Als Anführer unter Jugendlichen in einem Mietshaus, dem "Glaspalast", als Lehrer seiner Schüler, als Bürgermeister einer deutschen Großstadt für seine Mitbürger sucht der "Seelenbinder" Mitstreiter für Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei erfährt er Freundschaft und Liebe, aber auch Anfeindungen und Niederlagen. Am Ende aber führt ihn sein Kampf für das Gute zum Sieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Abendessen mit Überraschungsgästen
Träume unter Palmen in Daressalam
Der Tod fuhr mit
Dem Himmel so nahe
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin
Menam Queen
Burma, Traum und Wirklichkeit
Pirschfahrt in der Kalahari
Das Candacraig oder die Kunst in Gedanken zu reisen
Der Tag an dem ich mein Paradies fand
Kambodschas Dschungelstadt
Frühling an der Bergstraße
Geirrt wie Kolumbus
Unterwegs in der Unterwelt
Oktoberfahrt in die Weinberge
Warum ist es am Rhein so schön?
Sandwich Harbour
Meine Reise mit dem Finger auf der Landkarte
Faszination und Alptraum zugleich, kurz gesagt: Indien
In den Straßen von San Francisco
Der weiße Hai
Sundowner mit Haien
Auf dem Titelblatt der Thai Zeitung
Opium
Erta Ale, Einblick in das Erdinnere
Erste Begegnung mit Amsterdam
Prolog
Der etwas seltsam wirkende Untertitel meines Buches stammt nicht etwa von mir, mit diesen Lorbeeren kann ich mich nicht schmücken, er ist einem der großen Reisenden vergangener Jahrhunderte, mit kleinen Abweichungen, entliehen.
Kitab nuzhat al-mushtaq fi`khtiraq al-afaq (Buch einer Reise aus Lust an der Erkundung entlegener Länder) wurde von Al-Idrisis geschrieben und bezieht sich auf eine Entdeckungsfahrt auf dem Atlantik vor dem Jahr 1147.
Ich fand diesen Buchtitel sehr passend, denn Lust an der Erkundung „entlegener“ Länder hatte ich schon seit ich denken kann.
Das Fremdartige musste dazu nicht am anderen Ende der Welt liegen, manchmal reichte dazu auch eine Fahrradtour „um die Ecke“ oder eine Wanderung durch eine unerwartet unbekannte Heimat. Nicht die Entfernung in realen Kilometern macht die Qualität des Reisens aus, entscheidend ist für mich die Fantasie und der Wille Schönheit, Spannendes und Fremdartiges hinter jeder Biegung des Weges zu vermuten und wahrzunehmen.
Zunächst waren auch der Wald und die Wiesen der Umgebung meine „entlegenen Länder“, und eine Busfahrt in das Gorxheimertal nach Trösel war eine Weltreise mit mehrmaligem Umsteigen. Das alte Bauernhaus unserer Verwandtschaft am Hang ebenso exotisch wie die Unterkunft eines tibetanischen Mönches oder der Pontok eines namibischen Hirten. Selbst die Kleidung meiner Verwanden wirkten für mich wie von einem anderen Stern in der so eigenartig riechenden, dunklen, niedrigen, hölzernen Stube, in der nur am kleinen Fenster zur Straße hinaus genügend Licht einfiel, um mit Tante Gretel Mühle oder Dame zu spielen.
Es folgten zwei Urlaube im Nordschwarzwald, wo wir bei Verwanden eines Nachbarn wohnen durften und wohin wir mit dessen Auto chauffiert wurden. Alles war dort anders als zuhause und der schnell fließende Bach hinter unserem Zimmer mit den großen Forellen unterstrich dieses Gefühl losgelöst von der bekannten Heimat zu sein. Ich übernachtete zum ersten Mal in der Fremde und habe das Glucksen und Gluckern des Baches noch heute in den Ohren.
Ein Busurlaub in Österreich bildete einen Meilenstein in meinem Leben. Ich hatte zum ersten Mal mein Heimatland verlassen und traf am Großglockner auf eine großartige wilde Natur.
Danach dauerte es noch einige Jahre bis ich mit dem Geld, das ich in der Lehre verdiente, mir eine erste selbstständige Flugreise leisten konnte.
Meine erste Flugreise ging aber nicht etwa zum Pauschalurlaub in das europäische Ausland, wie man vielleicht annehmen konnte, sie führte mich sehr viel weiter. Ich reiste nach Südafrika. Ab dann gab es kein Halten mehr und meine Sehnsucht nach der „Entdeckung entlegener Länder“ war nicht mehr zu bremsen.
Inzwischen schaue ich auf einen Reisezeitraum von mehr als 60 Jahren zurück, wenn man meine Reisen in Wiesen, Wälder und Gorxheimertal dazu addiert.
In diesem Zeitraum sammelten sich einige Erfahrungen und Erlebnissen an.
Da ich nun genügend Zeit habe ein paar dieser Geschichten aufzuschreiben, bin ich dieser Tätigkeit nachgegangen, bevor die Erinnerungen einer Vergesslichkeit anheimfallen, die das Alter so mit sich bringt.
Ich behaupte in meinen Geschichten nicht, dass früher alles besser war.
Gerade diesbezüglich habe ich im letzten Jahr in Laos wieder den Gegenbeweis gefunden.
Verallgemeinerungen möchte ich nicht nur deshalb, egal zu welchem Thema, tunlichst vermeiden.
Trotzdem weiß ich aber, dass vieles für mich persönlich besser war, vieles was ich unterwegs angetroffen habe.
Wo heute ein Hotel neben dem anderen steht, wo sich eine Stadt gebildet hat, am Karon und Kata Beach auf Phuket in Thailand zum Beispiel, habe ich noch Reisfelder und Sandwege vorgefunden.
Nur ein paar erste kleine Bungalows mit Bambus-Wänden und Palmblätter bedeckt fanden sich zwischen den hohen Kokospalmen für eine sehr überschaubare Zahl an ersten Backpackern.
In Südafrika fuhren wir in einem alten DKW Junior Sprint, einem
Zweitakter, über unasphaltierte, Schlagloch-übersäte Wege entlang eines plötzlich vor uns auftauchenden Wasserfalls durch den Golden Gate Nationalpark in Natal.
Orientiert haben wir uns im Land mithilfe einer kostenlosen kleinen Broschüre, in der sich einige grobe Übersichts- Karten befanden. Ich kann die Beispiele beliebig fortsetzen.
Ich habe das Glück noch einer Generation anzugehören, die ohne
„Handy“, GPS- Geräten und sozialen Medien auskommen musste oder durfte.
Selbstredend benutze ich heute diese Dinge, auch wenn mein Blick darauf differenziert ist. Der Komfort ist größer, das Abenteuer und die Entdeckerfreude dagegen oftmals kleiner geworden.
Was ich damit sagen will, ist, dass sich die Welt sehr verändert hat. Dies ist nun mal der Lauf der Dinge.
Für diejenigen, die diese alte Welt nicht kennen, kann der Strand voller Hotels trotzdem noch „traumhaft“ sein, da es am Vergleich mangelt oder sich die persönliche Wertung der „Jetzt-Zeit“, vielleicht auch verbunden mit einem zunehmenden Wunsch nach Luxus, verändert hat
Die Möglichkeit eines Vergleichs und langjährige Erfahrung in einer sich immer weiter entwickelnden Welt verhindern aber, dass ich den Strand von Karon in Phuket, den ich 1978 kennenlernte, vierzig Jahre später, immer noch als „traumhaft“ ansehen kann.
Deshalb passt für mich auch der Satz „The first cut is the deepest“ perfekt zum Reisen.
Der erste Besuch einer Gegend oder eines Ortes wird immer der wichtigste Vergleichsparameter sein, an dem sich zukünftige Besuche messen lassen müssen.
Fällt die alte Kneipe am Hafen weg, verschwindet auch das altbekannte Gesicht des Wirtes, mit dem man sich so gut unterhalten hat und lässt mich, ob des Verlustes, mit etwas Wehmut an das Gestern denken, in dem Alles noch in Ordnung war.
Das neue Lokal, das objektiv gesehen vielleicht schöner und besser ist, kann subjektiv für mich eine Verschlechterung sein, da alte Weggefährten verschwunden sind und das Neue mich altern lässt. Vielleicht sollten deshalb junge Leute den Älteren nachsehen, wenn sie zu sehr von „Früher“ schwärmen. Früher waren wir Alten die
Jungen und ich verspreche Allen, ihr werdet irgendwann ebenfalls immer mehr von „Früher“ reden je älter ihr werdet.
Das bringt das Altern so mit sich.
Der Zunahme an Erfahrung und Wissen steht einer abnehmenden Perspektive und schwindenden Kräften gegenüber.
Als junger Mann bin ich einmal vor der paradiesischen Insel Koh Phi Phi zusammen mit dem damals noch sehr bekannten
Reiseschriftsteller Heinz Roux-Schulz geschnorchelt.
In einer Tiefe von etwa vier Metern entdeckte ich eine Muräne, die ich ihm zeigen wollte.
Dass er mit Achtzig Jahren nicht mehr so tief hinab tauchen konnte, habe ich damals nicht wirklich verstanden. Heute dagegen umso mehr.
Wahrscheinlich ist das ein Grund warum früher subjektiv gesehen doch einiges besser war.
Aber ich bin abgeschweift.
Dieses Buch beinhaltet kleine Geschichten, einige Momentaufnahmen, sowie Erlebnisse, die ich aus Reisen, die bis zu Fünfzig Jahre zurückliegen, zusammengestellt habe. Ich habe sie in allererster Linie für mich selbst aufgeschrieben, weil es mir Spaß bereitet hat, obwohl es zu Ende hin doch wieder in Arbeit ausgeartet ist.
Selbstverständlich lade ich aber gerne auch alle „geneigten Leser“ dazu ein, mich auf diesen Reisen zu begleiten und hoffe, dass die eine oder andere Geschichte gefällt. Damit wäre ich mehr als zufrieden.
Abendessen mit Überraschungsgästen
Moremi Delta, Botswana, August 2008 und 2009
Safari ist ein Kisuaheli Wort und bedeutet einfach nur Reise. Es wurde aber zum Synonym für Tierbeobachtung und dem Erleben der afrikanischen Wildnis. Was wäre für viele Besucher eine Reise auf den afrikanischen Kontinent ohne seine Tiere?
Sie sind einzigartig, großartig und mit nichts zu vergleichen. Allerdings wäre es ein katastrophaler Fehler, Afrika nur darauf zu reduzieren.
Dies würde diesem großartigen Kontinent in keiner Weise gerecht werden.
Als in einem Reiseforum einmal Johannesburg, Kampala und Daressalam nicht als authentisches Afrika akzeptiert wurde und der Fragesteller nur Wildreservate und Nationalparks als dieses ansah, schrieb ich, dass der Vogelpark Walsrode nun auch nicht unbedingt das authentische Deutschland abbildet.
Zumindest bei etlichen Mitlesern hat diese Bemerkung große Heiterkeit ausgelöst.
Nicht nur einmal habe ich gehört: „Was will man in Afrika sonst machen außer Safari. Kultur, so wie in Asien, gibt es ja nicht.“ Afrikas reichhaltige, faszinierende Kultur scheint für den oberflächlich Reisenden schwerer zu entdecken zu sein als die bekannten Tempel Kambodschas oder Thailands.
Das alles ändert aber nichts daran, dass natürlich auch Afrikas Tierwelt, die berühmten Nationalparks und Wildreservate heute den Mythos Afrika darstellen.
Und wer auch nur ein wenig Begeisterung für Wildnis und Natur aufbringen kann, der hat in Afrika ein Paradies gefunden.
Deshalb dürfen in meinem Reisebuch Begegnungen mit den wilden Tieren Afrikas nicht fehlen, auch wenn ich damit ein Klischee bediene.
Und damit bin ich endlich bei meiner Geschichte.
Wir waren meist allein mit einem Mietwagen und Zelt unterwegs.
Egal wo wir bisher in Afrikas Wildnis waren, ob in Uganda, Tansania, Zimbabwe, Botswana usw., jeder Tag war ein Erlebnis und ein Abenteuer. Es wäre aber zu viel des Guten über alles zu schreiben, was unvergessen bleibt, was begeistert, berührt und erschreckt hat, und manchmal auch fürchten ließ. Deshalb habe ich nur ein paar wenige Geschichten, die von Begegnungen mit Afrikas Tieren handeln, hier niedergeschrieben. Die meisten anderen bleiben mir zwar unvergessen, aber zumindest hier und jetzt nicht erzählt.
Khumaga Camp am Boteti River im Makgadikgadi Nationalpark Botswana, August 2009
Wir kamen aus der weiten, einsamen Zentral Kalahari, einem der größten Tierreservate der Welt, und waren auf dem Weg nach Zimbabwe.
Unsere Reise unterbrachen wir für einige Tage im Makgadikgadi Pans National Park in Botswana und schlugen unser Zelt im Khumaga Camp auf, oberhalb des Boteti Flusses.
Zu jener Zeit war der Boteti Fluss quasi ausgetrocknet, mit ganz wenigen, verschlammten Pools, in denen ein Krokodil und eine kleine Gruppe Flusspferde ausgeharrt hatten. Ein paar Jahre später zeigte die Weigerung dieser bemitleidenswerten Tiere das unwirtliche Gebiet zu verlassen Erfolg, als das Wasser zurückkam und den Fluss wieder füllte.
Im August führte dennoch die jährliche Migration der Zebras und Gnus aus nördlicheren Gebieten zu einer großen Ansammlung dieser Huftiere, die täglich zunahm. Ständig trafen neue Tiere ein.
Mit ihnen kamen auch ihre Jäger: Hyänen und Löwen.
Nach einer letzten nachmittäglichen Pirschfahrt an diesem Tag, mit vielen Giraffen, Zebras, Gnus und Elefanten im staubigen Flussbett, hatten wir es uns im ansonsten leeren Camp gemütlich gemacht. Unsere Hängematte war zwischen einem Gebüsch und dem Auto gespannt, das Dachzelt war aufgeklappt und Holz lag am
„Braaiplatz“ bereit, als die Sonne kitschig und blutrot hinter den Bäumen verschwand.
Die grünen Meerkatzen, die tagsüber unsere Begleiter waren, und die „Flying Bananas“, wie mancher die Tokos auch nennt, sowie etliche andere Vogelarten machten Platz für die Tiere und Geräusche der Nacht.
Die Zeit des afrikanischen Sundowner war angebrochen.
Vor uns brannte schon bald ein Feuer, während sich die Nacht in üblicher, fast übergangsloser, Geschwindigkeit über den Boteti und unser Camp senkte. Es schien, als ob jemand einen Schalter umgelegt und das Licht ausgeschaltet hätte.
Nach dem „Braai“ (dem Grillen) standen und saßen wir am wärmenden Feuer und lauschten in die Wildnis um uns herum.
Geräusche gibt es viele in der afrikanischen Nacht. Sie faszinieren und begeistern, lassen uns aber auch durch Ungewissheit, bedingt durch die Dunkelheit, eine Menge Adrenalin ausschütten
In der Nähe, am Ende des Campingplatzes, bemerkten wir, eher erahnten wir, Bewegungen und Schatten, auf die wir uns immer mehr konzentrierten.
Unscharfe Schemen von Tieren waren zu erkennen, unzureichend beleuchtet von unsere drei kleinen Stirnleuchten, unsere einzigen Lichtquellen für Beobachtungen in nächtlicher Ferne zu jener Zeit.
Zwar nahm die Sternen Zahl mit fortschreitender Nacht ständig zu, aber kurz nach Dunkelheit reichte deren Licht nicht aus, um mehr als nur diese undefinierbaren Schatten auszumachen.
Gebannt starrten wir drei hinüber zu den sich bewegenden Schatten.
„Sind die Tiere groß oder klein?“, fragt mein Sohn etwas beunruhigt.
Ich konnte Elefanten, Giraffen, Gnus und Zebras ausschließen.
Es war aber schlichtweg zu weit entfernt, um genaueres zu sagen. Es waren nur immer wieder Bewegungen, von unscharfen und undefinierbaren Schatten.
Plötzlich, wir waren ganz abgelenkt von den Schemen in weiter Ferne, huschte ein weiteres Tier durch unsere Wahrnehmung. Nicht weit von uns entfernt schien ein Honigdachs im nahen Gebüsch verschwunden zu sein, auf den wir uns nun alle drei konzentrieren.
Etwa vier bis fünf Schritte vom Auto entfernt starrten wir mit unseren Stirnleuchten in der Hand zum Gebüsch hinüber. Wir versuchten das Tier, dass sich dort versteckt hatte, im Licht unserer unzureichenden Lichtquellen zu sehen. Näher an das Gebüsch heran, weiter weg vom Auto, trauten wir uns nicht zu gehen. Dazu hatten wir Zuviel Respekt vor den Gefahren der Nacht im Busch.
Manchmal nimmt man mit dem Gefühl wahr.
Ich wendete mein Gesicht nach links und schaute in die Augen einer Löwin, die zwei Meter von uns entfernt, wohl aufgrund unseres gegenseitigen Erkennens, stehen geblieben war, und mir in die Augen blickte
Eine zweite Löwin betrat aus der Dunkelheit meine Wahrnehmung, gefolgt von zwei halbwüchsigen Jungtieren.
Ich sagte nur leise „Auto“, wohl wissend, dass es nicht mehr in unserer Hand lag, ob wir dieses Ziel erreichen würden. Die Löwen hatten die Situation in der Hand. Sie waren die Akteure und konnten entscheiden was weiterhin geschehen sollte.
Meine Frau und mein Sohn kannten das Codewort „Auto“ und ohne Verzögerung und unnötiger Worte traten sie rückwärtsgehend, den Löwen nicht den Rücken zukehrend, den Rückzug an.
Die erste Löwin schien inzwischen die Situation genügend analysiert zu haben und setzt ihren Weg, wenige Schritte von uns entfernt, in ihren und allen Katzen so eigenen, lässig und majestätisch zugleich anmutenden Bewegungen fort. Auch die zweite Löwin setzte sich wieder in Bewegung und beachtete uns nicht. Anders dagegen die zwei Halbwüchsigen, die uns, den Löwinnen folgend, mit großer Neugier beäugten.
Ich war der letzte der ins Auto einstieg und die Tür zuschlug.
Die Löwen hatten sich nicht sehr weit von uns wegbewegt und kamen nun gemächlich zurück, um unser Camp gründlich zu inspizieren.
Ihre Inspektion bezog sich auf die Stühle, den Tisch und das Auto, die alle beschnüffelt und anscheinend für uninteressant und ungefährlich eingestuft wurden.
Unser Feuer und das Grillgut schienen die Königinnen der Tiere nicht zu interessieren.
Löwen, die wenige Zentimeter von dir entfernt, wenn auch von einer
Glasscheibe getrennt, direkt in deine Augen blicken, bleiben ein unvergessliches Erlebnis, lassen dein Herz stocken und die Luft anhalten. Mehr noch als das, sie lassen die Zeit stillstehen.
Als die Zeit wieder weiterzulaufen begann, gingen die Erwachsenen auf Jagd. Anscheinend hatten wir richtig gesehen, dass sich ein Tier in dem Gebüsch versteckt hatte. Denn genau auf dieses Gebüsch konzentrierte sich das Interesse der Jägerinnen.
Die zwei halbwüchsigen Junglöwenmänner lies das Rudel, dass zudem noch aus den Schatten vom anderen Ende des Camping Areals bestand, zum Spielen bei uns zurück.
Aus der nahen Dunkelheit drangen kurz nach dem Verschwinden der erwachsenen Tiere Jagdgeräusche und Löwenrufe zu uns herüber, während immer wieder unterschiedlich große, sich von uns fortbewegende Schatten durch die Nacht rannten, huschten und sprangen.
Nachdem uns ins Bewusstsein gedrungen war, dass wir hier im Auto in Sicherheit waren und eigentlich nun nichts mehr
Lebensbedrohliches zu befürchten hatten, versuchen wir unbeholfen, ein paar Bilder der, um uns herumtollenden Junglöwen zu machen.
Diese Unternehmung scheiterte aber aufgrund mangelnder Kenntnisse des Fotoapparates und immer noch großer anhaltender Aufgeregtheit kläglich. Ob meine Hände zitterten, kann ich nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen.
Die erwachsenen Löwinnen, weiter von uns entfernt und nur erahnbar, sowie die heranwachsenden Junglöwen, die direkt am Auto, gut sichtbar, herumspazierten, besaßen nun die Oberhoheit über den Campingplatz. Wir hingegen saßen mit pochendem Herzen im Käfig des Autos und unserer Gefühle.
Als die Katzen irgendwann dann in der dunklen Nacht verschwunden waren und Ruhe eingekehrt zu sein schien, trauten wir uns langsam, nach allen Seiten mit Lichtstrahlen in die Dunkelheit absichernd, wieder heraus in die kühle Nachtluft unter den glitzernden Sternen.
Ich habe die Zeit nach Ankunft der Löwen nicht wirklich mehr im
Gedächtnis, gefühlt war es mindestens eine Ewigkeit. Ich sehe immer wieder nur die Löwin vor mir, die mich mustert, während ich keine Chance gehabt hätte. Und ich sehe ihre Augen, die in meine blicken.
Auge in Auge mit Afrikas Königinnen der Tiere
Diese Begegnung mit den Löwinnen, die bei der Jagd in der Nacht zwei Schritte entfernt vor uns standen, während wir ungeschützt und wehrlos ihnen ausgeliefert waren, kann ich im ganzen Leben nicht mehr vergessen.
Und zum Glück können wir drei das im weiteren Leben nicht vergessen, denn sie haben es gut mit uns gemeint.
Xakanaxa Camp im Okavango Delta im Moremi National Park Botswana August 2007
Etliche Kilometer nördlich des Makgadikgadi Nationalparks erreicht man den Moremi Nationalpark im Delta des Okavango.
Wir waren nach einer Übernachtung im Kazikinii Camp, vor den Toren des Parks, die meiste Zeit des Tages in Sand, Matsch und Wasser unterwegs gewesen.
Die marode, einsturzgefährdete First Bridge überquerten wir mit angehaltenem Atem, bevor wir eine längere Rast an der damals einsamen Third Bridge Camp Site einlegten.
Nachdem wir die gleichnamige Knüppelholzbrücke, an der ein angerostetes, geknicktes Metallschild, auf dem Boden liegend, vor Krokodilen warnte, überquert hatten, fuhren wir nordwärts Richtung Dead Tree Island, dass wir allerdings nie erreichten.
Das Wasser des Okavango versperrte uns immer wieder die Zufahrt, welchen schmalen Weg, welche Piste oder Schneise, wir auch nehmen wollten.
Kurze matschige Stellen, Querungen durch flacheres Wasser und vereinzelte dickere Äste, die wir wegtragen mussten, konnten uns nicht aufhalten.
Aber immer wieder endeten die Pfade, die teilweise durch lange Passagen von meterhohem Elefantengras führten, vor langen, tiefen und nicht enden wollenden Wegstrecken voller Morast, sowie tiefen Wasserlöchern, die uns zur Umkehr zwangen.
Irgendwann hatte ich in dem Gewirr der Pisten etwas die Orientierung verloren und eine beginnende Unsicherheit begann sich breit zu machen. Aber ein Zurück zur Third Bridge hätte einen langen Weg in die falsche Richtung bedeutet, der unseren knappen Benzinvorrat, den wir nirgends in den nächsten Tagen in der Wildnis auffüllen konnten, mehr als nötig reduziert hätte. Zudem wurde die Zeit bis zum Sonnenuntergang und damit zur danach schnell beginnenden Dunkelheit langsam aber sicher knapp. Gleichzeitig erschienen auch immer mehr Elefanten auf der Bildfläche, die uns den Weg versperrten oder zu längeren Stopps zwangen, wenn sie direkt an der schmalen „Pad“, wie die Straßen und Wege im südlichen Afrika genannt werden, plötzlich aus dem nach ihnen benannten Gras auftauchten und uns nicht aus den Augen ließen.
Wir standen wieder einmal grübelnd im Elefantengras vor dem Auto. Vor uns erstreckte sich eine lange Passage voller Wasser und Matsch, gesäumt von undurchdringlichem Elefantengras, deren Ende wir bedingt durch eine lange Biegung nicht einsehen konnten.
Welchen Weg sollten wir nehmen? Anhaltspunkte gab die Karte nicht her, zumal wir schon längere Zeit nicht mehr wussten, wo genau wir uns überhaupt befanden.
Aber wenn die Nacht am dunkelsten ist, kommt von irgendwo ein Licht daher.
In diesem Fall in Form eines grünen Land Rovers mit zwei Rangern.
Nachdem wir den ganzen Tag kein anderes Fahrzeug gesehen hatten, begegnete uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort dieses Rangerfahrzeug mit den Nationalpark Mitarbeitern.
Im Gespräch stellte sich heraus, dass wir nicht allzu weit von Xakanaxa entfernt waren, und diese Information zauberte mir und meinen Mitfahrern ein Lächeln ins Gesicht, während gleichzeitig ein dicker schwerer Stein vom Herzen in den Matsch fiel. Dazu kam, das Xakanaka auch ihr Ziel war und wir ihnen dahin folgen konnten.
Was mich weniger erfreut hätte, wenn ich denn gewusst hätte, dass vor uns etliche Wasserdurchfahrten lagen, von deren Existenz ich zum Glück aber erst erfuhr, als wir derselben jeweils ansichtig wurden, und das Rangerfahrzeug, das höher war als unser Hillux, ziemlich zügig, die oftmals breite, tiefe Furt durchquerte.
Die beiden Ranger hatten es eilig, ihr Feierabend war in Sicht.
Ein langsames Schleichen durch den Busch mit der Suche nach tierischen Aktivitäten war nicht vorgesehen.
Gelegentlichen Antilopen oder Giraffen wurden mit keinem Blick gewürdigt, nur die immer wieder auftauchenden Elefanten konnten und durften nicht ganz ignoriert werden.
Aber auch die mächtigen Elefanten ließen das Auto der Ranger kaum langsamer werden.
Ich wollte und konnte nicht zurückbleiben. Ein wortwörtliches
„Augen zu und durch“ ging aber auch nicht, da äußerste Konzentration gefordert war.
Mir standen schon bald Schweißperlen auf der Stirn, mein Hemd war nass und ich wirklich und im wahrsten Sinne schweißgebadet. Mir taten auch die Hände weh, so sehr hatte ich sie um das Lenkrad geballt.
Als wir an einem sehr breiten Wasserlauf ankamen, der sogar das
Rangerfahrzeug tief eintauchen ließ, waren meine Nerven aufs äußerste gespannt. Der Puls erreichte ungeahnte Höhen und ich hörte mein Herz schlagen.
Ich legte den zweiten Gang ein, der 4x4 Modus war schon aktiviert, als ich langsam und nicht zu hektisch in das Wasser hineinfuhr, das bald schon über die Windschutzscheibe schwappte und mir die Sicht nahm. Nur nicht panisch werden sagte ich mir in Gedanken immer wieder. Das Drehmoment nicht abfallen lassen und auf das Geräusch des immer langsamer werdenden Motors hören, waren weitere Gedanken.
Ob ich noch atmete, weiß ich nicht, aber man hätte es grundsätzlich machen können.
Auspuff und Motor waren tief im Wasser und das Motorgeräusch veränderte sich.
Sollten wir gleich stehen bleiben und im Wasserloch feststecken, könnten wir den Motor abschreiben. Tiefe Wasserdurchfahrten, welche grundsätzlich schon keine gute Idee sind, waren es hier in der Wildnis schon gar nicht.
Wasser begann ins Innere des Wagens zu dringen. Jeden Moment musste der Motor ausgehen, jeden Moment wartete ich auf das letzte Stottern des Motors, der immer weniger Leistung brachte. Bewegten wir uns eigentlich noch weiter? Wasser überall und das Herz pochte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit spürte ich endlich, dass wir etwas mehr Bodenhaftung bekamen und der Boden unter den Rädern führte uns in die gewünschte Richtung, nach oben.
Langsam zog sich der Toyota aus dem Wasser empor. Die Windschutzscheibe war sauber wie selten zuvor und allmählich tauchte auch der Auspuff wieder aus den Fluten.
Ich bemerkte jetzt, dass meine Hände vom krampfhaften Halten des Lenkrates ganz rot und die Knöchel ganz weiß waren. Ich nahm wahr, dass ich bewusst wieder atmete und mir der Schweiß aus jeder Pore des Körpers schoss.
Geschafft, wieder einmal geschafft bis zur nächsten Durchfahrt, jubilierte ich innerlich.
Ich glaube solch eine Autofahrt verbraucht mehr meiner Energie als lange Fahrradtouren oder lange Läufe durch den heimischen Wald.
Und auch die nicht anstrengenden Passagen solch einer Fahrt sind doch anstrengend in Erwartung der Hindernisse.
Erst an der Buschlandebahn für die Gäste der luxuriösen Xakanaxa Lodge, die in das Delta eingeflogen werden, begann sich die Spannung der Fahrt zu lösen.
Elefanten, Antilopen, Affen und andere tierische Zeitgenossen konnte ich wieder bewusster wahrnehmen und trugen zur Entspannung bei.
Wir fanden kurz vor Sonnenuntergang unseren Zeltplatz am Ende des Campinggeländes und bereiteten uns für die Nacht vor. Der Platz beinhaltete einen Steintisch mit vier steinernen Hockern um den Tisch herum.
Unser Auto richteten wir mit der Nase zum nahen Wasser des Okavango Deltas aus und entpacken das Dachzelt für die Nacht.
Als alle Arbeiten am Zelt und Auto abgeschlossen waren, widmete ich mich dem Abendessen.
Unser Braaiplatz befand sich zwischen zwei riesigen Bäumen, genau neun Schritte von der Beifahrertür entfernt. Woher ich das so genau weiß, erzähle ich gleich.
Wir hatten Kartoffeln dabei, die ich eingepackt in die Glut legte und dazu lagen leckere afrikanische Bratwürste auf dem Grill.
Da die Sonne bereits untergegangen war, hatten wir uns auch schon unseren üblichen, afrikanischen Sundowner, einen Gin Tonic, sowie ein Cola für meinen Sohn genehmigt.
Die fast volle Gin Flasche, die leere Cola Dose und eine frisch geöffnete Dose Bier standen auf dem Steintisch, an dem meine Frau und mein Sohn saßen.
Inzwischen waren erste Sterne am Himmel zu sehen, die später in der Nacht dieses einzigartige Sternenzelt über den afrikanischen Busch ausbreiten würden.
Der nahende Vollmond war etwas höher gestiegen und erhellte die Nacht im Busch.
Allerdings lenkte mich der Schein des rotglühenden Holzes stark von der Umgebung ab, als ich versuchte, mit einer langen Zange die Kartoffeln, zur Begutachtung ihres Gargrades, aus der Glut zu heben und zu testen.
In diesem Moment wurde es urplötzlich viel dunkler um mich herum.
Der Mond, soeben noch zwischen den Bäumen hängend, war verschwunden. Bei etwas längerer Betrachtung erkannte ich zwei riesige Ohren mit einem Kopf dazwischen, der einen langen Rüssel und ebenso lange Stoßzähne trug. Ich sah auf ein Grau mit Falten, auf kleine Äuglein, die mich ansahen und mein Herz schien auszusetzen.
Trotz allem Schreck bewahrte ich zunächst Contenance. Ich richtete mich aus der Hocke auf und mache langsame, aber bestimmte
Schritte rückwärts und sagte dabei im ruhigen, doch bestimmten Ton die bedeutenden Worte: „Sofort ins Auto!“.
Erst jetzt bemerkte auch der Rest der Familie, was da aus dem Busch bedrohlich auf sie zukam. Wie abgesprochen, nachdem das Codewort Auto im richtigen Tonfall gefallen war, machten sie sich, zügig rückwärtsgehend, auf den Weg zum Auto.
Meine Frau nahm ihren Platz auf der Rückbank ein, mein Sohn auf seinen angestammten Platz auf der Beifahrerseite und ich wollte nun auch da hinein.
Genau neun Schritte hatte ich gemacht, um vor diesem Platz zu stehen auf dem mein Sohn saß.
Nun verlor ich doch etwas die Beherrschung und presste: „Schnell auf die andere Seite“ hervor, während ich den Elefantenbullen, der sich auf mich zubewegte, nicht aus den Augen ließ.
Mein Sohn konnte aufgrund seines jugendlichen Alters diesen Befehl blitzartig ausführen, so dass ich endlich auch ins Auto gelangte, während der große Bulle mit langen, kräftigen Schritten immer näherkam.
Eine kleine Irritation ergab sich kurz darauf im Auto als Daniels Stirnleuchte anging und blinkte und meine Frau und ich unisono: „Licht aus“ zischten, was allerdings nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Daniel fummelte bereits hektisch an der Leuchte herum, aber der Angst im Auto wurde damit mehr Ausdruck verliehen. Dann war das Licht endlich aus und niemand rührte sich mehr, auch atmen schien unausgesprochen verboten.
Der Elefant kam direkt an mein Seitenfenster heran.
Ein Stoßzahn berührte das Fenster, machte ein unheilverheißendes
Geräusch, und ein kleines rotes Äuglein beobachtete uns.
Wir bewegten uns nicht, atmeten wohl auch nicht und waren wie paralysiert.
Dem Bullen schien zu gefallen, was er im Auto sah (ängstliche homo sapiens, die er unter Kontrolle hatte) und vor allem das, was da auf dem Tisch stand, und dem er sich nun zu wandte. Die leere Dose Cola von Daniel nahm er mit dem Rüssel und steckte sie in sein Maul, schüttelte sie und stellte sie wieder auf den Tisch.
Meine Dose Bier, von der ich noch keinen Schluck getrunken hatte, die ich allerdings dummerweise bereits geöffnet hatte, wurde als nächstes mit dem Rüssel umschlungen und ins Maul geführt. Wir hörten das Krachen als die Dose zu einem flachen Stück Blech verarbeitet wurde und konnten uns vorstellen, wie deren Inhalt zum Wohle des alten Bullen in seinen Magen lief.
Die flache Blechdose wurde ordentlich auf den Tisch zurückgelegt und befindet sich heute bei uns zuhause als Trophäe in unserem Afrika Zimmer.
Als letztes griff er alsdann zur Gin Flasche und da blieb mir fast das Herz stehen.
Ich malte mir aus, dass er sie ebenso zerquetscht wie die Bierdose zuvor, und dann, vor Scherzen über die Schnitte des zerbrochenen Glases, unser Auto angreift.
Elegant umfing der Rüssel die Flasche und schüttelte sie mehrmals in seinem Maul. Der Gin, allen Heiligen sei Dank, war glücklicherweise, nach unserem Gebrauch vorher, wieder ordentlich verschlossen worden.
An der Prozedur der versuchten Flaschenentleerung des Elefanten erkannte man im Nachhinein den erfahrenen Trinker, der wie ein solcher versuchte, den letzten Tropfen der hochprozentigen Flüssigkeit in den Hals zu bekommen.
Nach mehreren Versuchen, ich traute meinen Augen nicht, stellte er die Glasflasche wieder vorsichtig auf den Tisch zurück und kam noch einmal zur Wagenscheibe, um einen Blick auf drei verängstigte Touristen zu werfen. Dabei kratzte noch einmal Elfenbein gegen Glas.
Ich sehe noch einmal seinen forschenden Blick, wenige Zentimeter von mir entfernt, der wohl eher, so denke ich heute im nach hinein, möglicherweise weiteren potentiellen Spirituosen im Auto gegolten hatte, als uns bereits eingeschüchterte Menschen weiter zu erschrecken.
Langsam wendete er sich danach ab und so lautlos wie er gekommen war, so bestimmt und ruhig er in der Szene aufgetreten war, genauso trat er auch wieder ab, als er zwischen Bäumen und Okavango in der Magie der afrikanischen Nacht verschwand.
Wir konnten uns erst aus unserer Schockstarre lösen als eine aufgelöste italienische Dame auf der Bildfläche erschien und mit einem „Porca Miseria“ den Verlust mehrerer Getränke vom Tisch ihres in einiger Entfernung liegenden Zeltplatzes beklagte.
Die Schockstarre in der wir uns gefühlt die letzten Stunden befunden hatten, löste sich dadurch mit einem breiten Grinsen auf, und machte diesem Gefühl Platz, das Abenteurer befällt, nachdem sie höchste
Not und Todesgefahr überstanden hatten.
Eine Leichtigkeit des Seins breitete sich aus, und ein ungläubiges „Ist das eben wirklich passiert “- Gefühl flutete den Körper. Der Mond leuchtete plötzlich intensiver, die Sterne bildeten eine phantastische Milchstraße über uns, Glasfrösche im Okavango Schilf ließen akustisch Eis in Gläser fallen und etwas entfernt lachte eine Hyäne. Wir saßen inmitten dieser grandiosen wilden Freiheit mit einem langanhaltendem Lächeln.
Das war das jetzt unser Afrika.
Träume unter Palmen in Daressalam
Tansania, November 2015
Wer viel in Afrika unterwegs ist, kommt an Tansania eigentlich gar nicht vorbei. Das Land war für mich in meiner Jugend, aufgrund der Fernsehabende mit Prof. Grzimek, zusammen mit Kenia, das Synonym für Afrika.
Die Luft war schwül als sich die automatische Tür öffnete und ich mit meiner Frau aus der wohltemperierten Ankunftshalle des Internationalen Flughafens von Daressalam hinaus in die afrikanische Nacht ging. Vor uns standen wie eine unüberwindliche Wand „Abholer“, die mit großen Namensschildern, die sie mir entgegenhielten, unser Interesse wecken wollen. Wie gerne hätte ich mich jetzt einem der Abholer als sein zugehöriger Auftrag zu erkennen gegeben.
Ich konnte unseren Namen allerdings nicht entdecken. Nirgendwo auf den Pappschildern, die vor mein Gesicht gehalten wurden, war auch nur entfernt etwas zu lesen, was unseren Namen auch nur ähnlichsah.
Es war zwei Uhr nachts, wir waren müde, und langsam stieg eine gewisse Panik in mir auf.
Ich kannte nicht einmal den Namen unserer Unterkunft, in der wir den Rest der heutigen Nacht, und die darauffolgende, nächtigen wollten. Zu sehr hatte ich mich auf unseren Abholer verlassen und zudem den Zettel mit dem Namen der Unterkunft zuhause vergessen. Nur eine afrikanische Telefonnummer hatte ich mir in meinem Notizbuch notiert.
Natürlich waren in Afrika, dem Kontinent, auf dem die Uhren anders gehen, da wir Europäer zwar die Uhren haben, die Afrikaner aber die Zeit, wie ein Sprichwort sagt.
Aber warum musste gerade bei unserem Abholer die Uhr so extrem afrikanisch gehen?
Nach einer geraumen Zeit hatte sich der Flughafen fast geleert. Nur noch zwei oder drei Abholer blickten verschlafen und leicht frustriert immer noch auf die Tür, als könnten sie ihren Fahrgast herbei starren. Meine Zuversicht auf die Ankunft unseres Abholers war dagegen inzwischen unter den Nullpunkt gesunken.
Ob es mein verzweifelter Blick war, oder einfach nur meine ungeplante Präsenz, ist nicht von Bedeutung. Die unerwartete Hilfe sprach mich in Form eines schmächtigen schwarzen Mannes an.
Ob er mir helfen könnte, fragte er mich.
Ja er konnte, und ob er konnte.
Ich hatte noch keine tansanische Sim-Karte in meinem Mobiltelefon. Woher denn auch mitten in der Nacht auf einem nahezu verwaisten Flughafen?
Voller Hoffnung kramte ich die zuhause, glücklicherweise, notierte Telefonnummer der tansanischen Kontaktperson heraus, die von unserem Fahrer und Guide Mr. Armani.
Mein erster neuer Freund auf dieser Reise wählte und es klingelte. Es klingelte und klingelte und klingelte. Mein Kumpel (so schnell kann man einen hilfreichen Fremden in sein Herz schließen) wollte gerade achselzuckend aufgeben, als wir eine Stimme in seinem Telefon hörten.
Ein kurzer Moment des Glücks durchdrang mich in dieser dunklen afrikanischen Nacht.
Mein guter Freund reichte mir sein Telefon und ich wurde, fast schon etwas beleidigt ob der späten Störung, verschlafen begrüßt.
Im Gespräch erfuhr ich, dass Mr Armani es nicht für dringend notwendig und sinnvoll befunden hatte, extra wegen der einzigen zwei Teilnehmer seiner bald beginnenden Safari Tour durch den Süden Tansanias zu so später Stunde noch den weiten Weg zum außerhalb der Stadt liegendem Flughafen anzutreten. Er wäre lieber zeitig zu Bett gegangen, um uns am übernächsten Tag, frisch und ausgeschlafen durch den Verkehr Tansanias zu bringen, erklärte er mir im Ton der Überzeugung, alles richtig gemacht zu haben. Wir sollten doch einfach ein Taxi nehmen und uns zum Mikadi Beach Camp bringen lassen.
Ach ja, so hieß unsere Unterkunft, ich erinnerte mich wieder.
Ich war nicht empört, nein, auch nicht wütend. Ich war nur glücklich, zumindest zu wissen, wie es weitergehen sollte.
Im Überschwang seiner Fürsorge gab mir Mr. Armani noch den Tipp nicht mehr als 45 US$ für das Taxi zu bezahlen, die er es mir bei unserem Treffen am späten Vormittag wieder geben würde.
Mein kleiner, schmächtiger Flughafenkumpel wollte kein Geld für das Telefonat und, als letzte Hilfe, die er uns angedeihen ließ, gab er uns noch in die Hände eines herbeigerufenen Taxi Fahrers seines Vertrauens. Ich glaube, er konnte anhand meines Blickes und des langen festen Händedrucks erahnen, wie dankbar ich ihm war, als sich unsere Wege dann für immer trennten.
Durch wenig beleuchtete Straßen, die von der ursprünglichen
Autobahn ähnlichen Schnellstraße mit zügigem Vorankommen, zu schmaler und dunkler werdenden, Schlagloch übersäten Feldwegen mutierten, fuhren wir müde unserem Ziel entgegen.
Von der Fahrt bleiben nur dumpfe Erinnerungen und vorbeifliegende Ahnungen, die mangelnder Erinnerung ungesagt bleiben.
An unserer Unterkunft angekommen passierte beim ersten Hupen nichts am verschlossenen Tor. Ein zweites längeres Hupen brachte das gleiche Ergebnis. Uns beiden Fahrgästen fielen derweil fast schon die Augen zu. Erst nach längerem Warten öffnete sich dann doch langsam und quietschend das große metallene Tor und ein verschlafener Sicherheitsfachmann fragte nach unserem Begehr.
Die nächste Hürde war gemeistert und jetzt konnte eigentlich nichts mehr schief gehen.
Wir freuten uns auf ein Bett, einfach nur auf einen Platz zum Schlafen. Es war unser einziger Wunsch, ansonsten waren wir wunschlos zufrieden.
Der Sicherheitsfachmann brachte uns zum Restaurant, das gleichzeitig als Rezeption und Bar fungierte, alles, unisono, das gleiche luftige Palmblatt bedeckte Holzgebäude. Er übergab uns an eine herbeigerufene, überfordere und verschlafene junge Frau, die angab, nicht über die Kompetenz zu verfügen, uns den gewünschten Schlafplatz zuweisen zu dürfen und zu können.
Um nicht ganz ohne Hilfe einfach wieder zu verschwinden, gab sie uns, nach langem Nachdenken den Rat, doch einfach auf die Chefin zu warten, die am Morgen hier erscheinen würde
Dann waren wir allein.
Denn auch der Sicherheitsfachmann trabte dem Eingangstor und seinem unterbrochenen Schlaf entgegen und entschwand in dem Dunkel der Nacht.
Einzig ein patrouillierender Massai in stolzer Tracht mit dicker Armbanduhr am muskulösen Arm sah gelegentlich bei seinen Rundgängen zu uns herüber. So saßen wir nun mit unserem Gepäck, übermüdet, im leeren Restaurant und warteten auf den Morgen. Wer nun meint, dass wir sauer waren, wütend, deprimiert, oder gar enttäuscht, der irrt.
Wir hatten es geschafft hier anzukommen. Wir warnen sicher hinter den Mauern unserer Unterkunft im neuen fremden Land, wurden geschützt von einem tapferen Massai, und blickten auf einen indischen Ozean, der noch im Dunkeln, hinter Palmen verborgen, hörbar und gegenwärtig, seine Wellen an den nahen Strand schlug. TIA. This is Africa. Wenn einem nichts mehr einfällt, sagt oder denkt man TIA und hat Recht.
Diese englisch ausgesprochenen drei Buchstaben drücken oft mehr aus, als man in langen Essays und Abhandlungen erklären kann. Sie sind ein Gefühl und eine Tatsache zugleich.
Dann irgendwann kam der Tag aus der Nacht gestiegen und mit ihm andere Menschen von irgendwo her. Die Müdigkeit blieb und wurde sogar noch größer.
Das Restaurant wurde geöffnet. Der Duft nach Eiern und Kaffee zog durch die tropische Luft und wir konnten mit den am Flughafen erworbenen Schilling Hunger und Durst stillen.
Schritt für Schritt, oder pole pole (langsam langsam, wie es auf Suaheli heißt), ging es voran.
Eine Toilette hatten wir noch in der Nacht gefunden und damit ein weiteres Problem grandios gemeistert. Der oder die Verantwortliche für die Zimmer, besser gesagt der kleinen Hütten, war aber leider noch immer nicht erschienen.
Aber man kann nicht alles und auch noch sofort haben.
Die Zeit verging und die Sonne war schon höher am Himmel emporgestiegen als dann die verantwortliche Mitarbeiterin erschien und nun auch dieses Problem löste, obwohl, wie sie sagte, keine Reservierung vorlag.
Ob Mr. Armani eine Reservierung vielleicht auch nicht für unbedingt nötig erachtet hatte? Es war uns in diesem Moment egal.
Unser einfacher, sauberer Holz Bungalow stand zwischen hohen Kokospalmen, im ruhigen hinteren Teil des großen Gartens, und hatte ein großes Bett und eine schöne Veranda mit Blick zum Meer.
Nun endlich schlafen war das erklärte Ziel, nachdem wir das wenige Gepäck in unser Domizil auf Zeit gebracht hatten.
Aber dem stand der angekündigte Besuch Mr. Armanis gegenüber, der für den Vormittag angekündigt war, um mit uns, warum auch immer, den Ablauf der eigentlich feststehenden Tour zu besprechen.
Eine Zeitlang saßen wir unschlüssig auf der Terrasse herum, eine gewisse Zeit brauchte ich um zwei Getränke aus der Bar zu holen, relativ lange brauchten zwei immer schläfriger werdende Menschen, um die Getränke zu konsumieren, und fast schon mit geschlossenen Augen brauchten wir nur noch kurze Zeit, um zu entscheiden, auf das große Bett im Zimmer hinter uns zu sinken. Dann kam Mr Armani.
Mr. Armani kam mit einem Land Rover Defender, der alt genug aussah, um bereits Dr. Livingstone bei seiner Reise durch den Süden Tansanias chauffiert zu haben. Er fuhr neben unsere Veranda und begrüßte uns entspannt und ausgeruht, mit einem Lächeln.
Ich weiß gar nicht mehr, was wir an diesem Morgen zu besprechen hatten, schließlich stand der Ablauf der Tour schon fest, und was unterwegs Unvorhergesehenes passieren würde, lag außerhalb der Macht unserer Planung. Und sollten wir doch etwas Wichtiges besprochen haben, so ist es mir aufgrund meines damaligen Dämmerzustandes entfallen.
So dauerte der Besuch Mr Armanis auch nicht allzu lange und wir verblieben, dass er am folgenden Tag am frühen Morgen mit vollem Camping Equipment und allem weiteren benötigen Utensilien erscheinen würde.
Von dem Geld für das Taxi war, nebenbei bemerkt, keine Rede mehr und Mr. Armani verabschiedete sich.
Keine fünf Minuten später lagen wir, bei schönstem Sonnenschein und einer angenehmen kräftigen Brise, schlafend im Bett.
Was dann genau geschah weiß ich nicht mehr!
Wie im Traum, wie in der Phase zwischen Schlaf und wachwerden habe ich dumpfe Erinnerungen an einen großen Schlag, an ein unschönes Knirschen, seltsame Geräusche und an Rufe, die von fern in mein Bewusstsein drangen.
Die Decke des Zimmers war zum Greifen nahe, wenige Zentimeter über mir befand sich ein schwerer Querbalken, der doch eigentlich weit nach oben an die Decke gehörte. Und dazu auch noch das ganze Gebälk, ja das Gebälk war auch neben mir
Und was machten die Palmblätter hier, was der dicke mächtige Stamm der hohen Palme?
Svenja hatte neben mir die Augen geöffnet, mit Unverständnis und Müdigkeit darin.
Da waren Menschen, die sprachen, ohne dass ich sie verstand oder gar hörte. Ich war müde, immer noch so müde und kroch aus dem heraus, was anscheinend nicht mehr existierte, während Svenja mir folgte.
Ich verstand nichts mehr, schaute in aufgeregte Gesichter, deren Münder sich bewegten.
Es war, als hätte der Knall einer Bombe mein Gehör in Mitleidenschaft gezogen und mich paralysiert.
Langsam, wirklich ganz langsam, begriff ich, dass anscheinend eine der schönen großen Palmen auf unseren Bungalow gestürzt war und Decke, Bad und eine Seitenwand komplett zerstört hatte.
Aber warum waren alle um uns herum so aufgeregt und hektisch?
Warum meinte einer der schwarzen Männer um uns herum, wir hätten heute einen neuen Geburtstag?
Warum sagte ein anderer, dass Gott uns lieben würde?
Ich habe keine Erinnerung an alles, was weiter geschah. Ich wollte schlafen.