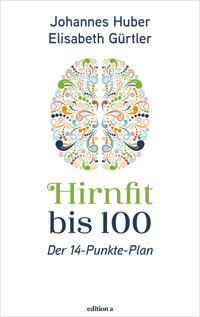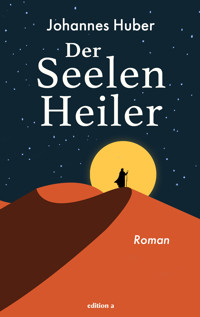
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jeshua, ein jüdischer Handwerker, trifft eine Frau, die an einer mysteriösen Krankheit leidet. Er will das Heilen lernen, um sie zu retten. Dazu reist er von Galiläa nach Alexandria und arbeitet dort in der Bibliothek, dem größten Wissensspeicher seiner Welt. Bald begreift er, er muss nicht die Körper der Menschen heilen, sondern ihre Seelen. Doch wie soll ihm das gelingen? In der Stille der Wüste findet er eine tiefe Wahrheit und seine Bestimmung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DER SEELENHEILER
Johannes Huber:
Der Seelenheiler
Alle Rechte vorbehalten
© 2024 edition a, Wien
www.edition-a.at
Cover: Bastian Welzer
Satz: Bastian Welzer
Gesetzt in der Benne
Gedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 27 26 25 24
isbn: 978-3-99001-755-5
e-isbn: 978-3-99001-756-2
Inhalt
VORWORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Das Wunder Mensch Nachbemerkung des Autors
Moses, die Ägypter und der Eine
Der große Philosoph Platon
Die offene Gesellschaft der Antike
Die Tradition der Propheten: Elias und Johannes
Schnittstelle Alexandria: Israels Rückkehr nach Ägypten
Die Redlichkeit des Glaubens
Das Wunder Mensch
VORWORT
Es freut mich als Kulturwissenschaftler der antiken Kultur, dass Prof. Johannes Huber mit dem vorliegenden Roman einen Bericht des antiken Philosophen Kelsos aus Alexandria aufgreift und ernst nimmt. Dieser besagt, der Wanderprediger Jesus aus Nazareth sei zu Beginn seiner Lehrtätigkeit in der Großstadt Alexandria gewesen. Das erzählten die Christen dieser Stadt im 2. Jahrhundert nach Christus.
Der Bericht lautet weiter, Jesus habe dort bei der Heilungsbewegung der »Therapeutae« (magoi) die Kunst des Heilens und des ekstatischen Gebets gelernt. Danach habe er in Galiläa seine Heilungsbewegung begonnen. Beim ekstatischen Gebet wird die himmlische Welt visualisiert, die Betenden können Gott auf dem Thronwagen und seine Engel sehen und hören. Diese virtuelle Welt verleiht den Betenden ungeheure Kraft für das Leben und das Heilen von Krankheiten.
Zum Zweiten ist dem Autor dieses Buches zu danken, dass er Jesus als normalen jüdischen Mann sieht. Bevor er seine Heilungstätigkeit aufnahm, lebte er in seiner Sippe und verdiente einen Teil des Unterhalts. Mit 33 Jahren dürfte Jesus seine Heilungsbewegung begonnen haben. Drei Jahre später starb er als Aufrührer gegen den jüdischen Tempel am Kreuz. So sehen auch die meisten jüdischen Theologen die Lebensgeschichte Jesu.
Von den Jahren vor dem Beginn seiner Heilertätigkeit erzählt dieser Roman. Damit eröffnet er eine neue Sichtweise auf die Person und Gestalt des Jesus von Nazareth und die frühe Jesusbewegung. Schon aus diesem Grund ist ihm viel Aufmerksamkeit und Erfolg zu wünschen.
Prof. Dr. Anton Grabner-Haider, Universität Graz, Religionsphilosoph
Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat.
Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen.
- Johannes, 21, 25
Alles begann mit einem merkwürdigen Traum. Das Merkwürdige daran war, dass er sich in einem Traum wusste. Er sah sich am Anfang einer Wüste stehen, der stets auch ihr Ende war, denn im scheinbar Grenzenlosen sind Anfang und Ende eins. Der Sand, der vor Äonen Stein gewesen war, bis die Zeit ihn in diese beinahe unsichtbar kleinen Körnchen gemahlen hatte, wie sie es mit allem Lebendigen tat, berührte ihn nicht. Die Sterne funkelten am Himmelszelt, formten Bilder, die er nicht entschlüsseln konnte, obwohl er wusste, dass sie seine Zukunft prophezeiten.
Über die Sandwüste jagte ein Streitwagen mit einem kräftigen, bärtigen Mann. Um sein Haupt rankten sich Weinreben, in der Hand hielt er einen Kelch mit Rotwein, aus dem er begierig trank. Ein wilder Chor aus herumtollenden Knaben verfolgte ihn. Das Getöse wurde leiser, als sie in der Dunkelheit verschwanden.
Dieselbe Nacht, die den feiernden Tross verschluckt hatte, offenbarte kurz darauf eine zierliche Gestalt. Ein weißes Kleid umfasste ihren Körper, das Mondlicht fing sie ein und perlte von ihr ab wie silberne Wassertropfen. Der kühle Nachtwind zerrte an ihren Konturen und lockte einige Haarsträhnen unter dem Umhang hervor. Sie hatten die Farbe von frisch gebranntem Lehm. Sie kam über eine Sanddüne, die viel zu weit entfernt war und die Nacht zu dunkel, und doch sah er ihre Augen, undurchdringlich blau wie Lapislazuli. Sie bewegte die Lippen und sprach einen unhörbaren Satz, den er doch verstand, als käme er aus ihm selbst.
»Ich sehe dich.«
Ein Rütteln zerriss die Welt, die Düne öffnete sich. Wie eine wütende Schlange bewegte sich der Strom des Sandes auf die gähnende Leere zu, die sich im Boden aufgetan hatte. Das Rütteln erfasste seinen Körper, wanderte in seine rechte Schulter. Dann fühlte er die Hand darauf.
»Aufstehen, Junge«, sagte der Mann, der sich um ihn kümmerte wie um einen Sohn. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und er hoffte, in den dunklen Ecken des Zimmers Überreste seines Traumes zu entdecken, doch vergeblich. Manche der Alten sagten, dass Träume die Stunden der Nacht nutzten, um den Menschen etwas zu zeigen, das ihnen unter dem Licht des Tages verborgen blieb. Doch er konnte seine Träume nicht deuten. Was wollten sie ihm sagen?
»Wir haben einen weiten Weg vor uns«, sagte Josef, als er das Zimmer verließ, um den Esel mit ihrem Werkzeug zu beladen. Mutter schlief noch.
Jeschua stand auf, wusch sich das Gesicht in einem Holzbottich und warf sich das Baumwollhemd über. Müde ging er nach draußen, wo eine angenehme Kühle herrschte. Es würde nicht lange so bleiben. Die unbarmherzige Sonne verbarg sich hinter dem Horizont. Sie mussten die zweistündige Wanderung nach Sepphoris auf sich nehmen, ehe die Hitze des Tages sie einholen konnte. Seit einigen Wochen bauten sie bereits an dem Dienstbotentrakt eines wohlhabenden Griechen. Es war sichere, gut bezahlte Arbeit. Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen, hatte die Stadt neu aufbauen lassen, nachdem die Römer sie zerstört hatten. Sie war mittlerweile ein reiches Handelszentrum, das Ornament von ganz Galiläa.
»Komm, Junge«, rief Josef, der bereits neben dem Esel ging und einige Meter Vorsprung hatte. »Die Sonne richtet sich nicht nach uns. Sie geht auf, ob wir wollen oder nicht. Darin liegt ihre Schönheit.«
Jeschua dachte an den Traum, aus dem er eben erst aufgewacht war. Was hatte der bärtige Mann zu bedeuten? Und die Frau im weißen Kleid? Manchmal fühlte er, dass die Welt ihm Zeichen sandte, ihm etwas mitteilen wollte, doch sie benutzte ein Alphabet, das er nicht lesen konnte. Lerne mir Deine Sprache, dachte Jeschua. Lerne mir, in den Dingen zu lesen.
Erst, als der Esel ein lautes Wiehern von sich gab, setzte er sich in Bewegung und folgte Josef.
Sepphoris war bereits von Weitem zu sehen. Auf einem Hügel thronte es wie die Krone auf dem Haupt eines Königs. Die Straßen der Stadt waren mit gebrochenem Marmor ausgelegt, die Häuser der reichen Bürger bestanden aus Lehm, Stein und Holz und waren innen mit Mosaiken ausgeschmückt. Es gab ein Hippodrom für Pferderennen und einen Tempel für die Götter der Heiden, der so anders war als jene Tempel und Gebetshäuser, die Jeschua kannte, obgleich er als gläubiger Jude in den fast dreißig Jahren seines Lebens noch nie darin gewesen war. In der Mitte der Stadt lag ein von Säulen umgebener Marktplatz, die Agora. In einen Hang war ein Theater hineingebaut, in dem die Römer ihre Schauspiele aufführten und sich amüsierten. Josef schüttelte darüber den Kopf. »Wer das Leben imitiert, der lästert Gott«, sagte er. »Nur ihm ist es gegeben, zu erschaffen.«
Das Haus ihres Auftraggebers lag südlich des Theaters. Die Diener des Griechen kamen fast alle aus seinem Heimatland und der Hausherr behandelte sie gut. Kratylos, wie der Hausherr hieß, war ein Mann, wie er Jeschua noch nie begegnet war. Wenn Josef und er eine Pause machten und sich sein Vater mit einem Schlauch Wasser in den Schatten einer Dattelpalme zurückzog, lud Kratylos den jungen Jeschua ein, mit ihm zu »diskutieren«. Eine Diskussion, erklärte er Jeschua, war eine griechische Kunst, in der beide Seiten aus verschiedenen Perspektiven über ein Phänomen sprachen und sich gegenseitig von ihrem Standpunkt zu überzeugen versuchten. Allerdings glichen Kratylos’ Diskussionen den Vorträgen, die Jeschua von den jüdischen Gelehrten kannte. Er selbst kam kaum zu Wort. Doch das störte ihn nicht, hatte der Grieche doch interessante und bisweilen lustige Dinge zu erzählen.
So berichtete er Jeschua von einem griechischen Philosophen. Philosophen, erklärte er ihm, seien große Weise gewesen, die Einsichten über das Leben besaßen, die sie über die gewöhnlichen Menschen erhoben. Sie würden in seiner Heimat sehr verehrt. Deshalb wunderte sich Jeschua, dass Kratylos’ Lieblingsphilosoph ein Mann namens Diogenes gewesen war, der mit nichts als einem Leinentuch bekleidet heimatlos umherirrte und von Almosen lebte. »Ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde«, soll dieser Diogenes gesagt haben. Und als er einmal auf den großen Feldherren Alexander traf, über den Jeschua zahlreiche Legenden gehört hatte, wollte ihm der große Kaiser einen Wunsch erfüllen. »Geh mir aus der Sonne«, war alles, was Diogenes darauf erwiderte.
Kratylos amüsierte sich prächtig über diese Geschichten. Seinem großen Vorbild zu Ehren hatte Kratylos die marmorne Statue eines Hundes am Eingang seines Hauses aufgestellt, denn Diogenes wurde auch Kyniker, Hund, genannt. Soweit Jeschua verstand, weil er lebte wie ein Hund.
Die Lehren seines Vorbilds predigte Kratylos auch seinen Dienern. Täglich sah Jeschua sie im Schatten der Palmen sitzen und ihrem Herrn lauschen, während er und sein Vater Lehm anrichteten und Holz bearbeiteten. Von der Gleichheit aller Menschen war da die Rede, von dem Wunder der Besitzlosigkeit und vom Glück durch innere Freiheit. »Egal, welche Umstände euch heimsuchen«, verkündete Kratylos, »nur euer Innerstes entscheidet, ob ihr frei seid oder nicht.«
Jeschua wusste nicht, was die Diener von den Reden ihres Herrn hielten. Er selbst kleidete sich zwar einfach und trug einen dichten, wilden, schwarzen Bart, der ihm ein grobschlächtiges Aussehen verlieh, doch Jeschua wusste, dass Kratylos mit dem Handel von Gewürzen und Stoffen ein Vermögen gemacht hatte. Es wirkte nicht, als ob er die Besitzlosigkeit lebte, die er anderen predigte. Seine Diener mochten das Glück in ihrem Inneren finden, Kratylos suchte es jedenfalls noch immer in den Goldmünzen, die jede Woche in sein Haus strömten. Aber Jeschua wäre es nicht eingefallen, bei einer ihrer Diskussionen dieses Missverhältnis zur Sprache zu bringen. Immerhin versorgte Kratylos Josef und ihn mit Arbeit.
Jeschua mochte diese Arbeit. Sie bekamen Datteln und Brot, Wasser und manchmal auch Wein. Kratylos trieb sie nicht an und zeigte sich mit ihren Fortschritten zufrieden. Außerdem war da noch Kratylos’ Gemahlin.
Zum ersten Mal hatte Jeschua sie nach seiner ersten Woche bemerkt. Die Sonne neigte bereits ihr stolzes Haupt und machte dem Abend Platz, als er eine Bewegung an einem der Fenster des Hauses wahrnahm. Als er den Blick hob, war das Fenster leer.
Am nächsten Tag wandte er den Blick zur gleichen Zeit empor. Diesmal war sie im Fensterrahmen geblieben. Er erkannte ihre zierliche Gestalt, doch von ihrem Gesicht sah er kaum etwas. Sie war völlig in einen purpurfarbenen Mantel gehüllt. Nur ihre schwarzen Augen blitzten hervor, fingen die letzten Sonnenstrahlen auf, bevor sie entkommen konnten, und entfachten ein bisher ungekanntes Feuer in Jeschuas Seele.
Am folgenden Tag trat sie aus dem Haus, kurz bevor Josef und er die Arbeit beendeten, warf ihm einen flüchtigen Blick zu und stellte einen Krug mit Wein vor die Tür, ehe sie wieder im Inneren verschwand. Josef widerstrebte es, den Wein zu trinken, auch wenn es laut Tora nicht verboten war. Doch bei den Griechen galten noch losere Regeln und er wollte keinen undankbaren Eindruck bei den Bauherren hinterlassen. Als ihn Kratylos aufforderte, ließ er sich also mit ihm vor dem Haus nieder und winkte Jeschua zu sich. Kratylos bestand darauf, dass auch der junge Mann einen Schluck nahm. »Bei uns beginnen die Männer schon zu trinken, wenn sie halb so alt sind wie du«, sagte er und reichte den Krug lachend an Jeschua.
Das herbe, bittere Getränk rann ihm die Kehle hinab. Es war weniger klar, weniger einfach als das Wasser, das er sonst trank. So viele Eindrücke lagen in einem so kleinen Schluck, dachte Jeschua.
»War das Eure Frau, die uns den Wein brachte?«, fragte Josef.
»Ja«, sagte Kratylos. Seine fröhliche Miene verfinsterte sich. »Sie ist eine gute Frau, eine schöne Frau. Ich lernte sie in Athen kennen. Sie war jünger als ich und ich dachte, sie könne mir gute Nachkommen schenken.« Er nahm einen Schluck. »Doch kurz nach unserer Hochzeit befiel sie eine seltsame Krankheit. Deshalb trägt sie zu jeder Stunde diesen Schleier und wagt sich erst für längere Zeit aus dem Haus, wenn die Nacht ihren schützenden Mantel über sie breitet. Die besten Ärzte Griechenlands konnten sie nicht heilen. Meine letzte Hoffnung besteht in den Medizinern Alexandrias. Sie sind die besten Heiler, die es gibt. Nun warten wir darauf, dass sie stark genug wird, um die weite Reise antreten zu können ...« Ohne seinen Satz zu beenden, stand er auf. Auf Jeschua machte es den Eindruck, als hätte Kratylos mehr gesagt, als ihm lieb war. Doch es war offensichtlich, dass er niemanden hier hatte, mit dem er sich über seine Sorgen unterhalten konnte. Gern hätte Jeschua den Mann nach diesem Alexandria gefragt, doch er wagte es nicht, aus Angst, ihn an das Schicksal seiner Frau zu erinnern, das auch sein Schicksal war.
Seit diesem Tag waren Wochen ins Land gezogen. Der Trakt der Bediensteten war beinahe fertig. Jeschua hatte ein wenig Griechisch gelernt, denn Kratylos meinte, ein Mann von Welt müsse die Sprache der Philosophen beherrschen. Und jeden Abend, kurz bevor sie den Weg nach Hause antraten, kam Kratylos’ Ehefrau vor die Tür und wartete, bis Jeschua ihren Blick erwiderte. Er wusste nicht, was darin lag, und wünschte, er wüsste es. Nur für einen Augenblick wollte er unter ihrem Schleier stecken, ihren Schmerz fühlen, ihre Einsamkeit und ihre Pein. Er wollte begreifen, wie es für sie war, sie zu sein. Dann wüsste er, wie er ihr würde helfen können. Denn das wollte er: helfen. Er konnte nicht sagen, warum er das wollte. Doch dieser Wunsch war stärker als alles andere. Er wollte den Schleier zerreißen, der die Welt und all ihre Wunder von diesen tiefen schwarzen Augen trennte.
Als Josef an diesem Tag ihre Ankunft meldete, führte sie ein Diener nicht wie sonst zum Trakt der Bediensteten, sondern ins Innere des Herrenhauses. Weder Josef noch Jeschua waren jemals darin gewesen.
Anders als der grobe Lehmboden des Diensttrakts bestand jener des Herrenhauses aus feinen Mosaiksteinchen, doch was sie zeigten, begriff Jeschua nicht. So etwas hatte er noch nie gesehen. Ein athletischer Mann, der mit einem Löwen rang. Ein anderer, der mit seinem Bogen auf eine Schar verängstigter Männer zielte. Eine Frau, die vor etwas saß, das wie ein Musikinstrument aussah.
dar »Halte dich nicht mit diesen Bildnissen auf«, sagte Josef auf Aramäisch. Es war die Sprache ihres Volkes und für die meisten Römer und Griechen, die nach der römischen Eroberung hierhergezogen waren, unverständlich. »Sie sind nichts als Illusionen, geschaffen zur Zerstreuung.«
Jeschua wandte den Blick ab, doch etwas daran faszinierte ihn. Der Bedienstete musste sein Interesse bemerkt haben, denn er wandte sich Jeschua zu. »Das sind Abbildungen griechischer Mythen«, erklärte er. »Geschichten, die sich die Griechen seit vielen Jahrhunderten erzählen. Mein Herr hat seine Liebsten als Mosaike darstellen lassen, um sie stets um sich zu haben.«
»Sind sie wirklich geschehen?«, fragte Jeschua.
Der Diener, ein kahlgeschorener Mann mit olivenfarbener, glatter Haut, dessen Alter unmöglich zu schätzen war, lächelte. »Wenn etwas lang genug zurückliegt, ist es egal, ob es wirklich geschehen ist oder nicht. Wird es oft genug erzählt, bekommt es eine Wahrheit, die über die Wirklichkeit hinausgeht.«
Der Diener sprach gebildeter, als Jeschua erwartet hatte. Ob dies mit Kratylos’ Vorträgen zu tun hatte? Er wusste, dass die griechischen Herren ihren Dienern manchmal eine gewisse Bildung zubilligten. Ein ungebildeter Diener konnte seinen Herrn in ein schlechtes Licht rücken.
Der Hausherr hatte Josef und ihn mit der Ausbesserung der Wände beauftragt. Der Lehm bröckelte ab und es hatten sich Risse gebildet. Außerdem mussten sie Stellen am Dach flicken. Da Josef mit fortschreitendem Alter immer unbeweglicher geworden war, übernahm Jeschua die Arbeiten an der Decke. Er stieg mit seinen Werkzeugen die Leiter nach oben und untersuchte die Decke nach Brüchen. Als er einen Blick nach unten warf, erschrak er.
Der bärtige Mann in seinem Streitwagen! Mit einem Krug Wein und zahlreichen Knaben, die spielerisch um ihn tanzten. Er erkannte ihn sofort. Das war der Mann aus seinem Traum! Ein wildes Grinsen stand in seinem Gesicht. Er schien ihn zu rufen. Jeschuas Finger lösten sich von der Leiter. Ein Schwindel packte ihn, zog ihn nach unten. Josef schrie, doch die Worte waren nicht mehr als ein Lufthauch.
Jeschua fiel.
Ein Wassertropfen schlängelte sich durch seine dichten, langen, dunklen Haare. Er glitt hinab, überquerte jede Furche seiner Stirn, verfing sich beinahe in seiner Augenbraue, ehe er das geschlossene Lid erreichte, die Wimpern beiseiteschob, die Bartstoppeln an der Wange benetzte und schließlich vom Kinn fiel, um auf der Brust Jeschuas aufzuschlagen.
Er fühlte die Feuchtigkeit, die Kühle. In diesem winzigen Wassertropfen lag die Idee des gesamten, riesigen Ozeans. So war es mit allen Dingen, die Natur verbarg ihr Größtes im Kleinsten. Achtung vor der Schöpfung bedeutete, dieses Gesetz anzuerkennen.
Jeschua schlug die Augen auf. Er erwartete Schmerz, doch da war keiner. Es dauerte einige Augenblicke, bis er sich an die Dunkelheit des Raumes gewöhnt hatte. Dann erkannte er Umrisse: Schränke, Truhen, einen kleinen Tisch mit einem Stuhl. Darauf Nähinstrumente und Bücher. Er selbst lag in einem Bett, dessen Stroh er unter sich fühlen konnte.
Er nahm etwas aus dem Augenwinkel wahr und wandte den Kopf. Täuschte er sich? Hatte er bloß einen Schatten erhascht? Doch dann bemerkte er eine menschliche Gestalt neben sich. Sie war in einen langen, purpurfarbenen Umhang gehüllt, der ihren ganzen Körper bedeckte. Bloß ein Schlitz offenbarte die Augen, die mit dem dunklen Raum verschwammen. Eine zarte, ungewöhnlich helle Hand kam unter dem Mantel hervor. Darin hielt sie einen nassen Schwamm, den die Frau des Griechen auf Jeschuas Kopf legte. Denn um niemand anderen konnte es sich handeln als um die geheimnisvolle Frau, deren Gesicht Jeschua außerhalb seiner Vorstellung noch nie gesehen hatte.
»Wo bin ich?«, fragte er schwach. War die Frau durch sein Erwachen überrascht worden, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Im Haus des Kratylos«, gab sie zurück. Ihre Stimme war sanft wie das Rauschen eines Bergbachs. »Du bist von einer Leiter gefallen. Dein Vater und mein Mann haben sich große Sorgen um dich gemacht. Sie werden froh sein, zu hören, dass du wieder erwacht bist.«
»Hast du neben mir Wache gehalten?«, fragte Jeschua. Die Frau antwortete nicht, nahm bloß das feuchte Tuch von seinem Kopf und ließ es in einen Eimer mit Wasser fallen. »Warum?«
Die Frau stand auf und wollte das Zimmer verlassen. Jeschua packte sie an der Hand. Ein Zittern durchfuhr ihren Körper. Jeschua wurde schlagartig bewusst, dass er womöglich der erste Mensch in einer langen Zeit war, der den Schleier, den sie zwischen sich und die Welt geschoben hatte, durchbrach. Sogleich zog er seine Hand zurück. »Entschuldige«, sagte er. Die Frau blieb stehen, wo sie war.
»Eine schwere Krankheit zwingt mich in diesen Käfig aus Stoff«, erklärte sie, ohne sich zu ihm umzudrehen. »Würde ich den Schleier, der meinen Körper verhüllt, abwerfen, so würde mich die Sonne töten. Es herrscht eine Fremdheit zwischen mir und dieser Welt, die ich nicht überwinden kann. So bleibe ich eine Gefangene ohne Schuld, deren Gefängnis ihr Überleben bedeutet.«
Sie wandte den Blick. Ihre Augen erinnerten an Kohlen eines eben erloschenen Feuers. »Über dich zu wachen, dich zu pflegen, selbst wenn es nur wenige Stunden waren, gab meinem Leben Sinn. Wenn du diesen Raum verlässt, wird er sich wieder in eine Zelle verwandeln. Zeit, die ohne Sinn vergeht, ist, als ob sie nie gelebt wurde.«
Jeschua richtete sich auf. »Gibt es denn keine Heilung?«, fragte er. Die Worte der Frau berührten etwas tief in ihm, als hätte sie damit einen Stein in den Brunnen seiner Seele geworfen und das Wasser am Grund in Schwingungen versetzt.
»Ich fürchte nicht«, sagte die Frau. »Der Kampf gegen meine Krankheit ist ein Kampf, den ich vor langer Zeit aufgab. Es ist besser, aufzugeben, als zu verlieren, findest du nicht?« Jeschua schwieg. »Ich werde jetzt gehen und meinem Mann Bescheid sagen. Er wird sehr erleichtert sein.«
Nachdem sie den Raum verlassen hatte, setzte sich Jeschua auf. Er betastete seinen Körper, doch konnte er keine Wunde an sich entdecken. Er hatte wohl großes Glück gehabt. Er stieg in seine Sandalen, die er am Boden fand, und folgte der Frau aus dem Raum. Da alle Fenster im Zimmer mit dunklen Stofftüchern verhängt waren, hatte Jeschua nicht sagen können, wie viel Zeit seit seinem Sturz vergangen war. Nun, als er in den großen Wohnbereich trat, in dem er kürzlich noch gearbeitet hatte, stellte er fest, dass die Sonne gerade aufgegangen war. Er hatte die Nacht also ohnmächtig im Haus des Griechen verbracht.
»Josef ist zu deiner Mutter heimgekehrt, um sie zu benachrichtigen«, hörte Jeschua die Stimme des Hausherrn. Er drehte sich um. Kratylos kam lächelnd auf ihn zu. »Ich bin froh, dass es dir gut geht, junger Mann. Bei der Höhe deines Sturzes fürchteten wir das Schlimmste.«
»Ich bin Eurer Frau zu Dank verpflichtet«, erwiderte Jeschua. »Ohne sie wäre es womöglich nicht gut ausgegangen. Ich wünschte, ich könnte mich erkenntlich zeigen.«
»Ich fürchte, es gibt nicht viel, was du für sie tun kannst«, sagte Kratylos mit trauriger Stimme. »Aber ich habe Nutzen für dich.«
Er zeigte Jeschua das Mosaik, in dem er gestern seinen Traum erkannt hatte. Offenbar war er auf das Bildnis gefallen. Es war zersplittert, die bunten Steinchen lagen über den Boden verstreut. Das Gesicht des bärtigen Mannes war zerschlagen. An seiner Stelle klaffte nun ein Loch.
»Das ist ... war Dionysos«, erklärte Kratylos. »Wir Griechen verehren ihn als Gott der Fruchtbarkeit, des Weins, der Freude, aber auch des Wahnsinns und der Ektase. Die Legende besagt, dass Zeus, unser mächtigster Gott, vergleichbar mit eurem Jahwe, sich in die wunderschöne Königstochter Semele verliebte.«
Jeschua wusste, wie sehr es Josef missfallen würde, die griechischen Götzen mit Ihm verglichen zu wissen, dem Einzigen.
»Er verliebte sich in eine Frau?«, fragte Jeschua ungläubig.
Kratylos lachte. »Ja, unsere Götter sind nicht so erhaben wie euer Gott. Sie handeln oft wie Menschen. Jedenfalls erwartete die schöne Semele ein Kind von Zeus, doch seine Gattin, die Göttin Hera, war eifersüchtig. Verkleidet als Zofe überredete sie Semele, Zeus nach seiner wahren Gestalt zu fragen. Denn er hatte ihr in Menschengestalt beigewohnt. Als er ihren Wunsch erfüllte, konnte Semele als Sterbliche dem göttlichen Licht nicht standhalten und verbrannte.« Kratylos machte eine Pause, in der er das Gesagte wirken ließ. Wie auch in seinen Lehrstunden genoss er es, das Wort zu haben.
»Zeus nahm das Kind zu sich. Aus ihm wurde Dionysos. Viele Griechen verehren Dionysos, weil er uns näher ist als andere Götter. Er trinkt, er lacht und feiert wilde Feste, er singt und schreit und liebt. Manche von uns glauben sogar, man könne mit ihm Kontakt aufnehmen.« Kratylos lächelte.
»Kontakt aufnehmen mit einem Gott?« Jeschua wusste, dass die Gelehrten in Jerusalem die Heiligen Schriften studierten und daraus die Gesetze Gottes abzuleiten suchten. Doch dass sie mit ihm Kontakt aufnehmen würden, davon hatte er noch nie gehört. Für ihn klang es nach Häresie.
»Dionysos ist der Rausch«, erklärte Kratylos. »Wir finden ihn, wenn wir unser Selbst verlassen. In der Ekstase begegnen wir dem Unbekannten, und darin begegnet uns Dionysos.«
Jeschua verstand keines dieser seltsamen Worte, doch ehe er nachfragen konnte, legte ihm Kratylos eine Hand auf die Schulter und führte ihn von dem Mosaik weg. »Es bringt Unglück, einen Gott solcherart gesichtslos zu belassen«, erklärte der Grieche. »Gehe heim, Josef wird sich freuen, dich gesund zu sehen. Nehmt eure Arbeit morgen wieder auf und kümmert euch zuallererst um das Mosaik.«
Jeschua verließ das Haus des Griechen. Neben der Statue des marmornen Hundes blickte er noch einmal zurück. In einem der Fenster sah er zwei schwarze Augen, die auf ihm ruhten. Sie begleiteten ihn noch, als er bereits lange außer Sichtweite war.
Die Sonne beherrschte den Himmel und verschlang die weite, wüste Ebene mit ihrer unersättlichen Gier. Jeschua hatte das Wasser, das Kratylos ihm mitgegeben hatte, beinahe aufgebraucht. Ein ungeübtes Auge hätte keinen Unterschied zwischen den Sträuchern und dem Buschwerk entlang seines Weges ausmachen können, und der unerfahrene Wanderer hätte sich bald schon aus Verzweiflung, im Kreis zu gehen, auf den trockenen Boden gesetzt und auf sein Ende gewartet. Doch die Natur kam dem Menschen nicht hinzu, sondern brachte ihn hervor, das wusste Jeschua. Sie war mindestens ebenso lebendig und wandelbar wie das Menschengeschlecht. Jeder Stauch erzitterte auf die ihm eigene Art, wenn der Windhauch ihn streifte. Manche Bäume verloren ihre Blätter schneller als andere und jedes von ihnen hatte eine eigene Schattierung, von grün über braun bis gelb. So fand sich Jeschua auf seinem Weg zurecht und fühlte sich selbst als einsamer Wanderer nicht allein.
Es wäre klüger gewesen, die Mittagshitze im Haus des Griechen abzuwarten und dann erst den Heimweg anzutreten. Doch er hatte keine Minute länger unter demselben Dach bleiben wollen wie die dem Tode geweihte Frau des Griechen. Erst da wurde ihm bewusst, dass er ihren Namen gar nicht kannte!
Was war es, das ihn an ihrem Schicksal so berührte? Jeschua hatte zuvor bereits den Tod mitangesehen. Alte waren gestorben, als ihre Zeit gekommen war. Junge waren gestorben, wenn