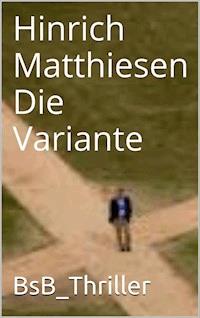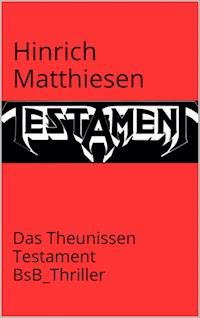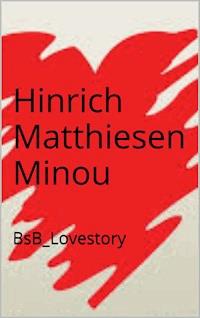Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann liegt im Schilf und beobachtet aus seinem Versteck das Treiben auf einer Yacht. Albert Bloom ist ein beherrschter Mann und ein zärtlicher Vater. Gewesen. Die drei jungen Männer, die sich vor seinen Augen ungeniert vergnügen, haben vor einem Jahr seine Tochter nicht nur brutal vergewaltigt, sondern sie auch halbtot und blind am Strand liegen lassen. Der Vater, der sein einziges Kind liebt, wie nur ein Vater lieben kann, hasst nun gnadenlos. Sein Racheplan ist längst geschmiedet. Es ist fast undenkbar, dass dieses schreckliche, dieses innige Buch einen gnädigen Ausgang findet, und doch gibt es ihn: Er liegt in dem blinden Mädchen selbst, das durch eine verständnisvolle Liebe wieder Lebensmut findet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexico. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman:MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal. «
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 4
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
Ein Mann liegt im Schilf und beobachtet aus seinem Versteck das Treiben auf einer Yacht. Albert Bloom ist ein beherrschter Mann und ein zärtlicher Vater. Gewesen. Denn die drei jungen Männer, die sich vor seinen Augen ungeniert vergnügen, haben vor einem Jahr seine Tochter nicht nur brutal vergewaltigt, sondern sie auch halbtot und blind am Strand liegen lassen. Der Vater, der sein einziges Kind liebt, wie nur ein Vater lieben kann, hasst nun gnadenlos. Seine Rachepläne sind längst geschmiedet...
Es ist fast undenkbar, dass dieses schreckliche, dieses innige Buch einen gnädigen Ausgang findet, und doch gibt es ihn: Er liegt in dem blinden Mädchen selbst, das durch eine verständnisvolle Liebe wieder Lebensmut findet.
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
Der Skorpion
Roman
:::
Bs
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 4
1
Der Mann bog das blassgrüne Schilf zur Seite. Er tat es sehr vorsichtig. Ganz langsam drückte er die langen, steilen Halme mit dem spröden Blattwerk nach links hinüber, schob sie aus seinem Blickfeld, sodass er ohne Behinderung auf das Wasser sehen konnte. Da lag es, das Boot, die weiße, vierzehn Meter lange MotorjachtOdysseus.Sie lag vor Anker und drehte sich langsam um ihre Kette. Die stromlinienförmige Längswand schrumpfte. Mehr und mehr kehrte sich die Rückseite der Jacht dem Manne zu. Für eine Weile sah er das kompakte Heck mit dem Namen aus schwarzen, aufgesetzten Antiqua-Lettern und dem an zwei kleinen weißen Davits hängenden Dingi und darüber das braungestrichene Brückengehäuse mit den Positionslampen, der überstehenden Flight-Bridge und der noch geschlossenen Kajütentür. Nach einer Weile kam erneut der Bug herum, gerieten Reling und Schanzkleid ins Blickfeld, und die weiße Bordwand streckte sich wieder bis zu ihrer ganzen Länge aus. Der Mann wusste nicht viel über Motorboote, aber er kannte einige Daten derOdysseus.Er wusste, dass sie vierzehn Meter lang, viereinhalb Meter breit und aus Kunststoff gebaut war, dass sie zwei Dieselmotoren von je 250 PS und sechs Kojen hatte und rund eine halbe Million Mark kostete. Ebenso kannte er die genaue Typenbezeichnung; es war ein Fahrzeug der KlasseCytra1400my.Er hatte sogar eine Vorstellung von der Innenausstattung des Bootes, obwohl er nie an Bord gewesen war. Zu Hause in seinem Wandsafe lag der Flächenaufriss mit der Raumgliederung und einer ausführlichen Inventarbeschreibung. Schon vor Monaten hatte er sich eingehend informiert, hatte eine Bootsausstellung besucht und sich Kataloge mit nach Hause genommen. Diese Erkundigungen, über die eine Akte existierte, waren Bestandteil einer ganz bestimmten Strategie gewesen, doch dann hatte der Mann plötzlich seinen Plan geändert. Er benötigte nicht mehr die genauen Daten. Das Boot interessierte ihn nur noch sekundär, als beteiligtes Objekt. Es ging ihm um die Leute. Es war ihm zwar auch vorher um die Leute gegangen, aber da hatte er noch in dem Fahrzeug die Lösung gesehen, das Mittel, und in diesem Punkt hatte er seinen Operationsplan korrigiert.
Er musste zum Fotografieren die Hände frei haben. Darum holte er eine Schere aus der Tasche und schnitt die zur Seite gebogenen Schilfhalme ab. Er trug den Fotoapparat umgehängt. Nun nahm er ihn in beide Hände und machte die erste Aufnahme von der Backbordseite des Bootes. Die Distanz betrug etwa dreißig Meter. Er benutzte ein Teleobjektiv. Sein Standort war unbequem, das Terrain weich und feucht, und stellenweise stand zwischen den Halmschäften das blanke Wasser. Er konnte sich also nicht setzen und auch nicht zwischendurch den schweren Fotoapparat ablegen, und er hatte schon jetzt trotz der Gummistiefel nasse Füße.
Die zweite Aufnahme machte er von der Frontansicht. Er hatte schon vorher, beim Anblick des gedrungenen Hecks, flüchtig an ein Tier gedacht, an einen großen auf der Wasseroberfläche hockenden Frosch. Nun, da der Bug genau vor ihm lag, war der Eindruck des Tierhaften verblüffend. Die Fenster empfand er, obwohl die Vorhänge noch zugezogen waren, als drohend auf sein Versteck gerichtete Blicke. In der nächsten halben Stunde machte er noch drei Bilder, eines davon ohne Teleobjektiv, um auch die kleine, fast kreisrunde Bucht mit dem Schilfbestand links und rechts und der schmalen Zuwegung im Hintergrund festzuhalten. Er hätte gern geraucht, aber er hatte, um jeder Versuchung vorzubeugen, seine Zigaretten im Wagen gelassen. Er sah auf die Uhr. Es war kurz nach neun. Bald werden sie aufwachen, dachte er. Die Sonne schien ihm ins Gesicht. Sie stand jetzt genau mitten über der Stadt, und obwohl sie ihn blendete, konnte er in der Ferne die weit hinter dem jenseitigen Seeufer stehenden Kirchtürme erkennen. Für die nächsten, wichtigeren Aufnahmen würde er den Gelbfilter benutzen müssen. Er griff in die Jackentasche und überzeugte sich davon, dass er ihn nicht vergessen hatte.
Ein leichter Wind kam von der Wasserseite her. Der Mann hätte ihn kaum wahrgenommen, wenn nicht das lästige Dunstgemisch aus Brand und Verwesung mit herübergeweht wäre, das die fünf Kilometer entfernt am Stadtrand gelegene Klär- und Müllverwertungsanlage ständig ausstieß und das, je nach den Windverhältnissen, fast immer einen Teil der am Seeufer wohnenden Bevölkerung heimsuchte.
Das Warten zog sich hin. Der Mann dachte an Anne, seine Tochter. Er dachte fast nur noch an sie, und auch dass er hier stand und fotografierte, geschah ihretwegen. Seit elf Monaten war er fixiert auf die Sorge um ihr Ergehen und auf sein Vorhaben, das damit zusammenhing. Seit dieser Zeit existierte, was Annes Befinden betraf, für ihn nur der Begriff »Ergehen« und nicht der viel gebräuchlichere des Wohlergehens. Der Schwund dieser einen Silbe sagte genug: die Trauer und das Ausbleiben aller Hoffnung. Ich werde ihr nachher etwas kaufen, dachte er, und schon dieser kleine Impuls stieß ihn, wie schon so oft in den vergangenen Monaten, mit schonungsloser Direktheit auf das, was er Annes Ergehen nannte und woraus seiner Meinung nach nie wieder ein Wohlergehen werden könnte.
Bücher, dachte er. Wie traurig, dass ausgerechnet sie niemals mehr ein Buch von mir bekommen wird, von mir nicht und von niemandem. Ausgerechnet sie, die mit Büchern lebte und die schon als Fünfzehnjährige einmal in wohlgesetzten Worten einem Hausgast den Unterschied zwischen abenteuerlicher Lektüre und dem Abenteuer der Lektüre klargemacht hatte. Vielleicht sollte ich ihr einen Hund kaufen. Natürlich, das ich daran nicht früher gedacht habe. Ein Hund, das ist ein Geschenk, das sie hören und zu dem sie sprechen kann, und es ist auch eines für ihre Hände.
Eine Bewegung am Brückenhaus schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Das Boot lag jetzt schräg vor ihm, mit wegdrehendem Bug, sodass sich das Heck wieder in den Vordergrund schob. Die Kajütentür hatte sich geöffnet. In ihrem Rahmen stand ein junges Mädchen, schlank, dunkelhaarig. Sie war nackt, hielt ihre Arme erhoben und reckte sich in den sonnigen Morgen hinein.
Der Mann setzte den Filter auf die Linse. Er machte das mit ganz ruhigen Bewegungen, hob den Apparat, wartete ein paar Sekunden, bis das Heck noch weiter herumgekommen war, dann drückte er auf den Auslöser. Das Klicken kam ganz leise. Beim Kauf des Apparates war die Lautstärke des Auslösers ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl gewesen. Es war ein hochwertigesLeica-Fabrikat, das allerdings seine Qualität nicht mehr auf Anhieb verriet, denn die Chromstahlteile waren mit mattschwarzer Plaka-Farbe übermalt. Fast eine ganze Stunde hatte der Mann über dieser Arbeit gesessen, aber er hatte gewusst, dass sie sich auszahlen würde. Schon jetzt hätte das Reflektieren der Sonnenstrahlen auf dem blanken Metall ihn verraten haben können.
Das Mädchen trat nun vollends heraus, machte, während sie sich an den Speichen des Ruderrades festhielt, auf der Gräting einige Kniebeugen, kletterte dann auf das Deck, blieb dort eine Weile stehen. Der Mann machte das zweite Bild von ihr. Für einen Moment kam ihm in den Sinn, dass ihn von zehn zufälligen Beobachtern genau zehn und nicht weniger für einen Voyeur halten würden, und er empfand eine Art Genugtuung bei dem Gedanken, dass er etwas viel Gefährlicheres war. Das Mädchen trat an den Decksrand, stellte sich auf die Zehenspitzen, straffte den Körper, hob die Arme und glitt mit einem sauberen Kopfsprung ins Wasser. Ihr Auftauchen verfolgte der Mann nicht mehr, denn inzwischen waren zwei junge Burschen im Türrahmen erschienen. Ganz schnell machte er eine Aufnahme, denn die Position war günstig: direkte Heckansicht derOdysseus,und das Brückengehäuse wirkte nun so, als wollten die beiden jungen Männer den Rahmen für ihr Bild gleich mitliefern.
Es waren zwei schlanke, sportliche Typen, hellblond der eine, von etwas dunklerem Blond der andere. Der Mann im Schilf, wohlpräpariert für seine Aufgabe, senkte den Fotoapparat, ließ ihn hängen, holte aus der Innentasche seiner Cordjacke ein Opernglas hervor, setzte es an die Augen. Er kannte die Männer. Beide waren langhaarig. Der eine trug eine knappsitzende blauweißgestreifte Badehose, der andere war nackt. Beide waren braungebrannt. Der Nackte kletterte auf die Flight-Bridge, rief »Hallo, Monika!« und winkte dem schwimmenden Mädchen zu. Dann sprang auch er mit elegantem Kopfsprung ins Wasser. Der andere streckte sich auf dem Deck zum Sonnen aus.
Die Kajütentür war offengeblieben, doch es dauerte noch etwa zehn Minuten, bis die anderen herauskamen. Zwei waren es, ein etwa zwanzigjähriger dunkelhaariger Mann und ein rötlich-blondes Mädchen. Beide waren unbekleidet, der Mann tiefbraun, das Mädchen noch von einer leicht rosa getönten Blässe. Sie begann sofort, sich einzuölen. Den Beobachter im Schilf irritierten die geschlechterverwirrenden Haarschöpfe der Jünglinge. In den Straßen seiner Stadt hatte er nicht selten beim Anblick langhaariger Männer die optische Verwandtschaft mit Christusdarstellungen empfunden. Nun, da er diese Typen nackt vor sich sah, verwunderte es ihn, dass gerade die entblößten Männerkörper auf eine diffuse Weise feminin wirkten, so als liefen da nicht Männer herum mit Frauenhaaren, sondern flachbrüstige Frauen mit umgehängten obszönen Scherzartikeln.
Der auf dem Deck liegende Junge begrüßte die beiden Hinzugetretenen. Er zog nun auch seine Badehose aus, warf sie aus dem Sitz durch die offene Tür in die Kajüte. Dann erhob er sich ganz, nahm der Blonden die Flasche mit dem Sonnenöl aus der Hand und machte sich daran, ihre blasse Haut mit dem Öl zu massieren. Die fünf schwatzten und lachten miteinander, rauchten, sprangen, schwammen. Der Mann hatte den Eindruck, sie wähnten sich völlig sicher vor neugierigen oder zufälligen Blicken. Sie hatten ihr Boot an der entlegensten Stelle des Sees geankert. Es war eine Schneise, etwa vierzig bis fünfzig Meter im Durchmesser und bis auf den schmalen Durchlass von hohem Schilf umstanden. In der Tat lag es fern, in dieser abgeschiedenen Gegend Beobachter zu vermuten. Das Ufer war sumpfig, der nächstgelegene feste Weg einen halben Kilometer entfernt. Es war die Straße, die um den See herumführte. Sie verlief zwar auch hier parallel zum Ufer, aber wegen des sumpfigen Geländes in weitem Abstand. Die ganze örtliche Beschaffenheit hatte etwas von einer Lagune, und der Mann im Schilf hatte dem Platz auch längst diesen Namen gegeben, schon vor Wochen, als er zum ersten Mal die Fahrt derOdysseusvon der Uferstraße aus mit dem Fernglas verfolgte und das Schiff dann plötzlich verschwinden sah. Er war dann durch das Schilf gelaufen und hatte diesen Ankerplatz entdeckt. Danach war er noch oft hier gewesen, hatte sich das Treiben auf der geankerten Jacht angesehen, ohne jedoch zu fotografieren. In seinen Gedanken hieß der Platz von Anfang an die Lagune, und sogar die beschwerliche Fußstrecke nannte er im Stillen den Weg durch die Mangroven, obwohl es sich um simples Schilf handelte und er sich mitten in Deutschland befand.
Die fünf ignorierten offensichtlich nicht nur die Möglichkeit eines fremden Einblicks in ihr idyllisches Freizeitversteck, sie schienen auch voreinander keinerlei Hemmungen zu haben. Die beiden, die als erste ins Wasser gesprungen waren, standen nun an der Reling, rauchten und unterhielten sich, und als sie ihre Zigarettenreste über Bord geworfen hatten, hob der junge Mann das Mädchen mit einer einzigen kraftvollen Bewegung empor, setzte es ohne Umstände auf das weiße Geländer, drückte ihr die Knie auseinander und stellte sich zwischen ihre weitgespreizten Schenkel. Das Mädchen hielt sich an seinem Hals fest und zog dabei seinen Kopf zu ihren Brüsten herab. Sie standen lange so. Der Mann im Schilf machte davon eine Aufnahme. Die drei anderen jungen Leute zeigten, selbst als die Wirkung der Pose durch rhythmisches Beiwerk intensiviert wurde, kein besonderes Interesse für das Paar, sahen nicht oder nur zufällig hinüber. Sie waren beschäftigt, holten Flaschen und Gläser aus der Kajüte, auch ein Radio. Als der Beat ertönte, dachte der Mann im Schilf, dass er bei dem Lärm unbesorgt den Auslöser seiner Kamera betätigen konnte.
Im Verlauf der letzten Stunde seiner Beobachtungen, während derer die jungen Leute auf dem kleinen Deck tranken und tanzten, machte er noch etwa ein Dutzend Fotos. Dann wartete er ab, bis die Jacht sich wieder so gedreht hatte, dass die Bugspitze auf ihn zeigte und das Brückenhaus sich für einige Minuten zwischen ihm und den fünfen befand. Er hatte einige Mühe, seine Füße aus dem Sumpf zu ziehen. Er musste dabei die Zehen durchkrümmen, damit ihm die Gummistiefel nicht ausgezogen wurden. Die durch die Saugwirkung hervorgerufenen dumpf schmatzenden Geräusche gingen unter in dem Getöse der Musik. Mit langsamen, vorsichtigen Schritten nach rückwärts bewegte der Mann sich vom Ufer weg, das Boot dabei ständig im Blick haltend und sorgfältig darauf bedacht, die hohen Schilffahnen so wenig wie möglich zu bewegen. Erst nach etwa fünfzig Schritten drehte er sich um, ging von da an vorwärts und war auch in seinen Bewegungen nicht mehr auf Vorsicht bedacht oder doch nur insoweit, als der Schutz des auf seiner Brust hängenden Fotoapparates sie erforderte.
Für die Fahrt hatte er den grauen Volkswagen seiner Tochter benutzt. Am Abend vorher hatte er auf der anderen Seite des Sees im Fährhaus gesessen, dem einzigen der in der Nähe der Mole liegenden Lokale, von dem aus man den Jachthafen in seiner ganzen Ausdehnung übersehen konnte. Nachdem dieOdysseusausgelaufen war, hatte auch er sich auf den Weg gemacht, war um den See herumgefahren und hatte den VW auf dem Parkplatz einer neben der Uferstraße liegenden Ferienkolonie abgestellt. Dann war er an den ihm schon vertrauten Beobachtungsplatz gegangen und hatte die Ankunft derOdysseuserwartet.
Eine halbe Stunde, nachdem er seinen Posten bezogen hatte, war das Boot in der kleinen Bucht vor Anker gegangen. Er hatte dann das Treiben der fünf bis zum Schluss beobachtet, das Verlöschen der Lichter abgewartet, war nach Hause gefahren und am Morgen um acht Uhr zurückgekehrt, wieder in Annes Auto. Sie brauchte es ohnehin nicht mehr, und er hielt es für besser, sein auffälliges Mercedes-Coupé aus den Operationen möglichst herauszuhalten.
Er öffnete den Wagen, legte die Kamera auf den Rücksitz zu den dort ausgebreiteten Angelutensilien, die er bei einigen der vorangegangenen Unternehmungen als Vorwand benutzt und mit hinunter ans Wasser genommen, diesmal aber im Wagen gelassen hatte, weil sie ihn beim Fotografieren behindert hätten. Dann wechselte er seine Schuhe, stieg ein, zündete sich eine Zigarette an und startete. Eine Viertelstunde später war er drüben in der Stadt. Er fuhr zum Postamt, suchte im Branchenverzeichnis des Telefonbuchs nach der Adresse eines Hundeasyls, stieß dabei auf die Anschrift eines Pudelzüchters, der dreißig Kilometer entfernt auf einem Gutshof wohnte. Er meldete dort seinen Besuch an. Er hatte Zeit, er hatte überhaupt alle Zeit der Welt, war nur noch für seine Tochter da, und so machte er sich sofort auf den Weg. Auf dem Gutshof erfuhr er, dass er in vierzehn Tagen einen Welpen bekommen könnte, vorher nicht, der Wurf sei noch nicht entwöhnt. Unter vier Exemplaren, die sich für ihn in ihrem Aussehen so gut wie überhaupt nicht voneinander unterschieden, suchte er das lebhafteste aus. Er unterhielt sich noch eine Weile mit dem Züchter über die Papiere des Hundes und über notwendige Anschaffungen für die Pflege, leistete eine Anzahlung und fuhr nach Haus.
Als er in die von hohem Ilex gesäumte Auffahrt zu seinem Grundstück einbog, musste er daran denken, wie Anne ihm wenige Tage nach ihrer Entlassung aus der Klinik von einem makabren Streich erzählte, die eine tiefwurzelnde Gewohnheit ihr gespielt hatte. Sie war, als sie seinen Mercedes über die Auffahrt herankommen hörte, von ihrer Couch aufgesprungen, ans Fenster getreten und hatte sogar den Vorhang zurückgeschlagen, ehe ihr bewusst wurde, dass dort an ihrem Fenster dieselbe erbarmungslose Nachtschwärze herrschte wie überall, wohin sie sich auch wenden mochte. Dieser kleine Bericht seiner Tochter von einem nur Sekunden währenden Vorgang hatte ihn tiefer erschüttert als alles Tasten und Anstoßen und Stolpern der ersten Tage. Später dann, in der Nacht, hatte er fast eine ganze Flasche Bourbon ausgetrunken, und zwar nicht, weil er das Maß verlor, sondern mit dem festen Vorsatz, sich zu betäuben. Diese Geschichte fiel ihm nun ein, er sah förmlich Annes Hinstürzen ans Fenster und das resignierte Zurücktreten. Die Vorstellung legte sich ihm lähmend auf die Glieder, sodass es aussah, als stellte da nicht ein durch viel Tennis und Reiten gestraffter Fünfzigjähriger, sondern ein alter, müder Mann seinen Wagen in der Garage ab und beträte sein Haus.
Wie so viele andere Dinge seiner Welt, große und kleine, so hatte auch das Haus, sein eigenes geliebtes Haus, den spezifischen, nicht berechenbaren Wert der intimen Bindung an ein Objekt im Verlauf des letzten Jahres eingebüßt. Er hatte es, obwohl erst ein Mann mittleren Alters, immer auch schon mit den Augen seiner Tochter gesehen, als ein Stück künftiger Hinterlassenschaft, jedoch nicht als Erbe im Sinne eines Marktwertes, sondern eines Arsenals von unzähligen Kindheitserinnerungen, als eine Stätte angesammelter Geschichten. Es war ein älteres, aber gut erhaltenes und gepflegtes Backsteingebäude. Es hatte fünf große Fenster zur Straßenfront hin, zwei im Erdgeschoss und drei oben. Zwei der oberen gehörten zu Annes Zimmer. Im ausgebauten Dachgeschoss befanden sich zwei Giebel, jeder mit einem kleineren Fenster. Dahinter lagen Gästezimmer, die seit Jahren nicht mehr benutzt wurden. Das Haus zeigte keinen Prunk. Es hatte nichts Auffallendes außer seiner Größe und dem weit ausladenden Dachüberstand. Es war solide und sauber, und wenn es ein wenig alt und verträumt schien, so deshalb, weil die helleren, moderneren Bauten der Nachbarschaft es in der Wirkung zurückdrängten und ihm eine gewisse altertümliche Behäbigkeit verliehen, so als habe es nicht recht mithalten können im Wettkampf der Farben und Linien.
Auch das Innere bestand aus einem Aufgebot klarer Konturen. Die große, neun mal sechs Meter messende Wohndiele im Erdgeschoss mochte auf den ersten Blick allzu sachlich, ja sogar streng wirken. Der Fußboden bestand zur Hälfte aus großen, dunkelroten Steinplatten, die andere Hälfte bedeckte ein anthrazitfarbener Teppich, Wände und Decken waren weiß. In der südlichen Längswand befanden sich zwei große Fenster mit dem Blick in einen ausgedehnten Garten, dem aber in diesem Frühjahr und Sommer die Hand des Hausherrn gefehlt hatte; der Rasen war gewuchert, und niemand hatte die wilden Rosentriebe geschnitten. Aus der Wohndiele führte eine steinerne Treppe mit schmiedeeisernem Geländer in den zweiten Stock. Sie verlief rechtwinklig; ihren Ansatz betrat man von der Dielenmitte her. Der Esstisch vor den Südfenstern des Raumes war ein schweres Möbel mit zweizölliger Platte und gedrungenen Beinen, die Stühle daran hochlehnig, streng, rustikal, dunkel gebeizt, bezogen mit Leder von einem Gelb, das ins Orangefarbene hinüberspielte. Außer dem Tisch und den Stühlen gab es nur noch wenige Möbelstücke in dem Zimmer. Alle waren schwer, behäbig, aus gebeizter Libanonzeder: ein Schreibtisch, ein runder Rauchtisch mit Sesseln, deren Holzteile dunkel und deren Polster mit königsblauem Leinen bespannt waren, Bücherregale und schließlich, unter der Treppe, die Bar, ihre Rückwand holzgetäfelt, die Theke ebenfalls aus dunklem Holz und die Platte darauf aus blauweißen Kacheln mit bäuerlichen Motiven. Vor der Bar standen vier hohe lederbezogene Hocker. Die Wandlampen und Kronleuchter waren aus Schmiedeeisen. Das einzige Stück in modernem Design war Annes Klavier.
Der Mann, der nun in die Diele trat und sich zunächst in einen der Sessel setzte, hielt nichts von verspielten Ecken mit Bildern und Nippes und Deckchen. Wie er die klaren Linien liebte, bevorzugte er auch leuchtende, eindeutige Farben, genauer gesagt, er und seine vor Jahren verstorbene Frau hatten diese Vorliebe bei der Einrichtung ihres Hauses walten lassen. Nun aber war er über alle Fragen nach Form und Farbe hinaus. Für einen fremden Betrachter mochte das Zimmer etwas Majestätisches, fast Verweisendes haben, mochte an die kühle Distanziertheit kolonialer Hacienda-Wohnräume erinnern, für die kleine Familie hatte er dennoch Geborgenheit und Wärme ausgestrahlt. Sie lagen in dem Wert der Dinge begründet, die der Raum enthielt, in ihrer Solidität, ihrer Verlässlichkeit, ihrer Verheißung von Dauer. Die anderen Räume des Hauses waren ähnlich eingerichtet. Sogar Anne, die als heranwachsendes Mädchen ihr Zimmer hatte neu ausgestalten dürfen, war dem elterlichen Geschmack gefolgt.
Der Mann hatte sich eben hingesetzt, da läutete das Telefon. Er stand auf, hob ab.
»Bloom«, sagte er. Auch seine Stimme hatte, wie sein Körper, etwas Müdes, Ausgelaugtes. Er sprach mit seiner Wirtschafterin. Sie sagte, sie sei aufgehalten worden und käme so schnell wie möglich, um das Mittagessen zu machen.
»Ist gut, Frau Bender«, sagte der Mann und legte auf. Er setzte sich wieder, diesmal an die Bar, nahm einen Bourbon und zündete sich eine Zigarette an. Er hatte Angst vor dem Weg nach oben. Er hatte Angst davor, und zugleich fieberte er danach, hinaufzugehen. Er wusste, dass sie alles gehört hatte, den Wagen, ihren eigenen Wagen, die Türen, die Schritte, das Telefon, und ebenso wusste er, dass sie jetzt dasaß oder dalag und auf ihn wartete. Wie grausam ist es, dachte er, wenn für ein attraktives neunzehnjähriges Mädchen der Fächer der Erwartungen zusammengedrückt wird zu einem schmalen Streifen, so weit, dass nur eine einzige und nicht einmal eine besonders erregende nachbleibt, das Warten auf des Vaters Rückkehr von kleinen, ganz alltäglichen Wegen. Für Anne Bloom gab es keinen Freund, keinen Geliebten. Es gab keine heißersehnten Briefe, keine Theater- oder Kinobesuche, keine Fernsehsendungen, keine Reitstunden, keine Ausflüge, keine Schulfeste. Es gab immer nur das Lauschen in die ewige Nacht, das Horchen auf das Motorengeräusch vom Garten her, auf das Öffnen und Schließen der Türen, auf die Schritte von der Treppe. Und Abend für Abend dieselben Bitten, bescheiden vorgebracht und in der Stimme doch deutlich gezeichnet von einem Drängen, von der Angst, sie könnten einmal nicht gewährt werden: Bleib doch... Erzähl mir noch etwas... Lass uns noch ein bisschen Musik hören... Lies mir etwas vor... Natürlich hatten sich nach Rückkehr aus der Klinik Freunde gemeldet, ehemalige Mitschüler und Mitschülerinnen, aber nach wenigen Besuchen hatte Anne den Vater gebeten, sie nicht mehr kommen zu lassen, jedenfalls nicht so bald wieder, es sei zu schwer für beide Seiten. Dann hatte für die meisten die Ausbildung oder das Studium begonnen, fast jeder Fall verbunden mit einem Ortswechsel. Briefschaften konnten nicht entstehen, und so war schließlich nur der Vater geblieben.
Bloom leerte sein Glas. Dann erhob er sich, ging die Treppe hinauf, klopfte an die Tür. Das »Ja, Vater!« kam ihm so vor, als sei es von einem neunjährigen ängstlichen Kind gesprochen und nicht von einer Neunzehnjährigen, so scheu klang es, so verhalten, oder vielmehr: So hörte er es, und er erwog nicht, ob er sich täuschte. Er trat ein. Die Vorhänge waren zurückgezogen und die Fenster geöffnet. Der Raum war hell und warm von der Julisonne. Anne saß auf der breiten Couch. Sie streckte beide Hände aus in Richtung auf die Tür. Albert Bloom erfasste sie mit einem Griff, beugte sich zu ihnen hinab, drückte seine Lippen auf die blassen Finger, erst rechts, dann links, es war wie ein Ritual. Dann trat er ganz heran, beugte sich über die Tochter, küsste ihr helles Haar, holte sich einen Stuhl heran, setzte sich Anne gegenüber.
»Wo warst du? Du warst lange weg.«
»In vierzehn Tagen bekommst du ein Geschenk, über das du dich freuen wirst. Es ist etwas Besonderes, und ich habe das heute vorbereitet.«
»Was ist es?«
»Ein Hund. Ein Zwergpudel. Er ist schwarz, und wenn du ihn bekommst, ist er noch so klein, dass er in deinen beiden Händen Platz hat.«
»Ein Hund! Das hast du dir gut ausgedacht. Er soll hier in meinem Zimmer schlafen. Geht das?«
»Noch nicht gleich, weil er noch nicht sauber ist. Aber später wird es gehen, ganz gewiss, schon nach wenigen Monaten. Wir stellen ihm dann seinen Korb neben dein Bett.«
»Ist es ein Hund oder eine Hündin?«
»Eine Hündin. Man sagte mir, sie seien anhänglicher als die Rüden. Du musst dir einen Namen für sie ausdenken.«
»In vierzehn Tagen, sagst du?«
»Ja. Du hast also Zeit, über einen Namen nachzudenken.«
Er hatte wieder die alte Frage auf den Lippen: Was hast du gemacht? Aber er stellte sie nicht. Ihm war bewusst geworden, dass selbst diese vier kleinen Worte, früher so oft dahergefragt im Plauderton, nun ein ganz anderes Gewicht hatten. Ja, beinah hatten sie nun etwas Verletzendes, weil sie so voller Hinweis waren auf das Verdammtsein zum Zeitverbringen, auf die Ohnmacht, denn wie viele Möglichkeiten einer Antwort gäbe es? Eine? Zwei? Musik gehört, und was noch? Und waren nicht selbst die immer wieder herangeschafften Schallplatten im Grunde eine Rücksichtslosigkeit, ein taktloser Fingerzeig, eine brutale Betonung des aufs bloße Hören eingeengten Erlebnisbereichs? Wie musste es in einem Menschen aussehen, dem von früh bis spät nichts zu tun bleibt als lauter Hörgenüsse aneinanderzureihen, fünf, zehn, zwanzig oder wie viele? Ist das dann noch Genuss oder nicht vielmehr schon die radikale Apostrophierung des Trostlosen, eine Aktion, die nach Wegen sucht und in diesem Bemühen immer wieder das Ausweglose offenbart? Also fragte er nicht, aber Anne berichtete von sich aus, was sie an diesem Morgen getan hatte.
»Ich war im Garten und hab eine Tonbandaufnahme gemacht. Willst du sie hören?«
»Ja, gern.«
Sie hatte den Kassetten-Rekorder neben sich auf der Couch stehen, schaltete ihn ein, regulierte die Lautstärke. Dem Vater fiel auf, wie schnell sie die Knöpfe fand. Und dann hörte er das wohl magerste Sammelsurium an Geräuschen, das je ein Mensch zusammenstellte. Von ganz weit eine Straßenbahn. Autos; näher, entfernter, näher. Kinder; Worte verstand man nicht, es war nur die verwaschene Kulisse aus hellen Stimmen zu hören, Schreien dabei. Dann endlich ein Vogel. »Ein Pirol«, sagte Anne. Albert Bloom nickte nur, aber dann fiel ihm ein, dass sie das nicht sehen konnte, und so sagte er: »Ja.« Der Vogel machte ihn nicht heiter. Ihn bedrückten die langen Strecken der Stille zwischen den einzelnen Geräuschen.
»Ein Männchen«, erklärte Anne. »Die Stimme der Weibchen ist rau.«
Zwischen den Vogelrufen ertönte das hohe Surren eines Baukrans. Schließlich verstummte der Pirol. Das Surren blieb noch sehr lange, ebbte ab und setzte immer wieder neu ein. Bloom glaubte die Drehungen des Schwenkarms zu hören, obwohl das Tonband davon nichts wiedergab. Als nun auch der Kran schwieg, sagte Anne:
»Nun ist es sehr lange still, aber pass mal gut auf, was als Nächstes kommt.«
Es war ein gramvoller Blick, mit dem Albert Bloom seine Tochter betrachtete. Immer wieder glitten seine Augen hinauf und hinunter, von den blassen Händen, die über dem schmalen Leib den Saum einer leichten Decke hielten, bis zum blonden Scheitel. Anne war sorgfältig frisiert. Sie trug ihr liebstes Kleidungsstück, eine hellblaue Leinenbluse mit aufgesetzten Taschen, und ihre Fingernägel waren kurzgeschnitten und sauber. Bloom hatte Frau Bender, der Haushälterin, gesagt, Annes tägliche Pflege sei die vordringlichste aller häuslichen Aufgaben, und Frau Bender hielt sich daran. Bloom überlegte, was Anne wohl sagen würde, wenn er ihr zum ersten Mal wieder ein neues Kleid mitbrächte. Wie mag es sein, fragte er sich, wenn für ein junges Mädchen ein neues Kleid zum Erlebnis der Hände wird? Es wird nicht ausreichen, dachte er, und sie wird nach der Farbe fragen, nach dem Schnitt. Aber was dann? Wie wird sie damit fertig, von Farben und Formen zu erfahren und dann nicht zu wissen, wohin mit dem Blau oder dem Gelb oder dem Rot, mit dem Paspel oder dem Stufenvolant oder der angeschnittenen Tasche? Wohin damit, da die Betrachtung auf doppelte Weise entfällt: Die anderen sind nicht mehr da, und auch das Hintreten vor den Spiegel bringt nichts; ebenso gut könnte sie sich in die Wüste stellen oder vor eine Kellertür.
»Gleich«, sagte Anne, »hörst du auch zu?«
»Ja, ich passe auf«, erwiderte er, und er strich ihr über den Scheitel. Aber er war nicht bei der Sache, denn er starrte auf die handbreite weiße Binde, die sie trug, dort, wo einmal ihre Augen waren. Das Leinen verdeckte nicht ganz die dunklen Flecken der Pigmentverfärbung. An zwei Stellen griffen die Konturen des bläulich-roten Mals über den weißen Rand hinaus, auf der linken Stirnseite und der linken Wange. Sie tastete nach seiner Hand.
»Jetzt, jetzt müsste es...«
Er staunte über ihr sicheres Zeitmaß, denn das Band unterbrach ihre Ankündigung. Er hörte den hohen, langgezogenen Ton gebremster Autoreifen. Das musste ziemlich nah gewesen sein, denn das Band gab das Jaulen der über den Asphalt radierenden Pneus laut wieder. Und dann kam der Aufprall. Bloom spürte den verstärkten Druck von Annes Hand. Er erwiderte ihn. Für eine Sekunde war der Raum angefüllt von dem Bersten der Materie. Es war ein so voluminöses Geräusch, dass der Rekorder nicht mehr sauber trennte, und es hatte fast den Anschein, als berste er selbst. Dann war Stille.
»Ich hab auch den Unfallwagen drauf«, sagte Anne, »aber er kommt erst nach ungefähr fünf Minuten.«
Sie stoppte das Gerät.
»Morgen werden wir aus der Zeitung wissen, was es war«, sagte Bloom.
Anne drückte auf die Rückspultaste. Wieder war Bloom überrascht zu sehen, mit welcher Sicherheit sie das Gerät bediente. Als das Band abgespult war, schaltete sie aus.
»Weißt du was, Vater?«
»Nun?«
»Heute Nachmittag will ich die langen Pausen herausschneiden und so die einzelnen Geräusche enger aneinanderfügen. Hoffentlich hat es keine Toten gegeben bei dem Zusammenstoß. Ich glaube, er war sehr heftig.«
»Ja, der Lautstärke nach. Du könntest auch deine Platten überspielen und Radiosendungen.«
»Ja, das hab ich auch schon gemacht.«
»Anne, wir haben schon oft über damals gesprochen, über..., über das Unglück, besonders damals in der Klinik, als es uns nur mit Mühe gelang, die Polizei herauszuhalten. Ich würde gern morgen noch einmal mit dir über alles reden. Nein, nicht über alles, hab keine Angst. Nur über einen einzigen wichtigen Punkt, über das Aussehen der Männer. Bist du dazu bereit?«
»Aber ich hab dir doch alles gesagt, was ich weiß. Und auch, wie sie ungefähr aussahen.«
»Ja, und morgen werde ich sie dir beschreiben, ganz genau, und auch das Boot noch einmal. Meine Beschreibungen werden genauer sein als deine, und vielleicht erkennst du etwas wieder, was dir entfallen war.«
»Aber wie soll das gehen? Wie willst du sie mir beschreiben und dann noch genauer, als ich es konnte?«
»Ich werde dann das Boot vor mir haben. Und auch die Männer. Ich habe Aufnahmen gemacht. Ich war heute Morgen nicht nur wegen des Hundes unterwegs. Ich war fast drei Stunden am Ufer des Sees. Eine Schneise im Schilf. Ein Versteck.«
»Wenn es dieOdysseusist, die du fotografiert hast, sind es aller Wahrscheinlichkeit nach auch dieselben Männer.«
»Ja. DieOdysseus.Du weißt, dass ich sie schon seit einigen Wochen beobachte. Wir werden morgen sehen.«
»Aber was willst du mit ihnen machen?«
»Ich werde zu ihnen gehen. Ich werde sie zur Rechenschaft ziehen. Jeden einzeln.«
»Aber wie?«
»Sehr streng, Anne. Sehr.«
»Willst du sie anzeigen?«
»Das wäre viel zu gnädig. Zuerst einmal will ich ein Geständnis von allen. Und dann werden wir weitersehen. Über das, was dann geschieht, bin ich mir noch nicht schlüssig. Aber der Polizei übergebe ich sie nicht. Sie bekämen vier oder fünf Jahre, und das wäre eine lächerliche Strafe. Sie haben Geld, oder vielmehr ihre Väter haben Geld, sie könnten sich die besten Anwälte Deutschlands leisten, und am Ende würde man die armen Jungen noch bedauern. Diese Chance werde ich ihnen nicht geben.«
»Aber Vater, was könntest du mit ihnen machen? Was wäre strenger als vier oder fünf Jahre?«
»Ich weiß es noch nicht. Es ist noch Zeit genug, darüber nachzudenken. Und das lass ganz meine Sorge sein, Anne. Sie haben dein Leben zerstört, leichtsinnig, gewissenlos, brutal. Und meines dazu, aber das fällt nicht ins Gewicht. Sie sind Verbrecher, Anne. Nicht die üblichen. Sie sind keine Profis, die heute eine Bank ausrauben und morgen eine Geisel nehmen und übermorgen jemanden totschlagen für ein Kopfgeld. Aber sie sind nicht weniger gefährlich und auch nicht weniger zu verdammen. Alle drei sind junge Männer aus sogenannten guten Familien mit einem Hintergrund aus Wohlstand und Kultur, und dennoch konnten sie tun, was sie mit dir taten. Sie leben ohne jede Moral, haben kein Rückgrat. Sie sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Genüsse zu erweitern, sich Freude zu verschaffen, Lust, Wollust, ohne Rücksicht darauf, ob andere dafür bezahlen müssen. Sie sind Playboys, aber nicht vom gängigen Typ, der zwar auch ein Parasit der Gesellschaft ist, aber ungefährlich. Diese drei sind gefährlich. Sie sind kriminell. Sie sind Raubtiere. Was sie mit dem Geld ihrer Väter nicht bekommen können, nehmen sie sich mit Gewalt. Und das Schlimme ist, sie sehen so sauber aus, so angenehm, so bestechend, wenn sie mit den Jachten ihrer Väter unterwegs sind und womöglich französisch sprechen und über Bach Bescheid wissen. Sie haben das Flair von ganz edlen Jagdhunden und sind Hyänen. Entschuldige, Anne, aber ich gerate bei diesem Thema immer in die Diktion einer Anklageschrift. Du hilfst mir morgen, ja?«
»Ja, Vater.«
»Und ich helfe dir heute Nachmittag beim Herausschneiden deiner Geräuschpausen. Gleich wird es Mittagessen geben. Ich lasse dich jetzt noch ein bisschen allein, möchte duschen und mich frischmachen. Nachher essen wir zusammen.«
Bloom verließ das Zimmer seiner Tochter. Frau Bender war zurückgekehrt. Er sagte ihr, er wolle in einer halben Stunde mit Anne oben essen, so lange habe er noch zu tun. Er ging mit seinem Fotoapparat in die Dunkelkammer. Sie war der kleinste der Kellerräume; er hatte sie sich schon in einem seiner ersten Ehejahre, bald nach dem Hausbau, eingerichtet. Er machte sich daran, den Film zu entwickeln. Am Abend oder in der Nacht wollte er sich um die Abzüge kümmern. Während er das Fixierbad ansetzte, fielen ihm Annes Tonbandaufnahmen ein. Er dachte: Welch ein erbärmlicher Ersatz für die echten Jungmädchensensationen! Die Absicht hat etwas Verzweifeltes; teilnehmen wollen und ausgestattet sein mit dem geistigen Rüstzeug eines ersten Semesters und dann über den Erlebnisradius eines horchenden Tieres nicht hinausgelangen können. Wie ich euch hasse, euch drei! Anne ist blind, und ich bin blind vor Hass, und ich will auch blind sein vor Hass. Ich will euch jagen, und sei es über die ganze Welt, und euch stellen. Gnade euch Gott, wenn ich euch habe!
2
Seit dem Unglück seiner Tochter hatte Albert Bloom sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückgezogen. Die Gesellschaft hatte das akzeptiert, mit Bedauern, doch auch mit Verständnis. Wenn zwar der eine oder der andere seinem Wesen nach in gleicher Lage anders reagiert, vielleicht die Hilfe der Mitmenschen gerade gesucht hätte statt ihr auszuweichen, so wusste doch jeder, dass ein solches Unglück, wie es über die Blooms hereingebrochen war, die Geister scheidet und - je nach Charakter - Verhaltensweisen hervorruft, für die es keine Muster gibt und denen mit zwischenmenschlichen Spielregeln nicht mehr beizukommen ist. Die Gesellschaft, das waren im Falle Albert Blooms auf der einen Seite ein gutes Dutzend ihm mehr oder minder befreundeter Familien und auf der anderen seine beruflichen Partner. Blooms Entschluss, die Kontakte abzubrechen, hatte sie kaum überrascht, ja, hier und da war sogar die Bemerkung gefallen, dass es für ihn überhaupt keinen anderen Weg geben könne. Denn er galt als ein Mann, der zwar im Umgang mit anderen ein hohes Maß an Verbindlichkeit aufbrachte, der es auf der anderen Seite aber immer darauf abstellte, seine Kontakte im Peripheren zu belassen. Selten hatte Bloom anderen Menschen Zugang in die Welt seiner Empfindungen gewährt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!