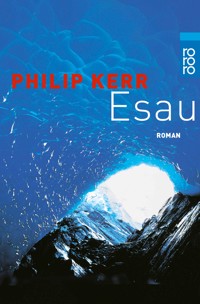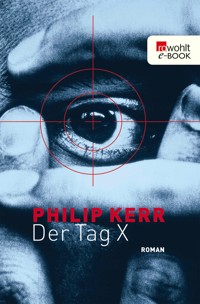
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Amerika 1960. Der Profikiller Tom Jefferson wird von der Mafia auf Fidel Castro angesetzt. Doch dann läuft die Sache völlig aus dem Ruder. Jefferson erhält ein Tonband, auf dem zu hören ist, wie sich seine Frau mit John F. Kennedy im Bett vergnügt. Kurz darauf ist sie tot – und Jefferson mit dem Geld der Mafia spurlos verschwunden. «Englands raffiniertester Thriller-Autor – ‹Der Tag X› liefert dafür den schlagenden Beweis.» (Sunday Times) «Ein glänzender, erfindungsreicher Thriller-Autor.» (Salman Rushdie)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philip Kerr
Der Tag X
Roman
Deutsch von Cornelia Holfelder-von der Tann
Für Robert Bookman
Ach, es sind des Haifischs Flossen
Rot, wenn dieser Blut vergießt!
Mackie Messer trägt ’nen Handschuh
Drauf man keine Untat liest.
Die Moritat von Mackie Messer
aus: Die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht
ERSTER TEIL
1
Im Reich der weißen Cäsaren
Helmut Gregor fürchtete den Klang seines richtigen Namens, wie andere den Namen ihres schlimmsten Feindes fürchten. Doch dank der großzügigen Hilfe seiner Familie und des immer noch florierenden Landguts in Günzberg, Bayern, führte er ein recht komfortables Leben in Buenos Aires.
Diese alte, aber attraktive Kapitale – völlig zu Recht «Stadt der guten Lüfte» genannt – besitzt viele prächtige Boulevards und ein exzellentes Opernhaus, und an diesem kühlen Julinachmittag im Jahr 1960 konnte sich der deutsche Arzt durchaus in seinem geliebten Wien wähnen, vor dem Krieg – ehe ihn die Kapitulation Deutschlands in dieses Dauerexil getrieben hatte. Fast zehn Jahre residierte er schon in einem ruhigen Landhaus in dem vorwiegend von Engländern bewohnten Vorort Temperley. Jedenfalls hatte er bis vor kurzem dort residiert. Nach dem, was Adolf Eichmann ereilt hatte, hielt Helmut Gregor es für sicherer, in die Innenstadt zu ziehen. Und bis er eine angemessene Wohnung im microcentro finden würde, wohnte er erst mal im noblen, modernen City Hotel.
Andere alte Kameraden waren, auf den Schock dieser tollkühnen Entführung hin – Eichmann war von israelischen Geheimdienstleuten aus seinem Haus in San Fernando gekidnappt und nach Jerusalem verschleppt worden–, über den Rio de la Plata nach Uruguay geflüchtet und in Montevideo untergetaucht. Der kaltblütigere Helmut Gregor hingegen hatte sich, angesichts der weltweiten Verurteilung dieser israelischen Völkerrechtsverletzung und der eventuell bevorstehenden Zwangsschließung der israelischen Botschaft in Buenos Aires – ganz abgesehen von der höchst befriedigenden Welle antisemitischer Ausschreitungen, zu der es infolge der illegalen israelischen Aktion in der Hauptstadt gekommen war – an den Fingern ausgerechnet, dass Buenos Aires jetzt die sicherste Stadt in ganz Südamerika war. Für ihn und seinesgleichen zumindest.
Es schien sehr unwahrscheinlich, dass Helmut Gregor das Gleiche passieren könnte wie Eichmann. Zumal ihm inzwischen Gesinnungsfreunde innerhalb der ultrarechten argentinischen Regierung Polizeischutz rund um die Uhr verschafft hatten. In Gregors Augen hatte es Eichmann – mit seinem Domizil mitten im Nichts und ohne die finanziellen Möglichkeiten, sich einen gewissen Schutz zu erkaufen – seinen israelischen Feinden leicht gemacht. Dennoch, das musste er zugeben, hatten die Juden die Operation mit einigem Geschick durchgeführt. Aber er glaubte nicht, dass sie die Absicht oder die Mittel hatten, ihn aus dem größten Hotel von Buenos Aires zu entführen.
Nicht, dass er den ganzen Tag auf seinem Zimmer gehockt hätte. Ganz und gar nicht. Wie Wien ist auch Buenos Aires eine Stadt zum Flanieren, und genau wie die österreichische Hauptstadt zeichnet es sich durch eine ganze Reihe hervorragender Kaffeehäuser aus. Also machte der deutsche Arzt jeden Nachmittag gegen drei Uhr, in Begleitung des melancholisch dunklen Polizisten, der sein Nachmittagsleibwächter war – und den Gregor, wären da nicht die durchdringend blauen Augen gewesen, eher als Zigeuner- denn als Spaniertypus bezeichnet hätte–, einen flotten Spaziergang zur Confiteria Ideal.
Mit ihrem kunstvollen Messingdekor, ihren Marmorsäulen und, spätnachmittags, einem Hammondorgelspieler, der ein Walzer- und Tangopotpourri zum Besten gab, schien die Confiteria Ideal, gleich bei der Avenida Corrientes, die bestmögliche Annäherung an die alte österreichische Gemütlichkeit. Wenn er seinen üblichen cortado doble getrunken und ein Stück köstlichen Schokoladenkuchen gegessen hatte und die kalten, dunklen Augen schloss, die seine Hände eine ganze malabolgía an Gräueln hatten verüben sehen, dann konnte der Doktor sich durchaus im Café Central in der Herrengasse wähnen, in Erwartung eines Abends in der Staatsoper oder im Burgtheater. Jedenfalls so lange, bis es Zeit zum Aufbruch war.
Als er und sein Leibwächter um die übliche Zeit, sprich Viertel vor fünf, ihre Mäntel nahmen und das Café Ideal verließen, wäre Helmut Gregor nie auf die Idee gekommen, dass er in irgendeiner Weise schlimmer dran sein könnte als Adolf Eichmann. Und doch war es so. Es sollte noch dreiundzwanzig Monate dauern, bis Eichmann im Ramleh-Gefängnis vor seinen Henker treten würde. Für den Doktor hingegen war die Stunde des Gerichts bereits da. Noch während er das Ideal verließ, ging ein Kellner, der – wie so viele Menschen in Buenos Aires– Jude war und das generöse Trinkgeld des Doktors ignoriert hatte, ans Telefon und rief im Hotel Continental an.
«Sylvia? Ich bin’s. Moloch ist unterwegs.»
Sylvia legte den Hörer des Zimmerapparats auf und nickte dem langen Amerikaner zu, der auf dem breiten Bett lag. Er warf den neuen Ian Fleming, in dem er gerade gelesen hatte, beiseite, drückte seine Zigarette aus, kletterte auf den mächtigen Mahagoni-Kleiderschrank und legte sich bäuchlings darauf. Sylvia fand dieses Verhalten keineswegs exzentrisch. Sie bewunderte ihn vielmehr wegen der effizienten, professionellen Art, wie er seine Aufgabe anging. Bewunderte und fürchtete ihn zugleich.
Das Continental an der Avenida Roque Saenz Pena war ein Gebäude im klassisch-italienischen Stil, aber den Amerikaner erinnerte es vor allem an das Flatiron Building in New York. Der Raum war ein Eckzimmer im fünften Stock, und durch das offene, hohe Fenster überblickte er die Straße bis zur Ecke Suipacha in hundertfünfzig Meter Entfernung. Der Schrank knarrte ein bisschen, als er sich zur Winchester vorbeugte, die bereits sorgfältig zwischen ein paar Kissen postiert war. Er hatte es noch nie leiden können, einfach einen Gewehrlauf aus einem offenen Fenster zu stecken, bevorzugte vielmehr die relative Anonymität einer improvisierten Scharfschützenstellung innerhalb der jeweiligen Räumlichkeit. Der um etwa zwei Meter von der Wand abgerückte Schrank lieferte ihm das perfekte urbane Schützenversteck, machte ihn von der Straße und dem gegenüber liegenden Bürogebäude aus praktisch unsichtbar. Das einzige Problem war jetzt noch der ungedämpfte Knall des Gewehrs, Kaliber .30, sobald er abdrückte.
Doch auch das war hoffentlich gelöst: Sylvia gestikulierte bereits zu einem auf der anderen Straßenseite parkenden Wagen hinüber. Der schwarze DeSoto, ein in Buenos Aires sehr beliebter Wagentyp, war alt und ramponiert und neigte zu Fehlzündungen, und nur wenige Sekunden später ertönte tatsächlich ein Knall, so laut wie jeder Büchsenschuss, und die Möwen und Tauben auf der Fensterbank stoben auseinander wie eine Hand voll Riesenkonfetti.
Keine besonders raffinierte List, dachte der Amerikaner, aber besser als nichts. Und außerdem war Buenos Aires nicht wie seine Heimatstadt Miami, wo die Einheimischen nicht recht an das Knallen von Feuerwerkskörpern oder Schusswaffen gewöhnt waren. Hier gab es so viele Feiertage, die alle lautstark mit Krachern und Startschusspistolen gefeiert wurden, ganz abgesehen von dieser komischen Revolution. Es war erst fünf Jahre her, dass die argentinische Luftwaffe im Zuge des Militärputsches gegen Perón den wichtigsten Platz der Stadt beschossen hatte. Laute Knallereien und Explosionen waren in Buenos Aires Teil des Lebens. Und manchmal auch des Sterbens.
Sylvia nahm einen Feldstecher und lehnte sich, direkt unterhalb des Gewehrlaufs, an den Kleiderschrank. Das Fernglas, das stärker war als das 8×-Unertl-Zielfernrohr auf der Winchester des Amerikaners, sollte sicherstellen, dass unter all den Passanten auf diesem Stück Roque Saenz Pena die Zielperson korrekt ausgemacht wurde und die Trefferwirkung überprüfbar war.
Sylvia sah gerade auf ihre Armbanduhr, als der DeSoto draußen auf der Straße eine weitere Fehlzündung produzierte. Trotz der Watte in Sylvias Ohren, die verhindern sollte, dass sie einen Gehörschaden erlitt, wenn der Amerikaner abdrückte, klang der Knall, dank des Halleffekts der hohen Gebäude an der Cangallo und der Roque, eher wie eine Bombenexplosion.
Als er eine stabile Liegeposition gefunden hatte, umspannte der Amerikaner mit der Nichtschusshand den Gewehrkolben und presste ihn sich fest an die Schulter. Dann umfasste er das Griffstück, steckte den Zeigefinger durch den Abzugbügel und legte die Wange an die glatte Schäftung. Jetzt erst prüfte er die Sicht durch das Zielfernrohr. Dieses war schon justiert, dank eines mühseligen Trips von zweimal hundertfünfundsiebzig Meilen ins Tal des Río Azul, wo der Amerikaner am letzten Wochenende mehrere Wildziegen geschossen hatte. Doch selbst mit einem korrekt eingeschossenen Gewehr würde dieses Ziel sicher schwerer zu treffen sein als eine Ziege. Es herrschte einiger Verkehr auf der Roque Saenz Pena und der Einmündung der Cangallo, vom Ablenkungseffekt der unberechenbaren Winde in diesem alten Seehafen mal ganz abgesehen.
Wie um die Problematik des Präzisionsschießens in einer urbanen Umgebung zu illustrieren, versperrte ihm ein colectivo – einer der roten Mercedes-Busse, die hier das öffentliche Verkehrsmittel waren – die Sicht, als er gerade übungshalber das Fadenkreuz auf den breitkrempigen Hut eines alten porteño ausgerichtet hatte.
«Moloch müsste jetzt jeden Moment in Sicht kommen», sagte Sylvia laut, da der Amerikaner sich ebenfalls die Ohren verstopft hatte.
Der Amerikaner sagte nichts, da er sich bereits auf seinen Atemzyklus konzentrierte: Man hatte ihm beigebracht, normal auszuatmen und dann den Atem für einen Sekundenbruchteil anzuhalten, ehe er abdrückte. Er zweifelte nicht daran, dass Sylvia die Zielperson korrekt identifizieren würde, wenn sie in Sicht kam. Wie alle im Shin-Beth-Team hier in Buenos Aires kannte sie Molochs Gesicht fast so gut wie das von Eichmann. Und wenn der Amerikaner Bedenken hatte, dann deshalb, weil er, was die Feststellung der Trefferwirkung betraf, auf eine Person angewiesen war, die noch nie mit angesehen hatte, wie jemand kaltblütig erschossen wurde.
Wegen des Rückschlags konnte ein Gewehrschütze grundsätzlich nicht sehen, ob er seinen Mann getroffen hatte. Schon gar nicht jedoch, wenn die Zielperson über hundert Meter entfernt und noch dazu in einer Menschenmenge stand. Auf diese Entfernung brauchte der Schütze einen Beobachter, so wie ein Pitcher einen Schiedsrichter hinter der Homebase braucht, der Fehlwürfe und Fehlschläge ausruft. Die geringste Zimperlichkeit ihrerseits, und sie liefen Gefahr, die Gelegenheit zu einem zweiten Schuss zu verpassen. Treffer festzustellen war leicht; Fehlschüsse – die auch dem besten Schützen unterlaufen konnten – auszumachen und zu beschreiben, wo die Kugel hingegangen war, das war der schwierigere Teil.
Der Amerikaner bildete sich nichts auf seine professionellen Fähigkeiten ein, er konstatierte lediglich, dass er ein hohes Honorar für seine Dienste fordern konnte. Es war keine Branche, in der man sich rühmen konnte, der Beste zu sein. Oder wo andere einen offiziell als den Besten rühmen konnten. Außerdem scheute er diese Art Renommee ebenso wie Großtuerei. In seinen Augen waren Diskretion und Zuverlässigkeit die Hauptgrundlagen seiner Art von Existenz, und je weniger Leute wussten, was er machte und wie gut er es machte, desto besser. Der wichtigste Teil des Jobs war, ungeschoren davonzukommen, und das erforderte jenes stille, unprätentiöse, unauffällige Vorgehen, dessen nur extrem zurückhaltende Menschen fähig waren. In all dem hielt er sich jedoch keineswegs für einen außergewöhnlichen Vertreter seines Berufszweigs. Er wusste, dort draußen waren noch andere Präzisionsschützen– Sarti, Nicoli, David, Nicoletti, um nur ein paar zu nennen–, aber außer den Namen wusste er kaum etwas über sie, was ihm sagte, dass sie ebenso bestrebt waren, sich im Hintergrund zu halten, wie er. Sein Name war Tom Jefferson.
Eines allerdings, das wusste er, war an seiner Situation außergewöhnlich: dass er verheiratet war und noch dazu mit einer Frau, die genau wusste, womit er seinen Lebensunterhalt verdiente. Die wusste, was er machte, und die es billigte.
Mary hatte Tom zum Lake Tahoe begleitet, wo der Kontrakt ausgehandelt werden sollte. So war es jedenfalls geplant; als sie endlich am Lake Tahoe waren, kam es ein wenig anders.
Sie flogen, auf Einladung eines gewissen Irving Davidson, mit der Bonanza Air von Miami nach Reno und fuhren von dort mit dem Auto zur Cal-Neva Lodge an der Crystal Bay am Nordufer des Sees. Mary, chinesischstämmig, aber in der Karibik geboren, war noch nie am Lake Tahoe gewesen, hatte jedoch die Cal-Neva-Illustriertenanzeigen («ein himmlischer Ort in der Hochwüste») gesehen und gelesen, dass Teile der Urlaubsanlage Frank Sinatra und Peter Lawford gehörten und dass Marilyn Monroe dort ebenso häufig weilte wie Mitglieder des Kennedy-Clans. Mary, die die Kennedys ebenso interessierten wie die von ihr verehrte Monroe, brannte darauf, an einem so glamourösen Ort zu sein.
Und sie fand Gefallen an diesem Ort, sobald sie ihn sah. Oder besser, sobald sie Joe DiMaggio und Jimmy Durante im Indian Room einen Drink nehmen sah. Doch für Tom hatte dieses Cal-Neva etwas Unangenehmes. Eine bestimmte Atmosphäre. Etwas diffus Korruptes. Vielleicht, weil die Unternehmensphilosophie dieser Anlage zu lauten schien, dass man für Geld alles haben konnte. Oder aber es rührte daher, dass das Ganze von einem reichen Geschäftsmann aus San Francisco zu dem erklärten Zweck erbaut worden war, die kalifornischen Gesetze zu umgehen. Auf der Staatsgrenze zwischen Kalifornien und Nevada gelegen, bestand die Anlage aus einer zentralen, rustikalen Lodge mit einem gigantischen offenen Kamin, einer Reihe luxuriöser Chalets und einem Casino, das wegen des kalifornischen Glücksspielverbots auf der Nevada-Seite der Grenze lag. Die Grenze verlief mitten durch den Swimmingpool, was es den Pool-Benutzern gestattete, von einem Staat in den anderen zu schwimmen. Tom war froh, als sich herausstellte, dass er nur eine Nacht hier verbringen musste.
Schon bald nach ihrer Ankunft erwies sich nämlich, dass ihr Gast- und Toms potenzieller Auftraggeber nicht kommen konnte. Per Anruf in dem diskreten Chalet, wo sich Tom und Mary gemeinsam in der großen Massagewanne entspannten, erläuterte Irving Davidson die Situation.
«Tom? Ich darf Sie doch Tom nennen? Ich fürchte, gewisse Geschäfte halten mich noch eine Weile hier in Las Vegas fest. Hören Sie, es tut mir sehr Leid, aber ich werde nicht zu Ihnen raufkommen können. Unter diesen Umständen, für die ich mich noch mal ausdrücklich bei Ihnen entschuldige, Tom, wollte ich Sie fragen, ob ich Ihre Zeit und Geduld vielleicht noch ein wenig weiter strapazieren könnte. Ob es Ihnen etwas ausmachen würde, herzukommen und mich und meine Geschäftspartner hier in Vegas zu treffen. Das sind etwa vierhundertfünfzig Meilen, immer den Highway 95 runter. Sie könnten gleich nach dem Frühstück losfahren und am späten Nachmittag hier sein. Es ist eine nette Fahrt. Vor allem, wenn man sie in einem netten Wagen macht. Da Sie aus Miami sind, Tom, wette ich, Sie fahren ein Cabrio. Habe ich recht?»
«Einen Chevy Bel Air», bestätigte Tom.
«Das ist ein netter Wagen», sagte Davidson. «Aber solange Sie in Nevada sind, steht Ihnen ein Dual-Ghia zur Verfügung, Tom. Das ist eine echte Schönheit von einem Wagen. Und der besondere Kick – er gehört Frank Sinatra. Wie klingt das? Und wenn Sie in Vegas sind, können Sie in Franks Suite hier im Sands übernachten. Ist alles geregelt. Was sagen Sie, Tom?»
Tom, der sich nie viel aus Sinatras Songs gemacht hatte, schwieg einen Moment. Er ahnte, dass die Suite für ihn allein gedacht war. «Und meine Frau?», fragte er.
«Die soll sich amüsieren, wo sie ist. Hören Sie, sie hat dort doch alles, was sie braucht. Eine Fahrt durch die Wüste, mit offenem Verdeck, das ist doch nichts für sie. Nichts für ihr Haar. Und ihren Teint. In der Lodge ist ein ziemlich guter Schönheitssalon. Ich habe ihr dort einen ganzen Vormittag gebucht. Und ich habe veranlasst, dass sie Chips im Wert von fünfhundert Dollar für das Casino bekommt. Wenn sie sonst noch was braucht, soll sie einfach nur zum Telefon greifen, und Skinny arrangiert es für sie. Skinny D’Amato, Sie wissen doch, der Direktor? Er weiß, dass Sie und Mary ganz spezielle Gäste von mir sind. Ich glaube, morgen treffen auch ein paar prominente Gäste ein. Eddie Fisher und Dean Martin. Wenn sie möchte, kann ich dafür sorgen, dass Skinny sie mit denen bekannt macht. Also, was sagen Sie, Tom?»
«Okay, Mr.Davidson. Ist Ihre Party.»
Früh am nächsten Morgen ließ Tom eine bei der Vorstellung, Dean Martin kennen zu lernen, überaus aufgeregte Mary zurück und fuhr, wie ihm geheißen, Sinatras teures Cabrio nach Vegas. Unterwegs hörte er einen Country-Music-Sender, und als er ankam, hatte er das Gefühl, bestimmt ein Dutzend Mal Hank Locklin mit «Please Help Me I’m Falling» gehört zu haben. Tom bevorzugte Jim Reeves. Nicht nur wegen dessen neuester Platte «He’ll Have to Go», sondern auch, weil er sich manchmal einbildete, wie eine jüngere, schlankere Ausgabe des Sängers auszusehen.
Es war etwa fünf Uhr, als er vom Highway 95 auf den Las Vegas Boulevard abbog und den Strip vor sich sah – ein Bild, bei dem jedem Illustrierten-Bildredakteur warm ums Herz geworden wäre. Er meldete sich an der Rezeption des Sands und ging dann hinauf in eine Suite, so groß wie der Fuller-Dome. Auf dem Resopal-Nierentisch erwarteten ihn ein gigantischer Obstkorb, eine Flasche Bourbon und eine Karte mit der Einladung, sich um zehn auf einen Drink in Davidsons Suite einzufinden. Also legte er sich aufs Bett und döste ein wenig, nahm dann ein Bad, aß eine Banane, zog sich ein frisches Hemd an und spazierte eine Weile auf dem Strip herum.
Tom spielte nicht. Nicht mal an Automaten. Tom hatte wenig Sinn für den alten Las-Vegas-Spruch, je mehr man setze, desto weniger verliere man, wenn man gewinne. Aber es gefiel ihm, die barbusigen Mädchen zu betrachten, die der Strip reichlich bot. Die Lido-Show im schicken Café Continental des Stardust war gut, ebenso die Ice-cubettes in der Ecstasy on Ice Revue im Thunderbird. Er sah gern Busen, auch in großen Mengen, aber am allerliebsten sah er Weiberärsche, und dafür musste man in Harold Minskys Harem-Hauptquartier im Dunes gehen, wo mehr nacktes Fleisch zu besichtigen war als in irgendeiner anderen Show in Vegas. Ein Haufen Gewinnchips auf einem Craps-Tisch war nichts gegen einen ordentlichen Weiberarsch in einem Flitter-G-String. Als er genug gesehen hatte, ging er ins Hotel zurück, duschte erneut und klopfte dann an Davidsons Tür.
Davidson öffnete ihm höchstpersönlich.
«Tom, kommen Sie rein.» Er war ein geschmeidiger, elegant gekleideter kleiner George-Raft-Typ, mit der gewandten Art eines Politikers. «Bitte sehr, darf ich Sie mit den Herren bekannt machen.»
Drei Männer erhoben sich von einem Pseudoleopardenfellsofa, das sich die rauen Steinwände der Luxus-Suite entlangschwang. Die Vorhänge des kinoleinwandgroßen Fensters waren zugezogen, als wäre Vertraulichkeit oberstes Gebot.
«Morris Dalitz, Lewis Rosenstiel und Efraim Ilani. Meine Herren, das ist Tom Jefferson.»
Schon vor der allgemeinen Begrüßung hatte Tom erraten, dass er der einzige Nichtjude im Raum war.
«Sehr erfreut, Tom», sagte Morris Dalitz.
Das war der einzige Name, der Tom etwas sagte. Der massige Mann mit dem fleischigen, großnasigen Gesicht – eine Art gröbere Version von Adlai Stevenson–, der jetzt über den hochflorigen Teppich auf Tom zukam, um ihm die Hand zu drücken, war Moe Dalitz, der Pate von Las Vegas. Jedenfalls hatte das der Kefauver-Ausschuss vor ein paar Jahren behauptet. Zu Rosenstiel konnte Tom – nachdem er beim Händedruck einen extravaganten Diamantmanschettenknopf hatte aufblitzen sehen – nur vermerken, dass er reich aussah. Wie man in Las Vegas eben aussah. Der dritte Mann, Ilani, der ein schlichtes, weißes, kurzärmliges Hemd und offene Sandalen trug und so arm wirkte wie Rosenstiel reich, zündete sich lediglich eine Zigarette an und nickte.
Die ersten Minuten machte vor allem Davidson Konversation. Das schien seine Spezialität zu sein.
«Einen Drink, Tom? Wir trinken alle Martini.»
Tom bemerkte, dass «alle» Ilani nicht einschloss, denn der trank Eiswasser.
«Danke, ich nehme einfach nur eine Coke.»
«Klaren Kopf behalten, wenn’s um Geschäfte geht, was? Das gefällt mir. Ist die einzige Möglichkeit, in dieser Stadt zu überleben.» Davidson bereitete den Erfrischungsdrink eigenhändig an einem Barwägelchen, das die Form einer Flugzeugtragfläche hatte, und reichte das Glas mit so großer Geste herüber, dass Tom ihn als jemanden einstufte, der nicht oft Drinks mixte. «Suite okay?»
«Sobald ich sie ganz besichtigt habe, sag ich’s Ihnen.»
Davidson lächelte. «Und die Fahrt vom Lake Tahoe hier runter?»
«Start und Landung waren okay.»
«Netter Wagen, der Dual-Ghia.»
«Ja, ist ein feines Auto», stimmte ihm Tom zu. «Sehr angenehm. Wie der Besitzer, schätze ich mal.»
«Ist das ein amerikanisches Modell?», fragte Rosenstiel.
«Das ist ein verflixter Chrysler», erklärte ihm Moe Dalitz.
«Ach? Klingt eher italienisch», sagte Rosenstiel.
«Sinatra hat einen», sagte Davidson. «Und Peter Lawford auch. Seinen hat Tom für uns hier runtergefahren.»
Tom lächelte stumm und fragte sich, welchem der beiden Stars der Wagen wirklich gehörte, wenn überhaupt. Nicht, dass es ihm wichtig gewesen wäre.
«Hey», sagte er, setzte sich aufs Sofa und trank von seiner Coke, «von mir aus kann Elizabeth Taylor nackt in dem Wagen quer durch die Staaten gefahren sein, ohne hinterher den Sitz abgewischt zu haben. Ich bin hier, reden wir also übers Geschäft.»
«Aber gewiss doch», sagte Davidson gewandt. «Wir sind ja alle Geschäftsleute. Wir vier, so wie wir hier sitzen, repräsentieren eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, Tom. Aber wenn Morris, Lewis und ich uns hier mit Ihnen besprechen, so tun wir das in unserer Eigenschaft als Mitglieder der Amerikanisch-jüdischen Liga gegen den Kommunismus. Und in dem Bestreben, Mr.Ilani zu helfen. In dieser speziellen Angelegenheit geht es allerdings nicht um Kommunisten, sondern um Faschisten.»
«Mal was anderes», schmunzelte Dalitz.
«Mr.Ilani ist mit dem Aufspüren und Bestrafen von Nazi-Kriegsverbrechern befasst. Ich nehme an, Sie haben das mit Adolf Eichmann mitgekriegt, Tom.»
«Ich lese Zeitung.»
«Seit Premierminister Ben Gurion dem israelischen Parlament erklärt hat, dass Eichmann sich in israelischem Gewahrsam befindet, hat Israel in der internationalen Gemeinschaft einen schweren Stand. Ganz abgesehen von den schweren diplomatischen Spannungen, die derzeit zwischen Israel und Argentinien bestehen. Wegen dieser ganzen Sache musste Mr.Ilani ein unerledigtes Geschäft in Buenos Aires zurücklassen. Jemanden, den er gern in Israel gesehen hätte, auf der Anklagebank, neben diesem Schwein von Eichmann. Aber leider können Mr.Ilani und seine Leute aus einleuchtenden Gründen nicht dorthin zurück.»
Tom sah verstohlen zu Ilani hinüber. Mit seiner blassen Haut, seinem behaarten Körper und der dicken Brille wirkte Ilani eher wie der Präsident der örtlichen Handelskammer denn wie ein Shin-Beth- oder Mossad-Mann.
«Jedenfalls nicht jetzt. Und vielleicht noch eine ganze Weile nicht. Also wäre die nächstbeste Lösung die, diesen zweiten Mann, der ebenfalls ein großer Kriegsverbrecher ist, direkt zur Rechenschaft zu ziehen und seiner gerechten Strafe zuzuführen, ohne öffentlichen Gerichtsprozess, wie es das israelische Volk natürlich vorziehen würde.»
«Mit anderen Worten», ergänzte Moe Dalitz, «wir wollen dieses Nazischwein abgeknallt haben.»
Tom nickte langsam. Und richtete seine nächsten Worte an Ilani.
«Ich hatte mal einen englischen Freund», sagte er. «Einen britischen Armeeoffizier, der in Jerusalem stationiert war. Das war vor zwölf Jahren. Achtundvierzig. Na, jedenfalls, dieser Freund kam ums Leben. Durch einen Kopfschuss aus einer Mannlicher Carcano 6,5Millimeter, auf achthundert Meter.» Tom schürzte die Lippen und zog die Brauen hoch. «Mitten in die Stirn, auf achthundert Meter», wiederholte er. «Meisterschuss.»
«Wollen Sie damit sagen, Sie möchten diesen Auftrag nicht übernehmen, Mr.Jefferson?» Das war Ilani. In Toms Ohren klang sein Akzent eher spanisch als hebräisch. «Sie haben etwas gegen den Staat Israel, ja?»
«Ich hab nichts für und nichts gegen den Staat Israel. Was ich sagen will, Mr.Ilani, ist, dass Sie dort ganz schön treffsichere Scharfschützen haben. Ich verstehe nicht, wieso Sie meine Dienste brauchen.»
«Angesichts des prekären Verhältnisses zwischen Israel und Argentinien», erklärte Davidson, «wäre es das Beste, einen außenstehenden Profi damit zu betrauen. Jemanden, der kein Jude ist. Unsere Information ist doch korrekt, Tom? Sie sind doch kein Jude, oder?»
«Ich? Du liebe Güte, nein. Ich bin römisch-katholisch. Jedenfalls steht das in meiner Militärakte. Ist allerdings eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal eine Kirche betreten habe. Gott und ich, wir reden schon lange nicht mehr miteinander. Ein Berufsrisiko, könnte man sagen.»
«Ich habe sie gelesen», sagte Ilani. «Ihre Militärakte. U.S.Marine Corps. Sie sprechen mehrere Sprachen, darunter auch Spanisch. Waren auf Guadalcanal dabei, auf Okinawa. Bei Ende des Zweiten Weltkriegs im Rang eines Gunnery Sergeant, mit dreiundzwanzig erfolgreichen Einsätzen. Von siebenundvierzig bis neunundvierzig den Vereinten Nationen unterstellt und Angehöriger der US-Streitkräfte in Korea, als nordkoreanische Truppen über den achtunddreißigsten Breitengrad vordrangen. Im Januar dreiundfünfzig am Pork Chop Hill in Gefangenschaft geraten. Im August repatriiert. Ehrenhaft entlassen. Mehrere Auszeichnungen et cetera, et cetera. Sehr beeindruckend.»
«Sie sind auch nicht ohne, Mr.Ilani», sagte Tom lächelnd. «All diese Informationen im Kopf, nicht mal ein Zettelchen auf dem Tisch. Ein richtiger Charles Van Doren, Sir. Ich wette, Sie könnten über jeden in diesem verflixten Zimmer einundzwanzig Fragen beantworten.»
Moe Dalitz, der aufgestanden war, um sich einen weiteren Drink zu machen, schnaubte vernehmlich. «Mir egal, wie viele Fragen es sind, solange nicht Bobby Kennedy derjenige ist, der sie stellt.»
Rosenstiel lachte schallend und zündete sich eine dicke Zigarre an. «Vielleicht sollten wir Tom bitten, Bobby auch gleich zu erledigen», sagte er. «Zwei Ratten zum Preis von einer.»
Tom zündete sich eine Chesterfield an und ließ die Runde ein Weilchen in dieser Richtung weiterschwadronieren, ehe er das Gespräch wieder auf den Auftrag zurücklenkte, um den es ging.
«Sie sagen, der Mann in Buenos Aires ist ein Nazi-Kriegsverbrecher. Wie heißt er und was hat er getan?»
«Dr.Helmut Gregor», antwortete Ilani. Er zog den Reißverschluss einer billigen Plastikmappe auf, nahm eine Akte heraus und reichte sie Tom. «Unter diesem Namen lebt er jetzt. Alles, was Sie über ihn wissen müssen, finden Sie in diesem Dossier. Ich fürchte, ich bin nicht befugt, Ihnen seinen richtigen Namen mitzuteilen. Aber es ist ohnehin so, dass nur wenige Leute je von diesem Mann gehört haben. Es mag genügen, dass er Tausende von Menschen gefoltert und umgebracht hat, vor allem Kinder.»
«Nicht mal wir kennen seinen richtigen Namen, Tom», sagte Davidson.
«Wird die argentinische Regierung nicht vermuten, dass Israel hinter dieser Operation steckt?», fragte Tom.
Ilani zuckte die Achseln.
«Da die argentinische Regierung leugnet, dass sich dieser Mann überhaupt in ihrem Land befindet», sagte er, «wird sie wohl kaum an die große Glocke hängen wollen, dass er sehr wohl dort war, indem sie sich über seine Ermordung beschwert. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sie die ganze Sache unter den Teppich kehren. Was von Vorteil für Sie ist, Mr.Jefferson. Es sollte Ihnen möglich sein, das Land ohne große Probleme zu verlassen. Angenommen, Sie übernehmen den Auftrag, wird Ihnen natürlich ein Team von argentinischen Juden vor Ort helfen. Sie halten Gregor seit Eichmanns Festnahme unter ständiger Beobachtung. Sie werden Ihnen alles beschaffen, was Sie dort brauchen. Ein geeignetes Gewehr, ein Fahrzeug, ein Hotelzimmer. Ich werde Ihnen mit Hilfe der Amerikanisch-jüdischen Liga gegen den Kommunismus einen US-Pass und eine geeignete Legende bereitstellen.»
«Und ein Visum?»
«US-Staatsbürger dürfen mit einem Reisepass einreisen, ohne spezielles Visum.»
«Sie reisen als Bill Casper, Coca-Cola-Repräsentant aus Atlanta», erklärte Davidson. «Zufällig bin ich registrierter Lobbyist, unter anderem für Coca-Cola. Ich habe hohe Limo-Tiere auf Missionen in aller Welt begleitet, unter anderem auch den echten Mr.Casper. Der übrigens gerade in Brasilien Urlaub macht. Die Thermalquellen im südlichen Minas Gerais genießt. Sie kommen in BA an, verteilen ein bisschen Coke, machen Ihren Job, peng, und fliegen wieder nach Hause.» Er zuckte die Achseln, als wollte er sagen, da sei doch wirklich nichts dabei.
Tom nickte und verkniff sich ein Grinsen, als sich diese Bilder in seinem Kopf verbanden: Mach mal peng, trink Coca-Cola – das erfrischt mörderisch. Vielleicht konnte ja irgendein Madison-Avenue-Fritze da eine Werbekampagne draus machen. Nur Ilani war schlau genug, die Realitäten zur Sprache zu bringen.
«So leicht wird es natürlich nicht sein», sagte er. «Sonst…»
Tom ließ jetzt dem Grinsen freien Lauf, froh, dass wenigstens jemand die Existenz einiger potenzieller Probleme anerkannte.
«Sonst», sagte Tom, «wären Sie nicht bereit, mir fünfundzwanzigtausend Dollar zu zahlen.»
«Verdammt wahr», sagte Rosenstiel.
Tom fragte sich, ob Rosenstiel derjenige war, der das Geld für den Auftrag hinlegte. Inzwischen waren es nicht mehr nur die Diamantmanschettenknöpfe, die Tom sagten, dass er stinkreich war. Hinzugekommen waren das Duoppioni-Etikett auf dem Innenfutter seines Seidenjacketts, die italienischen Slipper, die Rolex und das goldene Dunhill-Feuerzeug.
«Seit Eichmanns Festnahme wird Gregor gut bewacht», sagte Ilani. «Er hat ein paar mächtige Freunde beim Militärregime, hohe Tiere, die er mit hohen Geldsummen bestochen hat.»
«Wo wir gerade bei diesem Thema sind», sagte Tom. «Zu meinen Bedingungen gehört: die Hälfte des Honorars im Voraus, bar.»
«Kein Problem», sagte Moe Dalitz.
«Dann sind wir uns einig», sagte Tom. Es war nicht Rosenstiel. Das Casino legte das Geld für den Auftrag hin. Auch gut. Sie würden ihn vermutlich beim Roulette gewinnen lassen oder so was. Solange sie nicht erwarteten, dass er sich das Geld aus einem Spielautomaten holte.
Er reichte Davidson ein Blatt Papier.
«Meine Bank ist Maduro & Curiel in Curaçao», sagte er. «Da stehen die Telegraphenadresse und meine Kontonummer. Wenn die Leistung erbracht ist, lasse ich Sie’s telefonisch wissen, damit Sie das Resthonorar überweisen können.»
«Eins noch», sagte Ilani. «Uns wäre es am liebsten, wenn Sie gleich nach Ihrer Heimkehr nach Argentinien fliegen könnten.» Er reichte Tom ein Flugticket. «Diesen Freitag geht ein Braniff-Flug von Miami nach Buenos Aires. Wir möchten, dass Sie ihn nehmen. Es wäre möglich, dass Gregor ganz abtaucht.»
«Verstehe», sagte Tom. «Ich kann den Flug kriegen. Aber kriegen Sie denn bis dahin den Pass?»
«Den haben Sie morgen früh», versicherte Ilani.
«Dann wäre da nur noch die Anzahlung.»
«Aber gewiss doch», sagte Dalitz. «Schon mal Keno gespielt, Tom?»
«Ich hab’s mehr mit Golf als mit Glücksspiel.»
«Keno war die staatliche Lotterie im alten China. Von den Einnahmen wurde unter anderem die chinesische Mauer erbaut. Woraus Sie wohl entnehmen können, dass der Anteil des Hauses dabei größer ist als bei irgendeinem anderen Casinospiel. In Disneyland gewinnt man vielleicht beim Keno, aber überall sonst läuft es auf die althergebrachte Tour. Keine Ahnung, warum, aber es ist das beliebteste Spiel im ganzen Laden. Vegas liebt Gewinner, Tom. Und heute Abend, mein Freund, sind Sie einer.»
Moe Dalitz gab Tom ein Keno-Formular. Es war horizontal in zwei Rechtecke unterteilt. In der oberen Hälfte standen die Zahlen 1 bis 40, in der unteren die von 41 bis 80.Fünfzehn Zahlen waren bereits mit einem dicken schwarzen Stift markiert, und in der rechten oberen Ecke des Formulars stand der Preis für den Spielschein: einhundert Dollar.
«Geben Sie das am Schalter in der Keno-Lounge ab», erklärte ihm Dalitz. «Zahlen Sie den Einsatz. Die Dame gibt Ihnen einen Spielschein mit der Nummer des Spiels, das Sie spielen. Dann beobachten Sie das Keno-Board. Wenn zwanzig Zahlen erschienen sind, geben Sie Ihren Schein ab und nehmen Ihr Geld in Empfang. Aber hängen Sie nicht bis zum nächsten Spiel rum, sonst verspielen Sie alles wieder. Die ganzen dreizehn Riesen.»
Dalitz prostete Tom freundlich grinsend zu und sagte: «Gratuliere. Sie verlassen Vegas mit einem kleinen Vermögen. Dafür müssen die meisten Leute mit einem großen hier ankommen.»
Es war das erste Mal, dass Tom Keno spielte. Und da der ganze Schwindel so problemlos lief, dachte er, dass es wohl auch das letzte Mal war. Diese ganze Erfahrung bestätigte Tom nur in seiner Meinung, dass Glück etwas war, woran nur arme Trottel glaubten. Wie Gott. Und Gerechtigkeit. Vielleicht gab es ja Leute, die in dem, was Helmut Gregor bevorstand, eine Art gerechter Vergeltung sehen würden. Aber Tom gehörte nicht zu diesen Leuten. Er machte sich keine Illusionen, sein Tun betreffend. So abscheulich die Verbrechen dieses Mannes auch sein mochten, das hier war schlichter Mord. Und schlichter Mord war das, worin Tom gut war. So wie andere im Baseballwerfen oder Saxophonspielen. Vielleicht nicht gerade das großartigste Talent, aber eins, von dem man gut leben konnte. Tom hätte Walt Disney eine Kugel durch den Kopf gejagt, wenn ihm dafür jemand fünfundzwanzig Riesen geboten hätte.
Für beträchtlich mehr – volle zweihundertfünfzigtausend Dollar, um genau zu sein – hatte ein Konsortium verbitterter Kubaner, erbost über Eisenhowers mangelnden Einsatz für ihren mittlerweile ins Exil getriebenen Präsidenten Fulgencio Batista, Tom im März dafür gedungen, Ike bei dessen Staatsbesuch in Brasilien umzubringen. Hätten es die Kubaner geschafft, auf freiem Fuß zu bleiben – sie saßen jetzt allesamt auf der berüchtigten Gefängnisinsel Isle of Pines – und auch nur die Hälfte des Geldes aufzubringen, dann hätte das ein leichter Job sein können: in der Wochenschau hatte er Ike in Rio die ganze lange Avenida Rio Branco entlangfahren sehen, auf der Heckablage einer offenen Limousine sitzend, damit ihn die Papierschlangen werfende Menge besser sehen konnte. Eine seltene Gelegenheit. Der Wagen war mit nur acht Meilen pro Stunde dahingerollt. Normalerweise waren amerikanische Präsidenten nicht so leicht zu erwischen.
«Moloch. Da ist er», meldete Sylvia. Das Glücksbringerarmband an ihrem Handgelenk klimperte laut, während sie aufgeregt auf und ab wippte.
Ihr Duft drang in seine Nase. Nett. Besser als der Pulvergestank, der ihm folgen würde.
«Ich seh ihn.»
Toms Stimme klang ruhig, ja, sogar erfreut, als beobachtete er einen seltenen Vogel oder ein Mädchen, das sich an einem offenen Fenster auszog. Der Mann, der da eben um die Ecke gekommen war, sah ganz ehrbar aus und wie jemand, den Tom einmal gekannt hatte. Groß und dunkelhaarig, gab Gregor eine elegante Erscheinung ab, und er wirkte überhaupt nicht deutsch. Eher wie ein typischer porteño: so sorgfältig gekleidet wie ein Franzose, aber mit dem Auftreten eines Engländers. Josef Goebbels im grauen Anzug, mit zwei normalen Füßen und fünfzehn Zentimetern mehr. Tom war auf Anhieb klar, wieso es dem Deutschen über zehn Jahre gelungen war, nicht aufzufallen.
Er visierte, was eine andere Art von Konzentration war, weil es darum ging, die exakte Stelle zu wählen, die man treffen wollte. Das war ein alter Scharfschützentrick: Man wähle einen Zielpunkt, der genauso groß ist wie die eigene Kugel. Wenn er einen Mann seitlich in den Kopf schießen wollte, bevorzugte Tom das Ohrläppchen. Beim Schuss von vorn, wie in diesem Fall, zielte er immer auf das Philtrum, die kleine Rinne zwischen Nase und Oberlippe des Opfers. Bei beiden Methoden konnte man sicher sein, den Hirnstamm zu treffen. Und auf weniger als hundertfünfzig Meter war es unwahrscheinlich, dass Zähne und Knochen eine .30er Kugel ablenkten. Tom erzielte bei einer Serie auf hundert Meter ein Trefferbild mit einem Streukreis von zweieinhalb Zentimetern. Für einen präzisen Schuss ins zentrale Nervensystem war das hier tatsächlich seine Maximalweite. Er hielt also das Fadenkreuz stetig auf dem sich nähernden Zielpunkt und wartete, dass Sylvia ihm meldete, es seien keine Passanten und Fahrzeuge in der Nähe des Zielobjekts. Es war, wie einen Stummfilm zu gucken, nur in Farbe.
Fast dreißig Sekunden versperrte ihm ein Einspänner die Sicht auf sein Zielobjekt. Dann knallte der Kutscher, der eine Tweedkappe und einen blauen Anzug trug, mit der Peitsche, und das Pferd trabte an, bog um die Ecke Cangallo und hinterließ, wie Sylvia aufgeregt bestätigte, eine absolut freie Schussbahn.
Er ging mit dem Abzugsfinger langsam auf Fühlung, nahm nur das Spiel weg, bis er den stärkeren Widerstand der Rast spürte, und zog dann, indem er noch einmal einatmete, bis zum Auslösepunkt an. Da guckte Gregor sich plötzlich um, als wollte er sich vergewissern, dass sein polizeilicher Leibwächter noch da war. Als er ihn sah, drehte Gregor sich lächelnd wieder zurück und blieb an der Straßenecke stehen, bereit, die Cangallo zu überqueren. Er schien bar jeder Sorge. Und jeden Gewissens.
«Schussbahn ist frei», wiederholte Sylvia. «Es kommt nichts, weder–»
Einen Sekundenbruchteil, ehe sie den Knall über sich hörte, sah sie, wie der Deutsche sich an den Mund fasste, als hätte ihn ein plötzlicher Zahnschmerz durchzuckt, und sein Kopf war für einen Moment von einer Art hellroter Aureole umgeben, als der hintere Teil seines Schädels wegbarst. Der Leibwächter und ein hinter Gregor befindlicher Passant wurden mit Blut und Gehirnmasse bespritzt. Selbst für Sylvias ungeschultes Auge war offensichtlich, dass Gregor einen tödlichen Kopfschuss abbekommen hatte. Aber sie schluckte ihr Entsetzen hinunter, verfolgte seinen Körper bis aufs Gehwegpflaster und fuhr fort, die stumme Szene in ihrem Fernglas zu kommentieren. Ihr erster Gedanke war, wie unglaublich es schien, dass Gregor aus einer solchen Entfernung getötet worden sein sollte.
«Sieht aus, als hättest du ihm die Nase abgeschossen», sagte sie.
Tom lud durch und suchte dann wieder sein Zielobjekt, das jetzt im Rinnstein lag. Diesmal zielte er auf die Kehle, direkt unterm Kinn.
«Und den Hinterkopf, glaube ich, auch», fügte sie hinzu. «Er muss tot sein. Nein, halt, ich glaube, sein Bein hat sich leicht bewegt.»
Tom dachte, dass es vermutlich nur ein Spasmus gewesen war, drückte aber ein zweites Mal ab, um ganz sicherzugehen.
«Himmel», rief Sylvia, die nicht damit gerechnet hatte, dass Tom sich die Mühe machen würde, noch einmal zu schießen. Durch das immer noch angesetzte Glas sah sie Gregors Kinn wegfliegen, wie ein Stück von einem zerborstenen Gefäß. Kopfschüttelnd warf sie das Fernglas aufs Bett und erklärte, dass der Mann jetzt mit Sicherheit tot sei. Dann holte sie tief Luft, glitt auf den Fußboden hinab, den Rücken am Bett, und ließ den Kopf zwischen die Knie sinken, fast, als sei sie selbst getroffen worden.
Sie war schockiert von der Brutalität dessen, was sie mit angesehen hatte. Und von der Kaltblütigkeit, mit der es vollzogen worden war. Sie hatte nur eine vage Ahnung von den Verbrechen des Toten: dass er unbeschreiblich grausame Dinge getan hatte. Hoffentlich. Es bescherte ihr keinerlei Befriedigung, zum Tod dieses Mannes beigetragen zu haben, und wenn er noch so ein Unmensch gewesen sein mochte. Ihr einziger Trost war, dass ihn die unsichtbare Hand, die ihn mit so emotionsloser Präzision getötet hatte, aus seiner Perspektive ereilt hatte wie die Faust Gottes. Nicht, dass der Mann, der jetzt vom Kleiderschrank kletterte, wie ein Engel des Herrn ausgesehen hätte. Da war etwas im Gesicht des Amerikaners, das ihr unheimlich war. Keine Lachfalten um die Mundwinkel, nicht mal eine Runzelfurche in der hohen Stirn, und diese Augen – sie hatten nichts Totes oder sonst wie Gespenstisches, nein, sie waren einfach nur immer gleich, wobei das rechte, das, mit dem er durchs Zielfernrohr visierte, permanent ein wenig zusammengekniffen war, sodass er, wenn er sie ansah, immer ein Detail ihres Gesichts als nächsten Zielpunkt auszumachen schien.
Tom steckte das Gewehr in eine Golftasche, tarnte das Ende des Laufs mit einer nummerierten Schlägerabdeckung. Er steckte die Schläger dazu, hievte sich den Sack über die Schulter und überprüfte dann seine Erscheinung in dem Ganzkörperspiegel an der Kleiderschranktür. Es gab etliche ausgezeichnete Golfclubs in den Randbezirken von Buenos Aires – den Hurlingham-, den Ranelagh-, den Ituzaingo-, den Lomas-, den Jockey- und den Hindu Country Club–, und in den dunkelblauen Flanellhosen, dem marineblauen Polohemd und der dazu passenden Windjacke sah Tom für alle Welt wie jemand aus, der nichts Tödlicheres im Sinn hat als die trockenen Martinis, die er im Clubhaus zu konsumieren gedenkt.
Und wenn nicht schon später Nachmittag gewesen und es nicht schon bald dunkel geworden wäre, dann hätte er durchaus auf dem Weg zum Golfen sein können. Er war ein begeisterter Golfspieler und benutzte oft eine Schlägertasche, um die Tatsache zu kaschieren, dass er ein Gewehr bei sich trug. Diese konkrete Golftasche und den billigen Satz Sam-Snead-Schläger, den sie enthielt (und den man so billig auch wieder nicht nennen konnte, wenn man die Zollgebühren bedachte, die sie ihm dafür am Flughafen abgeknöpft hatten), hatte er aus dem Pro-Shop im Miami Shores Country Club, wo er gewöhnlich spielte, und er hatte vor, ihn Sylvias Vater zu schenken, sobald sie das Gewehr beseitigt hatte. Ihr alter Herr war Mitglied im Club von Olivos, nicht weit von dort, wo Eichmann gewohnt hatte, ehe ihn die Kaninchenzüchterei nach San Fernando getrieben hatte, in das Haus in der Garibaldi Street, aus dem er entführt worden war.
«Du willst es einfach durch den Haupteingang raustragen?», fragte Sylvia, während sie das Zimmerfenster schloss.
«Klar. Hast du eine bessere Idee?» Er fand, sie war ein bisschen grün um die Nase. Hatte noch nie eine Erschießung in Farbe gesehen. Wahrscheinlich nur ein paar alte Wochenschaustreifen, auf denen Juden von SS-Leuten per Genickschuss erledigt wurden. Ganz und gar nicht dasselbe.
Sie schüttelte den Kopf. «Nein, ich glaube nicht», gab sie zu.
«Du siehst aus, als könntest du eine Tasse mate gebrauchen», sagte Tom, der inzwischen selbst Geschmack an dem argentinischen Nationalgetränk gefunden hatte. Der belebende Tee war eine Alternative zum Kaffee, galt aber gleichzeitig als wirksames Mittel gegen leichtere Magenbeschwerden.
«Wie bringst du das fertig?», flüsterte sie. «Wie kannst du jemanden auf diese Art töten? So kaltblütig.»
«Warum ich das mache? Warum ich Aufträge vollstrecke?»
Tom dachte kurz über die Frage nach. Sie war ihm schon oft gestellt worden, vor allem bei der Armee, wo er offener mit seiner Scharfschützentätigkeit umgegangen war. Irgendwie schien es die Leute nie zu befriedigen, wenn er erklärte, es sei einfach nur eine Sache des Trainings. Wobei er normalerweise kein sonderliches Bedürfnis verspürte, sich Leuten zu erklären. Doch in den drei, vier Tagen, die er jetzt mit Sylvia zusammen war, hatte er Sympathien für sie entwickelt. Irgendetwas war an diesem Mädchen, was in ihm den Wunsch weckte, ihr zu erklären, dass er weder voller Hass steckte noch eine Art Psychopath war. Dass er einfach nur ein Mann war, der das tat, worin Männer von jeher am besten waren: andere Männer töten. Von Hause aus nicht sonderlich beredt, suchte Tom nach Worten, die sie verstehen könnte. Er zuckte die Achseln, schürzte die Lippen, neigte den Kopf abwägend hin und her und atmete tief durch die Nase ein, ehe er ihr schließlich antwortete.
«Ich gehe viel ins Kino. Ich bin viel an fremden Orten, muss die Zeit totschlagen, verstehst du?» Er grinste leise, als ihm seine Wortwahl bewusst wurde. «Da war dieser eine Film. Shane. Mit Allen Ladd? Verdammt guter Film. Geht um diesen Fremden, der in einen kleinen Ort in Wyoming kommt und sein bisheriges Leben als Kopfgeldjäger vergessen will. Aber man weiß, daraus wird nichts. Er wird’s versuchen und nicht schaffen und Punkt. Und das heißt, in dem Moment, wo der Schurke, Jack Palance, das erste Mal erscheint, weiß man schon, dass er erschossen wird. Und dass Shane derjenige ist, der ihn umlegt. Der Kerl ist schon so gut wie tot, obwohl er’s nicht weiß. Er steht schon mit einem Fuß im Grab.
Genauso ist’s mit den Kerlen, die ich umlege. Wenn ich den Kontrakt schließe, sind sie schon tot. Wenn ich nicht derjenige wäre, der sie umlegt, wär’s jemand anders. Ich seh den Kontrakt so, dass es besser ist, wenn ich’s bin, weil ich in meinem Fach gut bin. Besser für sie – ein sauberer Schuss – und besser für mich – weil ich gut dafür bezahlt werde. Wenn das Geld nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch in der Army. Geld ist nun mal das Warum und Wieso von so ziemlich allem auf der Welt. Ob’s drum geht, jemandem die Haare zu schneiden, ihm die Zähne zu ziehen oder ihn zu erschießen.»
Sylvia schüttelte den Kopf. In ihren Augen standen Tränen.
«Du bist jung», sagte er. «Du glaubst noch an Sachen. An Moral. An Ideale. An den Zionismus. Marxismus. Kapitalismus. Egal. Meinst du, das Zeug ist weniger gesellschaftsschädlich als das, was ich mache? Lass dir’s gesagt sein, es sind nicht die Leute, die an gar nichts glauben, vor denen man Angst haben muss, es sind die, die an was glauben. Religiöse Menschen. Politische. Idealisten. Bekehrte. Das sind die, die die Welt zerstören werden. Nicht Leute wie ich, die, die sich auf keinen Glauben und keine Sache berufen. Geld ist die einzige Sache, die einen nie enttäuscht, und Egoismus die einzige Weltanschauung, von der man nie beschissen wird. Das ist eine Philosophie, die immer funktioniert.»
Tom lächelte und verlagerte die Golftasche auf seine andere Schulter. Es gab Zeiten, da er sich mit seinem Geschwätz schon fast selbst überzeugte. Und wenn das nicht Politik war, dann war er der Mann mit dem Hathaway-Hemd.
«Und jetzt nichts wie raus hier, verdammt, eh jemand den Pulverdunst riecht.»
2
Quiniela Exacta
Aneinem heißen, stickigen Freitagabend im September verließ Tom Jefferson sein Haus in Miami Shores, direkt an der Biscayne Bay, und fuhr zwanzig Minuten in südwestlicher Richtung, zum Jai alai-frontón an der Ecke 37th Avenue und NW 35th Street. Die alte baskische Sportart Jai alai, die in Spanien und Frankreich recht populär war, wurde in Nordamerika nirgendwo anders gespielt als in Florida – ein Zeichen für den besonders heterogenen Charakter des Sonnenscheinstaats. Es waren zwei Kubaner, die 1928 das erste amerikanische frontón erbauten, im Schatten von Hialeah, der Grande Dame unter den Rennbahnen Floridas. Diese erste Ballspielhalle hielt jedoch nur bis zum großen Hurrikan von 1935.Danach wurde dann ein neues frontón errichtet, nur ein Stückchen südlich des alten, direkt neben dem internationalen Flughafen, und bis 1953 ein enthusiastischer Aficionado aus Chicago in Dania ein zweites frontón erbaute, hatte das in der 37th Street das Jai-alai-Monopol inne.
Tom verfolgte Jai alai so, wie er Baseball und Football verfolgte, was heißt, dass er kaum je dazu kam hinzugehen, aber aufmerksam die Spielergebnisse im Miami Herald studierte. Außerdem war es sowieso schwer, an Karten zu kommen. Die Ballspielhalle in der 37th fasste nur dreitausendfünfhundert Zuschauer. Angesichts der Popularität, die das Spiel, vor allem am Wochenende, unter der Latino-Bevölkerung genoss, hätten die Veranstalter zwei- bis dreimal so viele Karten absetzen können. Wenn die Karte nicht mit der Post gekommen wäre, hätte Tom nicht im Traum ins Auge gefasst, zu einem Freitagabendspiel zu gehen. Schon gar nicht, um dort über einen Auftrag zu verhandeln. Leute, die andere Leute umbringen lassen wollten, zogen fast immer einen ruhigeren Treffpunkt vor, wo die Gefahr, dass jemand mithörte, geringer war. Was hieß, dass der mysteriöse Mr.Ralston, der Tom die Eintrittskarte geschickt hatte, entweder ein blutiger Amateur im Mordgeschäft war und ergo jemand, den man besser mied, oder aber so bewandert in den Euphemismen der Branche, dass es ihm nichts ausmachte, inmitten einer Menschenmenge über einen solchen Auftrag zu reden.
Auf dem Programm stand ein Doppelwettkampf über elf Spiele bis zu sieben Punkten, wobei die sechzehn agierenden pelotaris teilweise aus Kuba, Mexiko und dem Baskenland kamen. Beim Jai alai hatte Tom nichts gegen eine kleine Wette: die Anzahl der beteiligten Akteure machte ein abgekartetes Endergebnis schwer. Daher erstand er, nachdem er das frontón betreten und einen Blick auf die Spieler geworfen hatte, einen quiniela-exacta-Wettscheinzu fünf Dollar an einem der staatlichen pari-mutuel-Automaten. Um mit diesem Schein zu gewinnen, musste man nicht nur das Siegerduo, sondern auch die Zweitplatzierten richtig vorhergesagt haben.
Gegen Viertel vor sieben machte sich Tom auf die Suche nach seinem Platz. Es war ein guter, der beste, den Tom je gehabt hatte – ganz vorn, gleich an der durchsichtigen Schutzwand. Doch von seinem Gastgeber war noch nichts zu sehen. Um kurz nach sieben, als sich die vier pelotaris bereits auf dem Platz aufwärmten, kam ein Mann, der ein Exemplar der New York Times und ein Taschenbuch bei sich trug, und setzte sich neben ihn.
«Ich bin John Ralston», sagte er und schüttelte Tom die Hand. «Freut mich, Sie kennen zu lernen. Danke, dass Sie gekommen sind.»
Es war ein kräftiger Händedruck, kräftiger, als es das geschäftsmännische, um nicht zu sagen adrette Äußere des Mannes hätte vermuten lassen. Er trug eine dicke dunkle Brille, ein cremefarbenes Hemd mit ebensolcher Krawatte, einen gut geschnittenen beigen Leinenanzug, ein gefaltetes Seidentüchlein in der Brusttasche und einen dicken Rubinring und verbreitete mehr als nur einen Hauch von Rasierwasser. Das Silberhaar über Ralstons hoher, sonnengebräunter Stirn war ein bisschen länger, als es der Mode entsprach, aber korrekt frisiert, und er fasste von Zeit zu Zeit hin, als sei es frisch geschnitten. Tom befand auf der Stelle, dass dieser Mann kein Amateur war: Ralston hatte nicht das kleinste bisschen Angst vor Tom.
«Danke, dass Sie mich hergebeten haben», sagte Tom.
«Haben Sie gewettet?» Ralstons Sprechweise war ebenso gepflegt wie sein Äußeres. Sein Akzent war schwer zu identifizieren, eine eigenartige Mischung aus Boston und Westküste.
«Eine quiniela exacta auf die Grünhemden als Sieger», sagte Tom. «Die beiden Kubaner sind in Form. Und als Zweite die mit den blauroten Hemden.» Er beobachtete, wie Ralston kurz das Programm studierte, und taxierte ihn auf Mitte fünfzig.
«Klingt, als verstünden Sie was von diesem Spiel.»
«Ich verfolge es in der Zeitung.»
«Ich komme erst seit kurzem her», gestand Ralston. «Seit ich in Florida bin. Ursprünglich komme ich aus Chicago, aber geschäftlich war ich hauptsächlich in Hollywood und Las Vegas tätig. Pedro Mir, der Veranstalter? Der ist ein Freund von mir. Ich habe ihm gesagt, er soll ein frontón in LA aufmachen. Oder vielleicht auch in Vegas. Bei den ganzen Mexikanern dort müsste das doch gut laufen. Was meinen Sie, Mr.Jefferson?»
«Ich kenne LA nicht so gut.»
«Was gibt’s da zu kennen?», sagte Ralston lächelnd. «Raymond Chandler hat mal gesagt, LA hat so viel Charakter wie ein Pappbecher. Aber fairnesshalber muss man sagen, was er wirklich gehasst hat, war Bay City. Lesen Sie gern, Mr.Jefferson?»
«Ich lese so ziemlich alles», sagte Tom und registrierte Titel und Autor des Taschenbuchs auf Ralstons Schoß. Island in the Sun von Alec Waugh war allerdings ein Buch, das er wohl nie lesen würde.
«Ich habe Chandler kennen gelernt, als er bei Paramount gearbeitet hat. Das muss so etwa dreiundvierzig gewesen sein. Chandler und einige andere. In letzter Zeit bin ich in der Obstbranche. Mittelamerika. Aber damals war ich im Filmbusiness. Auch als Produzent, aber hauptsächlich auf der Finanzseite.»
«Bestimmt nicht die schlechteste Seite», sagte Tom höflich.
Das Spiel begann. Es wurde auf einem etwa sechzig Meter langen, an drei Seiten von Wänden umschlossenen Platz gespielt, und die pelotaris benutzten einen am Arm festgeschnallten, geschwungenen, rohrgeflochtenen Schläger namens Cesta zum Schleudern der pelota, des ziegenlederumhüllten Hartgummiballs, der etwa doppelt so groß war wie ein Golfball. Die mit bis zu 270Stundenkilometern dahinsausende pelota wurde aus der Luft, nach einmaligem Aufspringen oder beim Abprallen von der hinter dem Spieler befindlichen Wand gefangen und wieder an die Stirnwand geschleudert. Jai alai verlangte Kraft, Ausdauer und die instinktive Fähigkeit, die besten Positionen auf einem Platz einzunehmen, der länger war als ein Fußballplatz breit.
Ralston senkte die Stimme. «Hauptsächlich war ich immer im Spielgeschäft», sagte er. «Nicht die pari-mutuel-Sorte, verstehen Sie. Obwohl ich noch nie kapiert habe, wieso manche Aktivitäten das Unbedenklichkeitssiegel kriegen, was die Wetterei angeht, und andere nicht.»
«Ein Hund, ein Pferd oder auch ein pelotari sind schwerer zu manipulieren als ein Keno-Spiel», bemerkte Tom.
«Das glauben die meisten Leute, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum dem Casinogeschäft hier in Florida der Hahn abgedreht wurde. Der wahre Grund ist, dass das Casino die staatlichen Profite aus den mutuel-Automaten bedroht hat. Aber das kümmert mich nicht mehr. Für mich sind das alles olle Kamellen.»
Er reichte Tom eine Geschäftskarte. Tom nahm sie und überflog den Namen und die Adresse in LA, irgendwo in der Nähe des Sunset Strip. Doch was ihn irritierte, war die Berufsbezeichnung. Die Karte wies Ralston als Strategen aus.
«Mittlerweile arbeite ich für die Regierung. In strategisch-beratender Funktion. Ich helfe ihnen bei der Lösung von Problemen, bereite Arbeitspapiere für Diskussionsgruppen vor und dergleichen. Wenn ich Leuten diese Karte gebe, dann fragen die meisten, im Unterschied zu Ihnen: ‹Was in aller Welt ist ein Stratege?› Und dann sage ich, ein Stratege ist eine Art Troubleshooter.»
«Wie ich», sagte Tom.
«Hmm?»
Ralstons Blick folgte dem Ball, und er reagierte überhaupt nicht auf den Witz. In der Annahme, dass das ein Thema nach Ralstons Gusto sein müsste, offerierte Tom eine ähnlich provokante Bezeichnung für die Institution, der er ihn zuordnete.
«Sie sind bei der Behörde für brillante Ideen und Geistesblitze. Auch bekannt unter dem Namen E Street, stimmt’s?» Tom sprach vom Washingtoner Hauptquartier der CIA.
«Das Dumme an vielen dieser so genannten brillanten Ideen ist, dass sie leider nicht sonderlich praktikabel sind. Um nicht zu sagen, Furzideen. Oh, prima Schlag.» Ralston begann zu klatschen.
«Gott schütze uns vor Leuten mit brillanten Ideen.» Tom konstatierte, dass Ralston seiner Unterstellung, er arbeite für die CIA, nicht widersprochen hatte. «Sage ich immer.»
«Ihr Wort in Gottes Ohr», sagte Ralston. Er reichte Tom die New York Times vom Vortag, die so gefaltet war, dass Tom einen Artikel vor Augen hatte, in dem es um Castros New-York-Besuch aus Anlass einer Rede vor der UNO-Generalversammlung ging.
Tom überflog die Story, die er bereits aus seiner Tageszeitung kannte. Unter Berufung auf angeblich überhöhte Preise war die kubanische Delegation aus dem Shelburne Hotel ausgezogen, um bei ihren unterdrückten schwarzen Brüdern im Theresa zu wohnen, einer heruntergekommenen Absteige in Harlem, die nicht mal der ärmste afrikanische Diplomat für ein angemessenes Quartier gehalten hätte. Die Times berichtete über das Chaos, das die Kubaner angeblich während ihres kurzen Aufenthalts im Shelburne in den Zimmern angerichtet hatten: Brandlöcher in den Teppichen, verstreute Hühnerfedern, Reste von rohem Fleisch in einem der Kühlschränke. Fast, als wollte die Zeitung suggerieren, dass dort eine Art kommunistisches Voodoo-Ritual stattgefunden hatte – die Erschaffung eines marxistischen Zombies, der die kapitalistische Welt ins Verderben stürzen sollte. Der Bericht aus dem Theresa konzentrierte sich auf den Dreck und auf die vielen Prostituierten, die dort aus und ein gingen. Ein Archivbild von Castro mit einer dicken Zigarre figurierte neben einem Foto der heruntergekommenen Harlemer Hotelfassade.
Ralston seufzte laut. «Aber selbst wenn ich’s Ihnen erzählen würde, Sie würden nicht glauben, auf was für hirnrissige Furzideen die Leute im Quarters Eye in Zusammenhang mit unserem Freund da in der Zeitung gekommen sind.»
Tom wusste, das Quarters Eye am Ohio Drive in Washington war eine andere Filiale des CIA – der Teil, der für Kuba zuständig war.
«Holzauge wäre ein besserer Name für den Laden. Sie würden’s nicht glauben. Da war alles vertreten, von einer explodierenden Zigarre bis zu einer dreckigen Klobrille.»
«Zuschlagen, wenn der Mann die Hosen runtergelassen hat, was?», sagte Tom. «Hab ich selbst schon gemacht. Beim Scheißen hält das Ziel still.»
Die Menge grölte anerkennend, als einer der kubanischen Spieler in den grünen Hemden einen spektakulären Ball fing.
«Schießen ist eine Sache. Furzideen sind eine andere. Heute wird alles unnötig kompliziert gemacht», bemerkte Ralston. «Zu viel Schnickschnack vorn am Cadillac, könnte man sagen. Verstehen Sie, was ich meine?»
«Ich glaube schon.»
«Diese Bomben vorn am Dreiundfünfziger.»
«Dagmars.»
«Unnütz und nicht zu reparieren. Man soll beim Einfachen bleiben. Das meine ich. Nehmen Sie den Volkswagen. Nehmen Sie den Porsche. Nehmen Sie sich selbst.»
«Mich?»
«Was Sie da unten in Argentinien gemacht haben? Nichts da Zigarre. Nichts da Schnickschnack. Einfach nur ein Bootsschwanzgeschoss in Matchqualität auf hundert Meter. Stimmt’s?»
Diesmal war es Ralstons Unterstellung, die unwidersprochen blieb.
«Ganz simpel», fuhr er fort. «Womit ich natürlich nicht sagen will, dass es eine einfache Sache war. Soweit ich gehört habe, war das ein Schuss, der bei den Panamerikanischen Spielen Gold geholt hätte. Nein, was ich sagen will, ist: Das, was Sie machen, worauf Sie sich verstehen, ist immer noch ein genauso wirksames Mittel zur Schädlingsbekämpfung wie eh und je. Wie damals, als Tim Murphy in der Schlacht von Saratoga General Simon Fraser auf dreihundert Meter erledigt hat.»
Tom war beeindruckt. Die Großtaten berühmter Scharfschützen waren ihm vor zwanzig Jahren eingebläut worden, während seiner Ausbildung in Camp Pendleton, der Späher- und Scharfschützenschule des Marine Corps in Greens Farm, San Diego. Aber auf ihn hatte sein Sitznachbar nicht so gewirkt, als wäre er je beim Militär gewesen. Bei der Mafia vielleicht, aber nicht bei der Armee.
«Deshalb rede ich mit Ihnen», sagte Ralston. «Die Leute, die ich vertrete, Leute in der Regierung, die hätten von Ihnen gern eine Machbarkeitsstudie für einen Job, diesen Herrn in der Times betreffend.»
Tom sah sich etwas unbehaglich um.
«Ach, wegen der Leute hier würde ich mir keine Sorgen machen», sagte Ralston. «Ich wette, hier ist kein einziger Mensch, der den máximo líder nicht gern ins Gras beißen sähe. Außerdem spricht hier außer uns beiden niemand Englisch.»
«Eine Machbarkeitsstudie?»
«Ist es machbar, Mister Jefferson? Wenn ja, wie? Und zu welchem Preis? Und wenn für den máximo líder, mit welcher Wahrscheinlichkeit dann gleichzeitig auch für seinen bärtigen Bruder Raúl? Meine persönliche quiniela exacta, wenn Sie so wollen. Es bringt nicht viel, das Kreuzchen für den Ersten richtig zu platzieren, wenn man es nicht gleichzeitig auch für den Zweiten richtig platziert, nicht wahr? Natürlich übernehmen wir Ihren Einsatz.»
Ralston reichte Tom das Taschenbuch. Als Tom nur darauf starrte, sagte er: «Sie sollten ein Buch nie nach dem Cover beurteilen.»
Tom, der kapierte, dass das Buch irgendetwas Wertvolles enthielt, blätterte es verstohlen durch und stellte fest, dass darin fünf Einhundertdollarnoten steckten. Er drehte das Buch um und überflog den Text auf der Rückseite. Passenderweise schien die Story auf einer fiktiven Karibikinsel zu spielen.
«Ich freue mich schon auf die Lektüre», sagte er.
«Ausgezeichnet. Aber lassen Sie sich nicht zu lange Zeit. Ich möchte doch meinen Freunden bald berichten, was Sie davon halten.»
«Ich lese fix, Mr.Ralston. Ich kann Ihnen wahrscheinlich schon in ein paar Tagen meinen Eindruck mitteilen.»
«Sagen wir, in einer Woche?»
«Abgemacht.»
«Kennen Sie das University Inn in Coral Gables?»
«Kenne ich. Dieser Schuppen auf dem Campus», sagte Tom. «Neben dem Riviera-Golfplatz.»
«Dort können Sie eine Nachricht für mich hinterlassen. Sehe ich es richtig, dass Sie nicht nur Jäger, sondern auch Golfer sind?»
«Was soll man denn in Miami sonst tun?»
«Ich könnte Ihnen da zweifellos ein paar Überraschungen bieten. Aber wie dem auch sei, ich selbst spiele auf dem Biltmore-Platz.»
«Der ist besser. Jede Menge Bäche, die einem ins Spiel pfuschen. Der Riviera-Platz ist okay. Ich meine, die Bunker sind okay, aber es gibt keine Wasserhindernisse, und in Florida ist das, na ja, wie ein Zirkus ohne Clowns.»
«Sie verlieren wohl gern Bälle? Wo spielen Sie?»
«Miami Shores. Einer der schwersten Parcours in ganz Florida, schätze ich.»
«Wer ist dort der Pro?»
«Jim MacLaughlin.»
«Und Ihr Handicap?»
«Acht.»
«So ein Zufall. Meins auch. Wir müssen irgendwann mal spielen.»
«Ja, aber wo? Es müsste auf neutralem Boden sein.»
«Schon mal auf dem Coral-Ridge-Platz gespielt, in Fort Lauderdale?»
«Nein.»
«Ich auch nicht. Aber Lou Worsham, der dortige Pro, ist ein Freund von mir. Ich werde was mit ihm arrangieren.»
Tom lächelte in sich hinein. Ralston war offensichtlich die Sorte Mensch, die Namen in die Landschaft streute wie ein schlechter Golfer Bälle. Er fragte sich, wer von dem Herrenquartett, das er in Vegas getroffen hatte, der Freund war, der Ralston von dem Job in Buenos Aires erzählt hatte. Nicht Ilani, so viel war sicher: Der Israeli schien nicht der Typ. Also einer der drei übrigen: Davidson, Dalitz oder Rosenstiel. Tom tippe auf Dalitz. Dalitz verfügte über mehr Kontakte als General Electric.
«Sie haben dort anscheinend ein Einer-Loch», sagte Ralston, «mit einem riesigen Tee, so groß wie ein Baseball-Homebase. Man kann es als Zweihundert-Meter-Drive über einen See spielen oder als Hundertfünfundzwanzig-Meter-Pitch.»
«Klingt interessant.»
«Dann steht unser Spiel», sagte Ralston.
Die Menge applaudierte laut, als die Kubaner den ersten Punkt holten. Ihre Gegner setzten sich hinter dem achten Spielerpaar auf die Bank, um zu warten, bis sie wieder dran waren. Das Team, das als erstes sieben Punkte hatte, würde Sieger sein.
Doch Ralston zerknüllte bereits seine Eintrittskarte und ließ sie auf den Boden fallen. Er zog ein silbernes Zigarettenetui heraus und wedelte damit in Toms Richtung, aber der schüttelte den Kopf, weil er lieber seine eigene Marke rauchte. Ralston zündete sich seine Zigarette mit einem ebenfalls silbernen Dunhill-Feuerzeug an, erhob sich und streckte Tom die Hand hin.
«War mir ein Vergnügen, Mr.Jefferson.»
Die beiden Männer wechselten einen Händedruck.
«Sie wollen schon gehen? Das Spiel fängt doch gerade erst an.»
«Ich habe um halb neun eine Dinner-Verabredung», sagte Ralston und sah kurz auf die klobige, goldene Girard-Perregaux an seinem Handgelenk. «Und wenn ich nicht aufpasse, komme ich noch zu spät.»
«Ich melde mich», sagte Tom.
«Und vergessen Sie nicht meine quiniela exacta», sagte Ralston und verschwand.
Tom blieb noch ein, zwei Minuten auf seinem Platz und folgte ihm dann.
Nachdem er das frontón verlassen hatte, marschierte Ralston ein paar Blocks nach Süden, den Miami Canal entlang, und er sah nicht mal auf, als eine Transamerica-Constellation mit einem solchen Donnergetöse vom International Airport startete, dass Tom froh war, kein Haus in Miami Springs gemietet zu haben. Als Tom den Blick wieder senkte, stieg Ralston gerade in einen hellblauen Cadillac Eldorado Brougham – ein Wagen, der allem zu widersprechen schien, was er gesagt hatte, von wegen zu viel Schnickschnack und Lob der Einfachheit. Mit seinen Heckflossen, einen guten Meter über Bürgersteig-Niveau, war der Eldorado barocke Pracht auf Rädern.
Tom rannte dorthin zurück, wo er selbst geparkt hatte, obwohl kein Grund zur Eile gegeben schien; es kam ihm so ähnlich vor, wie Elvis zu verfolgen, dessen rosa Cadillac überall Massen von Gaffern anzog. Als er den Chevy Bel Air gefunden hatte, verriegelte er die Tür, jagte den V8-Motor hoch, schoss unter hörbarem Reifenquietschen die 31st hinunter und holte gerade noch rechtzeitig auf, um Ralston die 27th Avenue nach Süden nehmen zu sehen.
Den Eldorado bequem im Blick, lehnte Tom sich zurück und nahm etwas Gas weg, nur für den Fall, dass Ralston der misstrauische Typ war. An einer Ampel ließ er einen Bus und einen Dodge-Kombi vorbei und zündete sich eine Zigarette an. Dann ging es weiter.
Miami war eine Hochburg der Firma, die größte CIA-Station überhaupt, und es war ein offenes Geheimnis, dass die Suntan University die spooks ihren Campus für Spionage-Ausbildungszwecke nutzen ließ. An jedem anderen Ort wäre das erstaunlich gewesen, aber die CIA war eine der Haupteinnahmequellen der Stadt. Sie pumpte mehr Geld in die lokale Wirtschaft als alle pari-mutuel