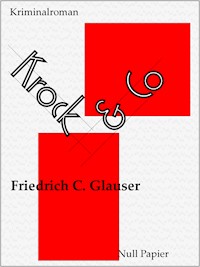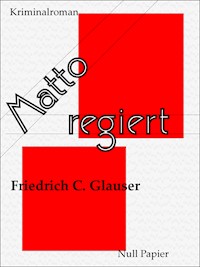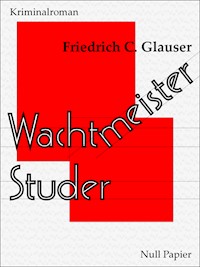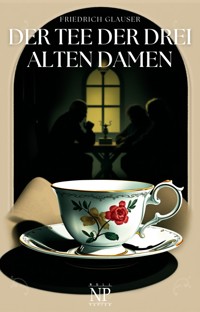
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann wird nachts in Genf aufgefunden, scheinbar vergiftet. Er stirbt im Krankenhaus. Nur wenige Tage danach erleidet ein Apotheker ein ähnlich tödliches Schicksal. Ein bekannter, morphiumsüchtiger Professor wird verdächtigt. Simpson O'Key - was für ein Name! - Agent der britischen Krone, macht sich auf die Jagd. Mit Hilfe der Polizei versucht er das Geheimnis um drei alte Damen zu enthüllen, die angeblich alleinstehende Männer zum Tee einladen. Die Geschichte, wie immer mit viel Liebe zum Detail aber auch zum Spott aufgezeichnet vom großartigen Schweizer Chronisten des beginnenden 20 Jahrhunderts, Friedrich Glauser, ist inspiriert von der in Genf stattgefunden Gründung des Völkerbundes, des Vorläufers der UNO, und den auftauchenden fremdländischen Personen: Spionen, Gauklern, Betrügern, Staatsoberhäuptern und sonstigem zwielichtigen Gesindel. Spionage, Gegenspionage, Hokuspokus, Gier und Neid sind Thema in dieser Krimisatire. Und wenn rätselhafte Ölfunde in noch rätselhafteren Ministaaten erwähnt werden, so erscheint die Geschichte bemerkenswert hellsichtig. Glaser, selbst lange Jahre Insasse verschiedener Irrenanstalten, hoffnungslos morphiumsüchtig und immer am Rande zum Wahnsinn - wer will das schon definieren? - hinterließ in seiner viel zu kurzem Schaffenszeit ein Panoptikum skurrilster Figuren; am bekanntesten der grantelnde Alpen-Ermittler Wachtmeister Studer, der vielleicht erste deutschsprachige Ermittler in der Literaturszene überhaupt. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Friedrich Glauser
Der Tee der drei alten Damen
Eine Kriminalgeschichte
Friedrich Glauser
Der Tee der drei alten Damen
Eine Kriminalgeschichte
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Morgarten, Zürich, 1940 3. Auflage, ISBN 978-3-954182-86-2
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Ein junger Mann wird nachts in Genf aufgefunden, scheinbar vergiftet. Er stirbt im Krankenhaus. Nur wenige Tage danach erleidet ein Apotheker ein ähnlich tödliches Schicksal. Ein bekannter, morphiumsüchtiger Professor wird verdächtigt. Simpson O’Key -- was für ein Name! -- Agent der britischen Krone, macht sich auf die Jagd. Mit Hilfe der Polizei versucht er das Geheimnis um drei alte Damen zu enthüllen, die angeblich gerne alleinstehende Männer zum Tee einladen.
Der Autor
Friedrich Charles Glauser (* 4. Februar 1896 in Wien; † 8. Dezember 1938 in Nervi bei Genua) war ein Schweizer Schriftsteller. Er gilt als einer der ersten deutschsprachigen Krimiautoren.
Schriftsteller zu sein, hieß für Friedrich Glauser zunächst, Gedichte zu schreiben. In der lyrischen Form glaubte er, sein inneres Erleben ausdrücken zu können. Vorbilder waren für ihn Stéphane Mallarmé und Georg Trakl; der Ton entspricht dem expressionistischen Tenor der Zeit am Ende des Ersten Weltkrieges. Doch keiner dieser Texte wurde gedruckt. Für die Sammlung seiner Gedichte, die Glauser 1920 zusammenstellte, fand sich kein Verleger. Seine Gedichte wurden daher erst posthum veröffentlicht.
In den letzten drei Lebensjahren schrieb Glauser fünf Kriminalromane, in deren Mittelpunkt Wachtmeister Studer steht, ein eigensinniger Kriminalpolizist mit Verständnis für die Gefallenen der Gesellschaft.
Der Kriminalroman »Matto regiert« spielt in einer psychiatrischen Klinik und man merkt ihm genauso wie den anderen Romanen an, dass der Autor eigene Erlebnisse verarbeitet hat. Mit eindringlichen Milieustudien und packenden Schilderungen der sozialpolitischen Situation gelingt es ihm, den Leser in seinen Bann zu schlagen.
Glauser ist nach der Auffassung von Erhard Jöst »einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Kriminalromans«. Seine Romane und drei weitere Bände mit Prosatexten wurden zwischen 1936 und 1945 veröffentlicht.
Glausers Nachlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.
Bei einer Umfrage im Jahr 1990 unter 37 Krimifachleuten nach dem »besten Kriminalroman aller Zeiten« landete Wachtmeister Studer als bester deutschsprachiger Krimi auf Platz 4.
Erstes Kapitel
1
Um zwei Uhr nachts ist die Place du Molard leer--. Eine Bogenlampe bescheint ein Tramhäuschen und einige Bäume, deren Blätter lackiert glänzen. Auch ist ein Polizist vorhanden, der diese Einsamkeit zu bewachen hat. Er langweilt sich, dieser Polizist, sehnt sich nach einem Glase Wein, denn er ist Waadtländer und der Wein für ihn der Inbegriff der Heimat. Dieser Polizist heißt Malan, er trägt einen kupferroten Schnurrbart und gähnt von Zeit zu Zeit.
Plötzlich steht vor dem Tramhäuschen ein junger Mensch -- weiß Gott, von wo er plötzlich aufgetaucht ist. Dieser junge Mann -- elegant gekleidet in einen grauen Anzug, nur seine Haare sind etwas wirr -- benimmt sich merkwürdig. Er zieht zuerst den Rock aus, dann löst er den ledernen Gürtel, taumelt ein wenig, steht dann in kurzen Unterhosen da, seine Sockenhalter sind aus blauer Seide. Nun nestelt er an seinen Manschettenknöpfen, der eine Knopf klirrt aufs Pflaster -- da rafft sich Polizist Malan auf, tritt näher und sagt:
»Aber mein Herr, was tun Sie da?«
Der junge Mann glotzt; die Pupillen seiner Augen sind sehr groß, so groß, daß die Farbe der Iris gar nicht zu erkennen ist. Außerdem sind die Züge des Gesichtes merkwürdig starr und unbewegt. Und während Polizist Malan noch überlegt, ob der Mann eigentlich besoffen ist, schwankt der Halbentkleidete stärker, greift mit den Händen in die Luft, findet keinen Halt und knallt mit dem Hinterkopf aufs Pflaster. Dann liegt er ruhig, nur die Gummiabsätze seiner braunen Halbschuhe trommeln einen leisen Marsch auf dem Asphalt. Malan beugt sich über den jungen Mann und murmelt:
»Der ist ja gar nicht betrunken, er riecht nicht nach Wein, nicht nach Schnaps.«
Dann schüttelt er den Kopf, hebt den Körper auf und trägt ihn auf die Bank, die den Kiosk im Halbkreis umgibt. Er sammelt die verstreuten Kleidungsstücke, faltet sie sorgfältig (schöner grauer Flanell, denkt er). Er liest die Adresse des Schneiders, murmelt: »Von London! Wohl einer von den fremden Diplomaten!« und seufzt dazu, denn der Völkerbund bringt doch nur Unannehmlichkeiten in die ruhige Stadt Genf. Und während er noch nicht recht weiß, was in einem solchen Fall zu tun ist, ob man zuerst ans Spital zu telephonieren hat oder an den Kommissär Pillevuit, kommen Schritte näher und im Schein der Bogenlampe taucht ein älterer Herr auf, der einen breitrandigen schwarzen Hut trägt; darunter schimmert ein kurzer weißer Bart.
»Was ist los, Brigadier?« frägt der alte Herr. Er hat eine tiefe Stimme. »Ein Unglücksfall? Kann ich Ihnen behilflich sein?«
Der alte Herr tritt zu dem Liegenden, hebt mit dem Daumen dessen Oberlid, und sagt:
»Merkwürdig!«
Dann faßt er nach dem Handgelenk, zählt laut die Pulsschläge, während er eine flache Uhr aus der Westentasche zieht. Malan steht daneben und weiß nicht recht, wie er sich benehmen soll. Der Herr, -- vielleicht ist er ein Arzt, dann ist alles gut, -- kommt möglicherweise von einem Krankenbesuch, sonst wäre seine Anwesenheit zu so nachtschlafender Zeit immerhin verdächtig. Man kann ja fragen, denkt Malan und räuspert sich; aber bevor er noch ein Wort gesagt hat, meldet sich der Herr: »Sie möchten wissen, wer ich bin? Da…«
Er hat eine Brieftasche gezogen, ihr eine Visitenkarte entnommen. Darauf steht:
Louis DominicéProfesseur de Psychologieà l’Université de Genève
»Mein lieber Brigadier, dies ist eine Vergiftung. Das beste, Sie telephonieren sofort ans Spital«, sagt der alte Herr. Er spricht die Worte sehr präzis aus und macht dazu belehrende Handbewegungen. »Haben Sie die Kleider schon durchsucht? Keine Papiere?«
Malan wird verlegen. Er hat seine Pflichten, scheint es, vergessen. Nun besinnt er sich auf sie, er kehrt die Taschen der Hosen, des Rockes um; sie sind leer.
»Von welcher Seite ist der Mann gekommen?« frägt der Professor weiter.
Auch diese Frage kann Malan nicht beantworten.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag«, sagt Professor Dominicé. »Ich werde an das Spital telephonieren, ich habe dort noch Bekannte, meinem Rufe wird man schneller Folge leisten als dem Ihren. Und während ich telephoniere, können Sie die Toilette untersuchen, die unter diesem Kiosk liegt. Vielleicht finden Sie dort etwas.«
Der Herr weiß mehr als ich, denkt Polizist Malan, aber er wagt nicht, seine Gedanken laut werden zu lassen. Er ist noch nicht lange bei der Polizei, und außerdem imponiert ein Professor einem einfachen Manne beträchtlich. Darum geht Malan auch gehorsam um das Tramhäuschen, steigt Treppen hinab und gelangt in einen weiß gekachelten Raum.
Es ist sehr still hier, Fliegen summen um eine einsame Glühbirne, die rötlich leuchtet. Geschlossene Türen mit der Aufschrift: »Öffnet sich nur nach Einwurf eines 20-Centimes-Stücks.« Alle Türen, an denen Malan vorbeischreitet, tragen noch ein anderes bewegliches Täfelchen, das anzeigt, daß die Kabine »frei« ist. Nur die letzte Tür ist angelehnt, das Schild verschoben, ein Spalt klafft. Malan lauscht. Nur Fliegen summen. Kein Atemzug. Er will die Tür vorsichtig aufstoßen, da wird sie von innen aufgerissen, Malan will zugreifen, ein harter spitzer Schädel bohrt sich in seine Magengrube -- später, viel später, als im Samariterkurs der »Plexus solaris« durchgenommen wird, denkt er still Aha! sonst nichts -- und er setzt sich auf die Fliesen. Seine aufgesperrten Augen nehmen dennoch ein Bild auf: zwei Beine, die über die Stiegen verschwinden.
Sie stecken in weißen Tennishosen.
Malan geht die Stufen hinauf, sieht sich oben um, der Platz ist leer. Auch der Professor scheint verschwunden zu sein. Auf der Bank liegt der junge Mann, mit halbgeschlossenen Augen, sein Atem geht pfeifend.
Doch da ist der Professor! Deutlich ist er in der Telephonkabine zu sehen, er gestikuliert und spricht aufgeregt in den Trichter. Dann hängt er den Hörer an und kommt heraus.
»Haben Sie niemanden gesehen?« frägt Malan. Der Professor schüttelt den Kopf. Er hat seinen breitrandigen Hut auf den Hinterkopf geschoben, seine weißen Haare schimmern feucht. Die Nacht ist sehr schwül.
»Es ist mir nämlich jemand begegnet, dort unten«, sagt Malan. Dabei preßt er die Fäuste in die Magengrube.
»Sind Sie verletzt?« erkundigt sich der Professor besorgt.
Malan schüttelt den Kopf. Dann öffnet er die geballten Fäuste. Aus der Rechten fällt etwas zu Boden, das im Lichte metallisch schimmert. Malan bückt sich, er erinnert sich, daß er beim Hinfallen etwas unter seiner Handfläche gespürt hat, -- und seine Finger haben sich unbewußt um dieses Ding geschlossen. Nun betrachtet er es und ist erstaunt, denn etwas Ähnliches hat er noch nie gesehen. Es sind, gebündelt, etwa 20 sehr feine Drähte, die nicht länger sind als ein kleiner Finger. Hilflos streckt er das Bündel dem Professor hin. Professor Dominicé nickt.
»Kenn ich«, sagt er trocken. Er zieht einen der feinen Drähte aus dem Bündel, hält ihn hoch und erklärt:
»Den braucht man, um jene Hohlnadeln zu reinigen, sofern sie nämlich verstopft sind, deren sich Morphinisten bedienen, um sich vermittelst einer sogenannten Pravazschen Spritze das aufgelöste Gift in den Körper einzuverleiben.«
Der Polizist Malan ist doch nicht ganz dumm. Die geschraubte, sicher verlegene Ausdrucksweise des Professors scheint ihm irgendwie bedenklich. Aber was soll man machen? Man ist schwerfällig. Wie soll man seinen Verdacht äußern, den Verdacht nämlich, daß mit diesem alten Herrn etwas nicht stimmt? Übrigens läßt Dominicé auch keine Frage aufkommen.
»Das Sanitätsauto«, sagt er, »wird in kürzester Frist den Patienten abholen. Ich bin müde. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Falls man mich braucht, werde ich immer zu erreichen sein. Gute Nacht.«
Merkwürdig, wie die Finger des Professors zittern, während er sich aus grobem französischem Tabak eine Zigarette dreht. Er zündet sie an, entfernt sich. Hinter ihm bleibt der Rauch in der stickigen Luft reglos stehen.
»Und ich habe den Herrn nicht einmal gefragt, ob er den Mann da kennt«, murmelt Malan verdrießlich. »Na, der Alte soll sich selber um die Sache kümmern!« Er sagt nicht Sache, sondern gebraucht ein gröberes Wort. Unter dem »Alten« aber versteht er den Kommissär Pillevuit, einen Mann mit blondem Fahnenbart, der mit dem Polizisten Malan immerhin eine Eigenschaft gemeinsam hat: der Kommissär liebt auch Waadtländer Weine.
Nun ist Malan wieder allein, denn der Kranke auf der Bank zählt nicht. Der große Platz ist trotz des scharfen Lichtes der Bogenlampe unheimlich. Die leeren Fenster der Geschäftshäuser glotzen bösartig und Malan räuspert sich, um sich dieses furchterregende Gebaren zu verbieten. Aber die Häuser glotzen weiter. Endlich kommt ein Surren näher, ein Auto hält mit einem Ruck. Es ist ein grüner geschlossener Kasten mit spärlichen Milchglasscheiben. Ein Mann steigt aus, der Chauffeur springt von seinem Sitz.
Eine Bahre gleitet aus dem Kasten, der Kranke wird darauf gepackt, eine Tür knallt zu, der Chauffeur sitzt schon wieder auf seinem Platz, ein böses Surren des Anlassers, und Malan kommt sich verhöhnt vor von dem roten Auge des Schlußlichts.
2
Deliriert er viel?« fragte Dr. Thévenoz. Er zog zwei Hartgummipfropfen aus den Ohren, die durch rote, zusammenlaufende Kautschukschläuche mit einem schwarzen Zylinder verbunden waren, der auf der nackten Brust des Patienten lag.
Schwester Annette schüttelte den Kopf.
»Eigentlich nicht«, sagte sie. »Er murmelt nur von Zeit zu Zeit unverständliche Worte. Ich glaube fast, es ist englisch.«
»So, englisch…«
Dr. Thévenoz, ein etwa 35jähriger Mann, mit spärlichem blondem Haar, blickte zum Fenster hinaus. Das ging auf grüne Laubbäume. Im Zimmer stand nur ein Bett. An der Wand war ein weißes Becken angebracht, mit zwei weißen Hähnen darüber.
Der Patient warf sich unruhig in seinem Bett herum.
»Don’t sting«, stöhnte er. »Go to hell…«
»Hallo, Rosenstock, sprachenkundiger Ahasver, was heißt ›sting‹?«
Doktor Wladimir Rosenstock, Assistenzarzt, klein, leicht verfettet trotz seines jugendlichen Aussehens, schien sich beim Gehen immer im Schlittschuhlauf zu üben. So glitt er ins Zimmer.
»Sting?« wiederholte Rosenstock fragend, »ein ungebräuchliches Wort, heißt stechen, wenn es sich um eine Biene handelt, oder um eine Wespe, oder sonst um ein Insekt.«
»Hallo!« Dr. Thévenoz schnalzte mit den Fingern. »Stimmt auffallend. Sehen Sie sich diesen Arm an. Nun? Der Flecken da am Ellbogengelenk?… Sieht der nicht wie eine Injektion aus? Eine intravenöse Einspritzung?… Vergiftet? Aber welches Gift? Was meinten Sie, mein blonder Engel?« Die letzten Worte galten Schwester Annette, die sich Mühe gab, zu erröten.
»Rosenstock, geliebtester meiner Schüler, welche Diagnose wird Ihrem Hirn entsteigen, weisheitsgepanzert, wie seinerzeit eine griechische Göttin dem Schädel ihres Vaters -- was übrigens eine merkwürdige Art vegetativer Vermehrung war, verzeihen Sie den schlechten Witz! --. Woran krankt der junge Mann? Welches Gift tobt in seinen Adern, um mich jener Ausdrucksweise zu bedienen, die geldverdienenden Schreibern eigen ist? Reden Sie, Rosenstock! Vergessen Sie Ihre Abstammung! Vergessen Sie das Sprichwort, welches das Schweigen mit dem Goldstandard in Verbindung bringt. Bekehren Sie sich zum Bimetallismus, lassen Sie das Silber Ihrer Rede erklingen, ich lausche.«
Schwester Annette kicherte ein Backfischlachen, auch Rosenstock lächelte, er liebte es, gehänselt zu werden. Doch als er antworten wollte, unterbrach ihn Doktor Thévenoz wieder.
»Wie, Rosenstock, Sie wollen ein Gutachten abgeben? Ohne den Patienten untersucht zu haben? Sie wollen sprechen und noch wissen Sie nichts von der Anamnese des Falles? Rosenstöcklein, bedenken Sie, Sie sind noch kein Professor, der mit nachtwandlerischer Sicherheit Kohl verzapfen darf -- intuitiv -- verstehen Sie? Sie sind erst Assistent, und als solcher zu höchster, zu strengster Gewissenhaftigkeit verpflichtet. Ich will Ihnen helfen. Der junge Mann hier -- ruhig, junger Mann! Ich bin daran, Ihren Fall zu explizieren, ich muß Sie dringendst bitten, mich nicht zu unterbrechen« -- der Patient stöhnte nämlich leise, warf sich herum, murmelte auch: »was sagen Sie, junger Mann?«
»Er hat Durst«, bemerkte Rosenstock.
»Glaub’ ich, wir könnten ihm vielleicht…«
Schwester Annette hatte schon ein Glas in der Hand und stützte den Patienten, um ihm das Trinken zu erleichtern.
Doktor Thévenoz seufzte tief:
»Ich möchte auch einmal krank sein und mich von Ihnen pflegen lassen, Sie sind so sanft, mein blonder Engel, und ich muß mich die ganze Zeit mit einer energischen Frau herumschlagen, die gar kein Gefühl hat für meine Zartheit.«
Es war bekannt im Spital, daß Dr. Thévenoz mit einer Kollegin verlobt war, die in der Irrenanstalt Bel-Air als Assistentin Dienst tat. Und auch an die Klagen des Arztes war man gewöhnt; die Dame -- sie hieß Madge Lemoyne, war in Amerika geboren und auch dort aufgewachsen -- mußte sehr energisch sein.
»Ja, Rosenstock, das Leben ist schwer. Denken Sie, Madge hat mir heute morgen angeläutet, sie müsse mich unbedingt sprechen. Dabei haben wir uns gestern abend noch gezankt. Was will sie nur?«
Thévenoz versank in Nachdenken, während Rosenstock den Körper des Patienten abklopfte. Es war ein sauberer Körper, braun gebrannt, sehnig, die Haut roch schwach nach Lavendel. Störend war einzig der große rote Fleck in der Ellbogenbeuge, der aussah, wie ein beginnender Ausschlag.
Dr. Thévenoz war ans Fenster getreten, um seinem Assistenten Platz zu machen. Von dorther kam seine Stimme, sachlich referierend: »Heute nacht hatte ich Dienst. Um 2:15 wurde ich angerufen. Professor Dominicé, einer meiner Lehrer, teilte mir mit, er habe an der Place du Molard einen jungen Mann gefunden, der offenbar an einer Vergiftung erkrankt sei. Er bat mich, das Sanitätsauto zu schicken, der Fall scheine schwer, es wäre gut, wenn der Patient bald in fachgemäße Behandlung käme. Auf meine Frage, ob er den Patienten kenne, hängte der Professor ab. Er sprach sonderbar unfrei am Telephon, er wiederholte sich oft. Ich hatte Mühe, ihn zu verstehen. Nun, hier ist der junge Mann, was haben Sie gefunden?«
»Ja«, sagte Rosenstock und schwieg.
»Nun, los, los, Rosenstock! Sie werden mich doch nicht blamieren wollen!«
»Also, mir scheint«, begann Rosenstock, »es könnte sein, daß der Einstich in der Ellbogenbeuge in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergiftung stünde.«
Er schwieg wieder und kratzte an seiner Nase, die dick war und knollig.
»Ein merkwürdiger Einstich!«
Er tippte mit dem Finger, der die Nase verlassen hatte, auf die entzündete Stelle.
»Es sieht aus, als hätte eine ungeschickte Hand eine intravenöse Injektion versucht. Und zwar scheint ein beträchtliches Quantum Gift eingespritzt worden zu sein. Dieses Gift… -- Nun, die Alkaloide des Opiums, als da sind Heroin, Codein, Morphin, schalten aus. Von wegen den vergrößerten Pupillen. Es käme nur die Gruppe der Tropeïne in Betracht, und wir haben die Auswahl zwischen Atropin, Scopolamin und Hyoscyamin. Hyoscyamin!« wiederholte Rosenstock und kostete das Wort aus wie einen Leckerbissen, »es klingt wie ein Frauenname aus einem Maeterlinckschen Stück. Das aktive Prinzip von Hyoscyamus niger, dem Bilsenkraut, einem Nachtschattengewächs. Bilsenkraut! -- Das hatte eine große Beliebtheit bei den Hexen des Mittelalters, ihre Flugträume hingen mit den Wirkungen dieser Pflanze zusammen. Sie nahmen das Zeug äußerlich, die Hexen, als Salbe, soviel ich mich erinnere. Haben Sie die Frage einmal studiert, Dr. Thévenoz? Sehr interessant! Wir sind hoffnungslos phantasiearm geworden, finden Sie nicht auch? Ich empfehle Ihnen, den Hexenhammer zu lesen, unglaubliche Geschichten werden Sie darin finden. Dinge, die auch Fräulein Dr. Lemoyne interessieren dürften, da sie doch zur Seelenkunde übergegangen ist.«
»Hören Sie auf, hören Sie auf! Schwätzer! Man merkt, daß Sie von Talmudisten abstammen. Ich bin ja einverstanden mit Ihnen. Hyoscyamin natürlich. Wird schwer nachzuweisen sein. Isomer und solche Geschichten… Wenn wir nur endlich einmal wüßten, wer…«
Da ging die Türe auf. Eine Frau, trotz der sommerlichen Hitze in dunkles Blau gekleidet, betrat das Zimmer. Sie schritt zum Bett, sah lange auf den Kranken und legte ihm die Hand auf die Stirn.
»Armer Junge!…« sagte sie.
»Wer sind Sie? Wie kommen Sie herein? Was fällt Ihnen ein?« Doktor Thévenoz überstürzte seine Fragen. Die Frau sah ihn einen Augenblick an, dann wandte sie sich zur Tür.
»Ich habe nur gehört von dem Unglück. Und ich wollte sehen«, sagte sie still. Und dann fiel die Tür hinter ihr zu. Thévenoz wollte ihr nachlaufen, aber in der Tür stieß er mit einer Schwester zusammen.
»Es will Sie jemand am Telephon sprechen«, sagte die Schwester.
»Mann oder Frau?« fragte Thévenoz wild.
»Es war eine Männerstimme«, antwortete die Schwester, und lächelte dazu ein wenig impertinent.
»Gut«, nickte Thévenoz. Er hatte den geheimnisvollen Besuch scheinbar vergessen, denn er verschwand.
3
Also, jetzt erzählen Sie einmal klar und deutlich, mein lieber Malan; aus Ihrem Rapport wird ja niemand klug.«
Kommissär Pillevuit ließ die Hand über seinen langen gelben Bart gleiten und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Polizist Malan stotterte…
»Nein, so geht das nicht. Warten Sie!«
Kommissär Pillevuit holte eine Flasche aus einem Fach seines Schreibtisches, füllte ein Glas mit einer wasserklaren Flüssigkeit -- sie roch bedenklich nach Alkohol --. Malan trank, räusperte sich… und dann konnte er plötzlich reden.
»Also, ich will einmal resümieren«, sagte Kommissär Pillevuit. »In der Toilette war ein Mann versteckt, der weiße Tennishosen trug. Groß? Klein? Das wissen Sie nicht?… Außerdem haben Sie Drähte aufgelesen, von denen jener Professor behauptet, sie seien zum Putzen von Hohlnadeln bestimmt. Wo sind diese Drähte?… Die hat der Professor mitgenommen! So, so… Werden ihn später anläuten. -- Und Sie finden, dieser Professor habe sich sonderbar benommen? Inwiefern sonderbar?… So, als ob er mit der Geschichte etwas zu tun gehabt hätte?… nicht?… aha, so, als ob er den jungen Mann kennen würde. Ich verstehe. Und Sie haben den Professor ans Spital telephonieren lassen, der junge Mann ist abgeholt worden… warten Sie, ich will schnell das Spital anrufen… Ja, hier Stadtpolizei. Ein junger Mann ist eingeliefert worden diese Nacht. Ich brauche einige Angaben, wer behandelt ihn? So, wollen Sie ihn ans Telephon rufen? Danke… Guten Tag Doktor, wir kennen uns ja… Ja, ja… Hören Sie, was hat der junge Mann, den Sie da behandeln?… Mysteriöse Angelegenheit? Wieso mysteriös? Es gibt nichts Mysteriöses. Was Sie nicht sagen!… Vergiftung?… Wie sagen Sie?… verteufelter Name! Werde ich mir nie merken können. Hab’ nie von diesem Gift gehört… Ah? Nicht möglich? Raffinierter Mordversuch?… Ja, ich sag’ es ja immer, seit dieser verdammte Völkerbund unsere Stadt unsicher macht, hat man nur Scherereien… Von einer fremden Delegation? Natürlich! Was hab’ ich Ihnen gesagt?… Sie glauben, Sie können ihn durchbringen?… Desto besser. Keine Anhaltspunkte? Ich meine, was seine Personalien betrifft? Gar nichts?… Ja, Professor Dominicé, ich weiß. Ich werde mich bei ihm erkundigen. Danke, Doktor, leben Sie wohl… Morgen vielleicht?… Gut, gut!«
Nach diesem Gespräch schwitzte Kommissär Pillevuit außerordentlich. Er bedurfte einer Erquickung. Also entließ er den Polizisten Malan und ging in eine kleine, nahe gelegene Weinstube, wo er die verlorene Flüssigkeit mit Hilfe von Waadtländer Wein ersetzte.
4
Seine Exzellenz Sir Avindranath Eric Bose hatte die Gesichtsfarbe jener alten Herren, die den Winter hindurch in Davos oder St. Moritz Curling gespielt haben und gewohnt sind, sich von den Anstrengungen dieses sanften Spieles bei einem Whisky Soda oder einem heißen Gin zu erholen. Übrigens war Sir Eric Baronet des Königreichs Großbritannien, bevollmächtigter Delegierter eines indischen Randstaates, eines kleinen Staates, der seinen eingeborenen Fürsten vertrieben und Sir Eric zum Landpfleger erkoren hatte. Eigentlich nur um seinen Untertanen zu schmeicheln, hatte Seine Exzellenz den merkwürdigen Namen »Avindranath« angenommen. Er stammte nämlich aus Sussex und hatte Nationalökonomie studiert. Das war schon lange her. Er langweilte sich oft in seinem Randstaat, darum war ihm der Völkerbund ein willkommener Vorwand zu einer Europareise; die Schweiz gefiel ihm ausnehmend.
Es war tiefer Nachmittag. Seine Exzellenz war spät aufgestanden, noch unrasiert, und diesen Mangel behob soeben sein Kammerdiener Charles. Während dieser den Pinsel sanft über die roten Wangen seines Herrn führte, erkundigte sich Sir Eric:
»Charles, noch immer keine Nachricht von Crawley?«
Charles stellte den Pinsel ab, zog ein Messer aus seiner oberen Rocktasche und begann es abzuziehen. Erst dann antwortete er:
»Nein, Sir.« Und er verneigte sich dazu.
Sir Eric wollte etwas bemerken, aber da das Messer soeben über seiner Oberlippe schwebte, verschluckte er die Bemerkung.
»Schmerzt es, Sir?« erkundigte sich Charles, und seine Exzellenz verneinte mit einem Grunzen.
Klopfen an der Türe.
»Gestatten Sie, Sir, daß ich mich erkundige, was los ist?« fragte Charles, klappte das Messer zu und ließ Sir Eric mit einer halb rasierten Gesichtshälfte sitzen. An der Türe führte der Diener ein leises Gespräch, kehrte zurück, um Seiner Exzellenz mitzuteilen, es seien zwei Ärzte draußen, die Seine Exzellenz zu sprechen wünschten.
»Bin nicht krank«, bemerkte Sir Eric mürrisch.
»Sie wünschen eine private Unterredung«, sagte Charles mit neutraler Stimme.
»Sie sollen warten«, bestimmte Sir Eric.
»Ich habe mir erlaubt, diese Weisung zu geben.«
»Warum fragen Sie mich dann?« Seine Exzellenz war ungnädig. Sie fuhr mit der Hand durch ihr spärliches weißes Haar, so, als leide sie an einer unerträglichen Migräne.
Im Empfangssalon des Hôtel de Russie -- Empfangssalon: hoffnungsloser Luxus, Beschreibung unnötig, Sie kennen das schon aus verschiedenen Filmen -- stritt sich Dr. Thévenoz mit seiner Braut, Frl. Dr. Madge Lemoyne. Diese Madge Lemoyne hatte ein Gesicht wie eine expressionistische Madonna, trug ihre Haare ungewöhnlich kurz, Herrenfrisur, Scheitel auf der Seite. Zu bemerken wäre noch, daß sie sehr geschmackvoll gekleidet war, roter ärmelloser Jumper, kurzer Rock, von einem raffinierten Braun, das ihre sonnverbrannte Hautfarbe gut zur Geltung brachte. Ihr Körper wirkte sehr weich; vielleicht war dies der Grund, daß sie es stets liebte, eine gewisse Härte in ihrem Verhalten hervorzukehren.
»Jonny«, sagte sie -- sie nannte ihren Freund, den Dr. Thévenoz, stets Jonny, obwohl er Jean hieß, und schon dieser Name brachte den Arzt in Harnisch -- »wird uns der alte Herr noch lange warten lassen? Ich bin sicher, daß Ronny sich unten langweilt.«
Ronny war Madges Airedalehund, und Ronny wartete unten im kleinen Amilcar-Zweisitzer, der Madge und ihren Freund -- vermeiden wir lieber das Wort »Verlobter« oder »Bräutigam«, denn Madge haßte diese Worte -- vom Spital zum Hôtel de Russie geführt hatte.
»Nenn mich bloß nicht Jonny«, klagte Dr. Thévenoz, »ich will nichts mit England zu tun haben. Ich bin Genfer, ich bin Schweizer, du sollst mich Jean nennen, verstehst du?« Madge grinste wie ein Schulmädel. Sie hatte breite Zähne, was nach dem Urteil eines Frauenkenners ein Zeichen von Intelligenz sein soll. Ich kann darüber nicht urteilen.
Sir Eric erschien. Er duftete nach Kölnisch Wasser und die Röte seines Gesichtes war mit Puder temperiert. Er war wirklich ein wohlgepflegter, alter Herr, noch nicht verfettet, sein glattes Gesicht lag in höflichen Falten, und er verneigte sich mit Würde. Sogar das Erstaunen über die Anwesenheit einer Dame (war nicht von zwei Ärzten die Rede gewesen?) hielt sich durchaus in den Grenzen des Anstands.
»Dr. Thévenoz«, stellte sich der Arzt vor, und »eine Kollegin, Dr. Madge Lemoyne.« Madge neigte den Kopf, Seine Exzellenz beugte sich nieder zum Handkuß. Sir Eric hatte eine Schwäche für moderne Frauen, die sich gut anzogen.
Madge überschüttete Seine Exzellenz mit einer Sturzflut englischer Erklärungen. Dr. Thévenoz stand ein wenig dumm daneben. Sir Eric hörte interessiert zu, dann wandte er sich an Thévenoz:
»Ihre Kollegin erklärt mir soeben«, -- Sir Erics Französisch war ein wenig mühsam -- »daß mein Sekretär Crawley als Patient in Ihrer Behandlung steht. Er wurde gestern, so sagt Madame, auf der Place du Molard gefunden, unter… unter mysteriösen Umständen. Vergiftung, wie? Und nur einem Zufall haben wir es zu verdanken, daß er erkannt worden ist. Das heißt noch nicht definitiv erkannt…«
»Die Sache ist folgende, Exzellenz«, sagte Dr. Thévenoz, und man sah ihm die Erleichterung an, daß er endlich sprechen durfte. »Frl. Lemoyne besucht Prof. Dominicé sehr oft, er war auch mein Lehrer, aber wir sehen uns nur selten, ich bin sehr beschäftigt. Spitaldienst ist anstrengender als Psychiatrie.«
Thévenoz freute sich ersichtlich über seine Bosheit, aber sie verpuffte wirkungslos. »Nun, Prof. Dominicé hat sich heute morgen erinnert, daß er jenen jungen Mann, den er mir zur Behandlung überwiesen hat, eigentlich doch erkannt habe. Es sei der Sekretär Eurer Exzellenz, Crawley, der, wie mir Dr. Lemoyne mitteilte, häufig als Besuch im Hause des Professors gewesen ist. Da sich nun der Professor nicht ganz wohl fühlt, hat er Frl. Lemoyne gebeten, Eure Exzellenz aufzusuchen und Sie zu bitten, mit uns ins Spital zu kommen.«
»Ich komme, natürlich komme ich sofort.« Sir Eric tat sehr aufgeregt. Er lief im Salon hin und her und ließ ein horngefaßtes Monokel an einem breiten, schwarzen Seidenband um seinen Zeigfinger rotieren.
»Charles«, rief er plötzlich. Ein zweiter Ruf war unnötig. Schon stand der Kammerdiener in der Türe, verneigte sich und fragte:
»Sir Eric?«
»Sagen Sie, Charles, hat Crawley nicht gestern abend jenen… Vertragsentwurf mitgenommen… zum Abschreiben, wie er sagte. Sie, Charles, dieser Entwurf ist wichtig, unendlich wichtig, wenn der in… in… -- doch das interessiert Sie nicht, hat er ihn mitgenommen?«
»Herr Crawley trug eine Aktenmappe, jawohl, Sir. Er sagte, er wolle noch jemandem diktieren, es könne länger dauern. Ich hatte gestern abend zu tun, sonst wäre ich ihm gefolgt. Soll ich mich erkundigen?«
»Nein, lassen Sie nur, ich werde sehen.«
Sir Eric Bose war undiplomatisch aufgeregt. Madge und Thévenoz betrachteten ihn verwundert.
»Das Auto, Charles, ich muß ins Spital! Crawley ist, scheint es, dort eingeliefert worden. Ich muß mich um ihn kümmern, wäre mir leid, wenn dem Jungen etwas passiert wäre. Auf was warten Sie, Charles? Gehen Sie!«
Charles war nicht aus der Ruhe zu bringen.
»Panama oder Filzhut, Sir? Ich würde zu Panama raten. Es ist heiß.«
»Bringen Sie, was Sie wollen, aber schnell, schnell…«
5
Der junge Mann, der nach dem Urteil zweier Ärzte an einer Hyoscyamin-Vergiftung litt, lag noch immer im weißen Isolierzimmer unter der Obhut von Schwester Annette. Sir Eric betrat als erster das Zimmer, gefolgt von Dr. Thévenoz. Madge erschien ein wenig später, ihr Zweisitzer war unterwegs aufgehalten worden.
»Hallo, Boy«, sagte er, »What’s the matter with you?«
Aber der »Boy« antwortete nichts. Er verdrehte nur die Augen.
»Ja, es ist mein Sekretär«, sagte Seine Exzellenz und blickte hilflos umher.
»Name, Vorname, Geburtsort, Jahrgang?« fragte Thévenoz streng und achtete nicht auf Madges vorwurfsvolle Blicke. Fräulein Lemoyne bemühte sich dann, diese abrupte Fragestellung bei Seiner Exzellenz zu entschuldigen. Aber Sir Eric setzte ein nachsichtiges Lächeln auf und antwortete bereitwilligst:
»Der junge Mann heißt Walter Crawley, ist in Bombay am 5 März 1902 geboren, stammt von englischen Eltern, kam später nach England, studierte dort. Seine Eltern sind schon früh gestorben. Freunde von diesen haben mir Crawley empfohlen. Er war mir sehr nützlich, denn er war ein verläßlicher Bursche, bis in die letzte Zeit. Ich weiß nicht, was da plötzlich mit ihm los war. Er war zerstreut, bedrückt; ich habe immer gedacht, das würde vorübergehen. Wenn Sie meine Angaben der Polizei mitteilen wollen -- bitte sehr. Übrigens stehe auch ich immer gerne zur Verfügung…«
Thévenoz nickte und verließ das Zimmer, die Zurückgebliebenen schwiegen. Nur Crawley in seinem Bett murmelte von Zeit zu Zeit, aber man schenkte diesem Murmeln keine Beachtung. Manchmal klang es nach »old man«, auch »professeur« war zu verstehen. Dann schien sich der Kranke gegen etwas zu wehren, sprach von »fly«, worüber Seine Exzellenz den Kopf schüttelte.
»Der Junge war nie von Aeroplanen begeistert, ein seltener Fall, bei unserer heutigen Jugend, er behauptete immer, er werde seekrank, wenn wir ausnahmsweise das Flugzeug benützen mußten.«
Seine Exzellenz schlug nun vor, die Kleider des Kranken eingehend zu untersuchen. Aber Schwester Annette wehrte sich gegen diesen Vorschlag. Man solle die Rückkunft des Arztes abwarten, meinte sie. Als Dr. Thévenoz bald darauf wieder eintrat, wurden die Kleider Crawleys gebracht. Aber die Taschen waren leer. Sir Eric endlich fand, als er durch ein Loch im Rockfutter griff, eine Visitenkarte. Sie glich der von Professor Dominicé am Morgen gegen zwei Uhr dem Polizisten Malan überreichten. Es waren darauf noch Schriftzeichen zu lesen, winzige Buchstaben. Madge Lemoyne konnte folgendes entziffern:
»Lieber Crawley, es wird mich freuen, Sie heute abend gegen acht Uhr bei mir zu sehen. Freundschaftlich Ihr D.«
»Höchst… höchst bedenklich«, äußerte sich Sir Eric. Er hielt das Monokel vors Auge, wie eine Lupe, und las die Mitteilung zum zweitenmal.
»Wieso bedenklich?« wollte Thévenoz wissen. »Die Erklärung, die der Professor wird geben können, wird sicher höchst einfach sein.«
»Wir werden sehen«, sagte Sir Eric und steckte die Karte ein. »Ich werde sie selber der Polizei übergeben.«
Zuerst wollte Thévenoz gegen die Mitnahme der Karte protestieren, aber das Gebaren des vernachlässigten Patienten störte ihn. Walter Crawley benahm sich reichlich sonderbar. Er ließ röchelnde Atemzüge laut werden, seine Gesichtsfarbe wurde fahl und grau, auf der Stirn bildeten sich Schweißtropfen. Wladimir Rosenstock, der Assistenzarzt, der vor kurzem eingetreten war, beschäftigte sich mit ihm.
»Hopp, hopp, Schwester!« flüsterte er erregt. Dr. Thévenoz war auch ans Bett getreten. Flüsternd gab er der Schwester Befehle. Diese rannte aus dem Zimmer, kehrte mit einer Spritze zurück.
Aber da spannte sich Crawleys Körper so, daß er einen Bogen bildete: nur Fersen und Hinterkopf lagen auf. Dann war ein Knacken zu hören, wie von brechendem Holz, und Walter Crawley, von Bombay (Indien), Sekretär Seiner Exzellenz Sir Avindranath Eric Bose, blieb entspannt liegen und hatte das Atmen vergessen. Um seinen Mund entstand langsam ein niederträchtig-höhnisches Lächeln, so, als wolle er sagen: »Gewiß, ich bin nun tot, aber damit ist meine Angelegenheit noch lange nicht erledigt. Ihr alle werdet euch über meinen Abgang noch den Kopf zerbrechen.« Dies sollte auch tatsächlich geschehen. Vorerst aber schien Thévenoz nur erstaunt, schüttelte den Kopf, jagte die Anwesenden aus dem Zimmer und blieb mit dem Toten allein.
6
Es gibt Leute, die ein Reizmittel einem Nahrungsmittel vorziehen; wenn sie hungrig sind und kein Geld haben, ziehen sie eine Zigarette einem Stück Brot vor. Dr. Thévenoz war ähnlich veranlagt. Nach dem Urteil seiner Bekannten wäre er mit einer einfachen Frau, einer jener besorgten, mütterlichen Naturen, durchaus glücklich geworden. Er zog aber dem Roggenbrot, wie gesagt, die Zigarette vor und verliebte sich in Fräulein Dr. Madge Lemoyne. Der Verkehr mit Madge war so anstrengend, daß er fünf Kilo Körpergewicht verloren hatte, und diesen Verlust hatte er bis jetzt nicht wieder zu ersetzen vermocht.
Ja, ein Zusammensein mit Madge zerrte an den Nerven. Eine schottische Dusche -- heißer Wasserstrahl, gleich darauf eiskalter -- kann, sparsam gebraucht, eine angenehme Entspannung erzeugen. Wird sie aber zu oft wiederholt, so kann sie zur Tortur werden. Madge konnte zärtlich sein, plötzlich, nach einem Wort, das ihr nicht paßte, wurde sie ausfallend und spielte die Gekränkte -- um ebenso unbegründet wieder einzulenken. Merkwürdig war, daß sie sich nur mit Thévenoz so benahm. Andere Leute rühmten ihre Gutmütigkeit, ihr ausgeglichenes Wesen. Manchmal schien es, als sei sie noch auf der Suche nach dem passenden Partner und habe Thévenoz nur so zum Zeitvertreib genommen, aus Furcht vielleicht vor jener Einsamkeit, vor jenem Sich-nutzlos-fühlen, das viele berufstätige Frauen wie eine Art schlechten Gewissens mit sich herumschleppen.
Walter Crawley war um halb fünf gestorben. Thévenoz hatte den Abend frei und so bat er Madge, mit ihm zusammen zu Nacht zu essen. Aber Fräulein Dr. Lemoyne wünschte, nachher noch tanzen zu gehen.
Thévenoz, der über einen nicht sehr beweglichen Körper verfügte, seufzte, als vom Tanzen die Rede war, aber er ergab sich in sein Schicksal. Er versuchte gewaltsam, lustig zu sein, und vermied es, von Crawleys Ableben zu sprechen. Erst, als er im Auto saß (zuerst hatte er noch einen kleinen Kampf mit Madges Airedaler Ronny zu bestehen, der nur sehr widerwillig seinen Platz dem unsympathischen Eindringling -- der Hund war obendrein noch eifersüchtig -- einräumte), erst im Auto, nach einem langen, drückenden Schweigen, sagte Thévenoz:
»Was nur der Meister mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat!«
Madge hakte sofort ein: »Erstens verstehe ich nicht, warum du Dominicé immer den Meister nennst. Obwohl… Und dann: Was soll der alte Mann mit dieser Vergiftungsgeschichte zu tun haben? Ich bitte dich! Ich weiß, daß Crawley seine Kurse besucht hat. Auch sonst war er manchmal beim Professor. Aber daß der alte Herr mit der Ermordung des Sekretärs etwas zu tun haben soll, das ist doch lächerlich.«
»Und die Karte? Gestern war Crawley also doch beim Meister. Beim Meister! Ich nenne ihn so! Du hast kein Gefühl für die Bedeutung dieses Mannes. Weißt du denn überhaupt, daß er unsere einzige Genfer Berühmtheit ist? In okkulten Fragen? Ich hab’ dir doch sein Buch zum Lesen gegeben.«
»Ja«, sagte Madge versöhnlich, »sein Buch ist gut; aber es ist alt. Wann hat er es geschrieben? Vor zwanzig Jahren? Inzwischen ist doch viel Wasser durch den Genfersee geflossen und viel Blut in der Erde versickert.«
»Alt? Sein Buch? Dessoir zitiert es, Schrenck-Notzing, Österreicher. Sogar Flammarion. Und da behauptest du, daß es veraltet ist?«
Madge war über diese Rede so erstaunt, daß der Wagen einen Zickzackkurs einschlug. Sie blickte kurz auf ihren Freund.
»Seit wann beschäftigst du dich mit diesen Fragen? Ich habe geglaubt, du interessiert dich überhaupt nur für Blutsenkungen und Harnanalysen? Seit wann liest du Séancenprotokolle?«
Thévenoz errötete wie ein ertappter Schulbube. Aber er zog sich geschickt aus der Situation:
»Seit ich eine Freundin habe, die sich mit Seelenkunde befaßt.«
Darauf schwieg Madge. Nach einer kleinen Pause fragte sie:
»Wer ist diese furchtbare Frau, die beim ›Meister‹ -- wie du sagst -- als Haushälterin dient?«
»Ah, du meinst Jane Pochon? Warum furchtbar? Sie sieht nicht schön aus, die Jane, alt ist sie auch. Ja, das ist ein ehemaliges Medium. Diese Jane spielt die Hauptrolle in seinem Buch. Der Meister hat sie in einem spiritistischen Zirkel kennengelernt, hat dann mit ihr allein Sitzungen abgehalten. Später hat sie sich verheiratet, ihr Mann war ein Trinker, er ist gestorben und hat sie mit einem Buben allein gelassen. Da hat sie der Professor bei sich aufgenommen, zuerst wohnte sie bei ihm, jetzt hat sie sich, glaub’ ich, eine kleine Wohnung eingerichtet und vermietet Zimmer. Aber wie ich gehört habe, hat sie kein Glück damit. Ihr letzter Mieter war ein Bankbeamter, den mußt du kennen, der ist ja jetzt bei euch oben, in Bel-Air, plötzlich verrückt geworden, erzählte die Frau, wart einmal, hieß er nicht Crottaz, Crossat oder so ähnlich?«
»Corbaz meinst du. Ja, jetzt erinnere ich mich. Diese Jane Pochon hat ihn damals gebracht, da hab’ ich sie auch zuerst gesehen, wir glaubten an ein Alkoholdelir, aber dann war es nur eine simple Schizophrenie. Verfolgungsideen, Stimmen, übrigens, er sprach auch immer von ›stechen‹, wie Crawley; jetzt hat er sich beruhigt und arbeitet im Garten.«
»So, stechen hat er gesagt«, stellte Thévenoz fest. Und dann schwieg er, bis sie vor dem kleinen Dorfwirtshaus in Jussy hielten, wo sie zu Nacht essen wollten. Während der Mahlzeit war Thévenoz sonderbar aufgeregt, er streichelte von Zeit zu Zeit Madges Hand, die auf dem Tisch lag, er, der Korrekte, der es sonst peinlich vermied, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeit zu zeigen. Madge ließ es geschehen, nur Ronny gefielen diese Demonstrationen nicht. Er bellte, ließ sich aber dann durch einen Brotbrocken, der in ausgelassene Butter getaucht worden war, beruhigen.
7
Die Latham-Bar in der Rue du Rhône ist jeden Abend gefüllt. Sie besitzt einen guten Mixer, der die Amerikaner anzieht, eine gute Kapelle, die manchmal auch Klassisches spielt, was die Engländer schätzen; die deutschen Diplomaten kommen wegen der französischen Lieder, weil sie bei diesen durch ein lautes Lachen beweisen können, daß sie die Pointen und Zweideutigkeiten verstehen, und also auf französischen Esprit geeicht sind. Im ganzen verkehrt dort ein internationales Publikum, in dem selbst Russen und Italiener nicht fehlen.
Thévenoz tanzte nicht gut. Erstens war der Platz, der inmitten der vielen Stühle für die Paare frei war, viel zu klein. Man mußte sich an den andern vorbeischieben, gab man nicht acht, so stieß man sich schmerzhaft an spitzen Ellenbogen oder bekam einen Absatz auf den Fußspann, was unangenehm war, besonders, wenn man Halbschuhe trug. Und dann war es entsetzlich heiß. Madge ärgerte sich, weil ihr Freund feuchte Hände hatte und Thévenoz mußte sich nach jedem Tanz die Hände waschen. Die Stimmung an ihrem kleinen Tisch war ungemütlich, Madge desertierte und tanzte oft mit einem jungen Mann, irgendeinem Balkaner mit Haaren wie geschmolzener Teer und einer Gesichtshaut, die in der Farbe an Tilsiter Käse erinnerte.
Während Thévenoz über seine Enttäuschung grübelte -- er hatte sich wirklich auf das Zusammensein mit Madge gefreut und nun kam es ganz anders -- während er vergebens versuchte, sich mit Ronny anzufreunden, der unter dem Tisch lag und, Kopf auf den Pfoten, ungnädig schielte, legte sich eine Hand auf seine Schulter.
»Darf ich mich setzen?« fragte Professor Dominicé. Er hatte viel Ähnlichkeit mit dem Apostel Petrus, wahrscheinlich war es auch der Havelock aus dünnem grauem Tuch, der an die Gewandung biblischer Figuren erinnerte.
Thévenoz sprang auf. »Meister«, sagte er, »Meister, welch guter Geist führt Sie her?«
»Kein guter Geist, der Geist der Unruhe und der Angst ist es…« Der Professor sprach so dröhnend, daß die Leute an den andern Tischen aufmerksam wurden. Thévenoz war bedrückt -- plötzlich sah er mit quälender Deutlichkeit den nackten Körper Crawleys, des Sekretärs, vor sich und den entzündeten Hof rings um den Stich in der Ellbogenbeuge -- war es ein Einstich?
»Setzen Sie sich, Meister, legen Sie den Mantel ab, es ist warm hier, ich muß Sie ein paar Sachen fragen. Was trinken Sie?«
»Mich friert«, sagte der Professor, dann rief er laut durch den Lärm: »Casimir!«
Ein Kellner in weißem Jäckchen arbeitete sich schwimmend durch die zähe Masse der Tanzenden. Der Professor schüttelte ihm schweigend die Hand. »Mich friert, Casimir«, wiederholte er, »einen Mokka double oder triple, besser noch triple, ich brauche Anregung.«
»Mit Kirsch, Professor?« fragte Casimir, kameradschaftlich, wie zu einem Gleichgestellten. Der Professor schüttelte den Kopf.
»Nein, nur stark, sehr stark!«
Dann versank Dominicé in ein Schweigen, das etwas unheimlich wirkte, und Thévenoz störte es nicht. Satzfäden durchzogen die Luft, die grau war vom Tabakrauch, sie wirkten ein buntes wirres Netz, das die beiden einspann. Dann kam Madge und zerriß das Netz.
Professor Dominicé stand auf, seine Höflichkeit wirkte wehmütig, wie ein Rokokostuhl inmitten von Stahlmöbeln.
»Liebes Kind«, sagte er, »wie freue ich mich, Sie zu sehen. Sie sind erhitzt, aber trotzdem ist Ihre Hand kühl geblieben. Das dünkt mich angenehm.«
Der Kellner brachte den Kaffee. Mit einem Seufzer zog der Professor seinen Havelock aus, legte ihn über einen Stuhl. Er trug einen langen grauen Gehrock, im Westenausschnitt war eine grauseidene Plastronkrawatte zu sehen.
»Ich habe mich einsam gefühlt, heute abend, es beschäftigt mich gar viel diese Tage«, er setzte sich umständlich, hob die Schöße seines Gehrocks, um unerwünschte Faltungen zu vermeiden.
Madge hatte die Hände gefaltet auf den Tisch gelegt, es waren kleine Mädchenhände mit stumpfen Fingern, die Nägel kurzgeschnitten und nicht sehr gepflegt.
Thévenoz nahm einen Anlauf. »Was ist das für eine Geschichte mit diesem Crawley, haben Sie ihn wirklich nicht erkannt, Meister?«
Dominicé unterbrach ein Gähnen, das er sich nicht die Mühe genommen hatte, hinter der Hand zu verbergen, seine Gesichtsfarbe war von einem ungesunden Grau, er nippte an dem heißen Kaffee. Seine Augen waren müde und ausdruckslos, ohne Glanz.
»Entschuldigt mich einen Augenblick«, sagte er, stand auf, tastete seine Taschen ab, so, als wolle er sich vergewissern, daß er ein notwendiges Requisit bei sich habe, dann ging er mit schleppenden Schritten über den in diesem Augenblick leeren Tanzplatz. Nach einigen Minuten kam er wieder, die Schritte, die Bewegungen des Körpers schienen die niederdrückende Müdigkeit wie ein staubigschweres Kleid abgestreift zu haben.
»Ja, die Geschichte mit Crawley«, sagte er, »ist merkwürdig. Merkwürdig für Laien, aber nicht für mich. Unser Perzeptionsvermögen«, und er begann eine lange psychologische Erklärung, die mit vielen Fremdwörtern beweisen sollte, daß das Nicht-Erkennen eines sonst bekannten Menschen eine alltägliche Angelegenheit sei.
So vertieft war der Professor in seine Erklärung, daß er ein wenig erschrak, als ein Vorübergehender ihn streifte. Ein Mann mit Wulstlippen war dies, die Poren der Gesichtshaut waren auffallend groß. Er entschuldigte sich wortreich. Neben ihm ging eine Frau, bei deren Anblick Thévenoz erregt aufspringen wollte. Während der Mann eifrig auf den Professor einsprach und dabei Madge anstarrte, flüsterte Thévenoz seiner Freundin zu:
»Das ist die Frau, die heute morgen Crawley besucht hat. Ich muß sie sprechen. Ich muß ihren Namen wissen --, sie soll mir sagen, was sie gewollt hat.«
Aber Madge hielt ihn zurück. Sie tat eifersüchtig -- ob sie es in Wirklichkeit war, konnte nicht festgestellt werden --, genug, sie packte Thévenoz’ Hand:
»Du wirst sitzen bleiben«, und ihre Stimme klang so drohend, daß Thévenoz gehorchte, denn eine Szene in einem öffentlichen Lokal war nicht nach seinem Geschmack.
Der Mann mit der großporigen Gesichtshaut hatte sein Gespräch mit dem Professor beendet, er verbeugte sich vor Madge und stellte sich vor: »Baranoff« (auf der zweiten Silbe betont). Dann entfernte er sich mit der hochgewachsenen Frau, die Thévenoz’ Interesse erregt hatte.
»Wer war das?« fragte Madge. Der Professor seufzte laut und gründlich. Sein Gesicht war noch grauer als sonst und ängstlich verzogen.
»Eine dunkle Persönlichkeit«, sagte er, »ein Russe, Baranoff heißt er, der, wie ich glaube, in irgendeiner Beziehung zu der Sowjetgesandtschaft steht, aber offiziell will die Delegation nichts mit ihm zu tun haben. Die Regierungen brauchen heutzutage, scheint es, derartige Subjekte«, Dominicé ballte die Fäuste auf dem Tisch, wie in hilfloser Wut, »um ihre dreckigen Geschäfte erledigen zu lassen. Geht etwas schief, so läßt man sie fallen und wäscht seine Hände in Unschuld. Wir leben in einer schmutzigen Zeit.«
»Und die Frau, die bei ihm war?« fragte Madge. »Thévenoz interessiert sich für sie, er wollte sie ansprechen, aber das dulde ich nicht.«
»Die Frau? Seine Sekretärin. Eine schöne Frau. Ich bin ihr einmal vorgestellt worden. Sie schien Mitleid mit mir zu haben. Natalja Ivanovna Kuligina heißt sie.«
»Sie kannte Crawley, den Sekretär«, platzte Thévenoz heraus. »Sie hat ihn heute morgen besucht, sie nannte ihn armer Junge. Mitleidig scheint sie zu sein. Ich wollte sie fragen, was sie eigentlich im Spital wollte, aber wenn Madge ihren Rappel hat…«
»Aber Jonny«, sagte Madge gefühlvoll. »Du solltest doch stolz sein, daß ich eifersüchtig bin.« Und sie legte ihre Hand auf Thévenoz’ Schulter, den die unerwartete Zärtlichkeit erstaunte.
»Sie kannte Crawley«, sagte der Professor und stützte den Kopf in die Hand. »Ich glaube wohl, daß sie Crawley kannte.«
Aber als Thévenoz und Madge in ihn drangen, sich ein wenig klarer auszudrücken, schüttelte Dominicé nur den Kopf. So ließen sie ihn schließlich allein sitzen.
Zweites Kapitel
1
D