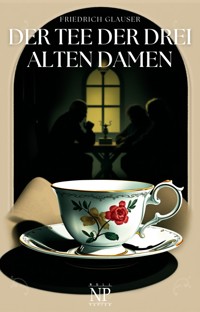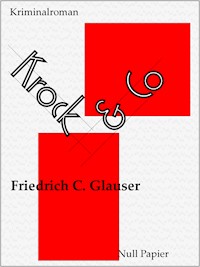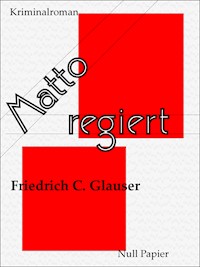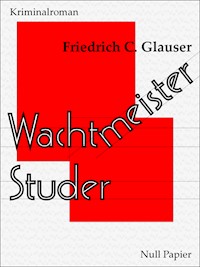0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wachtmeister Studer bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein kiffender Schweizer Columbo, der an Kauzigkeit jeden Bullen aus Tölz vergessen lässt. Es geht um die Aufklärung zweier aktueller und eines lange vergangenen ungeklärten Todesfalles -- es geht auch um Studers Jugendträume. Ein Teil der Handlung spielt bei der Fremdenlegion. Wie immer geht es um die armen Teufel, die das Leben über Gebühr gebeutelt hat und die es darum immer als Erste erwischt. Es geht um Religion - ein bisschen, um Liebe - auch und natürlich ums Geld. Wachtmeister Studer streitet sich mit dem französischen Geheimdienst. Und im all dem Chaos ist er der Einzige, der sich aufrichtig für das Schicksal der Beteiligten interessiert. Glauser gilt zu Recht als einer der bedeutendsten Schweizer Autoren des 20. Jahrhunderts, und was seinen Wachtmeister Studer angeht -- der steht als Fels in der Weltliteratur, vergleichbar nur mit Dürrenmatts Bärlach oder Maigret. Glauser ist nach der Auffassung von Erhard Jöst "einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Kriminalromans". Bei einer Umfrage im Jahr 1990 unter 37 Krimifachleuten nach dem »besten Kriminalroman aller Zeiten« landete Wachtmeister Studer als bester deutschsprachiger Krimi auf Platz 4. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Friedrich Glauser
Die Fieberkurve
Ein Wachtmeister Studer Kriminalroman
Friedrich Glauser
Die Fieberkurve
Ein Wachtmeister Studer Kriminalroman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Morgarten, Zürich, 1936 4. Auflage, ISBN 978-3-954181-89-6
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte vom Hellseherkorporal
Gas
Die erste Frau
Pater Matthias
Der kleine Mann im blauen Regenmantel und der andere
Die Geschichte vom ersten Daumenabdruck
Das Testament
Kanalräumen
Gangster in Bern und eine vernünftige Frau
Kommissaer Madelin macht sich unsichtbar
Studer in der Fremdenlegion
Der Hellseherkorporal nimmt Gestalt an
Capitaine Lartigue
Ein Morgen im Posten Gurama
Die Verhaftung
Die Verhandlung
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Wachtmeister Studer bei Null Papier
Wachtmeister Studer
Matto regiert
Die Fieberkurve
Der Chinese
Krock & Co
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Die Romane mit Wachtmeister Studer bei Null Papier
Wachtmeister Studer
Matto regiert
Die Fieberkurve
Der Chinese
Krock & Co
Andere Kriminalromane von Friedrich C. Glauser
Der Tee der drei alten Damen – Eine Kriminalgeschichte
Autor
Friedrich Charles Glauser (geboren Februar 1896 in Wien; gestorben 8. Dezember 1938 in Nervi bei Genua) war ein Schweizer Schriftsteller. Er gilt als einer der ersten deutschsprachigen Krimiautoren.
Schriftsteller zu sein, hieß für Friedrich Glauser zunächst, Gedichte zu schreiben. In der lyrischen Form glaubte er, sein inneres Erleben ausdrücken zu können. Vorbilder waren für ihn Stéphane Mallarmé und Georg Trakl; der Ton entspricht dem expressionistischen Tenor der Zeit am Ende des Ersten Weltkrieges. Doch keiner dieser Texte wurde gedruckt. Für die Sammlung seiner Gedichte, die Glauser 1920 zusammenstellte, fand sich kein Verleger. Seine Gedichte wurden daher erst posthum veröffentlicht.
In den letzten drei Lebensjahren schrieb Glauser fünf Kriminalromane, in deren Mittelpunkt Wachtmeister Studer steht, ein eigensinniger Kriminalpolizist mit Verständnis für die Gefallenen der Gesellschaft.
Der Kriminalroman »Matto regiert« spielt in einer psychiatrischen Klinik und man merkt ihm genauso wie den anderen Romanen an, dass der Autor eigene Erlebnisse verarbeitet hat. Mit eindringlichen Milieustudien und packenden Schilderungen der sozialpolitischen Situation gelingt es ihm, den Leser in seinen Bann zu schlagen.
Glauser ist nach der Auffassung von Erhard Jöst »einer der wichtigsten Wegbereiter des modernen Kriminalromans«. Seine Romane und drei weitere Bände mit Prosatexten wurden zwischen 1936 und 1945 veröffentlicht.
Glausers Nachlass befindet sich im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern.
Bei einer Umfrage im Jahr 1990 unter 37 Krimifachleuten nach dem »besten Kriminalroman aller Zeiten« landete Wachtmeister Studer als bester deutschsprachiger Krimi auf Platz 4.
Die Geschichte vom Hellseherkorporal
Da lies!«, sagte Studer und hielt seinem Freunde Madelin ein Telegramm unter die Nase. Vor dem Justizpalast war es finster, die Seine rieb sich glucksend an den Quaimauern, und die nächste Laterne war einige Meter weit entfernt.
»das junge jakobli lässt den alten jakob grüßen hedy«, entzifferte der Kommissär, als er unter dem flackernden Gaslicht stand. Obwohl Madelin vor Jahren an der Straßburger Sûreté gearbeitet hatte und ihm darum das Deutsche nicht ganz fremd war, machte es ihm doch Mühe, den Sinn des Satzes zu verstehen. So fragte er:
»Was soll das heißen, Stüdère?«
»Ich bin Großvater«, antwortete Studer mürrisch. »Meine Tochter hat einen Sohn bekommen.«
»Das muss man feiern!«, beschloss Madelin. »Und außerdem trifft es sich günstig. Denn heute hat mich ein Mann besucht, der mit dem Halbelf-Uhr-Zug in die Schweiz reist und mich gebeten hat, ihn an einen dortigen Kollegen zu empfehlen. Ich hab’ ihn auf neun Uhr in eine kleine Wirtschaft bei den ›Hallen‹ bestellt… Jetzt ist es…«, mit seinen Händen, die in Wollhandschuhen steckten, knöpfte Madelin seinen Überzieher auf, dessen Kragen sich von seinem Halse abwölbte, zog eine alte Silberuhr aus seiner Westentasche und stellte fest, dass es acht Uhr sei. »Wir haben Zeit«, meinte er befriedigt. Und während ihm die Bise seine ungeschützten Lippen zerriss, tat er einen tiefsinnigen Ausspruch: »Wenn man alt wird, hat man immer Zeit. Sonderbar! Geht’s dir auch so, Stüdère?«
Studer brummte. Doch wandte er sich brüsk um, denn eine hohe, krächzende Stimme sagte:
»Und ich darf doch auch Glück wünschen? Oder? Unserem verehrten Inspektor? Herzlich Glück wünschen?«
Madelin, groß, hager, und Studer, ebenso groß, nur massiger, mit breiteren Schultern, wandten sich um. Hinter den beiden hüpfte ein winziges Wesen – zuerst wusste man nicht, war es eine Frau oder ein Mann: der lange Mantel fiel bis zu den Knöcheln, das Béret war bis zu den Augenbrauen gezogen, der Wollschal verhüllte die Nase – sodass nur die Augen freiblieben, und auch diese versteckten sich hinter den Gläsern einer riesigen Hornbrille.
»Pass auf, Godofrey!«, sagte der Kommissär Madelin. »Dass du dich nicht erkältest! Ich brauch’ dich morgen. Die Sache mit Koller ist nicht klar. Aber ich hab’ die Papiere erst heute Abend bekommen. Morgen musst du sie untersuchen! Es stimmt etwas nicht mit den Papieren des Koller…«
»Danke, Godofrey«, sagte Studer. »Aber ich lade euch beide ein. Schließlich, wenn man Großvater ist, darf man sich nicht lumpen lassen…« Und er seufzte.
Das junge Jakobli lässt den alten Jakob grüßen, dachte er. Nun ist man Großvater und hat die Tochter also endgültig verloren. Wenn man Großvater ist, dann ist man alt – altes Eisen. Aber es ist doch eine Glanzidee gewesen, dass man die Flucht ergriffen hat vor der leeren Wohnung auf dem Kirchenfeld und dem unaufgewaschenen Geschirr im Schüttstein. Besonders aber vor dem grünen Kachelofen im Wohnzimmer, den nur die Frau richtig anheizen kann: versucht man es selbst, so raucht und qualmt der Donner wie eine schlechtgewickelte Brissago – und geht aus. Hier in Paris ist man vor solchen Katastrophen sicher. Man wohnt beim Kommissär Madelin, wird mit Achtung behandelt und ist nicht ein »Wachtmeister«, sondern ein »Inspektor«. Tagelang kann man bei Godofrey hocken, ganz oben, im Laboratorium unterm Dach des Justizpalastes und darf dem Kleinen zusehen, wie er Staub analysiert, Dokumente durchleuchtet. Der Bunsenbrenner pfeift leise, der Dampf in den Heizkörpern lauter, es riecht angenehm nach Chemikalien und nicht nach Bodenöl, wie im Amtshaus z’Bärn…
Die Marmortische in der Beize waren rechteckig und mit gerillten Papierservietten gedeckt. Ein schwarzer Ofen stand in der Mitte des Raumes, seine Platte glühte. Die große Kaffeemaschine summte auf dem Schanktisch und der Beizer – Arme hatte er, dick wie die Oberschenkel eines normalen Menschen – servierte eigenhändig.
Man begann mit Austern, und Kommissär Madelin ergab sich seiner Lieblingsbeschäftigung. Er hatte, ohne Studer zu fragen, einen 26er Vouvray bestellt, drei Flaschen auf einmal, und er trank ein Glas nach dem anderen. Dazwischen schlürfte er schnell drei Austern und kaute sie, bevor er sie schluckte. Godofrey nippte an seinem Glase wie ein schüchternes Mädchen; seine Hände waren klein, weiß, unbehaart.
Studer dachte an seine Frau, die nach Frauenfeld gefahren war, um der Tochter beizustehen. Er war schweigsam und ließ Godofrey plappern. Und auch Madelin schwieg. Zwei riesige Hunde – eine magere Dogge und ein zottiger Neufundländer – lassen ruhig und unberührt das Gekläff eines winzigen Foxterriers über sich ergehen…
Der Beizer stellte eine braune Terrine mit Kutteln auf den Tisch. Dann gab es bitteren Salat, drei volle Flaschen standen wieder vor den Dreien und waren plötzlich leer, zu gleicher Zeit wie die Platte mit dem zerfließenden Camembert – er hatte gestunken, aber er war gut gewesen. – Dann öffnete Kommissär Madelin seinen Mund zu einer Rede, wenigstens schien es so. Aber aus der Rede wurde nichts, denn die Tür ging auf und den Raum betrat ein Mann, der so sonderbar gekleidet war, dass Studer sich fragte, ob man in Paris Fastnacht vor Neujahr feiere…
Der Mann trug eine schneeweiße Mönchskutte und auf dem Kopfe eine Mütze, die aussah wie ein riesiger, roter Blumentopf, den ein ungeschickter Töpfer verpfuscht hat. An den Füßen – sie waren nackt, wahr und wahrhaftig blutt – trug er offene Sandalen; die Zehen konnte man sehen, den Rist; die Ferse war bedeckt.
Und Studer traute seinen Augen nicht. Kommissär Madelin, der Pfaffenfresser, stand auf, ging dem Manne entgegen, kam mit ihm zum Tisch zurück, stellte ihn vor: »Pater Matthias vom Orden der Weißen Väter…« – nannte Studers Namen: dies also sei der Inspektor der Schweizerischen Sicherheitspolizei.
Weißer Vater? Père blanc? – Dem Wachtmeister war es, als träume er einen jener merkwürdigen Träume, die uns nach einer schweren Krankheit besuchen kommen. Luftig und lustig zugleich sind sie und führen uns in die Kinderzeit zurück, da man Märchen erlebt…
Denn Pater Matthias sah genau so aus wie das Schneiderlein, das »Sieben auf einen Streich« erlegt hat. Ein spärliches graues Bärtchen wuchs ihm am Kinn und am Schnurrbart konnte man alle Haare zählen. Mager war das Gesicht! Nur die Farbe der Augen, der großen, grauen Augen erinnerte an das Meer, über das Wolken hinziehen – und manchmal blitzt kurz ein Sonnenstrahl über die Wasserfläche, die so harmlos den großen Abgrund verbirgt…
Wieder drei Flaschen…
Der Pater war hungrig. Schweigsam verzehrte er einen Teller voll Kutteln, dann noch einen… Er trank ausgiebig, stieß mit den anderen an. Er sprach das Französische mit einem leichten Akzent, der Studer an die Heimat erinnerte. Und richtig, kaum hatte sich der Weißbekuttete am Essen erlabt, sagte er und klopfte dem Berner Wachtmeister auf den Unterarm:
»Ich bin ein Landsmann von Ihnen, ein Berner…«
»A bah!«, meinte Studer, dem der Wein ein wenig in den Kopf gestiegen war.
»Aber ich bin schon lange im Ausland«, fuhr der Schneider fort – eh, was Schneider! Das war ja ein Mönch! Nein, kein Mönch… Ein… ein Pater! Ganz richtig! Ein weißer Vater! Ein Vater, der keine Kinder hatte – oder besser, alle Menschen waren seine Kinder. Aber man selbst war Großvater… Sollte man dies dem Landsmann, dem Auslandschweizer erzählen? Unnötig! Kommissär Madelin tat es:
»Wir feiern unseren Inspektor. Er hat von seiner Frau ein Telegramm erhalten, dass er Großvater geworden ist.«
Der Mönch schien sich zu freuen. Er hob sein Glas, trank dem Wachtmeister zu, Studer stieß an… Kam nicht bald der Kaffee? Doch, er kam, und mit ihm eine Flasche Rum. Und Studer, dem es merkwürdig zumute war – dieser Vouvray! Ein hinterlistiger Wein! – hörte den Kommissär Madelin zum Beizer sagen, er solle die Flasche nur auf dem Tisch stehen lassen…
Neben dem Wachtmeister saß Godofrey, der, wie viele kleine Menschen, übertrieben elegant gekleidet war. Aber das störte Studer nicht weiter. Im Gegenteil, die Nähe des Zwergleins, das eine wandelnde Enzyklopädie der kriminalistischen Wissenschaft war, wirkte tröstend und beruhigend. Der weiße Vater hatte seinen Platz an der anderen Seite des Tisches, neben Madelin…
Und dann war Pater Matthias mit Essen fertig. Er faltete die Hände vor seinem Teller, bewegte lautlos die Lippen – seine Augen waren geschlossen; er öffnete sie wieder, schob seinen Stuhl ein wenig vom Tisch ab, schlug das linke Bein über das rechte – zwei sehnige, behaarte Waden kamen unter der Kutte zum Vorschein. Er sagte: »Ich muss notwendig in die Schweiz, Herr Inspektor. Ich habe zwei Schwägerinnen dort, die eine in Basel, die andere in Bern. Und es ist gut möglich, dass ich in Schwierigkeiten gerate und die Hilfe der Polizei brauche. Würden Sie dann so freundlich sein und mir beistehen?«
Studer schlürfte seinen Kaffee und fluchte innerlich über Madelin, der das heiße Getränk allzu ausgiebig mit Rum gewürzt hatte; dann blickte er auf und erwiderte (auch er bediente sich der französischen Sprache):
»Die Schweizer Polizei beschäftigt sich sonst nicht mit Familienangelegenheiten. Um Ihnen helfen zu können, müsste ich wissen, worum es sich handelt.«
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Pater Matthias, »und ich wage kaum, sie zu erzählen, denn Sie alle«, seine Hand machte eine kreisförmige Bewegung, »werden mich auslachen.«
Godofrey protestierte höflich mit seiner Papageienstimme. Er nannte den Mönch »Mein Vater« – »mon père«, was Studer aus unerfindlichen Gründen äußerst komisch fand. Er lachte in seinen Schnurrbart hinein, prustete weiter, während er die wieder gefüllte Tasse zum Munde führte, und ließ das Prusten, um nicht Anstoß zu erregen, in ein Blasen übergehen – so als ob er den heißen Kaffee abkühlen wollte…
»Haben Sie sich je«, fragte Pater Matthias, »mit Hellsehen beschäftigt?«
»Kartenlegen? Kristallsehen? Telepathie? Kryptomnesie?« Godofrey leierte die Fragen ab wie eine Litanei.
»Ich sehe, Sie sind auf dem laufenden. Haben Sie sich viel mit diesen Dingen beschäftigt?«
Godofrey nickte. Madelin schüttelte sein Haupt und Studer sagte kurz: »Schwindel.«
Pater Matthias überhörte das Wort. Seine Augen waren in die Ferne gerichtet – aber die Ferne, hier in der kleinen Beize, war der Schanktisch mit seinem glänzenden Perkolator. Der Patron saß dahinter, die Hände über dem Bauch gefaltet und schnarchte. Die vier am Tisch waren seine einzigen Gäste. Das Leben in seiner Beize begann erst gegen zwei Uhr, wenn die ersten Karren mit Treibgemüse eintrafen…
»Ich möchte«, sagte der Weiße Vater, »Ihnen die Geschichte eines kleinen Propheten erzählen, eines Hellsehers, wenn Sie ihn so nennen wollen, denn dieser Hellseher ist daran schuld, dass ich mich hier befinde, anstatt die kleinen Posten im Süden von Marokko abzuklopfen, um dort für die verlorenen Schäflein der Fremdenlegion Messen zu lesen…
Wissen Sie, wo Géryville liegt? Vier Stunden hinterm Mond, genauer gesagt in Algerien, auf einem Hochplateau, siebzehnhundert Meter über dem Meeresspiegel, wie es die Inschrift auf einem Stein verkündet, der inmitten des Kasernenhofes steht. Hundertvierzig Kilometer von der nächsten Bahnstation entfernt. Die Luft ist gesund, darum hat mich der Prior dort hinauf geschickt im September vorigen Jahres, denn ich habe schwache Lungen. Es ist eine kleine Stadt, dieses Géryville, wenig Franzosen bewohnen sie, die Bevölkerung besteht zum größten Teil aus Arabern und Spaniolen. Mit den Arabern ist nicht viel anzufangen, sie lassen sich nicht gerne bekehren. Sie schicken ihre Kinder zu mir – das heißt, sie erlauben, dass die Kleinen zu mir kommen… Auch ein Bataillon der Fremdenlegion lag dort oben. Die Legionäre besuchten mich manchmal; mein Vorgänger hatte eine Bibliothek angelegt – und da kamen sie denn: Korporäle, Sergeanten, hin und wieder auch ein Gemeiner, schleppten Bücher fort oder rauchten meinen Tabak. Manchmal empfand einer meiner Besucher das Bedürfnis zu beichten… Es gehen seltsame Dinge vor in den Seelen dieser Menschen, ergreifende Bekehrungen, von denen jene keine Ahnung haben, welche die Legion für den Abschaum der Menschheit halten.
Gut… Kommt da eines Abends ein Korporal zu mir, der kleiner ist als ich; sein Gesicht gleicht dem eines verkrüppelten Kindes, traurig und alt ist es… Er heiße Collani, stockt und beginnt dann fieberhaft zu sprechen. Es ist keine regelrechte kirchliche Beichte, die der Mann ablegt. Einen Monolog hält er eher, ein Selbstgespräch. Allerlei muss er sich von der Seele reden, was nicht zu meiner Geschichte gehört. Er spricht ziemlich lang, eine halbe Stunde etwa. Es ist Abend und eine grünliche Dämmerung füllt das Zimmer; sie kommt vom dortigen Herbsthimmel, der hat manchmal so merkwürdige Farben…«
Studer hatte die Wange auf die Hand gestützt und so gespannt lauschte er der Erzählung, dass er gar nicht merkte, wie er sein linkes Auge arg verzog: schief sah es aus und geschlitzt, wie das eines Chinesen…
Das Hochplateau!… Die weiten Ebenen!… Das grüne Abendlicht!… Der Soldat, der beichtet!…
Es war doch etwas ganz anderes als das, was man tagtäglich sah! Fremdenlegion! Der Wachtmeister erinnerte sich, dass auch er einmal hatte engagieren wollen, zwanzig Jahre war er damals alt gewesen, wegen eines Streites mit seinem Vater… Aber dann war er – um die Mutter nicht zu betrüben – in der Schweiz geblieben, hatte Karriere gemacht und es bis zum Kommissär an der Berner Stadtpolizei gebracht. Später war jene Bankgeschichte passiert, die ihm das Genick gebrochen hatte. Und auch damals war wieder der Wunsch in ihm aufgestiegen, alles stehen und liegen zu lassen… Doch da war seine Frau, seine Tochter – und so gab er den Plan auf, fing wieder von vorne an, geduldig und bescheiden… Nur die Sehnsucht schlummerte weiter in ihm: nach den Ebenen, nach der Wüste, nach den Kämpfen. Da kam ein Pater und weckte alles wieder.
»Er spricht also ziemlich lange, der Korporal Collani. In seiner resedagrünen Capotte sieht er aus wie ein erholungsbedürftiges Chamäleon. Er schweigt eine Weile, ich will schon aufstehen und ihn mit ein paar tröstenden Worten entlassen, da beginnt er plötzlich mit ganz veränderter Stimme, rau und tief klingt sie, so, als ob ein anderer aus ihm rede, und die Stimme kommt mir sonderbar bekannt vor:
›Warum nimmt Mamadou das Leintuch vom Bett und versteckt es unter seiner Capotte? Ah, er will es in der Stadt verkaufen, der gemeine Hund! Und ich bin für die Wäsche verantwortlich. Jetzt geht er die Treppen hinunter, quer über den Hof zum Gitter. Natürlich, er wagt sich nicht an der Wache vorbei! Und am Gitter wartet Bielle auf ihn, nimmt ihm das Leintuch ab. Wohin will Bielle? Aha! Er läuft zum Juden in der kleinen Straße… Er verkauft das Leintuch für einen Duro…‹«
»Ein Duro«, erklärte Madelin, »ist ein Fünffrankenstück aus Silber…«
»Danke«, sagte Pater Matthias und schwieg. Er griff unter den Tisch, beschäftigte sich mit seiner Kutte, die irgendwo eine tiefe Tasche haben musste, und förderte aus ihr zutage: ein Nastuch, ein Vergrößerungsglas, einen Rosenkranz, eine aus roten Lederstreifen geflochtene Brieftasche und endlich eine Schnupftabaksdose. Aus dieser nahm er eine gehörige Prise. Dann schneuzte er sich laut und trompetend, der Beizer hinter dem Schanktisch schreckte auf, der Weiße Vater aber fuhr fort:
»Ich sage zu dem Mann: ›Collani! Wachen Sie auf, Korporal! Sie träumen ja!‹ – Aber er plappert weiter: ›Ich will euch lehren, militärisches Eigentum zu verquanten! Morgen sollt ihr Collani kennenlernen!‹ – Da packe ich den Korporal an der Schulter und schüttle ihn gehörig, denn es wird mir doch unheimlich zumute. Er wacht wirklich auf und sieht sich erstaunt um. ›Wissen Sie, was Sie mir erzählt haben?‹, frage ich. – ›Doch‹, erwidert Collani. Und wiederholt mir, was er in der Trance – so nennt man doch diesen Zustand?…«
»Sicherlich!«, schob Godofrey eifrig ein.
»… was er mir in der Trance erzählt hat. Darauf verabschiedet er sich. Am nächsten Morgen um acht Uhr – sehr klar war der Septembermorgen, man sah die Schotts, die großen Salzseen, in der Ferne funkeln – tret’ ich aus dem Haus und stoße mit Collani zusammen, der vom Fourier und vom Hauptmann begleitet ist. Hauptmann Pouette erzählt mir, Collani habe ihm gemeldet, dass seit einiger Zeit Leintücher verschwänden. Und Collani kenne sowohl die Diebe als auch den Hehler. Die Diebe seien schon eingesperrt, nun komme der Hehler an die Reihe. – Collani sah aus wie ein Quellensucher ohne Wünschelrute. Seine Augen blickten starr, doch war er bei vollem Bewusstsein. Nur drängte er vorwärts…
Ich will Sie nicht weiter langweilen. Bei einem Juden, der Zwiebeln, Feigen und Datteln in einem winzigen Lädlein feilhielt, fanden wir vier Leintücher auf dem Grunde einer Orangenkiste… Mamadou war ein Neger aus der vierten Kompagnie des Bataillons, er gestand den Diebstahl ein. Bielle, ein rothaariger Belgier, verlegte sich zuerst aufs Leugnen, dann gestand auch er…
Von dieser Stunde an nannte man Collani nur noch den Hellseherkorporal, und der Bataillonsarzt, Anatole Cantacuzène, veranstaltete Séancen mit ihm: Tischrücken, automatisches Schreiben – kurz all der gottsträfliche Unsinn wurde mit ihm versucht, den hierzulande die Spiritisten betreiben, ohne eine Ahnung von der Gefahr zu haben, in die sie sich begeben.
Sie werden sich fragen, meine Herren, warum ich Ihnen diese lange Geschichte erzählt habe… Nur um Ihnen zu beweisen, dass ich nicht gleichgültig bleiben konnte, als Collani mir eine Woche später Dinge erzählte, die mich, mich persönlich angingen…
Es war der 28. September. Ein Dienstag.«
Pater Matthias schwieg, bedeckte seine Augen mit der Hand und fuhr fort:
»Collani kommt. Ich spreche zu ihm, wie es meine Pflicht ist als Priester, beschwöre ihn, die teuflischen Experimente zu lassen. Er bleibt trotzig. Und plötzlich wird sein Blick wieder leer, die Oberlider verdecken halb die Augen, ein unangenehm höhnisches Lächeln zerrt seine Lippen auseinander, sodass ich seine breiten, gelben Zähne sehe, und dann sagt er mit jener Stimme, die mir so bekannt vorkommt: ›Hallo, Matthias, wie geht’s dir?‹ – Es war die Stimme meines Bruders, meines Bruders, der vor fünfzehn Jahren den Tod gefunden hatte!«
Die drei Männer um den Tisch in der kleinen Beize bei den Pariser Markthallen nahmen diese Mitteilung schweigsam entgegen. Kommissär Madelin lächelte schwach, wie man nach einem schlechten Witz lächelt. Studers Schnurrbart zitterte, und die Ursache dieses Zitterns war nicht recht festzustellen… Nur Godofrey bemühte sich, die peinliche Unwahrscheinlichkeit der Erzählung etwas zu mildern. Er sagte:
»Immer wieder zwingt uns das Leben, mit Gespenstern Umgang zu pflegen…«
Das konnte tiefsinnig sein. Pater Matthias sagte sehr leise:
»Die fremde und doch so vertraute Stimme redete aus dem Munde des Hellseherkorporals zu mir…«
Studers Schnurrbart hörte auf zu zittern, er beugte sich über den Tisch… Die Betonung des letzten Satzes! Sie klang unecht, übertrieben, gespielt! Der Berner Wachtmeister blickte zu Madelin hinüber. Das knochige Gesicht des Franzosen war ein wenig verzerrt. Also hatte auch der Kommissär den Misston empfunden! Er hob die Hand, legte sie sanft auf den Tisch: »Reden lassen! Nicht unterbrechen!« Und Studer nickte. Er hatte verstanden…
»›Hallo, Matthias! Kennst du mich noch? Hast du gemeint, ich sei tot? Springlebendig bin ich…‹ Und da bemerkte ich zum ersten Male, dass Collani Deutsch redete! – ›Matthias, beeil dich, wenn du die alten Frauen retten willst. Sonst komm’ ich sie holen. Sie werden in…‹ Da ging die Stimme, die doch nicht Collanis Stimme war, in ein Flüstern über, sodass ich die nächsten Worte nicht verstand. Und dann wieder, laut und deutlich vernehmbar: ›Hörst du es pfeifen? Es pfeift und dies Pfeifen bedeutet den Tod.
Fünfzehn Jahre hab’ ich gewartet! Zuerst die in Basel, dann die in Bern! Die eine war klug, sie hat mich durchschaut, die spar’ ich mir auf. Die andere hat meine Tochter schlecht erzogen. Dafür muss sie gestraft werden.‹ Ein Lachen und dann schwieg die Stimme. Diesmal war Collanis Schlaf so tief, dass ich Mühe hatte, den Mann zu wecken…
Endlich klappen seine Lider ganz auf, er sieht mich an, erstaunt. Da frage ich den Hellseherkorporal: ›Weißt du, was du mir erzählt hast, mein Sohn?‹ – Zuerst schüttelt Collani den Kopf, dann erwidert er: ›Ich sah einen Mann, den ich in Fez gepflegt hatte vor fünfzehn Jahren. Er ist gestorben, damals, an einem bösen Fieber… Im Jahre siebenzehn, während des Weltkrieges… Dann sah ich zwei Frauen. Die eine hatte eine Warze neben dem linken Nasenflügel… Der Mann damals in Fez – wie hieß er? Wie hieß er nur?‹ – Collani reibt sich die Stirne, er findet den Namen nicht, ich helfe ihm auch nicht – ›der Mann in Fez hat mir einen Brief gegeben. Den soll ich abschicken, nach fünfzehn Jahren. Ich hab’ ihn abgeschickt. An seinem Todestag. Am 20. Juli. Der Brief ist fort, ja er ist fort!‹, schreit er plötzlich. ›Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben! Es ist unerträglich. Jawohl!‹, schreit er noch lauter, als antworte er dem Vorwurf eines Unsichtbaren. ›Ich habe eine Kopie behalten. Was soll ich mit der Kopie tun?‹ – Der Hellseherkorporal ringt die Hände. Ich beruhige ihn: ›Bring mir die Abschrift des Briefes, mein Sohn. Dann wird dein Gewissen entlastet sein. Geh! Jetzt gleich!‹ – ›Ja, mein Vater‹, sagt Collani, steht auf und geht zur Türe. Ich höre noch die Nägel seiner Sohlen auf dem Stein vor meiner Haustüre kreischen…
Und dann hab’ ich ihn nie mehr gesehen! Er verschwand aus Géryville. Man nahm an, Collani sei desertiert. Der Fall wurde auf Befehl des Bataillonskommandanten untersucht. Man fand heraus, dass am gleichen Abend ein Fremder in einem Auto nach Géryville gekommen und in der gleichen Nacht wieder abgefahren war. Vielleicht hat er den Hellseherkorporal mitgenommen…«
Pater Matthias schwieg. Im kleinen Raum war einzig das Schnarchen des dicken Wirtes zu hören und dazwischen, ganz leise, das Ticken einer Wanduhr…
Der Weiße Vater nahm die Hand vom Gesicht. Seine Augen waren leicht gerötet, und noch immer gemahnte ihre Farbe an das Meer – aber nun lagen Nebelschwaden über den Wassern und verbargen die Sonne. Der alte Mann, der aussah wie der Schneider Meckmeck, musterte seine Zuhörer.
Es war ein schwieriges Unterfangen, drei mit allen Wassern gewaschenen Kriminalisten eine Gespenstergeschichte zu erzählen. Sie ließen ein langes Schweigen walten, dann klopfte der eine, Madelin, mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Wirt fuhr auf.
»Vier Gläser!«, befahl der Kommissär. Er füllte sie mit Rum, sagte trocken: »Eine kleine Stärkung wird Ihnen guttun, mein Vater.« Und Pater Matthias leerte gehorsam sein Glas. Studer zog ein längliches Lederetui aus der Busentasche, stellte betrübt fest, dass ihm nur noch eine Brissago verblieb, zündete sie umständlich an und gab auch Madelin Feuer, der eine Pfeife gestopft hatte. Mit dieser gab der Kommissär seinem Schweizer Kollegen einen Wink, eine kleine Aufforderung, mit dem fälligen Verhör zu beginnen.
Studer rückte nun ebenfalls vom Tisch ab, legte die Ellbogen auf die Schenkel, faltete die Hände und begann zu fragen, langsam und bedächtig, während seine Augen gesenkt blieben.
»Zwei Frauen? Ihr Bruder hat sich wohl nicht der Bigamie schuldig gemacht?«
»Nein«, sagte Pater Matthias. »Er ließ sich scheiden von der ersten Frau und heiratete dann ihre Schwester Josepha.«
»So so. Scheiden?«, wiederholte Studer. »Ich dachte, das gäbe es nicht in der katholischen Religion.« Er hob die Augen und sah, dass Pater Matthias rot geworden war. Von der sehr hohen Stirne rollte eine Blutwelle über das braungebrannte Gesicht – nachher blieb die Haut merkwürdig grau gefleckt.
»Ich bin mit achtzehn Jahren zur katholischen Religion übergetreten«, sagte Pater Matthias leise. »Daraufhin wurde ich von meiner Familie verstoßen.«
»Was war Ihr Bruder?«, fragte Studer weiter.
»Geologe. Er schürfte im Süden von Marokko nach Erzen: Blei, Silber, Kupfer. Für die französische Regierung. Und dann ist er in Fez gestorben.«
»Sie haben den Totenschein gesehen?«
»Er ist der zweiten Frau nach Basel geschickt worden. Meine Nichte hat ihn gesehen.«
»Sie kennen Ihre Nichte?«
»Ja; sie wohnt in Paris. Sie war hier bei dem Sekretär meines verstorbenen Bruders angestellt.«
»Nun«, meinte Studer und zog sein Notizbüchlein aus der Tasche – es war ein neues Ringbuch, das stark nach Juchten roch, ein Weihnachtsgeschenk seiner Frau, die sich immer über seine billigen Wachstuchbüchli geärgert hatte. Studer schlug es auf.
»Geben Sie mir die Adressen Ihrer beiden Schwägerinnen«, bat er höflich.
»Josepha Cleman-Hornuss, Spalenberg 12, Basel. – Sophie Hornuss, Gerechtigkeitsgasse 44, Bern.« Der Pater sprach ein wenig atemlos.
»Und Sie meinen wirklich, mein Vater, dass den alten Frauen Gefahr droht?«
»Ja… wirklich… ich glaube es… bei meiner Seele Seligkeit!« Wieder hätte Studer dem Männlein mit dem Schneiderbart am liebsten gesagt: »Reden Sie weniger geschwollen!« Aber das ging nicht an. Er sagte nur:
»Ich werde hier in Paris noch Silvester feiern, dann den Nachtzug nehmen und am Neujahrsmorgen in Basel ankommen. Wann fahren Sie in die Schweiz?«
»Heut’… Heut’ nacht!«
»Dann«, sagte Godofreys Papageienstimme, »dann haben Sie gerade noch Zeit, ein Taxi zu nehmen.«
»Mein Gott, ja, Sie haben recht… Aber wo…?«
Kommissär Madelin tauchte ein Stück Zucker in seinen Rum und während er an diesem »Canard« lutschte, rief er dem schnarchenden Beizer ein Wort zu.
Dieser sprang auf, stürzte zur Tür, steckte zwei Finger zwischen die Zähne. So gellend war der Pfiff, dass sich Pater Matthias die Ohren zuhielt.
Und dann war der Geschichtenerzähler verschwunden.
Kommissär Madelin brummte: »Ich möcht’ nur eines wissen. Hält uns der Mann für kleine Kinder? – Stüdère, es tut mir leid. Ich dachte, er hätte Wichtigeres zu erzählen. Und dann war er mir empfohlen worden. Er hat Protektionen, hohe Protektionen!… Aber nicht einmal eine Runde hat er bezahlt! Wirklich, er ist ein Kind!«
»Verzeihung, Chef«, entgegnete Godofrey. »Das stimmt nicht. Kinder stehen mit den Engeln auf du und du. Aber unser Pater duzt die Engel nicht…«
»Hä?« Madelin riss die Augen auf und auch Studer betrachtete erstaunt das überelegante Zwerglein.
Godofrey ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»Die Engel duzt man nur«, sagte er, »wenn man ein lauteres Gemüt hat. Unser Pater ist voller Ränke. Sie werden noch von ihm hören! Aber jetzt«, er winkte dem Wirt, »jetzt trinken wir Champagner auf das Wohl des Enkelkindes unseres Inspektors.« Und er wiederholte die deutschen Worte des Telegramms: »Das junge Schakobli lässt den alten Schakob grissen…« Studer lachte, dass ihm die Tränen in die Augen traten und dann tat er seinen Begleitern Bescheid.
Übrigens war es gut, dass Kommissär Madelin seinen Polizeiauswels bei sich trug. Denn sonst wären die drei Männer um zwei Uhr morgens sicher wegen Nachtlärm arretiert worden. Studer hatte es sich in den Kopf gesetzt, seinen beiden Begleitern das Lied vom »Brienzer Buurli« beizubringen, und ein uniformierter Polizist fand einen Pariser Boulevard ungeeignet für eine Gesangsstunde. Er beruhigte sich jedoch, als er den Beruf der drei Männer festgestellt hatte. Und so konnte Wachtmeister Studer fortfahren, seinen Kollegen von der Pariser Sicherheitspolizei bernisches Kulturgut zu vermitteln. Er lehrte sie: »Niene geit’s so schön und luschtig…«, worauf ihm das Wort »Emmental« Gelegenheit gab, den Unterschied zwischen Greyerzer- und Emmentalerkäse zu erläutern. Denn in Frankreich herrscht die ketzerische Ansicht, jeder Schweizerkäse stamme aus dem Greyerzerlande…
Gas
Nachdem Wachtmeister Studer seinen ramponierten Schweinslederkoffer in einem Abteil des Nachtschnellzuges Paris-Basel verstaut hatte, ließ er im Gang das Fenster herab und nahm Abschied von seinen Freunden. Kommissär Madelin zog mit Ächzen und Stöhnen eine in Zeitungspapier verpackte Flasche aus der Manteltasche, Godofrey reichte ein Päcklein zum Waggonfenster hinauf, das ohne Zweifel eine Terrine Gansleberpastete enthielt, und lispelte: »Pour madame!« Dann fuhr der Zug aus der Halle des Ostbahnhofes und Studer kehrte in sein Drittklass-Abteil zurück.
Seinem Eckplatz gegenüber hatte ein Fräulein Platz genommen. Pelzjackett, graue Wildlederschuhe, grauseidene Strümpfe. Das Fräulein zündete eine Zigarette an – ausgesprochen männliche Raucherware, französische Régie-Zigaretten: Gauloises. Sie streckte Studer das blaue Päcklein hin und der Wachtmeister bediente sich. Das Fräulein erzählte, es sei Baslerin und wolle seine Mutter besuchen. Über Neujahr. – Wo wohne die Mutter? – Auf dem Spalenberg. – So so? Auf dem Spalenberg? – Ja…
Studer begnügte sich mit dieser Auskunft. Das junge Meitschi war zwei-, höchstens dreiundzwanzigjährig und es gefiel dem Wachtmeister ausnehmend. Es gefiel ihm – in allen Ehren. Schließlich hatte man nicht das Recht als Großvater, als solider Mann… Äbe!… Und es war angenehm, mit dem Meitschi z’brichte…
Dann wurde Studer müde, entschuldigte sein Gähnen, er sei sehr beschäftigt gewesen in Paris – das Meitschi lächelte, unverschämt ein wenig, – was tat das? Der Wachtmeister lehnte den schweren Kopf in die Ecke auf seinen grauen Regenmantel und schlummerte ein. Als er erwachte, saß ihm gegenüber immer noch das Meitschi, es schien sich kaum bewegt zu haben. Nur das blaue Päckli mit den Zigaretten, das in Paris noch voll gewesen war, lag als leeres Papier, zusammengeknäuelt, in einer Ecke. Und Studer hatte Kopfweh, weil das Kupée blau von Rauch war…
Er trug seinen Koffer und den seiner Mitreisenden bis an den Zoll, verabschiedete sich dann und stieß mit einem Manne zusammen, der auf dem Kopfe eine Kappe trug, die aussah wie ein von einem Töpfer verpfuschter Blumentopf; eine weiße Mönchskutte hüllte seinen mageren Körper ein und die Füße, die blutten, steckten in offenen Sandalen…
Wachtmeister Studer erwartete eine herzliche Begrüßung. Sie erfolgte nicht. Das Gesicht, mit dem Schneiderbärtlein am Kinn, sah ängstlich aus und traurig, der Mund –wie bleich waren die Lippen! – murmelte: »Ah, Inspektor! Wie geht’s?« Und ohne eine Antwort abzuwarten, wandte sich Pater Matthias dem jungen Mädchen zu, das mit Studer gereist war, und nahm ihm den Koffer ab. Vor dem Bahnhof stiegen die beiden in ein Taxi und fuhren davon.
Der Wachtmeister hob die mächtigen Achseln. Die Prophezeiungen des Hellseherkorporals, die ein Weißer Vater drei Kriminalisten in einer Beize bei den Pariser Markthallen aufgetischt hatte, schienen jeder Bestätigung zu entbehren. Denn hätte der Pater ihnen Glauben geschenkt, so wäre es seine Pflicht gewesen, Wache zu halten bei der… der… wie hieß sie nur? Einerlei!… bei der Frau auf dem Spalenberg, um sie zu schützen gegen einen Tod, der irgend etwas mit Pfeifen zu tun hatte… Pfeifen… Was pfiff? Ein Pfeil… Der Bolzen eines Blasrohres… Was noch? Eine Schlange?… Das waren alles Erinnerungen aus den Detektivgeschichten des Herrn Conan Doyle, der unter die Spiritisten gegangen war. – Es gab da eine Geschichte… Wie hieß sie? Das getupfte… getupfte… Ja, das getupfte Band! Da wickelte sich eine Schlange um eine Klingelschnur. Nun, Herr Conan Doyle besaß Fantasie, aber Studer hatte keine Brissagos mehr. So liebenswürdig und gastfreundlich die Franzosen auch waren, Brissagos kannten sie nicht… Und darum ließ sich der Wachtmeister sein längliches Lederetui am Bahnhofkiosk frisch füllen. Aber er versagte sich den Genuss, sogleich einen dieser Stengel anzuzünden, sondern begab sich zuerst ins Buffet, allwo er z’Morgen aß, ausgiebig und friedlich. Und dann beschloss er, einen Freund aufzusuchen, der in der Missionsstraße wohnte.
Unterwegs, zuerst in der Freien Straße, denn es war noch früh am Morgen und Studer machte einen Umweg, um seinen Freund nicht zu früh aufzustören, schüttelte er den Kopf. Das schadete wenig, denn es gab keine Passanten, die sich über dies Kopfschütteln und das nachherige Selbstgespräch hätten aufhalten können. Wachtmeister Studer schüttelte also seinen Kopf und murmelte: »Er duzt die Engel nicht.« Und Pater Matthias schien ein Mann zu sein, der voller Ränke war.
Auf dem Marktplatz schüttelte er noch einmal den Kopf und murmelte dann: »Das junge Jakobli lässt den alten Jakob grüßen.« Das Hedy war doch ein merkwürdiges Frauenzimmer!… Nun war es nah an den Fünfzig, Großmutter dazu, aber es liebte eine originelle Ausdrucksweise. Früher hätte sich Studer darüber geärgert. Aber nach siebenundzwanzigjähriger Ehe wird man nicht mehr taub… s’Hedy!… Die Frau hatte es nicht immer leicht gehabt. Aber ein tapferer Kerl war sie… Und nun: eine tapfere Großmutter…
Großmutter… Studer blickte auf, blieb stehen, denn es ging bergauf. Richtig: der Spalenberg! Und eine Nummer leuchtete ihm entgegen…
Da flog das Haustor auf, ein Mädchen stürzte heraus, und da der Wachtmeister der einzige Mensch auf der Straße war, packte es natürlich ihn am Ärmel und keuchte:
»Kommen Sie mit!… Die Mutter!… Es riecht nach Gas!…«
Und Wachtmeister Studer von der Berner Fahndungspolizei folgte seinem Schicksal: diesmal hatte es die Gestalt eines jungen Meitschis angenommen das gerne starke französische Zigaretten rauchte und ein Pelzjackett, graue Wildlederschuhe und graue Seidenstrümpfe trug.
»Blyb uf dr Loube!«, sagte Studer, nachdem er keuchend drei Stockwerke erstiegen hatte. Ohne Zweifel, der Gasgeruch war deutlich! Keine Klinke, kein Schlüssel an der Türe… Tannenholz – und ein schwaches Schloss…
Studer nahm sechs Schritte Anlauf, keinen einzigen mehr. Aber eine simple Tannenholztüre vermag dem Anprall eines Doppelzentners nicht standzuhalten. So gab die Türe gehorsam nach – nicht das Holz, sondern das Schloss – und eine Wolke von Gas strömte Studer entgegen. Zum Glück war sein Nastuch groß. Er knotete es im Nacken fest, sodass es Mund und Nase bedeckte.
»Blyb dusse, Meitschi!«, rief Studer noch. Zwei Schritte – und die winzige Küche war durchquert; eine Türe wurde aufgestoßen. Das Wohnzimmer war quadratisch, weißgekalkt. Der Wachtmeister riss das Fenster auf und lehnte sich hinaus… Und das Nastuch ließ sich wie eine Fastnachtsmaske abstreifen…
Ein Gewirr von Dächern… Kamine stießen friedlich ihren Rauch in die kalte Winterluft. Reif glänzte auf den dunklen Ziegeln. Und über den höchsten First kroch langsam eine bleiche Wintersonne. Der eindringende Luftzug nahm das giftige Gas mit sich.
Studer wandte sich um und sah einen flachen Schreibtisch, eine Couch, drei Stühle; an der Wand das Telefon. Er durchquerte den Raum, gelangte in die korridorartige Küche. Die beiden Hähne des Réchauds waren geöffnet, das Gas pfiff aus den Brennern. Gedankenlos schloss Studer diese Hähne. Es war nicht sehr einfach, denn ein Lehnstuhl stand im Wege, mit grünem Samt überzogen. In ihm saß eine alte Frau, sonderbar friedlich, gelöst und schien zu schlafen. Die eine Hand ruhte auf der Armlehne, der Wachtmeister ergriff sie, tastete nach dem Puls, schüttelte den Kopf und legte die kalte Hand vorsichtig auf das geschnitzte Holz zurück.
Winzig war die Küche wirklich. Anderthalb Meter auf zwei, ein Korridor eher. Über dem Gasréchaud hing an der Wand ein Holzgestell. Blechdosen – ehemals weiß emailliert, jetzt gebräunt, die Glasur abgestoßen: »Kaffee«, »Mehl«, »Salz«… Alles war ärmlich. Und durch den leichten Gasgeruch, der noch zurückblieb, stach deutlich ein anderer: Kampfer…
Es roch nach alter Frau, nach einsamer, alter Frau.
Es war ein ganz bestimmter Geruch, den Studer kannte; er kannte ihn aus den winzigen Wohnungen in der Metzgergasse, wo es hin und wieder einer alten Frau zu langweilig wurde oder zu einsam und sie dann den Gashahn aufdrehte. Manchmal aber war es weder Einsamkeit noch Langeweile; sondern Not…
Studer trat vor die Wohnungstür. Links am Türpfosten, unter dem weißen Klingelknopf, ein Schild:
Josepha Cleman-Hornuss Witwe
Witwe!… Als ob Witwe ein Beruf wäre!…
Er rief dem Meitschi, das am Geländer der Laube lehnte – g’späßig war das Haus gebaut: die Laube ging auf ein Gärtlein, obwohl die Wohnung im dritten Stockwerk lag, und das Gärtlein war von einer Mauer umgeben, in die eine Türe eingelassen war; wohin führte die Tür?… wohl auf eine Nebengasse – er rief dem Meitschi und es kam näher.