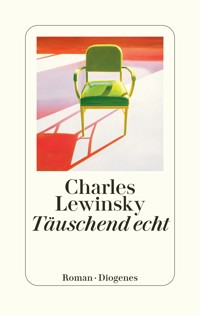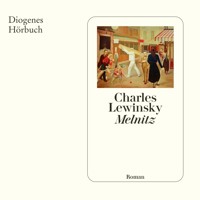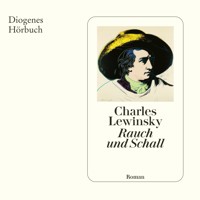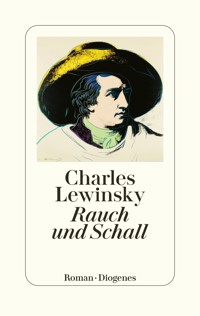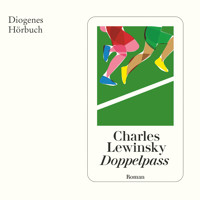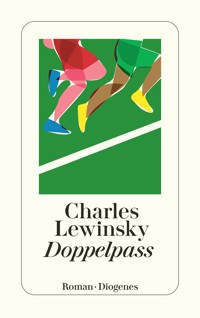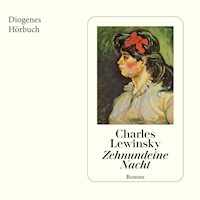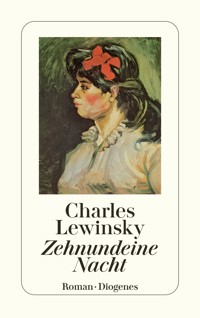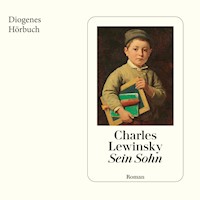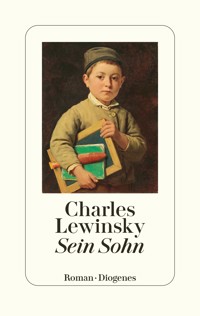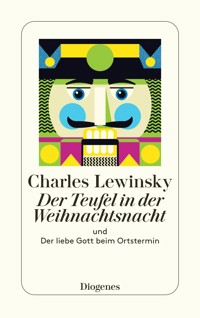
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einem üppigen Weihnachtsmahl erhält der Papst Besuch vom Teufel, der ihn in einem roten Ferrari in die Welt hinaus entführt und ihm den Rat gibt, die kirchlichen Finanzen durch Sponsoring zu sanieren. Hat er das geträumt? Vielleicht. Doch sieht die Welt am nächsten Morgen irgendwie anders aus. Auch der liebe Gott besucht die Erde, als er sieht, dass die Menschen dabei sind, seine Schöpfung zu demolieren. Kann er sie retten? Er will es zumindest versuchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charles Lewinsky
Der Teufel in der Weihnachtsnacht
und Der liebe Gott beim Ortstermin
Diogenes
Der Teufel in der Weihnachtsnacht
Schwester Innocentia war schuld.
Aus ihrem deutschen Stammkloster schon vor langen Jahren nach Rom entsandt und bei aller Begeisterung für die Heilige Stadt immer noch von kulinarischem Heimweh geplagt, hatte sie eine Mischung aus Panettone und Dresdener Christstollen kreiert, die mehr magenbeschwerende Köstlichkeiten enthielt als der Kirchenkalender Heilige zählt. Und sie hatte, die Gewohnheiten und Schwächen ihres Dienstherren wohl kennend, gestern Abend einen verführerischen Teller davon auf seinem Kopfkissen, direkt unter dem Kruzifix, platziert. Er hatte der Verführung nicht widerstehen können.
Der Papst rieb sich ächzend den Magen. Jedes Jahr nahm er sich vor, fit und rank in den berufsbedingten Weihnachtsstress zu gehen, und jedes Jahr kam ihm Schwester Innocentias Original Dresdener Christpanettone dazwischen. Er beschloss, ihr ein hübsch gerahmtes handgeschriebenes Vaterunser unter den Weihnachtsbaum zu legen, die Worte »… und führe uns nicht in Versuchung« rot unterstrichen. Er tastete nach dem Notizblock, der immer auf dem Nachttisch bereitlag, und fasste in einen Teller voller Puderzuckerreste und Mandelsplitter.
Der Gummizug seiner Pyjamahose spannte unangenehm über seinem von kandierten Früchten, Marzipan und Rosinen geblähten Bauch. Vielleicht hatte Schwester Innocentia doch recht mit ihrer Ansicht, ein Pyjama sei kein passendes Kleidungsstück für einen Papst. Sie versuchte schon seit Jahren, ihn zu langen weißen Nachthemden zu überreden. Aber die waren ihm immer den Hängerchen zu ähnlich gewesen, die er in der Öffentlichkeit tragen musste.
Von einem Kirchturm schlug es drei. Eine zweite Glocke stimmte ein, eine dritte und eine vierte. Das ist das Unangenehme an einer Wohnung im Vatikan: Wenn man hier wach im Bett liegt, wird man von allen Seiten daran erinnert, zu welch unchristlicher Stunde man sich immer noch ruhelos von einer Seite auf die andere wälzt. ›Unchristlich darf ich in diesem Zusammenhang gar nicht denken‹, dachte der Papst und schlummerte für zwei Minuten ein.
Diesmal waren es die Krümel, die ihn weckten. Durch irgend eine Perfidie in Schwester Innocentias Weihnachtsrezept waren sie besonders scharfkantig geraten, und ein paar von ihnen hatten sich, mit der sadistischen Treffsicherheit von Folterknechten, die einen urchristlichen Märtyrer seiner Heiligsprechung entgegenquälen, an besonders empfindlichen Stellen innerhalb des päpstlichen Pyjamas eingenistet. »Der Teufel soll sie holen!«, murmelte der Papst und fiel in einen unruhigen Schlaf.
Der Teufel fuhr einen roten Ferrari. Feuerwehrrot ist die Lieblingsfarbe aller infernalischen Geschöpfe. Sie werden gern daran erinnert, dass sie über ein Feuer verfügen, das auch der modernste Spritzenwagen nicht löschen kann. Aber warum gerade ein Ferrari? Warum nicht? Auch der Papst ist ja meistens ein italienisches Modell.
Dass es sich um den Teufel handeln musste, merkte man nur schon daran, dass er mit Vollgas durch die engsten römischen Straßen brettern konnte, ohne auch nur ein einziges Mal im Stau stecken zu bleiben. An den Schweizergardisten war er vorbeigekurvt, bevor die auch nur daran denken konnten, das Posieren für die knipsenden Touristen einzustellen und ihre Hellebarden als Straßensperre einzusetzen. Mit satanischer Rücksichtslosigkeit stellte er den Wagen direkt neben dem Haupteingang auf dem Parkplatz ab, der eigentlich für den Kardinal-Staatssekretär reserviert war. Ein echter Teufel schreckt vor keinem Sakrileg zurück.
Man erkennt die Bewohner der Hölle schon lange nicht mehr an irgendwelchen Bocksfüßen, und es ist auch vergebliche Liebesmüh, in der Hose ihres Maßanzugs einen sorgfältig versteckten Ringelschwanz entdecken zu wollen. Das einzige Requisit, das sie nach moderner höllischer Etikette immer bei sich zu tragen verpflichtet sind, ist ein Aktenköfferchen. Teufel sehen aus wie Versicherungsvertreter. So verschieden sind die beiden Berufsgattungen ja auch nicht: Beide haben sich darauf spezialisiert, Policen für das Paradies auszustellen und den Dreizack ins Kleingedruckte wegzumogeln.
Der Teufel, der den Papst besuchen kam, teilte mit einem guten Versicherungsvertreter noch eine weitere Fähigkeit: die Gabe, sich chamäleonartig jeder Umgebung anzupassen und dadurch immer und überall so auszusehen, als ob er dazugehörte. Als er an den goldgerahmten Ölgemälden auf dem langen Flur vorbeiging, bekam sein Gesicht haarfeine Risse wie alter gesprungener Firnis, vor den schweren flandrischen Teppichen wurden seine Haare zu verblasstem Flaum, und wenn sich eine der holzgeschnitzten Türen lautlos vor ihm öffnete, glänzte sein Teint wie vom Olivenöl, mit dem die kunstvollen Paneele seit Jahrhunderten poliert worden waren. Kurz: Er wurde quasi – oder in seinem Fall vielleicht sogar tatsächlich – unsichtbar. Wer will das so genau wissen? Auf jeden Fall hielt ihn niemand auf, als er das Schlafzimmer des Papstes betrat. Seine Heiligkeit hatte in der letzten Nacht wirklich sehr schlecht geschlafen.
»Schickes Pyjama«, sagte der Teufel anerkennend.
Der Papst schlug verwirrt die Augen auf und sah einen völlig fremden Mann an seinem Bett stehen, der sich mit dem fürsorglichen Lächeln eines Oberkellners über ihn beugte. »Wer sind Sie?«
Eine Visitenkarte wuchs – zumindest sah es in den noch schlaftrunkenen Augen des Papstes so aus – aus der überraschend behaarten Handfläche des Besuchers. »Teufel«, stellte er sich mit einer formvollendeten Verbeugung vor.
Erschrocken tastete der Papst nach dem Kreuz an der Halskette, die er seit seinen Tagen auf dem Priesterseminar nie mehr abgelegt hatte. Aber sein Gast schüttelte nur leicht amüsiert den Kopf und sprach weiter: »Hieronymus Teufel. Altes schwäbisches Patriziergeschlecht. Selbstverständlich katholisch. Schon immer.«
»Wie … wie kommen Sie hier herein?«
»Es hat mich niemand aufgehalten.« Moderne Teufel lügen nicht. Sie pflegen, wie medienbewusste Politiker, nur einen ökonomischen Umgang mit der Wahrheit. Es ist nicht ganz klar, wer die Technik von wem gelernt hat.
»Und was wollen Sie hier?«
Der Teufel setzte sich auf die Bettkante. Wenn jemand hereingekommen wäre, hätte er geschworen, hier betreue ein vertrauter Hausarzt einen alten Patienten. »Ich bin gekommen, um zu helfen«, sagte der Teufel.
»Mir?«
»Auch Ihnen. Allen guten Christenmenschen. Der ganzen Kirche.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Sehen Sie«, sagte der Teufel und saß plötzlich an dem Schreibtisch, an den sich außer dem Papst selber niemand, aber wirklich niemand setzen durfte, »sehen Sie, Eure Heiligkeit, mit den Finanzen der Kirche ist es nicht zum Besten bestellt. Ich habe hier den Abschluss des letzten Jahres …« – mit der betont nonchalanten Geste eines Zauberers, der einem leeren Zylinder einen riesigen Blumenstrauß entnimmt, holte er einen Packen Computerausdrucke aus der Luft und ließ sie, sich entfaltend, bis auf den Boden flattern –, »… und wenn man sich die Zahlen so ansieht, dann muss man feststellen: Als Privatunternehmen müsste der Heilige Stuhl schon bald einmal daran denken, die ersten Mitarbeiter zu entlassen.« Über den Rand einer schmalen Brille hinwegguckend wies er auf eine Zeile und schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Wirklich sehr bedenkliche Zahlen.«
»Woher …?«, setzte der Papst an, aber sein Besucher – auch das hatte er mit einem Versicherungsvertreter oder einem Politiker gemeinsam – ließ ihn gar nicht zu Worte kommen. »Fusionieren wäre natürlich eine Möglichkeit«, fuhr er nachdenklich fort. »Einen Partner mit ähnlicher Produktepalette suchen und dann die Synergien nutzen. Die Mitarbeiterzahl verkleinern und unnötige Produktionsstätten abstoßen.«
»Was für Produktionsstätten?«
»Ich denke an all die vielen Orte, wo eine katholische neben einer evangelischen Kirche steht, und beide sind in der gegenwärtigen Marktsituation nicht ausgelastet. Und das trotz oft bester Citylagen. Wenn sich dieser brachliegende Immobilienbestand aktivieren ließe …«
»Aktivieren?« Der Papst glich in diesem Moment sehr dem Tiziangemälde über seinem Schreibtisch. Es zeigte den heiligen Antonius von Padua beim Abwehren einer Versuchung. »Wollen Sie damit sagen: Wir sollen Kirchen verkaufen?«
»Aber nicht doch!«, beruhigte ihn sein Besucher.
»Gott sei Dank!«
Der Besucher zuckte zusammen. Irgendetwas an diesem Wort schien ihm nicht gut zu bekommen. »Ich würde vorschlagen: Leasing«, fuhr er fort. »Die Gebäude für neunundneunzig Jahre verpachten oder so. Als Disco oder Supermarkt.«
»Das kommt überhaupt nicht infrage!«, sagte der Papst mit seiner donnerndsten Ex-Cathedra-Stimme. Sein Gegenüber schien dadurch nicht beeindruckt.