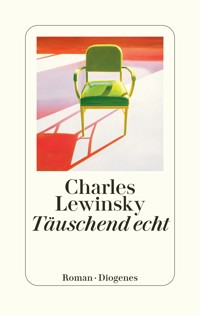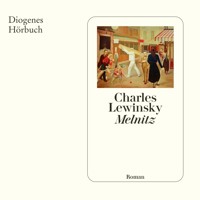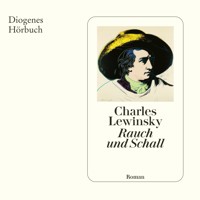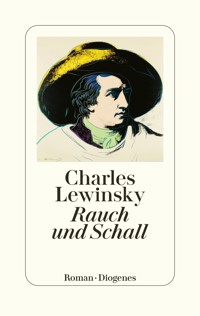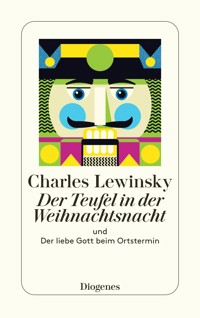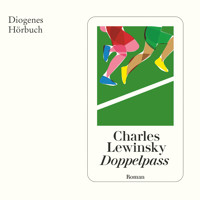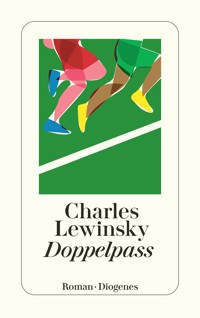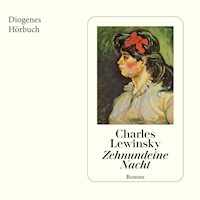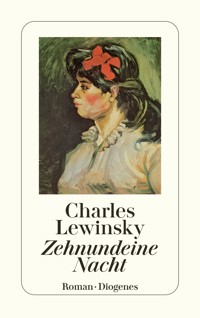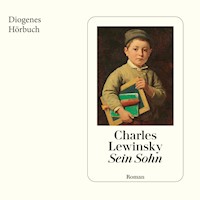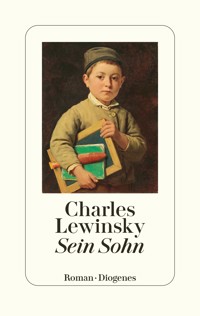
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Louis Chabos wächst in einem Kinderheim in Mailand auf. Nachdem er in Napoleons Russlandfeldzug den Krieg kennengelernt hat, möchte er nur noch eins: endlich zu einem menschenwürdigen Leben finden und Teil einer Familie werden. In Graubünden erlangt er ein kleines Stück des erhofften Glücks. Doch das verspielt er, als die Sehnsucht nach dem unbekannten Vater ihn nach Paris ruft und er zwischen Prunk und Schmutz seine Bestimmung sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Charles Lewinsky
Sein Sohn
Roman
Diogenes
»Steig hinter mir auf mein Pferd«, sagte der Herold. »Dann reiten wir zusammen zum Hof des Königs.«
Altes Märchen
I
1
Die Totengräber arbeiteten langsam. Wenn das Brot knapp wird, muss man die letzten Bissen einteilen.
»Eine einzige Leiche heute«, sagte der Alte. »Die Krankheit gönnt uns nichts mehr.«
»Die Seuche geht zu Ende«, sagte der Junge.
»Wir wollen es nicht hoffen«, sagte der Alte.
Der Tote lag auf dem Rücken. Die Augen offen. Einer, der am falschen Ort aufgewacht ist. Er passte nicht nach Saint-Ouen, wo manche nichts haben und viele noch weniger. Alle andern waren ausgehungert gewesen. Nicht gut genährt wie der Mann, für den sie da in dem lehmigen Boden ein Loch gruben. Der falsche Körper für ein Armengrab. Wer zu essen hat, stirbt nicht allein. Ein gedeckter Tisch findet leicht Gesellschaft.
Dass man seine Leiche auf der Straße gefunden hatte, bewies nicht das Gegenteil. Auch nicht, dass er nackt gewesen war. Man hatte sich an ihm bedient. Das war nur vernünftig. Einen Toten machen auch Seide und Samt nicht gesund.
»Leute wie der«, sagte der Alte, »werden sonst in Särgen angeliefert.«
»Nackt braucht er weniger Platz«, sagte der Junge.
»Auch wieder wahr«, sagte der Alte.
Die Stiele der Schaufeln kalt in ihren Händen. Der Winter schlich sich in die Stadt, wie sich die Cholera eingeschlichen hatte. Nur dass man vom Frieren langsamer starb.
Ein Schluck Fusel hätte jetzt gewärmt, aber den letzten hatten sie gestern getrunken. Auch Tabak hatten sie keinen mehr. Bevor das Grab zugeschaufelt war, gab es kein Geld.
»Müssen wir auf den Priester warten?«, fragte der Junge.
Er bekam keine Antwort. Hatte auch keine erwartet. Ein Gebet am Grab kostete einen Franc. Zwei Kilo Brot. Der Tote hatte kein Geld, wenn es ihm nicht zwischen den Arschbacken steckte.
Bevor sie ihn zum Grab schleppten, das war ihre Gewohnheit, stützten sie sich auf ihre Schaufeln und erfanden ein Leben für ihn. Wem die bessere Geschichte einfiel, durfte die Leiche unter den Achseln fassen. Der Verlierer musste die Beine nehmen.
»Du fängst an«, sagte der Alte. »Ich war gestern der Erste.«
»Und dann war ich dran«, sagte der Junge, »und dann wieder du und wieder ich und wieder du und wieder ich.«
»Sechs Leichen«, sagte der Alte. »Das war ein guter Tag.«
»Es ist noch nicht Mittag«, sagte der Junge.
Von der Kapelle her erklang die kleine Glocke.
»Siehst du«, sagte der Junge. »Wieder einer.«
»Nicht für uns«, sagte der Alte. »Auch das Läuten muss bezahlt werden.«
Die weißen Wolken ihres Atems stiegen senkrecht in die Höhe. Immerhin kein Wind.
»Eigentlich bin ich Pastetenbäcker«, sagte der Alte.
»Eigentlich bin ich Napoleon«, sagte der Junge. »Fang endlich an.«
»Vierzig Jahre alt.«
»Mehr.«
»Das täuscht«, sagte der Alte. »Die Seuche macht die Gesichter älter. Du bist dran.«
»Verheiratet. Zwei Kinder.«
»Und stirbt allein?«
»Die Krankheit hat sie vor ihm erwischt.«
Wenn der Alte lachte, musste er husten. Würgte gelben Schleim. »Ein Punkt für dich.«
»Du bist dran.«
»Tuchhändler. Frühstückt im Bett und diniert im Procope.«
»Wie kommt so einer nach Saint-Ouen?«
»Hier sind die Bordelle billiger.«
Der Junge stieß die Leiche mit der Stiefelspitze an. »An der rechten Hand hat er nur zwei Finger. Er muss falsch geschworen haben.«
»Wenn einem davon die Finger abfielen«, sagte der Alte, »die Straßen wären voll davon.«
Es fing an zu schneien, und so machte ihnen ihr Spiel keinen Spaß mehr. Sie warfen den Toten ins Loch. Schaufelten ihn zu, ohne entschieden zu haben, was für ein Leben er gelebt haben könnte.
2
Die Frau schrie.
»Das darf euch nicht stören«, sagte Professor Moscati.
Wie eine Sau beim Metzger.
»Ein Arzt darf sich nicht ablenken lassen«, sagte Professor Moscati.
»Nicht ablenken lassen«, notierte der neue Student.
Sein Bleistift fiel zu Boden. Jemand hatte ihn zur Seite gerempelt. Wer vorne stand, wurde vom Professor bemerkt.
Mit jedem Schrei der Frau kräuselte sich der Vorhang vor ihrem Gesicht.
»Der Vorhang ist wichtig«, hatte man ihnen beigebracht. »Auch auf dem Gebärstuhl soll das natürliche weibliche Schamgefühl nicht verletzt werden.«
Mulieris pudor.
»Sie und Sie!«, sagte der Professor. Die beiden ausgewählten Studenten traten vor. Einer mit angewinkeltem Arm. Als ob er den Professor zum Tanz auffordern wolle. Aber er war dann nur der Kleiderständer für Moscatis Gehrock. Die ausgestreckte Hand des anderen wartete auf dessen Siegelring.
Gut, dass er nicht mich ausgewählt hat, dachte der Neue. Ich hätte nicht gewusst, was erwartet wird.
»Der wichtigste Sinn für einen Accoucheur?«, fragte Moscati. Die Studenten, die schon einmal bei einer Geburt dabei gewesen waren, antworteten im Chor: »Der Tastsinn.«
Als der Professor der Frau in die Scheide griff, begann sie wieder zu schreien.
Die Hebamme machte einen Schritt auf den Gebärstuhl zu. Nahm ihn wieder zurück. Wenn der Professor unterrichtete, hatte sie sich nicht einzumischen.
Moscati hatte die Augen geschlossen. »Interessant«, sagte er.
Der neue Student stellte sich vor, wie sich die Finger des Professors in der Frau bewegten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, dachte er.
»Sie!« Mit einer Kopfbewegung rief Moscati einen der Studenten zu sich. Derselbe, der in der ersten Reihe hatte stehen wollen.
»Bitte.« Als ob er jemandem unter einer Tür den Vortritt ließe.
Jetzt hatte der Student seine Hand in der Gebärenden.
»Was stellen Sie fest?«
»Es ist schwierig, Herr Professor.«
»Wenn es anders wäre, hätten wir den Fall der Hebamme überlassen. Weg!«
Man hatte dem Neuen geraten, zu dieser Vorlesung ein großes Taschentuch mitzubringen. Jetzt wusste er, warum. Wenn einen der Professor drangenommen hatte, brauchte man es hinterher für die Hände.
Noch drei weitere Studenten kamen an die Reihe. Keiner fand die Antwort, die Moscati hören wollte. Die Frau schrie unterdessen nur noch leise.
»Der Körper des Kindes ist zum Os sacrum hin verdreht. Wer von Ihnen traut sich zu, das Ungeborene so zu wenden, dass eine Kopfgeburt stattfinden kann?«
Die Studenten, auch die erfahrenen, wichen seinem Blick aus.
»Gut, dass sich keiner meldet. Das Beste, was sich erreichen lässt, ist eine Fußgeburt. Und die muss schnell vor sich gehen. Warum?«
Die Hebamme, von der es niemand erwartet hätte, wusste die Antwort. »Weil sich die Nabelschnur zwischen dem noch nicht geborenen Kopf und der Beckenwand festklemmen kann.«
»Schade, dass Frauen keine Ärzte werden können«, sagte Moscati. »Sie scheinen der einzige denkende Mensch in diesem Auditorium zu sein.«
Die Frau auf dem Gebärstuhl versuchte etwas zu sagen. Aber der Professor war jetzt ins Dozieren gekommen und ließ sich nicht unterbrechen. »Es gibt noch einen zweiten Grund, der bei Fußgeburten höchste Beeilung notwendig macht. Manchmal beginnt so ein halb geborenes Kind schon in der Beckenhöhle zu atmen und zieht dabei Vaginalschleim und Blut in die Atemwege, was zum Tod per suffocationem führen kann.«
Ich müsste mir Notizen machen, dachte der neue Student. Aber sein Bleistift war verschwunden.
»Passen Sie gut auf!« Moscati krempelte seinen Hemdsärmel noch höher. Sein Arm – der neue Student hätte sich das nicht vorstellen können – verschwand bis über den Ellenbogen in der schreienden Frau.
»Noch lebt das Kind«, sagte der Professor. »Ich kann das Pulsieren der Nabelschnur spüren.«
Gut, dass sich jetzt alle nach vorn drängten. So konnte sich der neue Student unauffällig gegen die Wand lehnen und tief durchatmen. Er öffnete erst wieder die Augen, als er den Applaus hörte.
Das Kind lebte.
Während sich Professor Moscati die Hände abtrocknete, verneigte er sich wie ein Schauspieler.
3
Man war einfach zu gut, dachte die Mutter Oberin. Ließ sich überreden, obwohl man wusste, dass man nur Ärger davon haben würde.
Diese junge Frau, die da vor ihr stand …
Dieses Mädchen …
»Wie war schon wieder der Name?«
»Innocentia, ehrwürdige Mutter.«
Nur schon für diesen Namen sollte man sie in ihr Dorf zurückschicken. Keine siebzehn Jahre und schon Mutter. Ohne das Sakrament der Ehe natürlich. Aber: Innocentia. Sinnlos, nach dem Vater zu fragen. »Der Stallknecht vielleicht«, würde sie sagen. »Oder der fahrende Händler mit den schönen schwarzen Augen. Ich hatte kein Geld für das dunkelrote Band«, würde sie sagen, »und wollte es doch so gern haben.« Die Jungfräulichkeit weggeworfen wie einen abgeschnittenen Fingernagel.
Das Kind tot geboren. Deo gratias. Es gab zu viele davon.
»Zeig mir deine Brüste«, sagte die Mutter Oberin.
An den Geruch der ungewaschenen Körper würde sie sich nie gewöhnen. Auch in einem Dorf gab es Brunnen. Wasser kostete nichts.
Ungeeignet. Die anderen Punkte, Krätze, Skrofeln und so weiter, musste man gar nicht mehr überprüfen. Ein Blick genügte.
Pockennarben kann man überpudern, dachte die Mutter Oberin. Eine kahle Stelle unter der Frisur verschwinden lassen. Brüste sind so, wie sie sind. Ehrlich. Vielleicht war es deshalb eine Sünde, sie zu entblößen. Mit den Jahren hatte sie gelernt, die Formen zu lesen, wie ein Viehhändler ein Euter zu lesen versteht. Gute Milch, schlechte Milch. Die hier waren schlaff. Zu klein. Brustwarzen, die sich zu verstecken schienen. Es würde das Melken nicht lohnen.
Bei der stillenden Muttergottes auf dem alten Gemälde, dachte die Mutter Oberin, der Maria lactans, waren die Brüste ganz falsch gemalt. Und wie sie das Kind hielt … Kein Neugeborenes würde so trinken.
Die Bewerberin wollte ihr Hemd hochziehen. Ein Blick genügte, und sie ließ die Arme sinken. Immerhin, das Gehorchen hatte sie gelernt.
Man war zu gut und ließ sich überreden.
Die Giuseppa hatte sie empfohlen. Aus demselben Dorf. »Sie tun damit eine gute Tat«, hatte sie gesagt. Für wen? Nicht für den Säugling, der an solchen Brüsten verhungern würde.
Die Giuseppa, das war eine gute Amme. Dumm wie ein Stück Holz und so hässlich, dass man sich fragte, wie sie immer wieder einen Schwängerer fand. Aber sie war jetzt schon zum dritten Mal hier, und ihre Kinder gediehen. Die eigenen und die fremden.
Jeden anderen Beruf kann man lernen, dachte die Mutter Oberin. Schneiderin. Köchin. Stallmagd. Zur Amme muss man geboren sein.
Und zur Nonne, dachte sie. Musste über den eigenen Gedanken lächeln.
Die junge Frau lächelte schüchtern zurück. Schlechte Zähne, was auch gegen sie sprach. Die Giuseppa hatte ein Gebiss wie ein Pferd.
»Du kannst dich wieder anziehen. Warte draußen. Ich muss das besprechen.«
Sie musste gar nichts besprechen. Hier im Martinitt hatte ihr niemand reinzureden, schon gar nicht dieser österreichische Hofrat. Kaum ein Wort Italienisch, aber nach Mailand hatte man ihn geschickt. Nun ja, er störte den Betrieb nicht allzu sehr. Man musste ihn nur im Glauben lassen, er habe etwas zu entscheiden. Als er im Schlafsaal das Bild der alten Kaiserin aufhängen wollte, hatte sie ihm widersprochen, nur um ihn dann die Diskussion gewinnen zu lassen. Maria Theresia passte zu einem Waisenhaus. Sechzehn Kinder. Keine schöne Geschichte, das in Frankreich mit Marie Antoinette.
Die Mutter Oberin hingegen hatte für über fünfzig Kinder zu sorgen. Bei den älteren spielte einer mehr oder weniger keine Rolle. Machte man die Portionen halt ein bisschen kleiner. Aber die Säuglinge mussten gestillt werden. Heute kam schon wieder einer dazu, hatte ihr der Hofrat ausrichten lassen. Ohne Vorwarnung. Von einem Tag auf den anderen.
»Das Kostgeld im Voraus bezahlt«, hatte er gesagt. »Für die ganzen achtzehn Jahre.« Da war kein Widerspruch möglich gewesen.
»Sie werden eine Lösung finden«, hatte er gesagt. Als ob Ammen an den Bäumen wüchsen.
Die Giuseppa, die Chiara, die Emilia.
Die Innocentia?
Den Namen würde man ändern müssen. Maria Magdalena vielleicht. Ein Sünderinnennamen für eine Sünderin.
Eine Amme mit leeren Brüsten.
Andererseits …
»Louis Chabos«, stand auf dem Zettel. Ein Franzosenbalg. Von der Mutter schon vor der Geburt fürs Waisenhaus bestimmt. Oder vom Vater.
Für achtzehn Jahre im Voraus bezahlt. Wenn so ein Kind starb, nahm das Waisenhaus keinen Schaden. Immerhin.
Vergib uns unsere Schuld, dachte die Mutter Oberin. Man musste an das Ganze denken, das war ihre Verantwortung. Wer eine Schlacht gewinnen will, darf nicht um jeden Soldaten trauern.
»Ausnahmsweise«, würde sie sagen. »Aus christlicher Barmherzigkeit. Aber wasch dich, um Himmels willen!«
4
Die Größten und Stärksten in jeder Altersgruppe wurden Giuseppini genannt. Niemand im Waisenhaus erinnerte sich, wie es zu diesem Namen gekommen war. Der Oberste von ihnen hieß Leandro. Er war einen Kopf größer als die anderen und durfte deshalb befehlen.
Heute hatte er beschlossen, dass nach dem Mittagessen eine Schlacht stattfinden sollte. Franzosen gegen Österreicher. Er selbst würde die Franzosen anführen. Damit stand der Ausgang der Schlacht fest. Niemand wollte Österreicher werden. Aber die Giuseppini sorgten dafür, dass genügend Gegner zum Verprügeln da waren.
Auch Louis Chabos, der Kleinste der Sechsjährigen, wurde als Österreicher eingeteilt. Sie bekamen fünf Minuten Vorsprung, um sich zu verschanzen. Es war schwierig, ein Versteck zu finden, das nicht jeder kannte. Das Gelände des Martinitt war klein. Wenn man außerhalb erwischt wurde, brachten einen die Nonnen zur Mutter Oberin, und man musste sich über den Stuhl legen.
Sie zogen ihn an den Beinen hinter dem Holzstoß hervor. Zu ihrer Enttäuschung wehrte er sich nicht. So nahmen sie ihn wenigstens gefangen und brachten ihn zu Leandro. Der hatte sein Hauptquartier auf einem leeren Fass. Ein General muss das Schlachtfeld überblicken können.
»Warum kämpfst du nicht?«, fragte Leandro.
Louis sagte: »Es ist nicht gerecht, dass ich Österreicher sein muss. Wo ich doch Franzose bin.«
»Du bist das, was ich bestimme«, sagte Leandro.
»Im wirklichen Leben, meine ich.« Wenn man zu jemandem hinaufschauen muss, braucht es noch mehr Mut, ihm zu widersprechen.
»Im wirklichen Leben bist du ein Frosch.«
Wenn Napoleon einen Scherz macht, lachen seine Soldaten.
»Weil ich doch Chabos heiße«, sagte Louis. »Das ist ein französischer Name.«
»Oh, Verzeihung«, sagte Leandro. Seine Soldaten kannten den Ton. Wussten, dass sie bald noch mehr Grund zum Lachen haben würden.
»Das ändert natürlich alles«, sagte Leandro. Zuckersüß. »Sag doch mal etwas Französisches.«
»Das kann ich nicht.«
»Du kannst kein Französisch?«, fragte Leandro. Übertrieben überrascht. »Kein einziges Wort?«
Louis schüttelte den Kopf.
»Dann bist du kein richtiger Franzose. Und ein falscher Franzose mitten in einer Schlacht kann nur eines sein. Na?«
»Ein Frosch?«, fragte Louis mit dünner Stimme. Die Buben, die ihn festhielten, lachten wieder, aber Leandro winkte ab. Der General bestimmt, wann seine Soldaten fröhlich sein sollen.
»Du bist ein Spion«, sagte Leandro. »Spione müssen bestraft werden.«
Er hatte den Brauch eingeführt, dass der siegreiche General der gewonnenen Schlacht einen Namen gab. Marengo hätte diese heißen sollen, das hatte er sich vorgenommen. Aber für einen so schönen Namen war sie zu wenig glorreich gewesen.
Bis jetzt.
»Du und du«, sagte Leandro zu den beiden, die Louis gebracht hatten, »ihr bekommt für eure Wachsamkeit einen Orden.« Er steckte ihnen die Auszeichnungen, die es nicht gab, an die Uniformen, die sie nicht hatten.
»Untersucht ihn auf Waffen«, kommandierte er.
Die Soldaten machten ihre Arbeit gründlich und verstanden nicht, warum ihr General unzufrieden mit ihnen war. Louis’ Taschen waren wirklich leer.
»Spione sind schlau«, sagte Bonaparte. »Seine Waffen sind natürlich unsichtbar.«
Diesmal fanden sie eine Pistole, ein Gewehr und eine Bombe.
»Ich habe es gewusst«, sagte Leandro. Ließ seine Soldaten im Karree antreten. Er kannte diese militärischen Ausdrücke oder erfand sie, wie sie gebraucht wurden. Auch die Österreicher durften sich dazustellen. Ein siegreicher Feldherr kann sich Großzügigkeit leisten.
Er schlug Louis nicht selbst. Das überließ er den jüngeren Giuseppini.
»Zehn Schläge«, sagte er, »das ist die richtige Anzahl für einen Spion.«
Nach dem vierten Schlag begann Louis zu weinen, und die Zählung musste von vorn beginnen.
5
Dottor Mauro war Lehrer und erklärte ihnen die Regeln der Grammatik. Aber vor allem war er Dichter. Hatte schon viele Bücher geschrieben. Wenn man ihn danach fragte, vergaß er, was er hatte unterrichten wollen, und begann zu erzählen. Dass sich die anderen Dichter gegen ihn verschworen hatten. Dass seine Werke nur deshalb nicht bekannt waren. Dass er einmal ein Buch auf eigene Kosten hatte drucken lassen, aber niemand hatte es gekauft. Auch das hatte mit dieser Verschwörung zu tun.
Während er davon erzählte, konnte man über andere Dinge nachdenken oder sich unterhalten. Nur Louis Chabos hörte aufmerksam zu. Er war der Einzige, dem auffiel, dass Dottor Mauro einmal sechs Bücher geschrieben hatte und ein paar Wochen später schon acht. Er muss sehr fleißig sein, dachte Louis.
Um Mauro vom Unterrichten abzuhalten, konnte man ihn bitten, eine von seinen Geschichten vorzulesen. Er war überzeugt davon, dass sie den Waisenkindern im Leben nützlicher sein würden als Rechtschreibung oder die Genealogie der Sforza. Wenn man sich nach einer Geschichte besonders dankbar zeigte, las er auch noch eine zweite vor.
Einmal ging es um einen Waisenknaben, dem das Leben übel mitgespielt hatte. Zuerst war sein Vater gestorben, dann seine Mutter, andere Verwandte hatte er nicht, und da, wo er lebte, gab es kein Waisenhaus.
»Ihr habt Glück, dass ihr hier im Martinitt sein dürft«, sagte Mauro.
Der Waisenknabe hungerte, schlief auf harten Steinen und hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Dann kam eines Tags ein Herold angeritten, der suchte im Auftrag des Königs nach einem kleinen Jungen, der ein Muttermal in der Form eines Sterns auf der Brust hatte. Genau so ein Muttermal hatte der Waisenknabe. So stellte sich heraus, dass er in Wirklichkeit der Sohn des Königs war. Zigeuner hatten ihn vor vielen Jahren aus seiner Wiege gestohlen. Der Herold setzte ihn hinter sich auf sein Pferd und ritt mit ihm zum Schloss. Dort wurde er mit großer Freude empfangen, heiratete eine wunderschöne Prinzessin und bestieg später als König den Thron.
»Was können wir daraus lernen?«, fragte Dottor Mauro. Man musste auf solche Fragen nicht antworten. Die Moral seiner Geschichten erklärte er gern selbst.
»Wir können nie wissen, was der Himmel für uns vorausbestimmt hat«, sagte er, »das ist der tiefere Sinn meiner Geschichte. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Auch den Niedrigsten unter uns kann er erhöhen, wenn es ihm gefällt. Jeden Tag kann sein Herold auch zu euch kommen. Vielleicht sitzt ein Königssohn mit uns in diesem Zimmer, und wir wissen es nur nicht.«
Man durfte nicht lachen, wenn er so etwas sagte. Sonst stellte er knifflige grammatikalische Fragen und schlug einem mit dem Lineal auf die Finger.
»Jeder von euch kann dieser Königssohn sein«, sagte Dottor Mauro. »Vielleicht …« Wie es der Herold in seiner Geschichte getan hatte, ließ er seinen Blick über die Buben schweifen. Dann lächelte er und sagte: »Vielleicht sogar unser kleiner Louis Chabos.«
Jetzt durfte gelacht werden. Nicht über die Geschichte, sondern über die Vorstellung, dass Louis Chabos ein Königssohn sein sollte. Dass er eine Prinzessin heiraten und auf einem Thron sitzen sollte.
Louis lachte mit. Das schien ihm am sichersten.
Nach der Stunde verneigte sich Leandro tief vor dem kleinen Louis. Auch alle anderen machten einen Bückling.
»Wenn ich Eure Majestät um eine Gnade anflehen dürfte«, sagte Leandro, »zeigen Sie uns doch bitte Ihr Muttermal.«
»Ich habe keines«, sagte Louis.
»Sind wir nicht vornehm genug, um es zu sehen?«, fragte Leandro.
»Ich habe wirklich kein Muttermal.«
»Das muss überprüft werden«, sagte Leandro.
Seine Mitschüler stellten gemeinsam fest, dass auf Louis’ Brust kein Muttermal in der Form eines Sterns war. Sie zogen ihm auch die Hosen aus, für den Fall, dass das Zeichen seiner Herkunft an eine andere Stelle gerutscht sein sollte.
»So etwas kommt vor«, sagte Leandro.
Aber da war kein Muttermal, nicht an Louis’ Bauch und nicht an seinem Hintern. Leandro steckte ihm sogar einen Bleistift zwischen die Pobacken, um sie auseinanderzudrücken und ganz sicherzugehen.
»Es wäre doch möglich gewesen«, sagte er.
Als Schwester Costanza zur nächsten Stunde kam, lag Louis Chabos splitternackt auf dem Lehrerpult. Sie wüssten auch nicht, warum er sich ausgezogen habe, sagten seine Mitschüler.
Für seinen geschmacklosen Streich wurde er zur Mutter Oberin geschickt und musste sich über den Stuhl legen.
6
Am zwölften Geburtstag wurde man in den Raum bestellt, vor dem sich jeder fürchtete, weil man ihn sonst nur für Bestrafungen betrat. Man zog dafür seine besten Hosen an, wenn man beste Hosen hatte. Säuberte sich die Hände mit Bimsstein. Dann stand man vor der Mutter Oberin, und sie teilte einem mit, welchen Beruf man im Leben haben würde. »Du bist jetzt kein Kind mehr«, sagte sie jedes Mal als Erstes. Man nannte dieses Datum im Waisenhaus den »Kein-Kind-mehr-Tag«.
»Du bist jetzt kein Kind mehr«, sagte sie zu Louis Chabos.
Vor einem zwölften Geburtstag schlossen die Freunde Wetten ab. Um einen Apfel oder um den Nachtisch am Sonntag. »Ich bin sicher, du wirst dies« oder »Du wirst das«, sagten sie. Bei Louis hatte niemand gewettet. Dazu hätte man Freunde haben müssen.
Die Giuseppini und die anderen Großen und Starken wurden Maurer oder Holzarbeiter. Berufe für Männer, die Wein tranken und auf der Straße fremden Menschen vor die Füße spuckten. Wer geschickte Hände hatte, lernte mit Nadel und Faden umzugehen. Jacopo, der bei ihren Wettrennen immer Letzter geworden war, arbeitete jetzt in der Küche. Man nannte ihn »das Fass«, weil er es als Einziger geschafft hatte, trotz der mageren Waisenhauskost dick zu werden.
»Über deine Zukunft habe ich mir besonders viele Gedanken gemacht«, sagte die Mutter Oberin. Sie sagte es jedes Mal. Sie wusste nicht, dass sich auch diese Gewohnheit im Waisenhaus herumgesprochen hatte.
»Danke«, sagte Louis. Es war seine Erfahrung, dass er damit nichts falsch machen konnte.
Ein Stimmchen wie ein Achtjähriger, dachte die Mutter Oberin. Ist er tatsächlich schon zwölf?
Aber die Papiere waren eindeutig. Chabos, Louis. Sechzehnter Dezember 1794.
Die Zeit geht zu schnell vorbei, dachte sie. War sich nicht sicher, ob sie das laut gesagt hatte. Räusperte sich deshalb.
Der Junge zuckte zusammen. Schreckhaft, dachte die Mutter Oberin. Ängstlich. Nur schon wie er dasteht. Als ob er sich vor der Welt wegducken wollte.
»Jeder Mensch«, sagte sie, »hat von Gott ein besonderes Talent für sein Leben mitbekommen. Auch du.«
»Danke«, sagte Louis.
»Der eine ist stark, der andere ist klug. Du bist …« Am kleinen Chabos war ihr nie eine besondere Fähigkeit aufgefallen. Aber es wäre unchristlich gewesen, einen Jungen zu enttäuschen, den man auf seinen Lebensweg schickt. »Du bist so wunderbar bescheiden«, sagte sie.
»Danke«, sagte Louis.
»Bescheidenheit ist eine seltene Tugend. Und deshalb …«
Bei allen anderen hatte sie rechtzeitig über einen Beruf nachgedacht. Hatte sich den Jungen mit einem Schmiedehammer in der Hand vorgestellt. Mit der Peitsche eines Fuhrmanns. Meistens hatte es nicht viel Überlegung gebraucht. Besondere Talente waren selten. Diesen Louis hatte sie übersehen. Man musste an zu vieles denken.
Ich werde alt, dachte sie. Schob den Gedanken weg.
Der kleine Chabos …
Sie hatte damals nicht erwartet, dass er seinen ersten Geburtstag überleben würde. Diese Amme … Wie hatte sie schon wieder geheißen? Diese Maria Magdalena … Innocentia … Blaue Milch, das hatte man ihr angesehen. Ungesund wie ihr Charakter. War dann von einem Tag auf den anderen verschwunden. Durchgegangen mit einem Sizilianer, der auf dem Jahrmarkt zu San Bartolomeo Tänze vorgeführt hatte. Tänze, mein Gott. Am Gedenktag für einen Apostel. Einen Märtyrer. An solchen Tagen hätte es gar keine Jahrmärkte geben dürfen, das war immer ihre Ansicht gewesen. Einfach davongelaufen. Aber der Junge wäre auch so schwächlich geblieben.
»Und deshalb …«, sagte sie zum zweiten Mal.
Das Kostgeld für achtzehn Jahre zum Voraus bezahlt, stand in den Papieren. Von einem ungenannten Wohltäter.
Louis Chabos … Ein französischer Name. Damals hatte noch niemand daran gedacht, dass die Franzosen eines Tages in Mailand … Aus dem Waisenhaus ein Hospital für Soldaten gemacht. Aber die Institution selbst nicht angetastet, immerhin. Und es war ja eigentlich ganz nützlich, dass man jetzt mitten in der Stadt …
Früher konnte ich mich besser konzentrieren, dachte sie.
Nimm dich zusammen, dachte sie. Der kleine Louis braucht einen Beruf.
»Und deshalb …«, sagte die Mutter Oberin.
Wenn man einen Satz dreimal wiederholt, das hatte ihr einmal ein Prediger verraten, merken die Zuhörer nicht, dass man nur Zeit zum Überlegen gewinnen will.
Es lag nicht nur an ihr, wenn sie sich immer wieder ablenken ließ. Der Junge war daran schuld. Man vergaß ihn, noch während er vor einem stand. Machte sich kleiner, als er ohnehin war. Als ob er versuchte, unsichtbar zu werden.
Hinterher hätte sie nicht sagen können, warum ihr in diesem Moment der Marchese einfiel.
7
Der älteste Mann, den Louis Chabos je gesehen hatte. Die Haut wie brüchiges Leder. Die schütteren Haare gelblich verfärbt. Die Handrücken voll dunkelbrauner Flecken. Aber er stand mit geradem Rücken da. Wie ein Soldat. Als ob er einmal Soldat gewesen wäre.
»Wie alt bist du?«, fragte der Marchese.
»Zwölf Jahre«, sagte Louis Chabos.
»Sprich lauter!«, sagte der Marchese. »Alles andere ist unhöflich. Merk dir das. Noch einmal: Wie alt bist du?«
»Zwölf Jahre.«
»Herr Marchese«, sagte der Marchese. Er stieß die Spitze seines Gehstocks auf den Boden. Man merkte: Er war ungeduldig. Der Stock aus schwarzem Holz. Der Knauf aus Silber. Wie das Kreuz, das die Mutter Oberin um den Hals trug.
»Ich bin zwölf Jahre alt, Herr Marchese. Seit heute.«
»Du hast Geburtstag?«
»Ich bin jetzt kein Kind mehr.«
Der Marchese machte ein Geräusch, das vielleicht ein Lachen war. »Die Obernonne hat keine Zeit verloren«, sagte er. »Wenn ich einen Wunsch habe, erfüllt sie ihn mir. Sag mir warum!«
»Ich weiß es nicht, Herr Marchese.«
»Weißt du, was ein Testament ist?«
»Nein, Herr Marchese.«
»Wenn dich heute auf dem Heimweg ins Martinitt eine Kutsche überfährt, und du bist tot, wer bekommt dann deine Spielsachen?«
»Ich habe keine Spielsachen«, sagte Louis Chabos.
»Ich hatte früher ein ganzes Zimmer voll«, sagte der Marchese. »Ich hatte alles. Jetzt ist nur noch dieser Palazzo übrig. Nicht im besten Zustand. Ich habe ein Blatt Papier genommen und darauf geschrieben: ›Nach meinem Tod soll das Waisenhaus das Grundstück bekommen.‹ Das nennt man ein Testament. Man kann es jederzeit ändern. Darum erfüllt mir die Mutter Oberin jeden Wunsch. Hast du das verstanden?«
»Nicht ganz, Herr Marchese.«
»Du hast viel zu lernen. Vielleicht kann es unterhaltsam sein, es dir beizubringen.« Wenn der alte Mann nickte, sah er aus wie ein pickender Vogel. »Fangen wir am Anfang an: Was kannst du gut?«
»Nichts«, sagte Louis Chabos.
»Das ist schon mal nützlich«, sagte der Marchese. »Auf ein leeres Blatt lässt sich gut schreiben. Hol mir ein Buch!«
In dem großen Regal standen viele Bücher.
»Irgendeines.«
Um seinen Diensteifer zu zeigen, wählte Louis einen besonders großen Band.
»Dort. Auf den Tisch.«
Als er das Buch hinlegte, stieg Staub auf.
»Das ist schon einmal eine erste Arbeit für dich«, sagte der Marchese. »Jedes Buch einzeln sauber machen.« Er schlug den Deckel des Bandes auf. Wies auf zwei Worte, die in großen Buchstaben gedruckt waren. »Kannst du das lesen?«
»Imago Mundi«, buchstabierte Louis.
»Was heißt das?«
»Ich weiß es nicht, Herr Marchese.«
»Das Bild der Welt. Landkarten von fremden Ländern. Weißt du, was der Globus ist?«
»Nein, Herr Marchese.«
»Es weiß es niemand. Sie meinen nur alle, sie wüssten es. Aber keiner sieht weiter als bis zum nächsten Kirchturm. Zum nächsten Berg. Man macht sich auf den Weg, und wenn man ankommt, ist da nur ein anderer Kirchturm. Ein anderer Berg.« Der Marchese hatte die Augen geschlossen. Als ob er zu sich selbst redete. »Irgendwann«, sagte er, »irgendwann ist man wieder dort, wo man losgegangen ist. In derselben Stadt. Im selben Palazzo. Im selben Zimmer. Man nimmt die Bücher aus dem Regal, die man schon immer aus dem Regal genommen hat, und es stehen immer noch dieselben Weisheiten darin. Nur schwerer sind die Bücher geworden. Weil man selbst schwächer geworden ist. Man schlägt sie auf und denkt: Früher war da nicht so viel Staub. Das ist das Einzige, das sich verändert. Der Globus ist nur ein Versprechen. Verstehst du, was ich dir sagen will?«
»Nein, Herr Marchese.«
»Das ist gut«, sagte der Marchese. »Ich verstehe es auch nicht.« Er öffnete die Augen und schlug den Deckel des Buches so heftig zu, dass es klang wie ein Schuss. »Weißt du, warum die Mutter Oberin dich zu mir geschickt hat?«
»Weil ich einen Beruf erlernen soll.«
»Die Mutter Oberin besucht mich alle paar Monate«, sagte der Marchese. »Um sicherzugehen, dass ich mein Testament nicht geändert habe. Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass ich mir keine Dienstboten mehr leisten kann. Keinen Kutscher und keine Aufwärterin. Nur am Nachmittag kommt diese Frau und kocht etwas. Weißt du jetzt, welchen Beruf ich dir beibringen soll, Louis Chabos?«
8
Die ersten Tage hatte er während der Mahlzeiten hinter dem Marchese stehen müssen. Mit geradem Rücken und ohne sich zu rühren. Bis der irgendwann gesagt hatte: »Das Stehen scheinst du begriffen zu haben. Es wird Zeit für die nächste Lektion.« Seither aßen sie gemeinsam. Es gab viele Regeln zu beachten. Wie man das Besteck zu halten hatte. Den Mund abzuwischen. »Gute Manieren sind im Leben nützlich«, sagte der Marchese.
»Merk dir das«, sagte er.
Wenn Louis am Abend ins Martinitt zurückkam, war es ratsam, die neuen Manieren zu verstecken. Man wurde sonst verprügelt.
Der Marchese hatte ihn noch kein einziges Mal geschlagen. Auch nicht, als Louis das Kristallglas zerbrochen hatte. »Es war ohnehin schon alt«, hatte der Marchese gesagt. Dabei hatte er Louis erklärt, dass alte Dinge oft die wertvollsten waren.
Einmal hatte Louis große silberne Platten mit Zitronensaft einreiben müssen, um sie glänzend zu machen. Dann war ein fremder Mann gekommen und hatte sie gekauft. »Er hat zu wenig bezahlt«, sagte der Marchese hinterher. »In meiner Familie handelt man nicht.«
Manchmal sagte ihm der Marchese nicht, was er tun sollte, sondern schrieb es auf ein Blatt Papier. Beim ersten Mal hatte Louis das nicht verstanden, und das Blatt war unbeachtet auf dem Tisch liegen geblieben. »Heute Abend: Fisch« hatte darauf gestanden. Der Marchese hatte ihn nicht getadelt, sondern nur gesagt: »Ein guter Diener sieht alles. Auch das ist im Leben nützlich. Merk dir das.«
Heute hatte Louis aus einem Schrank auf dem Dachboden eine samtene Jacke und eine Kniebundhose holen müssen. Er hatte versucht, die Sachen anzuziehen, aber die Hose war zu weit, und in die Jacke hatten die Motten Löcher gefressen. »Du kannst den Boden damit aufwischen«, sagte der Marchese. »Wir bekommen Besuch.«
Der Besuch war die Mutter Oberin. Louis machte die Verbeugung, die ihm der Marchese beigebracht hatte. Sie schaute an ihm vorbei. Sprach über ihn, als ob er nicht anwesend wäre.
»Sind Sie mit ihm zufrieden?«, fragte die Mutter Oberin.
»Viel hat er im Martinitt nicht gelernt«, sagte der Marchese.
»Zu viel Bildung macht faule Menschen.«
»Da haben Sie wohl recht«, sagte der Marchese. »Mich haben meine Bücher zu einem sehr faulen Menschen gemacht.«
Die Mutter Oberin nahm einen winzigen Schluck von dem Vin Santo, den ihr Louis hatte servieren dürfen. »Seien Sie streng mit ihm. Wenn man die Buben verzärtelt, werden sie aufsässig.«
»Das mag wohl sein«, sagte der Marchese. Er führte sein Glas zum Mund. Ließ es wieder sinken, ohne getrunken zu haben. »Allerdings … Es wäre mir lieb, wenn Louis auch über Nacht hierbleiben könnte. Manchmal wache ich mit trockenem Mund auf. Dann ist niemand da, der mir ein Glas Wasser bringt.«
»Das ist leider nicht möglich. Unsere Hausordnung, Sie verstehen. Bevor er nicht sechzehn ist …«
»So lang wird mein Durst nicht warten«, sagte der Marchese. »Aber ich habe volles Verständnis. Es wird sich eine andere Lösung finden.«
Er hatte einen Fleck auf seiner Manschette entdeckt und musste mit dem Fingernagel daran herumkratzen. »Dann werde ich Louis also pünktlich zurück ins Waisenhaus schicken«, sagte er.
»Wenn es Ihnen sehr wichtig ist …«
»Ganz und gar nicht«, sagte der Marchese. »Auf keinen Fall will ich Ihnen Umstände machen.« Jetzt schien auch auf seiner anderen Manschette ein Fleck zu sein. »Außerdem haben mir die Benediktiner versprochen, jederzeit jemanden zu schicken.«
Die Mutter Oberin schien diesmal einen großen Schluck genommen zu haben, denn sie verschluckte sich. »Vielleicht könnten wir in Ihrem Fall eine Ausnahme …«
»Nicht nötig«, sagte der Marchese. »Es sind sehr hilfreiche Leute, diese Benediktiner. Vielleicht ist ein Erwachsener sogar besser. Weil er Zeuge sein kann. Falls ich einmal ein offizielles Dokument aufsetzen will.«
»Was für ein Dokument?«, fragte die Mutter Oberin. Sie sieht erschrocken aus, dachte Louis.
»Falls sich die Notwendigkeit ergeben sollte.«
»Selbstverständlich kann Louis Chabos rund um die Uhr bei Ihnen bleiben«, sagte die Mutter Oberin.
»Wenn es Ihnen keine Umstände macht«, sagte der Marchese.
»Als Christin ist es meine Pflicht.«
Der Marchese schüttelte den Kopf. Auch dabei sah er wie ein Vogel aus, aber diesmal war es eine Eule. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte er, »wollen wir den Erlöser nicht mit dieser Angelegenheit belästigen. Ich nehme an, er hat Wichtigeres zu tun. Meinen Sie nicht auch, ehrwürdige Mutter?«
9
Allein zu schlafen war ungewohnt. Aber schon bald vermisste Louis das Schnarchen und Im-Schlaf-Reden der andern nicht mehr. Auch das Federbett roch nicht mehr muffig, seit er es in der Sonne ausgelüftet hatte.
Der nächtliche Durst des Marchese schien sich gelegt zu haben. Er hatte Louis in keiner einzigen Nacht gerufen. Obwohl da eine Glocke gewesen wäre.
Die Arbeit fing jeden Morgen gleich an. »Das hat mir am meisten gefehlt«, sagte der Marchese. »Dass ich mich nicht mehr im Bett rasieren lassen konnte.«
Er hatte Louis schon eine Menge beigebracht. Nicht so, wie Schwester Costanza und die anderen Lehrer es taten. Der Marchese machte es mit Erinnerungen. Manchmal dachte Louis: Er ist alt. Aber um all das erlebt zu haben, müsste er noch älter sein.
»Einmal – ich war damals in sizilianischen Diensten – hat mich jemand beim Kartenspiel betrogen«, sagte der Marchese. »Ich habe es gemerkt und habe es geschehen lassen. Sag mir, warum!«
»Weil der andere stärker war?«, fragte Louis.
»Das darf nie ein Grund sein«, sagte der Marchese. »Man prügelt sich nicht in einer Kneipe. Merk dir das. Außer, wenn es unbedingt sein muss. Er hatte einen Trick beim Kartenmischen, nur waren seine Finger nicht schnell genug. Ich habe es gesehen und geschwiegen. Habe meine Schulden bezahlt und noch eine Flasche Nero d’Avola dazu. Bestell nie den Wein, den dir der Wirt empfiehlt. Auch das musst du dir merken.«
Louis Chabos hatte noch nie Wein getrunken.
»Ich habe mich höflich verabschiedet«, sagte der Marchese. »Habe draußen auf der Gasse auf ihn gewartet. Es hat lang gedauert, bis er gekommen ist. Die Flasche, die ich bezahlt hatte, war wohl nicht ihre letzte. Ich habe ihm das Gesicht aufgeschlitzt. So haben es schon meine Vorfahren mit Betrügern gemacht. Damit sie jeder erkennen konnte.«
»Und sich Ihr Geld wieder genommen.«
»Nein«, sagte der Marchese. »Ich habe es ihm gelassen. Es ging nicht um Geld, sondern um Ehre. Man hat so viel Ehre, wie man sich nimmt. Merk dir das.«
Ein paar Tage später, als Louis auf einer Leiter stand, um die Glasprismen des Kronleuchters von Staub zu befreien, sagte der Marchese: »Einmal bin ich auf so einer Leiter zu einer Frau ins Fenster gestiegen. Wir hätten uns auch heimlich treffen können, aber sie wollte von einem Helden geliebt werden. Ich war kein Held.«
Doch, dachte Louis, ganz bestimmt ist der Marchese ein Held gewesen.
»Irgendwann lässt sich nicht mehr unterscheiden, was die Welt von einem denkt und was man wirklich ist«, sagte der Marchese. »Wenn du die anderen von deinem Mut überzeugen kannst, wirst du eines Tages wirklich mutig sein. Merk dir das.«
Louis konnte sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlen würde, mutig zu sein.
»Sie hatte einen eifersüchtigen Ehemann«, sagte der Marchese. »Und zu dem Haus gehörte ein Rudel scharfer Hunde.« Er fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Nein«, sagte er dann, »es war nur ein einziger Hund. Aber sich selbst darf man anlügen. Manchmal lüge ich mir vor, ich sei noch jung.«
Er rüttelte so heftig an der Leiter, dass Louis beinahe das Gleichgewicht verlor. »Hattest du jetzt Angst?«, fragte er.
»Ja, Herr Marchese.«
»Lüg dir vor, dass du keine Angst hast. Dann geht sie vorbei. Was wollte ich erzählen?«
»Sie sind zu einer Frau ins Fenster geklettert.«
»Ich wollte zu ihr ins Fenster klettern«, sagte der Marchese. »Sie hat mir nicht aufgemacht. Die Dinge enden selten so, wie sie angefangen haben. Merk dir das.«
Ein anderes Mal, als sie beim Essen saßen und Louis Chabos ein Messer benutzt hatte, wo man es nicht hätte benutzen dürfen:
»Du musst dich jederzeit so benehmen, als ob du an einem Königshof eingeladen wärst. Sonst wird niemand auf den Gedanken kommen, dich auch tatsächlich dorthin einzuladen.«
»Haben Sie einmal einen richtigen König kennengelernt, Herr Marchese?«
»Ob es ein richtiger war, weiß ich nicht«, sagte der Marchese. »Man erzählte sich, er habe sich während einer Schlacht vor Angst in die Hosen geschissen.«
Manchmal wusste man nicht, ob die Dinge wirklich so gewesen sein konnten, wie er sich an sie erinnerte.
»Wenn du einen König beeindrucken willst«, sagte der Marchese, »verneig dich weniger tief als die anderen. Merk dir das. Von denen mit der Nase am Boden kennt er genug.«
Unter dem dicken Federbett versuchte sich Louis an all die Dinge zu erinnern, die er sich merken sollte.
10
Einmal, als Louis schon mehr als zwei Jahre im Palazzo lebte, stand der Marchese mitten in der Nacht an seinem Bett und schrie ihn an.
»Faulpelz!«, schrie der Marchese. »Warum kommst du nicht, wenn ich klingle?«
Die Glocke hatte nicht geläutet. Darauf hätte Louis jeden Eid geschworen. Auch den großen, blutigen, den im Martinitt noch nie jemand gebrochen hatte.
»Steh auf, wenn ich mit dir rede!«
Louis sprang aus dem Bett.
»Ich war zu nachsichtig«, sagte der Marchese. Gab ihm eine Ohrfeige. »Aber das ändert sich jetzt.«
Als die Glocke wenig später wirklich läutete, rannte Louis mit dem Glas los, so schnell er konnte.
»Zu langsam«, sagte der Marchese. Goss ihm das Wasser über den Kopf.
Beim Frühstück musste Louis hinter seinem Stuhl stehen. Bekam nicht einmal ein Stück Brot.
»Ich habe dich zu sehr verwöhnt«, sagte der Marchese.
Im großen Regal entdeckte er eine Spur von Staub. Fegte eine Reihe von Büchern auf den Boden. »Wenn du sie nicht wieder richtig einordnest, setzt es Prügel«, sagte er.
Louis fand die richtige Ordnung nicht.
»Du gibst dir keine Mühe«, sagte der Marchese.
Am Nachmittag war der Kaffee angebrannt. Wieder wurde Louis geschlagen. Dabei hätte er den blutigen Eid geschworen, dass er nichts falsch gemacht hatte.
Auch beim Abendessen musste er zusehen.
»Wenn du ein Hund wärst, würde ich dich auspeitschen«, sagte der Marchese.
»Sie werden Ihre Gründe haben«, sagte Louis.
Der Marchese stieß die Spitze seines Gehstocks auf den Boden.
»Herr Marchese«, sagte Louis schnell.
Der Marchese schob seinen Teller weg. Stand auf. »Du enttäuschst mich, Louis Chabos«, sagte er.
»Wie Sie meinen, Herr Marchese«, sagte Louis.
»Schon den ganzen Tag bestrafe ich dich für Dinge, die keine Strafe verdienen. Warum wehrst du dich nicht?«
»Ich bin Ihr Diener«, sagte Louis.
»Du bist ein Mensch«, sagte der Marchese. »Was würde ich tun, wenn mich jemand ohne Grund schlagen würde?«