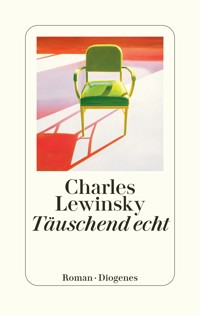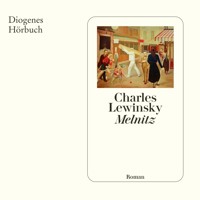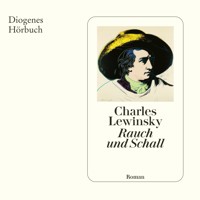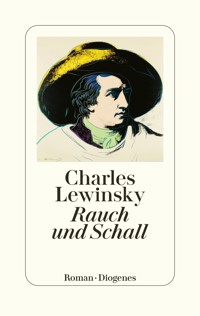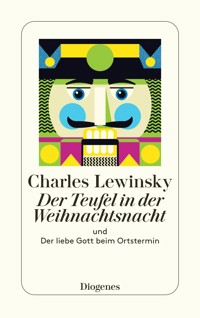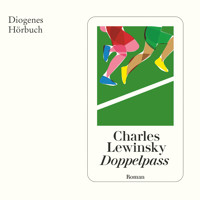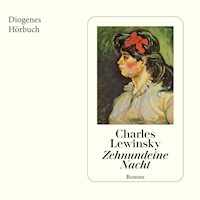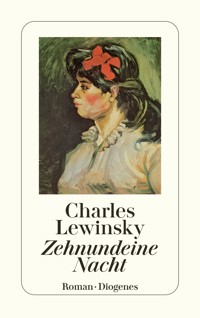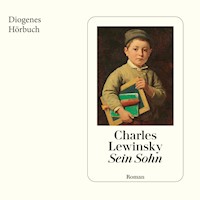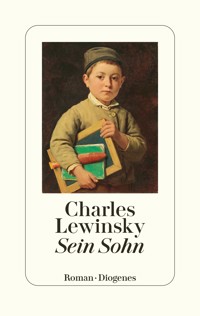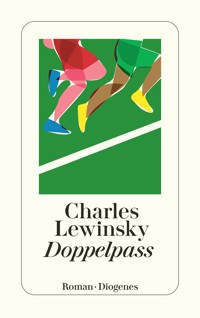
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Cousins Tom und Mike Keita sind beide aus Guinea in die Schweiz gekommen. Nur dass Tom ein erfolgreicher Fußballspieler ist und Mike ein illegaler Immigrant. Entsprechend verschieden werden sie behandelt. Während man dem einen die erleichterte Einbürgerung anbietet, gerät der andere in die Mühlen der Bürokratie, die nur ein Ziel kennt: ihn so schnell wie möglich wieder loszuwerden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charles Lewinsky
Doppelpass
roman
Diogenes
Vorwort
Ein Fortsetzungsroman? Für eine Zeitschrift? Wie kannst du nur?
Das waren so die Fragen meiner Freunde und Kollegen, als Doppelpass angekündigt wurde. Die Form sei doch völlig veraltet, sagte man mir. Tiefstes 19. Jahrhundert. Wer habe heute, im Zeitalter des blitzschnellen Internets, schon die Geduld, nach jedem Kapitel eine ganze Woche zu warten, nur um zu erfahren, wie eine Geschichte weitergehe? Und überhaupt: Wer lese denn heute überhaupt noch Zeitschriften?
Lauter berechtigte Einwände.Warum habe ich das Projekt trotzdem in Angriff genommen? Ich kann da nur die Antwort von Sir Edmund Hillary zitieren, als man von ihm wissen wollte, warum er denn auf den Mount Everest geklettert sei. »Because it was there«, sagte er.
Nun ist das Schreiben von Romanen bestimmt nicht so gefährlich wie das Besteigen von Achttausendern. (Selbst der schlimmste Verriss lässt sich nicht mit dem Sturz in eine Gletscherspalte vergleichen.) Aber wie soll sich ein für Bungeesprünge und andere adrenalinträchtige Vergnügungen völlig ungeeigneter Schriftsteller sonst das angenehme Kribbeln eines Abenteuers verschaffen? Und erst noch ohne dafür seinen Schreibtisch zu verlassen?
Und ein paar Parallelen zu einer Bergtour gibt es schon. Zum Beispiel die Wahl der richtigen Route. Wenn man sich als Bücherschreiber in einer Geschichte verläuft – und das kommt öfter vor, als der geneigte Leser vielleicht denkt –, dann gibt es am Computer für den Notfall immer diese wunderbare Delete-Taste, mit der man die eigenen Fehler für alle Zeiten im elektronischen Orkus verschwinden lassen kann. Im Normalfall kann man sich als Autor jederzeit umentscheiden, kann eine Szene in eine neue Richtung weitergehen lassen oder sie an eine andere Stelle verschieben.
Bei einem Fortsetzungsroman geht das nicht. Was erschienen ist, ist erschienen, und wenn einem hinterher einfällt, dass es anders viel besser gewesen wäre, dann nützt einem das gar nichts mehr.
Und wie bei einem Gipfelsturm wusste ich auch von Anfang an, wo mein Ziel war. Nicht auf 8800 Meter Höhe, sondern nach fünfzig Folgen à 10000 Anschläge. Exakt dort sollte die Geschichte zu Ende sein. Der Handlungsbogen musste also freihändig gespannt werden. Ohne die Möglichkeit, nachträglich noch Stützpfeiler einzuziehen.
Aber lassen wir die Klettersport-Vergleiche. Ich gebe ja gern zu: Die Sache hat mich einfach gereizt, weil sie schön schwierig war. Because it was there. Und weil sich eine ganze Menge großer Vorgänger auch schon mit dem gleichen Problem herumgeschlagen haben. Charles Dickens, Alexandre Dumas oder Arthur Conan Doyle – das ist doch eine ehrenwerte Ahnenreihe.
Als es dann um die Buchausgabe ging, war die Versuchung natürlich groß, nachträglich ein paar Verbesserungen anzubringen. Die eine oder andere Formulierung zu ändern. Oder den Bezug auf schon wieder vergessene Tagesaktualitäten wegzulassen. Ich habe dieser Versuchung widerstanden. Doppelpass erscheint hier ganz genau so, wie die Geschichte ein Jahr lang in der Weltwoche gestanden hat. Für einen Fortsetzungsroman, finde ich, gehört sich das so.
Charles Lewinsky
1
Der Lastwagen hielt ohne Vorwarnung an. Er hörte den metallischen Schlag, mit dem die Heckklappe entriegelt wurde, und dachte erschrocken: ›Wir sind in eine Kontrolle geraten.‹ Die Kisten, die sein Versteck umgaben wie eine Mauer, wurden zur Seite geschoben. Er hätte sich gern unsichtbar gemacht, aber da war kein Spalt mehr, in dem er sich hätte verkriechen können. Dann fiel auch schon Licht zu ihm herein, nicht grell und blendend, wie er es erwartet hatte, sondern mild und gedämpft. Es musste schon Abend sein.
Der Mann, der da stand, trug keine Uniform, nur eine Windjacke über einem T-Shirt. Der Fahrer, wenn es auch nicht derselbe war, den er beim Einsteigen gesehen hatte. Der Mann kratzte sich am Bauch und sagte etwas in einer rauen, fremden Sprache. Es konnte »Hier sind wir« bedeuten oder »Aussteigen« oder ganz einfach: »Hau ab!« Man musste die Worte nicht verstehen; die Geste war so eindeutig wie die Ungeduld.
Seine paar wenigen Habseligkeiten waren schnell eingesammelt. Den Mantel, der ihm zusammengerollt als Kopfkissen gedient hatte, zog er an. Damals im Auffanglager hatte er ihn sich aus einer Kleiderspende herausgesucht. Die andern hatten ihn dafür ausgelacht und Marabu genannt, denn der Mantel war zu lang, und manchmal stolperte er über den Saum. Aber er wärmte, und nur darauf kam es an.
Sein einziges Reisegepäck war eine blaue Plastiktasche mit dem Logo einer Fluggesellschaft. Irgendwann einmal, das hatte er sich vorgenommen, würde er zum Flughafen gehen und einfach einsteigen. Einsteigen und nach Hause fliegen. Einen Mantel mit Pelzkragen würde er dann anhaben, und ein Angestellter würde ihm die Tasche hinterhertragen.
Irgendwann einmal.
Als er von der Ladefläche auf die Straße sprang, knickten seine Knie ein. Er hatte sich allzu lang nicht richtig bewegen können. Der Mann schob ihn mit einer hastigen Bewegung zur Seite und verriegelte die Heckklappe wieder. Er nickte ihm nicht zu, bevor er zur Fahrerkabine zurückging, schaute ihn nicht einmal an. Aber an der nächsten Kreuzung ließ er die Bremslichter aufleuchten, und das konnte man, wenn man wollte, als Abschiedsgruß deuten.
Dann war er allein.
Das Erste, was ihm auffiel: Die Straße war so sauber. Eine andere Sauberkeit, als er sie kannte. Nicht als ob gerade eine Putzkolonne um die Ecke gebogen wäre, sondern als ob hier gar niemand wohnte, als ob sich hinter den Hecken auf beiden Seiten gar keine Häuser versteckten, sondern nur unbebautes Land. Oder als ob die Menschen hier gar nicht auf den Gedanken kämen, etwas wegzuwerfen. Obwohl sie doch so viel hatten. Da lag nirgends ein Papierfetzen. Keine Zigarettenpackung und keine Melonenschale.
Gab es hier überhaupt Melonen? Bestimmt. Hier gab es alles, hatte Vetter Tom geschrieben. ›Man kann hier alles kaufen‹, hatte in einem Brief gestanden. ›Man muss nur genug Geld haben.‹
Oft hatte er ja nicht geschrieben, oder vielleicht waren manche Briefe auch unterwegs verlorengegangen. Der Weg war weit, durch zwei Kontinente und über das Meer, und der Mann, der den Postjeep fuhr, war meistens betrunken. Aber wenn eine Nachricht gekommen war, aus dieser fremden Welt, dann hatten sie sie alle gelesen. Oder sich vorlesen lassen.
Eine Nachricht aus der Schweiz. Von Vetter Tom, der mit ihm um drei Ecken verwandt war. Vetter Tom mit den goldenen Füßen.
Manches hatten sie nicht verstanden und hatten es sich ausdeuten müssen wie ein Rätsel. ›Ich habe jetzt ein Haus‹, hatte Vetter Tom einmal geschrieben. ›Es gehört nicht mir, aber es ist doch mein eigenes.‹ Darüber hatten sie lang diskutiert.
›Es geht mir gut‹, hatte in jedem Brief gestanden. Und einmal sogar: ›So gut, wie Ihr es Euch überhaupt nicht vorstellen könnt.‹ Als er das gelesen hatte, genau diesen Satz, da hatte er beschlossen, eines Tages auch in dieses Land zu fahren. ›Sie sprechen hier vier Sprachen‹, hatte Vetter Tom geschrieben. ›Aber man muss sie nicht alle können.‹
Vier Sprachen. Bei ihm zu Hause in Guinea waren es acht. Es hatte das Geld der ganzen Familie gebraucht, um hierherzukommen. Aber jetzt war er da, und das Haus von Vetter Tom musste ganz in der Nähe sein.
Die Adresse stand auf dem Zettel, der, vierfach gefaltet, in dem kleinen Lederbeutel unter seinem Pullover steckte, ein dritter Glücksbringer neben dem Stein, der ihm Kraft spenden, und der Feder, die seine Reise leicht machen sollte. Er musste das Papier nicht herausholen, um sich an den Namen der Straße zu erinnern.
Birkenweg.
Eine Birke war ein Baum.
In dem Lager, wo er zwei Monate gewesen war, nachdem beim ersten Versuch die Küstenwache ihr Boot aufgebracht hatte, in dem Lager gab es einen Aufenthaltsraum, und dort ein Regal mit einer seltsam zusammengewürfelten Bibliothek: eine Reihe spanischer Romane, die niemand las, weil sie kein Spanisch konnten, auch wenn sie alle von der Notwendigkeit träumten, es zu lernen, eine viersprachige Bibel neben einem Koran, und auf demselben Brett ein ganzer Stapel von Broschüren über Empfängnisverhütung und Aids-Vermeidung. Sie lachten darüber, aber mit einem sehnsüchtigen Unterton, weil die Männer ja von den Frauen getrennt waren, und man sich nicht einmal hätte anstecken können, wenn man es gewollt hätte. Aber es gab da auch ein Wörterbuch und ein Lexikon, und darin hatte er die Birke gefunden, sogar mit einem Bild. Ein Baum mit einem schlanken, weißen Stamm, schwarz gefleckt. Auch die Form der Blätter hatte er sich eingeprägt, aber jetzt war Herbst, und die Äste waren kahl.
Rund um die Häuser wuchsen viele Bäume, aber er konnte ihre Stämme nicht sehen, weil sie sich alle hinter Mauern und Zäunen und akkurat geschnittenen Hecken verbargen. Über den Toren starrten Überwachungsgeräte in die Nacht hinaus, wie er sie auch schon aus dem Lager kannte. Er hatte dort gelernt, dass man den Kameras am besten auswich, wenn man sich unter ihnen wegduckte, und er tat das jetzt so automatisch, wie man sich aus Höflichkeit vor einem alten Mann verneigt oder aus Vorsicht einem Polizisten den Bürgersteig freigibt.
Seine Schuhe schoben bei jedem Schritt eine kleine Bugwelle aus trockenen Blättern vor sich her, und das erinnerte ihn daran, wie sie damals, beim ersten Versuch, durch das seichte Wasser gewatet waren, um zum Boot zu gelangen. Auch damals war es ihm vorgekommen, als ob seine Füße festgehalten würden. Zweitausend Dollar hatte der Schlepper genommen, und die Lichter auf der spanischen Insel waren schon sichtbar, als die Küstenwache sie doch noch aufbrachte.
Er hörte einen Hund bellen. Es klang beleidigt, als ob man ihm etwas versprochen und das Versprechen dann nicht gehalten hätte. Eine Stimme versuchte das kläffende Tier zu beruhigen, und als das nicht gelang, wurde ein Fenster geschlossen. Dann war es wieder still zwischen den Zäunen und Hecken, so still, dass man den Wind hören konnte, und manchmal, wenn er besonders heftig blies, das Knattern der Fahnentücher.
Noch etwas fiel ihm auf: An dieser Straße parkten keine Autos, obwohl auf beiden Seiten genügend Platz gewesen wäre. Hier fuhr wohl jeder direkt vor sein Haus und schloss hinter sich das Tor. Ein Auto war in diesem Land etwas Selbstverständliches, hatte Vetter Tom geschrieben, man war nicht reich, nur weil man eines besaß oder sogar zwei. Wenn es nicht mehr fuhr, ließ man es reparieren, und wenn es einem nicht mehr gefiel, kaufte man sich ein neues. Ein glückliches Land.
»Man darf hier nicht auffallen«, hatte man ihm mit auf den Weg gegeben, und so schnappte er sich den Reisigbesen, den jemand neben einem Haufen Laub hatte stehen lassen, und ging wischend weiter. So würde er nicht mehr wie ein Eindringling aussehen, war seine Überlegung, sondern wie jemand, der eine Funktion hatte, eine Arbeit, die zu seiner Hautfarbe passte. Die Mimikry schien zu funktionieren: Ein Wagen fuhr an ihm vorbei, ohne die Fahrt zu verlangsamen.
An der nächsten Kreuzung entdeckte er ein Straßenschild mit zwei Namen. Ulmenweg. Akazienweg. Aber da standen keine Akazien. Die hätte er mit oder ohne Blätter erkannt. Durstbäume hatte seine Mutter sie genannt, weil sie auch die trockensten Sommer unbeschadet überstanden.
Er ging nach rechts, weil ihm Akazien vertraut waren und er von Ulmen noch nie etwas gehört hatte. Wahrscheinlich waren auch das Bäume. Man benannte hier wohl alle Straßen nach solch starken Beschützern.
Der Birkenweg, als er ihn endlich fand, war eine Sackgasse. Links und rechts je fünf Häuser in ihren Gärten, und am Ende der Straße die Rückseite eines Friedhofs, das einzige Grundstück mit niedriger Mauer. Das letzte Tor auf der linken Seite hatte die richtige Nummer.
Birkenweg 10.
An der Klingel stand kein Name. Auch am Briefkasten nicht. Vielleicht war Vetter Tom so berühmt, dass er das nicht brauchte. Weil jeder, der ihn besuchen wollte, wusste, wo er wohnte. Oder vielleicht … Er hatte klingeln wollen und tat es nun doch nicht.
Vielleicht …
Es war schon bald ein Jahr her, seit er sich die Adresse aufgeschrieben hatte. So lang war er jetzt schon unterwegs. Es war doch möglich, dass Vetter Tom gar nicht mehr hier wohnte, sondern jemand anderes. Jemand, der nicht lange nachfragen, sondern sofort die Polizei alarmieren würde.
Klingeln oder nicht? Er zögerte immer noch, als sich in seinem Rücken ein Auto näherte. Er musste sich nicht umdrehen, um zu spüren, dass es nicht auf der Durchfahrt war, nicht nur einfach zufällig vorbeikam.
Ein Auto näherte sich. Es war deutlich zu hören, dass es immer langsamer wurde, wie auf der Suche nach etwas. Auf der Suche nach ihm? So schnell? »Hier gibt es keine Schlamperei, auf die man sich verlassen kann«, hatte man ihn gewarnt. Er drückte sich hinter die große Plastiktonne, die neben dem Eingang in einer Nische der Hecke stand. Die frisch geschnittenen, immergrünen Zweige stachen ihn in die Hände und ins Gesicht.
Das Auto hielt an.
Schritte.
Schritte, die sich näherten.
Der Geruch von zu lang getragenen Kleidungsstücken. Ein Geruch, den er nur allzu gut kannte. Verschwitzte Kleidung und kalter Rauch. Kein wohlhabender Geruch.
Der Mann – er konnte ihn nicht sehen, aber Frauen riechen anders – war nur noch wenige Schritte entfernt. Blieb stehen und …
»Keita«, sagte der Mann. Sagte seinen Namen. Sprach ihn falsch aus, aber etwas anderes konnte es nicht heißen. Noch keine Stunde, dass der Lastwagen ihn ausgeladen hatte, und sie wussten nicht nur, dass es ihn gab.
Sie wussten auch, wer er war.
2
»Keita?«, fragte der Taxifahrer in die Gegensprechanlage hinein. Er musste es drei- und viermal wiederholen, bis er endlich eine Antwort bekam. »Einen Augenblick«, sagte eine Frauenstimme und dann, nach einer Pause: »Sie können den Zähler ruhig schon laufen lassen.« Im Hintergrund hörte man Musik und Gelächter.
Die Fenster des Hauses waren hell erleuchtet. Hinter den Vorhängen bewegten sich Menschen, und selbst im Schattenriss war zu sehen, dass sie alle Gläser in der Hand hatten. Als dann die Tür geöffnet wurde, schwappten Musik und Lärm heraus wie aus einem angestochenen Fass. Was immer hier gefeiert wurde: Es war kein kleines Fest.
Eidenbenz hatte die lauteste Stimme von allen, und das war ihm in seiner Karriere schon oft nützlich gewesen. In Versammlungen oder Fernsehdiskussionen konnte er damit andere Meinungen einfach übertönen, konnte seinen Gegnern so lang ins Wort fallen, bis sie entnervt aufgaben und ihn reden ließen. Der Blocher hatte das auch immer so gemacht, und vom Blocher konnte man nach wie vor etwas lernen. Dabei hatte Eidenbenz eine sympathische, joviale Stimme, eine ›Onkelstimme‹, wie er es selber nannte, und ihre Lautstärke war seiner Meinung nach das Beste, was man als Politiker haben konnte. »Ich brauche keinen Lautsprecher«, sagte er gern. »Ich bin selber einer.« Und dann lachte er das schallende Lachen, das zu seinem Markenzeichen geworden war. Jede Silbe wie ein eigenes Wort. Wenn der Giacobbo ihn parodierte, dann schob der nach jedem Satz so ein Lachen ein. Es war gut, wenn man parodiert wurde. Das hieß, dass man bekannt war, und nur wer bekannt ist, ist auch beliebt. Und man konnte beweisen, dass man Humor hatte.
Obwohl der Giacobbo ja eigentlich der Falsche war, um ihn nachzumachen, dieses schmale Handtuch. Einmal war er bei dem in der Sendung Promigast gewesen, und auf die Frage, wie ihm denn seine Parodie in dem Einspielfilmchen gefalle, hatte er geantwortet: »Sie sollten das den andern machen lassen, den Müller. Für einen Eidenbenz haben Sie einfach nicht die Postur.« Da waren die Lacher dann wieder auf seiner Seite gewesen.
Eidenbenz, der Städter, hatte eine Figur wie ein Kranzschwinger, und er machte sich gern noch breiter, indem er die Hände in die Hüften stützte, nicht mit den Handflächen nach innen wie ein beleidigter Schwuler, sondern mit den Handrücken, wie es die Buben auf dem Spielplatz machen, wenn sie mit anderen Streit suchen. »Man muss die Ellbogen ausfahren«, sagte er, wenn ihn jemand darauf ansprach.
Jetzt stand er in dieser herausfordernden Pose unter der Tür. Die anderen, die hinter ihm aus dem Haus gewollt hatten, mussten warten und wirkten dadurch wie sein Hofstaat. »Also, Keita«, sagte Eidenbenz ohne sich umzudrehen, »genieß deine Verlobung noch! Aber nicht zu gründlich. Da muss ich als dein Vereinspräsident darauf bestehen. Nicht dass du morgen im Training vor lauter O-Beinen nicht mehr laufen kannst.« Er lachte sein Eidenbenz-Lachen, und die Leute im Hausgang wieherten das Echo, selbst die, die keine Ahnung hatten, wovon eigentlich die Rede war.
Er machte ein paar Schritte auf den Kiesweg hinaus, und die andern, wie wenn man den Korken aus der Flasche zieht, strömten hinter ihm her aus dem Eingang: Keita, seine Claudia und die paar Journalisten, die absichtlich zufällig von der Party erfahren hatten. Das Fernsehen hatte mal wieder nur die Weicheier von glanz & gloria geschickt, keinen vom Sport und keinen von der Tagesschau. Das war natürlich gegen ihn, Eidenbenz, gerichtet, aber von solch kleinen Nadelstichen ließ sich ein Mann wie er schon lang nicht mehr aus der Ruhe bringen.
Schon lang nicht mehr.
»Feiert noch schön!«, rief er also und drehte sich, weil er eine Kamera klicken hörte, doch noch einmal um. »Und vergesst nicht, ein paar auf mein Wohl zu trinken. Ihr wisst ja, was ich mag.« Das war wieder für einen Lacher gut, denn dass Eidenbenz nur Bier trank und nie etwas anderes, das gehörte zu seinem öffentlichen Bild. Eidenbenz sagte immer »öffentliches Bild« und nie »Image«. Warum sollte man einen englischen Ausdruck verwenden, wenn es ein gut schweizerdeutsches Wort für etwas gab?
»Machen wir!«, rief einer der Journalisten zurück, und Eidenbenz grüßte ihn mit hochgerecktem Daumen. Der Mann war zwar nur von dem lokalen Käseblatt, aber in ein paar Jahren schrieb so einer vielleicht bei der Weltwoche, und dann zahlte es sich aus, nett zu ihm gewesen zu sein. Obwohl sie die Weltwoche ja so oder so in der Tasche hatten.
»Tut mir leid, dass ich so früh wegmuss. Aber die Pflicht ruft. Die Politik macht auch wegen einer Verlobung keine Pause. Schon gar nicht jetzt, wo es einen Bundesrat zu wählen gibt.« Da war er schon beim Gartentor. »Du wärst auch ein guter Kandidat, Keita!«, setzte er noch hinzu, und schon lachten wieder alle. Man musste nur mit den Leuten umgehen können.
Der Taxifahrer war ein schmächtiger Mann, mit einem Schnurrbart, der viel zu groß für sein Gesicht war. Ein Ausländer. Kosovare oder so etwas. Bei sich zu Hause hatten sie keine Autos, und bei uns fuhren sie Taxis.
»Sind Sie Herr Keita?«, fragte der Fahrer. Ein Akzent, den man mit dem Messer schneiden konnte.
Eidenbenz, der es gewohnt war, dass man ihn erkannte, lachte nur und wollte einsteigen. Aber der Mann mit dem zu großen Schnurrbart stellte sich ihm in den Weg und blockierte die Tür. »Ich bin für einen Herrn Keita«, sagte er.
»Ist schon in Ordnung«, sagte Eidenbenz. »Der Keita wohnt hier. Aber der will nicht wegfahren. Der feiert heute Verlobung. Gestern die beiden Tore und heute eine schöne Braut. Ein richtiger Glückspilz.« Er lachte sein Eidenbenz-Lachen, aber der Taxifahrer lachte nicht mit.
»Ich hoffe, es ist in Ordnung«, sagte er ängstlich. »Sonst bekomme ich Ärger mit der Zentrale. Vielleicht sollte ich besser …«
»Wenn ich sage, es ist in Ordnung, dann ist es das auch«, unterbrach ihn Eidenbenz. »Nehmen Sie lieber Ihre Mappe da weg!« Er saß in Autos nicht gern hinten. Er brauchte den Überblick.
Es gab ja eigentlich keinen Grund, sich mit dem Taxifahrer zu unterhalten. Aber Eidenbenz war einfach nicht der Typ, der stumm neben jemandem sitzen konnte, ohne wenigstens den Versuch zu machen, ihn für sich zu gewinnen. Einmal, im vollen Morgenzug nach Bern, war er sogar mit dem Kondukteur in ein Gespräch geraten. So ein alter Gewerkschaftssozi war das gewesen und hatte eine dumme Bemerkung gemacht von wegen dem Gratis-GA erster Klasse. Er hätte sich ja über den Mann beschweren können, ihm richtig einen reindrücken, aber er hatte lieber mit ihm diskutiert. Bis Bern hatte der kein einziges Billett mehr kontrolliert, und bei der nächsten Wahl, darauf wäre Eidenbenz jede Wette eingegangen, hatte er bestimmt nicht mehr ohne zu überlegen die SP-Liste eingeworfen.
Kleinvieh macht auch Mist.
»Sie wissen ja, wer der Keita ist«, sagte Eidenbenz.
»Nein«, sagte der Fahrer. Drehte nicht einmal den Kopf, sondern stierte ins Halbdunkel hinaus, als ob er seine Brille zu Hause vergessen hätte.
»Tom Keita«, sagte Eidenbenz. »Der beste Spieler vom FC. Gegen Basel hat er zwei Tore gemacht. Die Gigi Oeri hat fast eine Herzbaracke gekriegt. Aber bei der macht das nichts. Sie kriegt ihre Pillen ja mit Rabatt.« Er lachte sein Lachen, aber der Fahrer ließ sich immer noch nicht anstecken. Fuhr stur fünfzig, obwohl hier überhaupt kein Verkehr war. Hatte seine Fahrprüfung wahrscheinlich auf einer Schafweide gemacht. Von der Schweiz wusste der überhaupt nichts. Hatte noch nie etwas von Gigi Oeri gehört und vom Keita auch nicht.
»Interessieren Sie sich nicht für Fußball?«
»Hab ich nicht gern«, sagte der Fahrer unter seinem Schnurrbart hervor. »Nach einem Spiel sind die Fahrgäste immer so laut. Einmal hat einer in den Wagen gekotzt. Direkt auf das Polster.«
»Muss einer von denen gewesen sein. Wenn unsere Mannschaft so spielen würde wie die, würde mir auch schlecht.« Mit einfachen Leuten musste man handfeste Sprüche machen. Träf. Das predigte er seinen jungen Leuten immer wieder. Nicht klug daherschwafeln, bloß weil man studiert hatte. Dem Volk aufs Maul schauen. Das hatte schon der Luther gesagt, und der Mann wusste, wovon er redete. Hatte schließlich auch eine Außenseiterpartei zur Mehrheit geführt, wenn man so wollte. Genau wie damals der Blocher.
Der Taxifahrer lachte nicht. Wahrscheinlich hatte er den Witz gar nicht verstanden. Heutzutage ließen sie jeden Taxi fahren, der knapp mit Messer und Gabel essen konnte. Einmal hatte Eidenbenz sogar einen erwischt, der wusste nicht einmal, wo der Bahnhof war. Man sagt ja, dass jemand nur Bahnhof versteht, aber der verstand nicht einmal das. Musste es sich auf dem Stadtplan zeigen lassen. Aber die Taxiprüfung bestanden. Wahrscheinlich hatte ihn so ein Weltverbesserer aus reinem Mitleid durchkommen lassen.
Eigentlich konnte es Eidenbenz ja egal sein, ob ihn der Taxifahrer mochte oder nicht. Ein Ausländer ohne Stimmrecht. Aber das war jetzt wie ein Spiel für ihn. Er griff also in die Tasche, wo er immer ein paar von den Gutscheinen bereithatte, und sagte: »Hier. Wenn Sie das an der Kasse abgeben, bekommen Sie ein Freibillett.«
Der Taxifahrer wartete bis zum nächsten Lichtsignal. Erst als dort rot war und er angehalten hatte – er zog sogar die Handbremse an, obwohl die Straße überhaupt nicht abschüssig war –, streckte er die Hand aus.
Er sah sich den Zettel an, so langsam und gründlich wie einer, der über das Alphabet nicht weit hinausgekommen ist, und fragte dann: »Fußball?«
»Ich bin der Präsident«, sagte Eidenbenz. »Der Präsident vom besten Fußballklub der Schweiz.«
Der Fahrer steckte den Gutschein sorgfältig in seine Brieftasche. Unterdessen war es wieder grün geworden, und hinter ihnen hupte einer ungeduldig. Erst beim nächsten Lichtsignal ging ihr Gespräch weiter.
»Wenn Sie der Präsident sind«, sagte der Taxifahrer, »dann kennen Sie vielleicht den Herrn Eidenbenz.«
Eidenbenz lachte sein patentiertes Lachen. »Doch«, sagte er, »den kenne ich ganz gut. Wir trinken regelmäßig ein Bier zusammen.«
»Dann können Sie mir sicher sagen …« Der Taxifahrer stierte in den Verkehr hinaus wie ein Kurzsichtiger. »Dann können Sie mir sicher sagen: Ist das wirklich so ein Arschloch, wie man überall hört?«
Als er bei seiner Sitzung ankam, musste sich Eidenbenz zur Fröhlichkeit zwingen. Er schüttelte ein paar Hände, klopfte auf ein paar Schultern und setzte sich dann an seinen Platz, wo ein großes Helles schon bereitstand. Er nahm einen tiefen Schluck, wischte sich den Schaum vom Mund und fragte: »Also, Leute, es geht um unseren Kandidaten für den Bundesrat. Soll ich euch gleich sagen, was wir beschließen, oder wollt ihr zuerst ein bisschen diskutieren?«
3
Die letzten Gäste gingen um halb drei. Claudia lächelte sich tapfer durch die Nacht und war bis ganz zum Schluss so vorbildlich charmant, dass Ilona Federspiel von der Miss-Swiss-Organisation stolz auf sie gewesen wäre. Sie selber hatte zur Fete nicht kommen können, wegen ihrem Unfall. Im Badezimmer ausgerutscht. Es war schwer gewesen, nicht darüber zu lachen.
»Liebenswürdig müsst ihr sein«, hatte Ilona ihnen immer eingetrichtert. »Liebenswürdig, liebenswürdig, liebenswürdig! Und wenn es euch noch so sehr ankotzt.« Nur wer liebenswürdig war, wurde von den Leuten auch geliebt, und nur wer von den Leuten geliebt wurde, bekam Geld dafür, dass er sich für einen Katalog ablichten ließ oder am Autosalon von einer Karosserie herunter strahlte.
Nur wer geliebt wurde, machte Karriere.
Also lächelte Claudia und sagte immer wieder: »Wie schade, dass Sie schon gehen müssen.« Und gähnte erst, wenn sich die Tür schon hinter dem Gast geschlossen hatte.
Sie war damals nur Vierte geworden. Es war kein Jahr für Blondinen gewesen. Und der eine Preisrichter … Direkt hatte er ja nichts gesagt, aber sie wusste: Wenn sie mit ihm ins Bett gegangen wäre, dann hätte das Ergebnis anders ausgesehen. Obwohl: Vierte war ja nicht schlecht.
Und sie hatte etwas daraus gemacht. Mehr als andere. War drangeblieben und hatte fleißig weiter in jede Kamera gestrahlt. Der Durchbruch war dann gekommen, als sie sich ausgezogen hatte. Nicht für den Playboy, das wäre billig gewesen, und das machten unterdessen schon Fünfzigjährige. Nein, für Peta, die Tierschutz-Organisation. ›Lieber nackt als im Pelz‹. Das hatte Stil, man stand in einer Reihe mit Leuten wie Pamela Anderson und Naomi Campbell und konnte den Leuten doch zeigen, was an einem dran war. Zwei Monate lang hatte sie an allen Plakatwänden gehangen.
Und der Skandal, der sich später daraus entwickelte, hatte auch nicht geschadet. Dieser Typ, der beim Fotoshooting für Peta die unerlaubten Bilder gemacht hatte, aus einem Winkel, aus dem die entscheidenden Körperstellen nicht diskret abgedeckt waren. Die Fotos waren dann im Internet aufgetaucht, es hatte sie jeder gesehen, wenn es auch keiner zugab, und sie selber hatte in ganz vielen Interviews erklären können, wie verletzt sie von diesem Vertrauensbruch war. Einmal, bei Aeschbacher, hatte sie sogar geweint. Das war ein Risiko gewesen, weil man scheiße aussieht, wenn einem der Eyeliner übers Gesicht läuft, aber es hatte sich ausgezahlt. Wer damals, in ihrem Jahr, Miss Swiss geworden war, das wusste heute keine Sau mehr. Während sie …
Nicht schlecht für eine abgebrochene Pädagogikstudentin.
Mitten im Wohnzimmer schlüpfte sie aus ihren Schuhen. Das war auch so ein Beweis dafür, dass die Wissenschaft an den falschen Dingen herumforschte. Eine Sonde zum Jupiter schicken, das konnten sie. Aber Schuhe, die gleichzeitig elegant und bequem waren, die hatte bis heute noch keiner erfunden.
Im ganzen Haus sah es aus wie in der Küche der alternativen Kindertagesstätte, in der sie als Studentin einmal ein Praktikum hatte machen müssen. Chaos pur. Zum Glück konnte man sich eine Putzfrau leisten. Richtig angemeldet natürlich, mit pünktlich einbezahlter AHV. Bei ihnen gab es nichts zu schnüffeln. Frau Ramires hatte versprochen, sie würde morgen eine Freundin zur Arbeit mitbringen, um ganz bestimmt pünktlich fertig zu werden. Nein, nicht morgen, korrigierte sich Claudia. Heute. In ein bisschen mehr als drei Stunden würden die beiden vor der Tür stehen. Hoffentlich machten sie beim Putzen nicht zu viel Lärm. Wenn man nicht genügend geschlafen hatte, nützte das beste Make-up nichts.
Aber um exakt drei Uhr nachmittags musste alles wieder picobello aussehen. Mehr als picobello. Da kam die Schweizer Illustrierte für ihre Homestory. Drei Seiten hatten sie ihr versprochen. Der Sven Epiney hatte nur zwei gehabt, beim ersten Mal. Mit drei Seiten war man bei den Leuten. Dann gehörte man dazu. Es war ja auch eine gute Story für die. Eine Fast-Miss-Swiss und ein Fußballstar als glückliches Paar. Am Herd, beim gemeinsamen Kochen, oder im Wohnzimmer, gemütlich aufs Sofa gekuschelt. Mit nackten Füßen natürlich. In der SI hatten die Leute in den Homestorys immer nackte Füße. Das sah dann so aus, als ob sie der Fotograf in einem intimen Moment überrascht hätte.
Beinahe wäre sie in ein Sektglas getreten, das jemand achtlos auf dem Parkett hatte stehen lassen. Die Leute waren aber auch zu rücksichtslos. Frau Ramires hatte ganz schön Arbeit vor sich.
Sie selber würde dann nur noch den Feinschliff machen. Ein paar Bücher wie zufällig im Zimmer platzieren, die Autobiografie von Barack Obama zum Beispiel, oder eine Abhandlung über die Ursachen der Finanzkrise. Zeigen, dass man auch einen IQ hatte und nicht nur eine Körbchengröße.
Und Blumen natürlich. Blumen machten sich in solchen Reportagen immer gut. Sie hatte extra noch welche bestellt, aber es wäre gar nicht nötig gewesen. Die Gäste hatten einen halben botanischen Garten mitgebracht. Sie hob einen umgekippten Aschenbecher vom Boden auf und ließ ihn gleich wieder fallen. Es hatte keinen Sinn, überhaupt anzufangen. Um drei Uhr am Morgen und ganz allein.
Tom war schon gegen halb eins im Schlafzimmer verschwunden. Mit seiner Superausrede, mit der er sich immer vor allem drücken konnte. »Morgen früh im Training muss ich fit sein.« Die Leute fanden das immer ganz toll und bewunderten seine Disziplin. Dabei hatte er für Feten einfach nichts übrig. Nicht einmal an der eigenen Verlobung. »Müssen wir wirklich so ein Theater machen?«, hatte er gefragt. »Wir sind doch schon zwei Jahre zusammen.« Aber da hatte sie sich durchgesetzt. Für einen guten Zweck Christbaumkugeln bemalen oder einen Aufruf zum Schutz der Delphine unterschreiben, das war ja alles ganz nett. Aber eine Homestory in der SI bekam man dafür nicht. Nicht drei ganze Seiten.
Sie blieb vor einem venezianischen Spiegel stehen und betrachtete kritisch ihr Gesicht. Das Make-up immer noch perfekt, auch nach der langen Nacht. Die Wangenknochen ein bisschen zu hoch, aber das konnte man mit strategisch aufgetragenem Rouge ausgleichen. Um die Augen noch kein einziges Fältchen. Zumindest keins, das man sehen konnte. Die Lippen waren schon immer ihr bestes Feature gewesen. Von Natur aus. Sie hatte nichts aufspritzen lassen müssen, wo man nachher aussah, als ob man ein Paar Wienerli quer im Mund hätte. Sie hatte überhaupt nie etwas an sich machen lassen. Na ja, fast nichts. Sie konnte zufrieden mit sich sein.
In fast jedem Zimmer hingen ein paar Spiegel. Sie sammelte Spiegel. »Von Kunst verstehe ich nichts«, hatte sie einmal der Schweizer Familie gesagt, »aber wenn ich in einen Spiegel schaue, sehe ich immer etwas Hübsches.«
Kopfschmerzen hatte sie auch. Von dem Gequalme und von der Anstrengung, die ganze Party lang alles richtig zu machen. Die Leute dachten immer, solche gesellschaftlichen Anlässe seien ein reines Vergnügen. Nichts als Glitter und Glamour und so. Die Leute hatten ja keine Ahnung.
Frische Luft. Das war es, was sie jetzt brauchte. Die Fenster aufreißen. Oder noch besser: in den Garten gehen und vor dem Einschlafen eine Ladung Sauerstoff tanken. Ja, das war das Richtige.
Sie zog nicht einmal einen Mantel an. Schlüpfte bloß in die Holzschuhe, die eigentlich bloß zur rustikalen Verzierung neben der Eingangstüre standen. Sie hatte nun wirklich keine Zeit, sich auch noch selber um die Beete zu kümmern.
Die Luft war kühl und fast schon winterlich. Ein bisschen Rauch war darin zu spüren, vielleicht weil jemand verbotenerweise Laub verbrannt hatte, oder weil die ersten schon ihre Cheminées anzündeten. Und die Stille war herrlich. So entspannend. Sogar ein erster Vogel zwitscherte. Ein richtiger Frühaufsteher. Als ob er noch eine Menge zu erledigen hätte, bevor der Winter ihn endgültig vertrieb.
Aber sonst: Stille. Wohltuende, kostbare Stille.
Und Schritte.
Schritte mitten in der Nacht.
Zuerst war sie sich nicht sicher. Ein Igel, das wusste sie aus einem Naturfilm, klang ganz ähnlich, wenn er sich einen Weg durchs trockene Laub bahnte. Auch wenn sie hier noch nie einen Igel gesehen hatte.
Nein, das war kein Igel. Das war ein Mensch. Da schlich jemand durch den Garten. Durch ihren Garten. Am Morgen um drei.
Sie merkte, wie die Angst in ihr hochschwappte wie eine heiße Welle. Da war jemand. Ein Einbrecher. Oder nur ein Obdachloser, der im Gartenhäuschen Unterschlupf suchte? Unsinn. Obdachlose gab es hier nicht. Nicht in diesem Quartier. Es musste ein Einbrecher sein.
Erst gestern hatte wieder so ein Artikel in der Zeitung gestanden. Da gab es regelrechte Banden, die organisiert in die Schweiz kamen, ganze Straßen überfielen wie die Heuschrecken und dann wieder über die Grenze verschwanden.
Ein Einbrecher.
Der sie noch nicht bemerkt hatte. Der Mond war nur eine ganz schmale Sichel, und die Straßenlaternen leuchteten nicht in den Garten hinein. Ein Einbrecher, der sich ganz sicher fühlte, denn die Schritte kamen näher. Immer näher.
Im Allgemeinen, hatte sie gelesen, wichen solche Banden den Menschen ja aus. Verschwanden einfach, wenn ein Haus nicht leer war, und probierten es beim nächsten. Aber wenn der sie jetzt antraf, wenn sie sein Gesicht sah und also eine Zeugin war, dann konnte es doch sein, dass so einer rabiat wurde. Sie zum Schweigen bringen wollte mit allen Mitteln.
Jetzt war er schon ganz nahe.
Und der Tom schlief da oben in seinem Bett. Träumte wahrscheinlich von einem Kunstschuss, mit dem er die Weltmeisterschaft entschied. Schlief einfach, während sie in Lebensgefahr war. In der Nacht ihrer offiziellen Verlobung.
Jetzt konnte sie den Mann sogar sehen. Im Gegenlicht eines beleuchteten Fensters war einen Moment lang seine Silhouette zu erkennen. Ein kräftiger, breit gebauter Mann. In einem langen Mantel.
›Der bringt mich um‹, dachte sie. ›Der packt mich einfach am Hals und erwürgt mich.‹ Und gleichzeitig schoss ihr durch den Kopf: ›Das gibt eine Titelgeschichte. In allen Zeitungen.‹
Sie konnte ihn jetzt nicht mehr sehen, und auch die Schritte hatten aufgehört. Wahrscheinlich machte er sich schon an einem Fenster zu schaffen. Sie musste Alarm schlagen. Tom aufwecken. Lärm machen. Aber wie?
Später hätte sie nicht sagen können, wie sie auf die Idee kam. Zum Überlegen war gar keine Zeit. Sie bückte sich, fasste einen der Holzschuhe und schleuderte ihn gegen das Haus. Traf, ohne bewusst gezielt zu haben, haarscharf die Scheibe des Schlafzimmers. Nur einen Moment später – es konnte nicht wirklich so schnell gegangen sein, aber es kam ihr so vor – streckte Tom den Kopf aus dem Fenster.
»Hilfe!«, schrie Claudia. »Wir werden überfallen!«
4
K31.
Warum ihm der verdammte Name nicht aus dem Kopf wollte? Es war doch wirklich egal, wie die Waffe hieß.
K31. K31. Ein Geradezug-Karabiner. Geradezug. Sein Hirn hatte sich die Bezeichnung gemerkt, obwohl er nicht die geringste Ahnung hatte, was sie bedeutete.
Er hatte geschossen, nur das war jetzt wichtig. Er, Tom Keita, Sturmspitze und Torschützenkönig, hatte einen Menschen erschossen. Auf dem sauber gemähten Rasen seiner Villa lag ein toter Mann, den Kopf im Blumenbeet.
›Die Blumen sind doch schon verblüht‹, dachte es in ihm, obwohl dieser Gedanke ja nun wirklich völlig sinnlos war. ›Warum regt sich Claudia dann so auf? Warum schreit sie so?‹
Er hatte ihn doch nur erschrecken wollen. Nur erschrecken. Mit dem Gewehr bedrohen und so vertreiben. Oder festnehmen lassen. Ihn mit der Waffe so lang in Schach halten, bis Claudia die Polizei angerufen hatte.
Ihn mit dem K31 in Schach halten.
Sie hatten ihm das Gewehr am Sechseläuten geschenkt, als er mit dieser Zunft in Zürich im Umzug hatte mitlaufen dürfen. Quer durch die Stadt, und man bekam Blumensträuße und Applaus. Den Applaus war er gewohnt, aber die viel zu vielen Blumen hatte er nur ungeschickt im Arm gehalten. Wie ein Amateur-Torhüter, der selber nicht weiß, wie er gerade diesen Ball gefangen hat.
Das war jetzt nicht wichtig. Das war jetzt alles nicht wichtig.
Wenn Claudia nur aufhören würde zu schreien. Sie, die sich sonst immer so gut unter Kontrolle hatte. Es klang, als ob sie mit jedem Ton ein Stück von ihrer Angst aus sich herauskotzte. Dabei wurde ihre Stimme nie wirklich laut. Selbst jetzt noch, mitten in der Panik, dachte sie daran, kein Aufsehen zu erregen. Keine negative Publicity.
Er hatte doch nicht gewusst, dass da eine Patrone im Magazin war. Er kannte sich mit solchen Sachen doch nicht aus. Ein einziges Mal war er dann in einem Schützenverein gewesen. Von einem Reporter begleitet. Er hatte sich das Gewehr erklären lassen, ohne wirklich zuzuhören, und er hatte ein paarmal abgedrückt. Aber vor allem hatte er Autogramme gegeben.
Und jetzt lag da ein fremder Mann im Gras und war tot.
War wahrscheinlich tot. Lag auf jeden Fall da und rührte sich nicht.
Der Zunftmeister hatte eine Ansprache gehalten nach dem Essen. Er hatte nicht alles verstanden, aber es musste eine lustige Rede gewesen sein, denn ringsum lachten sie nach jedem Satz, überlaut und mit roten Köpfen. »Der beste Schütze der Schweiz braucht auch ein echt schweizerisches Gewehr«, hatte der Zunftmeister gesagt, und dann hatte die Kapelle einen Marsch gespielt, und zwei Buben in Landsknechtsuniformen hatten den Karabiner durch den Saal getragen.
Den K31.
Mit einem Blumenstrauß im Lauf.
Als ihm der Zunftmeister das Gewehr in die Hand drückte, waren alle aufgestanden.
Er hatte doch nicht wissen können, dass da noch eine Patrone …
Er hatte sich ans Fenster gestellt und den Karabiner durch die zerbrochene Scheibe auf den fremden Mann gerichtet. »Hände hoch!«, hatte er gerufen, und der Mann hatte auch tatsächlich einen Arm gehoben. Nur einen. Es hatte ausgesehen, als ob er ihm zuwinken wollte. Ihm zuwinken wie einem alten Freund.
Und dann war der Schuss losgegangen. Wie von selber.
Der Rückstoß hatte ihn nicht an der Schulter getroffen, wie das wohl vorgesehen war, sondern am Kinn. Er hatte das Gewehr nicht richtig gehalten. Er kannte sich mit solchen Sachen doch nicht aus. Einen Moment lang war es genau so gewesen wie damals, als er bei einem Kopfball diesen Fußtritt bekommen hatte. Den Stollen direkt ans Kinn. Im Strafraum. Es war natürlich hohes Bein gewesen und gefährliches Spiel, der Schiri hatte einen Elfmeter gepfiffen, den hatte er selber schießen wollen, aber dann war schon der Mirko angelaufen, der immer den Macho spielen musste, und hatte den Ball prompt an den Pfosten …
Das war jetzt nicht mehr wichtig.
Das Kinn tat ihm weh, und der Hals war ganz verspannt. Hoffentlich würde das morgen beim Training …
Das war auch egal.
Bis jetzt hatte Claudia wortlos geschrien, wie jemand ein Lied singt, von dem er sich nur noch an die Melodie erinnert, aber nicht an den Text. Jetzt fand sie endlich die Worte, nach denen sie die ganze Zeit vergeblich gesucht hatte. »Komm runter«, schrie sie. »Viens ici tout de suite!« Als ob er noch gar kein Deutsch gelernt hätte.
Er hängte den Karabiner an die Wand zurück, an den Haken über dem Bett, den er erst vor zwei Tagen dort angebracht hatte. Weil Claudia das so wollte. »Das sieht gut aus, wenn die von der SI kommen«, hatte sie gesagt. »So ein altes Landsturmgewehr als Dekoration, das macht sympathisch.«
Außer wenn man gerade jemanden damit erschossen hat.
Er überlegte, ob er sich eine Hose anziehen sollte. Er schlief in Boxershorts und T-Shirt, und irgendwie schien ihm das für einen toten Mann nicht passend.
Aber darauf kam es jetzt auch nicht mehr an.
Er ging ins Erdgeschoss hinunter, und der Weg kam ihm länger vor als sonst. Der Treppe entlang hingen gerahmt die Trikots, die er von wichtigen Spielen als Andenken nach Hause gebracht hatte. Am wertvollsten waren die 7 von Ribéry und die 19 von Messi. Sie hatten beide Spiele verloren, hin und zurück, aber sie hatten sich dabei nicht blamiert, das konnte niemand behaupten. Sie hatten …
K31. Das war jetzt die einzige Nummer, auf die es ankam.
Ein Geradezug-Karabiner.
Der Vorgänger des Sturmgewehrs. Seltsam, was sich so ein Gehirn alles merkt.
Was war überhaupt ein Sturmgewehr?
Er öffnete die Haustüre, und die Luft draußen war kälter, als er es erwartet hatte. Oder lag es daran, dass er Angst hatte?
Er hatte überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Es war Selbstverteidigung gewesen. Oder etwa nicht?
Er ging den Kiesweg entlang und dachte: ›Ich hätte Schuhe anziehen sollen. Wenn jetzt da eine Scherbe von der Fensterscheibe liegt … Bei Galatasaray haben sie Lincolns Füße für sechs Millionen versichert. Wenn ich mir den Fuß kaputtmache – der Trainer bringt mich um.‹
Auch das war jetzt nicht mehr wichtig.
Claudias Make-up ganz verschmiert. Sie sah aus wie eine dieser Clownsfiguren, die sie so liebte, aber von der Wand genommen hatte, weil sie nicht mehr Mode waren. Ein weißes Gesicht mit einer dicken schwarzen Träne.
»Du hast alles kaputtgemacht«, sagte sie, und nach all dem Schreien war ihre Stimme jetzt heiser.
»Es war keine Absicht.«
»Wieso hast du das getan?«
»Ich wollte dich beschützen.«
»Du bist ein Arschloch«, sagte Claudia und legte ihren Kopf an seine Brust. »Du bist ein Arschloch, aber ein Held. Ich hasse dich«, sagte sie und drückte sich so fest an sein T-Shirt, als ob sie in ihn hineinkriechen wollte. »Ich liebe dich. Hast du es wirklich wegen mir getan?«
»Für dich tue ich alles«, sagte er. Er hatte das Gefühl, dass es das war, was sie in diesem Moment von ihm hören wollte.
»Und jetzt ist alles kaputt«, sagte sie, aber es klang nicht wie ein Vorwurf.
Vom Schlafzimmerfenster aus war der Mann auf dem Boden deutlicher zu erkennen gewesen als jetzt aus der Nähe. So wie sie da standen, deckten sie das Licht aus dem Wohnzimmer ab. Was da im Gras lag, hätte auch ein Sack mit Dünger sein können, den jemand dort abgeladen hatte. Ein Erdhügel. ›Der Hügel von einem Grab‹, dachte es in seinem Kopf.
»Er war plötzlich da«, sagte Claudia. »Ich wollte noch ein bisschen Luft schnappen, und auf einmal war er da. ›Ein Einbrecher‹, habe ich gedacht, ›oder …‹« Sie machte eine Pause, und Tom war sich sicher, dass sie in Zukunft jedes Mal diese Pause machen würde, wenn sie jemandem die Geschichte erzählte. Ob bei einem Freund oder bei einem Journalisten, sie würde jedes Mal an der genau gleichen Stelle verstummen, die Augen für einen Moment schließen und dann mit leiserer Stimme fortfahren: »… oder etwas noch Schlimmeres.«
Er legte den Arm um sie und streichelte mit der anderen Hand ihren Kopf. Für gewöhnlich mochte sie solche Berührungen nicht, weil sie ihre Frisur durcheinanderbrachten, aber jetzt ließ sie es geschehen. Sie war warm und weich, und wenn man sein Gesicht in ihre Haare legte und tief einatmete, dann verschwand der aufdringliche Duft des Parfums, und sie roch wie ein kleines Mädchen.
Wie jemand, den man beschützen musste.
»Wir werden das zusammen durchstehen«, sagte er. Aber sie schob ihn von sich weg und war plötzlich nur noch wütend. »Immer machst du alles kaputt«, sagte sie. »Immer. Ausgerechnet heute, wo wir doch diese Homestory haben.«
Als er dann das Geräusch hörte, dachte er zuerst an ein Tier. Eine Katze. Oder vielleicht der Fuchs, dem man in den Gärten manchmal sogar am helllichten Tag begegnete.
Aber es war kein Fuchs und keine Katze. Es war der Mann, der nur ein paar Schritte von ihnen entfernt mit dem Kopf im Blumenbeet lag und stöhnte.
Stöhnte.
Und sich bewegte.
Er war nicht tot.
Als Claudia endlich mit der Taschenlampe zurückkam – eigentlich war es nur ein Schlüsselanhänger, aber mit einem ganz starken Lichtstrahl –, da hatte er den Mann schon erkannt. Hatte zuerst nicht glauben wollen, was er da sah, wie einem die Nachricht von einem Lottogewinn oder von einem Todesfall auch nicht gleich in den Kopf will. Und hatte es dann doch glauben müssen.
Claudia richtete das Licht auf den Mann, und sogar sie, die ihn doch gar nicht kannte, bemerkte sofort die Ähnlichkeit. Vielleicht auch nur, weil für einen Weißen sowieso alle Schwarzen gleich aussehen.
»Ich weiß, wer das ist«, sagte Tom.
»Du kennst ihn?«
»Später. Zuerst muss ich ihn verbinden. Hol bitte den Sanitätskasten aus dem Auto!«
Dass Claudia wieder zu sich selber zurückgefunden hatte, konnte man an der störrischen Kopfbewegung sehen, mit der sie auf den Auftrag reagierte. Sie mochte es nicht, wenn man sie herumkommandierte. Aber sie ging.
»Nicht bewegen!«, sagte Tom. In Malinke, der vertrauten Sprache, die er schon so lange nicht mehr verwendet hatte. Die Briefe hatte er immer auf Französisch geschrieben. »Wo habe ich dich getroffen?«
Es war nur eine Fleischwunde am Arm. Ein Kratzer eigentlich nur. Dass er hingefallen war, das war mehr der Schreck gewesen. Ein ungeschickter Schritt, und dann war er über den Saum seines zu langen Mantels gestolpert. Beim Sturz hatte er sich den Kopf an etwas Hartem gestoßen.
An einem Gartenzwerg mit Schubkarre, den ihnen jemand aus Jux zum Einzug geschenkt hatte.
»Wie kommst du hierher?«, fragte Tom.
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Du bist seltsam angezogen.«
»Ich weiß«, sagte sein Vetter. »Ich bin ein Marabu.«
5
»Ein Gewehr über dem Bett«, sagte Klara Holzer und strahlte, als ob sie gerade in einer Tombola den ersten Preis gewonnen hätte. »Einfach süß!«
Sie hatte, wie es nicht anders zu erwarten gewesen war, so ziemlich alles süß gefunden, was Claudia und Tom ihr im Haus gezeigt hatten. In der Branche verspottete man die Journalistin wegen ihrer permanenten Begeisterung als Klara Süßholzer, aber sicherheitshalber tat man das nur hinter vorgehaltener Hand. Es ging nämlich bei den Reichen und Schönen der Schweiz das Gerücht, dass sie gleichzeitig auch Kassandra sei, die nie enttarnte, anonyme Verfasserin jenes bitterbösen Klatschkolumnen-Blogs, in dem schon so mancher prominente Seitensprung oder Drogenentzug ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt worden war. »Es ist doch auffallend, wie oft jemand in diesem Blog vorkommt, der kurz zuvor bei ihr eine Homestory hatte«, flüsterte man sich bei den Stehpartys über die Teller mit dem Fingerfood hinweg zu. Und bekam dann vielleicht zur Antwort: »Sie braucht das bestimmt als Ausgleich. In der SI muss sie ja immer alles wunderbar finden, und das hält auf die Dauer keine Sau aus.«
Ob Klara Holzer tatsächlich die Verfasserin von Das jüngste Gerücht war, wusste niemand mit Bestimmtheit zu sagen, und deshalb hielten es alle für wahr. Die Einzige, die von diesem Verdacht noch nie etwas gehört hatte, war Klara selber. Ihre kritiklose Begeisterung für die Lebensumstände von Fernsehpräsentatoren, Schönheitsköniginnen und Spitzensportlern war, auch wenn das niemand glauben wollte, ebenso echt wie die heimelige Mischung aus Kumpanei und Demut, mit der sie sich den Objekten der öffentlichen Begierde näherte und die ihre Homestorys bei den lesenden Analphabeten des Landes so beliebt machte.
»Süß!«, strahlte sie jetzt noch einmal. »Was meinst du, Kurt? Wenn er auf dem Bett läge, vielleicht in diesem Pyjama in den Vereinsfarben, das sie jetzt im Fanshop verkaufen, und dahinter hängt der Karabiner an der Wand – wäre das nicht ein tolles Motiv?«
»Das krieg ich vom Ausschnitt her nicht hin«, brummte Kurt Schädler und machte ein so angeekeltes Gesicht, als ob sie ihn aufgefordert hätte, eine Kloschüssel samt Inhalt zu porträtieren. Der Fotograf war immer schlecht gelaunt und ein bisschen rüpelhaft, aber er machte nun mal die schönsten Bilder und verstand sich wie kein anderer darauf, Tränensäcke und Orangenhaut per Photoshop verschwinden zu lassen. »Er ist eben ein Künstler«, meinten die Eingeweihten, »und einem Künstler muss man vieles nachsehen.«
»Es wäre nur zu machen, wenn er auf dem Bett liegt und das Gewehr im Arm hält.«
»Würden Sie …?«, fragte Klara Holzer.
»Nein«, sagte Tom. »Auf gar keinen Fall.«
»Seine Waffe ist ja doch eher der Fußballschuh«, warf Claudia schnell dazwischen. Sie hatte damit gar keinen Scherz bezweckt, aber die Journalistin belachte den Satz so herzlich und ausgiebig, als habe sie noch nie eine brillantere Formulierung gehört. »Seine Waffe ist der Fußballschuh«, wiederholte sie. »Einfach süß! Das wäre die perfekte Bildunterschrift. Wollen Sie nicht doch …?«
»Nein«, sagte Tom.
Nach dem, was in der Nacht passiert war, hatte er das Gewehr eigentlich abhängen und irgendwo verstecken wollen, aber Claudia war dagegen gewesen. »Die Geschichte damals am Sechseläuten stand in allen Zeitungen«, war ihr Argument. »Wenn sie dich nach dem Karabiner fragen, kannst du ihn nicht irgendwo in einen Schrank weggepackt haben. Das wirkt undankbar.«
Er hatte sich deshalb vorgenommen, die Leute von der SI einfach gar nicht in sein Schlafzimmer zu lassen, aber dann hatte man aus dem Untergeschoss dieses Geräusch gehört, diesen Schrei, und bevor noch jemand danach fragen konnte, hatte er schnell vorgeschlagen, in den ersten Stock zu gehen, dort gebe es auch noch manch Interessantes zu sehen.
Was sein Vetter da unten nur trieb? Er hatte ihm doch zehnmal eingeschärft, sich absolut still zu verhalten. Es musste nun wirklich niemand wissen, was für ein Besucher sich da bei ihm versteckte, ohne Visum und ohne Papiere. »Illegaler Immigrant beim Fußballstar« – das hätte diesen Journalisten was zu schreiben gegeben! Das wäre eine große Story geworden, aber eine, das hatte ihm Claudia schnell klargemacht, die er sich auf gar keinen Fall leisten konnte. Schon gar nicht jetzt, wo man ihnen drei Seiten in der SI versprochen hatte.
Die Homestory hatte man nicht mehr absagen können. Wenn sich die englische Königin zum Staatsbesuch angemeldet hat, kann die Calmy-Rey auch nicht einfach im Buckingham Palace anrufen und sagen: »Es ist mir etwas dazwischengekommen. Könnten wir es auf nächste Woche verschieben, Madame?«
Was gab es im Keller zu schreien? Schmerzen waren es bestimmt nicht. Die Wunde hatte sich schließlich als harmloser Streifschuss erwiesen, ein bisschen Jod drauf und ein Verband und fertig. Sie hatten sogar noch darüber gelacht, alle drei, weil der weiße Streifen am Arm aussah wie eine Kapitänsbinde. Und die Beule am Kopf … Mein Gott, so etwas erwischte ihn in jedem zweiten Training. Vor allem die Jungen, Übereifrigen stiegen bei den Spielchen vier gegen vier manchmal so hart ein, als ob es mindestens um den UEFA-Pokal …
»Tom!« Er merkte Claudias Stimme an, dass sie es nicht zum ersten Mal sagte. »Hörst du überhaupt zu?«
»Natürlich.« Er hatte nicht die geringste Ahnung, was man ihn gefragt hatte.
»Frau Holzer hat vorgeschlagen, du könntest im Garten den Rasen mähen.«
»Wie es jeder brave Bürger vor seinem Einfamilienhäuschen tut«, sagte die Süßholzer eifrig. »Der Star als Mensch wie du und ich. Das mögen meine Leser.«
»Es hat doch schon geschneit«, sagte Tom. »Da wächst das Gras nicht mehr.«