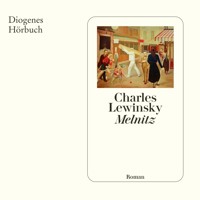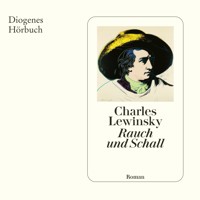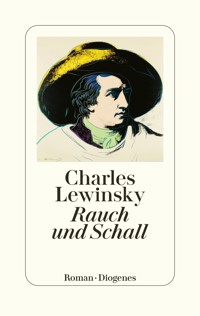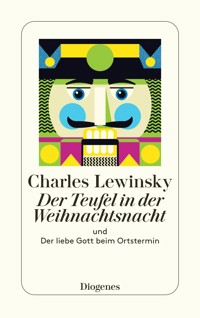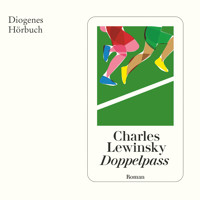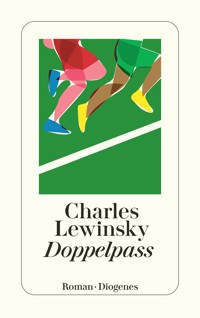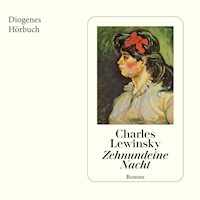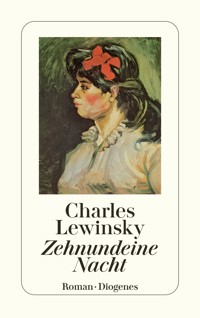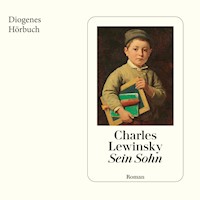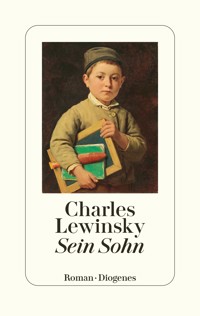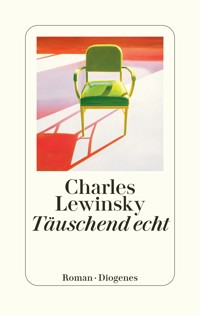
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Werbetexter verliert alles auf einen Schlag: Liebe, Geld und Karriere. Dank künstlicher Intelligenz schafft er es, sich wieder aufzurappeln. Die neue Technologie hilft ihm, ein Buch zu schreiben, das große Beachtung findet, weil es angeblich die »Geschichte eines wahren Schicksals« erzählt. Nur eine Frau weiß, dass das nicht stimmt: die ehemalige Geliebte, die den nun so gefeierten Autor schon einmal um alles gebracht hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Charles Lewinsky
Täuschend echt
Roman
Diogenes
Ein Bestseller ist ein Buch, das sich so gut verkauft, dass sogar die Katze deiner Nachbarn ein Exemplar besitzt.
ChatGPT
Alle kursiv gedruckten Texte sind von den Programmen ChatGPT und neuroflash geschrieben oder stammen von Wikipedia und anderen Webseiten.
I
Ich bin langweilig.
Sagt sie.
Das kann ich akzeptieren. Ich bin kein Entertainer. Für Karaoke ungeeignet.
Ihre Sachen waren verdächtig schnell gepackt. Was mich annehmen lässt, dass ihr spontaner Abgang gründlich vorbereitet war.
Das Terrarium hat sie zurückgelassen. »Es wird jemand vorbeikommen und es abholen«, hat sie gesagt.
Mit anderen Worten: Sie hat einen anderen. Ich kann ihn mir vorstellen. Bestimmt ist er in und hip oder wie man das heute nennt. Mit einem gepflegten Dreitagebart und weißen Turnschuhen. Die nicht mehr Turnschuhe heißen, sondern
Sneakers. Streetwear.
Es müsste ein Computerprogramm geben, das die deutsche Sprache automatisch in den gerade angesagten Slang übersetzt. Man klickt auf »Jugendsprache«, und aus »Guten Tag« wird »Hey, Alter«.
Falls das heute noch jemand sagt.
Sie hat ihre Spontaneität gründlich vorbereitet. Ein Alphabet von Gemeinheiten. Alle meine schlechten Eigenschaften, von »altmodisch« bis »zickig«.
Aber es ist nicht zickig, wenn ich in meinen Jazzplatten Ordnung haben will. Und in meinen Büchern.
Sie liest natürlich auf einem E-Reader.
Als ob man konzentriert lesen könnte, wenn gleichzeitig auf dem Handy alle paar Minuten eine neue Mitteilung aufploppt. Facebook, Instagram, TikTok, X oder wie die Medien alle heißen, von denen ich mich fernhalte.
Natürlich, ich verbringe auch viel Zeit im Netz. Aber doch nicht, um Unwichtiges über unwichtige Leute zu erfahren.
Auch das hat sie mir vorgeworfen. »Du lebst nicht in der Gegenwart«, hat sie gesagt.
Aber was jeden Tag milliardenfach über diese Netzwerke ausgekotzt wird, ist nicht die Gegenwart. Schon gar nicht die Wirklichkeit. Ein Zerrbild, durch immer neue Filter gejagt, bis es so aussieht, wie jemand gedacht hat, dass es aussehen müsse. Fake News. Fake Feelings.
Heutzutage kann sich jeder eine Wirklichkeit ausdenken. Es werden sich immer Menschen finden, die daran glauben.
Als unser Fernseher den Geist aufgab
Warum schreibe ich »unser«? Es ist meiner. Sie ist nur zu Gast.
War nur zu Gast.
Als der Fernseher kaputtging, hat sie gemeint, es sei Geldverschwendung, einen neuen zu kaufen. »Fernsehen ist etwas für alte Leute«, hat sie gesagt. Aber auf ihrem Tablet sieht sie sich stundenlang Realityshows an, in denen Laiendarsteller so tun, als ob sie das, was man ihnen ins Drehbuch geschrieben hat, tatsächlich erleben würden. »Ich betrachte das natürlich nur auf der Metaebene«, sagt sie. Hat sie gesagt. »Als interessantes kulturelles Phänomen.«
Forscher in den USA haben festgestellt: Wenn Sie Ihre Scheiße kulturelles Phänomen nennen, stinkt sie nicht mehr. Auf der Metaebene.
Auch meinen Plattenspieler fand sie lächerlich. Dabei kann sie bei ihren MP3s von so einer Tonqualität nur träumen. »Ein Relikt aus der Steinzeit« hat sie ihn genannt. »Wie wenn du deine Wohnung immer noch mit Öllämpchen beleuchten würdest.« Dabei ist ein Technics SL-1200 so was wie ein Rolls-Royce.
Und das Schlimmste: Klassischen Jazz findet sie langweilig. »Das Gedudel klingt doch jedes Mal gleich«, hat sie gesagt. »So etwas hört man sich nicht freiwillig an.«
Aber sie lässt denselben Song zwanzigmal hintereinander laufen. Mit Kopfhörern, immerhin, aber das Wummern der Bässe teilt sie trotzdem mit mir.
Duffa, duffa, duffa.
Ich hätte wissen müssen, dass wir nicht zusammenpassen.
Das stand auch auf ihrer Vorwurfsliste: Ich sei zu Beziehungen nicht fähig. Nur weil es nicht meine Art ist, meine Gefühle als Plakat vor mir her zu tragen. Aber ich habe sie trotzdem
»Liebe« ist ein zu großes Wort. Ein Versatzstück für die letzte Szene eines Films.
Ich war gern mit ihr zusammen.
Am Anfang.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Hölle. Das muss jemand aus der Schöpfungsgeschichte herausredigiert haben.
Ich habe nie verstanden, warum der Teufel immer männlich dargestellt wird. Er ist natürlich eine Frau. Ein Meter siebenundsechzig groß. Blonde Haare, wenn sie frisch gebleicht sind. Kleidergröße vierzig. Sie sagt achtunddreißig, aber das macht sie sich vor.
Keine Hörner, die setzt sie anderen auf.
»Du machst die schlechtesten Wortspiele der Welt.« Auch das hat sie mir vorgeworfen. Aber als sie mich Messie schimpfte und ich an den Fußballspieler dachte, da sollte das kein Wortspiel sein. Ich konnte mit dem Ausdruck einfach nichts anfangen. Nicht in Bezug auf mich.
Man ist kein Messie, nur weil man Dinge gern aufbewahrt. »Man muss mit leichtem Gepäck durchs Leben gehen«, sagt sie. »Alles Überflüssige wegschmeißen.« Nur: Was wirklich überflüssig war, stellt sich erst heraus, wenn man es schon weggeschmissen hat.
Meinen alten Teddy konnte ich gerade noch retten. Sie wollte ihn in die Mülltüte stecken.
Seine Knopfaugen waren von Anfang an schlecht befestigt gewesen, und irgendwann ist er blind geworden. Damals, ich werde vier Jahre alt gewesen sein oder fünf, habe ich nicht erlaubt, dass meine Mutter ihm neue Augen annähte. Er wäre dann nicht mehr meiner gewesen. Als ich zu Hause auszog, habe ich ihn mitgeschleppt und später in die Wohnung zurückgebracht. Jetzt sitzt er im Regal bei den Sachen aus meiner Schulzeit.
Sitzt er wieder im Regal.
»Als ob du dir mit all dem Kram beweisen müsstest, dass du überhaupt existierst«, hat sie gesagt. Hat mir mein altes Tagebuch als Argument vor die Füße geschmissen. »So einen Scheiß bewahrst du auf«, hat sie gesagt.
Ich habe zum letzten Mal Tagebuch geführt, als ich sechzehn war. Siebzehn. Die meisten Seiten sind leer geblieben. Ich war schon damals kein Mensch, der viel erlebt.
Gerade deshalb will ich es aufbewahren.
»Wozu?«, hat sie gefragt.
Muss es für alles einen Grund geben?
»Vielleicht schreibe ich mal meine Memoiren«, habe ich gesagt.
Und sie, in dem verächtlichen Ton, der immer schon da gewesen sein muss, den sie aber weggeheuchelt hatte, solang ihr das nützlich war, ein flüchtig übermalter Rostfleck: »Dazu müsstest du erst einmal etwas erleben. Man komponiert keine Symphonien, nur weil man auf der Blockflöte Hänschen klein spielen kann.«
Dann hat sie es gesungen. Immer wieder. Hänschen klein, ging allein. Ging allein. Ging allein.
Hat dabei auf die Uhr gesehen. Wollte es unauffällig tun, aber eine so gute Schauspielerin ist sie auch wieder nicht. Sie wird ihrem neuen Freund, ihrem neuen Opfer, exakt gesagt haben, wann sie abgeholt werden wollte. So, wie alles an dieser spontanen Szene geplant war.
Ich habe mich ihr nicht in den Weg gestellt. Habe nicht gebettelt. Sie hatte sich zum Gehen entschlossen, und ich habe sie gehen lassen.
»Wenn du dich wenigstens wehren würdest.« Das war das Letzte, was sie zu mir gesagt hat.
Ich muss den Anfang festhalten. Den ersten Akt. Sonst werde ich in ein paar Jahren überzeugt sein, mich falsch zu erinnern.
Als ich sie kennenlernte
Ich habe sie nie kennengelernt. Was ich für Kenntnis hielt, war Oberfläche. Sie hatte sich einen Charakter hingemalt, wie sie sich ein Gesicht malt, bevor sie am Abend aus dem Haus geht. Ohne mich natürlich. »Das ist nun wirklich nicht deine Welt«, sagt sie, und obwohl das stimmt, ist es jedes Mal verletzend.
War es jedes Mal verletzend.
Wenn sie nach Hause kam und ich mich schlafend stellte, weil ich auf Fragen doch keine Antwort bekommen hätte, wenn sie dann endlich nach Hause kam, roch sie nach Alkohol und Zigaretten und fremden Menschen.
»Ich bin noch jung«, hat sie gesagt und wollte mich damit daran erinnern, dass ich älter bin als sie. Aber neun Jahre sind doch kein so großer Unterschied.
Ich bin noch nicht einmal vierzig, verdammt noch mal.
Dass wir uns begegnet sind, habe ich Covid zu verdanken. Herzlichen Dank, Covid! Ein paar Millionen Tote und sie.
Straßenumfragen gehören nicht zu meinem Aufgabenbereich. Dafür haben wir studentische Hilfskräfte. Aber die hatten sich alle krankgemeldet, oder doch die meisten, und es gab einen Vertrag mit dem Auftraggeber, wonach so und so viele Umfragen bis dann und dann geführt sein mussten. Covid wäre Grund genug gewesen, eine Verlängerung des Termins zu fordern, außerordentliche Umstände, höhere Gewalt, aber davon wollte Anderberg nichts wissen. Die regelmäßigen Straßenumfragen, so überflüssig sie sein mögen, sind unser USP – »PR nahe am Verbraucher« –, also wurde auch ich losgeschickt. Zusammen mit diesem Praktikanten, der später keine Festanstellung gekriegt hat, und mit Lächel-Laura von der Telefonzentrale.
Üblicherweise bekomme ich die fertigen Umfrageergebnisse auf den Schreibtisch gelegt. Ein reines Ritual, denn für meine Arbeit sind sie nicht wirklich nützlich. Mein eigentlicher Job besteht in etwas, das nicht in den Briefings steht: zu verstehen, was der Kunde nicht zu artikulieren weiß, und die Texte dann so zu formulieren, dass sie neu klingen, ohne sich von den alten wirklich zu unterscheiden.
Bei unserer ersten Begegnung hatten wir beide eine Maske vor dem Gesicht. Die Einkaufsstraßen sahen damals aus, als ob die ganze Stadt ein großer Operationssaal wäre.
In dem sie mir dann das Herz aus dem Leib schnitt.
»Du bist immer so melodramatisch.« Das war auch einer ihrer Vorwürfe.
Ich war dankbar für die Maskenpflicht, weil sie mich unpersönlicher machte. Nicht, dass ich schüchtern wäre, aber es kostet mich Überwindung, fremde Menschen anzusprechen.
Doch, ich bin schüchtern.
Ich habe nicht das Äußere, um selbstsicher zu sein. Zu unbeholfen. Zu dick.
»Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«, habe ich gesagt. Und sie, schon im Weitergehen, über die Schulter weg: »Nein.«
Das hätte das Ende sein können.
Aber dann wollte ich mich bei Starbucks aufwärmen, und sie war auch dort. Ihr roter Fussballschal war mir schon auf der Straße aufgefallen. »Manchester United« hatte ich automatisch gelesen, aber jetzt merkte ich, dass da etwas ganz anderes stand: »Mankiller United«. Und das Teufelchen auf dem Logo war eine Frau.
Ironie als Fashion Statement. Auf der Metaebene.
Ich hätte gewarnt sein müssen.
Dass wir auf den zu hohen Stühlen an der Theke nebeneinandersaßen, war Zufall. Es waren keine anderen Plätze frei.
Ich habe mich lächerlich gemacht, indem ich mich für die Belästigung auf der Straße entschuldigt habe. Ihre Reaktion zeigte, dass sie sich an unsere Begegnung nicht einmal erinnerte.
Sie führte ein kurzes Telefongespräch, sprang auf und lief hinaus. Ihr Soja-Latte blieb ungetrunken stehen.
Dass auch ihr Handy liegen geblieben war, hätte mich nicht zu kümmern brauchen. Aber ich bin ihr nachgelaufen. Stand dann auf der Straße wie ein Idiot. Bis das Handy klingelte. Sie hatte sich bei jemandem ein Telefon ausgeliehen und die eigene Nummer angerufen.
Nein, sie könne jetzt nicht zurückkommen. Sie müsse ganz dringend zu einer Wohnungsbesichtigung, eine einmalige Chance, wo es doch in dieser Stadt fast unmöglich sei, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Sie wisse wirklich nicht, was sie jetzt tun solle.
Spielte das hilflose kleine Mädchen. Das kann sie gut.
Ich bin darauf reingefallen. Habe mir die Adresse der Wohnungsbesichtigung geben lassen, um ihr das Handy zu bringen. »Es macht mir wirklich keine Umstände«, habe ich gesagt. Der edle Ritter auf seinem Ross.
Der tumbe Tor.
Sie hat die Wohnung natürlich nicht bekommen. Die gar keine Wohnung war, sondern nur ein WG-Zimmer. Und wusste jetzt nicht, wo sie diese Nacht schlafen sollte.
Ich habe vergessen, wie sie ihre Situation damals genau geschildert hat. Ich weiß nur noch, dass sie in der Geschichte das unschuldige Opfer war. Was nicht zu ihrer Rolle als toughe Frau passte, aber dieser Widerspruch fiel mir erst später auf. Wie so vieles andere. Heute reime ich mir die Geschichte so zusammen: Sie war mit einem Mann zusammen gewesen, von dem hatte sie alles gekriegt, was zu kriegen war, es war nichts mehr aus ihm herauszuholen, und deshalb hatte sie sich schon mal den nächsten warmgehalten. Hat einen Krach provoziert, so, wie sie es dann auch bei mir gemacht hat.
In der Wikipedia steht über Blutegel:
Nach Erreichen der Sättigung fällt das Tier von selbst von seinem Wirt ab.
Aber dann ist ihr neuer Kerl aus irgendeinem Grund von der Bildfläche verschwunden. War klüger als ich. Und den großen Krach mit dem anderen hatte sie zu gut inszeniert.
Sie hat mir eine Legende erzählt, in der sie die Märtyrerin war. Hat es sogar geschafft, ein paar Tränchen zu vergießen. Nicht zu viele, wegen des Make-ups. Vor allem um ihr Haustier mache sie sich Sorgen. Ich dachte an eine Katze oder einen Hund.
Edel sei der Mensch, hilfreich und doof. Ich habe ihr angeboten, sie für eine Nacht bei mir unterzubringen. Sie wollte mir das auf keinen Fall zumuten, hat sich so heftig dagegen gewehrt, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als darauf zu bestehen. Wenn Manipulation eine Kunstform wäre, könnte sie mit der Nummer im Zirkus auftreten.
Ich habe ihr geholfen, ihre Sachen abzuholen. Viel war es nicht. Nomaden reisen mit leichtem Gepäck.
Nur das Terrarium habe ich kaum in den Kofferraum meines Golfs gekriegt.
Damals fand ich es originell, dass ihr Haustier eine Schlange war. Jetzt würde ich sagen: Es passte zu ihr.
So ein Tier sucht sich ein Plätzchen aus, das die Temperatur hat, die es im Moment braucht, und liegt dann dort faul herum. Macht es sich bequem und lässt sich füttern.
Aber schön gemustert.
Sie hat sich bei mir eingenistet, und
Warum schreibe ich immer nur »sie«?
Weil man den Teufel nicht beim Namen nennt.
Eingenistet wie ein Kuckuck im fremden Nest. »Nur bis ich etwas Eigenes finde«, hat sie gesagt. Ich wollte nicht, dass sie jemals wieder wegging. Nicht nach diesen ersten Tagen.
Nach diesen ersten Nächten.
Als ich damals die Wohnung meiner Eltern übernahm, habe ich an der Einrichtung nicht viel geändert. Man konnte darin leben, und »Design oder nicht sein« ist nie meine Devise gewesen. Nur gerade das scheußliche Buffet habe ich durch ein Regal für meine Schallplatten ersetzt. Und natürlich neue Matratzen für das Doppelbett gekauft. Die alten weiter zu benutzen, wäre mir inzestuös vorgekommen.
Ich habe ihr angeboten, sie könne auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen. Es ist nicht allzu unbequem, das weiß ich aus Erfahrung. Als Vater in seinen letzten Monaten Pflege brauchte, habe ich mehr als einmal darauf übernachtet. Aber sie meinte, wo im Schlafzimmer doch zwei Betten stünden, wäre das ein unnötiger Umstand. Wir seien schließlich moderne Menschen.
Dabei bin ich so altmodisch – sie nennt es spießig –, dass ich unter »zusammen schlafen« tatsächlich nur schlafen verstanden habe. Bis sie dann wie selbstverständlich
Alles muss ich nicht aufschreiben.
Ich habe tatsächlich geglaubt, der Sex habe etwas zu bedeuten. Ich vermutete Gefühle, wo es sich von ihrer Seite nur um eine Transaktion handelte. Ein Fall von selbstverständlicher Zahlungsunmoral.
Dabei bin ich, vermute ich, weiß ich, kein guter Liebhaber. Mir fehlt die Erfahrung. Natürlich sind die Videos auf Pornhub kein Maßstab, solche akrobatischen Turnübungen werden nicht Alltag sein, aber es wird schon stimmen, dass im Bett Ausdauer gefragt ist. Ich spiele da nicht in der Champions League.
Sie ließ es sich gefallen. Anfänglich. Später garnierte sie ihr Nein zuerst mit Ausreden und machte sich dann auch diese Mühe nicht mehr. Die Notwendigkeit, mich bei Laune zu halten, war entfallen. Sie musste nicht mehr befürchten, aus ihrem Kuckucksnest vertrieben zu werden.
Das Wort »Hörigkeit« würde mir Anderberg aus jedem Text herausstreichen. Zu altmodisch und zu wenig positiv. Man schreibt nicht: »Unser Morgenkaffee wird Sie hörig machen.« Sondern: »Sie werden den Tag nicht mehr ohne unseren besonders milden Morgenkaffee beginnen wollen.« So heißt das.
Aber um unsere Beziehung zu beschreiben, ist »hörig« das exakt richtige Wort.
Wikipedia:
Man bezeichnet damit die Unterwerfung des eigenen Willens unter die Macht einer anderen Person. Diese Unterwerfung kann erzwungen bzw. mehr oder weniger freiwillig erfolgen und ohne dass sich die betroffene Person dessen bewusst sein muss.
Ich war blöd genug, nicht zu merken, wie sie mich an der Leine herumführte. Wollte es nicht merken.
Sie kann jedes Gefühl vortäuschen, das ihr gerade nützlich erscheint.
Oder ich bin einfach leicht zu manipulieren.
Ich habe mich nicht dagegen gewehrt, dass sie ihr Territorium schleichend erweiterte. Nicht einmal gegen die gefrorenen Mäuse im Tiefkühlfach habe ich protestiert. »Du willst doch nicht, dass meine Schlange verhungert«, hat sie gesagt, und, nein, das wollte ich natürlich nicht. Wo sie das Tierchen doch so gern hatte.
»Tierchen«. Das Vieh ist fast einen Meter lang.
Sie wird sich die Kornnatter zugelegt haben, wie sie sich mich zugelegt hat: weil das vorübergehend in eine Laune passte. Ein modisches Accessoire, das man jederzeit wieder loswerden kann. Das Terrarium einfach irgendwo stehen lassen. Den Mann.
Und hatte einen Tag vorher noch gesagt: »Ich könnte ohne dieses Tier nicht mehr leben.«
Ohne dieses handzahme, wohldressierte Tierchen, das keine Miete verlangt und den Abwasch erledigt.
Es war eine Lüge. Wie alles an ihr. Ich hätte es merken können, wenn ich nicht so vernarrt in sie gewesen wäre.
»Vernarrt« ist ein gutes Wort. Sie hat mich zum Narren gehalten.
Als Narr wird eine männliche Person bezeichnet, welche sich töricht verhält und auf lächerliche Weise irreführen oder täuschen lässt.
Ich habe mich selber zum Narren gehalten.
Dabei war alles so offensichtlich widersprüchlich. Einerseits hatte sie nie Geld, andererseits wusste sie über die exklusivsten Champagnersorten Bescheid. Konnte ausführlich erklären, welche davon angesagt waren und welche nur protzig. Hatte schon überall Urlaub gemacht. Allein, um ihre Garderobe zu bezahlen – ich habe die Preise im Internet recherchiert –, hätte sie ein Direktorengehalt haben müssen.
Sie arbeitet auf Honorarbasis, je nach Auftragslage. Hat sie mir erzählt. Bei einer Agentur, die gesellschaftliche Anlässe organisiert. Firmenveranstaltungen und solche Sachen. Was auch der Grund sei, warum sie immer am Abend beschäftigt war und am Morgen endlos liegen bleiben konnte. Einmal bin ich über Mittag nach Hause gekommen, weil ich etwas vergessen hatte, und sie lag immer noch im Bett. »So ist das eben bei uns Freelancern«, hat sie gesagt.
Das müsste auch dringend mal jemand erfinden: eine Übersetzungs-App, die große Worte auf ihre eigentliche Bedeutung reduziert. Input: »Freelancerin«. Output: »arbeitslos«.
Ich habe keinen Beweis dafür, aber manchmal denke ich: Vielleicht waren die Partys, an denen sie so oft dienstlich teilnehmen musste, in Wirklichkeit Rendezvous mit zahlungskräftigen Männern.
Oder lasse ich mir solche Dinge einfallen, weil es mir besser geht, wenn ich schlecht über sie denke?
Es würde mir besser gehen, oder ich bilde mir doch ein, dass es mir besser gehen würde, wenn ich diese Gedanken nicht nur für mich aufschreiben, sondern sie ihr an den Kopf werfen könnte. All ihre schlechten Eigenschaften, alphabetisch geordnet.
Abgefuckt.
Betrügerisch.
Charakterlos.
Wenn ich wütend auf sie sein könnte, einfach nur wütend und nicht gleichzeitig auch traurig.
Aber ich schaffe es ja nicht einmal, der Heizmatte unter dem Terrarium den Stecker zu ziehen und die blöde Schlange verrecken zu lassen.
Stattdessen werde ich eine Maus für sie auftauen.
Es war nur ein kleines Detail, ein Giftkorn unter anderen Giftkörnern, etwas, das sie mir nur einfach so an den Kopf geworfen hat, weil sie ohnehin schon dabei war, mich fertigzumachen, eine kostenlose Zugabe für gute Kunden, ein winziges
»Komm zur Sache«, würde Anderberg sagen. »Dein Geschwurbel will niemand lesen.«
Zur Sache.
Neben vielem anderen, mit dem ich leben kann, weil es mich nicht wirklich trifft, die Vorwürfe wie mit der Schrotflinte aufs Geratewohl abgeschossen, neben all den Beleidigungen, die mehr über sie selber aussagen als über mich, neben dem ganzen Gemeinheitsalphabet war da etwas, das mir immer noch unter der Haut sitzt wie ein Holzsplitter, wie
Schwurbel.
Sie hat gesagt: »Leute wie du werden beruflich bald so überflüssig sein, wie du es privat schon immer gewesen bist. Solche Texte lässt man heutzutage von einer künstlichen Intelligenz schreiben. Schneller und besser.«
Sie hat das einfach so dahingesagt, natürlich. Hat eine offene Wunde vermutet und wollte darin herumstochern.
Dabei versteht sie nichts von meinem Beruf. Nichts von künstlicher Intelligenz. Hat den Begriff Artificial Intelligence irgendwo aufgelesen wie einen interessant geformten Stein und ihn mir an den Kopf geworfen, weil gerade nichts anderes zur Hand war.
Aber, ich mache mir da nichts vor, ich bin ein unsicherer Mensch. Sie hat mir den Gedanken ins Hirn gepflanzt. Den Krankheitskeim. Sie wusste, dass er mir keine Ruhe lassen würde.
Ich wollte ihr
Mir selber.
Ich wollte mir beweisen, dass sie nicht recht hat. Die Zeitungen waren gerade voll mit dem Thema und den Adressen von Webseiten, auf denen man sich Texte schreiben lassen kann. Ich habe, ohne lange Überlegung, ein paar Stichworte zu dem Kundenbrief eingegeben, an dem ich gerade saß.
Frühstücksmüsli. Sie hat das Wort immer so verächtlich ausgesprochen, als ob es noch viel mehr ü hätte. Früüühstück. Müüüsli.
Natürlich, Brad Pitt würde nie einen Frühstücksmüsli-Texter spielen. Bungeespringen ist abenteuerlicher. Aber man kann von solchen Texten leben.
Noch.
Es hat keine Sekunde gedauert, und schon hat der Computer ein Ergebnis ausgespuckt.
Mit einem gesunden Müsli starten Sie den Tag fit und ausgeruht. Unser Müsli ist eine gesunde Alternative zum herkömmlichen Frühstück und sorgt für einen guten Start in den Tag.
Mit unserem Müsli starten Sie jeden Morgen mit neuer Energie in den Tag. Es ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien und sättigt Sie bis zum Mittagessen. Zusätzlich ist es glutenfrei und damit für alle geeignet. Durch die Zugabe von frischem Obst und Joghurt erhalten Sie zusätzlich wichtige Nährstoffe, die Ihnen den ganzen Tag über Energie geben.
Mein Todesurteil.
Anderberg würde manches daran zu mäkeln finden. Anderberg findet immer etwas zu mäkeln. Die eine oder andere Stelle ließe sich verbessern, nicht dreimal »Start« so kurz hintereinander zum Beispiel, aber das wäre in zehn Minuten erledigt.
Bald wird man nicht mehr selber schreiben, sondern nur noch ab und zu korrigierend eingreifen. In Kalifornien, habe ich gelesen, darf ein Tesla nur dann im Selbstfahrmodus auf die Straße, wenn ein menschlicher Fahrer hinter dem Lenkrad sitzt. Unsere Sprache formuliert es schon richtig: Man bedient einen Computer. Er lässt sich von uns bedienen. Ein paar Schönheitskorrekturen, und der Text ist fertig.
Irgendwann wird man auch sämtliche stilistischen Regeln einprogrammieren können. Kann es vielleicht jetzt schon, und ich habe nur nicht die richtigen Kästchen angeklickt.
Sie wollte mir Angst machen, und es ist ihr gelungen.
An meinem letzten Arbeitstag wird mir Anderberg eine Flasche Wein überreichen. Unter den Flaschen, die ihm seine Kunden zu Weihnachten schicken, sind immer ein paar, die ihm nicht schmecken.
Ich werde den Wein zusammen mit den Kollegen austrinken.
Arbeitslose haben keine Kollegen.
Es ist nicht logisch, was es in mir denkt, überhaupt nicht logisch, aber ich beherrsche das Kunststück nicht, gleichzeitig wütend und vernünftig zu sein. Im Gegenteil: Die Unvernunft macht mir die Wut leichter erträglich.
In meinem Kopf ist sie die Erfinderin der künstlichen Intelligenz.
Diese Textmaschinen, habe ich gelesen, werden täglich besser. »Selbstlernend«, dieses bedrohliche Zauberwort. Irgendwann werden alle Texte auf diese Weise geschrieben werden. Schon bald, fürchte ich. Vielleicht nicht die der ganz großen Dichter, ein James Joyce wird sich nicht so leicht in Bits und Bytes auflösen lassen, aber ich bin ein Gebrauchsschreiber, ein ausgeleierter Wortautomat, so veraltet wie ein Telefon mit Wählscheibe. Für die Texte, die seine Kunden bei ihm bestellen, muss Anderberg in Zukunft keine Löhne mehr bezahlen. Er lädt sich das entsprechende Programm herunter und hat sofort, was er braucht, für jedes Medium und in jeder gewünschten Länge.
Nur dass es bald auch keinen Anderberg mehr brauchen wird. Die Kunden werden, was sie brauchen, von ihrem Computer herstellen lassen. Und irgendwann gibt es dann ein Programm, das die Texte auch noch selber liest, der Konsument wird ebenfalls überflüssig, die Frühstücksflocken bestellen sich selber, und die nächste Generation des Programms sorgt dafür, dass sie auch noch vollautomatisch gefressen werden.
Und sie ist schuld daran. In meinem Kopf ist sie schuld daran.
Statt dass ich, wie es vernünftig wäre, schon mal anfange zu überlegen, welche anderen Berufe für mich infrage kämen, denke ich über all die Dinge nach, von denen ich mir wünsche, dass sie ihr zustoßen sollten. Sammle Schimpfwörter, die ich ihr hätte hinterherrufen sollen.
Und selbst dazu fällt mir zu wenig ein. Zwischen »Aasgeier« und »Zecke« jede Menge Lücken im Alphabet.
Vielleicht hat sie recht, und ich bin tatsächlich nur die Bauchrednerpuppe meiner Kunden, wie sie das so charmant formuliert hat. Wenn einem noch nicht einmal genügend Beleidigungen einfallen, dann
Dann was?
Ich bin heute in die Agentur geschlichen, als ob ich schon entlassen wäre. Wollte auf dem Flur niemandem begegnen. Ich stellte mir vor, dass mich die Kollegen fragen würden: »Was machst du denn noch hier?« Höflich, aber mit einer Prise Ekel in der Stimme. Als ob sich eine Leiche auf der Bahre noch mal aufrichtete, und jetzt wüssten sie nicht, wie sie dem Verstorbenen beibringen sollten, dass es dafür zu spät ist.
Dass ich mein eigenes Büro habe, noch immer mein eigenes Büro, ist die Ausnahme. Anderberg ist überzeugter Open-Plan-Anhänger. »Nähe fördert die Kollegialität«, sagt er. Was die Übersetzungs-App, von der ich träume, so wiedergeben würde: »Man spart Miete, wenn alle im selben Raum hocken.«
Aber der Müslikönig, der allmächtige Herr Obermüsli, besteht darauf, nur mit mir und keinem anderen zusammenzuarbeiten. Also muss man nett zu mir sein. Anderberg, der sich die Welt nicht anders als ein Geflecht von Intrigen vorstellen kann, geht davon aus, dass zwischen dem Müslimenschen und mir eine geheime Beziehung besteht.
Dabei haben wir noch nie ein privates Wort miteinander gewechselt. Ich bin für ihn so wenig ein Freund, wie ein Koch mit seiner Bratpfanne befreundet ist. Uns verbindet nur eines: Ich kenne ihn unterdessen so gut, dass ich das, was er denkt, aber nicht zu formulieren versteht, zu Papier bringen kann, und
Auch diese Formulierung werde ich mir abgewöhnen müssen. Bald wird man überhaupt nichts mehr zu Papier bringen.
Ob man »zu Bildschirm bringen« sagen wird?
Die Sprache wird sich schon einen neuen Trampelpfad schaffen.
Der Müslikönig – das ist mein persönliches Alleinstellungsmerkmal – will seine vollautomatische Bauchrednerpuppe nicht hergeben, und Anderberg hat Angst, ich könnte zu einer anderen Agentur wechseln und den Kunden mitnehmen. Daher das eigene Büro.
Aber mein Unique Selling Point wird bald keiner mehr sein. Wenn man für diese Arbeit keinen Menschen mehr braucht, wenn eine Tastatur genügt, dann ist es scheißegal, wie gut ich den Kunden verstehe.
Ich wollte Schlag neun Uhr mit der Arbeit beginnen, hatte mir vorgenommen, in Zukunft immer vorbildlich pünktlich zu sein. Vielleicht sammelt Anderberg ja schon Gründe für eine Kündigung.
Ich konnte mich aber nicht konzentrieren, weil
Ich kann mich auch jetzt nicht konzentrieren.
Im alten Rom, die Vorstellung hat mich immer fasziniert, stand bei Triumphzügen ein Sklave hinter dem siegreichen Feldherrn, und während das Volk jubelte, flüsterte er ihm ins Ohr: »Bedenke, dass du sterblich bist.«
Ich bin kein Feldherr. Ich bin ein Schreibtischsoldat. Deshalb sagt die Stimme in meinem Ohr auch nichts vom Sterben.
»Bedenke, dass du überflüssig bist«, sagt die Stimme.
Ihre Stimme.
Sie verfolgt mich.
Überflüssig. Überflüssig. Überflüssig. Der Ohrwurm in meinem Kopf.
Gibt es das Wort »Hirnwurm«?
Früher, als man noch an Dämonen glaubte, hätte man einen Exorzisten kommen lassen, und der hätte mir das Teufelchen ausgetrieben. Heute würde man, wenn man darüber klagte, zum Psychiater geschickt, und es wäre der aus dem Uraltwitz, den Anderberg immer bei Betriebsfeiern erzählt.
»Sie haben keinen Minderwertigkeitskomplex. Sie sind minderwertig.«
Bei Anderbergs Witzen lachen immer alle schallend. Er kann nachtragend sein, und man will es sich nicht mit ihm verderben.
Darauf einen Anderberg.
Der Text, der noch vor der Mittagspause abgeliefert werden sollte, bot eigentlich keine besonderen Schwierigkeiten. Das Premium-Müsli mit noch mehr Früchten, Nüssen und Kernen. Der kleine Frühstücksluxus für den anspruchsvollen Genießer. Der sich niemals mit schlichten Getreideflocken zufriedengeben würde, sondern nach edlen Cerealien verlangt. Das Ganze nicht einfach crisp, sondern crunchy. Ein Unterschied, der dem Müslikönig ungeheuer wichtig ist.
Ich habe mir einen entsprechenden Artikel aus der englischen Wikipedia heruntergeladen und ihn von DeepL verdeutschen lassen. Manchmal kommt man so auf bessere Formulierungen. Dem Programm ging es wie mir: Es sah keinen Unterschied. Hielt crisp für crunchy und crunchy für crisp.
Knusprigkeit unterscheidet sich von Knusprigkeit darin, dass ein knuspriges Produkt schnell zerstäubt wird, während ein knuspriges Produkt anhaltenden, körnigen Widerstand gegen die Kieferbewegung bietet.
Mein Kopf war total blockiert. Systemabsturz.
Die längste Zeit saß ich nur da, tippte immer wieder das Wort »Müsli« und löschte es wieder.
Müsli.
Delete.
Müsli.
Delete.
Schließlich beschloss ich, den Text von der künstlichen Intelligenz schreiben zu lassen. Meinen Todfeind für mich arbeiten zu lassen. Ich hatte die Website schon aufgerufen, als mir etwas Besseres einfiel.
Ein persönlicher Exorzismus.
Ich gab ins Suchfeld ein: »Eine Liste von Beleidigungen für eine Frau.«
Enter.
Es gibt eine Liste von Beleidigungen, die man einer Frau nie sagen darf. Diese Worte können ihr wehtun und sie verletzen. Sie sind unangemessen und können eine Beziehung zerstören. Um eine Beziehung zu schützen und eine Frau zu ehren, sollte man sich immer bemühen, diese Worte zu vermeiden.
Als eingefleischter Feminist bin ich davon überzeugt, dass es ein absolutes Tabu sein sollte, einer Frau Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Respekt und Wertschätzung sind Grundlagen, die jeder Mensch verdient, ganz besonders aber Frauen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Worte wir im Umgang mit dem anderen Geschlecht verwenden, und uns davor hüten, die Grenzen zu überschreiten.
Sie haben beim Programmieren die Wokeness mit eingebaut, und zwar so gründlich, dass sich ein Konstrukt aus Bits und Bytes selber als feministisch bezeichnet. »Um eine Beziehung zu schützen und eine Frau zu ehren.« Unsere Beziehung ist im Arsch, und zu ehren gibt es nichts an ihr. Zu verachten, ja. Zu verfluchen. Zu hassen. Aber darauf scheint das Programm nicht eingerichtet zu sein.
Irgendwie habe ich den bestellten Text aus mir herausgewürgt und pünktlich abgeliefert.
Die künstliche Intelligenz hätte es ebenso gut gemacht.
Besser.
Die Kornnatter ist krank.
Mir kann es egal sein, wenn sie abkratzt. Es ist nicht mein Tier.
Aber ich mache mir Sorgen.
Ich bin kein Herpetologe – ein Wort, das sie, die große Schlangenfreundin, noch nicht einmal kannte –, aber diese gräuliche Verfärbung der Haut, jeden Tag ein bisschen stärker, kann nichts Gutes bedeuten. Fressen will sie auch nicht. Die Maus, die ich ihr mit der Futterpinzette hinhielt, hat sie nur kurz bezüngelt und sich dann wieder unter den trockenen Blättern verkrochen.
Sie hat, wie es früher in den Indianerbüchern hieß, eine gespaltene Zunge. Wie könnte es bei dieser Besitzerin anders sein?
Die Maus habe ich ins Klo gespült. Zuerst wollte ich den Leichnam den beiden immer so ekelhaft freundlichen jungen Leuten in der Wohnung nebenan auf die Türschwelle legen. Ein kleines Nachbarschaftsgeschenk als Dank dafür, dass ihre Katze schon zweimal ins Treppenhaus geschissen hat.
Warum schaffen sich Menschen ein Haustier an, wenn sie dann nicht in der Lage sind
Bin ich wirklich so spießig?
Ich werde die Schlange nicht zum Tierarzt bringen. Warum sollte ich? Soll sie sich doch kümmern.
Vielleicht kommt sie eines Tages ja doch noch mit jemandem an und will das Terrarium abholen. Hat den nächsten Dummen gefunden, den sie für sich arbeiten lassen kann. Den übernächsten.
Und ich sage dann: »Das Vieh liegt auf dem Müll.« Sage es ganz cool. Nehme mir vor, es ganz cool zu sagen.
Dabei weiß ich nicht einmal, wie man eine tote Schlange korrekt entsorgt.
Ich habe auf einer Terraristikfachseite nachgesehen. Die Farbveränderung und die Appetitlosigkeit bedeuten wohl nur, dass sich die Kornnatter bald häuten wird.
Ich denke ständig darüber nach, was ich hätte sagen sollen, wenn mir die richtigen Antworten eingefallen wären. Heute Nachmittag habe ich noch einmal einen elektronischen Exorzismus
Exorzismus?
Gut, dass das nie jemand lesen wird. Ich klinge wie ein totaler Freak.
Ich wollte mich irgendwie beschäftigen. Also habe ich das Spiel mit den KI-Texten noch einmal ausprobiert. Nur so zum Spaß.
Nicht nur zum Spaß.
Diesmal habe ich keine Beschimpfungen bestellt, sondern eine Szene, in der eine Frau Angst vor einem Mann hat. Die politisch korrekten Programmierer habe ich überlistet, indem ich behauptet habe, das Ganze sei für einen Roman bestimmt. Natürlich will ich keinen Roman schreiben. Es geht mir einfach besser, wenn ich mir vorstelle, dass es ihr schlecht geht.
Der Mond warf einen unheimlichen Schein auf das trostlose Moor, sein fahles Licht hüllte die Landschaft in eine unwirkliche Atmosphäre. In dieser düsteren Umgebung sah sich die Frau einem unerbittlichen Verfolger ausgeliefert.
Ihr Herz pochte in ihrer Brust wie ein donnernder Trommelschlag, während sie durch das Unterholz rannte. Jedes Rascheln der Blätter und jedes Knacken eines Astes verstärkten ihre Angst, verstärkten das spürbare Grauen in der Luft.
Ihre Füße stolperten über den unebenen Boden, aber sie rannte weiter, angetrieben von schierer Verzweiflung. Doch der Mann hinter ihr verringerte den Abstand mit beunruhigender Leichtigkeit.
Plötzlich geschah das Unvermeidliche. Ihre Beine gaben nach, und sie stürzte zu Boden. Bevor sie sich erheben konnte, tauchte der Mann über ihr auf, sein Gesicht von der Dunkelheit verdeckt, sein Atem heiß auf ihrer zitternden Haut. Ein Schimmer des Mondlichts glitzerte auf der kalten, stählernen Klinge, die er ihr an die Kehle drückte.
Ihr Keuchen blieb ihr in der Kehle stecken, als ihre panischen Augen sich mit seinem bösartigen Blick trafen. Die Lippen des Mannes verzogen sich zu einem finsteren Lächeln, das einen Hauch von Zufriedenheit verriet.
Seine Stimme triefte vor Gift, ein Flüstern, das in ihrer Seele widerhallte. »Es gibt kein Entkommen, meine Liebe«, zischte er, »du kannst deinem Schicksal nicht entkommen.«
Andere Leute ziehen sich einen Gruselfilm rein. »Die Nacht der menschenfressenden Leichen« und solche Sachen. Irgendwo habe ich gelesen, dass in Amerika eine Frau zum Filmstar geworden ist, nur weil sie so wunderbar vor Angst schreien kann. Weit aufgerissene Augen und alles. Sie hat einen eigenen Fanclub.
Ich brauche kein Kino, um meinen Film zu genießen. Die Bilder mache ich mir selber. Setze mich vor den Computer und lasse mich davon überraschen, was sich das Programm alles für sie einfallen lässt. Je grausamer, desto mehr genieße ich es.
Auf der Metaebene.
Gegenüber dem ersten Versuch habe ich die Stichworte leicht verändert und zur Abwechselung um die Ich-Form gebeten.
Ein unheimliches Gefühl der Bedrohung durchzuckte mich, und ich bekam eine Gänsehaut. Mein Herz begann wie wild zu klopfen, und ich bekam kaum noch Luft. Ich rief nach Hilfe, aber meine Stimme versagte mir den Dienst. Alles um mich herum drehte sich, und ich sank zu Boden. Ich krümmte mich vor Schmerzen und betete, dass dieser Albtraum bald vorbei sein würde. Aber er hörte nicht auf – im Gegenteil: Es wurde immer schlimmer. Mir war so heiß, als stünde ich in Flammen – und doch fror ich gleichzeitig bis ins Mark.
Ich habe schon immer unter Panikattacken gelitten, aber in den letzten Jahren ist es immer schlimmer geworden. Ich versuche dann jedes Mal verzweifelt, die Kontrolle über mich zu behalten – aber irgendwann reißt der Damm einfach, und ich bin völlig hilflos. Die Angst ist so überwältigend, dass sie alles andere ausblendet. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich stelle mir vor, dass ich es bin, der das Messer in der Hand hat.
Die Kettensäge.
Dass ich
Kusch.
Die Sprache ließe sich verbessern, aber darum geht es nicht. Das Programm ist ja auch erst eine Beta-Version.
Deep Blue hat Kasparow auch irgendwann im Schach geschlagen.
Irgendwann wird jeder das Programm auf seinem Laptop haben und sich seine Romane à la carte schreiben lassen.
Wie möchten Sie Ihre Geschichte gern? Scharf gewürzt oder mild?
Vielleicht etwas Exotisches? Mit Ctrl-T kommen Sie zur Liste unserer Tagesspezialitäten.
Und die Zubereitung?
Sehr blutig? Selbstverständlich, der Herr. Auf dem Pull-Down-Menu können Sie Ihre bevorzugten Todesarten wählen. Wenn Sie sich lieber überraschen lassen wollen, wählen Sie »Random«.
Oder zur Abwechslung heute lieber mal was Süßes? Junge Liebe mit Happy End?
Können Sie haben, der Herr. Können Sie alles, alles haben.
Ich hasse Müsli. Ich hasse Müsli mit Früchten, und ich hasse Müsli mit Nüssen. Ich hasse es crispy, und ich hasse es crunchy. Ich hasse Müsli.
Amen.