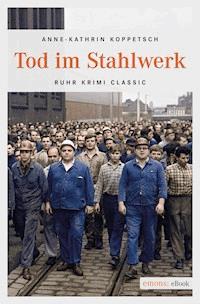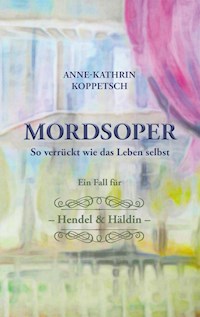Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martha Gerlach
- Sprache: Deutsch
Die Pastorin gerät ins Fadenkreuz: Der fesselnde Ruhrpott-Krimi »Der tote Kumpel« von Anne-Kathrin Koppetsch als eBook bei dotbooks. Deutschland 1969, das ganze Land ist im Aufbruch – und in Dortmund feiern die Stahlkocher ihren erfolgreichen Streik. Doch dann wird der Sohn des Betriebsrates tot aufgefunden. War es ein tragischer Unfall … oder wurde der junge Mann Opfer eines alten Streits, der nun mörderisch eskaliert ist? Pastorin Maria Gerlach ist erschüttert über den tragischen Tod ihres ehemaligen Konfirmanden. Als sie beginnt, Fragen zu stellen, gerät sie plötzlich selbst unter Verdacht, in den Fall verwickelt zu sein. Und schnell wird klar, dass Maria einem Geheimnis auf die Spur gekommen ist, das jemand dringen wahren will – und zwar um jeden Preis! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der ebenso nostalgische wie fesselnde Krimi »Der tote Kumpel« von Anne-Kathrin Koppetsch – der dritte Fall für die Pfarrerin Martha Gerlach. Alle Titel der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Deutschland 1969, das ganze Land ist im Aufbruch – und in Dortmund feiern die Stahlkocher ihren erfolgreichen Streik. Doch dann wird der Sohn des Betriebsrates tot aufgefunden. War es ein tragischer Unfall … oder wurde der junge Mann Opfer eines alten Streits, der nun mörderisch eskaliert ist? Pastorin Maria Gerlach ist erschüttert über den tragischen Tod ihres ehemaligen Konfirmanden. Als sie beginnt, Fragen zu stellen, gerät sie plötzlich selbst unter Verdacht, in den Fall verwickelt zu sein. Und schnell wird klar, dass Maria einem Geheimnis auf die Spur gekommen ist, das jemand dringend wahren will – und zwar um jeden Preis!
Über die Autorin:
Anne-Kathrin Koppetsch wurde 1963 im Sauerland geboren. Die Lehr- und Wanderjahre ihres Theologiestudiums brachten sie von Münster über Tübingen, Heidelberg und Jerusalem schließlich nach Berlin. Nach einer Zwischenstation als Journalistin (u.a. für den Tagesspiegel und den Sender Freies Berlin) kehrte sie nach Nordrhein-Westfalen zurück und arbeitet heute als Pfarrerin in der Öffentlichkeitsarbeit in der evangelischen Gemeinde Dortmund.
Bei dotbooks veröffentlichte Anne-Kathrin Koppetsch in ihrer Reihe um Martha Gerlach auch:»Der Tote im Keller – Der erste Fall«»Die Sündenmeile – Der zweite Fall«
Weiterhin veröffentlichte Anne-Kathrin Koppetsch bei dotbooks ihren Liebesroman »Ein Pfarrhaus zum Verlieben«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »Tod im Stahlwerk« im Emons Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2015 Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Oleg Gekman / Matt Gibson / jedamus / eWerk / Andrey tiyk
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-385-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der tote Kumpel« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne-Kathrin Koppetsch
Der tote Kumpel
Ein Fall für die Pastorin
dotbooks.
Aller Humor fängt damit an,
dass man die eigene Person nicht mehr ernst nimmt.
Hermann Hesse
Dieser Sommer
Die Amerikaner machten das Rennen um die erste Mondlandung. Politiker warben um Stimmen für den künftigen Kanzler und wollten ein modernes Deutschland schaffen.
Die siebziger Jahre standen vor der Tür.
Die Zeichen standen auf Zukunft.
Das Leben in unserer Siedlung am Rand der Dortmunder Innenstadt blieb davon scheinbar unberührt. Sonne, Leichtigkeit und Musik trugen mich durch die Tage. Silbrige Töne in der Stunde des Pan, wenn ich mich nach dem Mittagsläuten auf dem Rad den Berg hinunterrollen ließ und Kurs auf die Kleingartenanlage nahm. Sooft ich konnte, verbrachte ich die Mittagspause im Schrebergarten der Küsterfamilie, den ich mit nutzte. Von Weitem schon hörte ich das Jauchzen der Kinder, die in mit Wasser gefüllten Wannen und Eimern planschten.
»Freddy«, dachte ich dann. »Ob Freddy heute wieder spielt?« Wie der Hirtengott persönlich saß er am Ufer der Emscher und verzauberte die Umgebung mit seiner Flöte. Hingebungsvoll lauschte ich, wenn er mit seinen weichen Lippen dem Instrument magische Weisen entlockte. Manchmal wehte eine Prise Abwasserdunst aus der »Köttelbecke« herbei, wie die Emscher im Volksmund hieß. An einem heißen Tag in diesem Sommer, als es besonders übel stank, hatte ich in Freddys rechtem Mundwinkel ein Grübchen entdeckt. Die strohblonden Haare über den starken Brauen waren zerzaust, die Augen blitzten, als unsere Blicke sich trafen.
Beim Klang seiner Flöte fühlte ich mich wie auf einer Insel außerhalb von Raum und Zeit, schaute den federleichten, winzigen Wolken zu, die an den blauen Himmel getupft waren. Bachs meisterhaft gespielte Partita brachte die Welt zum Leuchten, selbst im Kohlenpott, wo die Luft immer noch zu dreckig und die Häuserfassaden zu düster waren. Zur Mozart-Arie begannen meine Gedanken zu hüpfen, lösten sich vom Boden und schwebten davon. Vergessen waren mein Beruf und meine Stellung. Verdrängt der Gedanke an die nächste Predigt oder die nächste Beerdigung.
Wenn Freddy nicht spielte, schwiegen wir meist. Manchmal redeten wir auch, und ich, die Pastorin, hielt das Gespräch bewusst neutral. Einmal fragte ich meinen ehemaligen Konfirmanden nach seinen Zukunftsplänen.
Lehrer solle er werden, das sei etwas Rechtes. Eine sichere Laufbahn als Beamter. Finanzielles Auskommen, bescheidener Wohlstand nach der entbehrungsreichen Zeit, die er und seine Mutter nach der Scheidung durchgemacht hatten.
Seine raue Stimme ließ die Sprechweise des erwachsenen Mannes bereits ahnen. Doch noch bröckelte sie an den Satzenden, zeigte Spuren des gerade erst überstandenen Stimmbruchs. Sein Gesicht war glatt. Ob er sich rasierte?
»Was würdest du selbst denn gerne machen, Freddy?«
»Musik. Am liebsten nur Musik, Fräulein Gerlach. Musik ist mein Leben«, sagte er mit kindlich anmutendem Ernst.
Wieder setzte er die Flöte an den Mund, spielte eine Tonleiter, die sich in gebrochene Akkorde verwandelte und schließlich in ein heiteres Sommerlied mündete.
»Wann bist du mit der Schule fertig, Freddy?«
»Ich wurde gerade in die Oberprima versetzt. Einmal bin ich hängen geblieben. Ich bin jetzt neunzehn.«
Also zwölf Jahre jünger als ich mit meinen einunddreißig Jahren. Ob ihm das bewusst war?
Nach dem Spiel baute Freddy seine Flöte sorgfältig auseinander und verstaute die Einzelteile in einer roten Stofftasche. Dann erhob er sich, verbeugte sich knapp und ging davon. Flink marschierte er den trockenen Uferweg entlang, kehrte zurück in die düstere, kasernenartige Siedlung am Emscherufer, die »Negerdorf« genannt wurde, weil die Zechenarbeiter früher ungewaschen und mit schwarzer Haut nach Hause gehen mussten. Ich stieg aufs Rad und kämpfte mich den Berg hinauf, zurück in meinen Gemeindealltag, beflügelt von der Vorfreude auf das nächste Treffen. Nicht nur die Welt um mich herum leuchtete. Auch ich strahlte. Dass ich mich modisch und bunt kleidete, fiel selbst meiner Freundin und Amtsschwester Rosi auf. »Bist du verliebt?«, fragte sie neugierig. »Doch nicht etwa in den Reporter? Diesen Windhund Luschinski?« Ich lachte nur.
Dann neigte sich der Sommer dem Ende zu. Von einem Tag auf den anderen blieb Freddy weg.
Sehnsüchtig hielt ich Ausschau nach ihm, wenn ich das Fahrrad über den holprigen Weg entlang der Emscher schob. Enttäuscht lenkte ich meine Schritte weiter zum Schrebergarten des Küsters. Noch immer bevölkerten Familien die Kleingärten, doch das Wetter war umgeschlagen und wurde wechselhaft. In der Ferne vernahm ich den Verkehrslärm der Bundesstraße.
Freddy kam nicht wieder.
Der Zauber war vorbei, verflogen wie die frühen Nebelschwaden in diesen Tagen zwischen Sommer und Herbst.
Statt der Flötentöne krochen die Klänge eines Transistorradios in mein Ohr. »Anuschka! Liebe braucht die ganze Welt …«
Da wusste ich, dass das Lied dieses Sommers verklungen war. Endgültig.
Kapitel 1
»Stunk bei Hoesch! Die Arbeiter wollen mehr Lohn.«
Schwungvoll warf der Reporter seine Ledertasche auf einen freien Stuhl und schüttelte die Tropfen aus den halblangen Haaren.
»Wahrscheinlich gibt’s Streik.«
»Du bist zu spät, Luschinski!« Vorwurfsvoll sah ich auf meine Armbanduhr. »Wieder einmal!« Die letzte Viertelstunde hatte ich an meiner Bluna-Limonade genippt und zugesehen, wie Monika mit den Männern am Tresen scherzte. Ein Pärchen am Nebentisch schwieg sich an. Abgesehen davon war der karge Raum leer an diesem Abend des ersten September. Das Vereinsheim einer Kleingartenanlage war nicht der romantischste Ort für ein Stelldichein, doch Romantik war ohnehin nicht Luschinskis starke Seite.
Der Reporter gab Monika ein Zeichen, und kurz darauf stand ein frisch Gezapftes auf dem blank gescheuerten Holztisch. »Nicht böse sein, Martha!« Er zwinkerte mir zu. »Musste dem Vorstand von Hoesch auflauern und ihn nach seiner Meinung fragen.«
Wieder einmal verzieh ich ihm, schließlich waren wir Schicksalsgenossen. Meine Dienstzeiten richteten sich ebenfalls nicht nach der Stechuhr.
»Du bist die erste Gemeindepastorin in Dortmund, Martha«, betonte meine Freundin und Amtsschwester Rosi gerne. »Fräulein Pastor Martha Gerlach in Amt und Würden.«
Mehr noch als meine ungeregelten Arbeitszeiten störte mich die Zölibatsklausel. Bei einer Eheschließung musste ich meinen Dienst als Pastorin aufgeben. So wollten es die Kirchengesetze selbst im Jahr des Herrn 1969, das wir mittlerweile schrieben.
Ich verfluchte diese Regelung, bescherte sie mir doch einsame Abende und lange Nächte.
»Eine Gemeinde haben und gleichzeitig Familie? Wie stellst du dir das vor?« Rosi machte keinen Hehl aus ihrer Skepsis, wenn ich ihr von meiner Sehnsucht nach einem Gefährten erzählte. »Außerdem hast du den Richtigen bisher nicht gefunden.« Luschinski, einen eingefleischten Junggesellen, hielt sie nicht für einen geeigneten Bewerber.
Den Reporter focht das nicht an. Fröhlich erzählte er von den aufgebrachten Arbeitern, die nach einem heißen Sommer im Walzwerk mehr Lohn forderten. »Eine Erhöhung um zwanzig Pfennig die Stunde!« Nicht einmal die Gewerkschaft glaubte daran. Der Vorstand war bereit, fünfzehn Pfennig mehr zu zahlen, jedoch erst bei der nächsten Tariferhöhung. »Aber dieses Mal lassen die Stahlkocher nicht locker. Sie sind wild entschlossen!« Luschinski wischte sich den Bierschaum vom Mund und dozierte über die ungleiche Behandlung in den Hoesch-Werken seit der Zusammenlegung mit der Hüttenunion im Jahr 1966 und über die Umstellung von Leistungslohn auf Zeitlohn. »Du weißt schon, kein Zuschlag mehr für den Akkord.«
Ich gähnte, ohne die Hand vor den Mund zu halten.
»Langweile ich dich, Martha?«
»Ich erzähle auch nicht stundenlang von Kanzeldienst und Konfirmandenunterricht!«
Luschinski strich mir über die Wange. »Der Streik betrifft Tausende oder Zehntausende! Übrigens auch deine Schäfchen!« Er zwinkerte, weil er wusste, dass es mir missfiel, wenn er die Gemeindemitglieder als Wolle tragende Herdentiere bezeichnete. »Die Stahlhütte steht doch fast vor eurer Kirchentür!«
Der Mann am Nebentisch warf eine Münze in die Musikbox. »Anuschka«, ertönte der Schlager dieses Sommers. »Anuschka, Liebe braucht die ganze Welt …« Die Schwermut der russisch anmutenden Melodie übermittelte sich selbst durch den scheppernden Lautsprecher.
Luschinski winkte der Bedienung. »Ich muss wieder los!« Er legte ein Fünf-Mark-Stück auf den Tisch. »Stimmt so, Monika!«
Beim Herausgehen stieß ich mir das Knie an der roten Mütze eines Gartenzwergs. »Aua!«
»Heile, heile Segen!«, spottete Luschinski und bot an: »Kann ich dich mitnehmen?« Sein Käfer, von ähnlicher Farbe wie die Zipfelmütze, stand vor dem Eingang. Dass man dort nicht parken durfte, interessierte den rasenden Reporter nicht.
»Danke. Ich bin mit dem Fahrrad hier.«
»Fahr vorsichtig. Es ist dunkel.«
»Ich habe vorne eine Lampe. Wann sehen wir uns wieder?«
»Weiß noch nicht.«
»Aha. Bist du wieder einer heißen Geschichte auf der Spur?«
Er legte mir kurz den Arm um die Schultern und zwinkerte mir zu: »Aber immer doch, Martha-Schätzchen!«
Es ging bereits auf halb neun Uhr zu, als ich die Tür meines Pfarrhauses aufschloss.
Ich öffnete das Fenster zum Westpark mit seinen hohen, alten Bäumen. Aus dem Park schollen Stimmen. Nachts trieb sich dort allerlei Gesindel herum: Gammler, Tippelbrüder und, wie man munkelte, neuerdings sogar Rauschgifthändler.
Was Freddy wohl machte? Vor einigen Tagen hatte ich ihn bei uns in der Gemeinde gesehen, in der Jugendgruppe meines Kollegen. Er unterhielt sich angeregt mit einem blonden jungen Mädchen, das sehr nah bei ihm stand. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Es versetzte mir einen Stich, dass er die Gleichaltrige mir vorzog. Kurz trafen sich unsere Blicke, aber er schaute so schnell wieder weg, als hätte ihn der Blitz getroffen.
Ich schloss das Fenster und nahm auf dem Sessel Platz. Wie schön wäre es, in eine warme, erleuchtete Wohnung zu kommen. Mein neuer Kollege aß wohl gerade mit seiner Frau zu Abend, und sie erzählten sich gegenseitig, was sie an diesem Tag erlebt hatten. Trautes Heim, Glück allein.
Nur ich lebte wie eine Einsiedlerin.
Während ich Kleidung für die Wäsche aussortierte und ein Kostüm für die Reinigung heraushängte, überlegte ich, ob tatsächlich ein Streik bevorstand. Viele Gemeindemitglieder arbeiteten bei Hoesch. Die meisten waren zufrieden. Der Stahlriese galt als sozial und räumte den Arbeitern Mitbestimmungsrechte ein, so hörte ich immer wieder bei meinen Hausbesuchen. Umso erstaunlicher erschien mir der angekündigte Arbeitskampf.
Doch Luschinski verfügte über zuverlässige Quellen. Wenn er behauptete, dass die Zeichen auf Sturm standen, dann stimmte es wohl.
Bereits am nächsten Tag war es so weit.
»Wilder Streik bei Hoesch«, sagte ein Sprecher im Radio. »Tausende von Arbeitern befinden sich seit heute Morgen im Ausstand. Allein dreitausend streiken auf der Westfalenhütte in Dortmund!« Während der Frühstückspause um neun Uhr waren sie zur Hauptverwaltung gelaufen.
Dreißig Pfennig mehr pro Stunde forderten die Arbeiter nun. Ich versuchte, die Summe hochzurechnen auf den Monatslohn, doch ich kam zu keinem Ergebnis. Ein Liter Benzin kostete weniger als sechzig Pfennig, doch ein Glas Nescafé schlug mit neun Mark achtundneunzig zu Buche. Für eine kleine Schachtel Camembert mussten dreiundneunzig Pfennig auf die Ladentheke gelegt werden.
Während im Mittagsmagazin berichtet wurde, schälte ich Kartoffeln und setzte einen Topf mit Wasser auf den Elektroherd. Den Kohleofen neben der Spüle, einen Küppersbusch, nutzte ich kaum noch.
Nun wurde über eine Ausweitung des Streiks spekuliert. »Fünfzehn Pfennig sind ein Witz!«, empörte sich ein Sprecher. »Die da oben können nicht machen, was sie wollen!« Mittlerweile belagerten immer mehr Arbeiter die Hauptverwaltung und trommelten mit den Schutzhelmen gegen das Treppengeländer.
Die Kartoffeln waren halb gar. Ich nahm einen Ring Fleischwurst aus dem Kühlschrank, schnitt ihn in dicke Scheiben, die ich panierte. Ungeduldig blickte ich auf die Küchenuhr. Schon sieben nach eins. Rosi, die sich zum Mittagessen angekündigt hatte, verspätete sich selten, doch heute ließ sie auf sich warten. Ich nahm die Pfanne vom Herd und deckte den Kartoffeltopf mit einem Handtuch zu. Mit erzwungener Ruhe zählte ich die Blumen auf der verblichenen Tapete, die ich längst hatte auswechseln wollen.
Endlich, um kurz nach halb zwei, klingelte es.
»Entschuldige«, sagte Rosi, als sie die Wohnung betrat. Sie war noch ganz außer Atem. »Ich bin von einer alten Dame aufgehalten worden. Sie war ganz aufgeregt wegen des Streiks!« Rosi arbeitete als Pastorin in einem Altersheim.
»Bei Hoesch?«
»Du weißt Bescheid?«
»Das Radio berichtet schon den ganzen Tag.«
»Ihr Sohn ist einer der Vertrauensleute. Hier, bei dir um die Ecke, auf der Stahlhütte. Sie macht sich Sorgen, dass er entlassen wird. Sie ist auf seiner Seite. Meint, man müsse für seine Rechte kämpfen!«
»Und was hältst du davon?«
Rosi strich die kurz geschnittenen grauen Haare hinter das Ohr und streckte ihre langen Beine aus.
»Irgendwie kann ich’s verstehen. Sie malochen ohne Ende und können kaum ihre Familien ernähren.«
»Bist du unter die Sozis gegangen?«
Ich lud Kartoffeln, Wurst und Kohlrabi auf unsere Teller.
»Das Essen ist kalt geworden.«
Nach dem Tischgebet nahm Rosi den Faden wieder auf.
»Weißt du überhaupt, was ein Stahlkocher in der Lohntüte hat?«
»Nein. Wie viel?«
»Achthundert Mark im Monat, vielleicht neunhundert, wenn’s hochkommt, tausend!«
Ich verglich diese Summe mit meinen Bezügen, die deutlich im vierstelligen Bereich lagen, auch wenn sie niedriger waren als die des männlichen Kollegen.
»Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.«
Nach der Mahlzeit setzte ich Wasser für einen Bohnenkaffee auf. Durch das geöffnete Fenster hörten wir die Kinder im Westpark. Ein vorwitziges Eichhörnchen kletterte den Baumstamm hinauf und verschwand in der Baumkrone. »In The Ghetto«, klagte Elvis Presley aus dem Radio. Anschließend erklärte ein Sprecher, dass sich der Betriebsrat mit den streikenden Arbeitern solidarisiere und ihre Forderungen unterstütze.
»Endlich!«, seufzte Rosi und nahm sich einen Apfel aus der Obstschale. Statt hineinzubeißen, fragte sie: »Hast du ein Hümmelchen?«
»Hümmelchen?«
»Messer. Schälmesser. Sagt man so im Kohlenpott.«
Während sie die Apfelschale kunstvoll wie eine Girlande schnitzte, kündigte ein Rundfunksprecher den Betriebsrat Stankow an.
Stankow?
Diesen Namen hatte ich schon gehört.
Mir fiel nur nicht ein, bei welcher Gelegenheit.
Ich lehnte das Fahrrad an den Zaun. Das Gartentor knarrte beim Öffnen. Aus der Laube holte ich einen Lappen und wischte damit über die Holzbank. Ich nahm Platz zwischen Dahlien und Sonnenblumen, legte den Kopf in den Nacken und ließ meine Gedanken mit den Wolken treiben, die am Himmel vorbeizogen. In den benachbarten Gärten krakeelten Kinder und kickten Bälle gegen den Zaun.
Und über allem schwebten wieder silbrige Flötentöne: Ich versuchte, die Musik zu orten. Sie schien aus einem der Nachbargärten zu kommen, doch ich entdeckte den Spieler nicht. Mozarts »Königin der Nacht« entfaltete ihre Magie. War es Zufall, oder wusste Freddy, dass ich mich hier aufhielt?
Da begann es zu regnen, und die Töne verstummten. Ich suchte Schutz in der Hütte.
Noch bevor sich meine Augen an das Halbdunkel im Innern gewöhnt hatten, öffnete sich die Tür. Freddy kam herein, länger und schlaksiger, als ich ihn in Erinnerung hatte.
»Guten Tag, Freddy!«
Er ließ die Tür hinter sich zufallen.
»Tag, Martha«, sagte er rau, mit einer sehr dunklen Stimme, die nur noch wenig von dem unsicheren Jungen spüren ließ. Nie zuvor hatte er mich mit Vornamen angeredet. Seine Augen, umrahmt von langen Wimpern, glänzten im schwachen Licht.
Er näherte sich mir bis auf Armlänge.
»Wir haben uns lange nicht gesehen«, stammelte ich.
»Ich weiß«, flüsterte er.
So standen wir uns gegenüber, während der Regen auf das Blechdach trommelte. Ich spürte seinen Atem, der nach Waldboden mit einer Prise von Pfefferminz duftete.
Er war größer als ich, und so hob ich den Kopf, während er seinen senkte. Unsere Nasenspitzen berührten sich. Ich verharrte. Dann hob ich meine herabhängenden Arme, legte ihm die Hände auf die Schultern, schob sie weiter hinter die Schulterblätter und ließ sie langsam den Rücken hinuntergleiten.
Sein Atem beschleunigte sich, vermischte sich mit meinem. Meine Stirn fand für einen Augenblick Halt in seiner Halsmulde. Ich schaute auf, und in diesem Moment wandte er mir sein Gesicht zu. Unsere Lippen fanden sich, sanft und zärtlich. Der Kuss löste einen Schwindel bei mir aus, seine Arme umfingen mich. Später ließen wir uns auf einer Couch nieder, die muffig roch. Nicht einmal das störte mich. Ich schloss die Augen und gab mich dem Moment hin, gleichgültig, was daraus werden würde.
Unverhofft löste er sich und sagte scharf: »Nein!«
»Was hast du, Freddy?« Ich strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Er hatte die Lippen aufeinandergepresst. Die Augen starr auf mich gerichtet, schien er durch mich hindurchzublicken.
Ich erschrak über die Härte in seiner Miene.
»Das dürfen wir nicht! Das darf nicht sein …«, rief er mit metallisch klingender Stimme. »Nein, das dürfen wir nicht … Das ist Unzucht!« Es klang trotzig und unsicher zugleich. Nun kam wieder der kleine Junge zum Vorschein. Ehe ich michs versah, sprang er auf, öffnete die Tür und rannte hinaus in den Regen.
Verstört blieb ich zurück.
Neben der Couch lag die rote Stofftasche. Sie war leer.
Ich hielt sie an mein Gesicht. Sie roch nach einer Mischung aus Schweiß, getragener Kleidung und Grasboden.
Wie Freddy.
Kapitel 2
Am nächsten Tag entdeckte ich, dass an meinem neuen roten Mantel ein Knopf fehlte. Ich machte mich auf den Weg in die Innenstadt, um bei Hertie in der Kurzwarenabteilung nach Ersatz zu suchen. Zu meinem Bedauern gab es diese Sorte nicht; ich musste mich mit etwas Ähnlichem begnügen. Anschließend gönnte ich mir ein Kännchen Kaffee in der Innenstadt.
Als ich den Rückweg antreten wollte, füllten sich die Straßen mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Arbeitern in Blaumännern. »Dreißig Pfennig je Stunde! Dreißig Pfennig je Stunde!«, riefen sie. Einige trugen Plakate. Passanten klatschten Beifall. »Die Männer haben recht«, sagte die Frau neben mir zufrieden. »Fette Dividenden und karge Löhne, das geht nicht! Jetzt kommen sie von der Stahlhütte und von der Westfalenhütte und treffen sich mitten in der Stadt.«
»Dreißig Pfennig je Stunde! Dreißig Pfennig je Stunde«, tönte es wieder gewaltig aus den Kehlen. Nun konnte auch ich die Schrift auf den Schildern entziffern. »Alle Räder stehen still, wenn der Arbeiter es will!« Immer mehr Männer strömten auf den Markt, fröhlich und laut. Nur wenige Frauen waren mit von der Partie, Freundinnen oder Ehefrauen, vermutete ich. »Harders muss weg! Harders muss weg!«, hörte man. »Der Vorstandsvorsitzende«, klärte mich die gut informierte Dame auf. »Der hat ihnen nichts gegönnt. Jahrelang! Jetzt wehren sie sich. Recht so!« Ein Sprecher versuchte, sich mit Hilfe eines Megafons verständlich zu machen. Wortfetzen drangen an mein Ohr: »Westfalenhütte … heißer Sommer … mehr Lohn sofort!« Vielstimmig schallte es herüber: »Harders raus … Ausbeuter!« Männer umarmten sich. Helme wurden hochgeworfen. Es war ein beeindruckendes Schauspiel.
»So ein Tag, so wunderschön wie heute!«, pfiff mein Kollege unmelodiös vor sich hin. Ernst Skendzik hieß er, und nicht nur wegen seines unaussprechlichen Namens duzte er sich mit allen. Seit einigen Monaten arbeitete er als Pfarrer in unserer Gemeinde. Er ersetzte Kruse, den alten Hagestolz, der sich mit Frauen im Pastorenamt nie hatte abfinden können. Nun hatte die Gemeinde mit dem jungen Kollegen ein modernes Gesicht erhalten.
»Wir haben dich gestern im Helferkreis vermisst«, sagte Ernst mit seiner warmen Bassstimme, die im Kontrast zu seiner schmächtigen Gestalt stand.
Ich schlug mir die Hand vor den Mund. »Den Helferkreis habe ich verpasst.« Lahm schob ich hinterher: »Es hat plötzlich gegossen, und ich musste mich unterstellen.« Das stimmte nur zum Teil. Tatsächlich war ich stundenlang im Regen umhergeirrt, Freddys rote Stofftasche an mich gedrückt, unfähig, nach unserer Begegnung einen klaren Gedanken zu fassen. Als ich zurück in meiner Wohnung war, vermisste ich die Stofftasche. Ich musste sie unterwegs verloren haben. Nachts hatte ich mich gewälzt, hin- und hergerissen zwischen süßer Sehnsucht und peinigender Reue. Freddy war minderjährig, und ich bekleidete ein verantwortliches Amt. Wie hatte das passieren können? In den frühen Morgenstunden war ich in einen unruhigen Schlaf gefallen, belastet von Alpträumen und düsteren Vorahnungen.
Der Kollege begann wieder zu pfeifen.
»Schön, dass du so fröhlich bist!«, fuhr ich ihn an. »Gibt es einen Grund?«
»Die Stahlkocher haben gewonnen! Nach der Demonstration hat der Vorstand Nerven gezeigt. Am Verwaltungsgebäude hing eine Stoffpuppe mit dem Namen des Vorsitzenden Dr. Harders!« Er grinste. »Die Hoesch-Manager haben nachgegeben. Dreißig Pfennig mehr in der Stunde! Ein schönes Ergebnis! Gerade eben wurde es im Radio bekannt gegeben. Jetzt haben sie die Arbeit wieder aufgenommen. Und sie feiern! ›So ein Tag, so wunderschön wie heute …‹«, intonierte er. Gesungen klang es besser als gepfiffen. »Hat sich ja angebahnt. Ich war einige Male auf der Hütte in den letzten Wochen, und da waren die Arbeiter sehr unzufrieden. Sie wollten mehr Lohn und fühlten sich vom Vorstand hingehalten. Aber dass es jetzt so schnell geht …« Er reichte mir ein Blatt. »Ich habe ein Grußwort der Kirchengemeinde verfasst, es wird gerade übermittelt. Willst du mal lesen?«
Ich überflog den getippten Text: »… erklären uns solidarisch … freuen uns mit der arbeitenden Bevölkerung über den Abschluss …«, las ich. »Müsste das Presbyterium dem nicht zustimmen? Die nächste Sitzung ist erst wieder in zwei Wochen.«
»Ach wo, das habe ich schon geregelt. Presbyter Rabenau steht dahinter und ein oder zwei andere ebenfalls. Das ist kein Problem.«
Ich runzelte die Stirn. Hätte er mich als dienstältere Pastorin nicht ebenfalls fragen sollen? Prüfend sah ich ihn an, einen gut aussehenden Mann mit dunklen halblangen Haaren und blassem Gesicht.
Im Büro klapperte unsere Schreibkraft auf der Maschine, einen Stift hinter das Ohr geklemmt, sodass ihr glänzender Bubikopf bestens zur Geltung kam.
Auch sie summte vor sich hin. »Mein Männe bekommt jetzt mehr Geld«, sagte sie freudig. »Wo wir uns doch bald was Kleines anschaffen wollen!«
Also würden wir uns wieder nach jemand Neuem umsehen müssen. Die vierte Bürokraft innerhalb von fünf Jahren.
Sie hackte weiter in die Tasten. Ernst klopfte ihr auf die Schulter und sagte: »Wird schon werden!«
Im Gemeindesaal waren die Tische eingedeckt. Ich nahm am Kopfende Platz und ließ mir Kaffee einschenken. »Uns hat damals auch keiner was geschenkt, nach dem Krieg«, meinte Hildchen Kruse, die Leiterin der Frauenhilfe, und reichte mir die Büchsenmilch. »Wir mussten uns alle nach der Decke strecken.«
»Ach«, erwiderte ihre Nachbarin und schaute bedächtig auf die vielen Ringe an ihrer Hand, »ich sach immer: leben und leben lassen, was?«
Abends klingelte es Sturm. Ich öffnete das Toilettenfenster, wie ich es mir zum Schutz vor unliebsamen Besuchern angewöhnt hatte, und rief »Wer ist da?«
»Martha, mach auf!«
»Luschinski?«
»Hier brauch wer Hilfe!« Es klang so undeutlich, als hätte der Reporter ordentlich getankt.
»Ich komme!«
Unten lehnte jemand an der Mauer. Ich kannte ihn nicht. Im schwachen Licht sah ich, dass er einen Blaumann trug. Der Mann hatte Schlagseite. Seine Alkoholfahne konnte ich riechen, noch bevor ich aus der Tür getreten war.
»Der hat einen überfahren!«, sagte Luschinski und zeigte mit dem Kopf in seine Richtung.
Kein Wunder in diesem Zustand, dachte ich.
»Mit dem Auto?«
»Nee, mitm Zug«, sagte der Mann mit hängendem Kopf.
»Wie ist denn das passiert?«, fragte ich. Der Mann war in sich zusammengesunken und gab keinen Ton von sich.
»Haben Sie mich verstanden?«, hakte ich nach.
»Is passiert.«
»Der ist Lokführer auffe Stahlhütte. Nachm Streik haben die Stahlkocher den Abschluss gefeiert. Haben sich einen verlötet, du weiß schon«, erklärte Luschinski. »Dann wollt er noch schnell die Ladung wegbringen und ist los mit der Diesellok. Hat einen platt gefahren.«
»Was heißt das? Gibt es Tote?«
»’n Jungen. Lag auffe Gleise. Konnt nich mehr bremsen.« Luschinski bekam Schluckauf. »Muss jetzt los, Martha. Der wohnt nebenan, bring ihn nach Hause! Erklär’s der Frau!« Ungeschickt klopfte er mir auf die Schulter. »Du machs das schon, Martha!«
»Warte! Wen hat er überfahren?«
»Den Sohn von irgendwem. Von einem bei Hoesch, Betriebsrat. Stankow oder so!«
»Stankow?«, fragte ich, mehr an mich selbst gerichtet. Jetzt fiel es mir wieder ein.
Freddy hieß mit Nachnamen Stankow.
Mein Herz klopfte, und ich spürte meine Hände feucht werden. »Herr Jesus! Lass es nicht Freddy gewesen sein!«, sandte ich ein Gebet zum Himmel. »Alles, nur das nicht!«
Vor meinem geistigen Auge erschien der große junge Mann mit den hellen Haaren, dem sensiblen Mund und dem virtuosen Flötenspiel.
Und nun sollte er tot sein?
Hatte ihn der Volltrunkene vor meinem Haus auf dem Gewissen?
Angeekelt sah ich, wie er sich übergab. Das Erbrochene lief zähflüssig an der Wand hinunter.
»Luschinski!«, brüllte ich wütend, doch der Reporter war bereits verschwunden.
Der Betrunkene richtete sich auf. Eine säuerlich riechende Wolke wehte zu mir herüber.
»’tschuldigung!«, nuschelte er und wischte sich mit der Hand über den Mund.
Mir drehte sich der Magen um. Hilflos, wie er war, konnte ich den Mann nicht einfach stehen lassen.
»Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie?«
»Bönke. Gestatten, Bönke!«, sagte er in dem verspäteten Versuch, die Form zu wahren.
»Wohin müssen Sie?«
Statt einer Antwort wankte er aus dem Eingang hinaus und wandte sich nach rechts. Widerwillig folgte ich ihm. Zwei Häuser weiter blieb er vor der Tür stehen.
»Wohnen Sie hier?«
»Jau.« Hilfesuchend sah er mich an.
In der Dunkelheit konnte ich die Namen auf den Klingelschildern nicht entziffern.
»Haben Sie einen Schlüssel dabei?«
Er kramte in der Hosentasche. »Find keinen.«
»Welche Klingel?«
»Unten.«
»Rechts oder links?«
»Weiß nich!«
Rechts unten stand ein kürzerer Name. Ich drückte auf den Knopf. Nichts regte sich. Beim zweiten Versuch ertönte der Türsummer. Wir betraten den Hausflur. Die rechte Wohnungstür stand einen Spaltbreit offen.
»Frau Bönke? Ich bringe Ihren Mann.«
In der Tür erschien eine kleine Frau mit platt gedrückter Lockenfrisur, deren Kittelschürze Flecken aufwies.
»Hermann! Wo kommst du jetzt her!«, schalt sie. »Und betrunken biste auch noch. Schon wieder!«
Endlich nahm sie Notiz von mir. »Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier?«
»Es hat einen Unfall gegeben«, berichtete ich. »Ihr Mann hat einen jungen Mann überfahren. Mit der Lok.«
Kapitel 3
»Halt! Wo wollen Sie hin? Haben Sie einen Passierschein?«, rief mir der Pförtner zu.
»Braucht man so etwas?« Ich war davon ausgegangen, dass der Zutritt zum Gelände des Stahlwerks an der Rheinischen Straße frei war. Hatte ich hier nicht schon Dutzende von Menschen ein und aus gehen sehen?
»Selbstverständlich brauchen Sie einen Passierschein.« Er ließ die Hosenträger schnalzen, die über das ehemals weiße Hemd gespannt waren. Sein Sakko hing über der Stuhllehne.
»Welchen Namen darf ich eintragen?«
»Martha Gerlach.«
»Zu wem wollen Sie?«
»Zu Herrn Stankow«, sagte ich auf gut Glück. »Dem Betriebsrat. Ist er im Haus?« Meines Wissens arbeitete Stankow auf der Stahlhütte und nicht auf der Westfalenhütte im Norden. Im Norden die Horden, schoss es mir durch den Kopf. Nach einer schlaflosen Nacht wollte ich mir Gewissheit verschaffen. War Freddy das Opfer? Und falls es so war, wusste der Vater bereits davon?
»Mal sehen.«
Ich betrachtete die Anzeigetafel am Werkstor. Der Konzern stellte ein. Hoesch suchte Betriebsschlosser, Fräser, Walzwerksarbeiter, Former, Radio- und Fernsehmechaniker, Rangierer, Hochofenarbeiter.
Die Stahlbranche schien zu florieren.
Während der Pförtner noch in seinem Telefonbuch blätterte, hielt ein Streifenwagen vor der Schranke.
Zwei Männer in Uniform sprangen heraus. »Tach!«, sagte der größere der beiden. »Hat Meldung über einen Unfall hier gegeben!«