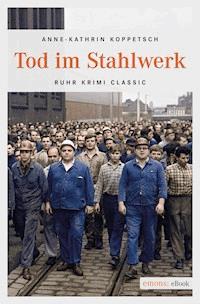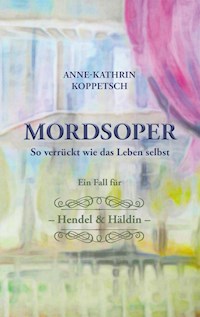Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martha Gerlach
- Sprache: Deutsch
Wo ein Schatten fällt, da ist irgendwo ein Licht: Der atmosphärische Krimi »Die Sündenmeile« von Anne-Kathrin Koppetsch als eBook bei dotbooks. Dortmund, 1968: Der Liter Benzin kostet nur wenige Pfennig, die Amis wollen einen Mann zum Mond schicken und selbst im Ruhrgebiet kommen die ›Swinging Sixties‹ langsam in Gang … Doch die Pastorin Martha Gerlach hat auf einmal ganz andere Sorgen: Eines Abends findet sie in ihrer eigenen Kirche ein Findelkind, nur kurze Zeit später wird unweit der Gemeinde eine Frauenleiche aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Kurz entschlossen beginnt Martha Gerlach auf eigene Faust zu ermitteln und muss einmal mehr beweisen, dass sich die Frau Pastorin für nichts zu schade ist – denn sie folgt der Spur bis in die berüchtigtste Ecke der Stadt, in den Abgrund des Rotlichtmillieus … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Krimi »Die Sündenmeile« von Anne-Kathrin Koppetsch – der zweite Fall für die Pfarrerin Martha Gerlach. Alle Titel der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Dortmund, 1968: Der Liter Benzin kostet nur wenige Pfennig, die Amis wollen einen Mann zum Mond schicken und selbst im Ruhrgebiet kommen die ›Swinging Sixties‹ langsam in Gang … Doch die Pastorin Martha Gerlach hat auf einmal ganz andere Sorgen: Eines Abends findet sie in ihrer eigenen Kirche ein Findelkind, nur kurze Zeit später wird unweit der Gemeinde eine Frauenleiche aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Kurz entschlossen beginnt Martha Gerlach auf eigene Faust zu ermitteln und muss einmal mehr beweisen, dass sich die Frau Pastorin für nichts zu schade ist – denn sie folgt der Spur bis in die berüchtigtste Ecke der Stadt, in den Abgrund des Rotlichtmillieus …
Über die Autorin:
Anne-Kathrin Koppetsch wurde 1963 im Sauerland geboren. Die Lehr- und Wanderjahre ihres Theologiestudiums brachten sie von Münster über Tübingen, Heidelberg und Jerusalem schließlich nach Berlin. Nach einer Zwischenstation als Journalistin (u.a. für den Tagesspiegel und den Sender Freies Berlin) kehrte sie nach Nordrhein-Westfalen zurück und arbeitet heute als Pfarrerin in der Öffentlichkeitsarbeit in der evangelischen Gemeinde Dortmund.
Bei dotbooks veröffentlichte Anne-Kathrin Koppetsch ihre Cosy-Krimi-Reihe rund um die ermittelnde Pfarrerin Martha Gerlach:»Der Tote im Keller«»Die Sündenmeile«»Der tote Kumpel«
Weiterhin veröffentlichte Anne-Kathrin Koppetsch bei dotbooks ihren Liebesroman »Ein Pfarrhaus zum Verlieben«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Dieses Buch erschien bereits 2013 unter dem Titel »Linienstraße« im Emons Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2013 Hermann-Josef Emons Verlag
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Oleg Gekman / Christian Mueller / Bruno Passigatti / Manninx
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-384-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sündenmeile« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Anne-Kathrin Koppetsch
Die Sündenmeile
Ein Fall für die Pastorin
dotbooks.
Meinen wunderbaren Freundinnen
Prolog
Sie löste sich aus dem Schutz der Hauswand und huschte über die Straße, ein Schatten in der Dämmerung. Instinktiv drückte sie das Bündel fester an sich. Mit einem Blick über die Schulter vergewisserte sie sich, dass ihr niemand gefolgt war.
Ob die Kirche offen war? Sie legte die Hand an den Griff und drückte die Tür nach innen auf. Langsam schob sie sich in das Gebäude hinein. Das dick eingepackte kleine Wesen in der Mulde zwischen ihrem Kinn und dem Schlüsselbein regte sich. »Ruhig. Nicht schreien!«, flüsterte sie in den Raum des Köpfchens. Sie blieb für einen Moment stehen. Dann ließ sie vorsichtig ihre Sohlen über die Steinfliesen gleiten, tastete sich in dem großen unbeleuchteten Innenraum an den Bänken entlang nach vorne. Nichts knarrte in dem modernen Gebäude, das erst vor wenigen Jahren eingeweiht worden war. Es roch frisch und neu. Angst, Hoffnung und Gebete hatten noch keine Patina auf den Wänden hinterlassen.
Sie konzentrierte sich auf ihre Schritte, versuchte, nicht daran zu denken, was sie als Nächstes tun würde. Tun musste. Ihr blieb keine Wahl. Sie wollte, dass das Kind lebte. Ihr kleiner Junge, dem sie keinen Namen geben wollte und den sie doch unwillkürlich Peter nannte. Peter, ihr ungetaufter Sohn.
Von alters her suchten Flüchtige und Bedrohte, Verfolgte und Verbrecher Schutz in Gotteshäusern. Und hierher brachte sie nun ein kleines, hilfloses Kind, das sie selbst nicht beschützen konnte.
Sie hatte die Stufen, die zum Altar führten, erreicht. Linker Hand stand der Taufstein, nur schemenhaft erkennbar. Probeweise legte sie das Bündel dort ab und versuchte sich vorzustellen, es wäre eine Ladung schmutziger Wäsche. Dann ließ sie los und wandte sich ab. In diesem Moment fing der Kleine zu schreien an. »Pscht!«, fauchte sie zornig, weil ihr Bild vom Wäschebündel damit abrupt zerstört war. Das Kind beruhigte sich erst, als sie es wieder hochnahm. Durch das fahle Licht von außen erkannte sie schemenhaft die Umrisse des Kreuzes über dem Altar. »Hilf, Herr Jesus!«, flehte sie.
Hinten hörte sie die Tür klappen. Sie hielt den Atem an. Glücklicherweise hielt Peter still, als spürte er, dass es in diesem Moment darauf ankam, nicht entdeckt zu werden. Sie duckte sich hinter den Taufstein. Einen Augenblick lang fürchtete sie, das Licht würde aufflammen und sie enttarnen. Doch es blieb finster. Kurz darauf hörte sie, wie die Tür wieder ins Schloss fiel.
Ein Würgereiz stieg ihr in die Kehle, Tränen, die sie sich nicht gestattete. »Es muss sein!«, sagte sie streng. »Ich muss dich jetzt hierlassen. Ich kann dir nicht helfen.« Vielleicht war das Taufbecken doch zu unsicher. Besser, sie legte das Kind auf dem Boden ab. Dann konnte es nicht herunterfallen.
»Gleich kommen sie. Dann nehmen sie dich mit. Du wirst schon sehen, du wirst ein feines neues Zuhause finden. Du wirst es gut haben!« Sie schluckte. Nein, sie hatte dieses Kind nicht gewollt, nicht gerade dann, als sie gehofft hatte, ein neues Leben beginnen zu können. Sie hatte versucht, sich unter die Frauen in der Siedlung zu mischen, eine von ihnen zu werden. Die Schwangerschaft, ein Vermächtnis aus der Vergangenheit, hatte diese Illusion zerstört. Als sie sie entdeckte, war sie bereits im vierten Monat. Zu spät für alles. Damit war ihr Schicksal besiegelt. »Guter Hoffnung sein!« – welch ein Hohn. Ihr Leben war hoffnungslos und wurde immer hoffnungsloser. Sie hatte versucht, ihren Zustand zu verbergen, und soweit sie beurteilen konnte, war es ihr gelungen. Das Kind kam leicht, fast wie von selbst, zur Welt.
Das Kind: ein Störfaktor. Sie hatte damit gerechnet, es zu hassen. Stattdessen regte sich ihr Beschützerinstinkt. Sie träumte davon, das Kind zu nehmen und zu verschwinden, irgendwohin, wo niemand sie finden würde. Doch das war illusorisch. Hinter ihr lag eine quälende Vergangenheit und vor ihr eine ungewisse Zukunft.
Sie bückte sich vor dem Altar und legte das Kind auf dem Boden ab, sorgfältig auf die Decke gebettet. Sobald sie losließ, fing der Kleine wieder an zu schreien. »Hör auf!« Das Baby verstummte. Sie hob den Blick ein letztes Mal zu dem schlichten Kreuz an der Wand. »Herr Jesus, beschütze mein Kind!«
Dann lief sie, so schnell es in der dunklen Kirche möglich war, zur Tür, begleitet von dem verzweifelten Geheul des Babys.
Wie von Sinnen rannte sie durch die Siedlung. Jetzt war alles egal. Der Junge war weg. Sie konnte nichts mehr für ihn tun.
Sie konnte nur versuchen, ihre eigene Haut zu retten.
Kapitel 1
»Macht hoch die Tür, die Tor macht weit!«, scholl der Gesang hell und kräftig durch den Saal. Mir verschaffte das Lied fünf Minuten Atempause inmitten der Alltagshektik. Advent, das bedeutete Hochsaison, Dutzende von Predigten zu schreiben und ungezählte Andachten zu halten. Ich verdrängte den Gedanken an die Weihnachtsgottesdienste, die ich noch vorzubereiten hatte, und lehnte mich zurück. »Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr!«, beendeten die Frauen die fünfte Strophe. Schwester Tabea klopfte die letzten Akkorde so energisch in die Klaviertasten, dass ihr weiß gestärktes Häubchen wippte. Als sie zu ihrem Platz ging, knarrten die Holzdielen unter ihren schmalen Füßen.
Hildchen Kruse erhob sich und blickte über die mit Tannenzweigen dekorierten Tische. In dem runden Gesicht unter der sauren Dauerwelle, unverkennbar gestaltet von Friseur Hanke an der Ecke, umspielte ein freundliches Lächeln die Lippen. »Fräulein Pastor Gerlach wird nun zu uns sprechen«, kündigte sie an und nickte mir zu: »Martha, du darfst beginnen!«
Ich erhob mich, strich den Rock meines anthrazitfarbenen Kostüms glatt und schlug die Bibel auf. »Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären«, las ich aus dem Buch des Propheten Jesaja. Während ich zum wiederholten Mal den altbekannten Vers auslegte, schweiften die Gedanken zurück zu meiner Anfangszeit in dieser Kirchengemeinde am Rande der Dortmunder Innenstadt. Damals hatte mir mein Kollege Kruse, ein entschiedener Gegner von Frauen auf der Kanzel, das Leben schwer gemacht.
Mittlerweile schrieben wir das Jahr 1968, ich war seit mehr als drei Jahren in der Gemeinde tätig. Mit Schrecken hatte ich am Morgen, als ich mir die Haare kämmte und aufsteckte, einige silbergraue Haare unter den vielen braunen entdeckt. Der Schmelz der Jugend war dahin. Doch auch in der Gesellschaft war die Zeit nicht stehen geblieben. Frauen standen selbstverständlich überall im Beruf ihren Mann. Selbst ein Ewiggestriger wie Pastor Kruse musste das allmählich einsehen. Außerdem ging ich, seitdem seine Frau Hilde die Frauenhilfe leitete, bei dem Ehepaar ein und aus. So war der Widerstand des altgedienten Pastors spürbar erlahmt. Die ein oder andere spitze Bemerkung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er insgeheim froh über meine Unterstützung war, insbesondere seit dem tragischen Tod unseres Kollegen Hanning. »Hunde, die bellen, beißen nicht«, pflegte meine Freundin und Amtsschwester Rosi zu sagen. »Du regst dich doch über Kruses Bemerkungen nicht mehr auf, oder? Sie wirken nur noch peinlich.«
Nach der Andacht gab Hildchen das Signal zum Beginn des gemütlichen Teils. Sie schenkte mir Bohnenkaffee ein. »Büchsenmilch, Martha?«
Ich schüttelte den Kopf und leerte meine Tasse so schnell wie möglich. Während Hildchen Zimtsterne und Lebkuchen von den Weihnachtstellern naschte, ging ich reihum und begrüßte die anwesenden Damen.
Bei Schwester Käthe, der alten Diakonisse, verweilte ich etwas länger. »Schön, dass Sie gekommen sind! Wie geht es Ihnen?«
»Es muss, Kindchen, es muss!« Das einst volle Gesicht unter dem weißen Häubchen wirkte eingefallen, ihr Leib unter der grauen Tracht geschrumpft. Die dünnen Haare hatten fast die Farbe ihrer Kopfbedeckung angenommen. »Der Herrgott wird mich bald zu sich nehmen«, sagte sie und nickte. Mit Sicherheit war sie über siebzig Jahre alt, vielleicht ging sie auch schon auf die achtzig zu. Sie war die gute Seele der Gemeinde und, nebenbei, über die meisten Vorgänge in unserer Siedlung bestens informiert. »Haben Sie schon gehört?«, fragte sie jetzt. »Dem Rabenau ist die Frau weggelaufen!«
»Wie bitte? Ich dachte, sie ist krank! Gemütskrank.«
»Krank?« Schwester Käthes helle Augenbrauen rutschten missbilligend in die Höhe. »Ich sach nur: Selbstverwirklichung! Das ist die Krankheit unserer Zeit. Kleckst die Leinwände voll und meint, sie wär wunders weiß was für eine Künstlerin.«
»Nein!«, sagte ich in angemessen entsetztem Tonfall.
»Doch! Ist zu Hause ausgezogen. Und wissen Sie, wohin?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Bei Trudi ins Haus!«
Nun war ich wirklich erschüttert. »Trinkhallen-Trudi, die Tratschzentrale? Das glaube ich nicht!«
»Böswilliges Verlassen nennt man so was!«, schimpfte Schwester Käthe weiter und holte mit der Hand so weit aus, dass ihr Krückstock, der an der Tischkante lehnte, umfiel. »Der Rabenau, das ist doch ein Guter. Gottesfürchtig ist er und sorgt für seine Familie. Eine ehrliche Haut.«
Ich bückte mich und hob die Gehhilfe auf.
»Kein Wunder, dass der arme Rabenau das Fundament für unseren Weihnachtsberg nicht fertig bekommt!«, stellte ich fest, »bei diesen familiären Problemen! Die Frauen aus dem Handarbeitskreis kleiden schon die Figuren ein, die Maria ist fast fertig! Doch ohne Grundlage nützt das nichts. Da wird der Platz unterm Weihnachtsbaum in der Kirche dieses Jahr wieder leer bleiben!«
Schwester Käthe seufzte. »Rabenau hat jetzt andere Sorgen. Die Frau ist weg. Und das Fräulein Tochter ist aufsässig geworden, seit sie studieren gegangen ist. Der arme Mann! Ich wär ja mal zu ihm hingegangen, aber die Beine wollen nicht mehr!« Sie umfasste den Griff ihres Stocks. »Damit schaff ich’s gerade noch die Treppe runter bis in den Gemeindesaal! Weiter geht es nicht mehr.«
»Da werde ich dann wohl mal nach dem Unglücksraben schauen, in den nächsten Tagen«, sagte ich folgsam.
»Recht so«, bestätigte die alte Diakonisse.
Und Rabenaus abtrünniger Ehefrau würde ich ebenfalls einen Besuch abstatten. Schon allein aus Neugier.
»Mit Ernst, o Menschenkinder«, stimmten die versammelten Frauen das nächste Lied an. Bei der letzten Strophe sah die Gruppenleiterin nervös auf ihre Armbanduhr. »Wo sie bloß bleibt?«, murmelte sie. »Ich habe sie doch gebeten, pünktlich zu sein.«
»Wartest du noch auf jemand, Hilde?«, fragte ich.
»Ja, freilich. Ich habe eine Schneiderin bestellt, damit sie uns beim Nähen der Gewänder hilft.«
»Wird schon noch kommen«, redete ich ihr beruhigend zu. »Aber mich braucht ihr jetzt ja nicht mehr, ich würde mich gerne verabschieden. In einer halben Stunde treffen sich die Kindergottesdiensthelferinnen in der Kirche.«
Hildchen nickte und sah ein weiteres Mal auf das Zifferblatt an ihrem Handgelenk, das von einem silbernen Armband gehalten wurde. Dann klatschte sie in die Hände. »Wir beginnen schon einmal mit unserer Handarbeit!«
Das Letzte, was ich sah, bevor ich den Gemeindesaal verließ, waren weiße Laken, die durch flinke Hände flossen und zusammengeheftet wurden. Die Frauen fertigten die Engelskleider für das Krippenspiel der Kinder an.
Ich wunderte mich, dass das Kirchenportal nicht verschlossen war. Hatte der Küster bereits für die Helferinnen aufgesperrt?
Beim Betreten des Gotteshauses meinte ich, ein Geräusch zu hören. Ich lauschte. »Ist da wer?«, fragte ich. Hohl hallte meine Stimme von den kahlen Wänden wider.
Niemand antwortete. Für einen Augenblick überlegte ich, die Lampen einzuschalten. Dann überwog mein Bedürfnis nach einem besinnlichen Moment in der Dunkelheit.
In einer der vorderen Bänke nahm ich Platz.
»Herr, du bist unsere Zuflucht für und für«, rezitierte ich einen meiner Lieblingspsalmen. »Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen!«
»Bahbahbah«, erklang es wie ein Echo auf meine eigene Stimme.
Ich spitzte die Ohren, doch nun war es wieder still.
»Hallo? Hallo?«, rief ich.
Da ertönte die Stimme wieder, hell und zornig, ohne Worte. Ich machte das Geplärr eines kleinen Kindes aus, irgendwo vorne im Chorraum.
»Hallo, ich komme!« Das Baby schrie nun anhaltend und jämmerlich.
Immer noch im Dunkeln tastete ich mich vor, unterhalb des Altars fand ich das Bündel. Ich nahm es hoch, ein winziges Menschlein, eingemummelt in Decken, eine kleine Mütze auf dem Kopf. Sobald ich es an mich drückte, verstummte es.
»Ruhig, ruhig. Alles wird gut!« Das Kind, allem Anschein nach ein Neugeborenes, lag in meiner linken Armbeuge. Mit der rechten Hand stützte ich es ab.
»Was machst du hier? Wer, um Gottes willen, hat dich hierhin gelegt?«, wisperte ich. Statt einer Antwort begann das Baby wieder zu weinen. Es klang herzzerreißend. »Ach, du Armes!« Ich stimmte ein Weihnachtslied an. »Es ist ein Ros entsprungen, aus einer Wurzel zart«, sang ich leise und wiegte das Baby sanft zu der alten Melodie. Langsam beruhigte es sich. »Wie uns die Alten sungen, von Jesse kam die Art. Und hat ein Blümlein bracht …«
In diesem Moment flammte das Licht auf.
»Steht Ihnen gut, so ein Kleines, liebe Schwester!«, sagte eine mir wohlbekannte, männlich-markante Stimme. Ich hätte sie unter Hunderten erkannt.
Ich drehte mich um und fand mich Auge in Auge mit Pastor Kruse, der sich breitbeinig im Gang aufgestellt hatte. Er grinste mich an. Im Lauf der Jahre hatte sein Leib sich deutlich gerundet, was wegen seiner geringen Körpergröße besonders auffiel. »Sie sollten sich auch eines zulegen!«
Er wusste genau, dass mir das nicht erlaubt war, zumindest nicht, wenn ich weiterhin als Pastorin arbeiten wollte. Eine Eheschließung hätte die sofortige Entlassung aus dem Amt bedeutet, ein uneheliches Kind ebenfalls. So wollten es die Kirchengesetze.
Doch von Kruse ließ ich mich nicht mehr einschüchtern. »Ihnen hätte ich so ein Kleines auch gegönnt«, konterte ich, »oder gar ein putziges Enkelkind!« Das war gemein von mir, denn ich wusste, dass die Ehe der Kruses ungewollt kinderlos geblieben war.
»Der Mensch denkt, und Gott lenkt!«, entgegnete er kurz angebunden und wandte sich ab.
Unser Schlagabtausch war nicht unbemerkt geblieben, denn Schwester Tabea hatte die Kirche betreten. Ihr folgten zwei weitere junge Frauen, eine blond und stämmig, die andere dunkel und schmal.
»Was ist das denn?«, riefen sie im Chor. »Der ist ja niedlich! Soll der getauft werden? Aber wo sind denn die Eltern?«
Ich schüttelte den Kopf. »Er lag hier am Altar. Keine Ahnung, wem er gehört. Ist es überhaupt ein Junge?«
Wie zur Bekräftigung fing der Säugling wieder an zu schreien. Gleichzeitig stieg mir ein stechender Geruch in die Nase. Ich hielt das Bündel von mir weg. »Windeln wechseln!«, sagte die Blonde und nahm mir die stinkende Last ab. »Zu Hause bei mir liegen welche. Ich hab selbst zwei Kleine, die Oma passt auf sie auf. Aber bis dorthin ist es zu weit …«
Gemeinsam überlegten sie, was zu tun sei. Derweil betraten weitere junge Frauen die Kirche und schnatterten durcheinander. »Ein Findelkind? Von wem könnte das sein?«
»War nicht die Koslewski schwanger?«
»Was ist mit der Kreuter?«
»Diese Schlampe! Ist die überhaupt verheiratet?«
»Noch nichts von der Antibabypille gehört?«
»Nehme ich auch inzwischen. Ich will doch kein Drittes!«
Schließlich tauchte Idschdi auf, unser Küster. Er erfasste die Situation mit einem Blick und verschwand wieder. Kurz darauf erschien seine Frau Marie. Sie schwenkte Stoffbahnen, die vormals weiß gewesen waren, nun aber die Farbe von Schnee, über den schon viele Füße gelaufen waren, angenommen hatten.
»Gib her, das Kleine«, forderte sie die Blonde auf. Mit der Fertigkeit einer Frau, die schon unzählige Male kleine Hintern abgeputzt und wieder verpackt hatte, wechselte die Küsterin die Windeln. Dass sie dabei den Altar als Wickeltisch benutzte, verhinderten weder mein Kollege noch ich, so überrumpelt waren wir.
»Kleiner Junge, wie meine beiden!«, verkündete sie den neugierig blickenden Umstehenden mit ihrem kaum noch vorhandenen polnischen Akzent. »Feiner Junge, kleiner Liebling. Dudududu!«
Mein Kollege murmelte einige Worte, von denen ich nur das Wort »Polizei« verstand.
»Polizei!« Ich stöhnte. An den letzten großen Polizeieinsatz in unserer Kirchengemeinde erinnerte ich mich noch zu gut. Tagelang hatten die Freunde und Helfer unseren Gemeindesaal besetzt gehalten, die gesamte Arbeit lahmgelegt und alles vollgequalmt. Danach hatten wir wochenlang lüften müssen, um den Gestank wieder loszuwerden.
»Natürlich Polizei, Schwester Gerlach! Es handelt sich um Kindesaussetzung! Ein Delikt!« Kruse gab nicht nach.
Die Helferinnen hatten wir nach Hause geschickt. Jetzt stand nur noch das Küsterehepaar abwartend im Kirchraum.
»Was machen wir denn nun mit dem Baby?«, fragte ich ratlos.
»Nehmen wir erst mal mit, das Kleine«, schlug Marie vor. »Werden zwei satt, reicht für Drittes!«, kommentierte Idschdi lakonisch. »Oder sogar für ein Viertes«, fügte ich mit Blick auf Maries Bauch hinzu, der wie eine überreife Frucht kurz vor dem Platzen aussah.
Kapitel 2
»Tut-tut-tut-tut«, tönte es mir aus dem Hörer entgegen. »Besetzt!«, schimpfte ich vor mich hin. »Diese Männer! Wenn man sie schon mal braucht: nicht erreichbar!« Nachdem ich etliche Male vergeblich den Zeigefinger in die Wählscheibe gesteckt und diese bis zum Anschlag durchgezogen hatte, setzte ich einen Kessel Wasser auf dem kleinen Elektroherd auf. Ein Kamillentee würde jetzt guttun. Für die Küche und das Arbeitszimmer hatte ich Radiatoren angeschafft, die die Wohnung elektrisch beheizten. Mit ein wenig Glück würde die Kirchengemeinde im nächsten Jahr Nachtspeicherheizungen im Pfarrhaus einbauen lassen. Die Kohleheizung blieb schon seit Längerem kalt, denn ich hatte weder Zeit noch Lust, diese Anlage zu versorgen. Familie Jankewicz, die das untere Stockwerk bewohnt und sich um die Heizung gekümmert hatte, war im Sommer ausgezogen. Ich konnte von Glück reden, dass der Winter sich bisher von seiner milden Seite gezeigt hatte.
Als es anfing zu pfeifen, schellte gleichzeitig das Telefon. Ich schob den Kessel auf eine kalte Herdplatte und eilte ins Amtszimmer, in der Hoffnung, dass Klaus seinerseits versuchte, mich zu erreichen.
»Evangelisches Pfarramt, Gerlach!«, meldete ich mich formell, da ich nicht wusste, mit wem ich sprach.
»Kommissar Keilmann!«, bellte eine raue Stimme, die mir unangenehme Schauer über den Rücken laufen ließ. »Es handelt sich um die Kindesaussetzung. Ich habe da einige Fragen an Sie.« Ergeben seufzend ließ ich mich auf den Schreibtischstuhl sinken.
»Bitte. Dann fragen Sie.«
»Nicht am Telefon, gnädiges Fräulein. Ich erwarte Sie morgen früh auf der Wache. Pünktlich um neun.«
»Jawohl. Zu Befehl, Herr Wachtmeister«, sagte ich, weil ich wusste, dass ihn das ärgerte. »Allerdings muss ich um halb elf auf dem Friedhof sein.«
Kaum hatte ich den Hörer auf die Gabel gelegt, klingelte es erneut.
»Guten Abend, Martha«, meldete sich mein Freund Klaus mit seiner dunklen, sonoren Stimme, die mir so gut gefiel.
»Wie schön, dass du anrufst!« Aufgekratzt berichtete ich von dem Vorfall in der Kirche. »Und jetzt ermittelt die Polizei«, schloss ich.
»Jaja!« Zu meiner Enttäuschung ging Klaus nicht weiter auf die Geschichte ein. »Martha«, mahnte er stattdessen, »denkst du an unsere Verabredung am Samstagabend?«
»Du hast mich zum Konzert des Bachvereins in die Reinoldi-Kirche eingeladen«, bestätigte ich. »Zum Weihnachtsoratorium. Ich freue mich schon.«
»Nicht, dass du mich wieder versetzt.«
»Ich habe dich erst einmal warten lassen.«
»Dafür eine volle Stunde lang in der Kälte«, hielt er mir vor.
»Klaus! Das war ein Notfall, eine alte Dame, deren Mann ganz plötzlich gestorben war und die der Seelsorge bedurfte.«
»Immer dein Beruf!«, klagte er. »Man hat mir übrigens die Stelle des Rektors angeboten. Dann würde ich mehr verdienen …«
Er ließ den Satz in der Luft hängen, doch ich kannte seine Fortsetzung ohnehin: »… genug, um eine Familie zu ernähren.« Im Hintergrund hörte ich Stimmen. »Hast du Besuch?«
»Nein, nein, das ist nur …« Ein kieksendes Geräusch ertönte, unklar, ob von einem Mann oder einer Frau, dann war die Leitung tot.
Ratlos betrachtete ich den Hörer in meiner Hand und ließ ihn schließlich auf die Gabel sinken.
Wenig später wärmte ich mich am Küchentisch mit einer Tasse heißem Tee auf. Die Plastikuhr an der Wand zeigte kurz vor neun. Plötzlich ging mir alles hier auf die Nerven: die scheußlich geblümten Tapeten an der Wand, die ich schon seit meinem Einzug durch etwas Modernes ersetzen wollte. Die Eckbank, blau bezogen und erst vor Kurzem gekauft, kam mir spießig vor. Über den schäbigen Flur mit dem undefinierbaren Bodenbelag ärgerte ich mich ebenfalls bereits seit dem ersten Tag. Mein Konterfei, das der halb blinde Spiegel an der Garderobe zurückwarf, zeigte eine nicht mehr ganz junge Frau mit ordentlich aufgesteckten dunklen Haaren, hagerem Gesicht und neuerdings einem strengen Zug um den Mund. Wo war der Schwung der zwanziger Jahre geblieben? Mein dreißigster Geburtstag lag noch nicht lange zurück.
»Martha, Martha, du hast es weit gebracht«, verspottete ich mich selbst. »Das Fräulein Pastor, eine alte Jungfer!« Versuchsweise streckte ich meinem Spiegelbild die Zunge heraus, doch auch das munterte mich nicht auf. Wie gerne hätte ich in diesem Moment das kalte, einsame Pfarrhaus gegen eine moderne Wohnung mit Einbauküche und Durchlauferhitzer eingetauscht! Statt die Finger über die Heizrippen zu legen und Trübsal zu blasen, würde ich mit meinem Mann im Fernsehmagazin nach einem Farbfilm unter den üblichen Schwarz-Weiß-Sendungen suchen. »Breit aus die Flügel beide« würde ich am Kinderbett anstimmen anstatt in der Kirchengemeinde. Der einzige Haken an diesem Traum waren meine begrenzten Kochkünste, es reichte gerade einmal für Spiegelei mit Speck und Salat. Doch das Kochen ließ sich lernen. Notfalls in einem Kursus an der Volkshochschule.
»Du musst dich entscheiden!«, bestätigte meine Freundin und Amtsschwester Rosi später am Telefon. »Kaminski lässt sich nicht mehr lange hinhalten. Und er ist ein anständiger Kerl.«
»Ich weiß. Warum kann ich nicht beides tun: heiraten und als Pastorin arbeiten? Für Männer geht das doch auch!«
»Aber Martha«, tadelte Rosi. »Seit wann bist du unter die Emanzen gegangen?«
»Bin ich doch gar nicht!« Ich nahm noch einen Schluck lauwarmen Tee. Er schmeckte so fade, wie mir mein derzeitiges Leben vorkam. »Sag, Rosi, hast du nie bereut, dass du dich für den Beruf entschieden und auf Familie verzichtet hast?«
Schweigen am anderen Ende.
»Rosi? Bist du noch dran?«
»Jaja!« Hatte ich es mir nur eingebildet, oder schwang da tatsächlich ein Seufzer mit? Über Herzensangelegenheiten hatte meine mütterliche Freundin, die die vierzig längst überschritten hatte, nie mit mir geredet.
»Liebst du ihn denn?«, fragte sie unvermittelt.
Nun war es an mir, leise zu seufzen. Das war tatsächlich die Frage aller Fragen: Liebte ich Klaus Kaminski? Und vor allem: Liebte ich ihn genug, um dafür meinen Beruf aufzugeben?
Ich konnte sie nicht beantworten.
Kapitel 3
Die geplante Mondumrundung der Apollo 8 stand auf Seite eins der RuhrRundschau, die Eröffnung der Dortmunder Universität vor wenigen Tagen war bereits aus den Schlagzeilen auf die hinteren Seiten gerutscht. Ich blätterte durch den Lokalteil, doch es gab noch keinen Artikel über das Findelkind in der Kirche. Das überraschte mich nicht, schließlich hatte ich Luschinski nicht am Tatort gesehen. Meine letzte Begegnung mit dem Lokalreporter lag schon einige Zeit zurück.
Ich zog meinen Mantel an, ging die Treppenstufen hinunter und trat aus der Haustür. Eine Viertelstunde Fußweg musste ich einkalkulieren von meiner Wohnung in der Möllerstraße bis zu dem Gebäudekomplex, wo Kirche, Gemeindehaus und das alte Pfarrhaus nebeneinanderlagen. Zunächst schritt ich an der Turnhalle der Hauptschule vorbei, an der Klaus unterrichtete. Obwohl es bereits kurz nach acht war, zog erst jetzt die Morgendämmerung herauf. Im Schein des frühen Lichts glänzte das goldene U über dem Gebäude der Union-Brauerei.
Ich bog ab in den Westpark. Dort war es noch finster. Früher hätte ich mich auf den schlecht beleuchteten Wegen unter den Bäumen gefürchtet und den Park zu dieser frühen Stunde gemieden. Doch das häufige Hin und Her zwischen meiner Wohnung und meiner Wirkungsstätte hatte mich unempfindlicher werden lassen. So summte ich leise vor mich hin und grüßte einen frühen Spaziergänger. An der nächsten Ecke nickte ich dem alten Stegemann zu, der seinen krummbeinigen Dackel ausführte. Hinter dem Park überquerte ich den Marktplatz, auf dem samstags Händler ihre Ware feilboten. Dann lief ich ein Stück an der Mauer entlang, hinter der die S-Bahn fuhr.
Wenige Minuten später erreichte ich die Sternstraße. Ich steuerte das alte Pfarrhaus neben dem Gemeindehaus an: Dort wohnte das Küsterehepaar.
Ich drückte die Klingel.
Marie öffnete die Tür.
»Morgen, Fräulein Martha« , grüßte sie, ein Kind auf dem Arm, das zweite hinten am Rockzipfel, das dritte im vorgewölbten Bauch. Im Lauf der Jahre war ihre Figur fraulicher geworden; es stand ihr gut.
»Guten Morgen, Marie.«
Das Kind am Rock erkannte meine Stimme und lugte vorsichtig hinter Mamas Schürze hervor.
»Kuckuck«, rief ich. »Kuckuck, Tommi!«
Nun wagte der Dreijährige sich ganz aus der Deckung. »Tante Matta, Tante Matta«, strahlte er. Ich wuschelte ihm durch den blonden Schopf.
»Na, kleiner Mann? Alles klar?«
Tommi war mein Patenkind, der Junge, den Marie während meiner Anfangszeit in der Gemeinde zur Welt gebracht hatte.
»Mittebach, mittebach?«, bettelte er. Ich drehte meine Hände um und zeigte ihm die leeren Flächen. »Ich habe nichts mitgebracht, Tommi. Bald ist Weihnachten. Geschenke gibt es erst zu Weihnachten!«
»Schenke. Weihnacht«, echote der Junge.
»Marie, wie geht’s dem Kleinen aus der Kirche?«, fragte ich. »Ist er das?« Ich zeigte auf das Baby in ihrem Arm.
»Ja, Fräulein Martha«, antwortete die Küstersfrau. »Geht gut dem Kleinen! Kommst du mit rein, Fräulein Martha?«, forderte sie mich auf.
Sie duzte mich zwar, aber die formelle Anrede konnte ich ihr nicht abgewöhnen. Als Pastorin war ich für sie eine Respektsperson. Sie brachte es nicht fertig, mich ausschließlich mit Vornamen anzureden.
Ich begleitete sie in die Wohnküche. Es duftete nach Gebackenem. Plätzchen in Form von Mond und Sternen kühlten auf dem Backblech aus. Im Unterschied zu mir besaß Marie bereits einen Elektroherd.
Im Laufstall saß Maries jüngerer Sohn. »Guten Morgen, Michi«, begrüßte ich das pausbackige Baby im Strampelanzug. »Killekille!« Ich kitzelte den Wonneproppen am Bauch. Michi krähte vergnügt.
Marie ließ derweil vorsichtig das Menschenbündel aus ihrem Arm auf eine bunte Kunststoffunterlage gleiten, die den Küchentisch bedeckte.
»Muss noch fertig machen kleines Baby und dann bringen zum Krankenhaus.« Interessiert sah ich zu, wie sie dem Säugling ein Hemd anzog und die dünnen Bändchen im Nacken zuknotete. Geschickt steckte sie anschließend die Arme durch die Löcher eines Jäckchens, das nun wieder vorne geschlossen wurde. Als der Säugling unruhig wurde, kitzelte sie ihn am Bauch. »Dudududu!«
»Udududu«, echote Tommi, der sich zwischen den Beinen des Küchentischs niedergelassen hatte. Dabei trat er gegen einen himmelblauen Pinkelpott. Zum Glück war er leer, sonst hätte es eine übel riechende Überschwemmung gegeben.
Marie nahm den Säugling hoch. »Ist noch ganz winzig, erst paar Tage alt. Wollen untersuchen im Krankenhaus!«
»Hat die Polizei das angeordnet?«
»Ja, Kommissar war hier und hat mit meinem Mann gesprochen. Wollen finden Mutter. Wer tut so was, Kind wegbringen?«
»Vielleicht eine Frau in Not?«
»Wir haben auch nicht viel Geld, aber für Kinder muss reichen!«
Vor dem Gemeindehaus erblickte ich eine schlaksige Gestalt, die mir den Rücken zudrehte. »Luschinski!«, rief ich erfreut.
Er drehte sich um. »Martha! Einen wunderschönen …«
»… guten Morgen!«, ergänzte ich.
Der Reporter kam mit langen Schritten auf mich zu. Sein jungenhafter Charme täuschte über sein wahres Alter hinweg, das ich auf weit über vierzig schätzte. Die Furchen zwischen Mund und Nase hatten sich seit unserer letzten Begegnung vertieft.
Wie üblich baumelte eine Kamera vor seiner Brust.
»Lange nicht gesehen, Martha! Ist mal wieder einiges los in deiner Gemeinde«, stellte er fest.
»Ja, und deshalb muss ich jetzt auch zum Polizeirevier und habe keine Zeit für dich. Kommissar Kellmann erwartet mich.«
»Aha. Hat er dich zur Wache zitiert.«
Ich verzog das Gesicht. »Pünktlich um neun.«
»Darf ich dich begleiten?« Er deutete eine Verbeugung an.
»Bist du auf der Suche nach einer heißen Geschichte?«
Er zwinkerte mir zu. »Höchstens mit dir, Martha! Höchstens mit dir!«