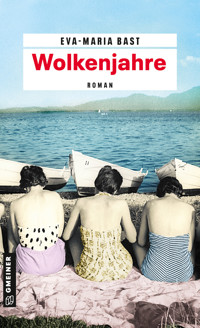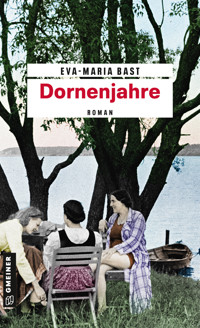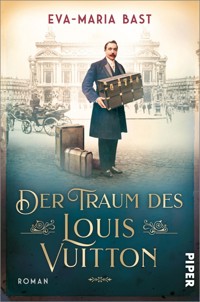
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Der Traum des Louis Vuitton« | Historischer Roman über eine Legende der Modebranche und eine Ikone exquisiter Handwerkskunst Eva-Maria Basts fesselnder Roman über den jungen Louis Vuitton (1821-1892), dessen geniale Erfindung ihn in den Olymp der größten Designer katapultierte Louis Vuitton war ein einfacher Junge aus einem französischen Bergdorf, als er mit 14 Jahren aufbrach, um die glitzernde Metropole Paris zu erobern. Paris, 1837: Der junge Louis Vuitton hat es aus seinem Heimatdorf ins aufregende Paris geschafft! Er beginnt eine Lehre als Kistenhersteller und Kofferpacker und stellt sich dabei derart geschickt an, dass er sogar an den Kaiserhof gerufen wird. Nur dass die Gepäckstücke so unpraktisch sind, macht ihm das Leben schwer. Louis tüftelt unermüdlich an einer besseren Form. Und just in dem Jahr, in dem ihm seine große Liebe begegnet, revolutioniert er den Koffer und gründet sein eigenes Geschäft. Der Erfolg ist riesig, doch als Louis Opfer eines großen Verrats wird, muss er für sein Unternehmen kämpfen ... Fans von historischen Romanen und Büchern über berühmte Persönlichkeiten können in dieser Romanbiografie den Menschen hinter der Luxusmarke Louis Vuitton entdecken. Mit 33 Jahre gründete Louis Vuitton sein erstes eigenes Geschäft. Während er hinten in der Werkstatt die Koffer baute, verkaufte seine Frau vorne im Geschäft die von ihm gefertigten Gepäckstücke. Sie wurden ihnen förmlich aus der Hand gerissen, denn sie waren nicht nur leicht, sondern ließen sich dank ihrer neuartigen, rechteckigen und geraden Form hervorragend stapeln. Als Louis zum Kofferhersteller Ihrer Kaiserlichen Hoheit ernannt wurde, gab es kein Halten mehr. 1859 errichteten die Vuittons ihre eigene Fabrik. Heute ist die Marke milliardenschwer und gilt als eine der wichtigsten der Welt. Vom Kofferträger zum Millionär! Lassen Sie sich entführen in eine hochspannende Geschichte nach wahren Begebenheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Der Traum des Louis Vuitton« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lesen & Hören, Anna Mechler.
Redaktion: René Stein
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com und shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Teil 1
1835–1838
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil 2
1853–1859
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Teil 3
1866–1873
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Wie es weiterging:Bemerkenswertes und Spuren der Realität
Danksagung
Literatur und Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Teil 1
1835–1838
Kapitel 1
Anchay, ein kleines Bergdorf in der Nähe von Lavans-sur-Valouse, Frühling 1835
Ein Vogel zwitscherte. Ein zweiter stimmte ein, dann ein dritter, und bald schon war die Luft erfüllt von ihrem Gesang. In seiner kleinen Kammer, im Dach ihrer einfachen Holzhütte gelegen, öffnete der dreizehnjährige Louis Vuitton die Augen. Lächelte. »Ich komme ja schon«, flüsterte er, überzeugt, dass die Vögel ihr fröhliches Lied eigens für ihn angestimmt hatten. »He, du«, schienen sie zu ihm zu sagen. »Es ist Frühling. Es wird hell. Steh schon auf, und komm heraus. Gleich geht die Sonne auf, und das Licht, das liebst du doch so sehr.«
Leise, um seinen sechs Jahre jüngeren Bruder Claude Régis nicht zu wecken, mit dem er sich die Dachkammer teilte, schlüpfte Louis unter seiner dünnen Decke hervor. Er tauschte sein Schlafkleid gegen eine Hose aus grobem, braunem Leinen, das immer ein wenig kratzte, und ein ebenso kratziges Hemd. Über die Füße zog er sich Socken, die seine zwanzigjährige Schwester Marie Victorine schon so oft gestopft hatte, dass vom eigentlichen Strumpf kaum noch etwas übrig war. Dann stieg er leise die Treppen hinunter. Bei jeder Bewegung fürchtete Louis, ein Geräusch zu erzeugen und im schlimmsten Fall sogar die Aufmerksamkeit seiner Stiefmutter Marie Coronnée zu erregen, die in solchen Fällen mit ihrer schrecklichen, kalten und unnatürlich hohen Stimme rief: »Louis! Bist du das? Komm sofort her, und geh mir zur Hand!«
Er konnte ihre Nähe, ja, konnte nicht einmal den Klang ihrer Stimme ertragen, ohne dass sein Herz auf unangenehme Weise schneller zu schlagen begann und es ihm die Kehle zuschnürte. Um ihr zu entkommen, flüchtete er immer mehr in seine Traumwelten – was zur Folge hatte, dass er häufig nicht mitbekam, wenn sie etwas von ihm wollte. Sie legte ihm seine Gedankenverlorenheit als Frechheit aus, was ihm schon das eine oder andere Mal eine heftige Tracht Prügel eingebracht hatte.
Doch so kalt und grau die Wirklichkeit auch war: Louis’ Traumwelt war voller Licht und Freude. Es war die Welt, in der sie gelebt hatten, bevor die Mutter vor drei Jahren gestorben war. Louis war zehn gewesen und fast umgekommen vor Kummer über den schweren Verlust. Er hatte das Gefühl gehabt, sein Leben sei nun zu Ende. Mit Maman war alle Liebe, alle Leichtigkeit und alle Freude aus ihrem Leben gewichen. Nach ihrem Tod hatte Louis die Umgebung des Jura, in der seine Familie nun schon in der fünften Generation lebte, nicht länger als heimelig und schutzgebend, sondern zum ersten Mal als kalt, hart, beengend und mitunter auch düster empfunden. Und nach dem Trauerjahr war alles noch schlimmer geworden: Der Vater hatte sich wieder vermählt, mit einem schrecklichen Weib, und zu der Trauer, die sie alle immer noch umtrieb, kam nun eine regelrecht vergiftete Atmosphäre. Seine Stiefmutter Marie Coronnée behandelte alle schlecht – angefangen bei Louis’ Vater, einem einfachen Müllersmann, von dem sie offenbar erwartete, dass er ihr ein Leben in Luxus ermöglichte. Marie Coronnée, die zu Louis’ Entsetzen auch noch den gleichen Erst- und Zweitnamen hatte wie seine leibliche Mutter, saugte seinen Vater regelrecht aus, dachte Louis wieder und wieder empört. Er machte sich Sorgen um seinen Vater, zu Lebzeiten seiner Mutter ein glücklicher und strahlender Mann, nun nur noch ein Schatten seiner selbst.
Dieserart in seine Gedanken versunken, hatte es Louis bis zur Haustüre geschafft. Er sperrte leise auf – der Schlüssel steckte wie immer innen – und schlich hinaus. Draußen nahmen ihn sofort die wunderbaren Geräusche des Jura gefangen. Das Vogelgezwitscher steigerte sich hier zu einem regelrechten Jubelkonzert, das Murmeln des Baches Ancheronne und seiner Wasserfälle, die ihren Weiler umgaben, kündeten von der gigantischen Kraft der Natur, und das milde Rauschen des Waldes wirkte beruhigend auf ihn. Ebenso erging es ihm mit dem immer gleichen Quietschen des Mühlrads, das tagein, tagaus seine Arbeit verrichtete und mit dem sich die Familie die Kraft der Natur zu eigen machte. Louis schloss für einen Moment die Augen und nahm das Konzert ganz in sich auf, dann öffnete er sie wieder und eilte zu seinem Lieblingsplatz, einer kleinen Anhöhe, von der aus sich ein atemberaubender Blick über die Täler eröffnete. Von hier wollte er beobachten, wie die Sonne über dem Jura aufging. Es gab, fand Louis, nichts Hoffnungsvolleres als einen Sonnenaufgang. War nicht jeder neue Tag ein Versprechen? Bot nicht jeder neue Tag eine wunderbare Gelegenheit, die es zu nutzen galt?
Trotz des Anstiegs hatte Louis die Anhöhe erreicht, ohne groß aus der Puste zu sein, was er der körperlichen Arbeit zu verdanken hatte, die er täglich verrichtete. Erwartungsfroh ließ er sich auf dem Felsen nieder, auf dem er immer saß, und atmete tief ein und aus. Wie klar die Luft war! Der leichte Duft nach Erde und Wald erzeugte in ihm ein Gefühl der Heimeligkeit, und der dezente Hauch von frisch erblühten Frühjahrsblumen das Gefühl von Hoffnung. Erneut schloss er für einen Moment die Augen – und als er sie wieder öffnete, färbte sich der Horizont bereits feuerrot. Was für ein imposantes Schauspiel, an dem er sich niemals sattsehen konnte! Was für ein unglaubliches Geschenk der Natur er da jeden Morgen empfing! Wie reich er war!
Ergriffen sah Louis zu, wie die Sonne höher und immer höher stieg und alles zum Leben erweckte. Was für ein magischer Moment! Später würde die Sonne mit den Schatten tanzen, kunstvolle Lichtgebilde auf den Waldboden malen, wenn sie ihre gleißenden Strahlen durch die Äste warf. Das Licht, dachte Louis nicht zum ersten Mal, war schon ein wahrer Künstler.
Für ihn aber wurde es Zeit. Wenn das Feuer im Kamin nicht brannte, bevor seine Stiefmutter geruhte, aufzustehen, würde es wieder Schläge setzen. Doch in diesen Morgenstunden, vollgesogen mit den Hoffnungsstrahlen der aufgehenden Sonne, hatte Louis nicht für einen Moment Zweifel daran, dass er es auch an diesem neuen Tag mit ihr aufnehmen und vielleicht sogar seinen Vater und seine Geschwister ein wenig vor ihr schützen konnte.
Auf dem Weg nach Hause – wobei er die einst heimelige Hütte seit dem Tod der Mutter eigentlich nicht mehr Zuhause nennen mochte – sammelte er fröhlich vor sich hin pfeifend einige Zweige ein. Sollte Marie Coronnée doch bemerken, dass er schon unterwegs gewesen war, konnte er sich immer noch damit herausreden, er habe Holz gesammelt. Das hielt er jeden Morgen so. Wobei sie ihn noch nie erwischt hatte. Und die Gefahr war und blieb auch denkbar gering: Marie Coronnée war eine so anspruchsvolle wie bequeme Frau, und es wäre ihr nie eingefallen, sich allzu früh aus ihrer Bettstatt zu erheben.
Tatsächlich war das Haus noch nicht zum Leben erwacht, nur seine sieben Jahre ältere Schwester Marie Victorine sah er aus der Ferne bei den Ställen: Ihre Aufgabe war es, die Ziegen zu melken, die Eier von den Hühnern zu holen und anschließend ein Frühstück zuzubereiten. Seine älteste Schwester hatte es von ihnen allen am schwersten, wie Louis fand, wurde sie doch von Marie Coronnée wie eine Dienstmagd behandelt. Die Stiefmutter machte ihr das Leben schwer, wo sie nur konnte. Selbst Louis’ jüngste Schwester, die neunjährige Marie Rosalie, und auch sein kleiner Bruder Claude Régis mussten schon kräftig mit anpacken. Besonders die Kleinen fürchteten sich sehr vor der bösen Stiefmutter. Und Louis als der älteste Bruder fühlte sich verantwortlich. Tausendmal lieber steckte er selbst Beschimpfungen und sogar Prügel ein, als zusehen zu müssen, wie Marie Coronnée über seine Geschwister herfiel. Das konnte er einfach nicht ertragen.
***
Mehrere Stunden später, die Sonne hatte gerade ihren Höchststand erreicht, war Louis damit beschäftigt, das Holz vor dem Haus zu schichten. Obwohl das Holzstapeln eine tägliche Arbeit war, ging Louis sorgsam, mit Bedacht und voller Respekt für das Material vor. Seine Finger wanderten über die Rinde, er sog tief den Duft von frisch geschnittenem Holz in sich ein, und manchmal zählte er auch die Jahresringe und las an deren Dicke ab, ob es ein besonders kaltes oder ein besonders warmes Jahr gewesen war. Wie wunderbar, dass es dieses Holz gab, das in den Wäldern auf den beiden Bergketten wuchs, die ihren Weiler umgaben. Es diente zum Heizen – in ihrem Heim, aber auch in den Glashütten und Schmieden der Gegend, die Eisen und Gusseisen herstellten. Außerdem schuf sein Vater mit Holz die wunderbarsten Kunstwerke. François-Xavier Vuitton war ein begnadeter Künstler, und in den langen Wintermonaten, wenn sie wieder einmal durch Unmengen von Schnee von der Umgebung abgeschnitten waren, hatte er früher oft am Kamin gesessen und seinen Kindern gezeigt, wie man schnitzte. Louis hatte staunend dabei zugesehen, wie das Holz unter den geschickten Händen seines Vaters seine Form änderte. Was waren das für herrliche Winter gewesen! Sie hatten stundenlang draußen herumgetollt, und wenn sie durchgefroren hereinkamen, hatte die Mutter mit heißer Milch auf sie gewartet, im Kamin hatte ein Feuer gebrannt, der Vater hatte davorgesessen und geschnitzt. Und die Kinder hatten sich einen Spaß daraus gemacht, die Holzspäne ins Feuer zu werfen. Wie herrlich das geduftet hatte!
Doch diese Zeiten waren vorbei. Marie Coronnée erlaubte es nicht, dass ihr Mann in der Hütte schnitzte, das mache nur Dreck, argumentierte sie stets mit der für sie so typischen sauertöpfischen Miene.
Derart in seine Gedanken vertieft, fuhr Louis erschrocken zusammen, als sich plötzlich jemand hinter ihm räusperte. Er drehte sich um und sah sich einem Fremden gegenüber.
»Guten Tag«, sagte der Herr, sehr elegant in feinstem Zwirn. »Du bist sicherlich Louis.«
»J… ja«, stammelte der Junge. »Aber wer sind Sie?«
Der Fremde lachte. »Du kennst mich wohl wirklich nicht mehr, was? Ich bin’s doch, euer alter Nachbar Clément.«
»Clément!« Louis starrte ihn an. Das war der Nachbarsjunge, dem er einst so große Bewunderung entgegengebracht hatte! Clément war etwa zehn Jahre älter als er, zu ihm hatte er stets aufgeblickt, doch vor vier Jahren war er plötzlich fort gewesen. Auf Wanderschaft, hatte sein Vater ihm erklärt, und Louis hatte beschlossen, irgendwann ebenfalls einmal auf Wanderschaft zu gehen. Und nun war dieser Clément also – in der Tat vollkommen verwandelt – zurückgekehrt.
»He, Kleiner, nun aber genug gestarrt«, sagte Clément.
»Ent… schuldigung«, stammelte Louis. »Aber du bist so verändert. Wie hast du das nur gemacht?« Er musterte seinen einstigen Nachbarn nun ganz genau, von Kopf bis Fuß: Auf seinem gepflegten Haar saß ein schwarzer Zylinder, Hose und Jacke waren aus feinstem Zwirn, der Bart zu einem Schnauzer geschnitten und streng gezwirbelt. Und die Schuhe! Keine genagelten Klötze, wie sie sie in den Bergen trugen, sondern auf Hochglanz polierte Stiefel aus einem Leder, das so weich wirkte, dass Louis sich am liebsten vor Clément auf den Boden geworfen hätte, um es zu befühlen.
Clément indes sandte Louis ein geheimnisvolles Lächeln, während er sich zu ihm beugte, um ihm zuzuraunen: »Paris. Ich war in Paris. Der Stadt des Lichts.«
»Die Stadt des Lichts?« Diese Bezeichnung weckte augenblicklich eine tiefe Sehnsucht in Louis. »Weshalb nennt man sie so?«
Clément zwinkerte ihm zu. »Ich kann dir nur empfehlen: Geh hin, und finde es heraus. Alt genug bist du. Und zäh genug auch.«
Aber, wollte Louis einwenden, das geht doch nicht! Doch dann schluckte er die Worte herunter, denn in seinem Inneren tauchte ein lang schon vergessen geglaubtes Bild auf, und eine Stimme ertönte: seine Mutter. Wie sie vor ihm niederkniete, sein pausbäckiges Jungengesicht zwischen ihre Hände nahm, ihn voller Liebe ansah und leise sagte: »Du wirst alles schaffen, was du dir vornimmst, mein lieber Schatz. Du verfügst über eine unglaubliche Kraft. Du darfst nur nicht aufhören, an dich und deine Träume zu glauben, hörst du?«
Louis erinnerte sich nicht mehr, was es genau gewesen war, zu dem die Mutter ihn in diesem Moment ermutigt hatte. Aber das Gefühl, das dieser Satz in ihm erzeugt hatte, das hatte er nie vergessen. Er konnte es stets abrufen, wenn er sich einsam oder unsicher fühlte. Und noch eine Erinnerung stieg nun in ihm auf. In ihren letzten Stunden, als klar wurde, dass sie ihre schwere Krankheit nicht überleben würde, da hatte seine Mutter ihre Kinder eins nach dem anderen, dem Alter nach, zu sich gerufen. Louis war als Zweiter an der Reihe gewesen. Sie hatte seine Hand genommen, ihn aus Augen angesehen, die inzwischen viel zu groß waren für ihr schmales, eingefallenes Gesicht, und gesagt: »Denk immer daran, mein Junge, dass du etwas ganz Besonderes bist. Und dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Versprich es mir.«
»Ich verspreche es«, hatte er erwidert, während ihm die Tränen über die Wangen liefen. Das waren die letzten Worte, die sie miteinander gewechselt hatten. Cléments Rückkehr hatte etwas zu bedeuten, nun war es an der Zeit, dieses Versprechen einzulösen. Was hielt ihn denn noch hier? Die Verantwortung für die Geschwister und den Vater, natürlich, aber musste er es nicht gerade um ihretwillen wagen? Auf der Suche nach einer besseren Zukunft, auch für sie? Du bist etwas ganz Besonderes, vergiss das nicht, hatte die Mutter zu ihm gesagt. Und bedeutete das nicht auch, dass nur er einen Ausweg für sich und seine Geschwister finden konnte? Wenn es ihm gelänge, in Paris sein Glück zu machen, dann würde er eines Tages zurückkehren, so wie nun Clément zurückgekehrt war, und alle seine Brüder und Schwestern zu sich holen.
»He«, brachte sich Clément da wieder in Erinnerung. »Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen? Ich kann dich wirklich nur ermutigen, dein Glück zu versuchen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Weißt du, Kleiner, ich hab mit eigenen Augen die Trois Glorieuses gesehen. Und seitdem ist alles noch besser geworden.«
»Was sind die Trois Glorieuses?« Louis schämte sich nicht, diese Frage zu stellen. Er war stolz darauf, dass die Mutter ihm zusätzlich zu dem Unterricht, den er in der Schule bekam, viel beigebracht hatte. Aber dennoch gab es einiges, was er nicht wusste. Was er aber wusste: dass er dem etwas eitlen Clément mit seiner Frage einen Gefallen tat. Denn dadurch konnte dieser einmal mehr mit seinem Wissen prahlen. In der Tat warf Clément sich nun ein wenig in die Brust und rief: »Das weißt du nicht?«, um dann selbstgefällig hinzuzufügen: »Nun ja, kein Wunder, da du doch noch nie aus diesem Weiler herausgekommen bist. Die Trois Glorieuses nennen die Pariser drei Tage im Juli 1830, in denen sie König Charles stürzten und den neuen König Louis-Philippe auf den Thron hievten.
»Was hatten sie denn gegen König Charles?«, wollte Louis wissen.
»Nun«, setzte Clément an, »kurz gesagt: Er wollte den Bürgern ihre Rechte nehmen und sie dem Adel zuschanzen, die Pressefreiheit beschränken und das Wahlrecht aushebeln.«
Louis wusste zwar weder, was eine Pressefreiheit noch was ein Wahlrecht war, aber irgendwie war es ihm nun doch peinlich, sich danach auch noch zu erkundigen. Das würde er selbst noch herausfinden. Stattdessen stellte er fest: »Und das wollten sich die Pariser nicht gefallen lassen?«
»Ganz genau«, bestätigte Clément mit leuchtenden Augen. »Da war ganz schön was geboten, kann ich dir sagen. Drei Tage lang war in Paris der Teufel los! Die Bürger sind auf die Barrikaden gegangen, und es wurde sogar geschossen.«
Louis schauderte. Das erinnerte ihn an die Erzählungen seiner Mutter über die Kriege, die im 16. und 17. Jahrhundert im Jura geherrscht hatten, als sowohl die Eidgenossen wie auch Spanien und Frankreich das Land für sich beanspruchten. Letztendlich hatte Frankreich die Kriege gewonnen, und so war der Weiler, in dem sie lebten, nun seit 1678 Teil des Königreichs Frankreich. Regelrecht verwüstet hätten die Kriege ihr schönes Jura damals, hatte die Mutter gesagt und ihn gemahnt: »Da siehst du es, Louis, Habgier und Missgunst führen immer nur zu Neid und Leid.« Offenbar herrschte in Paris aber jede Menge Missgunst, und er fragte sich, ob die Stadt wirklich ein solch erstrebenswertes Ziel war. Sein Gegenüber schien seine Gedanken zu erahnen.
»Keine Sorge«, sagte er. »Das ist längst vorbei. Ich habe dir doch gesagt, seither ist alles besser. Den neuen König nennen sie auch deshalb Bürgerkönig, weil er so umgänglich und freundlich zum Volk ist. Unter ihm macht Paris seinem Ruf und seinem Namen als Stadt des Lichts wieder alle Ehre.«
Louis nickte und machte sich erneut daran, Holz in den Stapel zu schichten. Doch dann hielt er noch einmal kurz inne und sah seinen einstigen Nachbarn an.
»Danke, Clément«, sagte er. »Ich will es tun, gleich morgen früh mache ich mich auf den Weg.«
***
In der letzten Nacht in seinem Zuhause tat Louis Vuitton kein Auge zu. Im flackernden Schein der Kerze schrieb er einen langen Brief an seinen Vater und einen weiteren an Victorine – stellvertretend für alle Geschwister, denen sie den Brief dann vorlesen sollte.
Beide Briefe, auch den für den Vater, legte er neben Victorines Kopfkissen, nachdem er sich leise in die Kammer seiner Schwestern geschlichen hatte. Nur so konnte er sicherstellen, dass Marie Coronnée den Brief nicht fand und an sich nahm, was sie sicherlich getan hätte, wenn sie ihn auf dem Küchentisch entdeckt hätte. Die Worte an seinen Vater waren schonungslos gegen seine Stiefmutter und voller Mitgefühl für den Vater und seine Geschwister. Niemals hätte Marie Coronnée einen solchen Schrieb geduldet und weitergegeben.
Er musste schlucken, wenn er sich vorstellte, wie Victorine morgens aufwachen und die Briefe vorfinden würde. Es würde schrecklich für sie alle werden, besonders für Rosalie und Claude, die beiden Kleinsten. Aber er hoffte auch, nein, er war sicher, dass sie ihn verstehen würden.
Bevor er ging, weilte er noch für einen Moment an jedem Bett seiner Geschwister. Zuletzt bei Claude Régis, seinem kleinen Bruder. Wie wunderschön und unschuldig er im Schlaf aussah. Zu gerne hätte er seine rosige Wange geküsst, aber er wagte es nicht. Wenn er ihn mit dieser Geste geweckt hätte, wäre sein ganzer schöner Plan perdu. Deshalb legte er nur vorsichtig seine Zwille, mit der Claude immer bettelte, spielen zu dürfen, neben ihn und sagte in Gedanken: »Adieu, Kleiner, und verzeih mir, dass ich dich jetzt nicht weiter beschützen kann. Aber ich werde dich holen und dir ein besseres Leben bieten. Das verspreche ich dir.«
Und dann schulterte der dreizehnjährige Louis Vuitton sein Bündel und verließ, ohne noch einmal einen Blick zurückzuwerfen, den Weiler, in dem seine Vorfahren seit fünf Generationen gelebt hatten.
Kapitel 2
Zwei Jahre später – Ankunft in Paris im Herbst 1837
Alles veränderte sich unablässig: Die Farben, die Geräusche, die Gerüche, die Bilder. Louis’ zweijährige Reise auf dem Weg nach Paris war eine stete Abfolge von wechselnden Eindrücken gewesen. Das Einzige, was Bestand gehabt hatte, war das Murmeln des Bächleins Ancheronne, dem er auf dem Weg in die französische Hauptstadt gefolgt war. Weiter und immer weiter – auch dann noch, als der Bach längst anders hieß und zu einem breiteren Strom geworden war, hatte ihn das stetige Rauschen begleitet – und ihm die Gewissheit gegeben, dass er immer noch mit seiner Heimat verbunden war. Der Heimat ganz im Osten des Landes, inmitten der Berge, die eine natürliche Grenze zur Schweiz bildeten und in dem das Leben hart und karg war. Im Sommer war es sengend heiß, während im Winter eisige Temperaturen herrschten, gegen die ihre einfache Behausung ebenso wenig Schutz bot wie ihre ärmliche Kleidung. Doch Louis hatte sich nie daran gestört – im Gegenteil: Waren sengend heiße Sommer und eisige Winter nicht ein weiterer Beweis für die Macht und die Kraft der Natur, die er eben dafür so bewunderte?
Und während er nun so durch die Lande stapfte, immer am Fluss entlang in Richtung Nordwesten, da dachte er, dass ihn dieses harte Leben auch robust gemacht hatte. Ob es wohl so war, dass die Umgebung, in der man aufwuchs, einen prägte? Manchmal kam Louis sich selbst vor wie dieses unbezwingbare Gebirge mit seinen wilden Bächen und tiefen Wäldern. Unbezwingbar wie das Gebirge waren sein Wille und sein Mut, vielleicht auch seine Konstitution. So wie die wilden Bächlein, war seine Fantasie, die Welt seiner Träume, die unablässig sprudelte, die unablässig Bilder schuf. Bilder von einer leuchtenden Stadt, einer friedlichen Welt – und er mittendrin. Und die Wälder waren wie die Tiefe seiner Gedanken. Denn während Louis so voranschritt, gingen seine Gedanken immer weiter auf die Reise und immer mehr in die Tiefe. Louis nahm alles, was er sah, fühlte, schmeckte und roch, intensiv wahr und stellte Überlegungen dazu an. Er ließ sich am Flussufer nieder, um wie schon in seinen Kindertagen dem Gurgeln des Bachs zu lauschen, verweilte stundenlang, um den Tanz eines Schmetterlings mit einer Blüte zu betrachten, und er fragte sich, wie es kam, dass ein Schmetterling so wunderschön war und wie dieses zauberhafte Tier eigentlich ihn, den Menschen, wahrnahm.
Louis war viel allein, aber er kam auf seiner Wanderschaft auch mit zahlreichen anderen jungen Burschen in Kontakt. Schuhmacher, Gerber, Hutmacher, Böttcher, Stellmacher, Eisenschmiede, Blechschmiede, Zimmerleute, Tischler und Steinmetze, die auf der Walz durch die Lande zogen. Gemeinsam mit ihnen übernachtete er dann und wann in Gästehäusern und bot dem Wirt eine Weile lang gegen freie Kost, Logis und einen kleinen Lohn seine Dienste an. Dank seines Vaters verfügte er über ein enormes Geschick im Umgang mit Holz, was seine Gastwirte durchaus zu schätzen wussten. Er blieb stets so lange, bis er genügend Geld beisammen hatte, um einige Tage weiterreisen zu können – und deshalb dauerte es zwei Jahre, bis er endlich die Stadtgrenze von Paris überquerte. Zweihundertzweiundneunzig Meilen hatte er zu Fuß hinter sich gebracht, und er war über die Maßen gereift. Wieder und wieder waren Postkutschen an ihm vorbeigezogen, und wenn Louis ihnen anfangs auch sehnsüchtig nachgeblickt hatte – immerhin wäre er mit einer solchen Postkutsche innerhalb von fünf Tagen in Paris gewesen –, so war er doch rasch dankbar dafür, dass bei ihm der Weg das Ziel war. Er hatte so viel gesehen und so viel gelernt und irgendwie auch das Gefühl, dass ihn seine Reise für seine Ankunft in Paris vorbereitet und ihn dazu befähigt hatte. Und dann kam er endlich an, in dieser viel gepriesenen Stadt des Lichts, über die er auf seiner Reise noch so viel mehr zu hören bekam als das, was Clément ihm bei der kurzen Begegnung geschildert hatte. Ein ums andere Mal war Louis bestätigt worden, dass Paris magisch sei.
Es war ein besonders schöner Sommertag, als Louis die Stadtgrenzen überquerte, als hätte Paris sein schönstes Kleid angelegt, um den jungen Mann willkommen zu heißen. Dennoch war Louis überrascht und auch etwas enttäuscht, als er sich in einer fast ländlichen Umgebung wiederfand: Sein Auge streifte umher, er sah schier endlose Äcker, Gärten und sogar Mühlen, und inmitten dieser Idylle verliefen keineswegs Straßen, sondern eher schmale Trampelpfade. Sogar einen kleinen Bach gab es, der in ihm den Gedanken aufkeimen ließ, dass er ja auch hier wieder mit seinem Zuhause verbunden war. Aufseufzend ließ sich Louis auf einem dicken Wackerstein nieder. Er hatte sich Paris großartiger vorgestellt und auch mondäner, aber was er vorfand, unterschied sich nicht so fundamental von dem, wie er es nach Cléments Schwärmereien und den Schilderungen seiner Weggefährten erwartet hatte. Auch die Menschen waren mitnichten so nobel gekleidet wie der aus der Stadt des Lichts heimkehrende Clément. Louis sah einfach gekleidete Handwerker, anscheinend Gerber, die Lederhäute in den Bach hielten, etwas weiter hinten arbeiteten Färber. Es stank, wie Louis fand, ganz entsetzlich.
Er erlaubte der Enttäuschung nicht, noch weiter Besitz von ihm zu ergreifen. Vielleicht war seine Vorstellung großartiger gewesen als die Realität, aber erstens war er nun einmal hier, und er hatte nicht den ganzen Weg und all die Strapazen auf sich genommen, um nun enttäuscht klein beizugeben. Und zweitens: Wenn Träume endlos waren, die Realität aber nicht, dann konnte man doch daran arbeiten, die Realität an die Träume anzupassen, oder nicht? Etwas ermutigt schritt Louis voran – nur um gleich darauf auf eine noch härtere Probe gestellt zu werden. Er hatte das Viertel Faubourg Saint-Marceau gerade erreicht, als er auch schon erschrocken aufkeuchte. In was für eine entsetzliche Gegend war er hier nur geraten! Von wegen Stadt des Lichts! Hier war es furchtbar eng und dunkel, dicht an dicht standen die Häuser, sodass kaum ein Lichtstrahl zwischen ihnen hindurch und auf die Straße fiel, zumal die Dächer sich an ihren Traufen fast berührten und eine Art Hohlgasse bildeten. Es stank auch hier entsetzlich. Überall drückten sich arme, verhärmte Kreaturen in Lumpen herum. Er hastete weiter – und blieb dann wie angewurzelt stehen und schnappte so heftig nach Luft, dass ihm für einen Moment schwindelig wurde. Er hatte die Seine erreicht – und sah in der Mitte einer kleinen Insel eine riesige Kathedrale aufragen, die von atemberaubender Grazie und Schönheit war. Das musste Notre-Dame sein, von der man ihm auf seiner Reise gesagt hatte, dass sie das Herz und die Seele von Paris sei. Louis war von ihrem Anblick wie vom Donner gerührt. Wenn das das Herz und die Seele von Paris war, dachte er, dann war er hier doch richtig, ungeachtet der zuerst ländlichen und dann düsteren Quartiers, die er auf seinem Weg hierher durchquert hatte.
Warum man Paris Stadt des Lichts nannte, hatte er zwar noch nicht herausgefunden. Aber dass sie eine Stadt der Gegensätze war, daran gab es nicht den geringsten Zweifel.
Mutig und voller Tatendrang überquerte Louis die nächstgelegene Brücke, die auf die Île de la Cité und damit zur Kathedrale führte, überzeugt, dass sich dort, um dieses wunderbare Gotteshaus herum, das Paris entfaltete, nach dem er suchte. Entsetzt musste Louis wenig später jedoch erkennen, dass die Welt um diese majestätische Kathedrale herum fast noch furchtbarer war als jenes Viertel, das er zuvor durchquert hatte. Wenn überhaupt möglich, dann war es hier noch enger, düsterer und die Luft noch verpesteter, die Menschen noch elender. Ein schlammfarbenes Haus reihte sich an das nächste, das Holz von Fenster und Türen war derart wurmstichig oder morsch, dass es stellenweise ganz auseinanderfiel, es roch nach Fäulnis und dem Unrat, der sich auf den Straßen häufte. Die Menschen sahen krank, ärmlich und ausgezehrt aus, husteten und spuckten Blut. Louis erblickte mehrere Alte, die offensichtlich auf der Straße lebten und zwischen Lumpen ihr armseliges Dasein fristeten – wie mochten sie nur den Winter überstehen? Ein Greis durchforstete einen Berg Küchenabfälle und zog etwas Undefinierbares heraus, um es zu verspeisen. Wie schrecklich musste sein Hunger sein! Dort hinten zerrte ein Mann ein schluchzendes Kind an den Haaren über den schmutzigen Boden. Die Kleine hatte blutige Beinchen und weinte bitterlich, was ihr aber nur Schläge des Mannes eintrug. Einem Impuls folgend, wollte Louis dem Mädchen beistehen, doch in letzter Minute besann er sich eines Besseren. Er kannte Menschen wie diesen Mann, und er wusste: Erstens würde er den Kürzeren ziehen, und zweitens würde er höchstwahrscheinlich dessen Wut noch anfachen, was die Kleine dann später umso schlimmer abbekommen würde. Seine Stiefmutter war genauso.
Plötzlich schob sich eine blonde, dralle Frau in sein Blickfeld. Sie war größer als er, viel größer, sodass er direkt in ihr üppiges Dekolleté blicken konnte. Der Anblick hätte ihn vermutlich erregen sollen, doch Louis empfand nur einen heftigen Ekel angesichts dieser dermaßen billig zur Schau gestellten Weiblichkeit. Das hier hatte nichts von all dem, was ihm wichtig war. Es war plump und plakativ, nicht feinsinnig und vielschichtig.
»Da guckste, was?«, meinte die Blondine. »Einmal anfassen kostet zehn Sous.«
»Lassen Sie mich durch!« Louis wollte gerade an der Drallen vorbeischlüpfen, als die ihn mit überraschend festem Griff am Arm packte. »Gucken kostet auch«, sagte sie, und auf einmal war ihre Stimme nicht mehr verlockend-süß, sondern hart und kalt. »Und geguckt hast du, und wie. Her mit dem Geld, sonst hol ich den Antoine, und dann gnade dir Gott.«
Louis wusste zwar nicht, wer dieser Antoine war, legte auf eine Begegnung mit ihm aber nicht den allergeringsten Wert. Und er war nicht umsonst im Jura aufgewachsen, jener harten, kantigen Gegend, die auch seine Bewohner hart und kantig machte. Er wandte den Kopf und sah der Blonden mit einem derartig eisigen Blick der Verachtung in die Augen, dass diese ruckartig von ihm abließ.
»Schon gut«, murmelte sie und eilte mit wackelndem Hintern davon.
Louis atmete für einen Moment auf, doch dann spürte er Bitterkeit in sich aufsteigen. Was, wenn es das Paris, nach dem er sich in den letzten beiden Jahren gesehnt hatte, gar nicht gab? Aber das konnte doch nicht sein, schließlich hatte jeder, absolut jeder, dem er begegnet war, von Paris geschwärmt! Es musste einfach noch eine andere Seite von Paris geben, und er würde sie finden. Allein schon seiner Geschwister wegen. Zwei Jahre war es nun her, dass er sie gesehen hatte, zwei Jahre, in denen sie den Gemeinheiten von Marie Coronnée ausgesetzt waren, so wie dieses kleine Mädchen von gerade eben den Grobheiten seines Vaters. Er hatte ihnen versprochen, für sie zu sorgen, sie nachzuholen. Und er würde sein Versprechen halten! Wieder schob sich das Gesicht seiner Mutter vor sein inneres Auge. »Du kannst alles erreichen, was du nur willst«, raunte sie ihm zu. »Glaub an deine Träume, hörst du? Sie werden wahr.«
Ja, dachte Louis. Er würde nicht aufhören, an seine Träume zu glauben. Und er würde nicht aufhören, zu suchen. Irgendwo musste dieser wunderbare Ort doch sein, von dem sie alle so schwärmten!
Kapitel 3
Louis sollte recht behalten: Es gab sie, die Stadt seiner Träume, und er entdeckte sie, als er die Île de la Cité auf ihrer anderen Seite wieder verließ. Er bestaunte den Louvre, die Tuilerien, folgte der unter Napoleon I. erbauten Rue de Rivoli immer weiter in Richtung Westen und passierte das Palais Royal. Die Düsternis der Quartiers, die er durchquert hatte, wich quirlendem, sprudelndem, leuchtendem Leben. Elegant gekleidete Damen und Herren bevölkerten die Straßen oder gönnten sich in den Cafés und Restaurants etwas zu trinken oder zu essen. Viele saßen draußen bei einem Kaffee und einem Croissant, legten die Köpfe in die Nacken und ließen sich die wärmenden Pariser Sonnenstrahlen in ihre Gesichter scheinen. Und alle, wirklich alle, lächelten und strahlten größte Zufriedenheit aus. Auch Louis, der seine Zuversicht zurückgewonnen hatte, lächelte nun, während er beschwingt weiterging und immer weiter. Er sah Läden mit prachtvollen Auslagen, die Schaufenster ein Stückchen zurückversetzt hinter Arkaden, sodass die feinen Damen auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes von Geschäft zu Geschäft eilen konnten. Nicht einmal die zahlreichen Bauarbeiten störten die Idylle, waren sie doch ein Zeichen des Fortschritts. Es war deutlich zu erkennen, dass hier allüberall noch weitere prachtvolle Häuser entstehen würden, eines größer und luxuriöser als das nächste. Auch die Luft war hier besser. Nicht zu vergleichen mit der klaren Bergluft seiner Heimat freilich, aber doch um Längen angenehmer als der Mief, den Louis in den finsteren Vierteln hatte atmen müssen.
Ja, dachte Louis, hier war er richtig. Hier war er angekommen. Er hatte es doch gewusst, und die Mutter hatte recht gehabt. Man musste nur an seine Träume glauben und seine Ziele unbeirrt verfolgen. Dann würden die Träume zur Wahrheit werden.
Das Glück war Louis weiterhin hold: Es gelang ihm auf Anhieb, eine günstige und saubere Pension zu finden, in der er die nächsten Nächte verbringen konnte, während er sich tagsüber auf die Suche nach einer Lehrstelle begab. Als die resolute Wirtin ihm gleich nach seiner Ankunft eine große Schale Suppe auf den blank gescheuerten Holztisch stellte, knurrte sein Magen vernehmlich. Viel zu schnell war die Schüssel leer. Er wollte sich gerade den letzten Löffel in den Mund schieben, den er sich mühevoll zusammengekratzt hatte, als sich ein weiterer Gast zu ihm an den Tisch gesellte. »Auf der Durchreise, junger Mann?«, fragte sein Gegenüber, ein schlanker, eleganter Herr, den Louis auf Mitte zwanzig einschätzte.
»Nein«, erwiderte der Junge aus Anchay, während er neidisch auf die dampfende Suppenschüssel äugte, die die Wirtin nun auch ihrem zweiten Gast servierte. »Ich hoffe, hier Arbeit zu finden.«
»Einem so kräftigen Burschen wie dir sollte das doch ein Leichtes sein«, urteilte der Gast und tunkte genussvoll den Löffel in seine Suppe.
»Ich suche ja nicht nur nach Arbeit«, ließ ihn Louis wissen, »sondern nach einer Lehrstelle.«
»Auch das wird kein Problem sein«, war sich der Fremde sicher. »Ich heiße übrigens Raphael«, fuhr er fort und reichte seine Hand über den Tisch.
»Louis«, erwiderte der Sechzehnjährige und schüttelte die angebotene Hand. »Und Sie, sind Sie auf der Durchreise?«
Raphael nickte und ergänzte: »Ja, nur ein paar Tage. Mein Vater hat beim Bau der ersten Eisenbahnstrecke in Paris mitgearbeitet.«
»Oh«, machte Louis beeindruckt. »Wo ist denn diese Baustelle?«
»In der Nähe des Jardin de Tivoli«, erwiderte der Mann, der seine Suppe inzwischen ebenfalls ausgelöffelt hatte und, wie zuvor Louis, mit bedauerndem Gesichtsausdruck in seine Schüssel blickte. Dann fügte er hinzu: »Aber es ist keine Baustelle mehr. Es ist fertig.«
»Jardin de Tivoli sagt mir nichts«, gestand Louis und fügte zu seiner Verteidigung hinzu: »Ich bin ja gerade erst angekommen.«
Raphael hatte seinen Einwurf offenbar nicht gehört oder er ignorierte ihn, jetzt fuhr er jedenfalls fort: »Morgen kommt sogar die Königin zur Einweihung der Strecke.«
»Da wäre ich gerne dabei«, seufzte Louis. »Ich habe noch nie eine Monarchin gesehen.«
»Dann lass uns doch morgen zusammen hingehen.«
»Aber kann man denn einfach so dort auftauchen?«, fragte Louis zweifelnd.
»Natürlich nicht«, stimmte Raphael ihm zu. »Aber von den Anhöhen oberhalb der Strecke hat man einen guten Blick.«
»Dann abgemacht«, rief Louis voller Vorfreude. Schon bevor er sich die Suppe bestellt hatte, hatte er die Münzen in seinem Lederbeutel gezählt und zufrieden festgestellt, dass die nächsten drei Wochen gesichert waren. Die Suche nach einer Lehrstelle konnte gut und gerne noch einen halben Tag warten.
»Abgemacht«, bestätigte Raphael und hob die Hand, um bei der Wirtin noch eine Suppe zu bestellen. Diesen Luxus wollte sich Louis dann doch nicht leisten.
Die Sonne strahlte mit den fröhlichen Gesichtern der Schaulustigen um die Wette, die sich am Donnerstag, 24. August 1837, auf der kleinen Anhöhe nahe des ersten Bahnhofs in Paris eingefunden hatten, um der Eröffnung der Bahnstrecke beizuwohnen. Auch, wenn er der Königin sicher nicht begegnen würde, war Louis bereits im Morgengrauen aufgestanden, um seine Schuhe, die vom Staub der Reise ganz blind geworden waren, auf Hochglanz zu polieren und seine Kleidung so gut es ging auszubürsten. Das würde sicherlich auch für seine folgenden Versuche, eine Lehrstelle zu finden, nicht von Nachteil sein. Stunden später stand er gespannt neben Raphael sowie einer Reihe weiterer Schaulustiger und wartete auf Maria Amalia von Neapel-Sizilien, einer Nichte von Marie Antoinette, wie Louis von Raphael erfahren hatte. Jener Königin, die während der Französischen Revolution gemeinsam mit ihrem Gatten und Regenten Louis XVI. hingerichtet worden war. Maria Amalias Angetrauter hingegen hatte die Revolution zunächst unterstützt und war sogar selbst Mitglied des revolutionären Jakobinerclubs geworden. Doch nach einem misslungenen Umsturzplan floh Louis-Philippe zunächst in die Schweiz und gelangte über mehrere Zwischenstationen schließlich auf Einladung von König Ferdinand III. von Sizilien nach Palermo, wo er dessen Tochter am 25. November 1809 heiratete.
Nach der Abdankung Napoleons zog das Paar, das die ersten fünf Ehejahre in Italien verbracht hatte, nach Frankreich. Da Louis-Philippe sich sehr volksnah gab – seine Kinder besuchten unter anderem die öffentlichen Schulen –, wurde er nach Absetzung Charles X. König der Franzosen, von Gottes Gnaden und dem Willen des Volkes. All das hatte Raphael Louis berichtet – und Louis hatte bei dessen Schilderung ein tiefes Gefühl der Befriedigung erfahren, wie immer, wenn es ihm gelang, zwei Puzzleteilchen zusammenzusetzen: Von Louis-Philippe hatte sein einstiger Nachbar Clément schließlich so geschwärmt, als er Louis empfohlen hatte, ebenfalls nach Paris zu gehen und sein Glück zu machen. Und nun würde er also gleich die Frau ebenjenes wunderbaren Königs zu Gesicht bekommen.
»Dort sind sie!«, hallte ein begeisterter Ruf durch die Menge. Louis blickte andächtig auf eine prächtige Kutsche, die von sechs Schimmeln gezogen und von einem Reitertrupp begleitet wurde. »Die Königin, die Königin kommt!«
Die Kutsche kam vor dem provisorischen Bahnhofsgebäude zum Stehen, und sogleich eilte ein Diener herbei und stellte einen kleinen Tritt bereit.
Louis’ Herz raste. So enttäuschend seine Ankunft gewesen war: Das hier wog alles auf, was er gestern an schlimmen Erfahrungen gemacht hatte. Hiervon wollte er seinen Geschwistern und dem Vater ins Jura schreiben.
Die Königin ließ sich Zeit. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, doch dann erschien ihre Gestalt in der Kutschentür – und die Schaulustigen jubelten.
Voller Neugierde beobachtete Louis Frankreichs Königin. Sie war keine Schönheit, doch sie strahlte eine derartige Würde und Eleganz aus, dass die Menge – und auch Louis – sie wie gebannt anstarrte. »Sie ist … beeindruckend«, flüsterte er Raphael zu.
»In der Tat, das ist sie«, bestätigte der.
»Warum ist der König eigentlich nicht dabei?«, wollte Louis wissen und schob dann rasch hinterher: »Er hat sicherlich zu viel zu tun?«
»Er bleibt aus Sicherheitsgründen fern«, korrigierte Raphael ihn. »So lange gibt es die Eisenbahn ja noch nicht, und es könnte etwas schiefgehen.«
»Und seine Frau lässt er das Risiko eingehen?« Louis war empört, und sein Bild von dem viel gelobten Bürgerkönig bekam die ersten Risse.
»Nun ja, ich vermute, sie hat es sich nicht verbieten lassen«, nahm Raphael den König in Schutz. »Und aus meiner Sicht zeugt es von der Verantwortung des Königs für sein Land. Würde ihm etwas zustoßen, hätte es keinen Regenten mehr.«
Louis war mit der Antwort zwar nicht ganz zufrieden, sagte aber nichts mehr, sondern verfolgte genau, wie die Königin zu dem kleinen Bahnhofsgebäude schritt und in einen der feierlich geschmückten Eisenbahnwaggons stieg. In diesem Moment erreichten weitere Wagen das Bahnhofsgelände, in denen allerdings nur das Gepäck der Königin transportiert wurde. Mühsam luden die Helfer die großen, schweren Kisten von den Kutschendächern sowie den Rückbänken und stellten sie auf bereitstehende Rollwagen.
»So viel Gepäck«, flüsterte Louis staunend.
»Ja«, stimmte Raphael ihm zu. »Das ist wirklich enorm – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Eisenbahnstrecke gerade mal gut zwölf Meilen lang ist.«
»Wie bitte?«, hakte Louis nach und dachte an das kleine Bündel, das ihn zwei Jahre lang begleitet hatte. Aber er war ja auch keine Königin. »Und dafür benötigt sie so viel Gepäck? Wohin fährt denn der Zug?«
»Nach Le Pecq«, erwiderte Raphael. »Der Adel nimmt stets sehr viele Dinge mit. Wenn der Hof verreist, ist das immer ein halber Umzug.«
Mit einem Kopfschütteln wandte Louis seine Aufmerksamkeit wieder den Helfern zu, die gerade versuchten, die wuchtigen Kisten mit den gewölbten Deckeln im Gepäckwagen des Zugs unterzubringen.
»Sind diese Kisten nicht unpraktisch?«, überlegte er.
Fragend sah sein neuer Freund ihn an. »Weshalb?«
»Man kann sie im Zug nicht aufeinanderstapeln – sie würden ja kippen.«
»Da hast du natürlich recht«, versetzte Raphael. »Diese Kisten sind wohl noch nicht auf diese neue Form des Reisens ausgelegt. Für die Kutschfahrten sind die gewölbten Deckel hingegen unerlässlich, weil …«
»… sonst das Regenwasser nicht ablaufen könnte«, ergänzte Louis. »Das ist mir schon klar.«
Inzwischen war alles Gepäck im Zug verladen, und die Lok mitsamt Waggons setzte sich lautstark in Bewegung. Nach wenigen Augenblicken waren nur noch die weißen Dampfwölkchen am Himmel zu sehen – doch auch sie verschwanden rasch, ebenso wie die Menge, die sich binnen weniger Augenblicke auflöste.
»Komm, lass uns gehen«, sagte Raphael. »Ich habe Durst.«
»Gut«, murmelte Louis und folgte dem anderen in Gedanken versunken den Hügel hinunter. Er dachte immer noch darüber nach, wie man die Gepäckwagen sinnvoller bestücken könnte. Und auch, wie unpraktisch die vielen Hutschachteln waren, die sein Vater stets für seine Mutter, die Modistin gewesen war, angefertigt hatte. Zwar ließen sich die großen zylinderförmigen Schachteln gut übereinanderstapeln, aber seitlich boten sie durch ihre runde Form kaum Halt. Eckig, dachte Louis, eckig und flach müssten die Koffer sein, wie die von Hand gefertigten Bauklötze seines Vaters, die sein kleiner Bruder Claude immer so gern gestapelt hatte. Wieder einmal überkam ihn ein heftiges Gefühl der Sehnsucht nach seinen Lieben im Jura. Wie gerne wäre er jetzt bei ihnen, wie gerne würde er wieder einmal ihre Stimmen hören, doch das würde wohl noch eine Weile dauern. Wenn er diesem Ziel näher kommen wollte, dann musste er nun erst einmal eine gute Lehrstelle finden und ein ordentliches Auskommen haben, um seine Geschwister eines Tages nach Paris holen zu können.
Kapitel 4
Louis’ Geduld wurde erneut auf eine harte Probe gestellt, als er sich rund um die Place Vendôme auf die Suche nach einer Lehrstelle begab. Die meisten Lehrherren hatten für einen sechzehnjährigen Knaben aus dem Jura nur ein müdes Lächeln übrig. »Wir sind hier in einem der besten Viertel von Paris, Junge«, hörte er wieder und wieder. »Versuch es doch mal draußen bei den Färbern und Ledergerbern, die können kräftige Burschen wie dich gebrauchen.«
Doch Louis wollte nicht zu den Ledergerbern. Und er wollte auch nicht zu den Färbern. Er wollte genau hierher. Und er war bereit, dafür zu kämpfen. Plötzlich, er befand sich an der Kreuzung der Rue du 29-Julliet und der Rue Saint-Honoré, wenige Hundert Meter von den Tuilerien entfernt, fiel sein Blick auf ein Schaufenster auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das von riesigen Kisten mit gewölbten Deckeln eingenommen wurde – ebensolche Kisten, wie sie am Vortag von den Kutschen der Königin geladen worden waren. Wie magisch angezogen, überquerte er die Straße. Laute Rufe und Wiehern ertönten, und Louis bemerkte erschrocken, dass er beinahe vor ein Fuhrwerk gelaufen wäre.
Entschuldigungen murmelnd trollte er sich von der Straße und bemerkte, dass auch auf dieser Kutsche Kisten mit gewölbten Deckeln geladen waren. Dann wandte er seinen Blick wieder dem Ladengeschäft zu, auf das er gerade zusteuerte. Über der Tür hing ein großes Schild: Kistenmacherei & Verpackerei Maréchal. Nur Mut, Louis Vuitton, sagte er sich und stieß die Ladentür auf.
Im Geschäft umfing ihn eine etwas staubige Dunkelheit. Louis brauchte ein wenig, bis sich seine Augen an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Suchend blickte er sich um, als auch schon durch eine Tür im hinteren Bereich des Geschäfts eine schmale Gestalt auf ihn zusteuerte. Er sah sich einem freundlich wirkenden Herren in den Fünfzigern gegenüber, der ihn ein wenig an seinen Vater erinnerte.
»Guten Tag«, sagte er.
»Guten Tag«, erwiderte der Mann. »Was kann ich für dich tun?«
»Ich bin Louis Vuitton und auf der Suche nach einer Lehrstelle«, stieß Louis hervor.
»Soso«, erwiderte der Mann. »Bist du das.«
Louis’ Gedanken rasten. Diesmal durfte er sich einfach nicht wieder wegschicken lassen – hier war er ganz und gar richtig, das spürte er!
»Bitte«, sagte Louis. »Ich weiß, dass Ihr sicherlich nicht auf mich gewartet habt. Aber ich möchte unbedingt Kistenmacher werden.«
Er verschwieg, dass er an diesem Tag schon bei fünf anderen Handwerksbetrieben vorstellig geworden und erst jetzt auf die Idee gekommen war, dass Kistenmachen ja auch ein Beruf war! Wieso war er da eigentlich erst draufgekommen, als er das Schaufenster des Monsieur Maréchal erblickt hatte? Immerhin war sein Vater ja neben seiner Tätigkeit als Müller auch in gewisser Weise Kistenmacher gewesen, hatte er doch die Hutschachteln für Maman gefertigt! Und genau das sagte er dem Mann nun: »Sie müssen wissen, mein Vater hat mir im Jura beigebracht, wie man Hutschachteln herstellt. Ich liebe Holz, den Duft, die Struktur …«
Das Lächeln auf dem Gesicht seines Gegenübers wurde breiter. »Das klingt alles sehr überzeugend«, sagte der Mann.
Louis blinzelte. Damit hätte er nicht gerechnet. »Wie bitte?«
»Das klingt alles sehr überzeugend«, wiederholte der Mann. »Ich würde sagen: Gehen wir doch nach nebenan, und du zeigst mir, was du kannst.«
»Oh!«, rief Louis überrascht. »Ihr gebt mir eine Chance?«
»Das tue ich, mein Junge. Scheinst mir ein aufgewecktes Bürschchen zu sein, und ich brauche tatsächlich jemanden. Hier.« Er erhob sich etwas umständlich wieder, ging zu einem großen Lagerregal, in dem verschiedene Bretter lagen, holte einige davon heraus und deutete auf ein Werkzeugregal. »Schaffst du es schon, mir eine Kiste anzufertigen für«, er sah sich suchend um, dann fiel sein Blick auf ein Paar Arbeiterhandschuhe, die in der Ecke lagen, »für dieses Paar Handschuhe?«
»Natürlich, Monsieur«, sagte Louis und blickte sich nach einem Maßband um. Zufrieden stellte er fest, dass alles – Maßband, Stift, Block, Säge, Hammer und Nagel – in dem Werkzeugregal bereitlag. Er legte die Handschuhe auf die Werkbank, strich sie glatt und nahm Maß, wobei er darauf achtete, ringsherum etwa einen Zentimeter Platz zu lassen. Er übertrug die Zahlen auf einen Block und machte dann eine Skizze.
»So«, sagte er zu Monsieur Maréchal, »nun würde ich die Maße auf das Brett übertragen und dann zu sägen beginnen.«
»Sehr gut«, nickte Maréchal anerkennend. »Wie sorgst du dafür, dass die Kanten gerade sind?«
»Zunächst einmal, indem ich die U-Säge verwende«, erwiderte Louis und griff zu einem Werkzeug, von dem sein Vater ihm erklärt hatte, dass man es Laubsäge nennt. »Und dann spanne ich das Brett auf das Tischchen«, schlug Louis vor und richtete seinen Blick auf das kleine, v-förmig eingeschnittene Holzbrett, das mit einer Zwinge am Arbeitstisch befestigt war.
»Sehr gut.« Maréchal nickte anerkennend. »Ich brauche dir ja gar nichts mehr beizubringen.«
Louis errötete vor Freude. »Oh, ich bin überzeugt, dass ich bei Euch noch eine Menge lernen kann, Monsieur.«
»Na, dann versuchen wir es doch zusammen, zumal ich wirklich Hilfe gebrauchen kann.«
Überrascht sah Louis auf. »Aber soll ich denn die Kiste gar nicht fertig machen, Monsieur?«
Der Meister winkte ab. »Das, was du mir bisher gezeigt und erklärt hast, hat mich überzeugt«, sagte er. »Ich bin übrigens Monsieur Maréchal, der Besitzer dieses Geschäfts.«
Louis war so überglücklich, dass er gar nicht wusste, wohin mit seiner Freude. »Ich danke Euch«, stieß er hervor. »Ich danke Euch sehr!«
»Schon gut. Übrigens wohnen unsere Lehrbuben auch bei uns. Wir haben zwei Kammern für sie, wobei wir gerade keinen Lehrbub haben, du hast also die Qual der Wahl. Meine Frau wird sich freuen. Sie kümmert sich gern um unsere Lehrbuben, vor allem, wo unsere Söhne doch schon lang aus dem Haus sind.«
Das wurde ja immer besser!
»Ich weiß gar nicht, wie ich Euch danken soll, Monsieur«, wiederholte Louis.
»Durch gute Arbeit«, versetzte Maréchal. »Ich nehme an, du besitzt die eine oder andere Habseligkeit?«
»Ja«, bestätigte Louis. »Bisher wohne ich in einer Pension in der Nähe.«
»Du kannst deine Sachen gleich holen und bei uns einziehen«, schlug Maréchal vor. »Wir erwarten dich zum Abendessen.«
»Das ist sehr freundlich«, erwiderte Louis, dann fügte er hinzu: »Ich hoffe, meine Zimmerwirtin lässt mich gehen.«
»Wenn du möchtest, begleite ich dich. Es ist ohnehin Ladenschluss.«
»Sehr gern«, freute sich Louis.
Als sie nach draußen traten, schrie er vor Überraschung auf: Obwohl es eigentlich dunkel war, war es draußen hell! In Dutzenden Laternen flackerten kleine Gasflammen und warfen ihren warmen Schein auf die Straßen. »Das ist unglaublich!«, flüsterte Louis.
»Nicht wahr?«, fragte Monsieur zufrieden.
»Nennt man Paris deshalb Stadt des Lichts?«, begriff Louis.
»Diesen Ausdruck habe ich zwar noch nie gehört, aber er passt sehr gut«, erwiderte Maréchal. »Und dann ist Paris sogar schon länger eine Stadt des Lichts.«
»Wie lange?«, erkundigte sich Louis. »Und warum?«
»Seit dem 17. Jahrhundert. Es waren finstere Zeiten, im wahrsten Sinne des Wortes, und überall ereigneten sich schlimme Verbrechen. König Louis XIV. versuchte, dem Treiben gemeinsam mit seinem Minister Jean-Baptiste Colbert und dem Generalleutnant der Polizei, Gilbert Nicolas Reynie, Einhalt zu gebieten. Es war Reynie, der den wunderbaren Einfall hatte, die dunklen und verwinkelten Gassen der Stadt zu beleuchten.«
»Mit solchen Lampen?«, fragte Louis und deutete auf die Gaslaternen.
Monsieur Maréchal schüttelte den Kopf. »Nein, die gab es damals noch nicht. Aber es gab Fackeln. Und den Bewohnern riet er außerdem dazu, Kerzen und Öllampen in ihre Fenster zu stellen. Die Stadt begann zu leuchten.«
»Das sah bestimmt wunderschön aus«, überlegte Louis und dachte, dass sicherlich die engen Gassen, durch die er nach seiner Ankunft gekommen war, im Lichtschein freundlicher gewirkt hätten. »Mir gegenüber hat ein Reisender von Paris als von der Stadt des Lichts gesprochen, und als ich ihn fragte, was es damit auf sich hat, sagte er mir, ich solle herkommen und es selbst herausfinden.«
»Und das hast du ja jetzt getan«, sagte Monsieur Maréchal und lächelte ihm erneut freundlich zu. »Und ich bin sehr froh darüber.«
»Ja«, sagte Louis. »Ja, ich auch. Und ich bin froh darüber, dass ich Euch gefunden habe.«
Inzwischen hatten sie die Pension erreicht. Die Wirtin bestand zwar darauf, diese Nacht noch zu berechnen, war aber einverstanden, Louis die weiteren Nächte zu erlassen.
»Wunderbar«, freute sich Monsieur Maréchal. »Dann lass uns nach Hause gehen.«
Kapitel 5
Madame Maréchal erwies sich als ebenso freundlich wie ihr Gatte. Sie empfing Louis nicht nur mit offenen Armen, sondern buchstäblich wie einen verlorenen Sohn und setzte ihm sogleich einen riesigen Teller Bratkartoffeln mit Speck vor. Dieses Mal musste er nicht, wie zwei Tage zuvor in der Pension, hungrig nach anderen, volleren Tellern schielen: Sobald der seine leer war, schöpfte die aufmerksame Madame Maréchal ihm nach. Auch in seinem Zimmer fühlte Louis sich sofort wohl. Es war im Dachgeschoss des Hauses gelegen, in dem sich auch das Ladengeschäft und die Werkstatt befanden und in dem die Maréchals lebten. Es war gemütlich eingerichtet und eröffnete einen hervorragenden Blick über die Stadt. Ja, dachte Louis glücklich. Es war nicht einfach, und der Weg lang gewesen, aber nun war er am Ziel. Besser hätte er es wahrlich nicht treffen können!
Die Gegend, in der Louis gelandet war, hieß Saint-Honoré, verfügte über eine Vielzahl prächtiger Herrenhäuser mit wunderschönen Gärten und war der bevorzugte Lebensort erfolgreicher Kaufleute, die, ihre Aktentaschen unter dem Arm, durch die Straßen eilten oder sich von ihren Lakaien kutschieren ließen. Dass sich das Geschäft des Kistenmachers und Verpackers Monsieur Maréchal sogar in der Rue Saint-Honoré befand, wertete Louis als gutes Zeichen. Wenn die Straße wie das Viertel hieß, musste es ja die wichtigste im ganzen Quartier sein.
»Die alte Aristokratie lebt eher im Saint-Germain«, hatte Madame Maréchal erklärt. Diese Gegend hier habe die neue Elite für sich auserkoren, es sei eine junge, quirlige und aufstrebende Gesellschaft.
Louis nickte beeindruckt. Das gefiel ihm, viel besser als alte Aristokratie, was sich in seinen Ohren etwas staubig anhörte – auch wenn ihn die Königin freilich beeindruckt hatte. Aber ein wenig alt war sie eben auch, ebenso wie die Kisten, die ihre Diener ihr hinterhergetragen hatten und die sich so gar nicht für diese neue Art des Reisens eigneten. Jung, quirlig und aufstrebend hingegen, das war er selbst auch; vielleicht könnte er sich von diesem so zu ihm passenden Strom ja mitreißen lassen. Und von seinem Zauber natürlich erst recht.
In Monsieur Maréchals Werkstatt arbeiteten noch ein weiterer Meister, Monsieur Bernard, und ein Geselle namens Charles Dubois. Beide empfingen Louis mit ebenso offenen Armen, wie das Ehepaar Maréchal es getan hatte: Der Junge aus dem Jura sollte bald feststellen, dass sie alle miteinander wie eine große Familie waren, einander halfen und sich zur Seite standen. Vor allem zu Charles, der ebenfalls bei Monsieur Maréchal in die Lehre gegangen war und gerade ausgelernt hatte, entwickelte Louis schnell eine innige Beziehung, was sicherlich auch daran lag, dass der andere nur zwei Jahre älter war als Louis und ihm rasch das Du anbot.
»Monsieur legt großen Wert darauf, dass wir uns gut verstehen«, sagte er, als die beiden jungen Männer an Louis’ zweitem Tag miteinander abends nach Ladenschluss durch die Straßen zogen – Charles hatte ihm angeboten, ihm ein wenig die Gegend zu zeigen.
»Wir hatten einmal einen Gesellen, der immer versucht hat, die anderen zu übertrumpfen. Nach einer einzigen Warnung hat Monsieur ihn vor die Tür gesetzt.«
Louis musste an seine Stiefmutter zu Hause denken und spürte einmal mehr Dankbarkeit darüber in sich aufsteigen, dass er hier an diesem Ort gelandet war, der ohne vergiftete Atmosphäre auskam. In dieser Stadt des Lichts und, so schien es ihm, auch in diesem Haus des Lichts. Monsieur Maréchal, ein geduldiger Lehrmeister, der nicht müde wurde, seinen Zögling für sein Geschick und seine Kunstfertigkeit zu loben, nahm ihn selbst unter seine Fittiche.
»Für unseren Beruf gibt es zwei Begriffe, weil wir streng genommen auch zwei Berufe ausüben: Layetier für Kistenmacher und Emballeur für Verpacker. Diese Berufe gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert«, sagte Monsieur, während er Louis zeigte, wie man die Haihaut, mit der er wieder und wieder über das Holz fuhr, so hielt, dass die Oberfläche glatt und samtig wurde.
Louis nickte beeindruckt. So wie die Geschichte des Lichts drängte es ihn, auch die Geschichte des Berufs zu erfahren, den er da gerade erlernte. »Wie kam es denn dazu?«, erkundigte er sich wissbegierig. »Also, dass unser Beruf ausgerechnet im 16. Jahrhundert entstanden ist?«
Monsieur Maréchal schien auf diese Frage gewartet zu haben. »Zu jener Zeit war der Hof sozusagen ständig auf Achse«, erklärte er. »Man wechselte wieder und wieder zwischen Paris, Fontainebleau und dem Loiretal, und außerdem war der Monarch ohnehin ständig auf Reisen durch sein Königreich. Da der Hofstaat die notwendigen und wertvollen Gegenstände mit sich führen musste, galt es, sie sorgsam zu verpacken, um sie gegen die Erschütterungen beim Transport, wenn die Pferde über die unebenen Straßen trabten, abzufedern.«
Maréchal deutete auf eine Kiste, die Charles gerade fachkundig zusammensetzte. »Und je besser und vor allem passgenauer die Kiste, desto geringer die Gefahr, dass der wertvolle Inhalt zu Bruch geht. Wichtig war und ist natürlich, dass der Gegenstand, den es zu transportieren gilt, dann auch sachgemäß in die Kiste gelegt wird. Und deshalb sind wir nicht nur Kistenmacher, sondern auch Verpacker.«