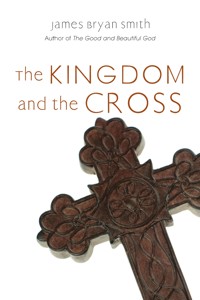Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Innerhalb von drei Jahren verliert der erfolgreiche Autor Tim Hudson seine Mutter, seinen besten Freund und auch noch seine kleine Tochter. Tief erschüttert und voller Trauer gerät sein Glaube an einen liebenden Gott ins Wanken. Ausgebrannt zieht sich Tim in ein Kloster zurück. Dort wird ihm ein "geistlicher Begleiter" zur Seite gestellt: der unkonventionelle Bruder Taylor. Eines Nachts hat Tim einen außergewöhnlichen Traum. Er begegnet im Himmel den Menschen, die seinen Glauben und sein Leben geprägt haben - und den dreien, die ihm so sehr fehlen. Eine heilsame Reise beginnt ... Ein bewegender Roman, der in Stil und Botschaft ähnlich ermutigend wie der Weltbestseller "Die Hütte" von William P. Young ist. Mit einem Nachwort von Dallas Willard.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Bryan Smith
Der Traum
Eine Geschichte vom Himmel, die das Herz heilt
Deutsch von Beate Zobel
Die amerikanische Originalausgabe erschien im Verlag Broadman & Holman, Nashville, Tennessee, unter dem Titel „Room of Marvels“.
© 2007 by James Bryan Smith
© der deutschen Ausgabe 2010 by Gerth Medien GmbH, Dillerberg 1, 35614 Asslar
Die Bibelzitate wurden der folgenden Bibelübersetzung entnommen: Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
ISBN 978-3-96122-189-9
Umschlaggestaltung: Immanuel Grapentin
Umschlagfoto: Getty Images/Shutterstock/iStock
Datenkonvertierung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Nachwort
Dank
Anmerkungen
Kapitel 1
Vor der Mautstelle hatte sich eine lange Schlange gebildet. Der feine Regen formte auf meiner Windschutzscheibe dicke Tropfen, die sich in kleinen Rinnsalen sammelten. Schließlich kam der Verkehr ganz zum Stehen.
Mein Blick fiel auf die Broschüre, die neben mir auf dem Beifahrersitz lag. Ich griff danach und las: Kloster zum Heiligen Stephanus. Darunter glänzte das Foto eines alten Gemäuers, das, von Wiesen umgeben, am Ufer eines malerischen Flusses lag. Ein Ort der Ruhe und Erholung, Wallfahrts- und Besinnungszentrum, Meditationswochen und Exerzitien für Einzelne und Gruppen.
Am liebsten hätte ich das Auto gewendet und wäre wieder nach Hause gefahren. Aber ich war eingekeilt zwischen den anderen Fahrzeugen, die sich mit mir millimeterweise voranschoben. Vor etwa einem Monat hatte mein Pastor mir den Prospekt gegeben. „Tim, du musst mal raus hier“, hatte er gesagt. „Nimm dir Zeit zum Trauern.“ Er hatte durchaus recht. Aber die feuchtkalten Wände eines weihrauchgeschwängerten Klosters waren das Letzte, wonach ich mich jetzt sehnte.
Meine Armbanduhr zeigte genau 11:11 Uhr, als mein alter Volvo die irdische Welt hinter sich ließ und eine gemauerte Toreinfahrt passierte, hinter der ein schmaler Kiesweg auf das Klostergebäude zuführte. Wie eine alte Burg erschien mir das verwitterte Anwesen. Mit einem letzten Blick auf meinen Wagen schritt ich durch den steinernen Torbogen und betrat die Eingangshalle.
Stille umfing mich. Die Wände waren mit edlem Holz getäfelt. An der Rezeption saß eine weißhaarige Dame. Sie blickte von ihrem Buch auf, musterte mich durch ihre Brille und fragte: „Was kann ich für Sie tun?“
„Ich will mich für ein paar Tage hier zurückziehen“, antwortete ich und gab ihr die Hand. „Mein Name ist Tim Hudson.“
„Schön, Sie kennenzulernen, Mr Hudson“, erwiderte sie. Ihrem leichten Akzent nach kam sie aus Neuengland. „Sind Sie etwa der Tim Hudson, von dem es so viele Bücher gibt?“
„Na ja, ich habe ein paar Bücher geschrieben ...“
„Welch eine Ehre, Sie hier zu haben! Erst letzte Woche bin ich mit Gott ist auf deiner Seite fertig geworden. Ein schönes Buch! Meine Schwester in Seattle hat mir ein Buch von Ihnen zu Weihnachten geschenkt, und seitdem bin ich ein Fan. Ich freue mich riesig, dass Sie jetzt bei uns sind. Sind Sie als Redner gekommen?“
„Nein, ich bin hier als ..., ich brauche Zeit zum ...“
„... zum geistlichen Auftanken?“, vollendete sie meinen Satz und kritzelte eine Notiz auf meine Akte.
„Ja, so könnte man es nennen. Verzeihen Sie, wie war Ihr Name bitte?“
„Ich bin Virginia. Ich freue mich so sehr, dass Sie hier sind. Sie haben sich einen schönen Ort ausgesucht, um sich zu erholen. Von den meisten Zimmern aus kann man den Fluss sehen. Wir haben herrliche Parkanlagen. Ach ja, würden Sie mir bitte Ihren Autoschlüssel geben? Einer der Brüder wird Ihren Wagen dann hinter das Kloster zum Parkplatz bringen.“
Ich zog den Schlüssel aus meiner Hosentasche und betrachtete ihn nachdenklich, ehe ich ihn Virginia aushändigte.
„Sie haben fünf Übernachtungen in einer Einzelzelle gebucht, richtig?“, fragte sie und hängte meinen Schlüsselbund an einen Haken hinter ihrem Tisch.
„Ja.“
„Gut. Die Mahlzeiten sind immer um 8:00, um 12:00 und um 17:00 Uhr. Beim Essen wird nicht gesprochen. Einer der Brüder liest vor, entweder aus der Bibel oder aus einem Andachtsbuch. Die Morgenandacht ist um 6:30 Uhr, um 9:00 Uhr ist das Morgengebet, das Nachmittagsgebet ist um 15:00 Uhr und um 21:00 Uhr ist die Abendandacht. Sie treffen sich jeden Nachmittag um 14:00 Uhr mit Ihrem geistlichen Mentor, Bruder Taylor.“ „Mit wem treffe ich mich?“ „Sie treffen sich mit Ihrem geistlichen Mentor ...“ „Aber ich habe nicht um einen geistlichen Mentor gebeten.“
„Das mag schon sein. Aber jedem unserer Gäste wird ein Mentor zugeordnet. Dafür berechnen wir Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Sie können den Treffen natürlich auch fernbleiben, aber wir empfehlen allen unseren Besuchern sehr, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Fünf Tage in der Einsamkeit können sehr lang werden. Abgesehen davon schaden ein paar geistliche Impulse nie.“
„Vermutlich haben Sie recht. Jetzt möchte ich mich aber gern ein bisschen ausruhen.“
„Selbstverständlich. Sie haben Zelle Nummer 322. Nehmen Sie die linke Treppe nach oben. Bruder Taylor erwartet Sie dann in der Studierstube, Zelle 111, am Ende des Flurs.“
Die Treppe war aus Stein. Alles hier war aus Stein. Mein Zimmer, nein, meine Zelle war etwa drei Meter lang und zwei Meter breit. „Buchstäblich eine Zelle“, murmelte ich und blieb zögernd an der Tür stehen. Der kahle Raum enthielt ein schmales Bett, einen Tisch mit einem hölzernen Stuhl und einen Kleiderschrank. Ich stellte meinen Koffer ab und ging zum Fenster, zog den Vorhang zurück und – starrte auf eine Backsteinwand. Tolle Aussicht, dachte ich sarkastisch. Welch ein Vorrecht! Fünf Tage lang werde ich jetzt diese Mauer genießen. Ich ließ mich auf das Bett fallen, sah mich ein letztes Mal in meiner Zelle um und schlief ein.
Obwohl ich mir keinen Wecker gestellt hatte, erwachte ich um 13:45 Uhr. Zögernd ging ich die Treppe hinunter und den Gang entlang, bis ich ganz am Ende des Flurs vor Zelle 111 stand.
Auf mein Klopfen ertönte eine tiefe Stimme: „Einen Augenblick bitte.“ Kurz darauf wurde die Tür von innen geöffnet, und vor mir stand ein Mann, der etwa Mitte 40 war, kaum älter als ich.
„Ich bin Bruder Taylor. Komm doch rein. Du bist bestimmt Tim.“
„Ja“, antwortete ich und betrat den Raum, der an allen vier Wänden von Bücherregalen gesäumt war. „Sind das viele Bücher!“, staunte ich.
„Ja, die Bücher gehören zum Klosterbesitz.“
Ich stand unsicher mitten im Raum.
„Bitte setz dich doch, Tim“, sagte er freundlich, deutete auf einen gepolsterten Stuhl und setzte sich mir gegenüber auf einen Holzstuhl.
Selbst im Sitzen hatte er eine beeindruckende Statur. Er war nicht übermäßig groß, hatte aber Muskeln wie ein Ringer und dichtes, allerdings schon etwas ergrautes Haar. Was bringt einen Mann dazu, Mönch zu werden?, überlegte ich, während er mich betrachtete. Unter seiner Kutte lugten Laufschuhe und Jogginghosen hervor. Er folgte meinem Blick und ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel.
Schließlich ertrug ich das Schweigen nicht länger und sagte den erstbesten Satz, der mir einfiel: „Schön ist es hier.“
„Ja, wirklich.“
Es war so unerträglich still; ich hörte das Ticken meiner Uhr.
„Meine Fahrt hierher hat fünf Stunden gedauert. Ich komme aus Connecticut und verdiene mir mein Geld mit Bücherschreiben.“
„Ach, wirklich? Was für Bücher schreibst du denn?“, fragte er und beugte sich interessiert nach vorn. „Bücher über geistliches Wachstum.“
Wieder hüllte er sich in Schweigen. Die Tatsache, einem Autor gegenüberzusitzen, schien ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Er hatte die Hände im Schoß gefaltet und sah mich einfach nur an. Die Stille war mir äußerst unangenehm.
Endlich stellte er eine Frage: „Tim, wie würdest du dein derzeitiges geistliches Leben beschreiben?“
„Hm, na ja, es ist ganz okay, denke ich. Ein bisschen Ruhe wird mir guttun.“
„Kannst du mir deine Beziehung zu Gott schildern?“
„Also, ich weiß nicht, ist das jetzt nicht ein bisschen zu persönlich? Könnten wir nicht zuerst über das Wetter reden, bevor ich mein Innerstes hier ausbreite?“
„Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit.“
„Ich bin fünf Tage hier; ich habe jede Menge Zeit.“
„Wirklich?“
„Was meinst du?“
„Tim, es gibt einen bestimmten Grund, warum du hierhergekommen bist. Niemand nimmt sich einfach mal so fünf Tage frei, um hier im Kloster zu sein. Ich versuche es noch einmal anders: Was ist dein Kummer?“
„Also, man könnte sagen, ich bin ein Heuchler geworden.“ Jetzt konnte ich ihm nicht mehr in die Augen sehen, sondern schaute aus dem Fenster.
„Inwiefern?“
„Ich kann selbst nicht mehr glauben, was ich geschrieben habe.“
„Was hast du denn geschrieben?“
„Ich habe ein Buch darüber geschrieben, dass Gott ein guter Gott ist. Darin fordere ich die Leser auf, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Ich habe geschrieben, dass Gott gerecht und barmherzig ist. Aber jetzt ...“
„Was ist jetzt?“
„Ich kann es selbst nicht mehr glauben.“
>„Was?“
„Dass Gott ... gut ist.“
„Wieso nicht?“
Ich starrte auf meine Schuhe und holte tief Luft. „Weil er nicht gut ist, deshalb!“ Ich spürte, wie mir die Zornesröte ins Gesicht stieg.
„Nicht gut?“
Ich schloss die Augen und atmete wieder tief durch. Mein Herz begann, wild zu klopfen. Da war so viel Zorn in mir, tief verborgen, ich hatte ihn noch nie ausgesprochen, nicht einmal mir selbst gegenüber hatte ich mir diese Gefühle eingestanden. Jetzt brachen sie aus mir heraus.
„Es ist jetzt vier Jahre her, dass meine Frau und ich voller Freude ein kleines Mädchen erwarteten. Wir hatten schon einen fröhlichen, aufgeweckten, gesunden Vierjährigen, und jetzt sollte er ein Schwesterchen bekommen. Ich hatte einige Bücher geschrieben, die recht erfolgreich waren. Alles lief perfekt, ich hatte eine wunderbare Frau, einen süßen kleinen Sohn, beruflichen Erfolg, und bald würde noch das Baby dazukommen. Das Leben war schön. Aber wenige Wochen vor der Geburt stellten die Ärzte fest, dass das Baby nicht mehr zunahm. Ein Ultraschall wurde gemacht und dabei kam heraus, dass unser Baby eine Hasenscharte und eine ganze Menge anderer Fehlbildungen hatte. Es wurde vermutet, dass eine seltene genetische Anomalie vorlag und das Kind nicht überlebensfähig sei. Die Ärzte rieten uns, die Vorbereitungen für die Beerdigung des Kindes zu treffen, bevor es überhaupt geboren war. Kannst du dir das vorstellen? Monatelang hatten wir ihr Kinderzimmer eingerichtet, die Wände in Rosa gestrichen, die Wiege aufgebaut – und jetzt sollten wir uns darauf einstellen, dass sie bei der Geburt sterben würde?“
Ich schlug die Hände vors Gesicht und versuchte, die Tränen zu verbergen, die mir über die Wangen strömten. Bruder Taylor stand auf, kam zu meinem Sessel, kniete sich neben mich und legte behutsam seinen Arm um meine Schultern.
„Tim, das tut mir leid.“ Dann steckte er mir ein Taschentuch zu und ging zu seinem Platz zurück. Mit geschlossenen Augen saß er da, als würde er beten. Minutenlang saßen wir uns schweigend gegenüber.
Dann atmete ich wieder tief durch und fuhr fort. „Sie ist nicht gestorben. Madison hatte viele Missbildungen, aber wir haben alles getan, was möglich war, um sie am Leben zu erhalten. Kurz nach ihrer Geburt flogen wir mit ihr nach New York, wo sie am offenen Herzen operiert wurde. Danach schien es ihr etwas besser zu gehen. Wir waren voller Hoffnung und beteten um ein Wunder. Sie konnte nicht selbst trinken, daher wurde sie über eine Sonde ernährt. In den folgenden zwei Jahren verbrachten wir mehr Zeit in der Klinik als zu Hause. Wir schliefen auf dem Fußboden neben ihrem Bett und beteten Tag und Nacht um Heilung. Sie lebte länger, als alle Ärzte vorhergesagt hatten; niemand hätte erwartet, dass sie zwei Jahre alt werden würde.“
Ich atmete schwer und musste einen Moment warten, ehe ich weitersprechen konnte.
„Unsere Wohnung sah zwar aus wie eine Intensivstation, und ungefähr einmal im Monat waren wir zu einer weiteren Operation im Krankenhaus, aber eigentlich ging es uns in dieser Zeit trotzdem noch recht gut. Aber als Madison eineinhalb Jahre alt war, traf uns ein anderer schwerer Schlag. Einer meiner besten Freunde, ein großes Glaubensvorbild für mich, starb bei einem Verkehrsunfall. Wir hatten vor meiner Heirat zwei Jahre lang zusammengewohnt. Meinen eigenen Bruder hätte ich nicht mehr lieben können als Wayne. Er war Musiker und hatte ein wunderschönes Lied für unsere Tochter geschrieben, die er sehr ins Herz geschlossen hatte. Wayne war erst vierzig, viel zu jung zum Sterben. Sein ganzes Leben lang hatte er Gott mit seiner Musik gedient und sich für die Ausgestoßenen unserer Gesellschaft eingesetzt – und dann starb er am Rand einer Autobahn, allein, im Regen. Wie konnte Gott das zulassen? Er war einer der liebevollsten Menschen, die ich kannte. Zahllose Menschen waren durch ihn berührt und mit Gott in Kontakt gebracht worden. Und plötzlich war er nicht mehr da, von einem Moment zum anderen.“
Wieder saßen wir uns schweigend gegenüber. Der nun folgende Teil meiner Geschichte war besonders schwer.
„Sechs Monate nach Waynes Tod starb Madison. Nach einem relativ kleinen Eingriff, der komplikationslos verlaufen war, fiel sie plötzlich ins Koma, und achtundvierzig Stunden später war sie tot.“
Die Erinnerung an diesen Tag überrollte mich. Ich sah mich wieder vor mir, wie ich aus dem Fenster des dritten Stockwerks schaute. Unten schob sich der Verkehr durch die Straßen, als ob nichts wäre. Die Autos hielten an roten Ampeln, fuhren wieder weiter, bogen in Parkplätze ein und hielten vor Restaurants. Menschen überquerten die Straßen, redeten und lachten. Ich dachte:
Wissen sie denn nicht, was gerade passiert ist? Es kann nicht sein, dass sie es nicht wissen! Wie können sie so tun, als ob nichts wäre? Sie können doch nicht einfach so weiterleben? Ich presste die Stirn gegen das Fenster und meine Tränen flossen an der Glasscheibe hinunter, als ob es regnete.
„Wollen Sie die Kleine ein letztes Mal auf den Arm nehmen?“, fragte mich die Krankenschwester. Ich nickte. Die Schwester reichte mir den leblosen Körper und ich wiegte sie in meinen Armen. Sie war noch warm und fühlte sich lebendig an, obwohl sie ihren kleinen Körper verlassen hatte. 40 Minuten zuvor hatten die Ärzte noch um ihr Leben gekämpft. Alle Augen waren auf den Monitor fixiert gewesen. Mehrere Male war ein Herzschlag zu sehen gewesen, der dann wieder ausgesetzt hatte. Nach einiger Zeit hatte ich gesehen, wie erschöpft ihr kleiner Körper war. Ich hatte mich über sie gebeugt und ihr zugeflüstert: „Es ist gut, kleiner Schatz. Du bist sehr tapfer gewesen. Jetzt darfst du gehen und mit den Engeln spielen. Papa wird bald bei dir sein.“ Dabei begann ich so heftig zu zittern, dass ihr ganzes Bett vibrierte.
Auf dem Monitor war kein Lebenszeichen mehr zu sehen. Es war vorbei.
Die Erinnerung löste heftige Gefühle in mir aus. Aufgestauter Zorn wollte sich Luft machen, ich sprang auf und schrie: „Bruder Taylor, was war los mit Gott? Wo war er? Ich war dort. Aber er war nicht da!“
Er antwortete mir nicht, sondern schloss die Augen, als würde er beten. Ich meinte, eine Träne in seinem Augenwinkel zu entdecken.
„Das ist jetzt zwei Jahre her, und die ganze Zeit versuche ich, so weiterzuleben, als ob alles in Ordnung wäre, immer nach dem Motto ,Gott im Himmel hält alles in seiner Hand, es hat schon alles seine Richtigkeit‘. Aber ein Jahr nach Madisons Tod bekam meine Mutter einen Herzinfarkt und starb ebenfalls. Okay, sie war siebzig, aber sie war bis dahin immer kerngesund gewesen. Sie hatte sich vernünftig ernährt und aktiv am Leben teilgenommen. Plötzlich war sie auch nicht mehr da. An ihr hatte ich mich immer orientiert, egal, wo ich gerade war und durch welche Stürme ich gehen musste. Sie war für mich wie ein Fels in der Brandung. Seit ich sie auch nicht mehr habe, fühle ich mich ganz verloren. In den letzten drei Jahren habe ich meinen besten Freund, meine Tochter und meine Mutter verloren – alle drei standen mir sehr nahe. Ich weiß, der Tod gehört zum Leben dazu, alle Menschen sterben irgendwann, es ist bloß ...“
„Was, Tim?“
„Es ist so ... so ungerecht“, stöhnte ich und fühlte mich dabei irgendwie dumm, wie ein Schulkind, das sich über eine schlechte Note beschwert.
„Was ist ungerecht?“
Der Zorn packte mich wieder und die Worte platzten nur so aus mir heraus: „Ich habe wirklich versucht, Gott zu gefallen und so zu leben, wie es ihm gefällt. Klar, ich bin nicht perfekt, nicht einmal annähernd, aber trotzdem, ich halte mich doch zu Gott. Ich gehöre zu ihm! Ich bin sein Freund. Da gibt es doch ganz andere Leute – Drogenabhängige, Kinderschänder –, die haben gesunde Kinder. Warum mussten wir ein Kind mit einem seltenen genetischen Defekt bekommen? Warum, Bruder Taylor? Wo war Gottes Schutz, als mein Freund Wayne auf der Straße starb? Warum musste meine Mutter so früh sterben? Ich hasse Beerdigungen!“
Er dachte offensichtlich gar nicht daran, mir zu antworten, sondern saß einfach nur da und sah mich an.
„Danke, Tim, dass du mir das alles erzählt hast. Ich werde für dich beten. Komm morgen wieder.“
„Was? Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Ich offenbare dir mein Innerstes, und du sagst bloß ‚bis morgen‘? Das kann nicht dein Ernst sein, Bruder Taylor! Ich erwarte ein bisschen mehr von dir. Ich bin kurz davor, meinen Glauben hinzuschmeißen. Du musst mir helfen!“
„Du brauchst Stille, Tim! Es ist gut, dass du hierhergekommen bist. Die Ruhe wird dir helfen. Es scheint mir sehr wichtig, dass du aufhörst, alles im Griff haben zu wollen.“
„Wie kommst du darauf, dass ich alles im Griff haben will?“
„Das ist leicht zu erkennen.“
„Aha.“
Wieder saß er mir schweigend gegenüber. Verunsichert rutschte ich auf meinem Sessel hin und her, verschränkte meine Arme, öffnete sie wieder und fühlte mich erneut wie ein Schuljunge, der zum Lehrer gerufen wurde. „Aber ...“
„Entspann dich, Tim.“
„Was soll ich deiner Meinung nach in den nächsten vierundzwanzig Stunden tun?“
„Nichts.“
„Nichts? Meine Aufgabe heißt, nichts zu tun?“
„Genau. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Versuch nicht, irgendetwas zu leisten. Geh meinetwegen am Fluss spazieren. Setz dich in den Garten. Atme die gute Luft ein. Komm zur Ruhe. Komm innerlich dort an, wo du körperlich gerade bist. Bis morgen, Tim. Ich werde für dich beten. Gott segne dich.“
Kapitel 2
Die Zelle war in meiner Abwesenheit leider nicht größer geworden. Fünf Tage in dieser Kammer – wie sollte ich das aushalten? Ich legte mich aufs Bett und schlief prompt ein.
Kurz vor 17:00 Uhr weckte mich die Glocke, die zum Abendessen rief. Ich ging hinunter zur Eingangshalle, wo Virginia mir winkte und in die Richtung deutete, in der ich den Speisesaal finden würde.
Entlang der Wand standen Teller, Tassen und Besteck, und auf einem dicken Schneidebrett thronte der große Suppentopf. Das Menü wurde von einer Auswahl an rohem Gemüse abgerundet. Ich werde in den fünf Tagen hier mindestens drei Kilo abnehmen, dachte ich und bemerkte, dass alle Mönche schlank waren. Nur ein Einziger hatte Übergewicht. Der schmuggelt bestimmt heimlich Süßigkeiten ins Kloster,dachte ich und grinste. Aber im selben Moment durchzuckte mich der Gedanke: Wenn ich hier für immer leben müsste, würde ich das bestimmt auch tun.
Ich setzte mich schweigend an einen der Tische und begann, meine Bohnensuppe zu löffeln und auf den rohen Karotten herumzukauen. Überraschenderweise schmeckte es aber besser, als ich erwartet hatte. Vielleicht war das hier so ähnlich wie bei einem Campingurlaub, wo alles, was auf dem Gaskocher fabriziert wird, besser schmeckt als zu Hause. Einer der Brüder las laut aus einem Buch von George MacDonald vor, dem alten schottischen Schriftsteller. Alle Übrigen im Raum versuchten, leise zu essen und zuzuhören. Einer der Brüder bat mich mit einer wortlosen Geste, ihm das Salz zu reichen, und nickte lächelnd, als ich es ihm gab.
Das meiste, was gelesen wurde, rauschte an mir vorüber, bis der Vorleser zu folgendem Abschnitt kam: „Fange an, so zu lieben, wie Gott liebt. Das wird deinen Schmerz bald lindern. Aber auf den Trost warte geduldig, bis seine Stunde dafür gekommen ist. Nur er allein weiß, in welcher Weise er dir begegnen kann. Mag sein, er wird dir seine zukünftigen Pläne nie enthüllen, doch du darfst wissen, was er bereits getan hat. Seine Gaben sind so gewaltig, dass du sie erst im Moment des Empfangens begreifen kannst. Doch sobald du sie erfassen kannst, sind sie dein.“
Meinen Schmerz kann man nicht lindern, dachte ich, und er hat auch bisher nicht nachgelassen. Gott hat ihn nicht geheilt. Im Stillen fragte ich mich, ob irgendeiner der Männer hier im Raum etwas Vergleichbares erlebt hatte wie ich. Verstohlen schaute ich zu Bruder Taylor, der ruhig seine Suppe aß. Ob er weiß, was es heißt, von Gott enttäuscht zu sein?, überlegte ich. Oder war er immer vom Schutz der Klostermauern umgeben, mit fünf Andachten pro Tag und viel Zeit, um staubige Bücher zu lesen, ohne eine Vorstellung zu haben von dem Schmerz, der außerhalb dieser Gemeinschaft wütet?
Die Stille während der Mahlzeit war angenehm. Es war richtig schön, sich nicht unterhalten zu müssen, nicht intelligent wirken oder Interesse für die Geschichten der anderen heucheln zu müssen. Wir konnten einfach nur in Ruhe essen. Irgendwie war es aber auch befremdlich, mit so vielen anderen Menschen gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen, ohne miteinander zu reden. Trotzdem hatte ich das wohlige Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, auch wenn ich mit keinem an meinem Tisch auch nur ein Wort gewechselt hatte.
Dann zog ich mich wieder in mein Zimmer zurück und saß drei Stunden lang dort, wie gelähmt von der Stille, die auch dort herrschte. Zwischendurch stand ich immer wieder auf, ging unruhig auf und ab und fühlte mich wie ein Tiger im Käfig. Ich stellte meinen Stuhl ans Fenster und starrte auf die Mauer.
Endlich rief uns die Glocke zum Abendgebet, dem letzten Ereignis des Tages. Ich hatte keine Lust, Gott zu preisen; nicht einmal nach Beten war mir zumute. Aber es war mir sehr recht, meine Zelle zu verlassen.
Die Mönche sangen eine Reihe von Psalmen, dazwischen sprachen sie liturgische Gebete und lasen Abschnitte aus dem Neuen Testament vor. Für jeden Tag im Jahr gab es eine festgeschriebene Abfolge. Die Kapelle wirkte auf mich, der ich die nüchternen Säle methodistischer Gemeinden gewohnt war, recht prunkvoll. Überall glitzerte es golden und silbern, das Licht schien durch buntes Fensterglas und der Geruch von Weihrauch lag schwer in der Luft. Nach einigen Minuten begann ich mich in all dem Gepränge wohlzufühlen. All das schien mich aus dem gewöhnlichen grauen Alltag zu erheben, hinein in einen anderen Raum und eine andere Zeit. Der Gesang der Mönche berührte mein Herz, und bald musste ich so heftig gegen den Kloß in meinem Hals ankämpfen, dass mir die Kehle schmerzte.
Schweigend verließen wir nach dem Gottesdienst die Kapelle. Und schon war ich wieder in meiner Zelle. Das Verlangen, mit einer bekannten Person zu reden, von der ich wusste, dass sie mich liebte, wurde übermächtig. Ich griff nach meinem Handy und ging ins Freie.
„Hallo, Schatz, ich bin’s.“
„Bist du gut angekommen?“
„Ja, kein Problem.“
„Und wie ist es?“
„Es ist wirklich schön hier. Alles wirkt ein bisschen mittelalterlich. Mein Zimmer ist so klein wie eine Besenkammer, das Essen ist bescheiden, und vor meinem Fenster ist eine Mauer. Aber die Leute sind ganz nett.“
„Wirst du die fünf Tage Stille aushalten?“
„Das weiß ich noch nicht. Jona hat drei Tage im Bauch des Fischs überlebt, also hoffe ich, dass ich auch fünf Tage in einem Kloster in Massachusetts mit ein paar Mönchen überstehen werde. Ich weiß, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich in einem Kloster, in der vagen Hoffnung, dass irgendwie, von irgendwoher ...“, ich unterbrach mich, „ach, vergiss es! Liebes, weißt du, ich bin dir wirklich dankbar, dass du dich so dafür eingesetzt hast, dass ich jetzt hier sein kann.“
Ihr Seufzen war nicht zu überhören, und so versuchte ich, sie wieder aufzuheitern. „Weißt du was? Die haben mir hier einen geistlichen Mentor zugeordnet, aber ich weiß nicht genau, wie geistlich er ist. Er ist ein Läufer.“
„Was?“
„Er ist ein Läufer, im Ernst. Unter seiner Kutte trägt er Jogginghosen und Laufschuhe. Da sollte man doch meinen, sie würden mir einen weisen alten Mann mit einem langen Bart zuteilen. Und stattdessen habe ich einen Marathon-Mönch gekriegt. Stell dir mal das vor! Tim und der Marathon-Mönch. Aber er ist ganz in Ordnung.“
„Ich hoffe nur ...“
„Was?“
„Ich hoffe, du wirst das finden, was dir verloren gegangen ist. Die letzte Zeit war ganz schön schwer. Es ging dir überhaupt nicht gut. In dir ist so viel Schmerz. Ich wünsche dir so sehr, dass du Hilfe findest.“
„Ich hoffe es auch. Du bist wirklich ein Schatz, dass du mich hierher geschickt hast. Keine Ahnung, ob ich hier Hilfe finden werde, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Kilo abnehmen, das ist ja auch nicht schlecht.“
„Ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich sehne mich danach, dich wieder lächeln zu sehen. Nathan und ich vermissen dich sehr.“
„Ich vermisse euch beide auch. Ich hab euch lieb.“
„Wir lieben dich auch. Bis bald.“
Als ich zu meiner Zelle zurückging, kam mir ein alter Mönch mit einem langen weißen Bart entgegen. Er zwinkerte mir zu und verneigte sich, und ich folgte seinem Beispiel. Da war er also, der weise Mönch mit dem weißen Bart, den ich insgeheim erwartet hatte. Als er an mir vorbeiging, fand ich, dass er ein besonderes Leuchten im Gesicht hatte.
Danach kam mir meine Zelle noch enger vor. Ich setzte mich an den Tisch und schlug meine Bibel auf. Über dem Tisch hing eine kleine Karteikarte, die mir bisher noch gar nicht aufgefallen war. Darauf stand: „Du bist hier willkommen. Genieße die Abgeschiedenheit. Du darfst deine Maske ablegen.“
Ich beschloss, den Tag zu beenden und ins Bett zu gehen. Die ganze Nacht lang wälzte ich mich unruhig hin und her. Schließlich erklang die Glocke, die zum Frühgebet rief, aber ich war zu müde, um mich den Mönchen anzuschließen.
„Bitte betet für mich“, flüsterte ich, „betet für mich.“ Ich schlief wieder ein. Als ich das nächste Mal wach wurde, stand die Sonne hoch am Himmel, und die Glocke rief schon zum Mittagessen. Ich ging zum Speisesaal, wo es heute Thunfisch-Brötchen und rohen Sellerie gab.
Eine Stunde später stand ich wieder vor Bruder Taylors Tür.
„Guten Tag, Tim.“
„Guten Tag, Bruder.“
Wieder saßen wir uns schweigend gegenüber, wieder machte mich die Stille ganz nervös.
„Also, ich habe nichts gemacht, genau, wie du es mir geraten hast.“
„Und?“
„Nichts. Gar nichts ist passiert. Es geht mir genauso schlecht wie vorher. Hier kann man ja überhaupt nichts machen. Es gibt nicht einmal einen Fernseher in meinem Zimmer. Ich drehe noch durch.“
>„Gut.“
„Gut? Was soll daran gut sein?“
„Du hast immer noch alles im Griff, du spielst immer noch dein Spiel. Hör auf damit! Es ist wie beim Einschlafen: Du kannst nicht machen, dass du einschläfst, ganz egal, wie sehr du dich auch anstrengst. Aber wenn du alles loslässt und zur Ruhe kommst, dann schläfst du von allein ein.“
Wir schwiegen uns wieder an.
„Da wir gerade vom Schlafen sprechen, erzähl doch mal, Tim, was du so träumst!“
„Bist du ein Traumdeuter?“, fragte ich ihn. „Machen wir jetzt Tiefenpsychologie?“ Er schüttelte verneinend den Kopf. „Na gut, in letzter Zeit hatte ich oft Albträume.“
„Kannst du sie mir erzählen? Gibt es einen Traum, an den du dich erinnern kannst?“
„In den letzten paar Monaten hatte ich immer den gleichen Traum. Meine Güte, das habe ich noch niemandem erzählt. Also gut: In meinem Traum gehe ich nachts über einen Feldweg. Ein Gewitter zieht auf, ich suche einen Platz, wo ich mich unterstellen kann, und finde ein altes, verlassenes Haus. Als ich es betreten habe, wird mir klar, dass ich in einer Art Leichenschauhaus bin. Ich öffne eine Tür und sehe in einen Raum, in dem sich ein verwitterter alter Mann mit dem Rücken zu mir über eine Werkbank beugt. Er lacht ein unheimliches Lachen und meißelt etwas in einen Stein. Ich trete näher und schaue ihm über die Schulter, kann aber nicht genau erkennen, was er macht; es ist zu dunkel. Plötzlich durchzuckt ein Blitz den Raum und ich sehe, dass er Namen auf Grabsteine schreibt. Vor ihm stehen vier Steine, darauf die Namen der drei Menschen, die ich verloren habe: Madison, Wayne und Rose, meine Mutter. Der Alte ist gerade dabei, auch in den vierten Stein einen Namen einzugravieren, aber ich wache auf, ehe ich den Schriftzug lesen kann.“
Bruder Taylor hatte sich dem Fenster zugewandt, sein Blick schweifte gedankenverloren in die Ferne.
„Ganz schön gruselig, oder?“
„Das ist auf jeden Fall kein schöner Traum.“
„Vielleicht bräuchte ich doch eine richtige tiefenpsychologische Therapie?“
Bruder Taylor lächelte.
„Was denkst du über meinen Traum?“
„Ich denke, du bist ein Mensch, der dringend bessere Träume braucht.“
Ich erwiderte sein Lächeln.
„Tim, glaubst du an den Himmel?“
„Natürlich, ich bin ja schließlich Christ.“
„Ich meine, glaubst du wirklich daran? Hast du diese unumstößliche Gewissheit in dir, dass es den Verstorbenen gut geht?“
„Ja, schon, also – vom Verstand her auf jeden Fall. Aber es gibt eben keine Beweise. Ich möchte gern glauben, dass es einen Himmel gibt. Aber manchmal kommt mir alles so unwirklich vor. Mein Vater sagte immer: Wer tot ist, ist tot. Das Spiel ist vorbei, egal, ob es ein Mensch, eine Ameise, eine Amöbe oder eine Bergziege war. Wer tot ist, existiert nicht mehr.“
„Glaubst du, dass er recht hat?“