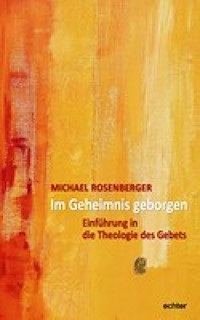13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tiere haben teil an der Auferstehung und am ewigen Leben, auch sie sind gesegnet und frei in der Liebe Gottes geboren. Aufgrund dieser Prämisse können und dürfen wir Tiere als gleichwertige Mitgeschöpfe wahrnehmen und damit endlich ein glückliches, würdevolles Miteinander leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Gleichgültigkeit oder Grausamkeit gegenüber anderen Geschöpfen dieser Welt überträgt sich immer auf die Weise, wie wir unsere Mitmenschen behandeln und wie unsere Beziehung zu Gott ist. Insofern ist die Mensch-Tier-Beziehung der Gradmesser jeglicher Moralität. Mit der Erfüllung des Traums vom Frieden zwischen Mensch und Tier ist also sowohl den Tieren, als auch darüber hinaus ganz besonders den Menschen geholfen. Nur so kann es ein Miteinander aller Lebewesen geben, das von Achtung und wahrer Wertschätzung geprägt ist.
Über den Autor
Prof. Dr. Michael Rosenberger, geboren 1962, lehrt Moraltheologie an der Katholische Universität Linz. Seit 2004 ist er Mitglied der Gentechnik-Kommission beim österreichischen Bundesministerium für Gesundheit und Frauen und Umweltsprecher der Diözese Linz. Er leitet die »Interdisziplinäre Arbeitsgruppe zur Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung«.
Michael Rosenberger
Der Traum vom Frieden zwischen Mensch und Tier
Eine christliche Tierethik
Kösel
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Copyright © 2015 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: Weiss Werkstatt München
Umschlagmotiv: © Das Buch Genesis, Miniatur aus der Bibel von Souvigny, 12. Jh.; De Agostini Picture Library / G. Dagli Orti / Bridgeman Images / Bild-Nr. 557297
© Initiale U, aus einer lateinischen Bibel, 14. Jh., Bibliotheque Mazarine, Paris / Archives Charmet / Bridgeman Images / Bild-Nr. 163348
ISBN 978-3-641-16957-2
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter
www.koesel.de
INHALT
VORWORT
WONACHDIESESBUCHFRAGT
TEIL 1Bestandsaufnahme – Wie Tiere sind und wie der Mensch mit ihnen umgeht
WASTIEREALLESKÖNNENVerhaltensbiologische Entdeckungen
WIEEINZIGARTIGJEDESTIERISTVorahnungen unendlicher Vielfalt
WIEMENSCHUNDTIERGEFÄHRTENWURDENDie absichtslosen Ursprünge ihrer Beziehung
WIEDERMENSCHMITTIERENUMGEHTTiere in der industrialisierten Moderne
TEIL 2Tierethik – Philosophische und theologische Entwürfe
TIEREALS »INSTRUMENTE« ODER »GLÜCKSBEHÄLTER«?Tierethische Entwürfe der Philosophie
TIEREALSRECHTSTRÄGERTierethik in der Bibel
TIEREALSWÜRDEN-TRÄGERDer Ansatz der Gerechtigkeit
TIEREGERECHTNUTZENUNDGERECHTLIEBENKonkretionen
TIERETÖTENUNDESSEN?Die Nagelprobe jeder Tierethik
TEIL 3Spirituelle Vertiefungen: Hoffnung für die Tiere
INGOTTESHANDDie Tradition der Tiersegnungen
WOLFUNDLAMM, SÄUGLINGUNDSCHLANGEDer Traum vom Frieden zwischen Mensch und Tier
LITERATUR
ANMERKUNGEN
VORWORT
Die einen umarmen wir, die anderen schlachten wir. Die einen vergöttern wir, die anderen machen wir zur Ware. Die einen hätscheln wir, die anderen essen wir. Ob das daran liegt, dass wir die einen »zum Knuddeln gern« haben, die anderen aber »zum Fressen gern«? In jedem Fall ist der menschliche Umgang mit den Tieren bisher wenig reflektiert und in vieler Hinsicht ziemlich widersprüchlich. Vieles geschieht, weil es »schon immer so war« oder »weil das doch klar ist«. Doch in den letzten Jahren werden die Stimmen jener lauter, die althergebrachte Überzeugungen in Frage stellen und eine Tierethik fordern, die diesen Namen verdient.
Seit etwa fünfzehn Jahren versuche ich in meinen Vorlesungen, Vorträgen und wissenschaftlichen Publikationen etwas zu einer Tierethik aus christlicher Perspektive beizutragen. Jetzt ist es an der Zeit, die gewonnenen Erkenntnisse in einem umfassenden Entwurf zusammenzufügen. Dieses Buch ist also die Frucht langjähriger Vorarbeiten. Als ich mit ersten Notizen und Skizzen begann, hätte ich nicht gedacht, dass es zum Zeitpunkt seiner Publikation auf einen solchen Boom des Themas treffen würde.
Dank sage ich für die inhaltlichen Impulse, die ich jenseits der verwendeten Literatur aus zahlreichen direkten Gesprächen und unmittelbaren Erlebnissen mitnehmen durfte:
Der interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung, die sich, angeregt von der Stiftung Bündnis Mensch & Tier und ihrer Gründerin Dr. Carola Otterstedt, seit 2008 regelmäßig trifft, Vorträge und Publikationen erarbeitet und meinen Blick auf das Thema enorm geweitet hat.
Karl Ludwig Schweisfurth und den Herrmannsdorfer Landwerkstätten sowie Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald und der Schweisfurth-Stiftung, mit denen ich mich seit vielen Jahren zu ökologischen und tierethischen Themen austauschen kann.
Den KollegInnen verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen im Informations- und Dialogforum »Tierversuche in der Forschung« der Helmholtz-Gesellschaft für Infektionsforschung Braunschweig, an dem ich von 2005–2008 mitwirken durfte.
Zahlreichen LandwirtInnen aus dem ökologischen Landbau in Deutschland und Österreich, deren tagtägliche Praxis mit ihren Möglichkeiten und Begrenzungen eine wichtige Quelle für meine Überlegungen ist.
Allen, mit denen ich das Thema im Laufe der Jahre diskutieren und vertiefen durfte, ob wissenschaftlich oder nicht, ob auf religiösem Hintergrund oder nicht.
Ich widme dieses Buch meinem kürzlich verstorbenen Vater Wolfgang Rosenberger (1923–2015), der uns Kindern als Biologe und Tierliebhaber von klein auf das Wunder jedes Lebewesens vermittelt hat – und sei es auch noch so unscheinbar.
Michael Rosenberger
WONACHDIESESBUCHFRAGT
»Eine Ethik, die Rücksicht auf die Tiere nehmen würde, findet man in der Bibel nicht.«1 Dieser Satz des Theologen Eugen Drewermann müsste eigentlich ein Erdbeben in Theologie und Kirche(n) auslösen. Stimmt er, dann muss sich das Christentum für ein gewaltiges Defizit rechtfertigen. Stimmt er aber nicht, dann müssen Theologie und Kirchen lautstark widersprechen und Drewermanns Behauptung sachgerecht widerlegen. Beides aber geschieht kaum und höchstens zaghaft. Weiß die Kirche also vielleicht gar nicht, wie sie auf die Provokation Drewermanns reagieren soll? Oder hält sie das Thema Tierethik immer noch für zu unwichtig?
Drewermanns Provokation ist keineswegs kontextlos. Sie geschieht in einer Zeit, da der Umgang des Menschen mit Tieren (wie auch mit Menschen!) aufs Äußerste ökonomisiert und industrialisiert worden ist. Das gilt am augenscheinlichsten für die Nutztiere, die ihre ökonomische Bedeutung bereits im Namen tragen. Es betrifft aber ebenso die Pets, die Gefährtentiere, die doch angeblich nur aus Liebe gehalten werden. Ein Riesengeschäft wird auch mit ihnen gemacht, von ihrer Zucht über Handel und Haltung bis zu ihrer Bestattung. »It’s the economy, stupid« – »Es ist die Wirtschaft, Dummkopf« – mit diesem Gedanken hat der frühere US-Präsident Bill Clinton 1992 die Wahl gewonnen. Die Wirtschaft ist der alles beherrschende Motor unserer Gesellschaft. Wer also eine Tierethik entwickeln will, muss mit ihrer Hilfe der wirtschaftlichen Dynamik Grenzen setzen. Die Wirtschaft ist für Menschen und Tiere da, nicht umgekehrt.
Gesellschaftlich erhitzt das Tierthema in den letzten Jahren zunehmend die Gemüter. Nie erlebe ich bei meinen Vorträgen so leidenschaftliche und kontroverse Debatten wie wenn ich über Tierethik rede. Da ist die Tierschutz- und Tierrechtsbewegung, oft mit hohem persönlichen Engagement vegetarisch oder vegan lebend; da sind die Menschen in der Landwirtschaft, die ihre Arbeit nicht als Job, sondern als Berufung verstehen, sich aber gesellschaftlich wie finanziell kaum gewürdigt fühlen; da sind die überzeugten FleischesserInnen, für die es einer Beraubung jeglicher Lebensfreude gleichkommt, ihren Fleischkonsum auch nur mengenmäßig in Frage zu stellen; da sind Menschen mit Heimtieren, die diese abgöttisch lieben, aber beim Konsum tierischer Lebensmittel die Augen verschließen. In der Diskussion über unseren Umgang mit Tieren sind alle TeilnehmerInnen Betroffene, niemand ist unbeteiligteR, neutraleR BeobachterIn. Das erleichtert das Vorhaben nicht, und ich bitte alle LeserInnen schon an dieser Stelle um ein gerütteltes Maß an Wohlwollen, Offenheit und Sachlichkeit gegenüber meinen Ideen und den Ideen anderer, die ich vorstelle. Im Kampfmodus werden wir denkerisch nicht weiterkommen – und das wäre auf jeden Fall eine Niederlage für alle, besonders für die Tiere.
Ich bin Theologe. Als solcher schaue ich auf die Tiere mit einem doppelten Blick: Erstens frage ich philosophisch, was ein humaner und gerechter Umgang mit den Tieren ist. Zweitens verschärfe ich diese Frage theologisch, indem ich die Tiere als Geschöpfe eines Gottes betrachte, der sie liebt und aus Liebe ins Leben gerufen hat. Diese theologische Perspektive kann die philosophische nicht ersetzen oder übertrumpfen, wohl aber bereichern, vertiefen und zuspitzen. Dass sie dies tatsächlich tut, möchte ich in diesem Buch zeigen. Dabei ist es eine glückliche Fügung, dass ich den roten Faden der jüngst veröffentlichten Enzyklika »Laudato si’« von Papst Franziskus weiterspinnen kann. Die Enzyklika dreht sich um die Verantwortung für die Umwelt, nicht für die Tiere. Aber an einigen Stellen trifft sie auch entscheidende Aussagen über die Mitgeschöpfe des Menschen.
Als roter Faden durch meine Überlegungen soll die These dienen, dass man am Umgang des Menschen mit den Tieren ablesen kann, wie der Mensch ist und wer er ist und wie er auch mit Seinesgleichen umgeht. Ich verstehe die Mensch-Tier-Beziehung also als »soziales Totalphänomen« (Marcel Mauss) und als Gradmesser jeglicher Moralität (Immanuel Kant). Dieser Gedanke ist nicht so neu – er findet sich bereits in der Bibel: »Der Gerechte weiß, was sein Vieh braucht« (Spr 12,10). Das heißt: Wer moralisch gerecht sein will, der muss gut für die Tiere sorgen, die ihm anvertraut sind. Das betont auch Papst Franziskus:
»Wenn … das Herz wirklich offen ist für eine universale Gemeinschaft, dann ist nichts und niemand aus dieser Geschwisterlichkeit ausgeschlossen. Folglich ist es auch wahr, dass die Gleichgültigkeit oder die Grausamkeit gegenüber den anderen Geschöpfen dieser Welt sich letztlich immer irgendwie auf die Weise übertragen, wie wir die anderen Menschen behandeln. Das Herz ist nur eines, und die gleiche Erbärmlichkeit, die dazu führt, ein Tier zu misshandeln, zeigt sich unverzüglich auch in der Beziehung zu anderen Menschen.«2
Die Darstellung folgt dem klassischen Dreischritt Sehen – Urteilen – Handeln. Zunächst wird in einer Bestandsaufnahme untersucht, wie Tiere sind und wie der Mensch faktisch mit ihnen umgeht (Erster Teil – Kapitel 2 bis 5). Dann werden philosophische und theologische Entwürfe der Tierethik samt ihren Konsequenzen vorgestellt und diskutiert (Zweiter Teil – Kapitel 6 bis 10). Schließlich geht es in den letzten beiden Kapiteln um spirituelle Vertiefungen des menschlichen Umgangs mit Tieren (Dritter Teil – Kapitel 11 und 12).
Der Traum vom Frieden zwischen Mensch und Tier ist ein uralter Menschheitstraum. Seine vollständige Erfüllung wird auf Erden wohl nie gelingen. Und doch: Vielleicht kann er uns immerhin so stark anlocken, dass wir Schritte in seine Richtung gehen. Damit wäre den Tieren, aber ebenso uns Menschen sehr geholfen.
TEIL 1
Bestandsaufnahme – Wie Tiere sind und wie der Mensch mit ihnen umgeht
WASTIEREALLESKÖNNEN
Verhaltensbiologische Entdeckungen
»Dadurch lässt sich auch der Unterschied zwischen den Menschen und Tieren erkennen. Denn es ist sehr bemerkenswert, dass es keine so stumpfsinnigen und dummen Menschen gibt, sogar die sinnlosen nicht ausgenommen, die nicht fähig wären, verschiedene Worte zusammenzuordnen und daraus eine Rede zu bilden, wodurch sie ihre Gedanken verständlich machen; wogegen es kein anderes noch so vollkommenes und noch so glücklich veranlagtes Tier gibt, das etwas Ähnliches tut. Das kommt nicht von der mangelhaften Beschaffenheit ihrer Organe, denn man sieht, dass die Spechte und Papageien ebenso gut Worte hervorbringen können wie wir, und doch können sie nicht ebenso gut wie wir reden, das heißt zugleich bezeugen, dass sie denken, was sie sagen; während Menschen, die taubstumm geboren, also ohne die Organe sind, die anderen zum Sprechen dienen, ebenso oder mehr als die Tiere einige Zeichen von selbst zu erfinden pflegen, um sich denen verständlich zu machen, die im täglichen Zusammensein mit ihnen Muße haben, ihre Sprache zu lernen. Dies beweist nicht bloß, dass die Tiere weniger Vernunft als die Menschen, sondern dass sie gar keine haben. Denn wie man sieht, gehört nur sehr wenig dazu, um sprechen zu können. Und da man unter den Tieren einer und derselben Art ebenso wie unter den Menschen Ungleichheit findet und die einen leichter abzurichten sind als die anderen, so ist es unglaublich, dass ein Affe oder ein Papagei, die zu den vollkommensten ihrer Art gehören, darin nicht einem der dümmsten Kinder oder wenigstens einem Geisteskranken gleichkommen würden, wenn ihre Seele nicht von einer ganz anderen Natur wäre als die unsrige. Man darf aber die Worte nicht mit den natürlichen Bewegungen verwechseln, welche Empfindungen bezeichnen und von Maschinen ebenso gut wie von Tieren nachgeahmt werden können, noch darf man wie einige der Alten meinen, dass die Tiere in der Tat sprechen und wir nur ihre Sprache nicht verstehen. Denn wäre es so, weil sie mehrere den unsrigen entsprechende Organe haben, so würden sie sich uns auch ebenso gut als ihresgleichen verständlich machen können. Auch ist es sehr bemerkenswert, dass, obwohl manche Tiere in manchen Handlungen mehr Geschicklichkeit zeigen als wir, man doch sieht, dass ebendieselben Tiere in vielen anderen Handlungen gar keine zeigen; sodass, was sie besser als wir machen, keineswegs Geist beweist, denn in diesem Falle würden sie mehr Gaben besitzen als einer von uns und es auch in allen anderen Dingen besser machen, sondern (es zeigt sich) vielmehr, dass sie keinen Geist haben und allein die Natur in ihnen nach der Disposition ihrer Organe handelt. Man sieht ja auch, dass ein Uhrwerk, das bloß aus Rädern und Federn besteht, richtiger als wir mit aller unserer Klugheit die Stunden zählen und die Zeit messen kann.«3
Diese programmatischen Sätze befinden sich im Erstlingswerk des Philosophen René Descartes (1596 La Haye – 1650 Stockholm), das 1637 unter dem Titel »Abhandlung über die Methode zum richtigen Vernunftgebrauch und zur wissenschaftlichen Wahrheitssuche« veröffentlicht wurde. In der Strömung des frühneuzeitlichen Rationalismus, der Erkenntnis allein aus dem Denken und nicht aus der Erfahrung gewinnen will, reißt Descartes damit einen Graben zwischen Mensch und Tier auf, der nie zuvor in der Geistesgeschichte derart tief war und bis heute auf die abendländische Wahrnehmung und Behandlung der Tiere stark nachwirkt.
Aus zwei angeblich universalen Tatsachen leitet Descartes zwei philosophisch-ethische Folgerungen ab.
Es gibt keinen Menschen, der nicht reden kann – und wenn auch nur mit einer reduzierten und nonverbalen Sprache wie der Taubstummensprache.Es gibt kein Tier, das im Sinne des verstehenden, reflektierten Redens sprechen kann – auch nicht mit einer ihm eigenen Sprache, die der Mensch nicht versteht.Die beiden philosophisch-ethischen Folgerungen führen zu:
Das Tier hat also keine Vernunft.Und Wesen, die keine Vernunft haben, haben auch keine Vernunftseele, sondern sind wie eine Uhr ein gut funktionierendes, aber seelenloses Räderwerk.Bis heute wirkt dieses Descartes’sche Bild von Tieren als seelenlosen Maschinen in der abendländischen Gesellschaft nach. Ob von Descartes gewollt oder nicht, hat es zu einer rein zweckrationalen Sicht auf das Tier geführt, die dieses fast ausschließlich den ökonomischen Interessen und Gesetzmäßigkeiten unterwirft. Daher ist es am Beginn dieses Buchs notwendig, das Descartes’sche Tierbild zu erschüttern. In den letzten Jahrzehnten hat die Erforschung der Intelligenz und der vielfältigen Fähigkeiten von Tieren gewaltige Fortschritte gemacht. Tierpsychologie, Verhaltensbiologie, Neurowissenschaften und eine Reihe anderer Disziplinen öffnen uns den Zugang zu einer unermesslichen Welt tierlichen Verhaltens. Deren Würdigung muss zwangsläufig Auswirkungen auf die Fragestellung haben, wie der Mensch ethisch verantwortet mit Tieren umgehen kann.
Nun haben die Naturwissenschaften ihre eigenen Methoden und Herangehensweisen. Anders als die Philosophie, die primär auf die großen Zusammenhänge schaut, untersuchen sie meist relativ überschaubare, kleine Einheiten des tierlichen Verhaltensrepertoires. Die Frage nach dem Denken, die Descartes noch sehr pauschal stellte, zerlegen sie in viele kleine Mosaiksteine, aus denen sich erst am Schluss ein Gesamtbild davon zusammensetzen lässt, ob und in welcher Weise einem konkreten Tier die Fähigkeit des Denkens zugesprochen werden kann. Sie beschreiten damit einen Weg »bottom up« von unten nach oben – von den kleinen beobachtbaren Phänomenen hin zu den größeren und spekulativeren Zusammenhängen – und nicht »top down« von oben nach unten, wie es die platonisch gefärbte Philosophie (anders als die aristotelisch inspirierte) über weite Strecken der Geistesgeschichte getan hat.
Im Folgenden möchte ich einige der wesentlichen Fähigkeiten nennen und beschreiben, die man in den letzten Jahrzehnten manchen Tierarten zuspricht. Dabei bin ich als Geisteswissenschaftler auf die Ergebnisse der Naturwissenschaften angewiesen. Ich kann sie aus der eigenen Perspektive hinterfragen, wo es mir nötig scheint. Im Normalfall aber werde ich sie als den geltenden Stand der Wissenschaft respektieren und übernehmen.
Die Fähigkeit zur bewussten Unterscheidung seiner selbst von der Umgebung
Alle Lebewesen stellen selbstorganisierende Systeme dar, die sich von ihrer Umgebung abgrenzen, zugleich aber mit dieser im ständigen Austausch sind. Doch während die Pflanzen diese Abgrenzung von der Umwelt ausschließlich im unbewussten Lebensvollzug praktizieren können, ist es für Tiere mit einem zentralen Nervensystem mindestens theoretisch denkbar, dass sie eine bewusste Vorstellung von sich selbst besitzen. Um nicht den philosophisch etablierten und hochgradig komplexen Begriff des »Selbstbewusstseins« zu verwenden, spricht man vorsichtiger vom »Ichbewusstsein«. So unterscheidet Heini Hedinger das Ichbewusstsein, das er allen höheren Tieren zuspricht, von der Fähigkeit zur Reflexion, die er dem Menschen vorbehält4. Dieses Ichbewusstsein kann bei Mensch und Tier viele unterschiedliche Komponenten umfassen. Die acht wichtigsten werden in den folgenden Abschnitten genannt und erläutert:
Viele Tiere besitzen ein Körperbewusstsein. Sie haben nicht nur ein Gefühl für ihren eigenen Körper, sondern eine kognitive Vorstellung desselben, die sich an Veränderungen des Körpers sofort anpasst. Männliche Hirsche etwa haben eine klare Vorstellung von der aktuellen Größe ihres Geweihs, obwohl sie dieses alljährlich im Frühjahr abwerfen und über den Sommer allmählich wieder aufbauen. Wenn sie durch dichtes Gestrüpp wandern oder unter einem Ast durchgehen wollen, bewegen sie sich so geschickt, dass sie nirgends hängen bleiben. In der geweihlosen Zeit kommen sie mit ihrem Kopf den Hindernissen ihrer Umwelt aber deutlich näher. Sie wissen also um ihre je aktuellen Körpermaße.Eine eigene Intelligenzleistung von Mensch und Tier stellt das Schattenbewusstsein dar, die Erkenntnis, dass etwas der eigene Schatten ist und nicht der eines anderen Lebewesens oder Gegenstandes. Lebewesen, die Schattenbewusstsein besitzen, laufen vor dem eigenen Schatten nicht davon und haben vor ihm keine Angst. Wie die dazu fähigen Tiere müssen auch Menschenkinder erst lernen, dass sie einen Schatten besitzen. Im zweiten Lebensjahr haben ängstliche Kinder zunächst Angst vor ihrem Schatten und wollen davonlaufen, mutige Kinder hingegen jagen ihrem Schatten nach, so als könnten sie ihn fangen, bis sie wie viele Tiere den Zusammenhang begreifen.Eine wichtige Komponente des Ichbewusstseins vieler Tiere ist das Duftbewusstsein, also die Fähigkeit, ihren eigenen Duft als eigenen zu erkennen. Erst auf dieser Grundlage können zum Beispiel Hunde ihr Revier markieren, wofür sie dann freilich noch eine weitere Komponente, das Heimbewusstsein, brauchen. Beim Menschen ist diese Fähigkeit vergleichsweise schwach ausgebildet und spielt daher keine bedeutende Rolle.Relativ weit verbreitet unter Tieren ist das Heimbewusstsein: Tiere wissen um ihr Nest, ihren Bau, ihren Stallplatz, ihr Revier und empfinden das entsprechende Territorium als ihren Besitz, den sie gegen ArtgenossInnen wie gegen Feinde energisch verteidigen. Von einzelnen Tieren weiß man, dass sie zum Beispiel nach Umsiedlungsaktionen nicht ruhen, bis sie den Rückweg in ihre angestammte Heimat gefunden und beschritten haben. Zugvögel wie der Storch beweisen oft jahrzehntelange Nesttreue.Komplexer ist die Fähigkeit mancher Tiere, die von Hedinger mimetisches Bewusstsein genannt wird: Es bedeutet das Bewusstsein der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit seiner selbst im Vergleich zur Umgebung. Diese Fähigkeit hat für viele Tiere höchste Bedeutung, da sie sich mit dieser kognitiven Leistung vor Fressfeinden schützen können. Kommt ein Feind in Reichweite, sucht das Tier eine Umgebung auf, um deren Ähnlichkeit zum eigenen Aussehen es weiß und in der es daher gut getarnt ist. Menschenkinder lernen viel davon beim Versteckspiel.Eine weitere, besonders komplexe Ausprägung des Ichbewusstseins ist das Spiegelbildbewusstsein: Lebewesen, die es besitzen, erkennen ihr Spiegelbild als solches. Um das zu prüfen, hat es sich bewährt, dem Lebewesen an einer Körperstelle einen Fleck aufzumalen, den es ohne Spiegel nicht sehen kann. Fasst es sich dann am eigenen Körper an die bemalte Stelle, ist erwiesen, dass es das Spiegelprinzip verstanden hat. Besitzt es (noch) kein Spiegelbewusstsein, wird es sein Spiegelbild wie einen Artgenossen behandeln und zum Beispiel bedrohen oder mit ihm zu spielen versuchen. Manche Tiere wie Schweine oder Hunde verstehen das Spiegelprinzip und können mit seiner Hilfe verborgene, nur im Spiegel sichtbare Futterquellen finden, erkennen sich selbst aber im Spiegel nicht. Letzteres ist bisher nur von wenigen Tierarten nachgewiesen: Den großen Menschenaffen, Delfinen, Elefanten, Raben, Elstern und Keas. Menschenkinder entwickeln ihr Spiegelbildbewusstsein bis zum Alter von 18 Monaten.Wo Menschen den mit ihnen lebenden Tieren einen Namen geben, können Tiere ihr Eigennamenbewusstsein beweisen. Hunde etwa verstehen, wenn sie gut geschult werden, relativ bald den Unterschied zwischen einem Befehl und ihrem Namen. Aber es scheint auch Tiere zu geben, die sich gegenseitig »beim Namen rufen«. So hat man jüngst herausgefunden, dass Große Tümmler eine eigene, individuelle »Erkennungsmelodie« haben, mit der sie sich ihren nahen Bekannten zu erkennen geben. Diese variieren die Melodie ihrerseits minimal, wenn sie das betreffende Individuum herbeirufen wollen5. Die Tümmler haben damit eine Vorstellung von sich selbst und von ihren Freunden.Bei sozial lebenden Tieren gehört im Regelfall das Statusbewusstsein, also das Wissen um den eigenen Rang in der Gruppe, zum Ichbewusstsein dazu. Logischerweise ist damit auch das Wissen um den Rang der anderen Gruppenmitglieder verbunden, denn Rangordnungen entstehen immer aus dem Vergleich zweier oder mehrerer Individuen. Eine Vorstellung von der aktuellen Rangordnung der eigenen Gruppe zu besitzen verlangt enorme kognitive Leistungen. Denn sie ist ja ständig im Fluss. Machtkämpfe und Auseinandersetzungen bringen einige Individuen nach oben, während andere an Rang verlieren.Marc Bekoff und Paul W. Sherman interpretieren die verschiedenen Dimensionen des tierlichen Ichbewusstseins im Rahmen eines evolutionären und ökologischen Ansatzes6. Sie gehen davon aus, dass unterschiedliche Tierarten in Abhängigkeit von ihren artspezifischen Lebensräumen und Lebensweisen unterschiedliche Grade von Selbsterkenntnis (self-cognizance) aufweisen, deren höchsten Grad sie als Selbstbewusstheit (self-consciousness) bezeichnen. Höhere Grade an Selbsterkenntnis seien bei solchen Tierarten zu erwarten, deren Individuen am meisten davon profitieren, wenn sie über ihr eigenes Verhalten »nachdenken« und es anpassen. Daher müsste die Selbsterkenntnis bei langlebigen sozial lebenden Tierarten am stärksten sein. Dort gibt es intensive Kooperation und Kommunikation, Neid und Eifersucht, Konkurrenz und Streit. Bekoff und Sherman behaupten, dass Tiere mit kooperativer Brutpflege und sozial lebende Wirbeltiere eine gleich hohe oder vielleicht sogar höher entwickelte Fähigkeit der Selbsterkenntnis aufweisen als manche einzelgängerische Primaten wie zum Beispiel die Orang Utans auf Borneo7. Denn sie müssen ständig darüber nachdenken, wie andere Mitglieder ihrer Gruppe auf sie reagieren, und ihr Verhalten entsprechend modifizieren – sei es bei der Jagd (Wölfe), beim Anlegen von Vorräten (Spechte, Maulwurfsratten) oder beim Schutz vor Feinden (Eichelhäher, Krähen, Mungos).
Die Interpretation von Bekoff und Sherman macht deutlich, wie die Naturwissenschaften denken. Sie ziehen keine scharfe Grenzlinie, unterhalb der ein Tier kein Ichbewusstsein hat und oberhalb der das Ichbewusstsein voll ausgebildet ist, sondern sie finden ein Kontinuum wachsenden Ichbewusstseins von Tieren. Und sie können plausibel erklären, warum das Ichbewusstsein einer bestimmten Tierart höher oder niedriger ist. Es hängt mit der geringeren oder höheren Notwendigkeit zusammen, aus aktuellen Erlebnissen für die Zukunft zu lernen.
Zugleich haben die Überlegungen Hedingers gezeigt, wie viele Komponenten das Ichbewusstsein ausmachen können. Das Spiegelbildbewusstsein ist ein mögliches Element des Ichbewusstseins, zweifelsohne ein besonders komplexes. Aber aus seinem Fehlen zu schließen, dass das betreffende Tier überhaupt kein Ichbewusstsein hat, wäre ziemlich unangemessen und würde die kognitiven Leistungen der Tiere stark unterbewerten.
Die Fähigkeit zur Empathie
Eine der wichtigsten Fähigkeiten von Tieren und Menschen ist die Fähigkeit zur Empathie. Empathie hat evolutionsbiologisch zwei Vorstufen: Die erste ist die »emotionale Ansteckung« (emotional contagion), eine unwillkürliche Reaktion, die Gefühlsäußerung eines Artgenossen zu übernehmen8: Wenn der Artgenosse fröhlich schaut, schaut man unwillkürlich ebenfalls fröhlich, wenn er lacht, lacht man ohne nachzudenken mit usw. Die zweite, schon komplexere Vorstufe ist das spontane Gefühl mitfühlender Besorgnis (sympathetic concern). Erst die dritte Stufe, die die ersten beiden umfasst und zugleich überschreitet, ist die Empathie im Vollsinn des Wortes. Sie ist emotional und kognitiv zugleich und meint die Fähigkeit, sich bewusst in die Gefühle eines anderen hineinzuversetzen (perspective taking), diese Gefühle also zu erkennen und zugleich ähnliche Gefühle am eigenen Leib zu spüren. Empathie beruht damit auf komplexen Voraussetzungen. Sie setzt die Fähigkeit voraus, zwischen Ich und Du zu unterscheiden – eine Fähigkeit, die erst auf den höheren Stufen des Ichbewusstseins vorhanden ist (s. o.).
Frans de Waal sieht die Fähigkeit zur Empathie als Voraussetzung zu sozialer Interaktion, koordinierter Aktivität und kooperativem Verhalten9. Ziel der Empathie ist es ja, dem notleidenden Artgenossen nach besten Möglichkeiten zu helfen (targeted helping). Empathie ist damit ein Mechanismus der Evolution, der gezielten Altruismus ermöglicht10.
Obwohl die meisten Tiere die emotionale Ansteckung vollziehen und viele mitfühlende Besorgnis zeigen, kennen wir bisher nur wenige Tierarten mit empathischem Verhalten im Vollsinn, teilweise sogar gegenüber artfremden Lebewesen11. Neben jenen Tieren, von denen man das ohnehin erwarten würde – Primaten, Delfine, Wale, Elefanten –, sind hier beispielsweise Hunde, Wölfe, Raben, Mäuse und Ratten zu nennen. Und vermutlich wird sich die Liste mit zunehmender Forschung verlängern.
Die Fähigkeit zur Trauer
Eine weitere, ebenfalls mit starken Emotionen behaftete Fähigkeit mancher Tiere ist die Fähigkeit zur Trauer. Mit Trauer ist mehr gemeint als nur die depressive Stimmung auf Grund des Nicht-mehr-Anwesend-Seins eines vertrauten Gefährten. Trauer im Vollsinn beinhaltet kognitive Elemente. Als Minimum muss die Irreversibilität des Todes des betreffenden Lebewesens verstanden werden: Es kann nicht mehr lebendig werden. Darüber hinaus umfasst menschliche Trauer auch das Wissen um die Universalität des Todes – alle Lebewesen müssen sterben, seine Unvorhersehbarkeit –, er kann jederzeit eintreten – und seine Unabwendbarkeit –, egal, was man tut, irgendwann muss man sterben. Menschenkinder stellen sich diese Fragen ab einem Alter von drei bis vier Jahren. Bei Tieren scheinen diese Fragen eher nicht aufzutauchen.
Trauer ist ein egozentrisches Gefühl. Um zu trauern, braucht es keine Empathie. Jedoch kann die Fähigkeit zum Trauern bei empathiefähigen Individuen zur gemeinsamen Trauer und zum gegenseitigen Trösten führen. Obgleich selbst egozentrisch, ist Trauer eine ideale Plattform altruistischer Hilfe und emotionaler Solidarität.
Dass ein Individuum die Irreversibilität des Todes eines Artgenossen begreift, ist bisher nur bei wenigen Tierarten nachgewiesen. Zu ihnen gehören auf jeden Fall die Menschenaffen.
»Wenn Schimpansen miterleben, wie das Leben eines vertrauten Gefährten sich dem Ende nähert, reagieren sie gefühlsmäßig vielleicht so, als würde ihnen, wenn auch noch so verschwommen, klar, was der Tod bedeutet.«12
De Waal berichtet, dass nach dem Tod eines Gorillas im Schimpansengehege in Arnheim vollkommene Stille herrschte, bis der Leichnam am nächsten Morgen aus dem Gehege entfernt wurde13. Das erinnert an die gespenstische Stille in manchen Dörfern, wenn dort ein junger Mensch gestorben ist. Auch diese Stille währt bis zur Wegnahme des Leichnams, also bis zum Begräbnis, und weicht danach schlagartig einem lauten, betriebsamen Leben. Vielfältig sind zudem die Berichte darüber, dass sich trauernde Schimpansen gegenseitig berühren und umarmen – sie tragen die Trauer gemeinsam.
Elefanten halten tagelang Totenwache am Leichnam eines toten Artgenossen, auch wenn sie Futter und Trank deswegen über weite Strecken holen müssen. Beim Auffinden von Gerippeansammlungen befühlen sie vor allem die Überreste ihrer Artgenossen. Skelette anderer großer Tiere und künstliche Knochen, die Forscher dazulegen, ignorieren sie.
Die Fähigkeit zum Spielen
Spielerische Aktivitäten müssen nach Gordon M. Burghardt fünf Kriterien erfüllen14:
Sie dürfen in ihrem unmittelbaren Kontext nicht vollständig funktional erklärbar sein;sie geschehen freiwillig, weil sie angenehm oder lohnenswert erscheinen;sie unterscheiden sich strukturell oder zeitlich von verwandten ernsten Verhaltensweisen;sie werden wiederholt vollzogen, und zwarin relativ harmlosen Situationen. Spiele können Bewegungsspiele, Spiele mit toten Objekten und / oder soziale Spiele sein.Pferdefohlen springen über die Weide und drehen Pirouetten (Bewegungsspiel). Delfine reiten begeistert auf den Bugwellen großer Schiffe (Bewegungsspiel) oder drücken Holzstücke unter Wasser und freuen sich, wenn diese wieder emporschnellen (Spiel mit Objekten). Junge Hunde fletschen spielerisch die Zähne und tollen in Kampfspielen herum, die ihre Artgenossen nicht verletzen (soziales Spiel). So sind es vor allem Säugetiere, die spielen. Aber auch Vögel wie Raben oder Papageien spielen Fangen und balgen miteinander. Und selbst Oktopoden lassen Korken in strömenden Luftblasen hüpfen.
Wenn Spiele den unmittelbaren Nutzen überschreiten – warum spielen Tiere und Menschen dann? Man könnte meinen, Spiel sei Vergeudung von Energie und Zeit und noch dazu gefährlich, weil man Feinden gegenüber weniger achtsam sei. Doch langfristig betrachtet ist der Nutzen des Spielens unermesslich. Junge Individuen können aus ihnen etwas für den Ernst des Lebens lernen, zum Beispiel Bewegungen, Kampftechniken, Futtersuche, Sexualkontakte, aber auch Geschlechterrollen (Schimpansenmädchen verwenden beim Spiel Stöcke als Puppen, Schimpansenjungen ebensolche Stöcke als Kampfinstrumente15). Junge und erwachsene Individuen stärken durch soziale Spiele ihre sozialen Bindungen und Verhaltensweisen. Schließlich regen Spiele die Sinne an, vertreiben damit Langeweile und verhindern Frust und Aggressivität, animieren aber zugleich zu Kreativität und Innovation. Spiele sind auf diese Weise eine zentrale Triebfeder für evolutionären Wandel.
Bei sozialen Spielen achten auch Tiere auf Fairplay: So werden zum Beispiel Wölfe, die wiederholt unfair spielen oder zu täuschen versuchen, aus dem Rudel verbannt. Verletzt hingegen ein Individuum ein anderes unabsichtlich, kommt es zu Entschuldigungsgesten. Soziale Spiele dienen also auch dazu, das Gruppenethos einzuüben – das natürlich nicht notwendig reflektiert sein muss (s. u.).
Die Fähigkeit zum Werkzeuggebrauch und zur Werkzeugherstellung
Lange Zeit galten Werkzeuggebrauch und -herstellung als Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Unter Werkzeuggebrauch versteht man »die Benutzung eines nicht zum Körper gehörenden Objekts, das als funktionale Erweiterung von Mund oder Schnabel, Hand oder Klaue dient, um ein unmittelbares Ziel zu erreichen.«16 Werkzeuge sind also Hilfsmittel dort, wo die dem Körper eigenen Werkzeuge nicht ausreichen.
Schimpansen stapeln Kisten aufeinander, um an eine hoch hängende Frucht zu gelangen; sie verwenden Stöckchen, um in Termitenbauten nach Termiten zu angeln; sie suchen nach Blättern, um mit ihnen wie mit einem Schwamm Wasser aus Baumlöchern zutage zu fördern; sie nutzen geeignete Steine als Hammer und Amboss zum Öffnen harter Nüsse – seit mehreren tausend Jahren; und für die Honigernte aus einem unterirdischen Bienenstock sammeln sie einen ganzen Werkzeugkasten unterschiedlich beschaffener, teilweise auch eigenhändig bearbeiteter Stöckchen, von denen jedes einer anderen Aufgabe dient17. Ein derart komplexer, sequenzieller Werkzeuggebrauch entspricht jenem der unmittelbaren Vorfahren des Menschen in der frühen Steinzeit.
Auch andere Affenarten, Delfine und Elefanten nutzen Werkzeuge. Doch wiederum ist diese Fähigkeit nicht auf die Säugetiere beschränkt. Neukaledonische Geradschnabelkrähen verbiegen Drähte, um mit ihnen nach Futter zu angeln, und verwenden dazu auch Blätter und Grashalme. Der männliche Gelbnacken-Laubenvogel nutzt zum Bemalen seiner Liebeslaube Blätter als »Pinsel«. Japanische Krähen sind mittlerweile berühmt dafür, dass sie besonders harte Nüsse auf Fußgängerüberwege mit Ampelschaltung legen. Dann warten sie, bis ein Auto darübergefahren ist, um bei der nächsten Grünphase für Fußgänger den Inhalt der Nuss gefahrlos zu fressen. Vereinzelt hat man sogar schon bei Fischen und Insekten Werkzeuggebrauch beobachtet18.
Verstehen die Tiere den Mechanismus des von ihnen gebrauchten Werkzeugs? Oder kommen sie eher zufällig auf dessen Potenziale? Dass dies keine Alternative sein muss, kann man leicht am Menschen beobachten. Viele menschliche Werkzeuge werden durch Versuch und Irrtum entwickelt, und erst nachträglich versucht man ihre Funktionsweise zu verstehen. Manche Tierversuche der jüngeren Zeit deuten aber zumindest darauf hin, dass Tiere einzelne Mechanismen ihrer Werkzeuge verstehen lernen. Doch hier bleibt noch viel zu erforschen.
Die Fähigkeit der Sprache
Die Möglichkeiten der Kommunikation sind vielfältig. Sprache muss selbst beim Menschen nicht ausschließlich akustisch übermittelt werden. Sie kann visuell ausgedrückt werden, im Tierreich zudem über chemische oder elektrische Signale. Aber ist die Kommunikation zwischen Tieren im Einzelfall eine bewusst gesteuerte oder folgt sie einem automatisierten Reiz-Reflex-Muster ? Sofern das Erste der Fall ist, wird Sprache erlernt und durch jede neue Kommunikation erweitert. Eine zweite Frage betrifft die Komplexität eines Zeichensystems. Enthält es nur Ein-Wort-Sätze bzw. Ein-Zeichen-Sinneinheiten oder gibt es so etwas wie Syntax und Grammatik, die das Ausdrücken und Vermitteln komplexerer Zusammenhänge ermöglichen? Auch Menschenkinder beginnen im zweiten Lebensjahr zunächst einzelne Worte zu sprechen und zu verstehen und bauen danach stufenweise immer komplexere Sätze.
Wiederum sind Affen die Tierarten, deren Sprache und Sprachfähigkeit man zuerst untersucht hat. Für Warnrufe beim Herannahen von Feinden etwa haben sie ein breites Repertoire – für jede feindliche Tierart einen anderen Ruf. Und die Reaktion der gewarnten Artgenossen zeigt, dass diese verstanden haben, vor welchem Feind gewarnt wird. Je nach Feind wenden sie nämlich ganz unterschiedliche Fluchtstrategien an19. Dabei weist jede Affensprache innerhalb derselben Art durchaus regionale Dialekte auf. Ihre Ausdrucksmöglichkeiten sind also nicht vollständig angeboren, sondern werden mindestens teilweise erlernt und weiterentwickelt.
Tiere haben aber nicht nur ihre eigene Sprache, manche sind in gewissem Umfang auch in der Lage, die menschliche Sprache zu verstehen. Hunde lernen durch menschliche Schulung zwischen 50 und 100 Begriffe, deren Bedeutung sie kennen. Julia Fischer berichtet von dem Border Collie Rico, der sich die Namen von über 200 Spielzeugen merken konnte20.
Haben Tiere, die kommunizieren, ein Konzept der Begriffe, die sie hören oder verwenden? Verstehen Affen, was eine Schlange ist und was ein Leopard? Eine Reihe von ForscherInnen hat das an Haustauben untersucht21. Man zeigte den Haustauben Dias, auf denen sie nach einem »Schlüsselgegenstand« suchen sollten. Befand sich der »Schlüsselgegenstand« auf dem Dia, erhielt die Taube Futter, wenn sie auf das Dia pickte, befand er sich nicht darauf, erhielt sie kein Futter, wenn sie auf das Dia pickte. Mit der Zeit lernten die Tauben, nur dann auf das Dia zu picken, wenn dort irgendwo der »Schlüsselgegenstand« abgebildet war. Zunächst ließ man sie nach Bäumen verschiedenster Farben und Formen suchen, dann nach Zahlen, Autos und Fischen. Stets lernten die Tauben schnell, welcher Gegenstand der gefragte war. Schließlich konnten sie mit der genannten Methode sogar die expressionistischen Bilder Claude Monets von den kubistischen Gemälden Pablo Picassos unterscheiden – zwei zugegebenermaßen sehr verschiedene Malstile, von denen man aber erst einmal eine Vorstellung erwerben muss. – Haben die Tauben nun einfach im Reiz-Reaktionsmuster gearbeitet und »automatisch« das richtige Bild erkannt? Oder haben sie das Gemeinsame jener Bilder entdeckt, also das Konzept, den Begriff des Schlüsselgegenstandes? Es fällt schwer, die erste Hypothese zu vertreten, denn die Tauben bekamen immer neue und komplexere Dias gezeigt – und antworteten mit hoher Erfolgsquote richtig. Sie müssen den Baum als Baum, das Auto als Auto erkannt und sich damit einen Begriff dieser Gegenstände gebildet haben.