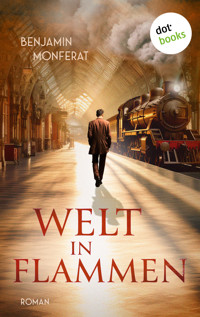Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sturm braut sich zusammen … 29. Oktober 1889: Die ganze Welt sieht auf Paris, wo Millionen von Menschen dem fulminanten Höhepunkt der großen Weltausstellung entgegenfiebern. Doch hinter der glänzenden Fassade dieser neuen, hoffnungsvollen Zeit brodelt es ... Als zwei Ermittler des französischen Geheimdienstes ermordet aufgefunden werden, setzen die Agenten Alain Marais und Pierre Trebut alles daran herauszufinden, wer hinter dem Attentat steckt. Dabei scheint ihr Schicksal mit dem einiger Besucher verbunden: Da ist eine schöne Kurtisane mit einem dunklen Geheimnis, ein junger Fotograf, der bereit ist, alles für seine Liebe zu tun, eine französische Adelige auf der Flucht vor einem Skandal, ein preußischer Spion mit einem besonderen Auftrag … Sie alle finden sich um Mitternacht am Eiffelturm wieder, wo sich die Zukunft Europas entscheiden soll – oder in Flammen aufgehen wird … »Vor der Kulisse der Pariser Weltausstellung entwirft Benjamin Monferat in seinem historischen Spionageroman ein Gesellschaftspanorama, das von den Konflikten der Großmächte durchdrungen ist.« Vogue Ein packender historischer Roman für alle Fans von Ken Follett und John le Carré. »Eine große schriftstellerische Leistung.« Amazon-RezensentIn »Ein wahrhaft opulenter Blick auf ein spektakuläres Ereignis der Vergangenheit, das Monferat so gut in Szene setzt, als hätte damals jemand mitgefilmt und das Material zu einer (geschriebenen) IMAX Experience verarbeitet. Exzellent!« Amazon-RezensentIn
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
29. Oktober 1889: Die ganze Welt sieht auf Paris, wo Millionen von Menschen dem fulminanten Höhepunkt der großen Weltausstellung entgegenfiebern. Doch hinter der glänzenden Fassade dieser neuen, hoffnungsvollen Zeit brodelt es ... Als zwei Ermittler des französischen Geheimdienstes ermordet aufgefunden werden, setzen die Agenten Alain Marais und Pierre Trebut alles daran herauszufinden, wer hinter dem Attentat steckt. Dabei scheint ihr Schicksal mit dem einiger Besucher verbunden: Da ist eine schöne Kurtisane mit einem dunklen Geheimnis, ein junger Fotograf, der bereit ist, alles für seine Liebe zu tun, eine französische Adelige auf der Flucht vor einem Skandal, ein preußischer Spion mit einem besonderen Auftrag … Sie alle finden sich um Mitternacht am Eiffelturm wieder, wo sich die Zukunft Europas entscheiden soll – oder in Flammen aufgehen wird …
Über den Autor:
Benjamin Monferat ist das Pseudonym des deutschen Bestsellerautors Stephan M. Rother. Der studierte Historiker war 15 Jahre lang als Kabarettist auf der Bühne unterwegs, bevor er sich im Jahr 2000 dem Schreiben widmete. Seitdem veröffentlichte er zahlreiche erfolgreiche Romane für Erwachsene und Jugendliche. Die Lebensgeschichte seines Großvaters, der im Dritten Reich am Bau luxuriöser Eisenbahn-Waggons beteiligt war und gleichzeitig im Widerstand gegen das Regime einsetzte, inspirierte ihn zu seinem Historien-Epos »Welt in Flammen«.
Bei dotbooks veröffentlichte Benjamin Monferat seine historischen Romane »Der Turm der Welt« und »Welt in Flammen«.
Die Website des Autors: magister-rother.de/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung zweier Photochrome von LOC Library of Congress (LC-DIG-ppmsc-05221 / (LC-DIG-ppmsc-05239) sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-205-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Benjamin Monferat
Der Turm der Welt
Roman
dotbooks.
Fluctuat nec mergitur
Auf den Wogen schwankend, wird sie dochnicht untergehen
(Inschrift auf dem Stadtwappen von Paris)
PROLOG
Die Zeit warf gespenstische Schatten.
Fahles Mondlicht drang durch das Dach der Halle. Widerstand gab es nicht, denn zu diesem Zweck war der Bau ersonnen worden: als Symphonie aus Glas und Stahl. Einem gigantischen Gewächshaus gleich thronte er über seinen mechanischen Bewohnern, die Atem zu schöpfen schienen in rasselnden, zischenden, dampfenden Träumen. Die Galerie des Machines, die Maschinenhalle, war das pochende Herz der Weltausstellung, doch es schlug langsam in der Nacht, viel zu langsam für die menschliche Wahrnehmung. Zwielicht herrschte und Schweigen, wenn die größte Schau, die das Jahrhundert gekannt hatte, ihre Pforten für den Abend geschlossen hatte.
Doch nicht in dieser Nacht. Da war ein Wispern, da waren Fetzen einer Unterhaltung. Da war ein nervöses Räuspern, ein unterdrücktes Hüsteln dann und wann. Und da waren andere, noch undeutlichere Laute, die vage nach einem krampfhaften Schlucken klangen. Als ob ein Mensch sich bemühte, den Inhalt seines Magens dort zu behalten, wo er hingehörte.
In einem weiten Halbkreis umstanden die Männer Berneaus gewaltige mechanische Uhr, jene grandiose Erfindung, die die Zeit mit bis dahin unerreichter Präzision anzuzeigen vermochte. Der mehrere Meter hohe Koloss, der den filigranen Mechanismus hütete, erhob sich an einem Ehrenplatz nahe dem Ende der Halle. Seine kleineren Vettern schienen respektvoll Abstand zu halten.
Nicht anders als die Versammlung der Honoratioren, die Berater des Präsidenten, der Präfekt der Polizei, der Vertreter der Gendarmerie und weitere Offizielle: alle, denen eine Rolle zukam, wenn die Sicherheit der größten Schau der Welt zum Gegenstand wurde. Sie alle hielten Abstand, die Köpfe geneigt, die Zylinderhüte in den Händen. Hielten Abstand nicht allein vom klobigen Körper der Berneau’schen Uhr, sondern selbst von dessen Umriss, den das Licht des Mondes auf das Pflaster malte.
Denn etwas stimmte nicht mit diesem Umriss, ließ sich nicht recht übereinbringen mit dem allseits bekannten Erscheinungsbild, das der große Konstrukteur dem Gehäuse verliehen hatte. Zwei Ausbuchtungen ragten über die Haube hinweg. Ausbuchtungen, die es nicht hätte geben dürfen und die von den Körpern zweier Männer stammten, durchbohrt von den gut daumendicken Zeigern.
Die Versammelten waren von Kurieren aus unterschiedlichen Winkeln der Stadt zusammengerufen worden und hatten die Halle vor etwa zwanzig Minuten gemeinsam betreten. Seitdem verharrten sie in ihrer Formation, während Gendarmen die entfernteren Abschnitte der Halle durchkämmten. Sie schienen auf etwas zu warten.
Ihre gedämpften Gespräche verstummten, als ein neues Geräusch ertönte. Tack tschick-tack, tack tschick-tack. Rhythmisch und exakt. Es hätten die Laute sein können, mit denen eine der komplizierten Apparaturen Fahrt aufnahm – die dampfgetriebene Pflasterverlegemaschine vielleicht oder Le Roys vollautomatisierter Eierkocher, doch den Umstehenden war das rhythmische Geräusch bestens vertraut. Langsam wandten sie sich um.
Der Mann mochte einen Meter sechzig messen, weniger vermutlich, gestützt auf seinen Gehstock, den er mit entschlossenen Bewegungen aufsetzte, Bruchteile von Sekunden, bevor sein rechter Fuß den Boden berührte. Tack tschick-tack, tack tschick-tack. Sein Körper schien ausschließlich aus Haut und Sehnen zu bestehen, die Konzentration so ziemlich das Einzige, was ihn aufrecht hielt. Die Konzentration und der steife Stoff seiner dunklen Uniform, deren Brust mit einer ganzen Batterie militärischer Auszeichnungen geschmückt war.
Einen Atemzug lang nahm er die grauenhaft veränderte Uhrenapparatur in den Blick. Ohne zu blinzeln und scheinbar ohne die Umstehenden wahrzunehmen. Schweigend. Um dann doch zu den Versammelten zu sehen, die einer um den anderen die Augen niederschlugen.
Général Philippe Auberlon stand seit Napoleons Zeiten im Dienste des französischen Staates. Seit den Zeiten des ersten Kaisers Napoleon, wohlgemerkt. Sieben – oder waren es acht? – politische Regime, die aufeinander gefolgt waren, doch von der Politik hatte er stets die Finger gelassen. Er war Soldat, wenn auch sein Kampfplatz nicht das offene Schlachtfeld war. Noch immer, mit weit über neunzig, war er der Mann, in dessen gichtgekrümmten Fingern die Fäden im gewaltigen Apparat des Deuxième Bureau zusammenliefen. Im militärischen Geheimdienst der französischen Republik.
Er betrachtete sie, die Mächtigen der Republik, die nicht auf seine Worte hatten hören wollen. Bis heute. Nun, da sie in ihrer Not nach Philippe Auberlon gerufen hatten. Nun, da es zu spät war und zwei seiner Beamten auf den Zeigern der gigantischen Uhr thronten wie die Trophäen eines grausigen Schmetterlingsfängers.
War er der Einzige? Der Einzige, der auf der Stelle begriff, was dieses Bild bedeutete?
Zwei tote Körper auf den beiden stählernen Zeigern des monströsen mechanischen Apparats. Einer von ihnen nahezu senkrecht, der andere leicht nach links geneigt. Exakt um fünf Minuten vor zwölf war das gigantische Räderwerk knirschend zum Stillstand gekommen.
TEIL EINS
29. Oktober 1889
L’après-midi / Am Nachmittag
ZÜNDUNG IN 59 STUNDEN, 51 MINUTEN
Deux Églises, Picardie – 29. Oktober 1889, 12:09 Uhr
»Und doch stellt selbst dies noch nicht den Höhepunkt der abendlichen Zerstreuungen dar.«
Gebannt hing Mélanie an den Lippen ihrer Cousine. Was Agnès indessen zum Anlass nahm, den Figaro sinken zu lassen und eine bedeutungsvolle Pause einzulegen. Nachdenklich sah sie zunächst Mélanie, dann deren Mutter an, die allerdings keine Miene verzog. Was Agnès achselzuckend fortfahren ließ.
»Die demoiselles im Publikum erscheinen einig, dass es sich bei diesem Höhepunkt um die Darbietung der wilden Kanaken handelt, welche im zuckenden Schein der Öllampen einen urtümlichen Tanz aus ihrer fernen Heimat ...«
»Kanaken?« Mélanie hatte den Rest ihrer Brioche zum Mund führen wollen, dann aber mitten in der Bewegung innegehalten. Sie glaubte, das Bild vor Augen zu sehen: nackte Wilde, Kannibalen womöglich, die zum hypnotischen Klang der Buschtrommeln mit ihren Speeren hantierten. Gefährlich. Einschüchternd. Und unberechenbar – wie sämtliche Völker jenseits der Grenzen der Französischen Republik, jenseits der Grenzen Europas. Sie musste sich räuspern, bevor sie wieder ein Wort herausbekam. »Echte Kanaken?«
Agnès hatte das Zeitungsblatt abgelegt und musterte sie mit zweifelndem Blick. »Ich habe noch nie von unechten Kanaken gehört. Wie sollte man das auch machen? Höchstens, dass man sie schwarz anmalen könnte ...« Sie warf einen Blick nach rechts. »Sind Kanaken schwarz, tata Albertine?«
Mélanie hatte ebenfalls den Kopf gedreht. Vicomtesse Albertine de Rocquefort saß am Kopfende der Frühstückstafel und war dem Gespräch der beiden Mädchen schweigend gefolgt. War sie beim Wort tata, Tantchen, kurz zusammengezuckt? Vermutlich nicht. Kein Mensch wusste seine Contenance zu wahren wie Mélanies Mutter. Doch Mélanie hätte die Reaktion gut verstehen können. Albertine de Rocquefort hatte einmal als eine der schönsten Damen von Paris gegolten, und selbst heute noch vermochte sie ihre Taille auf einen Umfang zu schnüren, um den sie Frauen beneidet hätten, die nicht die Hälfte ihrer Jahre zählten. Ein Tantchen war sie mit Sicherheit nicht.
Die Vicomtesse warf ihrer Nichte einen prüfenden Blick zu. »Kanaken haben eine dunkle Hautfarbe, soviel ich weiß. Aber sie sind nicht regelrecht schwarz. Ein Bronzeton, denke ich.«
»Ungefähr wie die Kommode?« Agnès wies auf das schwere Möbelstück aus glänzend poliertem Mahagoni. »Wenn sie von ihren Tänzen erhitzt sind und sich das Fackellicht auf der nackten Haut ihrer Körper ...«
»Möglich.« In einem sehr endgültigen Tonfall schnitt Albertine de Rocquefort dem Mädchen das Wort ab. »Wobei du gerade etwas von Öllampen vorgelesen hast. Ich gehe davon aus, dass sie mit offenem Feuer vorsichtig sein werden an der Esplanade des Invalides. Mitten in der Stadt. Selbst wenn die wilden Völker in ihrer eigenen Heimat ...«
»Im Senegal! Auf der Ausstellung gibt es auch ein Negerdorf aus dem Senegal! Und Tempeltänzerinnen aus Annam. Das ist in Hinterindien! Mit einem eigenen Tempel! Und sie machen Musik auf Instrumenten, die noch kein Mensch in Europa zu Gesicht bekommen hat! Auf den Champs de Mars wird der größte Edelstein der Welt gezeigt, und der stählerne Turm ...«
Albertine de Rocqueforts Blick traf das junge Mädchen, und diesmal kam er ohne Worte aus. Agnès verstummte, und im Grunde war es wie immer. Auf eine Weise tat es Mélanie leid. Natürlich wurde ihre Cousine manchmal ungeduldig, wenn sich Mélanie nicht auf der Stelle anstecken ließ von ihrer Begeisterung und ihren verrückten Einfällen: ein Ausritt mitten in der Nacht. Ein Boulespiel gegen eine Mannschaft aus dem Dorf. Doch was spielte das schon für eine Rolle? Meistens liebte sie es einfach nur, Agnès zuzuhören, deren Augen zu leuchten begannen, wenn das Wort auf halbnackte Menschenfresser kam, während sich Mélanie selbst der Magen zusammenzog und sie Angst bekam, allein der Gedanke könnte einen ihrer Anfälle auslösen.
Die Vicomtesse schien jetzt beide Mädchen aufmerksam zu mustern. »Ich habe über etwas nachgedacht«, erklärte sie. »Als wir die Stadt verlassen haben, um den Sommer hier auf dem Lande zu verbringen, hatte die Ausstellung eben erst begonnen. Und wie ihr wisst ...« Ein winziges Zögern. »Schon damals haben sehr viele Menschen das Gelände besucht, sehr viele ... gewöhnliche Leute. Und der Doktor hatte Mélanie jede Art von Aufregung streng untersagt.« Unvermittelt drehte sie sich zur Seite. »Doch der Sommer hat dir gutgetan, Mélanie, nicht wahr?«
Hitze durchfuhr das Mädchen. Agnès genoss es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, und tatsächlich tat sie das ja oft genug. Doch Mélanie selbst? Mit einem Mal waren die Augen auf sie gerichtet. Was wollte Maman von ihr hören? Ja, sie fühlte sich besser als am Beginn des Sommers, als die Anfälle beinahe Tag für Tag gekommen waren und sie es kaum noch gewagt hatte, ihr Nachtlager zu verlassen, um sich auf dem Balkon mit Blick auf den Élysée-Palast in den Lehnstuhl zu betten. Zögernd nickte sie.
Die Vicomtesse schien ihre Reaktion geahnt zu haben. »Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht noch nicht zu spät ist«, sagte sie, ohne die Mädchen aus den Augen zu lassen. »Ich erhalte Korrespondenz von Herrschaften, deren Urteil ich vertraue, und sie versichern mir, dass ein Besuch der Ausstellung nicht allein für Personen niederen Standes ein lohnendes Erlebnis darstellt. Und du bist kein Kind mehr, Mélanie. Du bist eine junge Dame und wirst mich in der kommenden Saison in die Salons begleiten können.« Eine kurze Pause. »Ihr alle beide. – Zum Abschluss der Ausstellung sind spezielle Darbietungen angekündigt, die sich als lehrreich erweisen könnten. Neue technische Konstruktionen, die im Betrieb zu erleben sein werden. Eiffels Turm und das gesamte Gelände sollen in besonderer Weise illuminiert werden. Ja, von einer letzten, großen Innovation ist die Rede, welche die Aussteller bis zu den Abschlussfeierlichkeiten zurückhalten würden, um sie erst übermorgen Abend den staunenden Augen der Welt zu präsentieren, kurz bevor das größte bisher gekannte Feuerwerk die Monate der Exposition beschließen wird.«
Agnès hatte den Mund bereits geöffnet, doch jetzt genügte Albertine de Rocquefort die bloße Andeutung eines Seitenblicks, und sie schloss ihn wieder, ohne gesprochen zu haben.
»Nachdem deine Gesundheit nun tatsächlich so erfreuliche Fortschritte gemacht hat, wüsste ich nicht, was einer Rückkehr in die Stadt noch entgegensteht«, wandte sich die Vicomtesse an ihre Tochter. »Hättest du Freude daran, die Exposition Universelle zu besuchen?«
Die Weltausstellung! Mélanie war erstarrt. Jeden Tag brachte der Zeitungsbote den Figaro nach Deux Églises, und jeden Tag war wenigstens eine Seite der Ausgabe mit Neuigkeiten von der Exposition gefüllt. Im Wechsel lasen die beiden Mädchen jene Berichte vor, doch Mélanie war es am liebsten, wenn ihre Cousine an der Reihe war. Dann konnte sie sich ganz den Bildern hingeben, die in ihrem Kopf erwachten: wilde und gefährliche Bilder einer fremden, unbekannten Welt, die vom vertrauten Terrain am Quai d’Orsay Besitz ergriffen hatte. Eine Welt voller grausamer kleiner Pygmäen mit bunt bemalten Gesichtern, die aus dem Rhododendron giftige Pfeile verschossen. Voller schnaufender, pochender Maschinen, die stinkenden, schwarzen Qualm ausstießen. Und voller wagemutiger Menschen, die sich mit dem elektrischen ascenseur bis an die Spitze von Eiffels stählernem Turm befördern ließen, um Vögeln gleich die große Stadt von oben zu betrachten.
Schwindelerregende Bilder, im wahrsten Sinne des Wortes. Bilder, die ihr den Atem nahmen und doch den einen entscheidenden Vorteil hatten: Sie existierten einzig und allein in ihrem Kopf. Wenige Tage noch, und das gesamte wilde Spektakel, so fern und so nah zugleich, würde seine Tore schließen, und erleichtert würde Mélanie feststellen, dass die Stadt, in die sie zurückkehrten, noch immer das vertraute Paris war.
Deswegen hatten sie die Stadt in diesem Jahr so früh verlassen: damit Mélanie nicht gezwungen sein würde, sich dieser Unruhe auszusetzen. Und nun: Hättest du Freude daran, die Exposition Universelle zu besuchen?
»Ich ...« Es war ein Gefühl wie ein Nebel in ihrem Kopf, dem Gefühl, mit dem ihre Anfälle sich ankündigten, gar nicht unähnlich, aber dann doch wieder ganz anders. Und auf irgendeine Weise sorgte es dafür, dass ihr Mund sich öffnete, die Worte wie von selbst über ihre Lippen kamen: »Ich glaube, die Musik würde ich wirklich gerne hören.«
Agnès stieß einen Laut des Entzückens aus. Die Vicomtesse nahm ihn nicht zur Kenntnis. Ihr Blick blieb prüfend auf Mélanie gerichtet.
»Und du fühlst dich kräftig genug für einen Besuch der Ausstellung?«
Mélanie erwiderte den Blick ihrer Mutter, vorsichtig zunächst, aber dann ... Sie konnte nicht sagen, woher die plötzliche Entschlossenheit kam. Stumm nickte sie.
»Das wird un-glaub-lich!«, jubelte Agnès. »Wir müssen uns überlegen, was wir anziehen, ta... Tante Albertine! Mein Reitkleid ...«
Noch immer schenkte die Vicomtesse ihr keine Beachtung. Ihr Blick blieb auf ihre Tochter geheftet, und jetzt spürte Mélanie etwas: War es möglich, dass es ein kleiner Triumph war? In diesem Moment ging es nicht um Agnès, der so oft die gesamte Aufmerksamkeit galt. Es ging um sie, um Mélanie allein.
»Ja«, sagte sie und sah ihrer Mutter in die Augen. »Ich bin mir sicher: Es geht mir sehr viel besser. Ich möchte die Ausstellung sehen.«
Ein feines Lächeln erschien auf den Lippen Albertine de Rocqueforts. Nur selten konnte Mélanie erkennen, was im Kopf ihrer Mutter tatsächlich vorging, doch jetzt sah sie es deutlich, sah die Genugtuung.
»D’accord«, murmelte die Vicomtesse, faltete ihre Serviette und legte sie neben dem Teller ab. Ein Zeichen an das Hausmädchen, dass die Tafel aufgehoben war. »Ich erwarte einen Gast heute Nachmittag, doch Marguerite wird dem Kutscher Bescheid geben und alles arrangieren. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Zwei Tage und drei Nächte, bis die Exposition ihre Tore schließt. Schon morgen kehren wir in die Stadt zurück.«
***
ZÜNDUNG IN 59 STUNDEN, 43 MINUTEN
Exposition Universelle, Esplanade des Invalides, Paris,7. Arrondissement – 29. Oktober 1889, 12:17 Uhr
»Extraordinaire, mon cher secretaire! Extraordinaire!«
Die Worte tönten hohl. Vom breiten Akzent, der so deutlich nach der märkischen Heide klang, war nichts mehr zu hören. Darüber hinaus klangen sie durchaus bedrohlich, was vermutlich auch Drakensteins Absicht gewesen war, als er Kopf und Hals im mächtigen Rohr der französischen Haubitze versenkt hatte.
Friedrich aber sah genauer hin. Während seine Aufmerksamkeit vorgeblich dem Oberhaupt seiner Delegation galt, registrierte er die Reaktion der Gastgeber in jedem Detail. Sekretär Longueville, der die Gäste aus dem Deutschen Reich offiziell begrüßt hatte, war ein Diplomat alten Schlages. Deutlich untersetzt, die Haare auf bizarre Weise quer über den erkahlenden Schädel gekämmt. Keine Regung auf seinem Gesicht, der Ausdruck höflichen Interesses blieb an Ort und Stelle. Einige der jüngeren Beamten aus dem französischen Kriegsministerium hatten sich weniger unter Kontrolle. Deutlich verzog sich der eine oder andere Mund zu einem überlegenen Lächeln. Und das zu dulden war eine Herausforderung.
Drakenstein war natürlich ein Idiot, zugleich aber war er der Anführer dessen, was einer offiziellen deutschen Delegation auf der Weltausstellung noch am nächsten kam. Zufällig wusste Friedrich, welche Mühe es gekostet hatte, den Kaiser zu bewegen, in letzter Minute doch noch eine solche Delegation auf den Weg zu schicken. Eine recht hochrangige Delegation obendrein. Drakenstein war der Milchbruder des verstorbenen Vaters Seiner Majestät. Seite an Seite hatten die beiden an den Brüsten der kaiserlichen Amme gelegen. Wie der Mann sich auch gebärden mochte: Die Franzosen schuldeten ihm Respekt als einem offiziellen Gesandten des Reiches.
Und davon konnte nicht die Rede sein. Feixende Mienen, während auf Friedrichs eigenem Gesicht nicht die leiseste Regung ablesbar war. Er beschloss, sich die Gesichter sorgfältig einzuprägen. Die internationale Lage war gespannt wie seit Jahren nicht. Alle diplomatische Höflichkeit konnte nur mühsam darüber hinwegtäuschen, dass man sich eher früher als später auf dem Schlachtfeld wiedersehen würde. Und dann würden die Geschütze geladen sein.
»Famos.« Drakensteins Kopf kam wieder ins Freie. Die Franzosen mussten das Ausstellungsstück sorgfältig gereinigt haben. Kein Staubkorn auf seinem feisten Gesicht mit dem mächtigen Walrossbart. »Fernwaffe«, wandte er sich auf Deutsch an Friedrich. »Hohe Reichweite. Was denken Sie, hm? Geht noch besser. Werden irgendwann bis Paris reichen, wenn wir welche von der Sorte an der Grenze im Elsass aufstellen.«
Friedrich beschränkte sich auf ein Nicken. Die wenigsten Franzosen machten sich in ihrer Arroganz die Mühe, ein Wort Deutsch zu lernen; schließlich war ihre Sprache die Muttersprache der Diplomatie. Doch galt das auch für Longueville und seine Offiziellen? Er hatte Zweifel, dass Drakenstein darüber nachgedacht hatte.
Der Blick des Gesandten ging einen Moment lang suchend hin und her. Sie befanden sich vor dem Pavillon des französischen Kriegsministeriums, einem Palast im Stile des Sonnenkönigs, das Hauptportal flankiert von unterschiedlichen historischen Geschützen. Selbstverständlich überragte der Bau sämtliche anderen Gebäude auf dem Kolonialgelände der Weltausstellung: die Pavillons von Algerien, Tunesien, Indochina, jeweils im Stil der betreffenden Region gehalten. Unmittelbar gegenüber, vor dem Quartier der Kolonie Annam, waren die Tempeltänzerinnen eben dabei, Besuchern Tee zu reichen.
»Nicht dumm. Gar nicht dumm«, murmelte Drakenstein, bevor er sich an Longueville wandte in etwas, das aus seinem Mund dem Französischen noch am nächsten kam: »Die Wilden immer unter Kontrolle, hm? Wenn sie aufmüpfig werden, wirkt sie Wunder, die große Kanone, hm?«
Longueville neigte stumm den Kopf. Doch Drakensteins Augen waren schon weiter, blieben an Friedrich hängen.
»Ah.« Die Hand des Gesandten legte sich auf die Schulter des jungen Mannes. »Hab ich Ihnen noch gar nicht vorgestellt, mon cher secretaire. – Hauptmann Friedrich-Wilhelm von Straten.« Vertraulich: »Ziehsohn von Graf Gottleben. Nummer zwei im deutschen Generalstab. Graf Gottleben natürlich, nicht der Junge.«
Longueville nickte grüßend, während Friedrich militärisch salutierte, den Blick geradeaus, was ihm die Gelegenheit gab, den Franzosen ganz offen im Auge zu behalten.
Funktionierte es? Drakenstein war nicht eingeweiht. Es hätte ein Risiko bedeutet, ihn einzuweihen, und wie sich gerade gezeigt hatte, war dieses Risiko unnötig gewesen. Die erste sich bietende Gelegenheit, mit der Nähe seines Adjutanten zu einem der Mächtigen des Reiches herauszuplatzen, und schon hatte der Mann sie genutzt. Und ja: Longueville, wie erhofft, schien anzubeißen, wandte nach zwei Sekunden den Blick wieder ab und lud die Gäste aus dem Deutschen Reich mit einer Armbewegung ein, ihm in die Tiefen des Geländes zu folgen.
Friedrich verkniff sich ein zufriedenes Nicken. Diplomaten neigten dazu, Menschen in Schubladen einzusortieren. Friedrich von Straten, ein Adelssöhnchen, das seine Chance auf erste diplomatische Meriten seinen familiären Verbindungen verdankte. Unterschätzt zu werden konnte mehr als einen strategischen Vorteil bedeuten. Es konnte sich als Waffe erweisen.
Denn es hatte eine besondere Bewandtnis mit seiner Anwesenheit in Paris. Eine besondere Bewandtnis mit der frisch aus der Taufe gehobenen Sektion innerhalb der dritten Abteilung des Generalstabs, in der er Dienst tat. Eine Sektion, in der es den jungen Offizieren bewusst war, dass sie mit jeder Minute ihr Leben aufs Spiel setzten, selbst in Zeiten, da ringsum trügerischer Frieden herrschte. Wohl wissend, dass ihr Tun den Augen des Deutschen Volkes verborgen bleiben würde. Den Augen der Franzosen ohnehin. Ihre Einsätze bedeuteten einen ständigen Kampf, doch dieser Kampf war unsichtbar, wurde nicht mit dem stählernen Helm auf dem Haupte ausgefochten. Denn auch ihr Gegner kämpfte nicht mit der Waffe in der Hand, sondern verborgen und tückisch: Franzosen, Russen, Briten – Agenten der feindlichen Mächte, fieberhaft auf der Suche nach Schwachstellen, die sie erbarmungslos nutzen würden an jenem Tag, da sie sich zusammenrotten würden, um aus allen Himmelsrichtungen über das Deutsche Reich herzufallen.
Noch war dieser Tag nicht gekommen. Wenn er aber kam, dann würde Deutschland bereit sein, und Friedrich von Straten würde das Seine dazu beitragen. Diese Reise war seine Gelegenheit, den Beweis anzutreten und sich für neue, noch höhere Aufgaben zu empfehlen. Unter anderem diente sie diesem Zweck, dachte er. Doch vom letzten Punkt auf Friedrichs Agenda wusste der deutsche Generalstab so wenig wie die Franzosen.
Sekretär Longueville hatte zu einer weitschweifigen Erklärung ausgeholt, deutete in Richtung des Pavillons der Kolonie Kambodscha, in dem Friedrich einen Nachbau der Pagode von Angkor erkannte, die er auf Fotografien gesehen hatte. Eine ganze Welt war hier versammelt. Die ganze Welt, soweit die Franzosen sie beherrschten, von den halbnackten, nachtschwarzen Eingeborenen des Senegal bis zu den Chinesen in ihren langen Kutten, die reglos vor ihrer Behausung hockten und an ihren Opiumpfeifen pafften. Die eigentlichen Wunder der Ausstellung, die technischen Wunder, hatte er überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen. Und diese Massen von Menschen, von Besuchern: Allein in diesem Moment mussten es Tausende sein, die sich auf der Promenade drängten. Staunende Gesichter, verzauberte Gesichter. Hatte er solche Gesichter jemals in Potsdam und Berlin gesehen?
Höflich hielt er sich mehrere Schritte hinter Drakenstein und dem französischen Sekretär. Ganz wie das Protokoll es gebot. Unsichtbar, wie es erwartet wurde von Drakensteins Adjutanten. Unsichtbar – doch nicht taub. Aufmerksame Ohren verlangte seine Mission für den Generalstab.
Sein Blick ging nach links, wie beiläufig. Das Hauptareal der Ausstellung mit der Galerie des Machines, der Gemäldegalerie und den Bauten der auswärtigen Mächte befand sich mehrere Straßenzüge entfernt. Lediglich die Spitze der stählernen Turmkonstruktion nach den Plänen Eiffels ragte über die Dächer, einem Skelett, einem bloßen Provisorium ähnlicher als einem bereits vollendeten Bau. Das höchste Gebäude der Welt, Stahl gewordenes Zeichen für den Hochmut einer Nation, die noch vor weniger als zwei Jahrzehnten vor den Deutschen im Staub gekrochen war.
War es wirklich angemessen, eine solche Veranstaltung nun doch noch mit einer offiziellen Delegation aus dem Reich zu ehren? Das zu beurteilen, war nicht Friedrich von Stratens Aufgabe. Seine Aufgabe war anderer Natur, und sie wartete hier in Paris auf ihn. Bisher hatte er noch nicht wesentlich mehr gesehen als das Hotel, in dem man ihnen bei ihrer Ankunft einen fast schon lächerlich guten preußischen Sauerbraten aufgetragen hatte, und nun, heute Morgen, das Kolonialgelände der Weltausstellung. An diesem Abend aber würde er auf seinen Kontaktmann treffen, der bereits in der Stadt am Werke war. Und wie auch immer die Instruktionen aussehen mochten, die auf Friedrich warteten: In einer Hinsicht konnte er sich sicher sein. Dass sie Longueville nicht gefallen würden. Und ebenso wenig seinen Offizieren, die jetzt eitel wie die Pfauen zwischen den Tempeltänzerinnen umherstolzierten, wie es einem deutschen – einem preußischen – Offizier niemals in den Sinn gekommen wäre. Friedrichs eigene Uniform saß sauber und ordentlich, die beiden Hauptmannssterne am Schulterstück noch der auffälligste Schmuck.
Hochmut, dachte er, kommt vor dem Fall. Ein letzter Blick zur stählernen Spitze des Turms, die sich gegen den wolkenlosen Himmel abhob. Dreihundert Meter. Dreihundert Meter waren eine ganz beachtliche Höhe.
***
ZÜNDUNG IN 59 STUNDEN, 30 MINUTEN
Hôtel Vernet, Paris, 8. Arrondissement – 29. Oktober 1889, 12:30 Uhr
»Die Dame in der Nummer zwölf hat sich erneut beschwert.« Der Concierge warf einen raschen Blick auf seinen Notizblock. »Also die Dame, die jetzt in der Nummer zwölf wohnt und vorher in der Nummer drei gewohnt hat, wo sie den strengen Geruch bemängelt hat. Der Geruch sei immer noch da, klagt sie, obwohl sie ein Zimmer auf einer anderen Etage und auf der anderen Seite des Hauses bekommen hat. Unser letztes freies Zimmer überhaupt, die Prinzensuite ausgenommen.«
Aus dem Augenwinkel sah Celeste Marêchal, wie eine der Reinemachefrauen eilig ihren Putzeimer beiseitezog. Eine gute Entscheidung. Serge war nicht in der Verfassung, auf seine Schritte zu achten. Nicht, wenn er seine Liste abspulte. Anders als Celeste selbst, die mit ihren ausladenden Röcken theoretisch sehr viel mehr Raum einnahm als der ihr hinterhereilende spindeldürre Concierge. Und die dem Eimer und seiner Besitzerin dennoch mit einer routinierten Bewegung auswich.
Sie kamen in das Foyer des Hotels, einen schattigen, mit dunklen Hölzern verkleideten Raum, an der Decke ein altertümlicher Kristalllüster. Celeste nickte grüßend in Richtung des österreichischen Ehepaars aus der Nummer neunzehn, das soeben ins Hotel zurückkehrte, und hob die Hand, als eines der Zimmermädchen auf sie zukam: nicht jetzt, nicht hier draußen.
»Die Nummer sechzehn.« Serge, weiter auf ihren Fersen. »Monsieur Søndergracht gibt an, dass er wieder kein Auge zugetan habe. Was sich allerdings nicht verträgt mit der Aussage der Dame in der Nummer sechs, also direkt unter ihm, die ebenfalls nicht geschlafen haben will. Weil er nämlich so laut geschnarcht habe. Ich würde einem von ihnen ein anderes Zimmer geben, aber wie Sie wissen ...«
»Lassen Sie sie die Zimmer tauschen«, erwiderte Celeste und nahm im gleichen Atemzug von Sophie, der Rezeptionistin, ein Schreiben entgegen, das sie eilig überflog.
»Der neue Händler in den Kaufhallen«, setzte Sophie mit gedämpfter Stimme an. »Derjenige, von dem wir die Zutaten für das Souper der deutschen Delegation beziehen. Er müsse seine Lieferanten auch auf der Stelle bezahlen und nicht erst am Monatsende. Heute hat Gustave die Ware noch mitnehmen dürfen, aber er hat gedroht ...«
Celeste hob die Hand. »Ich werde mit ihm reden.«
»Madame?« Der Concierge, in fragendem Tonfall.
Sie drehte sich um, straffte sich. »Wenn Gäste sich beschweren, haben sie eine konkrete Erwartung: dass irgendetwas passiert. Also wird etwas passieren.« Celeste schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Die Herrschaften werden zufrieden sein, alle beide. Glauben Sie mir, Monsieur Serge.«
Ein zweifelnder Blick auf den Notizblock. »Oui, Madame.«
»Das wäre dann alles?«
»Für den Moment?« Zögernd. »Ja.«
»Dann machen Sie es so.«
Der Concierge blinzelte kurz, zog sich dann aber mit einem letzten Oui, Madame zurück.
Celeste holte Luft und warf einen Blick auf die Uhr über der Rezeption. Zwölf Uhr dreißig am Mittag, und sie war buchstäblich noch keine Minute zum Durchatmen gekommen. Und der Tag versprach noch heißer und stickiger zu werden als seine Vorgänger. Wenn es tatsächlich die Hitze von draußen war. Wenn sie nicht aus Celeste Marêchal selbst kam. Regelmäßig und doch vollständig unvorhersehbar. Sie nickte der Rezeptionistin zu und verzog das Gesicht, während sie in den Flur einbog, der zu ihrem Büro führte. Die Hitze. Und alles andere. Der Rest der Welt hielt sie für siebenundvierzig. In Wahrheit aber war sie vier Jahre älter. Im selben Alter hatte ihre Mutter aufgehört zu bluten.
Die Tür fiel ins Schloss, und Celeste sank gegen das schwere Holz. Sie gab sich fünf Sekunden, atmete ein, langsam wieder aus, zog das Taschentuch aus dem Ärmel ihres Kleides, berührte vorsichtig Stirn und Schläfen. Eine Schüssel kaltes, klares Wasser wäre in diesem Moment ein Traum gewesen, und ein Traum würde sie auch bleiben. Mindestens bis nach dem Déjeuner.
Ein langgezogenes Poltern ertönte, gleichzeitig wurden hinter der Milchglasscheibe die schemenhaften Umrisse eines Handkarrens in der Zufahrt sichtbar. Gut. Gustave war von seinem Mittagsbesuch auf dem Markt zurück. Die Küche konnte mit den Vorbereitungen für das Souper am Abend beginnen, noch während die Mittagsmahlzeit aufgetragen wurde; für den Wein würde Celeste selbst in den Keller steigen und die Auswahl vornehmen. Alles hätte seinen Gang gehen können wie seit Jahren eingeübt – wäre da nicht jenes spezielle Problem gewesen.
Ihr Blick fiel auf die unterste Schublade ihres Sekretärs. Jene Schublade, die sich nicht mehr schließen ließ, weil der Stapel der Rechnungen schlicht zu hoch geworden war. Wie hatte es so weit kommen können? Das Hotel quoll über vor Gästen, nun, auf dem Höhepunkt der Exposition, doch die Preise für Lebensmittel von einer Qualität, die ein Haus wie das Vernet seinen Gästen bieten musste, sprengten seit Wochen jedes realistische Maß. Nicht anders als die Gehaltswünsche des Personals im gesamten Hotelgewerbe der Hauptstadt, wobei sich Celeste in dieser Hinsicht noch glücklich schätzen konnte. Etliche ihrer Angestellten waren von der ersten Stunde an dabei und ließen eine gewisse Rücksicht walten, selbst wenn sie nicht ahnen konnten, wie ernst die Situation tatsächlich war.
Zwanzig Jahre, dachte sie. Sie hatte Bertie überrascht. Vermutlich war er selten in seinem Leben dermaßen überrascht worden wie an jenem Tag, als er nach Paris zurückgekehrt war, um festzustellen, dass sie seine großzügigen Geschenke zu Geld gemacht und mit diesem Geld ihr eigenes Hotel erworben hatte. Vielleicht war es ja genau das, eine bestimmte Art von Respekt, die dafür gesorgt hatte, dass sie bis heute Freunde waren. Soweit eine Freundschaft möglich war zwischen einem Mann, den nur der Atem einer siebzigjährigen Matrone von der Herrschaft über ein Weltreich trennte, und der Betreiberin eines Hotels in der Seitenstraße einer Seitenstraße der Champs-Élysées. Albert Edward, Prince of Wales. Bertie für jene, die ihm nahestanden. Bertie, der das kleine Etablissement natürlich seinen Freunden empfohlen hatte und dem Celeste letztlich auch Gäste wie Graf Drakenstein verdankte. Politische Spannungen hin oder her; der deutsche Kaiser war schließlich Verwandtschaft. Bertie, der seinen eigenen Besuch bereits angekündigt hatte zum Abschluss der Ausstellung, und es war ein Besuch, auf den sie sich freute.
Doch wie sollte sie sich von ganzem Herzen freuen, wenn es womöglich das letzte Mal war? Zwanzig Jahre. Die Zeiten waren hart, aber waren sie das nicht immer gewesen? Durchhalten, dachte Celeste Marêchal. Und wusste doch nur zu gut, dass ihr lediglich eine letzte Frist geschenkt worden war: bis zum Ende der Ausstellung. Keiner ihrer Kreditgeber wäre so dumm gewesen, inmitten des einzigartigen Geschäfts rund um die Exposition Universelle Scherereien zu riskieren, die ein Besitzerwechsel unweigerlich mit sich bringen würde. Am nächsten Morgen, sobald alles vorbei war, würde sie Kassensturz machen. War es auch nur möglich, dass es noch einmal gutgehen würde?
»Kopf oder Zahl«, murmelte Celeste Marêchal. Für sie selbst. Für die Zimmermädchen und die Pagen und alle, denen das Vernet ein Zuhause war. Nein, das Glücksspiel war niemals ihre Welt gewesen.
***
ZÜNDUNG IN 57 STUNDEN, 26 MINUTEN
Boulevard de Clichy, Paris, 9. Arrondissement –29. Oktober 1889, 14:34 Uhr
Lucien Dantez musste daran denken, wie alles begonnen hatte. Es war zwei Jahre her, und er war eben frisch nach Paris gekommen. Er hatte seine Kamera unterhalb des Trocadéro-Palastes aufgebaut, gegenüber dem Gelände, das inzwischen die Weltausstellung beherbergte. Die Gärten dort besaßen zu einer bestimmten Stunde des Nachmittags einen ganz besonderen Zauber, und damals hatte er über die Auswahl seiner Motive nicht großartig nachdenken müssen. Ein einzelner Magnesiumblitz verschlang ein Vermögen, wenn man in den Dimensionen eines Jungen aus Pontoise denken musste, und ohne einen solchen Blitz – oder eine Kamera mit modernster Ausstattung wie den neuartigen Schlitzblenden – war es schlichtweg unmöglich, irgendetwas in ausreichender Schärfe im Bilde einzufangen, wenn es sich ständig unwillkürlich bewegte. Und das taten Menschen nun einmal, selbst dann, wenn sie glaubten, für ein Porträt vollständig stillzusitzen. An jenem Tag aber waren wie durch ein Wunder lediglich eine Handvoll Flaneure unterwegs gewesen. Für einige kostbare Minuten, hatte Lucien gedacht, würde der Trocadéro ihm gehören.
Und dann war sie erschienen. Zum allerersten Mal hatte er sie tatsächlich durch das Mattglas des Suchers erblickt, ein schemenhaftes Etwas unter einem schneeweißen Schirm, das langsam ins Bild kam. Oder in das, was sein Bild hätte werden sollen. Mit einem lautlosen Fluch hatte er sich aus seiner gebückten Haltung aufgerichtet. Was hätte er tun sollen? Abwarten, bis sie mit ihren müßigen Schritten den Bildausschnitt durchquert hatte und wieder aus dem Blickwinkel der Kamera verschwunden war? Genau das hatte sie nicht getan. Eine Sitzbank, nahezu exakt in seiner Sichtachse. Versonnen hatten ihre behandschuhten Finger imaginären Schmutz beiseite gestrichen. Zwei Sekunden später, und sie hatte dort gesessen, im Zentrum des Bildes, das den Trocadéro hätte zeigen sollen. Sie zu bitten, eine andere Sitzbank zu wählen, war natürlich nicht in Frage gekommen bei einer Dame der Gesellschaft. Und das war sie ganz unübersehbar, in der Mode jener Jahre mit der gewaltigen Tournüre und dem ausladenden cul de Paris, dem Gestänge, auf dem sich die Röcke über den Hinterteilen der Damen zu bizarren Formen aufbauschten. Doch die Alternative? Einen anderen Standort für die Kamera suchen? Er hatte sich ausrechnen können, dass jenes besondere Licht längst verschwunden sein würde, bis er einen solchen Ort gefunden hatte.
Mit einem Knurren war er ein letztes Mal hinter den Okularen und dem Sucher verschwunden, in der Hoffnung, dass die Dame vielleicht nur ganz klein auf der Fotografie zu sehen sein würde. Was natürlich nicht der Fall gewesen war. Stattdessen hatte er sie gesehen, die nahezu den gesamten Bildausschnitt einnahm, mit ihren Kleidern aus schwerer, dunkler Seide, dem samtenen Mantel – und ihrem Blick, der sich über den Fluss hinweg verlor, in einem geheimnisvollen Irgendwo. Einem Blick, wie er ihn noch niemals gesehen hatte bei einem sterblichen Menschen. Eine Göttin, thronend über dem Reich der Sterblichen. Ein so großes Bild, übermenschlich groß. Und ebendieses Bild hatte sich auf alle Zeiten in seinem Herzen eingebrannt, schärfer, deutlicher und lebendiger, als jede Fotografie es vermocht hätte.
Mademoiselle? Seine Stimme hatte sich rau angehört. Trauen Sie es sich zu, sich mehrere Minuten lang überhaupt nicht zu bewegen?
Ja, so hatte es angefangen. Und wie weit waren sie gekommen seit jener Zeit.
»Das bin ich«, flüsterte Madeleine. Lucien musste die Worte von ihren Lippen lesen, so leise wurden sie gesprochen.
Er genoss dieses Bild. Wobei er das Bild, die Fotografie in diesem Augenblick überhaupt nicht sehen konnte: sein neuestes Porträt, das vor wenigen Tagen unter Zuhilfenahme sämtlicher technischer Werkzeuge, über die er heute verfügte, in seinem Atelier entstanden war. Er hatte einen goldlackierten Rahmen erstanden und die Fotografie hinter Glas fassen lassen, und nun stand sie auf dem kleinen, ovalen Tisch, wo das Licht durch die Fenster in Madeleines Boudoir fiel. Ihr zugewandt.
Heute war ein besonderer Tag. Und schon dies war ein besonderer Moment, der Moment einer doppelten Spiegelung: die Fotografie, in der er die junge Frau eingefangen hatte wie in einem unzerbrechlichen Spiegel – und ihre Reaktion auf dieses Bild, wie eine erneute Spiegelung auf ihr Gesicht zurückgeworfen.
Er sah, wie ihre Augen sich bewegten, erst dieses, dann jenes Detail in den Blick nahmen. Sah tausend Gefühle, tausend Eindrücke über ihre Miene huschen. Erstaunen. Einen Hauch von Befriedigung, woraus er schloss, dass sie die hohen Wangenknochen musterte, die er tatsächlich mit beträchtlicher Sorgfalt in Szene gesetzt hatte. Und dann doch ein Anflug von Skepsis, vielleicht weil sie die Frisur betrachtete und soeben feststellte, dass sie nicht hundertprozentig symmetrisch geordnet war: eine winzige Unregelmäßigkeit, die wiederum ihm ganz besonders gefiel. Jetzt aber, und an irgendetwas erkannte er, dass sie das Bild noch einmal im Ganzen in den Blick nahm: Bewunderung. Und sie war voll und ganz gerechtfertigt, denn die Frau, die das Porträt zeigte, war wunderschön.
»Und?«, fragte er. »Was sagst du?«
Noch einmal betrachtete sie die Aufnahme, und sein Herz machte einen Sprung, als sie sich fast ein wenig widerwillig von ihr löste, um sich ihm zuzuwenden.
»Nun«, bemerkte sie. »Ich dachte wirklich, meine Nase wäre etwas länger.«
Schweigen. Dann, nach weniger als zwei Sekunden, ihr glockenhelles Lachen. »Oh Lucien!« Federleicht kam sie von ihrem Stuhl in die Höhe. »Du hättest gerade dieses Bild sehen müssen! Was du für ein Gesicht gemacht hast!« Für Atemzüge versank er in ihrer weichen, duftenden Umarmung. »Das ist das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe«, sagte sie leise. »Danke!«
Erst jetzt, stellte er fest, begann der Druck auf seiner Brust, sich zu lösen. Er räusperte sich. »Ich bin froh«, sagte er, »dass du mir erlaubt hast, die Aufnahme anzufertigen. Und dass es dir gefällt, dein Bild durch meine Augen, durch mein ...« Er sprach es nicht aus, sondern ergriff ihre Hand und legte sie auf die Brust seines Gehrocks.
Sie lächelte ihn an, doch nur für einen Moment, dann glitt ihr Blick zurück zu der Fotografie. »Das ist mehr als ein Bild«, sagte sie, plötzlich ernster. »Mehr als das, was man im Spiegel sieht. Anders. Fast ein bisschen wie, ja, Zauberei. Jede Fotografie kommt mir ein bisschen vor wie Zauberei, aber deine ... ganz besonders.«
Diesmal war er es, der lächelte. Natürlich war es ihm alles andere als unrecht, wenn sie ihn bewunderte. Und ihm war bewusst, dass diese Gelegenheiten nicht allzu häufig sein konnten. Dazu waren ihre Welten zu unterschiedlich. Zu außergewöhnlich die Menschen, mit denen Madeleine zusammentraf, die Orte, an denen sie verkehrte, die großen Salons und die Feste derjenigen, die in der Republik das Sagen hatten. Dass er selbst in dieser Welt nicht vorkam, hatte ihm schon mehr als eine schlaflose Nacht beschert, doch jetzt kam es darauf an, dass sie nicht anfing, ihn für einen schrulligen Zauberlehrling zu halten.
»Mag sein, dass es aussieht wie Zauberei«, gab er zu und hielt einen Moment inne. Es konnte nicht schaden, wenn er durchblicken ließ, dass sie mit dieser Meinung nicht alleinstand. »Aber in Wahrheit ist es einfach nur ein gewisser Umgang mit dem Licht. Das Geheimnis besteht darin, den Blick in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die Dinge, die der Fotograf in den Mittelpunkt stellt, soll der Betrachter besonders deutlich wahrnehmen.«
Sie sah ihn an, die Stirn plötzlich leicht in Falten gelegt, dann kehrte ihr Blick zurück zum Bild. »In den Mittelpunkt? – Meine Nase?«
Er verspürte das Bedürfnis, sich auf die Zunge zu beißen. Zu kompliziert! Nur dass die Technik der Fotografie tatsächlich eine recht komplizierte Materie darstellte, während in ihrer Welt ... Ihre Welt!
»Die Oper!«, sagte er rasch.
Sie hob die Augenbrauen, und ein Stein fiel ihm vom Herzen. Die Oper liebte sie und ließ sich regelmäßig dorthin einladen – von Herren, denen andere finanzielle Mittel zu Gebote standen als ihm selbst.
»In der Oper kommt es darauf an, dass das Publikum beobachtet, was auf der Bühne passiert«, erklärte er. »Richtig? Deshalb wird die Bühne auf eine bestimmte Weise ausgeleuchtet. Die Plätze im Parkett dagegen, auf den Rängen, in den Logen ... diese Plätze bleiben im Dunkeln.«
Sie nickte. Zögernd. »Es ist nicht richtig dunkel«, schränkte sie ein. »Jedenfalls in den Logen nicht. Wir könnten uns unseren Aufputz sparen, wenn das so wäre. Aber ist es nicht klar, dass das Publikum auf die Bühne achtet? Deshalb ist es doch gekommen, um zu sehen, was auf der Bühne passiert.«
»Genau. Und deshalb ist es in der Oper leichter. Weil ständig etwas passiert, wird das Publikum auch nicht müde, es zu beobachten.«
Auf ihrer Stirn war eine senkrechte Falte entstanden. Sie sah zurück zu der Porträtaufnahme, zurück zu ihm. Schon wieder begann sich jene einzelne nachtschwarze Haarsträhne zu lösen, knapp über dem rechten Ohr. Jene vorwitzige Strähne, die sie zu etwas Unvollkommenem machte und der er aus ebendiesem Grunde so unendlich dankbar war.
»Auf einer Fotografie passiert nichts«, murmelte sie. »Das Bild ist unbeweglich. Bilder sind totes Papier. Und doch sind sie lebendig. Deine Bilder jedenfalls.«
Er neigte den Kopf. »So sagt man«, bestätigte er bescheiden. War das der Moment? Der eigentliche und entscheidende Moment? Ihm war bewusst, wie wichtig die nächsten Worte sein konnten. Er holte Luft. »Ich habe letzten Monat über dreißig Bilder verkauft. Viele davon in mehreren Abzügen. Ich habe mehr als zweihundert Francs verdient.«
»Tatsächlich?« Sie klimperte mit den Augenlidern. »Das ist wirklich hübsch, Lucien.« Wieder ging ihr Blick zu der Fotografie, doch schon sah er, wie ihre Augen sich weiterbewegten, zu dem hohen Spiegel, prüfend, wie sie in diesem Moment aussah, heute Nachmittag.
Er biss die Zähne aufeinander. Sie hatte eine Verabredung an diesem Abend, zu einem Empfang am Rande der Ausstellung. Gleich bei seiner Ankunft hatte sie ihm das mitgeteilt. Eine Verabredung mit einem Baron oder Vicomte oder einem Fabrikbesitzer; er hatte es vergessen. Was er niemals vergessen würde, war, wie diese Verabredungen mit ziemlicher Sicherheit regelmäßig endeten. Auf welche Weise Madeleine ihr Leben in der Wohnung am Boulevard de Clichy bestritt.
Er räusperte sich. »Zweihundert Francs sind noch nicht viel«, gab er zu. Was eine glatte Lüge war. Zweihundert Francs waren mehr, als ein Junge aus Pontoise sich jemals hätte träumen lassen. Aber er war kein Junge aus Pontoise mehr. Er war Lucien Dantez, der aufstrebende junge Fotograf mit dem kleinen Ladengeschäft im achtzehnten Arrondissement. Doch dass es für sie keine große Summe war, stand fest. Zweihundert Francs würden einige ihrer Kavaliere an einem einzigen Abend auf den Kopf schlagen, nicht eingeschlossen der Posten für die charmante Begleitung durch Madeleine.
»Aber es ist ein Anfang«, sagte er mit Betonung. »Oder, nein, mehr als ein Anfang. Erinnere dich, was ich vor ein paar Monaten verdient habe. Und jetzt stell dir vor, was ich vielleicht in ein oder zwei Jahren verdienen werde. Genug für ein großes Haus, für eine Kutsche, für ein ...«
Sie hatte sich vollständig ihrem Spiegel zugewandt, musterte sich kritisch, kniff mit Daumen und Zeigefinger in die Wangen, ließ die Hand dann lächelnd sinken. Ihre Augen trafen sich im Spiegel, und noch bevor sie den Mund öffnete, wusste er, dass es nicht funktioniert hatte. Nicht heute. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie weit er es bringen würde. Dass einmal ganz Paris, dass die ganze Welt über die Aufnahmen sprechen würde, die sie doch selbst als lebendige Bilder bezeichnet hatte. Noch konnte sie es sich nicht vorstellen.
»Mon petit rêveur«, sagte sie leise. Mein kleiner Träumer. Ein Ausdruck der Zuneigung in ihrem Blick, der Wärme, der Freundlichkeit.
Lucien schnitt er ins Herz. Es war einer jener Blicke, die die Halbweltdamen ihren Schoßhündchen zuwarfen. War es ein Zufall, dass Madeleine kein solches Hündchen besaß? Lag es daran, dass sie ihn hatte?
Nein. Nein, es war etwas anderes zwischen ihnen beiden. Sie beide wussten, dass es unzählige Kavaliere gab, die bereit waren, für eine Nacht oder einige Stunden mit Madeleine zu bezahlen – aber nur einen, der sie aufrichtig verehrte. Der sie liebte. Und der alles dafür tun würde, ihr einen Ausweg zu eröffnen aus diesem Leben, aus diesem Gewerbe, selbst wenn sie ihm in einem Quartier nachging, das einer Comtesse würdig gewesen wäre. Einen Adelstitel würde auch Lucien ihr nicht verschaffen können, doch er würde alles dafür tun, damit sie auf keinen Luxus würde verzichten müssen in einem Leben an seiner Seite. Zweihundert Francs im Monat, doch schon im nächsten Jahr konnten es zweitausend werden, wenn er nur weiterhin entschlossen genug ...
»Lucien?«
Er zuckte zusammen. Sie hatte sich umgewandt und musterte ihn so eindringlich, dass er spürte, wie er rote Ohren bekam.
»Madeleine?«
»Ich hatte gefragt, wie du es angestellt hast, dass du jetzt so viel verdienst. Ich freue mich für dich. Hast du den Auftrag am Chinesischen Pavillon bekommen?«
Er biss sich auf die Innenseite der Wangen. Madeleine selbst war es gewesen, die ihn mit den Verantwortlichen zusammengebracht hatte: nicht etwa offiziellen Vertretern des chinesischen Kaiserreichs, das auf der Weltausstellung überhaupt nicht vertreten war, sondern einem Konsortium asiatischer Händler. Was, wenn er sich wirklich Mühe gegeben und auf die Wünsche der Männer eingegangen wäre? Hätte er den Auftrag dann tatsächlich bekommen? Er war sich nicht sicher. Was war es gewesen, das ihn davon abgehalten hatte? Das Wissen, dass der Pavillon von spanischen Handwerkern nach den Plänen eines französischen Architekten zusammengebaut worden war und bei näherem Hinsehen so viel Chinesisches an sich hatte wie Sammeltassen aus Limoges? Sein Widerwille, an etwas mitzuwirken, das sich unecht und einfach falsch anfühlte? Dann sollte ich vielleicht noch an ganz anderer Stelle auf diesen Widerwillen hören.
»Leider nein«, sagte er leise. »Aber ich habe einen ... Partner.«
»Oh?« Jetzt war sie voll und ganz bei ihm.
Er knabberte an seiner Unterlippe. Sollte er es ihr erzählen? Jetzt? Ein weiter Weg, den er gegangen war seit ihrer ersten Begegnung, und so viel von dem, was er seither erreicht hatte, verdankte er ihr. Du weißt sehr genau, was ihre Reaktion sein wird, wenn du ihr die Wahrheit erzählst. Ja, er würde es ihr erzählen, aber nicht jetzt, nicht heute. Sobald er zweitausend Francs im Monat verdiente und ihr das Leben bieten konnte, das ihr zukam, einer Göttin, hinabgestiegen ins Reich der Sterblichen. Er wusste es, er hoffte es: Dann würde sie verstehen.
Sie hatte sich wieder zu ihrem Spiegel umgewandt, schien den Gegenstand des Gesprächs bereits vergessen zu haben. Über ihre Schulter hinweg sah Lucien in sein eigenes Gesicht. Und fragte sich, was er von diesem Bild halten sollte.
***
ZÜNDUNG IN 56 STUNDEN, 41 MINUTEN
Boulevard de Clichy, Paris, 9. Arrondissement – 29. Oktober 1889, 15:19 Uhr
»Mon petit rêveur.« Madeleine stand lächelnd am Fenster des Boudoir und sah ihm nach, wie er mit zielstrebigen Schritten über den Boulevard eilte, die Schultern durchgedrückt, die Nase voran, als ob sie es noch eine Spur eiliger hätte als der Rest von Lucien Dantez. Sie kannte seine Gewissenhaftigkeit. Er musste ein Schild in das Fenster seines Ateliers gehängt haben mit der Uhrzeit, zu der er wieder öffnen würde. Als könnte ihn bereits eine Schlange von Menschen vor der Tür erwarten. Sie hatte eine ungefähre Vorstellung davon, wie es um die Kundschaft des Ateliers bestellt war. Diese Kundschaft existierte nicht. Madeleine hatte ihren eigenen Kundenkreis immer wieder ermuntert, das kleine Ladengeschäft in der Rue Lepic aufzusuchen, und von mehreren der Herren wusste sie, dass sie dies auch brav getan hatten. Um sich bei ihrem nächsten Treffen durchaus anerkennend zu äußern. Doch sie bezweifelte, dass einer von ihnen diesen Besuch ohne ihre Ermunterung wiederholt hatte.
Mit einem Seufzen wandte sie sich ab. Es war ein kleines, nicht hörbares, ein privates Seufzen. Nicht jener Laut, in dem sie sich monatelang geübt hatte, den von dichten Wimpern umschatteten Blick aufmerksam auf dem Gesicht ihres Publikums. Des kleinsten und erlesensten Publikums der Welt, das jeweils aus einem einzigen Herrn bestand.
Madeleine Royal war eine Künstlerin. Der Titel ihrer Darbietung lautete Betörung, und in diesem Sinne fühlte sie sich Lucien durchaus verwandt. Möglicherweise musste man Franzose sein, Bürger der Hauptstadt gar, um das Wesen ihrer Kunst vollständig begreifen zu können. Bedeutende Künstler hatten an den Höfen dieses Landes gewirkt, angefangen mit dem großen Leonardo. Ob diese Männer jemals tatsächlichen Einfluss auf die Geschäfte des Staates ausgeübt hatten, wusste Madeleine nicht zu sagen. Die Madame de Pompadour dagegen hatte das ganz eindeutig getan als offizielle königliche Mätresse: ein Titel, ja, ein Amt, dem wenige andere im Königreich gleichgekommen waren. Und nach dem Ende der Monarchie hatten andere Frauen ihr Erbe angetreten. Dumas’ Kameliendame, Lola Montez, Cora Pearl. Die großen Kurtisanen. Madeleine Royal empfand nicht geringen Stolz, wenn ihr eigener Name in einem Atemzug mit diesen Namen ausgesprochen wurde.
Große, wahre Kunst. Das war es, was Frauen wie sie unterschied von den Huren, die die Straßen rund um den Montmartre bevölkerten. So wie sich Luciens Fotografien von gewöhnlichen Aufnahmen unterschieden, die ein bloßes Abbild der Wirklichkeit als den Gegenstand selbst ausgaben. Weil sie anders waren, eine eigene Wahrheit an sich.
Ein Seufzen. Diesmal von jener Art, die ihrem Publikum vorbehalten war. Es war das Besondere, welches das Publikum zu würdigen wusste. Der gigantische Aufwand, wenn etwas zu einer Wahrheit aus sich selbst heraus wurde. In seiner Profession wie in der ihren. Das Eigentliche, der Schoß irgendeiner Frau, war schließlich für eine weit geringere Investition zu haben in den Straßen abseits des Boulevard de Clichy. Und auf der Exposition Universelle wurden neuartige fotografische Kameras präsentiert, die angeblich jeder Laie bedienen konnte. Waren die Aufnahmen einmal eingefangen, wurde die Kamera an den Hersteller geschickt, und Wochen später kamen die fertig entwickelten Positive zurück, mitsamt dem Apparat, der schon wieder vollständig befüllt war mit neuen, unbelichteten Platten.
»Und so verliert die Welt ihren Zauber«, murmelte Madeleine und verharrte einen Moment, um den Worten nachzulauschen. Unsinn. Das war nicht ihre Art zu denken: rückwärtsgewandt. Es war der Augenblick, der zählte, der kostbare, leuchtende, unwiederbringliche Augenblick, der alles enthielt, was ein Leben nur ausmachte. Die Männer, die sie ausführten, mochten glauben, dass sie auf diese Weise etwas kaufen konnten vom Zauber solcher Augenblicke, doch in Wahrheit war das natürlich unmöglich. Madeleine Royal war nicht zu kaufen. Sie war unendlich weit entfernt davon, und genau das hatte ihren Namen zur Legende gemacht: ein fernes Echo dieses Wissens, welches die Männer erreichte.
Das, was wirklich zählte, konnte nur verschenkt und als Geschenk empfangen werden. Und es wurde fortgegeben, ohne sich dabei zu vermindern. Eine Form von Glück, das nur noch anwuchs beim Schenkenden wie beim Beschenkten. Etwas, das Madeleine mit aller Bedenkenlosigkeit aus der Hand geben konnte, wieder und wieder. Warum also nicht an ihre großzügigen Kavaliere? Auch diese Männer bescherten ihr schließlich einen Abend voller Glück und Freude – auf ihre Weise. Jeder Mann, bei dem sie aus einem Impuls heraus das Bedürfnis verspürte, dieses Glück mit ihm zu teilen, ob nun Geld im Spiel war oder nicht. Ausgenommen Lucien natürlich, den sie so gerne um sich hatte und bei dem sie sich aus genau diesem Grund jene Art der Nähe von Anfang an verboten hatte. Sie kannte seine Träumereien und ließ ihn damit gewähren, doch dieses eine würden sie niemals miteinander teilen.
Über dreißig Bilder verkauft. Mehr als zweihundert Francs in diesem Monat. Wie hatte er das nur angestellt? Doch Madeleine hatte sich bereits entschlossen, ihm sein Geheimnis zu gönnen, bis er irgendwann von selbst entschied, es ihr zu offenbaren.
Ein Klopfen von der Tür.
Überrascht wandte sie sich um. Hatte Lucien etwas vergessen? – »Entrez!«
Schweigen. Madeleine wartete. Zwei Atemzüge lang, dann entstand ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie ging zur Tür und öffnete, den Blick bereits nach unten gerichtet.
Zwei große blaue Augen sahen ihr entgegen, aus einem nicht sehr sauberen Gesicht. Irgendjemand musste sich wieder einmal die Mühe gemacht haben, das strohblonde Haar zu ordentlichen Zöpfen zu flechten, doch von diesem strapaziösen Manöver war schon nicht mehr viel übrig.
»Hallo, Yve«, begrüßte sie das kleine Mädchen, das aus dem dunklen Flur heraus blinzelnd zu ihr emporsah. Wenn sie langsam sprach, konnte die Kleine die Worte von ihren Lippen lesen.
»’leine.« Undeutlich, aber doch erkennbar die zweite Silbe ihres Vornamens. Und ein etwas ungeschickter höflicher Knicks dazu.
»Das war sehr, sehr gut!«, lobte Madeleine und beobachtete, wie sich ein scheues Lächeln auf dem Gesicht der Kleinen ausbreitete.
Niemand konnte mit Sicherheit sagen, wo Yve herkam. In der Nachbarschaft der einschlägigen Etablissements wimmelte es von solchen Kindern. Die Kleine war eines Tages einfach da gewesen. Die Frau des Hauswirts ließ sie in einer Kammer zum Hinterhof schlafen und steckte ihr wohl hin und wieder ein Stück Brot zu. Im Gegenzug erledigte Yve kleine Botengänge für die Hausbewohner und bekam auch auf diese Weise den einen oder anderen Sous zugesteckt. Das Haus hatte sie adoptiert, dachte Madeleine. Ohne dass irgendein Papier unterschrieben worden war. Und alles war besser als die staatlichen Waisenanstalten. Geschweige denn die Bordelle, die die Kinder der Huren widerwillig durchfütterten, bis sie so weit waren, selbst etwas zu verdienen. Und ein Mädchen, das weder hören noch richtig sprechen konnte, wäre alldem noch hilfloser ausgesetzt als jedes andere.
»Möchtest du dir dein Macaron abholen?«, erkundigte Madeleine sich freundlich. Das kleine Mädchen war so viel auf den Beinen, dass es ihm nicht jeden Tag gelang, vorsichtig an ihre Tür zu klopfen, um sich mit dem süßen Mandelgebäck verwöhnen zu lassen.
Die kugelrunden Augen der Kleinen hatten sich bei der Erwähnung des Macarons noch eine Idee weiter geöffnet, doch gleichzeitig begann Yve, in den Ärmel ihres verschossenen Kleidchens zu tasten, das einmal der Tochter der Hauswirtin gehört hatte. Mit ernsthafter Miene brachte sie ein Kuvert zum Vorschein.
Es fiel Madeleine nicht leicht, doch diesmal verkniff sie sich das Lächeln. Yve legte größten Wert darauf, dass sie sich das Leben in dem herrschaftlichen Gebäude auch tatsächlich verdiente. Gut, dachte Madeleine. Das Geschäftliche zuerst.
»Oh? Post für mich?« Sie streckte die Finger aus.
Mit einem bedeutungsvollen Nicken wurde der Umschlag in ihre Hand gelegt. Sofort fiel ihr auf, wie leicht er war. Fast als ob er leer wäre. Im selben Moment aber ertastete sie bereits den Umriss in der unteren linken Ecke. Die Größe war charakteristisch: eine Visitenkarte.
»Hat der Herr ... Wartet er unten?«, fragte sie an das kleine Mädchen gewandt. Dass es ein Herr war, war keine Frage, wenn er auf diese Weise bei Madeleine Royal vorstellig wurde.
Yve schüttelte den Kopf Ihre Hand beschrieb eine wedelnde Geste in Richtung Fenster. Nein, übersetzte Madeleine. Er war sofort wieder gegangen. Doch jetzt hielt das kleine Mädchen einen Moment lang inne, schien zu zögern, bevor es sich ein Stückchen nach rechts drehte und die Geste wiederholte, zur Tür, die in Madeleines Schlafzimmer abging.
Madeleine kniff die Augen zusammen. »Er ist schon wieder weg und ...« Sie stutzte. Nein. Nicht das Schlafzimmer. »Er ist nicht in Richtung Montmartre verschwunden, sondern in die andere Richtung. Zum Arc de Triomphe, zum Trocadéro!«
Die Kleine nickte gemessen, winkelte dann die Ärmchen an, brachte zuerst die linke Faust nach vorn, dann die rechte, dann wieder die linke ... Wie die Dauerläufer, die man am frühen Morgen an den Ufern der Seine beobachten konnte.
»Er ist sehr schnell wieder verschwunden?« Staunend betrachtete Madeleine das Mädchen, das bestätigend nickte. Unglaublich, wie viel die Kleine erzählen konnte, ohne ein Wort zu sagen. Madeleine hob den Umschlag und führte ihn einem Impuls folgend unter der Nase entlang. Der Hauch eines Duftes? Ja, ein herbes Herrenparfüm, das sie nicht sicher einordnen konnte, doch noch etwas anderes. Das Aroma von Mandeln? Hier war sie sich noch weniger sicher. Direkt neben Luciens Geschenk stand schließlich eine Papiertüte mit einem halben Dutzend Macarons auf dem Tisch.
»Hast du den Mann schon einmal gesehen?«, fragte sie nach.
Kopfschütteln.
Madeleine überlegte. Sie wollte das Mädchen nicht überfordern, und wenn der Umschlag eine Visitenkarte enthielt, musste sie ihn schließlich nur öffnen, um zu erfahren, von wem er stammte. Trotzdem: Das Spiel hatte eine Faszination gewonnen, und mit einem Mal war sie sich sicher, dass ihr die Einschätzung des kleinen Mädchens womöglich sehr viel mehr verraten würde, als irgendein Name das tun würde.
»Wie sah er aus?«, fragte sie. »War er dick oder dünn? Hatte er einen Mantel an oder ...« Sie hielt inne.
Yve zögerte. Dann nickte sie knapp, schien sich zu konzentrieren, bevor sie an den Ärmeln ihres Kleidchens, anschließend am hoch geknöpften, leicht aus der Form geratenen Kragen zupfte. Jetzt noch einmal und ... Die Hand der Kleinen fuhr an ihre Stirn, wurde dann gesenkt. Fragend sah das Mädchen zu der jungen Frau hoch.
»Ich ...« Madeleine sog die Unterlippe zwischen die Zähne. »Ich fürchte, das verstehe ich nicht.«
Yve hob die Augenbrauen. Rügend beinahe. Eine Sekunde lang rührte sie sich nicht, dann zupfte sie erneut an ihren Ärmeln. Am Kragen. Und wieder die Hand an die Stirn und ... Das Mädchen ließ die Hände sinken, machte einen demonstrativen Schritt zur Seite, sah zu Madeleine auf und hob die linke Hand, zeigte ihre Handfläche – und berührte sie mit dem Zeigefinger der rechten, als ob sie ... Als ob sie etwas schrieb.
Plötzlich war es da. »Zwei«, murmelte Madeleine. »Du sprichst von zwei verschiedenen Männern. Der eine von ihnen hat den Brief geschrieben. Diesen Mann hast du überhaupt nicht gesehen. Der andere, derjenige, der dir das Kuvert gegeben hat ...« Sie zupfte selbst an ihrem Ärmel. »Er war zerlumpt. Hatte abgerissene Kleider an. Ein Clochard.« Sie fuhr sich an den Kopf. »Du hattest das Gefühl, dass er nicht ganz bei Verstand war. Deshalb bist du dir so sicher, dass er keinen Brief schreiben kann.«
Ein breites Grinsen war die Antwort, bei dem nahezu ein volles Dutzend kleiner weißer Zähne zum Vorschein kam. Der obere rechte Schneidezahn hatte gerade Platz gemacht für seinen Nachfolger.
Mit einem Lächeln griff Madeleine nach der Papiertüte aus der Patisserie. Ursprünglich hatte sie vorgehabt, dem Mädchen lediglich zwei oder drei der Macarons zu geben und den Rest bis zum nächsten Tag zu verwahren. Doch so schnell, wie das Gebäck hart wurde ... Yve hatte es sich wirklich verdient.
Sie beobachtete, wie die Kleine das erste Macaron gleich auf der Stelle in den Mund stopfte, bevor sie sich mit einem neuen, tiefen Knicks verabschiedete. Das Wort konnte ein voir sein, wie in au revoir, doch da war das Mädchen schon draußen, und die Tür schloss sich.
Immer noch lächelnd, betrachtete Madeleine den Umschlag, nahm den Brieföffner zur Hand und öffnete das Kuvert mit einem entschlossenen Schnitt. Tatsächlich, nichts als eine Visitenkarte, und ... Auf der einen Seite einige wenige Worte, jedoch nicht per Hand geschrieben, sondern mit einer jener Maschinen, deren neueste Serie ebenfalls auf der Exposition zu bewundern war. Einer ihrer Begleiter hatte kürzlich bemerkt, vermutlich mache Remington mit diesen Schreibmaschinen inzwischen bessere Geschäfte als mit seinen Gewehren. Doch daran hatte Madeleine in diesem Moment kaum einen Gedanken. Sie drehte die Karte um.
Die Vorderseite, wo der Name und die Anschrift des Besitzers hätten zu lesen sein müssen: kein einziges Wort, und doch war die cremeweiße Kartonfläche nicht leer. In die obere rechte Ecke war eine einzelne nachtschwarze Rose geprägt. Das war alles. Stirnrunzelnd bemühte sie sich, aus den Worten schlau zu werden, die die Typenhebel der Remington in das Papier gegraben hatten.
***
ZÜNDUNG IN 56 STUNDEN, 14 MINUTEN
Deux Églises, Picardie – 29. Oktober 1889, 15:46 Uhr