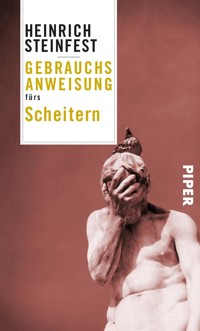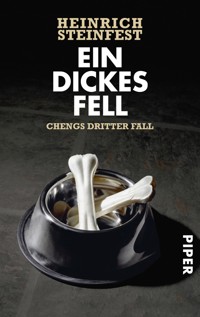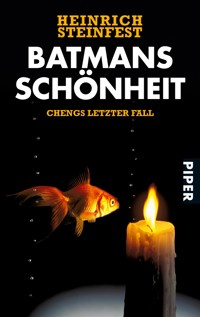9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Leo Reisiger rettet eine Dame vor einer Horde Hooligans. Ihr Gatte Siem Bobeck lädt ihn zum Dank in sein Schloss im österreichischen Purbach ein. Reisiger nimmt an, doch der Dank ist nicht von Dauer. Dort öffnet sich Reisiger der ganze Umfang einer Hölle: Bobeck ist Begründer einer Sekte und auf der Suche nach einem legendären mittelalterlichen Buch. Als Reisiger aus der Hölle entlassen wird, sitzt er im Rollstuhl, und Bobeck lebt immer noch … Heinrich Steinfests ausgesprochen skurriler Humor und einzigartiger Schreibstil machen diesen Kriminalroman zu etwas ganz Besonderem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
6. Auflage Februar 2011
ISBN 978-3-492-95805-9
© 2005 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Lew Robertson / Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Es ist für uns gut, wenn wir zuweilen in große Schwierigkeiten geraten; denn dadurch wird der Mensch wieder daran erinnert, daß er in der Fremde ist und seine Hoffnung auf nichts in dieser Welt setzen soll.
Mann und Mond
Der Mensch besteht aus seinen Leidenschaften.
Zieht man die Leidenschaften ab, bleibt in der Regel nicht viel übrig. Das ist wie mit diesen voluminösen Perserkatzen, die – einmal unters Wasser gehalten – an magere Ratten oder gerupfte Hühner erinnern. Der Mensch bar seiner Leidenschaften besitzt zwar noch immer eine Gestalt, ist noch immer in der Lage, nach Schweiß, nach zerquetschten Blüten oder auch nach gar nichts zu riechen, kann noch immer Böses oder Gutes tun, schöne oder häßliche Schuhe tragen, auf das falsche oder auf das richtige Pferd setzen, Egon heißen oder Margot, doch alles, was er unternimmt oder bleiben läßt, mutet nun leer und fahl und belanglos an. Die Leidenschaft speist den Menschen mit einer Energie, die seine Handlungen erst mit einer bestimmten, wirklichen Farbe ausstattet. Aus dem Menschen wird die Person.
Freilich kann nicht jeder Mensch behaupten, bloß weil er Schuhe nicht nur trägt, sondern für selbige auch schwärmt, darum schon eine Person zu sein, von einer Persönlichkeit ganz zu schweigen. Leo Reisiger aber konnte das. Er vollzog seine Leidenschaften mit jener Intensität, die nötig war, um in die Welt auch wirklich einzutreten, die Welt mit Leben zu erfüllen, nämlich mit eigenem. Und das, obgleich es sich der Zahl nach bloß um zwei Leidenschaften handelte. Die dann auch noch ein geringes Maß an Originalität besaßen: den Mond und das Lottospiel.
Natürlich: Wer spielt nicht alles Lotto? Wer betrachtet nicht alles den Mond? Freilich stellt sich die Frage, ob man in diesen zahllosen Fällen stets von echter Leidenschaft sprechen kann. Von Spielleidenschaft? Von Mondleidenschaft? Gar von Besessenheit?
Und doch: Gerade das Lottospiel stellt den großen Krieg des einzelnen gegen sein Schicksal dar. Die große Versuchung. Die große Herausforderung. Dieselben Leute, die sich damit abfinden, ein trostloses Leben an der Seite eines inferioren Partners zu führen, die sich mit den Abenteuern begnügen, die das Fernsehen bietet, und die den Verfall oder zumindest den fortgesetzten Einbruch ihres Körpers achselzuckend zur Kenntnis nehmen, all diese Menschen, die keine drei Schritte täten, um ein drei Schritte entferntes Glück zu fassen, praktizieren etwas vollkommen Umständliches, Irres, Absurdes und Aussichtsloses, etwas Großartiges und Wagemutiges, indem sie ausgerechnet mittels ein paar angekreuzter Zahlen versuchen, das Steuer ihres Lebens herumzureißen. Das ist, als wollte jemand, anstatt ein Bad zu nehmen, sich in eine Badewanne verwandeln.
Es ist ein vielsagender Irrtum vor allem unter den Gebildeten, wenn sie meinen, die allgemeine Spielsucht resultiere aus einer Propaganda, die den Leuten die Hoffnung auf das große Geld einimpfe und sie vergessen lasse, wie überaus gering ihre Gewinnchancen wären.
Das Gegenteil ist der Fall. Noch der dümmste Spieler ist sich in einem jeden Moment bewußt – erst recht im Angesicht der bedruckten Leere auszufüllender Wettscheine –, daß seine Aussicht auf einen tatsächlich hohen Gewinn nicht nur einfach verschwindend ist, sondern weniger als verschwindend, mikroskopisch, atomistisch, eigentlich virtuell. Darum ja die Leidenschaft, für die der Schwierigkeitsgrad nicht hoch genug liegen kann. Lottospieler pfeifen auf die Einfachheit dreier Schritte, ja, sie empfinden ein solches Drei-Schritte-Glück gelinge gesagt als abstoßend. Nicht jeder, mag sein, aber die meisten. Und genau darum stellt es auch ein Mißverständnis dar, wenn gemeint wird, gebildete Menschen würden darum seltener Lotto spielen, da sie mehrheitlich zu den Besserverdienenden gehören, während umgekehrt Armut, Not oder auch nur mittelständische Trostlosigkeit die Hoffnung auf monetäre Erlösung und somit das Spielbedürfnis verstärken würden. Wenn Propaganda, dann besteht sie genau darin, in dieser Anschauung.
Nein, Lottospieler – damit sind jene gemeint, die auch wirklich keine einzige Ziehung auslassen und treu zu ihren Zahlen stehen –, Lottospieler also sind Menschen, die schlichtweg die allerhöchsten Gipfel erreichen wollen, ohne Schuhwerk, ohne Schlafsack, ohne Traubenzucker und Satellitentelefon, ohne Sauerstoffgerät sowieso. Gipfel von solcher Macht, daß einen schon der bloße Anblick umwirft. Es sind Menschen, die zwar nicht Gott herausfordern, aber doch etwas, was Gott ziemlich nahekommt. Man könnte es vielleicht die Zukunft nennen. Der Lottospieler fordert eine Zukunft heraus, in der für ihn, den Spieler, kein Platz ist, in der zumindest seine Zahlen keinen Platz haben, zumindest nicht als feststehende Gruppe in ein und derselben Ziehung. Das weiß der Spieler und spielt trotzdem. In anderen Zusammenhängen würde man so etwas als Todesverachtung, Blasphemie, Hybris oder als ein wahnhaftes Leugnen realer Verhältnisse klassifizieren. Doch soviel Glück hat auch der glückloseste Lottospieler, daß ihn seine Leidenschaft selten in die Klapsmühle führt. Vielmehr hat das massenhafte Auftreten dieses Typus wenigstens in den betroffenen Milieus zur Anschauung geführt, ein Mensch, der nicht spiele, sei nicht ganz normal. Wie wahr.
Leo Reisiger war fraglos ein echter Lottospieler. Was bedeutete, daß er sich für zwölf unwiderrufliche Zahlenreihen entschieden hatte, es jedoch ablehnte, einen Systemwettschein zur Anwendung zu bringen, in eine Tipgemeinschaft einzutreten oder auch nur Wetten für die übernächste Ziehung abzuschließen. Statt dessen machte er sich die Mühe und Freude, die Darlegung seiner gleichbleibenden Voraussagen von Mal zu Mal handschriftlich vorzunehmen, die Kreuze wie jemand zu setzen, der eine Landkarte mit Nadeln markiert und solcherart eine Eroberung gedanklich durchspielt. Denn auch Reisiger versuchte, eine unwillige Zukunft in Besitz zu nehmen. Und obgleich nur ein einziger seiner verschiedenen Tips der absolut richtige sein konnte, so besaßen die anderen elf die Bedeutung eines militärischen Apparats, dessen Geheimnis darin bestand, seine genaue Gestalt, nämlich elf von zwölf zu sein, erst mit dem Eintritt der »richtigen« Zukunft preiszugeben.
Es waren also zweiundsiebzig Kreuze, die Reisiger zweimal die Woche mittels eines sehr speziellen Kugelschreibers aufzeichnete. Eines Kugelschreibers, dessen Gehäuse über ein derart blasses Lichtblau verfügte, wie es sonst nur bestimmte Mineralwasserflaschen sowie ausgesprochen dunstige Sommertage besaßen. Bei flüchtigem Hinsehen konnte man meinen, es handle sich nicht um einen blauen, sondern um einen weißen Kugelschreiber, was auch immer wieder behauptet wurde: »Interessantes Ding, Ihr weißer Kugelschreiber.«
Leute, die das taten, die also nicht nur ungenau waren, sondern diese Ungenauigkeit auch noch zum besten gaben, waren für Leo Reisiger erledigt. Wobei er jedoch Übertreibungen vermied. Das heißt, er erregte sich nicht in dem Sinn, daß er etwa seinen Schwager öffentlich zur Schnecke machte, nur weil dieser von einem weißen Kugelschreiber gesprochen hatte. Aber hätte Reisiger die Möglichkeit gehabt, einer Reihe von Menschen ein langes, zufriedenes Leben zu ermöglichen, hätte sein Schwager mit Sicherheit nicht dazugezählt. Wäre Reisiger andererseits gezwungen gewesen, ein paar Krankheiten zu verteilen …
Übrigens stellte dieser Kugelschreiber eine Spezialanfertigung dar, war durch zwei Griffstellen auf Reisigers rechten Daumen und Zeigefinger »zugeschnitten« worden, besaß die Gestalt eines stark stilisierten Heuschreckenrumpfs, verfügte über Silberteile an den Enden und in der Mitte (welche natürlich den Eindruck von »Weiß« nur noch verstärkten) und war nicht durch den üblichen Druck auf Bolzen oder Oberteil zu aktivieren, sondern kraft eines gewissen Schwungs, mit dem man das Schreibgerät aus der Tasche zog. Was ziemlich genau an ein offenes Jagdgewehr erinnerte, das durch einen aufwärts geführten, raschen Ruck geschlossen und in einen schußbereiten Zustand versetzt wird. Freilich hätte Reisiger einen solchen Vergleich strikt abgelehnt und den Urheber des Vergleichs in die Kategorie »Empfänger von Krankheiten« aufgenommen.
Reisiger war seit jeher ein großer Freund exquisiter Schreibgeräte, ohne aber dafür dieselbe Leidenschaft wie für den Mond und das Lottospiel entwickelt zu haben. Nichtsdestoweniger hielt er eisern daran fest, stets einen Kugelschreiber bei sich zu tragen. Zusätzlich zu einer Füllfeder und einigen Bleistiften. Und zwar keineswegs aus einer konservativen Haltung heraus. Reisiger war alles andere als ein Feind von Computern, schätzte auch im Privaten deren gewisse Zuverlässigkeit, Präzision und Rasanz, in etwa wie man die guten Eigenschaften einer bestimmten Hunderasse hochhält und dabei gewisse negative Zuchtmerkmale billigend hinnimmt. Einen Nutzen, der ohne Schaden war, ohne Risiko, ohne Tücken und Unbill, hätte Leo Reisiger als Teufelswerk abgelehnt. Denn Reisiger, der ausgesprochen religiös war und in einer wenn auch modifizierten und ungegenständlichen Form an den Teufel glaubte, war der Ansicht, daß Gott in der Welt vor allem dadurch sichtbar wurde, daß Dinge, die funktionierten, nicht immer funktionierten. Somit war das Scheitern eine Erfindung Gottes, eine gute dazu, ohne welche die ganze Vielfalt wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. (Es gibt diesen amüsanten und im Grunde sehr richtigen Satz Einsteins, Amerika sei ein Fehler. Aber wahrscheinlich muß man Einstein dahingehend korrigieren, indem man erklärt, die ganze Welt sei ein Fehler.) Ein Computer, der immer funktioniert hätte, wäre Reisiger verdächtig, eben diabolisch erschienen. Nicht anders als ein Mensch, der ausnahmslos das Richtige sagt und das Richtige tut. Weshalb sich Reisiger auch im klaren darüber war, daß der Teufel, wäre er denn als Mensch herniedergestiegen, keineswegs den Fehler begangen hätte, den zartblauen Schimmer auf einem bestimmten Kugelschreiber zu übersehen. Somit war es aber auch eine schöne und gute Erfahrung in Reisigers Leben, daß ihm noch nie ein Computer untergekommen war, der völlig ohne Macken gewesen wäre und nicht den einen oder anderen Einbruch erlitten hätte. Was ja für die meisten Dinge galt. Ganz so mächtig konnte der Teufel also nicht sein.
Reisigers Kugelschreiber war ein Geschenk seiner Firma anläßlich seines fünfzigsten Geburtstags gewesen. Die Design-Abteilung, die üblicherweise die Gehäuse hochklassiger Unterhaltungselektronik entwarf, hatte dieses spezielle Schreibgerät entwickelt, welches ja nicht nur nett anzusehen war, fingergenau in der Hand lag und von den silbernen Elementen abgesehen aus einem Material bestand, das bei Hitze abkühlte und sich in der Kälte aufwärmte, sondern auch über eine Mine verfügte, die eine Farbspur entließ, welche die extreme Blässe der Ummantelung ins Kraftvolle verkehrte, indem nämlich das überaus dunkle Blau der Schrift immer noch eine Ahnung von Transparenz besaß, so wie ja auch das tiefste und schwärzeste Meer nicht aufhört, zur Gänze aus durchsichtigem Wasser zu bestehen. Dazu kam, daß selbst dieser Farbton je nach Temperatur leicht variierte, minimal nur, und doch sichtbar für den, der darum wußte und nicht ganz blind war. Selbstverständlich handelte es sich auch hierbei um eine Spezialanfertigung, die von Leuten stammte, die sich üblicherweise mit den Innereien von Hi-Fi-Geräten auseinandersetzten. Reisiger besaß eine ganze Serie solcher Minen, die er in einem speziellen Behältnis aufbewahrte, in etwa wie man Zigarren lagert. Ein wenig fürchtete er den Tag, da sie ihm ausgehen würden.
Wenn man bedachte, welche Mühe sich die Belegschaft jener Firma gegeben hatte, in der Reisiger seit einem Vierteljahrhundert angestellt war und seit gut zehn Jahren die Werbeabteilung leidenschaftslos, aber erfolgreich leitete, so hätte man glauben müssen, er sei entweder mächtig oder beliebt. Doch er war ersteres nur sehr bedingt und zweiteres gar nicht. Zudem fehlte ihm jegliche Begeisterung für die Produkte, deren Vermarktung er betrieb, während der Großteil der Mitarbeiter ein ausgesprochen inniges Verhältnis zur eigenen Ware pflegte.
So gesehen war ein solches Geschenk, wie es Reisiger erhalten hatte – passend, perfekt, aufwendig und einmalig –, nur schwer zu erklären, da auch die Unternehmensleitung nichts dergleichen in Auftrag gegeben hatte. Im Grunde konnte niemand wirklich sagen, wie jener launische Einfall, einen Kugelschreiber speziell für Reisiger zu entwerfen, überhaupt entstanden war. Die Idee war einfach dagewesen, das Engagement beträchtlich, das Ergebnis erstaunlich. Gerade so, als müßte man einen Virus dafür verantwortlich machen. Und als die Belegschaft praktisch geheilt gewesen war, war ihr nichts anderes übriggeblieben, als eine kleine, peinliche Geburtstagsfeier abzuhalten und Reisiger sein Präsent zu überreichen. Sodann wurde nie wieder ein Wort darüber verloren. Darum auch Reisigers Befürchtung, die Minen von damals könnten die letzten gewesen sein.
Ohne diesen Kugelschreiber wäre Reisiger nicht aus dem Haus gegangen, so wie er auch schon zuvor niemals ohne Schreibgerät auf die Straße getreten war. Alles eine Frage der Sicherheit. Und zwar im engsten Sinne. Denn aus unerfindlichen Gründen war Reisiger der Überzeugung, daß irgendwann einmal eine Situation eintreten werde, in der sich der Besitz eines Schreibinstruments als absolut notwendig erweisen und das Fehlen eines solchen Geräts zur persönlichen, wenn nicht sogar überpersönlichen Katastrophe führen würde. Nicht, daß Reisiger auch nur einen Schimmer davon besaß, von welcher Katastrophe die Rede hätte sein müssen. Es war die pure Intuition, die ihn diesbezüglich trieb. Und zwar von Jugend an. Wobei er wohl nicht der einzige war. Möglicherweise rüsteten sich Hunderttausende von Menschen Tag für Tag mit Kugelschreibern oder Wäscheklammern oder Teebeuteln oder einer ganz bestimmten Art von Schraubenschlüsseln aus, in Erwartung einer Konstellation, deren fatale Auswirkung sich etwa nur durch eine Wäscheklammer verhindern lassen würde. Es mochte Leute geben, welche die Vision in sich trugen, eines Tages mittels einer solchen Wäscheklammer die gesamte Menschheit zu retten. Und wer kann schon sagen, wie oft die Welt bereits von ihrem Untergang bewahrt worden war, weil solche Spinner existierten.
Reisiger war nun sicher kein Spinner, bloß jemand, der es als geringe Mühe ansah, darauf zu achten, ständig einen Kugelschreiber mit sich zu führen. Für alle Fälle. Aber eben auch für Notizen und vor allem natürlich wegen des Ausfüllens seiner Lottoscheine. Hätte Reisigers rätselhafte Vorahnung jedoch darin bestanden, irgendeine Art von Unglück nur dadurch verhindern zu können, tagaus, tagein mit einem karierten, bis zur Brustmitte hin offenen Hemd durch die Gegend zu rennen, so hätte er gewiß den Eintritt dieser Katastrophe demütig hingenommen. Was ein wenig über seinen Hang zu gesitteter Kleidung aussagt. Er war das, was man wohl einen »gut« gekleideten Mann nennt. Nicht mehr und nicht weniger. Seine Anzüge und Hemden und Krawatten paßten, aber auch nicht so sehr, daß es jemand verblüfft hätte. Es gibt solche Leute, die dadurch verblüffen, daß sie eine Krawatte oder einen Turnschuh oder eine simple Kappe in einer Weise tragen, als wäre jenes Kleidungsstück gleich einer Blüte oder einem Geweih aus ihnen herausgewachsen. Zu denen gehörte Reisiger nicht. Übrigens sehr zu seinem Bedauern. Er wäre gerne perfekt gewesen. Aber perfekt war eben nur sein Kugelschreiber.
Wenn man von Leo Reisiger seine zwei Leidenschaften, den Mond und das Lottospiel, abzog, dann blieb folgendes übrig: ein zweiundfünfzigjähriger Mann, der bereits begonnen hatte – behauptete er – ein wenig zu schrumpfen, jedoch noch immer bei einer Höhe von Einmetervierundachtzig seinen Abschluß fand. Er wog ständig zwischen achtzig und fünfundneunzig Kilo, wirkte aber leichter, manchmal sogar schlank, was er natürlich nicht war. Aber er verstand es – durch eine gewisse Art flotten Gehens und eine gewisse Art flüssig hingestreckten Sitzens –, einen schlanken Eindruck zu vermitteln. Auch vermied er eine Kleidung, die seinen Körper strumpfartig umgeben hätte. Er rauchte sowohl Pfeife als auch Zigaretten, gleichwohl zwang er sich zu stundenlangen Rauchpausen, in denen er von Leuten, die ihn nicht gut kannten, für einen militanten Nichtraucher gehalten wurde. Anders gesagt: Er schätzte es nicht, wenn man während seiner Rauchpausen rauchte.
Leo Reisiger hatte ein Studium der Mathematik halb absolviert und eines der Kunstgeschichte zu Ende geführt, wobei ihm dennoch die ganze Kunstgeschichte so fremd geblieben war wie jene luxuriösen, objekthaften und totemartigen Hi-Fi-Geräte, deren Mystifizierung einen Teil seiner Arbeit bildete. Es erschien ihm wie eine bittere Notwendigkeit, sich ausgerechnet in jenen Disziplinen durchgesetzt zu haben, die ihm nur wenig bedeuteten. Natürlich war er in der Lage, einen Braque von einem Picasso zu unterscheiden, das Original von der Fälschung, wenn man so will.
Aber die Kunstwerke an sich, deren behaupteter Reiz, deren angebliche Magie blieben ihm verborgen. Beziehungsweise leugnete er eine solche Magie, hielt sie maximal für etwas, was allein im Kopf des Betrachters stattfand, vergleichbar einer Person, die sich verliebt und aus diesem Gefühl heraus eine Welt sieht, die gar nicht existiert.
Veilchen, wo keine sind. Scherben, die Glück bringen, obgleich einem die Hand blutet. Es war dieses Entzücken, welches Reisiger so sehr ablehnte, das Entzücken der Leute, die in eine Ausstellung gingen und die in Wirklichkeit von sich selbst entzückt waren, von der eigenen Position als Rezipient. Die somit ein Bild, ein Kunstwerk stets als einen Spiegel wahrnahmen und sich in einem jeden Farbflecken wiedererkannten. Aber auch in der Schwierigkeit mancher Kunst. Oder sogar in ihrer Unverständlichkeit. Gerade das Unverständliche war imstande, das Entzücken manchen Publikums ins Rauschhafte zu steigern. Wobei allerdings Reisigers kritische Haltung keineswegs auf die Moderne oder Avantgarde beschränkt war.
Besonders mißbilligend reagierte er auf das Entzücken angesichts Alter Meister, da in diesem Fall auch noch eine unsinnige Verbeugung vor dem Alter dazukam. Dabei gaben die meisten dieser Bilder schon aus konservatorischen Gründen wenig her. Nicht selten handelte es sich einfach um große, schwarze Leinwände, Hell-Dunkel-Malereien, von denen bloß der viele Schatten übriggeblieben war. Das meiste Licht auf diesen Bildern stammte von jenen ungewollten Spiegelungen der Scheinwerfer. Aber auch helleren, besser erhaltenen Gemälden konnte Reisiger nicht viel abgewinnen. An Rubens etwa störte ihn dieser völlige Mangel an Selbstbeherrschung. Rubens Malerei erinnerte Reisiger an ein Kind, das sich gerade ein bestimmtes Wort angeeignet hatte und nun einfach nicht mehr aufhörte, dieses eine Wort immer und immer wieder herauszuplärren, und dabei völlig vergaß, daß es auch noch andere Wörter zu erlernen gab.
Nun, Reisiger hatte über Rubens promoviert, über einige sehr spezielle Aspekte, und zwar auf Anraten seines Doktorvaters, versteht sich. Eine schwere Geburt, wenn man bedachte, wie tief Reisigers Aversion gegen Rubens, gegen die Barockmalerei, ja, die Malerei an sich, überhaupt die Kunstgeschichte gewesen war. Dennoch hatte seine Arbeit großes Lob geerntet, so als hätte ein jeder Leser gespürt, wieviel gerade von jener Selbstbeherrschung in ihr steckte, welche Rubens’ Bildern fehlte.
Von der Kunstgeschichte war Reisiger schnurstracks in die Privatwirtschaft übergewechselt, hatte zwei Jahre für einen Lebensmittelkonzern gearbeitet, war dann aber in jenes mittelgroße Unternehmen eingetreten, dessen Plattenspieler und Radiogeräte und CD-Player und Lautsprechersysteme es sich eigentlich verbaten, genau so, nämlich als Radiogeräte und Plattenspieler et cetera bezeichnet zu werden. Zu vollkommen waren sie gestaltet, zu sehr beruhte ihre Fähigkeit, ein bestimmtes Geräusch, einen bestimmten Klang an ein ganz bestimmtes williges Ohr heranzuführen, auf dem Prinzip der totalen Vereinnahmung und der totalen Hingabe. Es ging also nicht bloß um die originalgetreue Wiedergabe, was ohnehin kein Mensch ernsthaft zu beurteilen verstand, sondern um die radikale Konzentration, um das vollständige Eingespanntsein eines Zuhörers in den Klang und in das Geräusch wie in ein Ei. Man könnte sagen: Es ging um die Vernichtung des ganzen Menschen zugunsten seines Gehörs.
Und weil es also viel zu banal gewesen wäre, derartige Geräte mit ihren ursprünglichen Gattungsbegriffen zu versehen, hatte es von Anfang an zu Reisigers Aufgaben gehört, die herkömmlichen Bezeichnungen durch neue zu ersetzen, zumindest Ergänzungen, Artikelnamen, Adjektive und Erlebniswörter zu kreieren, die nie und nimmer den Verdacht zuließen, es bloß mit besserer und teurerer Unterhaltungselektronik zu tun zu haben. Allein der Begriff der Unterhaltung war natürlich unangebracht. Welcher Audiophile wollte sich schon unterhalten. Lieber wollten diese Leute tot sein, als Spaß haben.
Das konnte man verstehen oder nicht. Für Reisiger jedenfalls waren Menschen, die sich zu horrenden Preisen derart hochgezüchtete Geräte anschafften und sie in einer akustisch wie auch kultisch optimierten Weise in ansonsten leeren Räumen aufstellten, arme Irre. Er sagte ja auch nicht, er mache Werbung für Hi-Fi-Geräte. Sondern er sagte, er mache Werbung für arme Irre.
Ebenfalls als eine Irre, wenn auch keine arme, empfand Reisiger seine Frau, die er als Neunzehnjähriger kennengelernt und bereits als Zwanzigjähriger geheiratet hatte. Wobei er das Irresein auf das extrem aktive Wesen dieser Frau bezog, die als Filmkritikerin für mehrere Zeitschriften arbeitete, Biographien verfaßte, die Festivals abklapperte, die meiste Zeit ihres Lebens vor Leinwänden und in der Umgebung tobsüchtiger und hysterischer Menschen verbrachte und dann auch noch ihre spärliche Freizeit mit der aufwendigen und umständlichen Durchquerung großer Seen und beträchtlicher Meeresabschnitte verbrachte. Denn trotz ihrer ebenfalls zweiundfünfzig Jahre war sie noch immer eine ausgezeichnete und begeisterte Langstreckenschwimmerin.
Reisiger empfand dies alles als grotesk. Hätte er seiner Frau begegnen wollen, hätte er ein Kino aufsuchen oder ins Wasser gehen müssen. Freilich kam ihm nichts davon in den Sinn, auch nicht, seiner Frau begegnen zu wollen. Nicht, daß er sie haßte. Aber ihre quirlige Art zu Land machte ihn nervös. Und ihr langer Atem zu Wasser blieb ihm fremd wie ein Bild von Rubens. Dazu kam, daß nach so vielen Jahren der Ehe alles gesagt war, alles Schöne und alles Häßliche, und sich ein stilles Nebeneinander weder anbot noch erwünscht war. Die Familie hatte sich erübrigt. Nicht zuletzt, da die Kinder, eine Tochter und ein Sohn, bereits erwachsen waren und irgendwo auf der Welt ihren Berufen nachgingen. Vielleicht auch Karriere machten. Reisiger war sich da nicht so sicher. Die kurzen Mitteilungen auf den Postkarten, die ihn zu Anlässen wie Weihnachten oder seinem Geburtstag erreichten, blieben undurchsichtig wie jene, die ihm dieselben Kinder zehn Jahre zuvor aus Sommerlagern geschickt hatten. Immer behaupteten sie – damals wie heute –, es würde ihnen gut gehen. Aber vielleicht tat es das ja wirklich.
Leo Reisiger abzüglich seiner beiden Leidenschaften verfügte über ein Haus am Stadtrand, fuhr einen kleinen, namenlosen Wagen, abonnierte Zeitungen, die er nicht las, und besaß zwei Pistolen, die er aus Sicherheitsgründen im Haus versteckt hatte, sich aber seit einiger Zeit nicht mehr erinnern konnte, wo denn eigentlich. Weshalb er aber noch lange nicht an seinem Verstand zweifelte. Er hielt Vergeßlichkeit in jeder Hinsicht für eine Tugend. Und natürlich für eine göttliche Erfindung. Er aß gerne gebratene Niere, aber in Maßen, bevorzugte eine japanisch angehauchte Einrichtung und schluckte seit Jahr und Tag ein Antidepressivum, das ihm ein gütiger und generöser Hausarzt anstandslos verschrieb. Reisiger war kein ausgesprochen schöner Mann, in der Art der vollhaarig Graumelierten, aber er besaß ein festes, kantiges Gesicht, das den Reiz eines Steins besaß, der einen lebendigen Eindruck macht. Totes, das lebt – so etwas wirkt natürlich interessant. Wie auch der Schatten, der stets auf seinen Augen zu liegen schien und die an und für sich belanglose Gestalt dieser Augen in ein Dunkel stellte, das gerne als Ausdruck von Intelligenz empfunden wurde. Wogegen Reisiger nichts einzuwenden hatte, obgleich er es andererseits vermied, die Sprache auf seinen Doktortitel zu bringen. Er wäre dann vielleicht in die Verlegenheit geraten, über Rubens reden zu müssen. Freundlich zu reden, um die Leute nicht zu verwirren. Folglich bevorzugte er es, sich als halber Mathematiker denn als ganzer Kunsthistoriker auszuweisen. Übrigens meinte seine Frau, die nicht anders als in Filmen denken konnte, Leo sei physiognomisch gesehen ganz eindeutig ein Connery-Typ. Und da hatte sie absolut recht.
Leo Reisiger stand in der Mitte des Zimmers. Er trug einen rötelfarbenen Wollanzug und ein schwarzes Hemd, während aus dem Schatten, der in gewohnter Weise seine Augen verdunkelte, die von einem hellen Metallgestell umrandeten Brillengläser halb herausstanden. Er hatte seine Brille nicht immer aufgesetzt, so wie er nicht immer rauchte. Jetzt aber war beides der Fall. Die Zigarette hielt er in der rechten, ein wenig weggestreckten Hand, wobei der gerade aufsteigende Rauch das Aussehen einer Klinge besaß. Die linke Hand war zu einer lockeren Faust gerundet und beinhaltete eine Schachtel Zündhölzer. Ein Aschenbecher war nirgends zu sehen.
Es war kalt in dem hohen, weiten Raum. Die gläsernen Flügeltüren standen weit geöffnet. Die Morgenröte, die sich draußen ereignete und den Balkon samt dem schmiedeeisernen Blätterwerk von der Seite her erreichte, trug so gut wie nichts dazu bei, den dunklen Raum und damit auch die dunkle Zimmermitte, in der Reisiger sich befand, aufzuhellen. Die alten, schweren Möbel, der offene, leere Kamin, das breite, ungemachte Bett, die Tapeten, die Vasen, der moosgrüne Teppichboden, der wie glattes Wasser auseinanderlief, das kleine Fresko weit oben, eingefaßt in die ovale Stuckumrandung des Plafonds, das alles verschwand in der Dunkelheit wie in einem tiefen Brunnen.
Die einzige Ausnahme war das Fernsehgerät in einer Ecke des Raums. Reisiger hatte am Vorabend vergessen, es auszuschalten. Soeben war in einer sehr viel wärmeren Gegend ein bedeutender Krieg losgebrochen, dessen erste Bilder übertragen wurden. Weil aber Reisigers Blick nach draußen fiel, hinüber auf die schneebedeckten Berge, hinüber auf den tiefstehenden Morgenmond, fand dieser Krieg praktisch hinter seinem Rücken statt. Er konnte nicht sehen, wie die Raketen sich in Bewegung setzen. Und da nun mal der Ton abgeschaltet war, entgingen ihm die aufgeregten Kommentare, in denen aber auch so etwas wie Erlösung anklang. Das war ja das Schreckliche, daß jeder Krieg auch eine Befreiung darstellte, eine Befreiung vom Druck, den der Frieden bedeutete.
Es braucht nicht betont zu werden, daß der Krieg Not und Elend hervorruft und in der Regel nicht gerade von den allernettesten Menschen organisiert wird. Wobei freilich auch der Frieden eine Menge Not und Elend nach sich zieht und sich ebensowenig von Heiligen in Szene setzen läßt. Der Krieg ist ein schlagender Vater, der Frieden eine tyrannisierende Mutter. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht um das Gefühl der Starre, das die Menschen im Frieden überkommt, als sei die Zeit steckengeblieben, nicht nur die Zeit, ein jedes Ding, eine jede Person. Als sei auch der schönste Frieden ein Stillstand, den auf Dauer niemand aushalten könne. Wie ja auch Pausen nur erträglich sind, solange sie auch wirklich Pausen bleiben, also eine endliche und übersichtliche Dauer besitzen. Man stelle sich eine Pause zwischen zwei Akten, zwischen zwei Halbzeiten, zwischen zwei Liedern vor, die nicht endet. Eine Warten-auf-Godot-Pause. Fürchterlich.
Der Krieg, der soeben in Reisigers Rücken begonnen hatte, war zwar ein weit entfernter, aber eben auch diese weit entfernten Kriege – waren sie nur bedeutend und einschneidend und weitreichend genug – gaben einem das Gefühl, eine Pause sei zu Ende gegangen, so daß sich die Zeit und damit auch die Welt wieder in Bewegung setzen konnte. Darum also dieser leise, verschämte Ton der Erleichterung in den Stimmen der Berichterstatter.
Nun, davon bekam Reisiger nichts mit. Er gab sich völlig dem Anblick des Mondes hin, der etwas von einer papierenen Hülle an sich hatte, die aber nicht lampionartig von innen heraus leuchtete, wie man dies zumeist in der Nacht empfand, nein, dieser Mond stand im Licht wie ein Gesicht, das in die Sonne gehalten wird. Und genau das war ja auch der Fall.
Allerdings wirkte er größer und näher als üblich. Als stünde er tatsächlich über genau diesen Bergen. Einen solchen Mond hatte Reisiger noch selten gesehen. Nicht minder wichtig war ihm dabei die Art und Weise der Betrachtung. Die momentane war ihm die liebste. In einem Zimmer stehend, ohne die Hilfe eines Teleskops, den Blick beinahe gerade auf jenen Trabanten gerichtet. Frei von Poesie. Frei von Esoterik. Denn wenn man von Rubens und der ganzen Kunstgeschichte einmal absah, gab es wenig, was Reisiger so sehr verabscheute, wie die Vereinnahmung des Mondes durch Menschen, die immer irgend etwas oder irgend jemanden für ihr Unglück, ja sogar noch für ihr Glück verantwortlich machten. Leute, die sich mit gezeitenabhängigen Wassermassen verwechselten und eine bestimmte Mondphase zum Anlaß nahmen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen oder ein bestimmtes Gefühl zu entwickeln. Ja statt nein zu sagen, ihre Haustiere umzubenennen, sich die Haare schneiden zu lassen oder den Therapeuten zu wechseln. Und denen es gelang, selbst noch das Auftauchen oder Verschwinden entzündeter Talgdrüsen der Einflußsphäre des Mondes unterzuschieben. Als wollte man die Sattheit, die man einer Scheibe Brot verdankt, einer am Tisch stehenden Blumenvase zuordnen, weil sie halt gar so hübsch aussieht.
Reisiger kannte und verachtete sie, diese Charaktere, die, nachdem sie im Antlitz ihrer heranwachsenden Kinder eine gewisse optische Ähnlichkeit zu sich selbst konstatiert hatten, dazu übergingen, diesen trockenen Umstand in einen lunaren Zusammenhang zu stellen. Als sei der Mond also nicht nur für Wunder, sondern auch für Banalitäten verantwortlich. Nicht minder idiotisch empfand Reisiger die höchst populäre Anschauung, der Vollmond würde große Teile der Bevölkerung in Rage, zumindest in Unruhe versetzen. Weshalb eine jede Wirtshauskeilerei, die in einer solchen Nacht geschah, mit einem Mal einen übersozialen Hintergrund besaß.
All diese Dinge waren für Reisiger reinster Humbug. Seine Liebe zum Mond galt alleine dem Objekt, dem Himmelskörper, der deutlichen Masse am Firmament. Vor allem natürlich auch der Möglichkeit, diese Masse relativ genau betrachten und studieren zu können. Wofür sich Reisiger durchaus diverser Fernrohre bediente, so wie er auch Sternwarten aufsuchte, Mondkarten studierte, ein kleines, nicht ganz billiges Stück Mondgestein besaß und über eine große Sammlung einschlägiger Fotografien verfügte. Aber dennoch blieb der freie Blick auf den Mond das Um und Auf, der Kern der Sache, auch der Kern der Liebe. Zudem half er, der freie Blick, die Relationen nicht aus dem Auge zu verlieren. Nicht zu vergessen, wer man war und wo man stand, nämlich in Zimmern und auf Balkonen. Während etwa die Benutzung eines Teleskops die Illusion hervorrief, sich mit einem Teil seiner Persönlichkeit von der Erde wegzubewegen. Diese Illusion verwarf Reisiger. Wenn schon, dann wollte er mit beiden Füßen auf dem Mond zu stehen kommen und nicht bloß mit den Plateausohlen seines Bewußtseins. Der Einsatz von Beobachtungsgeräten diente für ihn der Bildung, nicht der Stimmung. Die Stimmung aber ergab sich allein im Moment des freien, durch keine Technik verstellten, von keiner Technik getragenen Blicks.
Wie viele Augen braucht der Mensch?
Reisiger betrachtete die Flocken von Asche, die den Boden bedeckten. Er umging sie und warf die Zigarette in den Kamin, der mit seiner mächtigen, barocken Gestalt, mit seinen Löwenfratzen und Gazellenköpfen und seinen marmornen Wülsten mehr wie die Pforte zu einem repräsentativen Gebäude aussah. Man hätte einen Baum in diesem Monstrum verbrennen müssen, um es gemütlich zu haben.
Nun, Reisiger war nicht hier wegen der Gemütlichkeit, sondern aus beruflichen Gründen. Wobei es eigentlich seiner Art widersprach, in Grandhotels wie diesem abzusteigen. Räume, die eine Höhe von drei Metern weit überstiegen, empfand Reisiger gewissermaßen als nach oben hin offen. Und er pflegte nun mal nicht im Freien zu übernachten.
Im vorliegenden Fall aber hatte er sich fügen müssen, da es der ausdrückliche Wunsch seines Geschäftspartners gewesen war, Reisiger in diesem Hotel einzuquartieren, so daß er also die Nacht, wenn schon nicht neben einem riesigen Feuer, so doch in einem riesigen Bett verbracht hatte, in dem es allerdings trotz hochgeschraubter Zentralheizung nie so richtig warm geworden war. Als dürfe es in solchen Betten gar nicht warm werden, als seien warme Betten ein Privileg der unteren Klassen. Das war wohl ein Unterschied wie zwischen Sarg und Gruft.
Im Moment aber wußte Reisiger die Kälte zu schätzen, die durch die offenen Flügeltüren eindrang. Es war ein bitterkalter Tag. Der See vor dem Hotel gefroren. Der ganze Ort gefroren. Die Promenade, der Himmel, der Mond, die Berge. In Reisigers Kopf aber breitete sich die notwendige Klarheit aus, um zu tun, was zu tun war. Er trat an den schwarzen, langen Schreibtisch, der im Dunkel gleich einer Planke zu schwimmen schien. Reisiger griff nach den beiden Papieren, die einsam auf der weiten Fläche lagen, und hielt sie in die Höhe: einen Lottoschein, ausgefüllt, samt jener nur halb so großen, maschinell ausgestellten Quittung.
Gewissermaßen war es so, daß ein ganzes Land auf der Suche nach diesem Lottoschein war. Beziehungsweise nach seinem Besitzer. Auf das übliche Lotto-Fieber war ein unübliches Nach- und Spätfieber gefolgt, eine posttraumatische Erregung. Immerhin handelte es sich um den zweithöchsten Betrag in der Geschichte dieses Spiels und dieses Landes. Bloß, daß bereits mehr als vier Wochen vergangen waren, in denen sich der Gewinner nicht gemeldet hatte. Was diesen zweithöchsten Gewinn für Medien und Publikum weit interessanter machte, als jener höchste es gewesen war, den im Jahr zuvor eine uncharismatische Wettgemeinschaft kassiert hatte. Wettgemeinschaften waren auch für Reisiger so ziemlich das letzte, wofür sich Menschen hergeben durften. Solchen Leuten fehlte jeglicher Stolz, jegliche Einsicht in das Spiel als Herausforderung und Prüfung. Im Falle dieser Kollektive verwirklichte sich sodann das Bild jener mickerigen, winselnden, unterprivilegierten Gestalten, denen es allein ums Geld ging und die sich als Gewinner wie als Verlierer genau so verhielten, wie nichtspielende Gebildete sich das vorstellten.
Dieser höchste Gewinn war also nicht wirklich ein Thema gewesen, da sich seine Umstände und Folgen als undramatisch erwiesen hatten. Geld, das aufgeteilt wurde, war sozusagen kein Geld mehr, sondern eben bloß noch ein Rest von Geld, vergleichbar einem Ferrari, von dem man nicht mehr als die Räder besaß oder auch nur das Lenkrad oder bloß irgendeine Düse. Nicht verwunderlich also, daß man die Mitglieder dieser Wettgemeinschaft – so hoch ihre Anteile de facto auch gewesen waren – in der Öffentlichkeit bemitleidet hatte. Und tatsächlich wurde auch keiner von ihnen so richtig glücklich. Bald war die Rede von den »traurigen Millionären«. Selbst die Lottogesellschaft hatte darauf verzichtet, diesen höchsten Gewinn merklich herauszustellen. Um so erfreulicher war es nun, daß man bei dem Gewinner jener zweithöchsten Summe ganz eindeutig eine Einzelperson annehmen durfte. Anders war ein solches Schweigen nicht zu erklären. Kollektive schwiegen nicht. Nicht so lange.
Spekulationen machten die Runde, etwa über den Tod jener Person, deren Körper nun in irgendeiner stickigen, kleinen Wohnung seit Wochen vor sich hinfaulte. An anderer Stelle entwickelte man die Vorstellung einer vertuschten, hochkomplizierten Familientragödie, dann wieder davon, daß der Wettschein und die eigentlich maßgebliche Quittung verlorengegangen waren, am besten irgendwo im öffentlichen Raum, auf das ein ganzes Volk animiert wurde, die Augen endlich einmal offenzuhalten. Anonyme Briefe erschienen in den Zeitungen, von Leuten, die sich als Gewinner ausgaben und irgendwelche verrückten Dinge behaupteten. Eine kleine Hysterie hatte sich über das Land gelegt, nicht weiter schlimm, nichts, was diesem Land wirklich geschadet hätte. Daß aber der unbekannte Gewinner sich schlichtweg auf einer längeren Urlaubsreise befand, wollte niemand glauben. Denn soviel wußte man, daß es sich um keinen Systemwettschein handelte, so wenig wie eine mehrwöchige Laufzeit quittiert worden war. Vielmehr war die Wette allein für diese eine Spielrunde vorgenommen worden. Dies widersprach ganz eindeutig der Vorstellung eines urlaubenden Spielers.
Nicht zuletzt hatte die Presse dank einer dieser undichten Stellen den Namen jenes Mannes in Erfahrung gebracht, welcher in seinem Tabakladen den Schein entgegengenommen hatte. Was dazu führte, daß dieser Mann geradezu belagert wurde. Er selbst schwieg beharrlich. Nicht ohne Stolz, nicht ohne Pathos. Somit im Bewußtsein der historisch gefärbten Situation, zu der er einen wesentlichen Teil beizutragen meinte. Freilich hieß es, der Mann sei berühmt für seine Vergeßlichkeit, so daß ihm gar nichts anders übrigbleibe, als sich in eine dramatische Verschwiegenheit zu hüllen und mit großer Geste vor allem jene Kundschaft zu bedienen, die den Ort mit der Tat verwechselte und seinen Laden mit Bergen von Lottoscheinen stürmte.
Das Irrationale bestimmt die Welt. Und nicht ein paar Rädchen, die ständig geölt werden müssen.
Reisiger trat an die offene Flügeltüre und hob mit einer Hand die beiden Scheine ins Licht, die er gegeneinander verschob, so daß sich eine Lücke bildete und genau in der Bucht des spitzen Winkels die Gestalt des Mondes sichtbar wurde. Gleichzeitig ergab es sich, daß im Licht der seitlich einfallenden Sonne die gläserne Tiefe der über die Zahlen gelegten und mit Kugelschreibertinte aufgezeichneten Schrägkreuze deutlicher hervortrat. Wie eingebrannt in ein Papier, das an diesen Stellen eine Tiefe von vielen hundert Metern zu besitzen schien. Ozeanisches Papier.
So gesehen fand eine optische Verbindung der beiden Leidenschaften statt, denen Leo Reisiger anhing. Ein Mond, der zwischen Lottoschein und Quittung wie in einer Schaukel oder Wiege hing. Es war ein schöner, würdevoller Moment. Reisiger verbat es sich, auch nur einen Seufzer zu tun. Sodann trat er zurück ins Zimmer und begab sich zu jenem voluminösen Kamin, auf dessen Sims er die beiden Scheine ablegte. Er öffnete seine linke Faust, in der sich noch immer die Streichholzschachtel befand, und setzte eines der Hölzer in Brand. Erneut griff er nach den Scheinen, und ohne auch nur eine Sekunde innezuhalten, führte er die Flamme an die beiden Papiere heran, welche rasch und heftig Feuer fingen. Reisiger ließ sie los, ein wenig wie man die Hand der Geliebten losläßt, die über dem Abgrund baumelt. Lodernd segelten Spielschein und Quittung auf die feuerfeste Bodenplatte, wo sie zur Gänze verbrannten.
Wenn es denn so etwas wie eine telepathische Verbindung zwischen Menschen und Dingen gab, so mußten in diesem Moment eine Unmenge von Leuten einen tiefen Schmerz verspürt haben. Eine Explosion im Magen, ein Stechen in der Brust, ein Bersten im Kopf. Einem ganzen Land mußte für einen Moment ziemlich übel geworden sein.
Bei aller Ruhe und Beherrschtheit, zu der sich Leo Reisiger gezwungen hatte, war natürlich auch ihm der Fraß der Flammen qualvoll in die Glieder gefahren und ins Herz gedrungen. Gut möglich, daß er in diesem kurzen Augenblick ganze Millimeter geschrumpft war. Es ging ja nicht nur um das Vermögen, die Abermillionen, um die er sich selbst soeben gebracht hatte, es ging um den Wettschein als solchen, um die beiden Papiere, die Reisigers Triumph hätten dokumentieren können und die jetzt nichts anderes waren als Ruß auf einer steinernen Fläche.
Aber es versteht sich, daß Reisiger gar nicht anders hatte handeln können. Und wie um sich selbst zu bestätigen, das einzig Richtige getan zu haben, nickte er fortgesetzt in den Raum hinein, gleichmäßig wie ein Tier, das ein Loch gräbt. Ja, es war ein Loch, welches Reisiger nickenderweise in die kalte Luft bohrte. Und es war nun auch dieses Loch, durch das er gleichsam entkam.
Er nahm seine Brille ab und deponierte sie in einem schwarzen Etui, das er in der Innentasche seines Jacketts neben seinem Kugelschreiber unterbrachte. Daß er unter Weitsichtigkeit litt, erschien ihm wie eine symbolische Gabe, wenn man bedachte, wieviel Zeit er investierte, einen weit entfernten Körper im Auge zu behalten. Um freilich Lottoscheine auszufüllen oder sie auch nur zu betrachten, bevor sie in Flammen aufgingen, bedurfte es der ausgleichenden Kraft seiner Augengläser. Nun, damit war es jetzt vorbei.
Reisiger schlüpfte in einen schweren, dunklen Mantel und warf sich einen Schal um, der ihm – überrascht von der Kälte, die vor Ort herrschte – von der Rezeption zur Verfügung gestellt worden war. Ein wenig empfand er den Schal als Schlinge. Als eine bequeme Schlinge, das schon.
Er trat an die Schwelle zum Vorzimmer und blickte noch einmal zurück in den hohen Raum, um eigentlich so gut wie nichts zu erkennen, am ehesten die aufgetürmte Bettwäsche. Keinesfalls aber das noch immer laufende Fernsehgerät. Denn während Reisiger zuvor dem Bildschirm dauernd den eigenen Rücken zugewandt hatte, war es nun das Gerät, das mit seiner hinteren Verschalung zu Reisiger stand. Es sollte sich übrigens zeigen, daß Reisiger auch im Fortlauf dieser Geschichte ungewollt immer im Rücken von oder mit dem Rücken zu sämtlichen Fernsehgeräten, die seinen Weg kreuzten, zu stehen kommen würde. Beziehungsweise würde seine Blickrichtung, seine Konzentration und seine akustische Wahrnehmung stets so geartet sein, daß ihm dieser Krieg verborgen bleiben mußte. Weder verschlief noch ignorierte er ihn, sondern er übersah und überhörte ihn aus purem Zufall. Weshalb auch auf diesen Krieg im speziellen nicht eingegangen werden kann. Er blieb im Dunkel verborgen. Nicht anders als die Vasen und Möbel, nicht anders als das breite, kalte Bett und der breite, kalte Kamin.
Reisiger ging hinunter ins Foyer, das naturgemäß noch um einiges höher aufragte als die Gästezimmer. So hell es auch draußen werden mochte, hier drinnen stand man wie unter einem bedeckten Nachthimmel. Immerhin, im Kamin schien tatsächlich ein ganzer Baum zu brennen. Ältere Männer saßen schweigend davor, mit morgendlichen Drinks ausgestattet. Ihre Gesichter glühten. Vor diesem Hintergrund durchquerte ein sehr viel jüngerer Mensch die Halle, ein Paar kurze, weiße Ski geschultert, als entführe er eine steife, schlanke Braut.
Reisiger griff automatisch nach einer Zeitung, die er im Stehen ausbreitete, sich für den Inhalt aber so wenig interessierte wie zu Hause für seine abonnierten Exemplare. Er schenkte nicht einmal den Fotos Beachtung, sondern blätterte wie in einem Gestrüpp, durch das er sich – achtlos gegen Details – hindurchkämpfte. Man hätte ihn für einen ungeschickten Agenten halten können. Schlußendlich faltete er die Seiten wieder zusammen, fuhr damit durch die Luft, als verscheuche er eine Fliege, legte das Papier ab und trat hinaus in die Kälte, die sich auf seine Haut legte gleich einer Gesichtsmaske aus Gurkenscheiben.
Er stieg die gestreuten Stufen runter, trat auf den breiten Gehweg, an dessen Rändern harter Schnee kleine Hügel bildete. Dahinter öffnete sich der vereiste See, auf dem erste Spaziergänger zu sehen waren, pärchenweise, wie es schien. Wahrscheinlich mußte man ein Pärchen sein, um die Unsinnigkeit zu treiben, auf gefrorenem Wasser zu gehen. Reisiger aber begab sich hinein in die Stadt, in welcher der Begriff des Jet-sets in einer Weise überlebt hatte, wie man das von Bakterien kennt, die durch so gut wie nichts umzubringen sind. Der Ort gehörte zu den vornehmsten seiner Art, nahe der Berge, aber eben nicht mitten drin, wie viele Wintersportorte, die den Eindruck erwecken, in einem einzigen Moment von einem bloßen Kran oder Hubschrauber in der Wildnis abgestellt worden zu sein. Und dementsprechend auch jederzeit wieder verschwinden können.
Hier jedoch spürte man die Gewachsenheit des Ortes, auch die Gewachsenheit des Häßlichen, wie jene enge, eingeschattete Fußgängerzone, in die Reisiger nun über eine kleine Gasse einbog. Erste Geschäfte wurden geöffnet. Kellner in bloßen Hemden traten kurz nach draußen, plauderten. Die wenigen Passanten trugen Anoraks. Menschen, die Pelzmäntel bevorzugten, verließen erwiesenermaßen sehr viel später ihre Häuser. Der Anorak war die Uniform der Frühaufsteher wie der Nachtschwärmer, also von Personen, die der Witterung zu trotzen verstanden. Freilich waren die Anoraks, die an diesem Ort gehobenen Flanierens zu sehen waren, wenig geeignet, einen Kältetod zu verhindern. Wie es schien, waren sie nicht einmal geeignet, die Attacke ein paar besoffener Jungs abzuwehren. Denn etwa in der Mitte dieser Geschäftsstraße, genau dort, wo mehrere hohe Säulen aus poliertem Metall einen Kreis bildeten, einen überflüssigen Kreis, vielleicht auch ein überflüssiges Oval, wenn man genau hinsah, genau dort also ergab es sich nun, daß eine Gruppe junger Männer ebenfalls einen Kreis bildete, und zwar einen, der um zwei Frauen gezogen wurde. Welche wenig erfreut schienen ob dieser Einengung. Reisiger konnte von fern die Flüche einer der beiden Frauen hören, während die andere versuchte, aus dem Kreis auszubrechen, doch von einem der Burschen zurückgedrängt wurde, derart, daß sie unsanft gegen eine der Säulen stieß.
Wie schon angedeutet, beide Frauen trugen Anoraks, modische, teure Dinger, die gewissermaßen mit den ausgestellten Stücken der gegenüberliegenden Boutique korrespondierten. Die Frauen also paßten bestens in dieses Umfeld. Nicht aber die Gruppe offenkundig betrunkener und enthemmter junger Männer, die mit ihren schwarzen, von Stickern übersäten Lederjacken und den langen, bis zu den Knien reichenden Schals auf Reisiger den Eindruck von Hooligans machten. Auch meinte er, mehrmals den Ausdruck »Honved« vernommen zu haben, einen Begriff also, der ja nicht nur ungarische Vaterlandsverteidiger benennt, sondern auch eine Budapester Fußballmannschaft. Freilich paßte das nicht so richtig zusammen. Denn obgleich man bereits März schrieb und anderswo durchaus Fußball gespielt wurde, konnte bei den hiesigen Verhältnissen mit Sicherheit kein Spiel stattfinden. Ganz abgesehen davon, daß dieser schöne Ort für vieles berühmt war, aber sicher nicht für seinen Fußball.
Nun gut, das war auch gar nicht die Frage. Die Frage, die sich aufdrängte und die sich ein jeder der unbeteiligten Passanten stellen mochte, war die, was zu tun war, um diese kleine Meute rabiater Burschen daran zu hindern, zu tun, was sie taten. Denn alles andere als eine bloße Frotzelei ging hier vonstatten. Nachdem die eine Frau nicht aufgehört hatte, sich mit lauter Stimme zu erregen, hatte ihr einer von den Typen mit einer kaum faßbaren Plötzlichkeit einen Schlag mitten ins Gesicht versetzt. Noch nie hatte Reisiger eine getroffene Person, auch keinen Boxer, auf diese Weise stürzen sehen, nicht wie Menschen stürzen, sondern Felsen oder schwere, reife Früchte oder vielleicht auch Frösche, wenn es Frösche regnet. Die Frau prallte mit einem Schrei auf dem Boden auf, fiel praktisch in den eigenen Schrei hinein und erstickte ihn, so daß ein bloßes Schluchzen übrigblieb. Eine Augenbraue war geplatzt, Blut zog quer über das Gesicht, was einen windverwehten Eindruck machte, und tropfte dann auf den hellgelben, wattierten Anorak, auf dem zwei Katzenköpfe aufgedruckt waren.
Ein Kellner kam aus seinem Lokal geeilt, während er gleichzeitig die Ärmel seines strahlend weißen Hemdes nach oben schob. Ein zweiter folgte ihm. Mit ihren weißen, langen Schürzen und den feinen Terrakottagesichtern erinnerten sie an Renaissanceengel. Engel im Anflug. Doch nur ein einziger von den Hooligans machte sich auch die Mühe, die beiden himmlischen Gestalten zu beachten. Er griff in das Innere seiner Jacke und holte ein Messer hervor, ein Messer mit breiter, gezackter Klinge, ein Tauchermesser möglicherweise, verzichtete aber darauf, es den Herbeigeeilten entgegenzustrecken. Vielmehr hielt er es sich mit einer obszönen Geste ans eigene Geschlecht. Was auch immer das bedeuten sollte, es beeindruckte die Kellner, die ihren Lauf abbremsten, ihre Hände fächerartig anhoben und erklärten, man könne die Sache doch auch sicher in Frieden regeln. Der Mann mit dem Messer verdrehte bloß die Augen. Er schien ehrlich gelangweilt ob der Naivität der zwei Schürzenträger, ja, er faßte sich in einer durchaus schwermütigen Weise an den Kopf, wie jemand, der an einer kalten Welt zu zerbrechen droht. Gleich darauf lachte er schäbig. Ein gespucktes und gespeites Lachen. Seine Kumpels lachten mit. Woraufhin die beiden entzauberten Kellner kehrtmachten, der eine jedoch sich am Eingang des Restaurants nochmals umwandte, um kleinlaut das baldige Eintreffen der Polizei anzukündigen. Die Hooligans blieben ungerührt, als wüßten sie es besser.
Wie die meisten anderen Passanten auch, war Reisiger in dem Moment erstarrt, als der Fausthieb die Frau mit großer Wucht umgeworfen hatte. Und wie die anderen auch, hatte ihn das Auftauchen der engelsgleichen Kellner erleichtert und deren Rückzug bestürzt. Darum vor allem bestürzt, da er nun wieder in den Sog einer Verpflichtung geriet, die darin bestand, etwas zu unternehmen. Umso mehr, als nun einer von den Kerlen an die zweite Frau herangetreten war, wobei seine Schrittfolge unheimlicherweise an eine Einladung zum Tanz erinnerte. Er lächelte wie über einen Witz, der allein in seinem Kopf steckte und unaussprechlich blieb. Dann schob er seine Hand unter den gefransten Anorak und packte die Brust der versteinert dastehenden Frau, tatsächlich so, als wolle er diese Brust melken. Es lag etwas erschreckend Hilfloses in seiner unmenschlichen Handlung. Dieser vielleicht zwanzigjährige Mensch wollte widerwärtig und brutal sein, aber er scheiterte und spürte das auch. Er registrierte das Unbeholfene seiner Brutalität. Er war ganz einfach nicht der große, böse Bub, der er sein wollte, sondern eine komische Figur. Es blieb ihm verwehrt, diese Frau dadurch zu erniedrigen, indem er so tat, als handle es sich bei ihr um eine Kuh, die man melken konnte. Vielmehr ließ sein Auftritt ihn selbst als eine Art Dorftrottel erscheinen, als jemanden, der zu blöde war, zwischen Kuh und Frau zu unterscheiden. Und tatsächlich: So groß die Furcht der Frau auch sein mochte, und sie mußte enorm sein, so betrachtete sie jetzt das Gesicht ihres Peinigers mit unverhohlener Respektlosigkeit. In ihrem Blick klang etwas an, das wohl heißen sollte: Mein Gott, du armes Schwein, hast wohl noch nie was anderes berührt als die Euter deiner Viecher. Dann mußte sie grinsen. Sie konnte nicht anders.
Reisiger sah dieses unwillkürliche Grinsen. Intuitiv spürte er, daß es zu einer noch deutlicheren Eskalation führen würde, führen mußte. Hier waren Messer im Spiel, hier waren ein paar durchgeknallte Jungs im Spiel, die weiß Gott was für Zeug geschluckt hatten. Oder auch bloß über die Niederlage ihrer Mannschaft nicht hinwegkamen. Das Unglück der Welt war im Spiel. Und das alles vor dem Hintergrund einer miserablen Kunst am Bau, bestehend aus ein paar hohen Säulen.
Jedenfalls spürte Reisiger die nahende Katastrophe. Wobei ihm unklar blieb, inwieweit nun sein Kugelschreiber von Bedeutung sein könnte. Höchstwahrscheinlich war auch nichts zu retten mittels eines noch so wunderbaren Schreibgerätes. Die Katastrophe, auf die Reisiger seit seiner Jugend wartete und in der sein Kugelschreiber eine Rolle spielen würde, war wohl eine andere. Dennoch entschloß er sich, hier und jetzt zu handeln. Nicht, daß er der Typ dafür war. Er war eigentlich der Typ, der sich aus solchen Dingen heraushielt und auf die Polizei zu warten pflegte. Ob die nun kam oder nicht. Doch die Verhältnisse hatten sich geändert. Keine halbe Stunde zuvor hatte er einen Lottoschein verbrannt, den Lottoschein. Er hatte ein Millionenvermögen in Brand gesetzt. Er hatte die soeben eroberte Zukunft fallenlassen. Er hatte seine Leidenschaft verraten. Also war es nur recht und billig, wenn er jetzt daranging, sich mit diesen vier oder … Reisiger zählte, ja, er zählte, wie viele Jungs es an der Zahl waren, als wollte er mit ihnen Ball spielen. Einer schien von einem anderen verdeckt. Reisiger trat einen Schritt zur Seite und konnte nun feststellen, daß es sich um insgesamt fünf handelte, drei davon so großgewachsen wie er selbst.
Wie kräftig sie wirklich gebaut waren, war der wuchtigen Jacken wegen schwer zu sagen. Mitunter erwies sich manch martialische Erscheinung bar seines ledernen Harnischs als aufgeblähte Kröte. Allerdings besaß der Kerl mit dem Tauchermesser die platte Nase eines Boxers. Auch Reisiger hatte vor Jahren mit dem Boxen begonnen, ohne wirkliche Leidenschaft und mit der typischen Schwerfälligkeit des Spätberufenen. Was ihn nicht gehindert hatte zu erlernen, wie man Fäuste kontrolliert und effektiv in fremden Körpern unterbrachte, freilich nicht in fünf Körpern gleichzeitig. Aber darum ging es Reisiger auch gar nicht. Er wollte nicht eigentlich die anderen verletzen, sondern selbst verletzt werden. Er wollte einerseits ein Unglück verhindern, gleichzeitig aber wollte er bestraft werden. Und das war nun mal der Moment, da sich eine Strafe auch wirklich anbot. Reisiger war entschlossen, sich auf diese fünf wilden Gestalten einzulassen, wie man sich auf eine kleine Hölle einläßt, in der kleine Teufel werkeln. Für eine große Hölle hatten die fünf natürlich nicht das Format. Eine große Hölle war es auch nicht, was Reisiger vorschwebte.
»Aus!« sagte Reisiger und ging ein paar Schritte vor, ohne Eile, so wie er ja auch nicht etwa geschrieen, sondern recht ruhig gesprochen hatte. Allerdings laut genug, um verstanden zu werden. Und tatsächlich schien ein jeder ihn gehört zu haben. Denn während noch kurz zuvor das Auftauchen der beiden beschürzten Engel nur einen einzigen der Hooligans zu einer kleinen Regung verlockt hatte, waren auf Reisigers gefaßten Kommandoton hin fünf Köpfe in seine Richtung geschwenkt.
»Zieh Leine, alter Mann«, sagte der mit der Nase und dem Messer, »bevor ich dir zwei neue Augen ins Gesicht schnitze.« Und, nach einer kleinen Pause, um das Gesagte wie einen Brühwürfel zur Wirkung kommen zu lassen: »Wer braucht schon vier Augen?«
Niemand braucht vier Augen, das ist richtig. Aber daß der Plattnasige »alter Mann« gesagt hatte und nicht etwa »Opa« oder »olle Schwuchtel«, deutete eine gewisse Unsicherheit an. Eine Unsicherheit, die er wohl selbst nicht wahrhaben wollte. Vergebens. Er wirkte bei weitem nicht mehr so gelassen-melancholisch wie gerade eben. Und machte nun auch noch den Fehler, sein aus der Tasche gezogenes Messer dem alten Mann entgegenzuhalten.
»Ich weiß, wie ein Messer aussieht«, sagte Reisiger und fühlte sich auf eine unwirkliche Weise vergnügt.
»Also doch vier Augen«, bestand der Messermann auf seiner Strategie.
»Ich sehe mit den zweien, die ich besitze, ausgezeichnet«, erklärte Reisiger und nahm endlich seine Hände aus den Manteltaschen. »Und was ich sehe, sind ein paar jämmerliche Gestalten in viel zu großen Lederjacken. Wer verkauft euch solches Zeug? Wer redet euch ein, daß ihr damit wie richtige Menschen ausseht? Oder wollt ihr gar nicht wie Menschen aussehen? Macht euch das glücklich, für eine Kreuzung aus Kugelfisch und Schimpanse gehalten zu werden? Mein Gott, ich versteh euch nicht. Was für eine Lust kann denn darin bestehen, häßlich zu sein?«
Natürlich stellte sich eine ganz andere Frage, ob das nämlich die richtige Art war, eine Eskalation zu vermeiden. Immerhin kam es augenblicklich zu einer Verschiebung der Interessen. Die fünf Kerle wandten sich abrupt von den Frauen ab. Die Hand des Dorftrottels fiel wie alter Putz von der Brust der Attackierten. Auch aus dieser Hand wuchs kurz darauf die Klinge eines Messers, kleiner, schmaler, aber nicht minder geeignet, ein drittes und viertes Auge zu fabrizieren. Mag sein, daß Reisiger einen Moment zweifelte, ob denn diese Hölle wirklich so klein war, wie er gedacht hatte. Aber er stand eisern zu der einmal getroffenen Entscheidung. Auch war sein Blut fortgesetzt kühl. Kühl, wie er sich das nie hätte vorstellen können. Er sagte: »Messer machen einen auch nicht schöner.«
Der Dorftrottel vollzog einen Ausfallschritt, sprang dann auf Reisiger zu und richtete in der Folge das Messer auf dessen Kehle, derart, daß die Spitze nur wenige Zentimeter vor dem deutlich hervorstehenden Adamsapfel des Zweiundfünzigjährigen zu stehen kam.
»Was soll ich jetzt tun?« fragte Reisiger trocken und blickte am Messer vorbei in das Gesicht des anderen wie in einen kleinen, leeren Sack. »Lachen? Weinen? Einen Fotografen rufen, damit er uns beide ablichten kann, wie wir da stehen und nicht wissen, wie’s weitergeht. Etwas muß ja wohl geschehen. Ich an deiner Stelle … also ich würde zustechen. Aber nicht bis übermorgen warten.«
Reisiger schlug dem jungen Mann das Messer aus der Hand. Er tat dies rasch und unvermutet, beinahe leger. Als übe er das bereits ein halbes Leben. Die Wirklichkeit freilich war dahingehend eine andere, daß bei aller theatralischer Lockerheit, die Reisiger betrieb, auch ein gewisses Ungeschick zum Zuge kam, indem er mit dem Daumenballen seiner linken Hand an die Schneide des Messers geriet und sich einen tiefen Schnitt zuzog. Er spürte deutlich, wie die Haut und das Fleisch sich öffneten. Als klappe ein Maul auf. Man könnte natürlich auch sagen: als werde ein drittes oder viertes Auge aufgeschlagen. Entgeistert betrachtete Reisiger die Wunde, aus der das Blut wie eine Reihe kleiner Zierfische schwappte. Sogleich aber fing er sich, schob das Ärmelende seines Mantels über die Wunde und sagte: »Das hätte in jeder besseren Küche auch passieren können.«
Was immer er damit meinte, es tat ihm gut, etwas Derartiges gesagt zu haben. Vielleicht, weil er begriffen hatte, daß es in der Auseinandersetzung mit diesen fünf herzkranken Jungs wichtig war, etwas von sich zu geben, was die andere Seite verwirrte. Diese Träger wulstiger Lederjacken also mit Wörtern und Sätzen einzudecken, die ihnen zu schaffen machten, nicht weniger als ein Faustschlag. Eher mehr.
Obgleich Leo Reisiger eigentlich vorgehabt hatte, sich verletzen zu lassen – und tatsächlich verfügte er über eine erste Verletzung, wenn auch aus eigener Schuld –, so widerstrebte es ihm trotzdem, ein Opferlamm abzugeben. Nicht anstelle von zwei Frauen in Anoraks, die ihm persönlich unbekannt waren. Er wollte sich wehren. Er wollte aus dieser Sache etwas machen. Etwas Besonderes.
Zunächst einmal aber unternahm er das Naheliegende, indem er mit seiner rechten, der unverletzten Hand, dem Dorftrottel einen Stoß gegen die Brust versetzte. Einen leichten bloß. Genaugenommen legte Reisiger seine Hand auf den Brustkorb des nun Messerlosen und trommelte mit den Fingern ein wenig dagegen. Man konnte diese Handlung auch als eine spöttische Paraphrase auf jene vormalige Berührung eines Frauenbusens verstehen. Es war jetzt also der Dorftrottel, welcher gemelkt wurde. Jedenfalls schreckte diese Vorgangsweise den jungen Mann derart, daß er hektisch zurückwich, über die eigenen Beine stolperte und hart mit dem Rücken auf dem Boden aufprallte. Gleichzeitig trat Reisiger zur Seite, beugte sich zu dem verwaisten Messer und hob es auf. Und zwar an zwei Fingern, wie Kriminalisten das zu tun pflegen oder wie man mitunter einen verdreckten Gegenstand berührt. Reisiger hielt die Klinge in Augenhöhe und meinte: »Ich glaube nicht, daß man mit so einem Messer zwei Augen schnitzen kann, vielleicht einen kleinen Mund, einen Mund ohne Zunge und ohne Zähne, aber keine schönen Augen.«
»Von schön war nie die Rede«, sagte die Plattnase, als handle es sich um einen ernsthaften Diskurs.
»Ach nicht?« sagte Reisiger mit gespieltem Erstaunen. »Na dann.«
Er packte jetzt das Messer voll am Griff, streckte seinen Arm aus, stellte die Klinge schräg und zeichnete mit der Messerspitze zwei kleine imaginäre Formen in die Luft, dabei sprach er über die Augenform der Japaner, die soviel edler anmute als die der europäischen Rasse. Nicht, daß den europäischen Augen der Eindruck von Tiefe fehle. Nein, sie würden aus viel zuviel Tiefe bestehen. Bodenloser Tiefe, was dann wiederum gemein und einfältig anmute. Das japanische Auge hingegen vermittle eine Tiefe, die immer auch die Existenz eines Grundes andeute.
Während er da herumphilosophierte, stichelte Reisiger wild in der Luft herum. Es war eindeutig, daß er mit dieser ungestümen Messersprache europäische Augen meinte.
Bei alldem betrachteten ihn die vier Jungs, die noch standen, sowie der eine, der auf dem Boden lag, mit deutlichem Unbehagen. Sie dachten wohl, es mit einem Wahnsinnigen zu tun zu haben. Und zwar mit einem wirklichen. Denn die Wahnsinnigen, an die sie üblicherweise gerieten, waren ihnen ja verwandt, Halbstarke wie sie selbst, Leute mit Baseballschlägern, die diese oder jene Religion vertraten, mit Gaspistolen und Schreckschußpistolen und Leuchtpistolen und genagelten Schuhen und Bleikugeln in den ledernen Laschen ihrer Schleudern. Bleikugeln, mit denen man nicht nur die Spatzen von den Dächern holte. Wie gesagt, es waren Herzkranke, die viel häufiger, als das allgemein bekannt ist, in die Kirche gingen, um Kerzen anzuzünden. Auch für die Spatzen, auch für die Typen, denen sie die Zähne ausschlugen. Hooligans waren in Wirklichkeit Fromme, unter ihnen auch ein paar Heilige, die in einem symbolischen wie tatsächlichen Sinn das Böse in der Welt auf sich nahmen. Zumindest Teile dieses Bösen, auf daß nicht noch mehr an Schrecklichem zu geschehen brauchte. Aber genau darum, weil alles, was sie taten, eine kompensative Kraft besaß, lebten sie stark in Ritualen. Sie zogen durch die Länder wie kleine Armeen, gescholten und verdammt, Aussätzige, die für jedermann das Bild des Asozialen verkörperten. Und die auch noch gezwungen waren, anstatt gegen einen wirklichen Gegner zu bestehen, sich vornehmlich untereinander zu bekriegen. Anders hätte eine Kompensation des Bösen gar nicht funktioniert. Während hingegen die Kämpfe, die man mit der Polizei und Ordnungskräften ausfocht, bloß eine Überwindung belebter Barrikaden darstellte, nicht viel anders, als hätte man eine landschaftliche Hürde nehmen müssen, einen Fluß oder den Paß eines unwirtlichen Gebirges.
Freilich mißachteten auch Hooligans hin und wieder die eigenen Regeln und Gepflogenheiten, verließen die Welt ihrer Bräuche und Konventionen. Dazu gehörte mit Sicherheit, sich an einem eiskalten Wintermorgen in die Fußgängerzone eines namhaften Nobelortes zu begeben, um zwei Frauen zu belästigen und diese in jeder Hinsicht zu verletzen. Ohne daß irgendein echtes Ritual zur Anwendung gekommen wäre. Außer jenem echter Betrunkenheit. Damit war absolut nichts zu kompensieren, kein Gott und kein Teufel milde zu stimmen. Ganz im Gegenteil. Mag sein, daß diese fünf Jungs genau das intuitiv begriffen hatten, weshalb ihnen das Auftauchen Reisigers wie eine Strafe erscheinen mußte (was dann eine Verdoppelung des Gedankens an Strafe bedeutet hätte). Jedenfalls scheuten sie sich, mit der ihnen gewohnten Brutalität vorzugehen. Ihnen fehlte im Augenblick jener kollektive Habitus, der nötig war, um zu fünft oder auch nur zu viert einen einzelnen Mann zu überwältigen und in der gewohnten Manier niederzuschlagen, auf ihn einzutreten, bis er sich nicht mehr rühren konnte. Statt dessen war ein jeder mit sich selbst beschäftigt, auch mit dem Gedanken an Verteidigung. Sodaß also Reisiger in aller Ruhe mehrere europidisch schlundige Augenpaare in die Luft zeichnen konnte. Als das geschehen war, drängte er: »Es wird Zeit, Leute. Auch hier gibt’s eine Polizei, die irgendwann aufwacht.«
»Ja«, sagte die Plattnase und gab den anderen ein Zeichen. Und zwar eines, das bedeuten sollte, endlich daranzugehen, sich den alten Mann gemeinsam vorzuknöpfen und die Sache zu irgendeinem Ende zu bringen.
Es war aber erneut Reisiger, der die Akzente setzte, indem er mit dem Fuß ausholte, wie bei einem hoch zu spielenden Ball, nur, daß er eben keinen Ball spielte, sondern dem auf dem Boden Liegenden, der sich jetzt halb aufgerichtet hatte, einen Tritt in die Rippen versetzte. Der Körper des Jungen ging in die Höhe, zappelte in der Luft, bog sich und schlug noch heftiger als zuvor auf dem Mosaik des Trottoirs auf.
Was Reisiger getan hatte, bedeutete eine neuerliche Verhöhnung: nämlich dadurch, daß er in Hooligan-Manier vorgegangen war. Er, der »alte Mann«, spielte hier den Brutalo, spielte den Lässigen, den Virtuosen. Weshalb sich nun wenigstens der Plattnasige aus seiner Lethargie befreite und auf Reisiger losstürzte. Dabei brüllte er: »Zwei neue Augen, der Herr?!«
»Ich bitte darum«, sagte Reisiger und vollzog eine Körpertäuschung. Oder hielt es eben für eine solche, indem er dem Plattnasigen auswich und mit dem Messer eine halbkreisförmige Spur durch die Luft zog, wie um in einem Aufwasch die Bäuche der drei anderen, noch immer bewegungslosen Männer aufzuschlitzen. Was er natürlich nicht wirklich vorhatte, und dies auch gar nicht funktioniert hätte. Zu weit standen sie weg, zu dick war das Leder ihrer Jacken, um mühelos die dahinterliegenden Bäuche zu durchdringen. Aber Reisiger gab nun mal vor, sich den dreien widmen zu wollen, wechselte aber mit einem Mal die Richtung, ging ein wenig in die Knie, vollzog – nur noch auf den hinteren Kanten seiner Schuhsohlen stehend – eine Kehre und versuchte solcherart, in den Rücken des Plattnasigen zu gelangen.
Während es Leo Reisiger immer wieder schaffte, absichtslos im Rücken irgendwelcher Fernsehgeräte zum Stehen zu kommen, blieb ihm ein solches Gelingen im Falle des Plattnasigen verwehrt. Vielmehr prallte er in die Seite seines Gegners, derart heftig, das ihm nun seinerseits das Messer aus der Hand sprang, erneut in einem hohen Bogen dahinflog und in einer haustierartigen Anhänglichkeit knapp neben dem Kopf seines eigentlichen Besitzers aufschlug.
Reisiger, mit einem Mal messerlos, auch ein wenig kopflos, stand jetzt Schulter an Schulter mit dem Plattnasigen, hätte entweder seinen rechten Ellbogen in die Niere des anderen drücken oder mit einem weit auszuholenden Haken seiner verletzten Linken versuchen können, einen Schlag in der oberen Körperhälfte des Gegners unterzubringen. Zwischen diesen Möglichkeiten stehend, zögerte Reisiger, auch überfordert von seiner eigenen Kühnheit und der extremen Gymnastik. Ja, eine plötzliche Müdigkeit, in der Art wie sie einen Grippekranken ereilt, überkam Reisiger. Er tat also gar nichts, stand da, beinahe lehnte er sich gegen die Schulter des anderen.
Dieser zeigte sich um einiges entschlußfreudiger, legte seinen freien Arm um Reisiger, zog ihn wie den allerbesten Freund an sich und beförderte ihn mittels eines Hüftwurfs zu Boden. Der Wurf war weder sauber noch elegant gewesen, hatte etwas Lasches besessen. Zwei Welpen, die sich balgen. Was nichts daran änderte, daß Reisiger einen unrunden Bogen durch die Luft beschrieb, ungebremst mit der Schulter aufschlug, viel Luft und die Hälfte eines Schreis ausstieß, zur Seite fiel und auf dem Rücken zum Liegen kam, wo ihm dann der Rest des Schreis entfuhr.
Es war nun aber die Kälte des Bodens, die ihm in höchster Weise unangenehm war, weniger der Umstand, in eine aussichtslose Position geraten zu sein. Darum war er ja hier, um jetzt endlich seine Strafe zu empfangen. Welche nun zunächst einmal darin bestand, daß der Plattnasige sich mit seinem Hintern auf Reisigers Brustkorb niederließ und mit seinen beiden Knien – ohne daß dies eigentlich noch nötig gewesen wäre – die Arme des Unterlegenen fixierte. Mit seiner freien Hand packte er Reisigers Unterkiefer und drückte ihn nach oben, sodaß es Reisiger also unmöglich wurde, seinen Mund zu öffnen. Offensichtlich war dem Plattnasigen sehr daran gelegen, seinem Kontrahenten die Möglichkeit zu nehmen, weiterhin mit Worten und komischen Theorien um sich zu werfen und die gemeinschaftliche Ordnung der Hooligans ins Wanken zu bringen. Tatsächlich wirkten die anderen Jungs geradezu erleichtert ob der Anbringung einer Mundsperre und traten ein paar Schritte heran, als seien sie die ersten Menschen, zumindest die ersten Europäer, die nun ein exotisches und gefährliches, aber endlich erlegtes Tier betrachten durften. Auch der Dorftrottel erhob sich, um näher zu kommen. Sein Messer aber vergaß er.