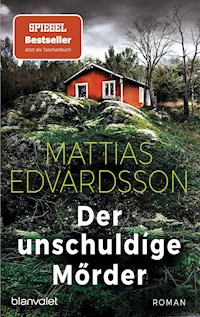
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Krimi-Hit aus Schweden: Ein Mord ohne Leiche und ein fataler Schuldspruch – doch die wahre Geschichte wartet noch darauf, erzählt zu werden …
Lund, Schweden: Vier Literaturstudenten treffen auf den gefeierten Autor Leo Stark. Schnell geraten sie in den Bann des manipulativen Schriftstellers, der sie gleichermaßen fasziniert wie abstößt. Doch eines Nachts verschwindet Stark spurlos. Und obwohl keine Leiche gefunden wird, spricht man den Studenten Adrian des Mordes schuldig.
Jahre später beschließt dessen Freund Zack, ein Buch zu schreiben. Das Verbrechen von damals, für das Adrian acht Jahre ins Gefängnis musste, hat den Journalisten nie richtig losgelassen. Von Adrians Unschuld überzeugt, ist Zack fest entschlossen, die Wahrheit aufzudecken. Doch bei seinen Recherchen stößt er auf den Widerstand seiner ehemaligen Studienfreunde. Alle scheinen sie etwas vor Zack zu verbergen. Und dann taucht plötzlich Leo Starks Leiche auf …
Sie lieben meisterhaft erzählte skandinavische Spannung? Dann lesen Sie auch die anderen Romane von Mattias Edvardsson.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Lund, Schweden: Vier Literaturstudenten treffen auf den gefeierten Autor Leo Stark. Schnell geraten sie in den Bann des manipulativen Schriftstellers, der sie gleichermaßen fasziniert wie abstößt. Doch eines Nachts verschwindet Stark spurlos. Und obwohl keine Leiche gefunden wird, spricht man den Studenten Adrian des Mordes schuldig.
Jahre später beschließt Journalist Zack, ein Buch zu schreiben. Das Verbrechen von damals, für das sein Freund Adrian acht Jahre ins Gefängnis musste, hat ihn nie richtig losgelassen. Von dessen Unschuld überzeugt, ist er fest entschlossen, die Wahrheit aufzudecken. Doch bei seinen Recherchen stößt er auf den Widerstand seiner ehemaligen Studienfreunde. Alle scheinen sie etwas vor Zack zu verbergen. Und dann taucht plötzlich Leo Starks Leiche auf …
Autor
Mattias Edvardsson lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Töchtern außerhalb von Lund in Skåne, Schweden. Wenn er keine Bücher schreibt, arbeitet er als Gymnasiallehrer und unterrichtet Schwedisch und Psychologie.
Von Mattias Edvardsson bereits erschienen
Die Lüge
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
MATTIASEDVARDSSON
ROMAN
Deutsch von Annika Krummacher
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »En nästan sann historia« bei Bokförlaget Forum, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Mattias Edvardsson
Published in the German language by arrangement with Bonnier Rights, Stockholm, Schweden.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
Covergestaltung: www.bürosüd.de Covermotiv: mauritius images/MARKA/Alamy; www.bürosüd.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-21521-7V002
www.limes-verlag.de
Von allem Geschriebenen liebe ich nur Das, was Einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut: und du wirst erfahren, dass Blut Geist ist.
Friedrich Nietzsche
Ohne jeden Zweifel vermittelt die Fiktion das treffendere Bild der Wahrheit.
Doris Lessing
Für Kajsa
Der unschuldige Mörder
von Zackarias Levin
Vorwort
Die Wahrheit muss ans Licht.
Einer der größten Schriftsteller Schwedens ist verschwunden, und ein unschuldiger Mann wurde als sein Mörder verurteilt. Nach zwölf Jahren beginnen die Leute zu vergessen, aber es gibt andere, die nie vergessen werden.
Adrian Mollberg vergisst nie. Und auch ich werde nie vergessen.
Einst war Adrian mein bester Freund. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Leben und dieselben Träume. Bevor er wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er nicht begangen hatte und bei dem die Leiche fehlte. Es war, bevor Adrian Mollberg als Mörder abgestempelt wurde.
Nach zwölf Jahren werde ich ihn wieder aufsuchen. Diesmal werde ich die Wahrheit herausfinden und alles aufklären.
Aber wo fängt man eigentlich an?
Alle, die es zu irgendetwas bringen, haben den Mut aufgebracht, den ersten Schritt zu tun. Es braucht Mut, um mit dem Erzählen anzufangen, und nicht selten ist es am einfachsten, man beginnt dort, wo man gerade im Leben steht. Das habe ich in jenem schicksalsträchtigen Herbst 1996 gelernt, als ich gegen die Einwände meiner Mutter ein Studium in Literarischem Schreiben an der Universität Lund begann.
Da setze ich ein.
August 2008
Es war ein beschissener Sommer.
In derselben Woche, in der Caisa mich verließ, wurde ich zu einem Meeting gerufen, in dem der Chefredakteur mir eröffnete, dass einem Drittel der Angestellten gekündigt werden würde. Das allgemeine Zeitungssterben hatte die Hauptstadt erreicht. Die Leute wollten kein Geld mehr für Nachrichten ausgeben, die schon einen Tag alt waren. Das Internet quoll über von Klatsch und Tratsch und kontroversen Ansichten von rechts und links. Ich war überflüssig geworden.
Das Ganze kam nicht völlig unerwartet, traf mich aber dennoch ins Mark. Caisa sagte, sie habe sich innerlich von mir entfernt und brauche etwas Stabileres, etwas Dauerhaftes mit Zukunftspotenzial. Schon vor Mittsommer war sie ausgezogen, und die Kündigungsfrist in der Zeitung betrug zwei Wochen.
Ich verschlief die Vormittage und versoff die Abende. Nachts trieb ich mich in Straßencafés und Nachtclubs herum, schlief auf der Rückbank eines Taxis oder bei einer reichlich angetrunkenen Frau ein. Wenn ich am nächsten Morgen erwachte, fühlte ich mich einsam und antriebslos und versuchte, die Panik im Zaum zu halten.
Als meine Mutter anrief, schwindelte ich hemmungslos. »Geht alles seinen Gang. Läuft wie immer. Nichts Neues. Keine Probleme.« Dann aß ich Eis zum Frühstück, direkt aus der Zweiliterpackung, saß nackt auf dem Sofa mit den dreckigen Füßen auf dem Tisch, während ich mich durch die Onlineversion der Zeitung klickte, die bis vor Kurzem mein zweites Zuhause und meine Herzensangelegenheit gewesen war. Jetzt füllte ich die Kommentarfelder mit höhnischen Andeutungen und expliziten Beleidigungen. Im Suff sandte ich Caisa die letzten erbärmlichen Liebesbezeugungen, bevor sie mich auf allen Kanälen blockierte. Ich schickte meinen Lebenslauf an einige Redaktionen, bei denen ich mir vorstellen konnte zu arbeiten, und an andere, bei denen ich nicht im Traum daran dachte, auch nur einen Fuß hineinzusetzen. Eines Nachmittags radelte ich nach Långholmen und fläzte mich auf eine Sonnenliege – zusammen mit zwei Kollegen, die mein Schicksal teilten.
»Wie geht es dir?«, fragten sie. »Was hast du vor? Was Neues in Sicht?«
Und ich behauptete, ich wolle es eine Weile etwas ruhiger angehen lassen, vielleicht umsatteln, mich selbstständig machen oder mich auf die literarischen Träume meiner Jugendzeit besinnen.
»Du hast gut reden«, sagten sie. »Du hast ja auch keine Familie und kein Haus, das du abbezahlen musst.«
Die beiden trieben sich in den großen Medienhäusern herum, priesen sich an wie im Schlussverkauf und waren bereit, den Begriff Journalismus so weit zu fassen, dass sogar ein Klatschreporter die Nase gerümpft hätte.
Erst im August erwachte ich aus meinem Sommerschlaf und begriff, dass ich irgendetwas tun musste. Ich war mit der Miete im Rückstand, der Anrufbeantworter war voll mit empörten Nachrichten meines kleinlichen Vermieters, in meiner Stammpizzeria konnte ich nicht mehr anschreiben lassen, und die Rastlosigkeit brauste wie ein immer stärker werdender Sturm in meiner Brust.
Einige E-Mails und Gespräche später war mir klar, dass die Jobsituation in der Stockholmer Medienlandschaft mehr als prekär war.
»Was haben Sie bisher gemacht?« (Der Redakteur irgendeines Blattes)
»Kolumnen, Glossen, Veranstaltungstipps.« (Ich)
»Wie war noch mal Ihr Name? Zackarias irgendwas?« (Wieder der Redakteur)
»Zackarias Levin. Aber die meisten nennen mich einfach nur Zack.« (Ich, schon ein bisschen resigniert)
»Einfach nur Zack?« (Der Redakteur, kurz vor Ende des Gesprächs)
Und als mein abscheulicher Vermieter schließlich so laut an die Tür haute, dass der Chihuahua des Nachbarn im Falsett bellte, hatte ich genug und rief meine Mutter an.
»Endlich!«, rief sie, als ich anfragte, ob ich eine Weile bei ihr wohnen dürfe.
»Immer mit der Ruhe. Das ist wirklich nur eine Übergangslösung.«
Ich setzte mich in die Küche und googelte ein bisschen, bevor ich in den verschiedenen Redaktionen Südschwedens herumtelefonierte. Nicht eine Sekunde kam mir in den Sinn, dass ein einziges Provinzblatt mit nur ein wenig Selbstachtung einen relativ bekannten (na ja) Journalisten aus Stockholm ablehnen würde, der schon für die ganz großen Zeitungen geschrieben hatte.
Ich hatte mich geirrt.
»Wir kriechen schon auf dem Zahnfleisch und müssen etlichen Kollegen kündigen.«
»Die Internetzeitungen ziehen unsere Printleser ab.«
»Die Leute heutzutage wollen eigentlich nur Mist lesen.«
Ich sah erst ein Licht am Ende des Tunnels, als ich den Feuilletonchef und zugleich den einzigen Kulturredakteur der Provinzzeitung erwischte, die jeden zweiten Tag erschien und bei der ich vor langer Zeit meine Karriere begonnen hatte.
»Aha, und du willst also wieder nach Hause ziehen?«
Er bemühte sich nicht einmal, die Schadenfreude in seiner Stimme zu verbergen.
»Nur vorübergehend«, erklärte ich.
»Kannst du eine Glosse pro Woche liefern? Du weißt schon, solche albernen Betrachtungen, die die Leute so richtig provozieren. Fünfhundert plus Sozialabgaben ist das Standardhonorar. Mehr kann ich dir nicht bieten, auch wenn du es bist, Zack.«
Fünfhundert. Ich würde auf Kosten meiner Mutter leben müssen, bis ich irgendwann in Rente ging.
Trotzdem ließ ich die Sache noch offen. Ich versprach, mich zu melden, und behauptete, ich wolle erst ein paar andere Möglichkeiten durchspielen. Ich konnte den Feuilletonchef vor mir sehen: ein Lächeln so breit und schadenfroh, dass der Speichel vom Kautabak nur so herunterlief. Hab ich’s nicht immer schon gesagt und so weiter.
»Womit willst du eigentlich dein Geld verdienen?«, fragte meine Mutter, als ich sie für ein Flugticket nach Südschweden anpumpte.
»Das steht noch nicht richtig fest.«
»Willst du nicht ein Buch schreiben? Du hast doch immer davon gesprochen, dass du ein Buch schreiben willst.«
Sie zahlte mein Flugticket. Ich wollte schon am nächsten Tag fahren und dachte erst über ihre Worte nach, als ich am letzten Abend in Stockholm im Bett lag und mich in der klebrigen Sommerhitze zwischen den Laken herumwälzte. Meine Mutter hatte natürlich recht. Ich würde ein Buch schreiben.
Es ist schon seltsam. Manche Dinge werden von einem Augenblick auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt, während andere für immer und ewig bestehen, vollkommen unangetastet vom Zahn der Zeit. Ich fuhr zu meiner Mutter und betrat das Museum meiner Kindheit: dieselben bestickten Wandbehänge, die Kupfergefäße an der Küchenwand und die alten, vergilbten Plakate. Es roch noch immer nach Früchtekuchen und braunem Zucker. Sie saß in Großvaters mottenzerfressenem Schaukelstuhl und war lange vor der Zeit gealtert, wusste noch immer nicht, wie man sich in den Arm nahm, hatte aber schon die Kaffeebohnen in die Mühle gefüllt, die wie ein Sägewerk auf der Küchenbank vor sich hin ratterte.
»Jetzt erzähl mal. Was hast du angestellt?«
Sie saß mit verschränkten Armen da und schaute mich wütend an. Ich fühlte mich wieder wie damals mit zwölf.
»Ich habe nichts angestellt!«
»Irgendwas musst du doch angestellt haben, damit sie dir kündigen? Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich gesagt habe, dass du aufhören sollst, solche Dummheiten zu schreiben. Normale Leute ärgern sich über so was. Man sollte sich nicht für was Besseres halten, nur weil man in die Hauptstadt gezogen ist und beim Aftonbladet arbeitet.«
»Ich habe doch noch nie beim Aftonbladet gearbeitet.«
»Sei nicht so haarspalterisch.«
Sie starrte die Kaffeemaschine an, bis sie mit einem demütigen Piepsen kapitulierte.
»Und was ist dann passiert?«
»Hör mal, Mama, ein Drittel der Belegschaft hat eine Kündigung gekriegt. Diejenigen, die du die normalen Leute nennst, die lesen nicht mehr Zeitung. Sie gehören dieser verdammten Geiz-ist-geil-Generation an und wollen für Qualität nichts zahlen.«
»Qualität?«, wiederholte sie und flüsterte dann ihr ewiges Gott bewahre und Himmelherrgott vor sich hin.
Wir hatten noch immer unsere alten Sitzplätze am Tisch. Der Kaffee musste mit reichlich Milch verdünnt werden, doch er schuf eine befreiende Oase von Schweigen und Nachdenken.
»Und Caisa?«, fragte meine Mutter schließlich.
»Das hat nicht mehr gehalten. Wir haben uns voneinander entfernt.«
Ich hatte versucht, nicht an Caisa zu denken. Jetzt öffnete sich der Schmerz erneut wie eine schwärende Wunde.
»Voneinander entfernt? Manchmal muss man kämpfen, Zackarias. Eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen.«
»Du mochtest Caisa doch gar nicht?«
Sie tat so, als hätte sie es nicht gehört.
»Du bist jetzt über dreißig. Als ich in deinem Alter war …«
»Mama!«
Nun begab sie sich doch aus der Deckung. Ihr Blick triefte vor bitterer Enttäuschung.
»Irgendwann will man doch auch mal Oma werden. Hier sind alle Oma oder haben zumindest eine Schwiegertochter mit Kindern aus erster Ehe. Ich bin als Einzige übrig geblieben, und das ist wirklich nicht schön.«
Jetzt erkannte ich sie wieder. Same old, same old. Eine halbe Stunde in Skåne, und schon hatte ich die Nase wieder gestrichen voll. Ich begann, über das Bücherschreiben nachzudenken, sortierte in meinem Kopf die Ideen, die sich während des Flugs formiert hatten. Ein Buch zu schreiben konnte doch nicht so schwer sein. Wenn ich mich ranhielt, sollte es bis zum Frühjahr fertig sein. Das Schreiben selbst würde etwa einen Monat dauern, einen weiteren veranschlagte ich fürs Redigieren, dann kamen Druck, Produktion und Marketing. Das Frühjahrsprogramm war ein realistisches Ziel, die Taschenbuchausgabe würde kurz vor dem Weihnachtsgeschäft erscheinen.
»Hast du Tomaten auf den Ohren?«, fragte meine Mutter, und ich zuckte zusammen. »Du hörst ja gar nicht zu. Hast du Drogen genommen, oder wie? Du bist völlig abwesend und hast ganz rote Augen.«
»Jetzt hör schon auf. Was hast du eben gesagt?«
Sie verzog das Gesicht zu einer mürrischen Grimasse.
»Ich habe von Mädchen gesprochen. Dass es vielleicht eine gibt, mit der du dich mal treffen könntest.«
»Wie jetzt? Hier in Veberöd?«
»Genau. Die Niedliche mit den Sommersprossen, die in deiner Klasse war. Sie ist inzwischen geschieden und hat zwei Kinder, aber den Mann sieht man nie. Wie hieß sie noch mal?«
»Malin Åhlén? Sprichst du von Malin Åhlén?«
Sie sprach schon seit 1985 von Malin Åhlén.
»Richtig, Malin.«
»Mama, das mit Malin Åhlén war in der achten. Außerdem weiß ich nicht, ob ich im Moment überhaupt so ein Techtelmechtel brauche.«
Sie schenkte mir nach, bis der Kaffee überschwappte.
»Nein, ich glaube auch nicht, dass du ein Techtelmechtel brauchst. Was du brauchst, ist eine Frau.«
Ich konnte nicht mehr. Während meine Mutter weiterredete, holte ich mein Handy heraus.
»Hast du es mal mit Internetdating probiert?«, fuhr sie fort. »Evelyns Junge hat auf diesem Weg eine neue Freundin gefunden. Sie sieht nett aus und wirkt ganz normal. Und einen Haufen Geld scheint sie auch zu haben.«
»Hör auf, Mama. Ich muss mich eine Weile auf mich selbst konzentrieren.«
»Dich auf dich selbst konzentrieren? Macht man so was in Stockholm? Du bist bald zweiunddreißig.«
»Ich weiß, wie alt ich bin. Aber es ist nicht so wie in deiner Jugend.«
»Nicht so wie in meiner Jugend?«
»Es ist anders heutzutage.«
»Vielen Dank auch«, sagte sie und pustete in ihre Tasse, ehe sie einen Schluck Kaffee trank. »Das habe ich schon gemerkt.«
Noch am selben Abend schloss ich mich in meinem alten Jugendzimmer ein und skizzierte die besten Buchideen. Meine Mutter hatte mein Zimmer in einen Abstellraum verwandelt und die Regale mit dem gesamten Sortiment des Verlags Bra Böcker aus den Achtzigerjahren bestückt. Doch an der einen Dachschräge hing noch mein altes Bon-Jovi-Plakat wie eine bewusste Normabweichung, die vermutlich gar nicht so weit von den ästhetischen Idealen eines perversen Einrichtungsbloggers entfernt war.
Im Bett hackte ich in Rekordzeit eine Kurzzusammenfassung in den Laptop. Es konnte doch nicht so schwer sein, etwas Spannendes zusammenzuzimmern, wenn man sich wirklich bemühte.
Schlagartig wurde ich zurückgeschleudert in mein Studium des Literarischen Schreibens. Große Teile des Handwerkszeugs waren noch da. Es war wie beim Radfahren. Wenn ich nur die richtige Story fand, würde ich die Sache schon hinkriegen.
Doch die Erinnerungen an jenen Herbst in den Neunzigerjahren in Lund drängten sich weiter auf und nahmen schon bald mein ganzes Bewusstsein in Anspruch. Ich konnte nicht mehr an meine Romanfiguren denken. Ich dachte an Adrian und Fredrik. Ich dachte an Leo Stark, den berühmten Schriftsteller, der einfach verschwunden war. Ich dachte an unsere Dozentin Li Karpe, die postmoderne Dichterprinzessin. Vor allem aber dachte ich an Betty. Und das tat weh.
Ich legte eine Pause ein und surfte im Internet herum, weil ich wissen wollte, wie sie jetzt aussahen, zwölf Jahre später. Doch ich stieß weder auf Betty noch auf Adrian. Das Internet war zwar voll von Texten über den Schriftstellermord, von Spekulationen und Gerüchten und allgemeinen Meinungsäußerungen, aber nirgends gab es Informationen darüber, was Betty oder Adrian inzwischen machten, was aus ihnen geworden war. Erst als ich nach Fredrik Niemi suchte, sah ich mich plötzlich mit dieser Zeit in meinem Leben konfrontiert, die alles verändert hatte, vor der ich geflohen war und die ich über ein Jahrzehnt verdrängt hatte. Es fühlte sich so weit weg an, beinahe wie ein Traum.
Das Foto von Fredrik katapultierte mich zurück. Er hatte sich nicht sehr verändert. Vom Typ her eindeutig obere Mittelschicht, die Haare etwas dünner und die Brille etwas teurer, ansonsten war er derselbe geblieben. Eine seltsame Wiederentdeckung nach so vielen Jahren.
Ich wusste, dass er in der Buchbranche tätig war, und nachdem ich ein bisschen recherchiert hatte, fand ich heraus, dass er als Lektor in einem Kleinverlag in Lund arbeitete.
Das war beinahe zu gut. Zumindest war es zu gut, um diese Gelegenheit ungenutzt zu lassen.
Ich stand früh auf und rief ihn an. Fredrik Niemi schien überrumpelt, als ihm aufging, wer ich war.
»Zack Levin? Das ist ja schon ewig her!«
Dann hatte er es ziemlich eilig, im Hintergrund waren Stimmen zu hören, und er musste zu einer Sitzung. Ob ich ihm einfach eine Mail schicken könne? Aber ich blieb hartnäckig und journalistisch penetrant, bis wir eine Verabredung zum Mittagessen hatten. In der Markthalle – falls ich mich daran erinnerte.
»Natürlich«, sagte ich und merkte, wie alles zurückkehrte. Die alten Rollen, die Machtbalance, lauter Dinge, die nicht zu greifen waren und nichts mit Arbeitslosigkeit oder Heimkehrerblues oder anderen alltäglichen Niederlagen zu tun hatten.
Während meine Mutter das ganze Haus putzte, als stünde eine große Feier oder ein Maklerbesuch bevor, entwarf ich probehalber ein paar Romanideen. Ich kritzelte die Charakterzüge eines Antihelden hin, der ohne Weiteres eine ganze Romantrilogie würde füllen können, blätterte in einem Namenslexikon und suchte nach den perfekten Namen für meine künftigen Romanfiguren.
Etwas widerwillig lieh mir meine Mutter ihr Auto, und ich fuhr nach Lund, stellte den Wagen auf dem Mårtenstorget ab und spazierte langsam zwischen flatternden Tauben und Hackenporsches herum, während das scharfe Spätsommerlicht auf die hundertjährigen Gebäude fiel.
Fredrik Niemi saß schon im Restaurant der Markthalle. Sein Händedruck wirkte gestresst, und ich bemerkte sein nervöses Augenzucken, das ich so gut kannte.
»Ich habe ein paar von deinen Glossen gelesen«, sagte er.
Wir blätterten in der Speisekarte, und ich wartete auf eine Fortsetzung, eine Art Anerkennung, wenigstens aus Höflichkeit, aber Fredrik sagte nichts weiter.
»Lange nichts gehört«, stellte er fest und lächelte etwas zögerlich.
Dann fragte er, wie lange ich bleiben wolle, und ich schwindelte und behauptete, ich brauche einfach etwas Urlaub von Stockholm, dass alles hier etwas näher sei und etwas langsamer und das momentan genau das Richtige für mich sei.
»Es ist so interessant, wie die Leute einen hier anschauen. Als ob sie einen genau unter die Lupe nehmen, ja, analysieren wollten. In Stockholm wechselt man kaum einen Blick.«
Fredrik nickte gleichgültig.
»Es ist wegen einer Frau, oder?«
»Unter anderem.«
»Ich weiß noch, damals warst du wegen dieser ganzen Sache mit Betty völlig am Boden zerstört.«
»Dieser ganzen Sache mit Betty?«
Er lächelte etwas schief.
»Was heißt schon am Boden zerstört«, sagte ich. »Wir waren ja noch Teenies.«
»Stimmt auch wieder.«
Ich bestellte mir ein Entrecote, medium rare gebraten. Die Kellnerin lächelte falsch und spielte mit dem Kugelschreiber herum, während Fredrik weiter in der Speisekarte blätterte.
»Ist das Entrecote zart?«
»Klar, es ist völlig in Ordnung.«
Heimlich warf mir die Kellnerin einen einvernehmlichen Blick zu, kratzte sich am Schlüsselbein und gähnte.
»Für mich auch ein Entrecote, aber bitte well done«, sagte Fredrik, und sie kritzelte irgendetwas in ihren Block und ging davon.
»Der Magen«, sagte er und sah mich an, als würde es mich wirklich interessieren.
Fredrik Niemi hatte sich erschreckenderweise kaum verändert. Die Brille und der Seitenscheitel und diese trockene Haut, die in mir die Lust weckte, mit meiner Hand fest über seine rauen Wangen zu fahren. Vor mir sah ich denselben unsicheren jungen Mann, der vor zwölf Jahren eine Schreibmaschine zum Literarischen Schreiben mitgeschleppt hatte.
Nach jenem Herbst 1996 hatte er ein Jahr in Dublin Literaturgeschichte studiert und war auf Leopold Blooms Spuren gewandelt. Er klang nicht einmal ironisch, als er davon erzählte. Zurück in Schweden hatte er einen Job in einem Indieverlag in Göteborg gefunden und war auf einem Broder-Daniel-Konzert seiner großen Liebe Cattis begegnet. Dann hatte alles seinen Lauf genommen. Die Zeit verging, und er folgte ihr. Jetzt saß er in einem Einfamilienhaus in Bjärred mit einer Tochter, die demnächst in die Schule kam, und einem Jungen, der bald fünf wurde. Seit mittlerweile zwei Jahren hatte er in dem Verlag in Lund die Programmleitung Belletristik inne und übersetzte nebenbei französische Prosalyrik, die niemand las.
Ich erzählte nicht viel aus meinem eigenen Leben, und Fredrik stellte keine Fragen. Als die Kellnerin unsere Entrecotes brachte, kam ich zur Sache.
»Ich will ein Buch schreiben.«
Fredrik stocherte mit der Gabel im Fleisch herum und sagte: »Das ist genau das Richtige.«
»Wie meinst du das?«
Er hielt in der Bewegung inne und sah mich erschrocken an.
»Na ja, ich meine, es gibt doch keine bessere Therapie, als einen Roman zu schreiben, oder? Einen verbitterten Liebesroman mit einem raffinierten Racheplan.«
Er lächelte vorsichtig, aber ich schüttelte nur den Kopf.
»Ich bin nicht verbittert. Und ich brauche keine Therapie. Ich brauche Geld.«
Fredrik kaute mühsam und blickte aus dem Fenster. Meine Geradlinigkeit war ihm sichtlich unangenehm.
»Und an dieser Stelle kommst du ins Spiel«, fuhr ich fort und schnitt mir ein Stück blutiges Fleisch ab. »Du kennst dich auf dem Buchmarkt aus.«
»Na ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich wirklich auf dem Buchmarkt auskennt. Der führt nämlich ein Eigenleben.«
»Aber du hast Insiderwissen. Viel mehr als ein Normalleser.«
Er wand sich.
»Was genau hast du denn vor?«, fragte er dann.
Ich leckte mir die Sauce von den Lippen und nahm einen großen Schluck Staropramen.
»Ich will einen Bestseller schreiben, den neuen Da Vinci Code, die neue Millenniums-Trilogie. Der Buchmarkt ist jetzt reif für etwas Neues, was bisher gefehlt hat und wonach sich die Leute sehnen. Man muss nur im richtigen Moment die richtige Idee haben und sie als Erster herausbringen.«
Fredrik säbelte an seinem Entrecote herum.
»Ich fürchte, so simpel ist es nicht«, sagte er, ohne mich anzusehen. »Meine Arbeit wäre sehr viel einfacher, wenn man auf dem Buchmarkt alles vorhersehen könnte. Aber sie wäre auch ein bisschen langweiliger.«
»Gut, natürlich vereinfache ich die Sache ein bisschen. Aber du verstehst, was ich meine. Ich habe schon ein paar gute Ideen, die du dir anschauen könntest.«
»Ich weiß nicht so recht.«
Endlich hatte er ein Stück Fleisch abgeschnitten, das er nun langsam zwischen seinen Backenzähnen zermalmte.
»Mir kommt es so vor, als würdest du am falschen Ende anfangen«, murmelte er zwischen den Bissen. »Du solltest beim Schreiben von dir selbst ausgehen, also dort graben, wo du stehst, wie man so schön sagt. Was für ein Buch willst du schreiben? Was willst du erzählen?«
Ich lachte.
»Jetzt klingst du genau wie Li Karpe.«
Er hörte auf zu kauen und sah mich abwartend an. Binnen weniger Sekunden hing ihr Name wie ein Schwergewicht zwischen uns.
»Du bist Li Karpe geworden!«
»Von wegen!«, protestierte Fredrik und verzog den Mund zu einem Lachen. »Aber sie hatte schon was. Trotz allem.«
»So ein Projekt ist das nicht«, erklärte ich. »Ich will nicht so ein Buch schreiben.«
Er kratzte sich unter dem Arm.
»Was meinst du?«
Ich legte das Besteck auf den Teller und wischte mir das Kinn mit der Serviette ab.
»Es geht nicht um Qualität. Ich will keinen Literaturpreis gewinnen. Ich bin bereit, irgendwas zu schreiben – Hauptsache, das Buch landet ganz oben auf der Bestsellerliste und sorgt dafür, dass ich bei meiner Mutter ausziehen kann.«
Er starrte mich an, als hätte ich ein Sakrileg begangen.
»Es geht hier nicht um literarisches Schreiben«, fuhr ich fort. »Wir sind keine neunzehnjährigen Romantiker mehr.«
Fredrik lächelte nachsichtig.
»Es gibt vermutlich kein einfaches Erfolgsrezept, Zack. Außerdem beschäftige ich mich hauptsächlich mit Literatur, die sich in Auflagen von fünfhundert Exemplaren verkauft. Chinesische Poesie, rumänische Erzählkunst. Lauter prätentiöses Zeug.«
»Ach, komm schon! Gib mir einen einzigen konkreten Tipp. Ein Genre, ein Thema, was auch immer. Wonach schreit denn der Markt im Moment?«
Er seufzte, lehnte sich zurück und ließ den Blick zwischen seinem hoffnungslos durchgebratenen Fleischstück und mir hin- und herwandern.
»Schreib was Autobiografisches, was Sensationelles, was Aufsehen erregt. Es darf ruhig unverschämt und provokativ sein. Stell dich selbst und alle in deinem Umfeld bloß und schrecke nicht vor Spekulationen zurück. Übertreibe maßlos und ergänze das Ganze mit schmuddeligen Details.«
»Tatsächlich?«
»So was verkauft sich.«
Ich dachte an das, was ich im Internet über Betty und Adrian gelesen hatte, an die sensationslüsternen Spekulationen über den verschwundenen Starautor Leo Stark und den legendenumwobenen Mordprozess.
»Sprichst du von …? Denken wir an dasselbe?«
Fredrik sah erstaunt aus.
»Meinst du, ich soll über uns schreiben?«
»Nein, nein, gar nicht! So habe ich es überhaupt nicht …«
»Aber indirekt hast du genau das gesagt. Schreib über den Schriftstellermord!«
»Keineswegs«, sagte Fredrik scharf. »Es gibt keinen Grund, in dieser alten Geschichte herumzuwühlen.«
Ich sagte nichts, denn ich hatte nicht vor, mit ihm zu diskutieren. Ich hatte mich schon entschieden. Im selben Moment, in dem der Gedanke geboren wurde, hatte mein Entschluss festgestanden. Am liebsten wollte ich sofort loslegen.
»Hast du noch Kontakt zu Adrian?«, fragte Fredrik.
Ich schüttelte den Kopf.
»Du?«
»Nein, gar nicht.«
Ich sah Adrian im Gerichtssaal vor mir, die Schatten auf seinem Gesicht, den ausweichenden Blick. Sehr deutlich erinnerte ich mich an die Verlesung des Urteils. Die Tränen und die Schreie, das Gefühl von Unwirklichkeit.
»Er wohnt anscheinend noch hier in der Gegend«, sagte Fredrik. »Irgendwo in Richtung Bjärred, habe ich gehört.«
Ich konnte mich kaum noch auf Fredrik konzentrieren und dachte stattdessen über das Buchcover und den Titel nach, sah suggestive Bilder vom Hauptgebäude der Universität in Lund vor mir, mit dem großen Springbrunnen, in Schwarz und Grau gehalten, vielleicht mit ein wenig Rosa zur Aufmunterung. Der unschuldige Mörder.
»Ich denke nicht einmal mehr daran«, fuhr Fredrik fort. »Eine Weile hatte ich jede Nacht Alpträume, aber jetzt nicht mehr. Mir ist es gelungen, die Sache zu vergessen.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Keiner von uns wird es je vergessen. Das geht nicht.«
Vielsagend sah Fredrik auf seine Armbanduhr.
»Ich muss weiter«, sagte er und lächelte abschließend.
Der Titel zog sich wie ein Neonband durch meinen Kopf. Der unschuldige Mörder. Ich sah mich selbst auf der Buchmesse, neben dem Bestsellerautor Jan Guillou, mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, vor mir die langen Schlangen von Lesern, die sich mein Buch signieren lassen wollten. Anschließend saß ich in Talkshows und durfte auf irgendeiner Kulturseite die Bücher meiner Konkurrenten rezensieren. Sogar die Literatursendung Babel würde bei mir anrufen.
Fredrik räusperte sich und holte mich wieder in die Gegenwart zurück. Wir erhoben uns und schüttelten uns die Hand. Kein Wort von einem Wiedersehen. Fredrik hoffte vermutlich, dass ich die kindische Idee mit diesem Buch wie die meisten so schnell wie möglich fallen ließ. Wie oft hatte man nicht schon Leute sagen hören, sie wollten ein Buch schreiben?
Doch er unterschätzte mich.
Der unschuldige Mörder
von Zackarias Levin
1. Kapitel
September 1996
Als ich Adrian Mollberg zum ersten Mal sah, saß ich auf einer Bank vor der Unibibliothek, deren begrünte Mauern gerade die ersten herbstlich bunten Farbtupfer bekommen hatten. Ich blätterte in einem Buch, war aber zu nervös, um mich auf die Lektüre zu konzentrieren, als er sich wie ein großer Schatten in meinem Gesichtsfeld aufbaute.
»Es war kein Selbstmord. Das weißt du, oder?«
Er erschreckte mich beinahe. Der flatternde Mantel, das abstehende Haar. Sein Körper wirkte eigenartig schief, als wäre das eine Bein länger als das andere.
»Kurt Cobain meine ich«, sagte er und zeigte auf mein Nirvana-Shirt. »Courtney hat ihn erschossen.«
Ich beschattete meine Augen mit der Hand und beobachtete ihn, wie er eine Zigarette aus einer zerdrückten Marlboroschachtel hervorzauberte.
»Es gab keine Fingerabdrücke auf dem Gewehr«, murmelte er und versuchte, sein Feuerzeug anzumachen. »Wie zum Teufel schießt man sich selbst in den Kopf, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen?«
Hektisch schüttelte er das störrische Feuerzeug und erzeugte schließlich eine kleine, zittrige Flamme, in die er rasch seine Zigarette tauchte.
»Was studierst du?«, fragte er und hielt mir die Zigarettenschachtel hin.
Ich klopfte eine Zigarette heraus, zögerte aber mit der Antwort. Bisher hatte ich kaum jemandem erzählt, was ich studieren wollte, und ich war von meiner Entscheidung auch nicht ganz überzeugt. Vor nur wenigen Minuten hatte ich auf der Bank gesessen und erwogen, meine Pläne in den Wind zu schießen und mich bei der Studienberatung zu erkundigen, ob es nicht noch freie Plätze im Bibliothekars- oder Lehramtsstudiengang gab.
Meine Mutter hatte vermutlich recht, als sie mein Vorhaben als verlorene Zeit und Verschwendung des staatlichen Studiendarlehens abgetan hatte.
»Ich werde hier studieren …«, sagte ich und zeigte aufs Institut für Literaturwissenschaft.
Er folgte meiner Bewegung mit der Zigarette im Mund und ließ den Rauch in Kringeln zum wolkenlosen Himmel emporsteigen.
»Litwiss?«, fragte er enthusiastisch.
»Ja, wobei … Ja.«
»Da werde ich auch studieren! Du bist Erstsemester, oder?«
»Ja, ich habe im Frühling Abi gemacht.«
»Nervös?«
»Quatsch«, sagte ich und lächelte ängstlich.
Er trat vor und drückte meine Hand.
»Ich heiße Adrian«, sagte er. »Ich bin gestern erst hierhergezogen, deshalb kenne ich noch nicht so viele Leute.«
»Ich heiße Zackarias, aber alle nennen mich Zack.«
»Warum das?«
»Wahrscheinlich weil es einfacher ist.«
»Ich mag das Einfache nicht. Warum haben die Menschen solche Angst vor der Komplexität?«
Er drückte die Zigarette an der Schuhsohle aus, setzte sich neben mich und schlug die Beine übereinander. Mit großen Augen und breitem Lächeln sah er mich an.
»Für welchen Kurs hast du dich angemeldet, Zackarias?«
Am liebsten hätte ich es ihm verschwiegen.
»Literarisches Schreiben.«
»Wirklich wahr? Bei Li Karpe? Literarisches Schreiben bei Li Karpe?« Adrian war so begeistert, dass seine Stimme einen feierlichen Singsang bekam. »Ich studiere auch Literarisches Schreiben! Dann sind wir wohl Studienkollegen, Zackarias.«
»Ja, sieht ganz so aus.«
Ich versuchte, eine vorsichtige Freude zum Ausdruck zu bringen, obwohl ich noch nicht davon überzeugt war, dass die Nachricht eindeutig positiv war.
»Ich mache es natürlich nur wegen Li Karpe. Wenn sie nicht wäre, hätte ich mich nie hier eingeschrieben«, erklärte Adrian.
»Na ja, ich bin da eher zögerlich. Ich dachte mir, ich schau mir erst mal an, wie es so ist. Im Notfall kann man ja immer noch abspringen.«
»Nein, nein, solange Li Karpe den Kurs macht, bleibe ich.«
Ich nickte. Natürlich würde ich nie zugeben, dass Li Karpe ein vollkommen neuer Name für mich war. Adrians Augen leuchteten, als er sagte:
»Ich bin ein bisschen besessen von Li Karpe, wie du sicher schon gemerkt hast. Wenn du mich fragst, ist sie die bedeutendste schwedische Vertreterin der Postmoderne. Ein verdammtes Genie. Ansonsten bin ich bei solchen Schreibstudiengängen eher skeptisch, aber wenn ich fünf Tage pro Woche mit Li Karpe zusammen sein kann, würde ich sogar einen Kurs über die Geschichte der Philatelie belegen.«
Er lachte laut und ungezügelt, und nachdem ich ihn einen Augenblick wie ein Idiot angestarrt hatte, konnte ich nicht mehr widerstehen und stimmte in sein Lachen ein, und bald erfasste meinen ganzen Körper eine unbeherrschte Wildheit.
Ebenso plötzlich, wie das Lachen ihn überkommen hatte, erstarrte Adrian wieder, wischte jede Spur von Ausgelassenheit aus seinem Gesicht und stieß mir mit dem Ellenbogen in die Seite. Er zeigte quer durch den Park zum Kiesweg zwischen den Bäumen, und ich folgte seinem Finger mit dem Blick.
Dort schwebte sie entlang, langbeinig, mit hohen Absätzen, das Haar wie eine Fahne im Wind, mit geradem Rücken und den Blick in die Ferne gerichtet. Sich fortzubewegen schien ihre gesamte Aufmerksamkeit zu erfordern.
»Li Karpe«, sagte Adrian. Ihr Name klang wie ein zart schmelzendes Bonbon in seinem Mund.
»Ist sie das?«
Obwohl ich keinerlei tiefere Einsichten in die Postmoderne als Phänomen hatte, verfügte mein Bewusstsein offenbar dennoch über eine gewisse Vorstellung, wie eine Vertreterin der Postmoderne auszusehen hatte. Und Li Karpe entsprach diesem Bild ganz und gar nicht.
»Wahnsinn, was für eine Aura«, sagte Adrian.
Unsere Blicke klebten an ihrem Körper, während sie durch den Park ging. Vor dem roten Ziegelgebäude Haus Absalon, in dem das Institut für Literaturwissenschaft untergebracht war, blieb sie stehen, warf die Haare nach hinten, drehte sich um und sah uns direkt in die Augen.
August 2008
Er war wie vom Erdboden verschluckt. Ich durchforstete das gesamte Internet, fand aber weder Adresse noch Telefonnummer. Ich rief beim Finanzamt an und erfuhr, dass es keinen einzigen Adrian Mollberg in Schweden gab.
»Angeblich wohnt er irgendwo außerhalb von Lund, in Richtung Bjärred, habe ich gehört.«
Die Frau im Finanzamt klapperte auf ihrer Tastatur herum, und dann musste ich mir eintönige Wartemusik anhören, ehe sie wieder am Apparat war, abermals mit einem negativen Bescheid.
»Jetzt habe ich überall nachgesehen. Es gibt keinen Adrian Mollberg, der in Schweden gemeldet wäre, weder in Lund noch in Bjärred oder anderswo.«
»Könnte er seinen Nachnamen gewechselt haben?«
»Das könnte natürlich sein.«
Es hatte keinen Sinn. Also beschloss ich, meine Suche auf Betty zu verlagern. Ich setzte Kaffee auf und drehte die Lautstärke des Lokalsenders auf, während meine Mutter die Pflanzen auf der Fensterbank goss, bis sie badeten.
»Am besten kaufst du den Geranien Schwimmwesten.«
Sie starrte mich an.
»Willst ausgerechnet du mir beibringen, wie man Blumen pflegt? Dabei kenne ich außer dir niemanden, der einen Kaktus vertrocknen lassen kann.«
Um ihre Kompetenz zu unterstreichen, bedachte sie jede einzelne Pflanze mit einem weiteren Strahl Wasser.
»So, jetzt ist gut.«
Ich goss den dampfenden Kaffee in unsere Tassen, meine Mutter nahm mir gegenüber Platz, und ich klappte meinen Laptop für die nächste Rechercherunde auf.
»Aha«, brummte meine Mutter. »Ja, ja.«
Ich schrieb »Betty Johnsson« ins Suchfeld und scrollte die Liste der Ergebnisse hinunter. Eine hatte einen Preis bei einem Pferderennen gewonnen, eine andere war eine amerikanische Schauspielerin mit Dreadlocks, und es gab eine Vierzehnjährige aus Schottland mit diesem Namen, die behauptete, sie würde für Justin Bieber sterben.
»Musst du wirklich mit diesem Ding da rummachen, während wir Kaffee trinken?«
Meine Mutter rührte in ihrer Tasse und starrte wütend meinen Computer an, als beleidigte er sie persönlich.
»Sorry, ich hab nicht gedacht, dass …«, sagte ich und klappte meinen Laptop wieder zu.
»Gibt es wirklich so viel Interessantes in diesem Kasten? Es ist dieses Facebook, oder? Karla ist auch Mitglied bei Facebook. Sie sagt, es ist die einzige Art, mal ihre Enkel zu Gesicht zu bekommen.«
»Nein, Mama, es ist nicht Facebook.«
Dass ich jetzt erst darauf gekommen war! Ich klappte den Laptop gleich wieder auf.
»Sag mal, Junge, kannst du nicht eine einzige Minute ohne?«
»Mama, du bist ein Genie!«, sagte ich.
Sie starrte mich an.
»Das weiß ich doch.«
Ich lachte und trug Bettys Namen ins Suchfeld bei Facebook ein. Es erschien eine ganze Reihe von Gesichtern. Ich scrollte immer weiter runter, und am Ende fand ich sie.
Sie hatte als Facebook-Namen Betty Writer gewählt, aber sie war es, zweifellos. Genau wie ich sie in Erinnerung hatte, als wäre kein einziger Tag vergangen. Die Zeit hatte keinerlei Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Das Leuchten ihrer Augen, das ungezügelte Freiheitschaos ihrer Haare und die schmalen lachsrosa Lippen.
Trotz all der Jahre, die verstrichen waren, hatte ich das Gefühl, ein Pflaster von einer blutenden Wunde zu reißen. Erinnerungen und Gefühle brachen hervor. Alles, von dem ich gedacht hatte, es sei längst vergessen, hatte offenbar nur direkt unter der Hautoberfläche geschlummert.
»Was ist los mit dir?«, fragte meine Mutter.
Ich musste mich am Riemen reißen, um nicht zusammenzubrechen.
Laut Facebook wohnte Betty noch immer in Lund, und ich schrieb ihr eine kurze Nachricht.
Ich habe vor, ein Buch zu schreiben. Willst du mir helfen?
Der unschuldige Mörder
von Zackarias Levin
2. Kapitel
September 1996
Wir waren in einem Keller untergebracht. Der einjährige Studiengang Literarisches Schreiben. Oder nach der Definition meiner Mutter: eine Verschwendung von Steuergeldern. Und laut Adrian Mollberg: ein leicht prätentiöser Zeitvertreib unter der Leitung des schönsten Genies der Welt.
In unserer ersten Übung sollten wir uns selbst beschreiben. Adrian und ich saßen ganz vorn im schmutzig weißen Kellerraum, wo die Rohre unter der Decke verliefen und das Isolierungsmaterial zwischen den Abschlussleisten hervorquoll. Es juckte einen, wenn man bloß hinsah, und der muffige Geruch drang einem in die Nase. Li Karpe ging langsam zwischen den Tischen auf und ab.
»Lasst eurer inneren Kreativität freien Lauf. Denkt um, denkt neu, denkt groß!«
Ihre Stimme war ähnlich gemächlich wie ihre Schritte. Nichts geschah in Eile, alles schien wohlüberlegt zu sein.
»Ich hab es doch gesagt«, flüsterte Adrian. »Sie ist ein Genie!«
Vorsichtig drehte ich mich um, als sie an uns vorbeiging. Ein schimmernder Zuckerduft umwehte sie. Ihr Haar fiel in fein geformten Korkenzieherlocken über ihre Schultern, die Jeans saßen weit oben an der Taille und eng über den Oberschenkeln. Ihre Absätze waren mindestens zehn Zentimeter hoch.
»Wer bist du? Wer bist du eigentlich?«, fragte sie und blickte in vierzehn reglose Gesichter.
Dann legten wir los. Ich griff nach meinem neuen Kugelschreiber – den ich mir eigens fürs Literarische Schreiben zugelegt hatte – und blickte auf die erste leere Seite in meinem neuen Notizbuch mit schwarzem Ledereinband. Adrian seufzte schwer. Jedes Mal wenn er eine neue Mine aus seinem Druckbleistift drückte, brach sie ab und fiel heraus. Nachdem er eine Weile verärgert vor sich hin gemurmelt hatte, gab er auf. Er drehte sich um und lieh sich bei einer Mitstudentin einen Bleistift. Schweigend saß er da und starrte den Stift an. Schließlich beugte er sich zu mir.
»Sag mal, Zackarias? Könntest du mir wohl ein Blatt Papier leihen?«
Widerwillig riss ich eine Seite aus dem Notizbuch, das ich im selben exklusiven Laden gekauft hatte wie den Kugelschreiber und das mittelfristig für den ersten Entwurf des schlagkräftigsten Romandebüts seit Ulf Lundells Jack vorgesehen war. Immer noch betrachtete ich die leeren Linien auf dem Papier. Um mich herum war das Kratzen eifriger Kugelschreiberspitzen zu hören, und ganz hinten das Klappern eines langsamen Zeigefingerwalzers. Dort saß der einzige männliche Teilnehmer des Kurses, abgesehen von Adrian und mir. Er hatte schlechte Haut, mausbraunes, seitlich gescheiteltes Haar und eine runde Nickelbrille. Auf seinem Tisch stand eine Reiseschreibmaschine, und es schien ihn nicht zu stören, dass die anderen ihn verwundert anschauten.
Zehn Minuten später hatte ich noch immer keinen Strich in meinem Notizbuch zustande gebracht. Verstohlen sah ich über die Schulter und versuchte zu lesen, was Adrian geschrieben hatte. Er fing meinen Blick auf und lächelte zufrieden.
Mit langsamen Bewegungen schrieb ich meinen vollständigen Namen oben auf die Seite.
»Noch zehn Minuten«, sagte Li Karpe.
Stoßseufzer erklangen, und die Geschwindigkeit der Kugelschreiber auf dem Papier stieg. Ich blickte mich ein letztes Mal um und schrieb dann:
Zackarias Bror Levin
Ich werde im Dezember neunzehn Jahre alt und weiß nicht richtig, wer ich bin. Das ist vermutlich ziemlich normal. Ich glaube, dass ich ziemlich normal bin.
Ich bin in einem kleinen Dorf bei meiner Mutter aufgewachsen. Sie ist nicht ganz so normal. Mein Vater ist Seemann im Persischen Golf, und als ich kleiner war, kam er jeden zweiten Monat nach Hause, aber später besuchte er uns nicht mehr.
Ich habe niemandem von diesem Kurs erzählt. Dort, wo ich herkomme, glaubt niemand, dass man Schriftsteller werden kann. Also bin ich wohl doch nicht ganz normal.
Ich mag gute Musik und bin nachts gern lange wach. Schreiben ist vermutlich das Einzige, worin ich mehr als mittelmäßig bin. Deshalb möchte ich damit weitermachen.
»Hört zu«, sagte Li Karpe und legte den Kopf schief. »Mein Vorschlag ist, dass ihr jetzt die Präsentationen der anderen lest, damit ihr eure neuen Mitstudenten kennenlernt.«
Adrian und ich wechselten Blicke.
»Ihr könnt doch mit demjenigen beginnen, der neben euch sitzt«, sagte Li Karpe.
Adrian lachte und gab mir sein Blatt Papier. Ich reichte ihm mein Notizbuch.
Und so beschrieb Adrian Mollberg sich selbst:
Ich bin nicht du.
»Ist das alles?«, fragte ich.
Er nickte.
»Über das Komplexe muss man sich nicht lang und breit auslassen. Im Kleinen ist das Große bereits enthalten.«
Während er meinen Text überflog, las ich seinen Satz immer wieder durch und versuchte zu verstehen, was da stand. Ich bin nicht du. Sollte ich das als Distanzierung verstehen? Oder war es nur eine einfache Feststellung? Ich traute mich nicht zu fragen.
»Ich mag deine Wiederholung des Wortes normal«, sagte Adrian nachdenklich, nachdem er meine Präsentation gelesen hatte. Nicht mehr. Nichts über meinen Schriftstellertraum oder meine Eltern.
»Jetzt nehmt ihr eure Präsentationen«, sagte Li Karpe, »und wählt jemanden aus, der euch interessant erscheint, jemanden, den ihr näher kennenlernen wollt, und bittet ihn darum, seine Präsentation lesen zu dürfen.«
Mein Magen verkrampfte sich. Adrian erhob sich und wedelte mit seinem Papier, aber meine Beine waren so schwer wie die eines Nashorns.
»Los jetzt, Zackarias.«
Ich zwang mich aufzustehen. Ein kurzer Schwindelanfall, dann folgte ich Adrian. Zwei Blondinen standen kichernd in der Ecke, ein Mädchen mit ängstlichem Gesicht drückte sich an die Wand. Wir waren vierzehn Auserwählte, vierzehn von mehreren Hundert, wenn die Gerüchte stimmten. Elf Frauen und drei Männer, alle im Alter zwischen achtzehn und fünfundzwanzig. Sorgfältig ausgewählt nach Textproben in verschiedenen Genres: Prosa, Lyrik und Drama. Literarisches Schreiben war einer der wenigen Studiengänge, die mir trotz meines mittelmäßigen Abiturs offengestanden hatten.
Li Karpe musste eine von denen gewesen sein, die mich ausgewählt hatten. Sie hatte meine Texte gelesen und ein gewisses Potenzial entdeckt. Jetzt stand sie lächelnd vor mir und wollte mir helfen, jemanden zu finden, dem ich meine Präsentation zu lesen geben konnte.
»Dort hinten«, sagte sie und zeigte quer durch den Raum auf ein Mädchen mit Tanktop im Camouflagelook, Baggyjeans und roten Doc Martens. »Sprich mit ihr.«
Li Karpe reckte sich und winkte dem Mädchen zu, das nicht sonderlich beeindruckt wirkte.
Adrian war schon in ein angeregtes Gespräch mit einer jungen Frau vertieft, die wild gestikulierte. Ich drückte mich vorbei und gab dem Mädchen im Camouflagetop die Hand.
»Betty«, sagte sie verbissen.
Ihr Händedruck war schlaff und unengagiert. Sie sah mir nicht einmal in die Augen.
»Wollen wir tauschen?«, fragte ich und hielt ihr mein Notizbuch hin.
»Oh, ein ganzes Buch.«
Sie schlug die erste Seite auf und begann zu lesen.
»Und was ist mit deiner Präsentation?«, fragte ich, bekam aber keine Antwort.
Erst nachdem sie den Text gelesen hatte, hob sie den Blick. Sie sah erstaunt aus, als hätte sie Schwierigkeiten, das Geschriebene mit der Person zusammenzubringen, die vor ihr stand.
»Ach ja, richtig«, sagte sie und reichte mir ein DIN-A4-Blatt mit schiefen Zeilen und hinkenden Krakelfüßen.
Ich bin das Scharfe in deiner Kehle
ich bin der Eiter in der Wunde, die nie heilt
ich bin die Erbse unter der Matratze
ich bin der Stein in deinem Schuh
Ich bin das nächtliche Rauschen in den Ohren
ich bin eine tickende Zeitbombe
ich bin die verwehrte Wiederkehr
ich bin eine abgerissene Oberleitung
Ich bin der Schatten unter dem Bett
ich bin das Skelett in deinem Schrank
ich bin die Narben in deinem Herzen
ich bin das Messer in deinem Rücken
Ich bin Milliarden von Hirnsynapsen
und fünf Liter Blut
Wer bist du, verdammt?
Ich musste den Text zweimal lesen.
»Verdammt gut«, sagte ich.
»Ach was«, sagte sie nur und riss mir das Papier aus der Hand.
Wir standen schweigend da und betrachteten verstohlen die Schuhe des anderen. Abwartend, ohne eigentlich auf etwas zu warten.
»Ich komme auch aus so einem Dorf«, sagte sie schließlich und hielt den Blick immer noch gesenkt. »Wo man nicht glauben darf, dass man was Besonderes ist.«
»Ich hasse solche Orte. Sobald ich ein Wohnheimzimmer kriege, werde ich aus Veberöd abhauen und nie zurückkehren.«
»Das verstehe ich«, sagte sie. »In meiner Jugend bin ich voller Angst durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, dass das Leben immer so weitergehen würde. Ich habe nicht begriffen, dass man neue Chancen bekommt und von vorn beginnen, sich für ein anderes Leben entscheiden kann.«
»Ein anderes Leben?«
Betty nickte nur. Sie schaute mich an, verwundert, vielleicht irritiert. Es war mir unangenehm, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Nach einer Weile, die sich wie eine halbe Ewigkeit anfühlte, sagte sie schließlich:
»Du weißt schon, dass es nicht so war, wie allgemein behauptet wird?«
Ich kapierte nicht, was sie meinte. Mir wurde schwindlig, meine Gedanken drifteten ab.
Betty zeigte auf mein T-Shirt.
»Kurt Cobain«, sagte sie. »Es kann kein Selbstmord gewesen sein.«
August 2008
Ich wartete an der Straßenecke vor dem Hotel Lundia auf sie. Jedes Mal wenn eine Frau vorbeikam, die nur die entfernteste Ähnlichkeit mit ihr hatte, zuckte ich zusammen und griff mir ans Herz.
Noch am selben Nachmittag hatte Betty auf meine Nachricht geantwortet. Äußerst widerwillig hatte sie sich zu einem Kaffee bereit erklärt, und ich fühlte mich wie ein Eindringling.
Aus dem Augenwinkel sah ich einen Typen, der auf einem Skateboard angefahren kam. Blonde Locken flatterten unter seiner Basecap. Er sprang ab, trat auf das Skateboard, sodass es hochschnellte, und klemmte es sich unter den Arm. Dann ging er direkt auf mich zu.
»Bist du Zack?«
»Wer fragt?«
»Betty schickt mich. Sie wartet in ihrer Wohnung auf dich.«
Er gab mir die Hand und sagte, er heiße Henry. Dann stellte er das Skateboard wieder auf den Boden und signalisierte mir, dass ich ihm folgen solle.
»Betty geht tagsüber lieber nicht raus.«
»Warum denn nicht?«
Aber Henry antwortete nicht und rollte davon. Ich musste laufen, damit ich mit ihm Schritt halten konnte. Wir kamen am Clemenstorget und an der Sozialhochschule vorbei, wo einer meiner ältesten Freunde aus Veberöd eine Abschlussarbeit über die kontaktschaffende Funktion von Rollenspielen geschrieben hatte. Er bekam einen Job bei Framfab und strich während des großen IT-Booms ein Jahresgehalt pro Monat ein.
Vor einem roten Haus am Markt blieb Henry stehen.
»Hier ist es«, sagte er und zeigte auf das Gebäude.
Der Fahrstuhl knirschte, und wir drückten uns an die Wand der Kabine. Henry musterte mich ungeniert von oben bis unten.
»Lange her bei euch, oder?«, fragte er.
»Lange her?«
»Na du und Betty. Ihr kennt euch schon lange?«
»Ja, aber wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen.«
Warum hatte sie den Typen vorgeschickt? Vertraute sie mir nicht? Henry hielt die Fahrstuhltür auf und ließ mich vorgehen. An der Tür stand Westergren, direkt darunter klebte ein handgeschriebener gelber Zettel mit dem Namen B. Johnsson. Es roch nach Bratfett und Waschmittel.
»Komm rein«, sagte Henry und streifte in der Diele seine Sneakers ab.
Es brauchte eine gewisse Präzision, um sich einen Weg durch das Schuhwirrwarr in der engen Diele zu bahnen. Wir gelangten in die Küche, wo eine Frau am Tisch vor einem leer gegessenen Teller saß. Sie drehte sich zu mir um, aber es dauerte einen Augenblick, bis ich sie erkannte.
»Betty?«
Sie presste die Lippen zusammen. Ihre Augen glänzten feucht.
Ich konnte nicht glauben, dass sie es war. Die Einsicht sank wie ein schwerer Stein in meinen Körper. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Mir war klar, dass man mir ansah, was ich dachte.
»Ist schon okay«, sagte Betty. »Ich weiß, wie ich aussehe.«
Sie hatte eine Fleecehose und einen ausgebeulten grauen Kapuzenpulli an. Ihre Wangen hingen herab, das Kinn und der Hals schienen zusammengewachsen zu sein, unter den Armen, den Brüsten und dem Bauch wabbelte es. Aber es war nicht nur das Gewicht. Ihre Haare waren strähnig und stumpf, und ihre Haut hatte rote Flecken. Ihre Augen sahen müde aus.
»Wohnst du nicht in Stockholm?«, fragte sie. »Ich habe deinen Namen in der Zeitung gesehen.«
Ich bemühte mich, sie nicht anzustarren.
»Mir ist gekündigt worden. Ich bin nach Hause zu meiner Mutter gezogen.«
Es fühlte sich völlig natürlich an, so geradeaus zu sein. Als würde die Situation es erfordern.
»Das heißt, du wirst jetzt Schriftsteller? Wie damals, in der guten alten Zeit?«
»Ach, das weiß ich noch nicht. Es ist nur ein Projekt.«
Plötzlich fühlte es sich albern an, darüber zu sprechen. Vor mir saß Betty. Wenn sich einer von uns literarisch betätigen sollte, dann mit Sicherheit nicht ich. Vielleicht sollte ich es einfach bleiben lassen.
Betty gab ein Grunzen von sich und verzog das Gesicht zu einer Grimasse, während sie sich mit beiden Armen auf dem Tisch abstützte und aufstand, um mir Platz zu machen.
»Ich vermute, du bist enttäuscht«, sagte sie. »Das Foto auf Facebook ist ein paar Jährchen alt. Ich will es lieber nicht aktualisieren.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Enttäuscht war nicht das richtige Wort. Natürlich war ich angesichts Bettys Metamorphose schockiert, aber in erster Linie empfand ich eine große Wehmut. Nicht unbedingt weil Betty so zugelegt hatte, sondern weil ihr Leuchten verschwunden war, das Mürrische, Kantige. Damals konnte sie wie ein hochgehaltener Mittelfinger aussehen. Jetzt wirkte sie nur müde und ausgelaugt.
»Betty Writer?«, sagte ich und nahm auf ihren Facebook-Namen Bezug. »Hast du geheiratet?«
»Ich?« Sie lachte. »Ganz im Gegenteil. Das ist nur eine Art, sich zu verstecken.«
Auf einmal drehte Henry den Wasserhahn auf, und das Wasser donnerte ins Spülbecken.
»Wollt ihr einen Kaffee?«, fragte er mit lauter Stimme, während er die Kanne unter dem Hahn füllte.
»Es ist Henrys Wohnung. Ich bin nur seine Untermieterin«, erklärte Betty. Wir nahmen Henrys Kaffeeangebot an.
»Du hast mir nie geschrieben«, sagte ich.
Es klang vorwurfsvoll, und Betty sah mich verständnislos an.
»Du hast gesagt, du würdest mir Briefe schreiben«, fuhr ich in etwas versöhnlicherem Ton fort. »Nach dem Gerichtsprozess. Als ich nach Stockholm gegangen bin.«
»Ich habe mir gedacht, es wäre am besten, es nicht zu tun. Am besten für alle.«
»Und Adrian? Was ist mit dir und Adrian?«
Betty seufzte schwer. Dann wandte sie den Blick ab, als wollte sie lieber nicht antworten.
»Redet ihr noch miteinander?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf.
»Wir haben uns ein paar Mal getroffen, nachdem er aus dem Gefängnis raus war. Aber das ist auch schon mehrere Jahre her.«
Aus irgendeinem Grund fühlte sich das gut an.
»Was hast du denn nach dem Gerichtsverfahren gemacht?«
Betty erzählte, dass sie Adrian mehrmals im Gefängnis besucht habe. Sie hätten über die Zukunft gesprochen, Pläne geschmiedet, seien trotz allem zuversichtlich gewesen. Sie hatte ihm einen neuen Anwalt besorgt, einen jungen skrupellosen Staranwalt, der es wohl als Karrierechance angesehen hatte, Adrian Mollberg zu vertreten und im besten Fall freizubekommen – den Mann, der wegen Mordes verurteilt worden war, obwohl es keine Leiche gab. Die Medien waren mit einem Mal aufmerksam geworden und hatten eine Reihe Artikel zum Thema Rechtsskandal und Justizmord publiziert, aber sehr viel mehr war nicht daraus geworden.
»Milch und Zucker?«, fragte Henry, als er den dampfend heißen Kaffee in eine Tasse mit dem Konterfei von Che Guevara goss.
»Zucker, bitte«, sagte ich. »Zwei Stücke.«
Er sah mich an, als hätte ich sie nicht mehr alle.
»Aber dann haben wir uns eine längere Zeit nicht mehr gesehen«, fuhr Betty fort. »Adrian wollte nicht mehr, und ich wurde krank. In den letzten Jahren habe ich ihn gar nicht mehr besucht. Bis zu seiner Entlassung, meine ich.«
Henry stellte eine Packung mit einer plastikartigen Biskuitrolle auf den Tisch. Betty wischte das Brotmesser mit einer Serviette ab.
»Selbst gebacken?«, bemerkte ich.
Aber der Witz kam nicht gut an. Betty starrte mich nur an und schob sich ein großes Stück Kuchen in den Mund.
»Weißt du, wo er inzwischen wohnt?«
»Glaub schon«, sagte Betty. »Nach seiner Entlassung hat er hier angerufen. Er klang verzweifelt, hatte keine Bleibe, und ich habe ihm geholfen. Oder besser gesagt, Henry hat ihm geholfen. Sein Onkel besitzt ein verfallenes Haus auf dem Land.«
»Das heißt, Adrian ist da eingezogen?«
Jetzt nahm ich die Witterung auf. So nah war ich Adrian Mollberg seit zwölf Jahren nicht gewesen. Gedankenverloren schnitt ich ein Stück Biskuitrolle ab.
»Er wohnt noch immer da. Es ist eine richtige Bruchbude, wo es reinregnet und nach Schimmel riecht. Aber er hat da draußen seine Ruhe, und das scheint für ihn das Wichtigste zu sein.«
»Wo liegt das Haus?«
»Im Niemandsland, also richtig weit draußen. Etwas nördlich von Flädie, in Richtung Bjärred.«
Ich jubelte innerlich. Der unschuldige Mörder. Ich würde ihn ausfindig machen! Es würde doch etwas werden aus meinen Buchplänen.
»Wirst du zu ihm fahren?«, fragte Betty.
»Nun, vielleicht kann er mir ja mit meinem Buch helfen.«
Sie sah skeptisch aus und stopfte sich noch mehr Biskuitrolle in den Mund. An den Lippen blieb etwas Schlagsahne hängen. Ich wartete darauf, dass sie es merkte.
»Kommst du mit?«, fragte ich unüberlegt.
»Ich? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe inzwischen nur noch selten raus. Mir geht es nicht gut, ich nehme starke Medikamente, verstehst du?« Dann sah sie mir wieder in die Augen. »Was willst du denn für ein Buch schreiben?«
Ich räusperte mich. Henry starrte mich an.
»Einen Roman über unser Studium in Literarischem Schreiben. Über Li Karpe und Leo Stark. Über dich und mich, Fredrik und Adrian.«
Ich erklärte, dass ich schon begonnen hätte.
»Diesmal habe ich ein Ziel, eine Botschaft. Li Karpe wird stolz sein.«
Betty verzog keine Miene. Henrys Blick huschte zwischen uns hin und her, als erwarte er ein großes Drama.
»Der unschuldige Mörder«, sagte ich und gestikulierte herum. »Das Buch, das die Wahrheit über den geheimnisumwitterten Schriftstellermord und den größten Rechtsskandal unserer Zeit offenbart.«
Ich wischte mir Krümel von der Oberlippe und lächelte breit. Ein für alle Mal würde ich Adrian Mollbergs Namen reinwaschen und obendrein Millionär und gefeierter Bestsellerautor werden.
Betty zündete sich eine Zigarette an und blies einen Schwall Rauch geradewegs über den Tisch. Plötzlich war das Mürrische und Kantige zurückgekehrt, die Augenbrauen, die sich zusammenzogen, der starre Blick.
»Vergiss es«, sagte sie. »Vergiss die ganze Idee, das Buch, alles. Es wird nichts draus werden.«
Ich hustete und wedelte den Rauch weg.
»Was meinst du damit?«
»Adrian ist nicht unschuldig. Er hat mir gegenüber alles zugegeben.«
Der unschuldige Mörder
von Zackarias Levin
3. Kapitel
September 1996
»Nur noch diesen Abschnitt! Das ist der eigentliche Kern des Romans.«
Wir ließen ihn gewähren. Adrian Mollberg verstellte seine Stimme und stieß die Wörter mit übertriebener Betonung hervor. Dabei beugte er sich tief über den Tisch, als würde er an einem verglühenden Lagerfeuer Gespenstergeschichten erzählen.
»Bret Easton Ellis«, sagte er und schloss das Buch. »Merkt euch diesen Namen. Ehe unsere Zeit auf Erden um ist, wird dieser Typ mindestens einen Nobelpreis bekommen haben.«
Fredrik Niemi verzog sein Gesicht zu einer Grimasse.
»Ich finde, das sind die reinsten Gewaltorgien.«
Mir ging auf, dass ich Fredriks Stimme bis zu diesem Zeitpunkt kaum je gehört hatte. Sein Dialekt war schwer einzuordnen, aber auf jeden Fall war er ein ganzes Stück südwärts gezogen, um Literarisches Schreiben in Lund zu studieren. Er hatte seine Reiseschreibmaschine auf den Stuhl neben sich gehievt, und als Betty ihn fragte, warum er diesen Koloss mit sich herumschleppte, bekamen seine Wangen eine schweinchenrosa Färbung. Er nahm seine runde Brille ab und kratzte sich im Augenwinkel.
»Ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass alle auf der Maschine schreiben.«
Wir warfen uns über den Tisch hinweg einen Blick zu und brachen in so lautes Gelächter aus, dass der Kellner seine Zeitung sinken ließ und verärgert zu uns herübersah.
»Was für einen Herbst wir vor uns haben!«, sagte Adrian und wiegte das Bierglas hin und her, bis es überschwappte. »Ich bin so glücklich, dass ich ausgerechnet mit euch hier sitzen darf. Und Li Karpe! Ich kann es noch gar nicht fassen, dass Li Karpe unseren Kurs leitet. Ist das nicht ein Traum?«
Es war Adrians Verdienst, dass wir dort im Keller saßen und abgestandenes Bier tranken. Wäre Adrian nicht gewesen, hätten wir diesen Abend mit größter Wahrscheinlichkeit jeder für sich allein verbracht. Wäre nicht Adrian Mollberg nach unserem allerersten Seminartag auf der Treppe vor dem Institut für Literaturwissenschaft stehen geblieben und hätte mich am Pullover gezogen, und hätte ich nicht zufällig erwähnt, dass Betty seine verschwörungstheoretische Sicht auf Kurt Cobains Tod teilte. Wäre nicht Fredrik mit seiner Reiseschreibmaschine stehen geblieben und hätte wie ein Kind ausgesehen, das seine Eltern verloren hatte.
Ich empfand einen starken Rausch. Nicht vom Bier, sondern durch das Gemeinschaftsgefühl, aufgrund der Erwartungen, der Hoffnung auf etwas Neues, um das meine ganze Sehnsucht gekreist war. Adrian stieß sein Glas gegen meins und nannte Li Karpes Namen zum ich weiß nicht wievielten Mal.
»Es klingt beinahe so, als würdest du sie kennen«, sagte Betty.
»Natürlich kenne ich sie. Wir haben eine ganz besondere Beziehung.«
»Inwiefern besonders?«
»Ich weiß quasi alles über sie, aber sie weiß nicht einmal, dass ich existiere.«
»Jetzt weiß sie es«, bemerkte ich.
Adrian lächelte.
»Du hast recht, Zackarias. Von heute an gibt es mich in Li Karpes Sinnenwelt. Bisher hat es meiner Existenz an Wert gemangelt, die ersten neunzehn Jahre meines Lebens waren ein einziges Warten auf diesen Moment. Ich bin von heute an neugeboren. Lasst uns darauf unsere Gläser erheben!«
Er stieß sein Glas gegen das von Fredrik und lachte laut. Betty lehnte sich zu mir herüber.
»Kennst du diesen Typen eigentlich?«, flüsterte sie. »Ein bisschen unangenehm, oder?«
Sie legte ihren Arm auf den Tisch und drehte an ihren Stoffarmbändern.
»Ich hab ihn heute Vormittag zum ersten Mal gesehen.«
»Ich traue ihm nicht eine Sekunde über den Weg. Nur dass du es weißt. Jetzt bist du schuld, wenn was passiert.«
»Was kann schon passieren?«
Sie fixierte mich mit dem Blick, und erst jetzt fielen mir ihre Augen auf. Sie bestanden aus Regenbogen. Kurze Streifen und Striche in allen Farben des Himmels. Als könnten sie sich nicht richtig entscheiden.
»Er könnte uns zum Beispiel Schlafmittel ins Bier tun, damit wir später in seiner Wohnung zusammenbrechen. Vielleicht erschlägt er uns mit der Axt und schändet unsere Leichen.« Sie holte tief Luft. »Falls das passiert, ist es deine Schuld.«
Sie sah mich an, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ich glaube nicht, dass er so einer ist«, sagte ich.
»Nicht?«
»Ich glaube, er will uns lebend haben. Er sperrt uns in ein dunkles Kellerloch und zwingt uns, unseren eigenen Urin zu trinken, damit wir überleben.«
Unser Lachen blieb uns im Halse stecken, als Adrian uns plötzlich direkt ansah. Ich räusperte mich und kratzte mich an der Nase. Betty warf ihr Haar nach hinten.
»Jetzt gehen wir«, sagte Adrian.
»Wohin?«, fragte Betty.
Nicht einmal in meinem bierseligen Zustand hatte ich das Gefühl, dass es eine gute Idee war. Aber Adrian gab nicht klein bei. Mitten auf einer Straßenkreuzung blieb er stehen und streckte den Zeigefinger aus.
»Trädgårdsgatan«, sagte er. »Das muss hier irgendwo sein.«
Auf dem Touristenstadtplan, den er aus seiner Tasche gezogen hatte, war die Stelle mit einem großen schwarzen Kreuz markiert.
»Du hast dir tatsächlich herausgesucht, wo sie wohnt?« Betty schüttelte den Kopf.





























