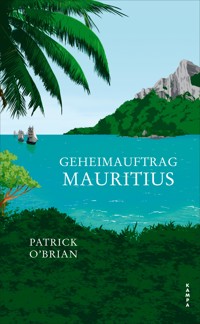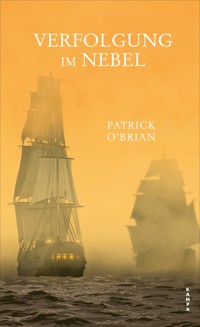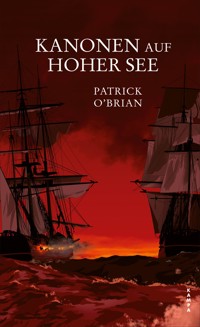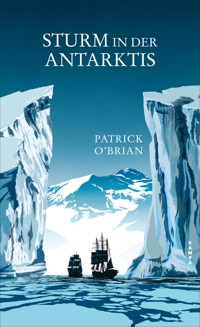Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuer von Aubrey und Maturin
- Sprache: Deutsch
Kapitänsleutnant Jack Aubrey genießt seinen verdienten Landurlaub: Fuchsjagden, anständige Musik, hier und da ein Opernbesuch. Sein letztes Gefecht, in dem er mit seiner kleinen Vierzehn-Kanonen-Brigg Sophie die spanische Schebeckenfregatte Cacafuego erobert hat, war monatelang in aller Munde und hat ihm Ruhm und Anerkennung eingebracht. Da erhält Aubrey einen Brief: Sein Prisenagent hat ihn um die verdienten Anteilsgelder betrogen. Nicht nur seine Karriere gerät jetzt in gefährliche Fahrwasser, für die Mutter der jungen Frau, in die er sich verliebt hat, wird er auch zu einem inakzeptablen Heiratskandidaten. Um dem Schuldgefängnis zu entgehen, flieht Aubrey zusammen mit seinem Freund und Schiffsarzt Dr. Stephen Maturin Hals über Kopf außer Landes. Erst als die beiden wieder Planken unter die Füße bekommen, kann Aubrey erneut beweisen, was in ihm steckt. Die zweifelhafte Belohnung für seine Verdienste: Das Kommando der Polychrest, einer schwimmenden Fehlkonstruktion, mit der er Napoleons Truppen in einem ihrer eigenen Häfen attackieren soll …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick O’Brian
Der verliebte Kapitän
Das zweite Abenteuer für Aubrey und Maturin
Roman
Aus dem Englischen von Jutta Wannenmacher
Kampa
1
Im Morgengrauen teilten sich die über dem Ärmelkanal ostwärts treibenden Regenschleier gerade lange genug, um den Verfolgern zu zeigen, dass ihr Jagdwild Kurs geändert hatte. Die Charwell war fast die ganze Nacht seinem Kielwasser gefolgt, mit sieben Knoten Fahrt trotz ihres stark verkrusteten Unterwasserschiffs, und jetzt trennten sie nur noch gut anderthalb Seemeilen. Das vordere Schiff drehte, ging immer höher an den Wind, und das Schweigen an Deck der britischen Fregatte gewann eine neue Intensität, als jeder Mann an Bord die beiden Reihen der feindlichen Stückpforten in Sicht kommen sah. Zum ersten Mal, seit der Ausguck in der Abenddämmerung das Auftauchen eines Segels am Horizont gemeldet hatte, konnten sie das fremde Schiff zur Gänze erkennen. Einen Strich an Backbord voraus hatte es die ganze Zeit Nordnordostkurs gehalten, und an Bord der Charwell war man der einhelligen Meinung gewesen, dass es sich entweder um einen von seinem Konvoi versprengten Franzosen oder um einen amerikanischen Blockadebrecher handeln musste, der im Schutz der Neumondnacht Brest zu erreichen hoffte.
Zwei Minuten nach dieser ersten Sichtmeldung hatte die Charwell ihr Fock- und Großbramsegel gesetzt: nicht gerade eine gewaltige Menge Tuch, aber schließlich hatte die Fregatte eine lange, mühselige Überfahrt von Westindien hinter sich, mit neun Wochen ohne Landsicht. Die Äquinoktialstürme hatten ihre Takelage bis an die Bruchgrenze gebeutelt, und auf dem Höhepunkt des Unwetters hatte sie im Golf von Biskaya drei Tage lang beidrehen müssen. Deshalb war es verständlich, dass der Kommandant, Kapitän Griffiths, Schiff und Besatzung schonen wollte. Keine Wolke von Segeln also, aber trotzdem hatten sie sich binnen zweier Stunden ins Kielwasser des Fremdlings gesetzt, und bei vier Glasen in der Morgenwache hatte die Charwell gefechtsklar gemacht. Die Trommel schlug ihre Wirbel, die eingerollten Hängematten wurden an Deck gebracht und als Kugelfang in den Finknetzen an der Reling verstaut. Die Kanonen wurden ausgefahren, und die schlafwarme, aus rosigem Schlummer gerissene Freiwache stand in Bereitschaft, seit über einer Stunde im kalten Regen an Deck und bis ins Mark durchgefroren.
In der Stille, die dieser neuen Wendung gefolgt war, konnte man nun hören, wie ein Kanonier in der Kuhl seinem erschreckt nach vorn starrenden Nachbarn erklärte: »Das ist ein französischer Zweidecker, Kamerad, mit vierundsiebzig oder achtzig Kanonen. Da sind wir an den Falschen geraten, mein Freund.«
»Ruhe dort unten, verdammt noch mal«, brüllte Kapitän Griffiths. »Mr Quarles, notieren Sie den Namen dieses Mannes.«
Dann schlossen sich die grauen Regenschleier wieder um die beiden Schiffe. Doch jetzt wusste jeder auf dem überfüllten Achterdeck der Fregatte, was hinter den treibenden, alle Formen verwischenden Schauern auf sie wartete: ein französisches Linienschiff mit zwei Reihen bereits geöffneter Stückpforten. Und keinem einzigen Mann war die leichte Drehung der Rah entgangen, die bedeutete, dass der Franzose seine Fock back stellte, um beizudrehen und es mit ihnen aufzunehmen.
Die Charwell war mit zweiunddreißig Zwölfpfündern bewaffnet, und wenn sie nahe genug herankommen konnte, um ihre gedrungenen Karronaden auf Achterdeck und Vorschiff und ihre langen Jagdkanonen einzusetzen, konnte sie mit einer Breitseite insgesamt zweihundertachtunddreißig Pfund Eisen verschießen. Aber ein französisches Linienschiff brachte es auf mindestens neunhundertsechzig Pfund. Von Ebenbürtigkeit konnte da keine Rede mehr sein, und es wäre keine Schande gewesen, hätte Griffiths jetzt abdrehen lassen und Fersengeld gegeben. Doch da war noch ihr Begleitschiff, die starke Fregatte Dee mit ihren achtunddreißig Achtzehnpfündern, irgendwo hinter ihnen auf der dunstigen See. Im letzten Sturm hatte sie eine Maststenge verloren und dadurch an Fahrt eingebüßt, aber bei Einbruch der Nacht war sie noch gut in Sicht gewesen und hatte auch Kapitän Griffiths’ Signal bestätigt, mit dem er die Verfolgung des fremden Schiffes befohlen hatte. Denn Kapitän Griffiths war der ranghöhere Kommandant.
Der Bewaffnung nach waren selbst beide Fregatten zusammen einem Linienschiff noch immer weit unterlegen, dennoch stand außer Zweifel, dass sie den Kampf aufnehmen konnten: Der Franzose würde mit seiner Breitseite auf die eine Fregatte feuern und sie mit Sicherheit schrecklich verwüsten, aber die zweite konnte sich vor seinen Bug oder sein Heck legen und ihn der Länge nach beharken: mit einem mörderischen Kugelhagel durch all seine Decks, dem er fast nichts entgegenzusetzen hatte. Das war zu schaffen, wie andere zuvor bewiesen hatten: 1797 beispielsweise hatten die britischen Fregatten Indefatigable und Amazon einen französischen Vierundsiebziger vernichtet. Andererseits hatten es die beiden Fregatten zusammen auf achtzig lange Kanonen gebracht und die Droits de l’Homme hatte damals wegen des rauen Seegangs ihre unteren Stückpforten nicht öffnen können. Jetzt aber lief nur ein leichter Schwell, und um den Franzosen zu besiegen, hätte ihn die Charwell von Brest abschneiden und ihn längere Zeit ins Gefecht verwickeln müssen. Aber wie lange?
»Mr Howell«, befahl der Kommandant, »nehmen Sie ein Fernglas mit in den Masttopp, und berichten Sie, was von der Dee zu sehen ist.«
Der langbeinige Kadett war schon halb die Besanwanten hochgeklettert, bevor der Kommandant zu Ende gesprochen hatte, und sein »Aye-aye, Sir« klang gedämpft durch den Regen herab. Eine dunkle Schauerbö peitschte das Deck mit ihren Güssen, sodass die Männer auf dem Achterdeck kaum das Vorschiff erkennen konnten und ganze Wasserfälle durch die Speigatten außenbords rauschten. Dann war’s vorbei, und im folgenden fahlen Morgenlicht erscholl von oben der Ruf: »An Deck, Sir. Die Dee steht in Lee querab, mit dem Rumpf über der Kimm. Sie hat ihren Mast geschient …«
»Das reicht«, sagte der Kommandant laut in neutralem Ton. »Mr Barr zu mir.«
Der Dritte Offizier kam von seiner Gefechtsstation herbeigeeilt. Der Wind griff unter seinen regenschweren Wachmantel, als er das Achterdeck betrat, und er reagierte unwillkürlich: Eine Hand bändigte die knatternden Mantelschöße, die andere hielt den Hut fest.
»Nehmen Sie ihn ab, Sir«, rief Kapitän Griffiths, vor Zorn errötend. »Nehmen Sie sofort den Hut ab! Sie kennen Lord St Vincents Befehl – Sie haben ihn alle gelesen – und wissen, wie Sie zu grüßen haben …« Griffiths klappte den Mund zu. »Wann wechselt die Tide?«, fragte er.
»Bitte um Vergebung, Sir«, sagte Barr. »Um zehn Minuten nach acht Uhr, Sir. Stillwasser ist fast vorbei, Sir, wenn Sie gestatten.«
Kapitän Griffiths grunzte und wandte sich dem an Deck zurückgekehrten Kadetten zu. »Ihr Bericht, Mr Howell?«
»Die Dee hat ihre Großmaststenge geschient, Sir«, berichtete der barhäuptige Kadett, der seinen Kommandanten um Haupteslänge überragte. »Und sie ist gerade höher an den Wind gegangen.«
Der Kommandant richtete sein Teleskop auf die zweite Fregatte, deren Bramsegel nun deutlich über dem wie ein Sägeblatt gezahnten Horizont zu erkennen waren; wenn sich beide Schiffe gleichzeitig auf einen Wellenkamm hoben, konnte man schon ihre Marssegel sehen. Griffiths wischte die Linse trocken, starrte nochmals hindurch, fuhr zu dem Franzosen herum, schob das Teleskop mit einem Klicken zusammen und warf noch einen letzten Blick auf seinen fernen Begleiter. Der Kommandant stand allein an der Reling, allein auf der geheiligten Steuerbordseite seines Achterdecks, während die Offiziere von Zeit zu Zeit, wenn sie nicht nach dem Feind oder der Dee ausspähten, verstohlen seinen Rücken musterten.
Die Situation war immer noch in Fluss, war eher eine Möglichkeit als eine Ausgangslage. Aber jede Entscheidung würde sie jetzt erstarren lassen, und sobald sich die Lage verfestigte, mussten die nächsten Ereignisse zwangsläufig ablaufen, zuerst langsam und unentrinnbar, dann immer rasanter, ihrem unwiderruflichen Ende entgegen. Und eine Entscheidung musste jetzt getroffen werden, musste unverzüglich getroffen werden, denn die Charwell würde bei ihrem augenblicklichen Tempo in weniger als zehn Minuten in Schussweite des Zweideckers sein. Dabei gab es so viele Faktoren zu berücksichtigen … Die Dee war hoch am Wind kein besonders guter Segler; auch würde die neue Gezeit sie behindern, denn der Tidenstrom setzte genau quer zu ihrem Kurs; vielleicht musste sie sogar noch eine Wende fahren. Binnen einer halben Stunde konnte der Franzose mit seinen Sechsunddreißigpfündern die Charwell zerfleischen, sie entmasten und als Beute nach Brest abschleppen – der Wind stand günstig für Brest.
Warum war kein einziges Schiff des britischen Blockadegeschwaders in Sicht? Es konnte doch nicht versprengt worden sein, nicht von diesem Wind. Das alles war schon sehr merkwürdig. Verdammt merkwürdig sogar, angefangen mit dem seltsamen Verhalten des Franzosen. Immerhin würde das Krachen der Kanonen das britische Geschwader herbeirufen … Also Verzögerungstaktik …
Kapitän Griffiths spürte die gespannten Blicke in seinem Rücken, und sie erzürnten ihn. Es waren ungewöhnlich viele Blicke, denn auf der Charwell fuhren mehrere Offiziere und einige Zivilisten als Passagiere mit, die eine Gruppe seit Gibraltar und die andere schon seit Trinidad. Der Feuerfresser General Paget gehörte dazu, ein einflussreicher Mann; ein anderer war Kapitänleutnant Aubrey, Lucky Jack Aubrey, der vor Kurzem mit seiner Vierzehn-Kanonen-Brigg Sophie eine spanische Schebeckenfregatte von sechsunddreißig Kanonen erobert hatte, die Cacafuego; damit hatte er der ganzen Flotte monatelang Gesprächsstoff geliefert.
All das belastete Griffiths bei seiner Entscheidungsfindung.
Kapitänleutnant Aubrey stand neben der achtersten Karronade an Backbord und hatte eine geistesabwesende, ausdruckslose Miene aufgesetzt. Bei seiner Größe konnte er von dort die Lage gut überblicken, wie sie sich ihm in dem fließenden Dreieck der drei Schiffe darstellte, dessen Seiten sich rapide verschoben. Dicht neben ihm standen zwei kleinere Gestalten: sein früherer Schiffsarzt auf der Sophie, Dr. Maturin, und ein Mann ganz in Schwarz – schwarze Hose, schwarzer Hut, flatternder schwarzer Umhang –, ein Mann, dem die Profession Geheimagent förmlich auf die schmale Stirn geschrieben stand. Oder vielmehr, aus Platzmangel, eher das Wort Spion. Sie verständigten sich in einer Sprache, die manche der Umstehenden für Latein hielten. Es war ein lebhaftes Gespräch. Jack Aubrey, der Kapitän Griffiths’ wütenden Blick aufgefangen hatte, beugte sich zum Ohr seines Freundes hinab und flüsterte: »Stephen, möchtest du nicht unter Deck gehen? Gewiss wirst du jetzt gleich im Lazarett gebraucht.«
Kapitän Griffiths wandte sich an der Reling um und sagte mit erzwungener Ruhe: »Mr Berry, machen Sie folgendes Signal: Ich beabsichtige …«
In diesem Augenblick gab das französische Linienschiff einen Kanonenschuss ab, dem drei Blaufeuer folgten: Zischend sprühten sie ihr geisterhaftes Licht in den grauen Morgen. Noch bevor die letzten Funken nach Lee davongeweht waren, schoss eine Reihe Raketen in die Höhe: ein bleiches, einsames Guy-Fawkes-Feuerwerk auf hoher See.
Was zum Teufel will er damit sagen?, fragte sich Jack Aubrey mit schmalen Augen, und das verwunderte Gemurmel an Deck der Fregatte spiegelte seine eigene Verblüffung.
»An Deck!«, brüllte der Ausguck im Fockmast. »Ein Kutter kommt aus ihrem Windschatten gepullt!«
Kapitän Griffiths’ Teleskop schwang herum. »Gei auf Untersegel!«, rief er, und als die Geitaue Fock und Großsegel wie Vorhänge nach oben rafften, bekam er freie Sicht auf den Kutter, einen englischen Kutter, der jetzt mit bretthartem Gaffelsegel schnell Fahrt aufnahm und über die graue See auf die Fregatte zustrebte.
»Den Kutter auffassen!«, befahl Griffiths. »Mr Bowes, einen Schuss vor seinen Bug.«
Endlich, nach den langen Stunden erstarrten Wartens in Kälte und Regen, prasselten die Befehle. Ein Zwölfpfünder wurde sorgsam ausgerichtet, dann krachte der Schuss; kleine, beißende Rauchwirbel trieben mit dem Wind davon, und die Jubelrufe der Besatzung begleiteten die Kugel auf ihrem Flug quer vor dem Bug des Kutters vorbei. Aber von dort kam als Antwort nur ähnlicher Jubel. Hüte wurden geschwenkt, während die beiden Fahrzeuge mit der kombinierten Fahrt von fünfzehn Knoten aufeinander zupreschten.
Der schnell und geschickt manövrierende Kutter – sicherlich ein Schmugglerboot – drehte in Lee der Charwell bei, verlor an Fahrt und lag schließlich so gelassen in der See wie eine Möwe, mit den Wellen auf und ab tanzend. Eine Reihe braun gebrannter, schlauer Gesichter grinste zu den Kanonen der Fregatte herauf.
Binnen zweier Minuten hätte ich ein halbes Dutzend erstklassiger Seeleute aus diesem Kutter gepresst, sagte sich Jack, während Kapitän Griffiths den Bootsführer über das trennende Wasser hin anrief.
»Kommen Sie an Bord«, knurrte er schließlich misstrauisch, und nach einigem Segelschlagen und Abhalten, nach vielem »Sinnig-sinnig«-Geschrei und: »Pass doch auf, du Idiot!« kam schließlich der Segelmeister mit einem Bündel unterm Arm die Jakobsleiter hochgeklettert. Behände flankte er über die Reling, streckte Griffiths die Hand entgegen und sagte: »Möge der Frieden Ihnen viel Freude bringen, Kapitän.«
»Frieden?«, rief Kapitän Griffiths.
»Jawohl, Sir. Dachte mir, dass Sie überrascht sein würden. Erst vor drei Tagen wurde er unterzeichnet. Kein einziges Überseeschiff außer Ihnen weiß schon Bescheid. Ich habe Stöße von Zeitungen im Kutter, aus London, Paris und den Provinzstädten – alle mit den neuesten Informationen, meine Herren«, sagte er, sich auffordernd umblickend. »Eine halbe Krone das Blatt.«
Niemand auf dem Achterdeck zweifelte an seinen Worten, nur total perplex waren die Gesichter, die ihn anstarrten. Doch von den freudestrahlenden Crews der Karronaden lief ein Flüstern das Deck entlang nach vorn, und nun brach auf dem Vorschiff der Jubel los. Trotz des reflexartigen Befehls des Kommandanten: »Notieren Sie den Namen dieses Mannes, Mr Quarles!« ebbte es bis zum Großmast zurück und breitete sich im ganzen Schiff aus: ein Freudengeheul aus voller Kehle. Es winkten Freiheit, Sicherheit, die Ehefrauen und die Herzallerliebsten, kurz, die ganze köstliche Fülle des Landes.
Kein Wunder, dass Kapitän Griffiths’ Befehl nicht sonderlich grimmig geklungen hatte. Jeder hätte bei einem Blick in seine engstehenden Augen in ihrer Tiefe eine heimliche Ekstase entdeckt. Zwar war seine Bestallung jetzt dahin, verweht mit einem Wölkchen Pulverrauch; und niemand auf Gottes weiter Erde würde jemals erfahren, welcher Art das letzte Signal war, das er hatte setzen wollen. Aber trotz der selbstauferlegten eisernen Beherrschung schwang eine ungewohnte Leutseligkeit in seinem Ton mit, als er die Passagiere, den Ersten, den Wachoffizier und den Fähnrich vom Dienst dazu einlud, an diesem Nachmittag mit ihm zu dinieren.
»Es wärmt einem das Herz, wenn man sieht, wie dankbar die Leute sind – dankbar für die Segnungen des Friedens«, sagte Stephen Maturin höflich zu Reverend Mr Hake.
»Aye, die Segnungen des Friedens. Ja, gewiss«, antwortete der Kaplan, der keinen Besitz hatte, auf den er sich zurückziehen konnte, keinerlei privates Vermögen, und der wusste, dass die Charwell gleich nach ihrem Einlaufen in Portsmouth außer Dienst gestellt werden würde. Steifen Schritts verließ er die Offiziersmesse, um sich in trübem Schweigen auf dem Achterdeck zu ergehen, und überließ Kapitänleutnant Aubrey sowie Dr. Maturin sich selbst.
»Hätte nicht gedacht, dass er’s so freudlos aufnimmt«, bemerkte Stephen Maturin.
»Es ist schon seltsam mit dir, Stephen«, meinte Jack Aubrey und musterte ihn freundschaftlich. »Du bist nun bereits eine ganze Weile auf See und bei Gott kein Narr, aber du weißt nicht mehr vom Leben eines Seemanns als ein Neugeborenes. Es kann dir doch bestimmt nicht entgangen sein, wie schweigsam Quarles, Rodgers und die anderen beim Dinner waren. Und wie bedrückt jeder in diesem Krieg reagierte, sobald ein Friedensschluss drohte?«
»Ich habe ihre Schweigsamkeit der anstrengenden Nacht zugeschrieben – der Spannung, der Wachsamkeit, dem Schlafmangel; nicht der Furcht vor Gefahren, wie ich betonen möchte. Kapitän Griffiths war jedenfalls bester Laune.«
»Oh«, sagte Jack und kniff ein Auge zu, »sein Fall liegt ja auch völlig anders. Immerhin ist er Vollkapitän und bekommt zehn Shilling am Tag. Und was auch geschieht, er rückt auf der Personalliste in dem Tempo nach oben, wie seine Vorgänger wegsterben oder zum Admiral befördert werden. Auch wenn er schon ziemlich alt ist – vierzig, würde ich sagen, wenn nicht älter –, wird er mit etwas Glück als Admiral das Zeitliche segnen. Nein, es sind die anderen, die mir leidtun, die Leutnants auf Halbsold und fast ohne Aussicht auf ein Schiff – und ohne jede Hoffnung auf Beförderung. Die armen, elenden Fähnriche, die jetzt kein Offizierspatent bekommen, von einem neuen Posten ganz zu schweigen. Ihnen bleibt nur die Handelsmarine – oder ein Schuhputzerstand vor dem St James Park. Kennst du nicht das alte Lied? Es geht so …« Er summte eine Melodie und begann dann mit leiser, diskreter Bassstimme zu singen:
»Da sagt Jan Maat: ›Frohe Botschaft! Es herrscht Frieden an Land und auf See!
Die Kanonen schweigen, wir fahr’n alle nach Hause, juchhe!‹
Sagt der Admiral: ›Was für’n Jammer!‹ Der Kapitän: ›Mir bricht das Herz.‹
Der Leutnant ruft: ›Was fang ich bloß an ohne Kurs, o Schmerz!‹
Der Doktor sagt: ›Ich bin ein feiner Mann, ein Herr von hohem Stand.
Ich geh auf den Jahrmarkt, verkauf Arznei aus erster Hand.‹
Ha, ha, Stephen, das bezieht sich auf dich. Aber weiter:
Der Fähnrich sagt: ›Hab kein Patent, hab nur die freie Wahl.
Geh zum Tor von St James und putz die Schuh allemal.
Setz mich hin Tag für Tag, bin als Wichser gar anstellig.
Frag jeden, der vorbeikommt: Wichs und Bürste gefällig?‹«
Mr Quarles spähte durch den Türspalt herein, erkannte das Lied und holte scharf Luft. Doch Jack war hier Gast und der ranghöhere Offizier – immerhin Kapitänleutnant, mit einer Epaulette auf der Schulter –, außerdem war er breitschultrig und hochgewachsen. Also stieß Mr Quarles nur seufzend die Luft aus und schloss die Tür wieder.
»Ich hätte wohl noch leiser singen sollen.« Jack rückte mit seinem Stuhl näher an den Tisch heran und fuhr gedämpft fort: »Nein, das sind die Burschen, die einen dauern können. Natürlich tu ich mir auch selber leid – ich bekomme bestimmt kein Schiff mehr, und selbst wenn, ist es mit den unabhängigen Feindeinsätzen und der Prisenjagd einstweilen vorbei. Aber im Vergleich zu ihnen geht’s mir noch gut. Wir haben ja zum Glück schönes Prisengeld gemacht. Ließe meine Beförderung nicht so verdammt lange auf sich warten, wären mir sechs Monate Landurlaub ganz lieb: Fuchsjagden und anständige Musik, vielleicht ein Opernbesuch – he, wir könnten sogar nach Wien in die Oper fahren! Was hältst du davon, Stephen? Obwohl ich zugeben muss, dass sich mir diese Warterei aufs Gemüt legt. Aber sie ist gar nichts gegen die Sorgen der anderen, außerdem bin ich ganz sicher, dass meine Angelegenheit bald geregelt wird.« Er griff zur Times und überflog noch einmal die London Gazette, nur für den Fall, dass er zuvor beim dreimaligen Durchlesen seinen Namen übersehen hatte. »Ach, reich mir lieber das Blatt dort auf der Kommode«, bat er dann und warf die Times hin. »Den Sussex Courier.«
»Ja, das klingt schon besser«, sagte er fünf Minuten später. »Hör zu, Stephen: ›Mr Saviles Meute trifft dich am Mittwoch, dem 6. November 1802, um zehn Uhr an der Kreuzung bei Champflower.‹ Oh, was hatten wir bei ihm für herrliche Jagden, als ich noch ein Junge war! Das Regiment meines Vaters kampierte damals bei Rainsford, nur sieben Meilen entfernt – großartiges Terrain, wenn man ein gutes Pferd besitzt … Oder hör dir das an: ›Repräsentativer Herrensitz, auf Kies erbaut, für ein Jahr zu günstigen Bedingungen zu verpachten.‹ Hat Stallungen für zehn, steht da.«
»Gibt’s auch Zimmer?«
»Wieso – natürlich gibt’s Zimmer, sonst wäre er ja nicht repräsentativ. Was bist du doch für ein komischer Kauz, Stephen. Nein, das Herrenhaus hat allein zehn Schlafzimmer. Sapperlot, so was wäre gar nicht übel: nicht weit von der See, und dann diese schöne Landschaft …«
»Aber wolltest du denn nicht in Woolhampton wohnen – im Haus deines Vaters?«
»Ja … ja, schon. Jedenfalls will ich ihn mal besuchen. Aber jetzt lebt dort auch meine neue Stiefmutter, musst du wissen. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir gut miteinander auskämen.« Jack schwieg und versuchte sich an den Namen des Mannes zu erinnern, der im klassischen Altertum solchen Ärger mit der zweiten Frau seines Vaters gehabt hatte. Denn General Aubrey hatte kürzlich sein Milchmädchen geheiratet, eine junge, schwarzäugige Schönheit mit feuchten Handflächen, an denen mancher Geldschein kleben blieb; Jack kannte die Kleine nur zu genau. War es Actaeon gewesen, Ajax oder Aristides? Jedenfalls war’s diesem Mann ähnlich ergangen wie ihm, und falls ihm der Name einfiel, konnte er Stephen die Lage diskret andeuten. Aber er kam nicht darauf und wandte sich nach einer Weile wieder den Anzeigen zu. »Eigentlich spricht eine Menge für ein Haus in der Nähe von Rainsford«, fuhr er fort. »Drei oder vier Meuten in Reichweite, London nur einen Tagesritt entfernt und dutzendweise repräsentative Herrensitze in der Nachbarschaft, alle trocken auf Kies erbaut. Bist du dabei, Stephen? Wir nehmen Bonden, Killick, Lewis und noch einen oder zwei alte Sophies mit, dazu ein paar von den Jungen, und machen uns ein schönes Leben. Ein Leben wie Gott in Frankreich!«
»Doch, das würde mir schon sehr behagen«, sagte Stephen. »Denn gleichgültig, was in diesen Anzeigen behauptet wird, es ist Kreidekalkland, und in den Downs gibt es ein paar seltene Pflanzen und Käfer. Ich kann es kaum erwarten, endlich einen Tauteich zu sehen.«
Polcary Down und ein kalter Himmel darüber: Ruhelos strich der Nordwind über die Salzwiesen, quer über die Furchen der höher gelegenen Äcker und schließlich über die Weiten des hügeligen Graslands oben. An dessen unterem Rand lag Rumbold’s Gorse, eine geschützte Senke. Zwischen ihrem Gestrüpp hatten sich wie rote Punkte ein Dutzend Jäger verteilt. Tief unter ihnen, etwa auf halber Höhe des Hangs, stand ein Pflüger am Ende der Furche reglos hinter seinem Gespann Sussexochsen und spähte zu Mr Saviles Hunden hinauf, die sich durch den Ginster und die braunen Reste des Adlerfarns arbeiteten.
Langsame Arbeit: eine schwache, oft unterbrochene Duftschleppe. So blieb den Fuchsjägern viel Zeit, einen Schluck aus der Hüftflasche zu nehmen, in die kalten Hände zu pusten und den Blick über die Landschaft tief unten schweifen zu lassen – über den Fluss, der sich durch das Patchwork der Felder wand, über die Zinnen und Kirchtürme von Hither, Middle, Nether und Savile Champflower, über die sechs bis sieben im Tal verteilten Herrenhäuser, über die wie Walrücken gestaffelten, rollenden Hügelkämme dahinter und schließlich über die ferne, bleigraue See.
Es war eine kleine Jagdpartie, in der fast jeder jeden kannte: ein halbes Dutzend Bauern, ein paar Privatiers aus Champflower und den umliegenden Sprengeln, zwei Milizoffiziere vom ausgedünnten Lager bei Rainsford, dazu Mr Burton, der trotz seines triefenden Schnupfens herausgekommen war, um einen Blick auf Mrs St John zu erhaschen, und nicht zuletzt Dr. Vining, der seinen Hut mit Nadeln an die Perücke gesteckt und beide festgebunden hatte, mit einem unterm Kinn geknoteten großen Sacktuch. Er hatte sich zu Beginn seiner Besuchsrunde vom rechten Pfad weglocken lassen – hatte dem Klang des Jagdhorns noch nie widerstehen können –, aber sein schlechtes Gewissen machte ihm nun zu schaffen, seit die Hunde die Fuchsfährte verloren hatten. Von Zeit zu Zeit wanderte sein Blick über die vielen Meilen frostigen Landes, flog von der Senke hinüber nach Mapes Court, wo Mrs Williams inzwischen auf ihn warten musste. Dabei fehlt ihr gar nichts, sagte er sich. Meine Behandlung ist völlig sinnlos. Aber aus christlicher Nächstenliebe sollte ich sie besuchen. Und das werde ich auch tun, falls sie die Fährte nicht wiederfinden, ehe ich bis hundert gezählt habe.
Er tastete nach seinem Puls und begann zu zählen. Bei neunzig hielt er inne, blickte sich nach Erlösung um und entdeckte am anderen Rand der Senke eine ihm unbekannte Gestalt. Das ist bestimmt der Mediziner, von dem sie mir erzählt haben, murmelte er. Aus Höflichkeit sollte ich jetzt wohl hinreiten und ein paar Worte mit ihm wechseln. Aber was für ein merkwürdiger Kauz! Meine Güte, was für ein höchst merkwürdiger Kauz!
Der merkwürdige Kauz hockte breitbeinig auf einem Maultier und bot einen in englischen Jagdgefilden wirklich ungewöhnlichen Anblick. Abgesehen von dem Maultier fiel er auch durch die Verschrobenheit seiner Person auf: schiefergraue, unsportliche Kleidung, ein bleiches Gesicht, fahle Augen in einem noch fahleren, fast glattrasierten Schädel (sein Hut war mit der Perücke am Sattel festgebunden); und dann die Art, wie er in einen Kanten Brot biss, der mit Knoblauch eingerieben war … Nun rief er auch noch mit lauter Stimme seinem Begleiter zu, in dem Dr. Vining den neuen Pächter von Melbury Lodge erkannte: »Ich kann dir sagen, was es ist, Jack! Ich kann dir jetzt sagen, was es ist.«
»Sie da, Sir – Sie auf dem Maultier!«, brüllte der greise Mr Savile wütend. »Würden Sie die vermaledeiten Hunde endlich ihre Arbeit machen lassen? He, he – wo sind wir denn, in einem gottverdammten Kaffeehaus? Tun Sie mir die Liebe – wir sind doch kein infernalischer Debattierklub!«
Captain Aubrey machte ein zerknirschtes Gesicht und trieb sein Pferd die zwanzig Meter zu Dr. Maturin hinüber. »Sag’s mir später, Stephen«, knurrte er und drängte seinen Freund zur anderen Seite der Senke, wo sie außer Sicht des Masters waren. »Sag’s mir später, wenn die ihren Fuchs gefunden haben.«
Die Zerknirschung passte schlecht zu Jack Aubreys rotem Gesicht, das bei diesem Wetter die Farbe seines Jagdrocks angenommen hatte; und sowie sie auf der anderen Seite waren, in Lee eines vom Wind verkrüppelten Weißdornbuschs, gewann es auch seinen gewohnt heiteren Ausdruck zurück. Gespannt spähte Jack zu dem Ginsterdickicht hinauf, in dem ein gelegentliches Rascheln und Schwanken das Stöbern der Foxhoundmeute verriet.
»Ach, sie suchen nach einem Fuchs?«, fragte Stephen Maturin so erstaunt, als seien etwa Einhörner die übliche Jagdbeute in England; danach versank er wieder in düsteres Grübeln und kaute zerstreut an seinem Brot.
Der Wind streichelte die weitläufigen Hänge; hohe Wolken zogen stetig über den Himmel. Hin und wieder spitzte Jacks großer Brauner die Ohren, ein starkknochiges Tier, erst kürzlich erworben, das mit Jacks hundert Kilo spielend fertig wurde. Aber es liebte die Jagd nicht sonderlich und trauerte wie mancher Wallach seiner verlorenen Männlichkeit nach: ein unzufriedenes Pferd. Hätten die Anfälle von Übellaunigkeit, die in seinem Kopf einander folgten, die Form von Worten angenommen, hätten seine Gedanken ungefähr so gelautet: Zu schwer – sitzt zu weit vorn, wenn wir einen Zaun überspringen – hab ihn für einen Tag jetzt weit genug getragen – gleich werf ich ihn ab, wirst schon sehen … Ich rieche eine Stute. Eine Stute! Seine geblähten Nüstern zitterten, und er begann zu stampfen.
Jack blickte sich um und gewahrte zwei Neuankömmlinge. Eine junge Frau trabte mit ihrem Groom auf dem Feldrain zu ihnen herauf; der Groom ritt einen Isländer und die junge Frau eine hübsche kleine kastanienbraune Vollblutstute. Als sie den Zaun erreichten, der das Brachland von den Feldern trennte, galoppierte der Pferdeknecht zu einem offenen Gatter, aber die junge Frau versammelte ihre Stute und sprang sauber hinüber, gerade als ein Winseln in der Senke, gefolgt von einem gellenden Aufheulen, Vielversprechendes ankündigte.
Das Jaulen verstummte; ein junger Hund rannte ins Freie und starrte perplex um sich. Stephen Maturin bewegte sich ein Stück hinter dem dichten Dornbusch hervor, um mit Blicken dem Flug eines Falken zu folgen. Beim Anblick seines Maultiers begann die kastanienbraune Stute zu tänzeln, ließ ihre weißen Fesseln blitzen und warf den Kopf.
»Verschwinde, du –«, sagte die Frau mit reiner heller, junger Stimme.
Jack, der dieses Schimpfwort noch nie aus dem Mund einer Dame gehört hatte, drehte sich um und musterte die Reiterin mit neuerwachtem Interesse. Sie war vollauf damit beschäftigt, ihr scheuendes Pferd zu beruhigen, fing aber nach einer Weile seinen Blick auf und runzelte die Stirn. Lächelnd blickte er weg, denn sie war das Hübscheste, was er je gesehen hatte – sogar eine kleine Schönheit mit ihren lebhaften Farben und dem geraden, eleganten Rücken; im Sattel saß sie mit der unbewussten Grazie eines Kadetten an der Pinne bei hohem Seegang. Schwarze Haare, blaue Augen und ein Rutsch-mir-doch-Gehabe, das bei einem so zerbrechlichen Wesen leicht komisch und entschieden rührend wirkte. Sie trug einen schäbigen blauen Jagdrock mit weißen Aufschlägen und Stulpen, der an die Uniform eines Marineleutnants erinnerte, und als Krönung einen verwegenen Dreispitz mit Straußenfeder. Einfallsreich hatte sie ihr Haar – wahrscheinlich mit Steckkämmen – so unter dem Hut aufgetürmt, dass ein Ohr frei blieb. Und dieses wunderhübsche Ohr war, wie Jack feststellte, als die Stute im Traversgang auf ihn zutänzelte, so rosafarben wie …
»Da ist ja besagter Fuchs«, bemerkte Stephen beiläufig. »Da ist ja der Fuchs, von dem alle reden. Obwohl es in Wahrheit eine Fähe ist, würde ich sagen.«
Tief geduckt einer Bodenfalte folgend, schnürte der rostbraune Fuchs an ihnen vorbei auf die Äcker zu. Die Ohren der Pferde und des Maultiers richteten sich auf wie Semaphorenarme und folgten ihm. Sowie der Fuchs einen guten Vorsprung hatte, stellte sich Jack in die Steigbügel, riss den Hut vom Kopf und stieß mit seiner Hochseestimme einen Alarmruf aus, der den Hornisten herumfahren und losposaunen ließ, während die Hunde von allen Seiten aus dem Ginster brachen. In der windgeschützten Furche nahmen sie sofort die Witterung auf und hetzten mit lautem Geläut hinter dem Fuchs her. In breitem Strom unterliefen sie den Zaun, ergossen sich über die noch ungepflügten Stoppeläcker, eine dichte, braun-weiße Masse – welch köstliche Musik! –, und der Hornist galoppierte hinterher. Donnernd kam das Feld um die Senke gebogen, jemand riss das Gatter auf, und im nächsten Moment drängelten sich die Reiter ungeduldig an diesem Engpass, denn bergab über den Zaun zu springen wäre teuflisch riskant gewesen.
Jack hielt sich zunächst zurück, setzte mit neuem Pferd und in unbekanntem Terrain lieber nicht alles auf eine Karte, aber sein Herz schlug zum Gefecht, doppelt so schnell wie sonst, und er hatte sich bereits die Falllinie ausgesucht, der er folgen wollte, sobald das Feld dünner wurde. Er war ein leidenschaftlicher Parforcejäger und liebte alles an der Jagd, vom ersten Ton des Horns bis zum ranzigen Gestank des zerrissenen Fuchses. Aber trotz einiger verhasster Intervalle ohne Schiff hatte er zwei Drittel seines Lebens auf See verbracht und war im Sattel nicht so versiert, wie er dachte.
Das Gatter war immer noch verstopft – dort kam keiner durch, ehe die Meute nicht das nächste Feld erreicht hatte. Jack riss sein Pferd herum, rief: »Los, Stephen!« und galoppierte auf den Zaun zu. Aus dem Augenwinkel sah er einen kastanienbraunen Blitz zwischen seinem Freund und dem Gedränge am Gatter durchschießen. Als sein Pferd abhob, drehte er sich leicht, um zu sehen, wie die Reiterin das Hindernis bewältigte, und sein Wallach reagierte sofort auf diese Gewichtsverlagerung. Mit hohem weitem Sprung setzte er über den Zaun, landete aber mit gesenktem Kopf, senkte auch raffiniert eine Schulter, half mit einem Heben des Hinterteils nach und hatte seinen Reiter im nächsten Moment aus dem Sattel geworfen.
Jack fiel nicht wie ein Stein. Langsam und unrühmlich rutschte er an dieser vertrackten Pferdeschulter hinab, ein Büschel Mähnenhaare in der rechten Faust. Doch das Pferd war jetzt Herr der Lage, und nach zwanzig Metern war der Sattel leer.
Seine Genugtuung währte nicht lange. Jacks rechter Stiefel stak noch im Steigbügel und ließ sich einfach nicht abschütteln. Da hing also dieser schwergewichtige Mensch an seiner Flanke, schlug polternd auf und krümmte sich, brüllte und fluchte ganz fürchterlich. Das Pferd begann sich zu graulen, den Kopf zu verlieren, zu schnauben, die Augen zu rollen, und galoppierte immer schneller über diese dunklen, steinübersäten, tückischen Furchen.
Der pflügende Bauer ließ sein Ochsengespann stehen, rannte bergauf und fuchtelte dabei mit seinem Stachelstock. Ein großer junger Mann in grünem Rock, ein Treiber, lief mit weit ausgebreiteten Armen auf das Pferd zu, laut »He, holla!« rufend. Das Maultier am Ende des rasch entschwindenden Parforcefeldes wendete und raste zurück, um den Wallach abzufangen, wobei es unerhört dicht am Boden dahintrippelte. Es überholte die Fußtruppe, stellte sich dem Wallach in den Weg, behauptete stur seinen Platz und fing den Anprall ab. Heldenhaft warf sich Stephen aus dem Sattel, packte Jacks Zügel und umklammerte sie, bis Bauer und Treiber keuchend herbeigestolpert kamen.
Das Ochsengespann, auf halber Furche überraschend sich selbst überlassen, brachte die ganze Aufregung so in Wallung, dass es kurz davorstand, seinerseits ein paar Kapriolen zu versuchen. Aber ehe es sich dazu durchgerungen hatte, war schon alles vorbei. Der Bauer führte das beschämte Pferd zum Feldrain, gefolgt von den beiden anderen Helfern, die Jacks schmerzende Knochen und blutigen Kopf in die Mitte nahmen und ernsthaft seinen Erklärungen lauschten. Das Maultier bildete den Schluss.
Mapes Court war eine Hochburg der Frauen – seine Mauern beherbergten keinen einzigen Mann, vom Butler und dem Groom einmal abgesehen. Mrs Williams war eine Frau, biologisch gesehen. Aber darüber hinaus war sie so begeistert weiblich, so durch und durch Frau, dass sie fast keine anderen typischen Wesenszüge aufwies. Außerdem war sie vulgär, obwohl ihre alteingesessene Familie einiges Gewicht in der Nachbarschaft besaß und seit Dutch Williams’ Zeiten hier lebte.
Nur schwer erkennen ließ sich eine Verbindung, eine Familienähnlichkeit, zwischen ihr, ihren Töchtern und ihrer Nichte, welche die Familie vervollständigte. Überhaupt spielte Ähnlichkeit in diesem Haus keine große Rolle, und die vergilbten Familienporträts hätten ebenso gut auf verschiedenen Auktionen erworben sein können. Obwohl die drei Töchter gemeinsam aufgewachsen waren, erzogen von denselben Menschen, umgeben vom gleichen, angestrengt vornehmen Milieu, in dem Geld und ein hoher Stand angebetet und moralische Entrüstung verbreitet wurden – eine Entrüstung, die keines speziellen Objekts bedurfte, sondern latent stets vorhanden war; ein Hausmädchen, das sonntags Silberschnallen trug, konnte schon eine Woche lang Entrüstung auslösen –, trotz all dieser Gemeinsamkeiten waren die drei Töchter nach Charakter und Geist ebenso verschieden wie in ihrem Äußeren.
Sophia, die Älteste, war hochgewachsen, hatte graue, weit auseinanderliegende Augen, eine hohe glatte Stirn, feines goldenes Haar, einen makellosen Teint und ein bezauberndes Wesen. In ihrem Benehmen eher zurückhaltend, schien sie in einer privaten Traumwelt zu leben, zu der sie niemandem Zugang gewährte. Vielleicht lag es an der skrupellosen Selbstgerechtigkeit ihrer Mutter, dass sie von klein auf ein Leben als Erwachsene verabscheute. Jedenfalls wirkte sie sehr jung für ihre siebenundzwanzig Jahre. Aber ihre Mädchenhaftigkeit war nicht im Geringsten affektiert oder kindisch, sondern hatte eher etwas Ätherisches, die Aura einer Opferpriesterin: Iphigenie vor dem enthüllenden Brief. Sophias gutes Aussehen wurde von allen bewundert. Elegant wirkte sie immer, und wenn sie bei Laune und Gesundheit war, konnte man sie eine Schönheit nennen. Sie sprach wenig, ob in Gesellschaft oder privat, und doch war sie fähig zu überraschenden Äußerungen von solch scharfer Intelligenz und tiefer Nachdenklichkeit, wie sie bei ihrer lückenhaften Erziehung und dem ruhigen Leben in der Provinz niemand von ihr erwartet hätte. Diese Äußerungen erzielten umso stärkere Wirkung, als sie aus einer liebenswerten, anschmiegsamen und mitunter schläfrigen Zurückhaltung hervorbrachen, und hatten schon oft Männer aufgeschreckt, die Sophia nicht sonderlich gut kannten – Männer, die im glücklichen Bewusstsein ihrer Überlegenheit hemmungslos dahergeschwätzt hatten. Vage erahnten sie in ihr eine verborgene Kraft und brachten diese in Verbindung mit ihrem gelegentlichen Ausdruck heimlicher Belustigung und stillen Amüsements über einen Anlass, den sie mit keinem zu teilen gedachte.
Cecilia ähnelte mehr ihrer Mutter: ein Gänschen mit rundem Gesicht und porzellanblauen Augen, das auf Schmuck und Dekoration versessen war und ihr gelbes Haar mit der Brennschere kräuselte – oberflächlich und albern bis fast zur Dämlichkeit, aber fröhlich, voll lärmender Heiterkeit und noch ohne jede Spur von Gehässigkeit. Männergesellschaft liebte sie über alles, mochte Männer in jeder Form und Größe. Die jüngste Schwester, Frances, war das genaue Gegenteil: gleichgültig gegenüber jeder männlichen Bewunderung. Eine langbeinige Nymphe, pfiff sie gern wie ein Junge und warf mit Steinen nach den Eichhörnchen im Nussbaum. Sie besaß noch die ganze Erbarmungslosigkeit der Jugend. Und sie war restlos hinreißend – als Erscheinung an sich. Sie hatte das gleiche schwarze Haar wie ihre Cousine Diana und dazu große dunkelblaue Augen, zwei tiefe, verschleierte Teiche. Ihren Schwestern glich sie so wenig, als gehörten sie verschiedenen Geschlechtern an. Gemeinsam war allen dreien nur die jugendliche Grazie, ein gerüttelt’ Maß Frohsinn, makellose Gesundheit und zehntausend Pfund Mitgift pro Kopf.
Bei so vielen Vorzügen verwunderte es, dass noch keine der Schwestern verheiratet war, zumal das Ehebett in ihrer Mutter Gedanken stets den ersten Platz einnahm. Doch der Mangel an standesgemäßen Junggesellen in der Nachbarschaft, die Verwerfungen des zehnjährigen Krieges und Sophias Scheu vor der Ehe (sie hatte mehrere Anträge abgelehnt) waren einige der Gründe dafür. Die anderen waren Mrs Williams’ Gier nach einem vorteilhaften Ehevertrag und die Abneigung der meisten geeigneten Kandidaten, sie als Schwiegermutter zu akzeptieren.
Ob Mrs Williams ihre Töchter überhaupt liebte, war fraglich. Natürlich vergötterte sie sie und hatte »ihnen alles geopfert«, aber in ihrem Herzen blieb nicht viel Raum für Liebe – Selbstgerechtigkeit nahm darin den meisten Platz ein (Erkenne Deine Dienerin Mrs Williams, o Herr, die auf Erden nicht ihresgleichen hat, eine untadelige, aufrechte Frau), und den Rest beanspruchten Erschöpfung sowie die Klage über ständiges Ausgenutztwerden. Dr. Vining, der sie von klein auf kannte und alle ihre Kinder zur Welt gebracht hatte, bestritt, dass sie sie liebte. Aber selbst er, der Mrs Williams gründlich verabscheute, musste zugeben, dass ihr nichts so sehr am Herzen lag wie das materielle Wohlergehen ihrer Töchter. Sie mochte ihre keimende Kreativität ersticken, mochte das ganze Jahr graue Missbilligung versprühen, konnte ihnen sogar die Geburtstage mit hartnäckigen Anfällen von Migräne verderben –, aber sie kämpfte wie eine Tigerin gegen andere Eltern, gegen Treuhänder und Anwälte, um ihnen eine »angemessene Versorgung« zu sichern.
Trotzdem blieben ihre Töchter nach wie vor unverheiratet, was sie tröstlicherweise auf die Tatsache zurückführen konnte, dass ihre Nichte alle drei in den Schatten stellte. Und in der Tat sah diese Nichte – Diana Villiers – auf eine ganz andere Art ebenso gut aus wie Sophia. Dabei waren die beiden völlig verschieden. Diana wirkte mit ihrem geraden Rücken und der stolzen Kopfhaltung recht hochgewachsen, aber wenn sie neben ihrer Cousine stand, reichte sie ihr nur bis zum Kinn. Beide besaßen ein Höchstmaß an natürlicher Grazie, doch während sich Sophia mit einer biegsamen, fließenden, ja fast trägen Anmut bewegte, lebte Diana nach einem temperamentvollen, blitzschnellen inneren Rhythmus. Wenn, was recht selten vorkam, in der Umgebung von Mapes Court ein Ball stattfand, brillierte sie als Tänzerin, und bei Kerzenlicht wirkte ihr Teint fast ebenso makellos wie der Sophias.
Mrs Villiers war bereits Witwe. Obwohl im selben Jahr geboren wie Sophia, hätte ihrer beider Leben nicht unterschiedlicher verlaufen können. Nach dem Tod ihrer Mutter war sie, erst fünfzehn Jahre alt, nach Indien gegangen, um ihrem liederlichen, verschwenderischen Vater den Haushalt zu führen, und hatte dort auch nach ihrer Hochzeit mit einem einstweilen mittellosen jungen Mann auf großem Fuß gelebt. Der Gatte, ihres Vaters Adjutant, zog einfach mit in ihren prunkvollen Palast, der so weitläufig war, dass ein Schwiegersohn und ein Dutzend zusätzlicher Diener nicht weiter auffielen.
Von der emotionalen Konstellation her war es eine übereilte, unkluge Heirat gewesen – zwei starke, eigenwillige, allzu leidenschaftliche Charaktere und so gegensätzlich, dass sie bald nichts mehr gemeinsam hatten außer dem Trieb, einander zu zerfleischen –, doch vom gesellschaftlichen Standpunkt hatte vieles dafürgesprochen. Die Heirat brachte Diana einen gut aussehenden Mann ein, außerdem winkten ihr ein Landsitz mit Wildpark und zehntausend Pfund Apanage im Jahr, denn Charles Villiers kam nicht nur aus wohlhabender Familie (lediglich ein kränklicher Verwandter trennte ihn von einem großen Erbe), sondern war auch intelligent, kultiviert, skrupellos und sehr aktiv – ein begabtes politisches Talent: wie gemacht für eine große Karriere in Indien und spätestens mit Anfang dreißig ein reicher Mann. Vielleicht sogar ein zweiter Clive. Doch beide fielen im Feldzug gegen Tippu Sahib, Dianas Vater mit dreihunderttausend Rupien Schulden und ihr Ehemann mit halb so viel.
Die Ostindische Handelskompanie zahlte Diana die Schiffspassage nach England und jährlich fünfzig Pfund Rente bis zur Wiederverheiratung. So kehrte sie heim mit Schränken voller Tropenkleidung, einer gewissen Lebenserfahrung und mit wenig sonst. Sie kehrte heim zu einem Leben im Schulzimmer oder etwas Ähnlichem. Und sie begriff sofort, dass ihre Tante eisern entschlossen war, sie zu unterdrücken und klein zu halten, damit sie niemals, niemals die Chancen ihrer Töchter beeinträchtigen konnte. Aber weil Diana weder Geld noch eine andere Zuflucht besaß, beschloss sie, sich in diese enge, gemächliche Welt der englischen Provinz zu fügen und sich abzufinden mit ihren starren Ansichten und seltsamen Moralbegriffen.
Sie beabsichtigte, ja, sie war gezwungen, einen Beschützer zu finden, und fasste gleich zu Beginn den Entschluss, sich demütig, vorsichtig und zurückhaltend zu geben. Ihr war klar, dass andere Frauen sie als Bedrohung empfinden mussten, deshalb enthielt sie sich bewusst jeder Provokation. Und doch konnte sie manchmal Theorie und Praxis nicht ganz vereinbaren, denn Mrs Williams fasste Fürsorge als totale Vereinnahmung auf. Sie fürchtete sich vor Diana und wagte nicht, sie zum Äußersten zu treiben, versuchte jedoch unaufhörlich, eine moralische Überlegenheit zu etablieren. Es war überraschend, wie es diese im Grunde dumme Frau, die sich weder aus ethischen Grundsätzen noch aus Ehrgefühl Zügel anlegte, immer wieder schaffte, ihre Nadeln dort einzustechen, wo es am meisten schmerzte.
Das ging nun schon jahrelang so, und Dianas heimliche oder zumindest unangekündigte Ausflüge mit Mr Saviles Meute dienten nicht nur dem Zweck, ihre Lust am Reiten zu befriedigen. Bei der Rückkehr traf sie in der Halle auf ihre Cousine Cecilia, die ins Frühstückszimmer eilte, um dort ihre neue Schutenhaube im Wandspiegel zu bewundern.
»Du siehst aus wie der Antichrist mit diesem sündigen Hut«, sagte Diana finster, denn die Meute hatte den Fuchs verloren, und der einzige halbwegs stattliche Mann war spurlos verschwunden.
»Oh! Oh!«, rief Cecilia. »Wie kannst du nur so was Grässliches sagen! Das ist gewiss eine Gotteslästerung. Seit Jemmy Blagrove mir dieses schlimme Wort nachrief, hat niemand so was Schreckliches zu mir gesagt. Ich werd’s Mama erzählen.«
»Sei keine Närrin, Cissy. Es war ein Zitat – ein literarisches Zitat – aus der Bibel.«
»Ach. Trotzdem, ich finde es höchst schockierend. Du bist von oben bis unten voller Schlamm, Di. Oh, und du hast einfach meinen Dreispitz genommen – die Feder ist bestimmt ruiniert. Ach, was bist du doch für ein böses Ding. Ich werd’s Mama sagen.« Cecilia riss den Hut an sich, fand ihn unbeschädigt und fuhr etwas umgänglicher fort: »Du warst also ausreiten und hast dich schmutzig gemacht. Wahrscheinlich bist du wieder die Gallipot Lane entlanggeritten. Hast du was von der Fuchsjagd gesehen? Sie haben sich den ganzen Morgen oben auf Polcary herumgetrieben, mit diesem scheußlichen Geheul und Gekläff.«
»Ja, ich habe sie in der Ferne gesehen«, antwortete Diana.
»Mit deinem schrecklichen Wort über Christus hast du mich so erschreckt«, Cecilia blies auf die Straußenfeder, »dass ich die Neuigkeiten fast vergessen hätte: Der Admiral ist wieder da!«
»Schon?«
»Ja. Und er kommt uns heute Nachmittag besuchen. Er hat Ned herübergeschickt, mit einer Empfehlung und der Anfrage, ob er Mamas Zephyrwolle nach dem Essen vorbeibringen darf. So ein Spaß! Er hat uns gewiss eine Menge zu erzählen, vor allem von diesen wunderschönen jungen Männern. Männer, Diana!«
Die Familie hatte sich kaum zum Tee versammelt, als Admiral Haddock eintrat. Er war nur ein »gelber« Admiral und pensioniert worden, bevor er seine eigene Flagge über einem Schiff hissen konnte – eigentlich hatte er seit 1794 keinen Fuß mehr aufs Wasser gesetzt –, aber er verkörperte ihre einzige Autorität in Marinedingen und war schmerzlich vermisst worden, seit Captain Aubrey von der Royal Navy so unvermutet in der Nachbarschaft aufgetaucht war: ein Marineoffizier, der zu ihrem Einflussbereich gehörte, weil er Melbury Lodge gepachtet hatte, über den sie aber weiter nichts wussten, nur dass er Junggeselle war, weshalb sie ihn als anständige Frauen nicht allein besuchen konnten.
»Sagen Sie, Admiral«, begann Mrs Williams, sobald die Zephyrwolle halbherzig gelobt, mit gespitzten Lippen und schmalen Augen gemustert und insgeheim als unbrauchbar abgeschrieben worden war – ein Reinfall in Qualität, Farbe und Preis –, »sagen Sie doch bitte, was wissen Sie über diesen Captain Aubrey, der jetzt in Melbury Lodge wohnen soll?«
»Aubrey? Na klar«, sagte der Admiral und leckte sich mit trockener Zunge die pergamentenen Lippen. »Über den weiß ich Bescheid. Ich bin ihm zwar noch nicht begegnet, habe aber im Klub und in der Admiralität schon viel von ihm gehört. Nach meiner Rückkehr von London habe ich gleich seinen Namen in der Navyliste herausgesucht: ein junger Dachs, erst Kapitänleutnant, müssen Sie wissen …«
»Heißt das, er gibt sich fälschlich als Kapitän aus?«, rief Mrs Williams, die stets bereit war, von anderen Schlechtes zu glauben.
»Nein, nein«, sagte Admiral Haddock ungeduldig. »Wir nennen einen Kapitänleutnant immer Captain Soundso. Wirkliche Kapitäne, Seniorkapitäne, nennen wir Vollkapitän – das heißt dann, er befehligt ein Schiff sechster Klasse und größer, etwa eine Fregatte von achtundzwanzig oder zweiunddreißig Kanonen. Eben ein Vollschiff, liebe Dame.«
»Aha, so ist das.« Mrs Williams nickte weise.
»Also nur Kapitänleutnant; aber er hat sich im Mittelmeer tapfer geschlagen. Lord Keith betraute ihn mit einem Einsatz nach dem anderen, und er hauste mit dieser kleinen alten Achterkastell-Brigg, die wir 95 von den Spaniern erobert haben, wie ein Wolf unter der feindlichen Küstenschifffahrt. Es gab Zeiten, da war fast die ganze Lazaretto-Reede in Mahón mit seinen Prisen voll – Lucky Jack Aubrey nannten sie ihn. Er muss dabei ein hübsches Sümmchen gemacht haben, ein sehr hübsches Sümmchen. Er war’s auch, der die Cacafuego erobert hat. Genau dieser Jack Aubrey«, sagte der Admiral und blickte triumphierend in die Runde begriffsstutziger Gesichter. Als es den Damen selbst nach einer Denkpause noch nicht dämmerte, schüttelte er über so viel Dummheit den Kopf und fragte: »Soll das heißen, Sie haben noch nie von diesem Gefecht gehört?«
Nein, hatten sie nicht – bedauerlicherweise. War das Gefecht mit der Cacafuego etwas wie die Schlacht bei Saint Vincent? Vielleicht hatte es gerade stattgefunden, als sie so sehr mit der Erdbeerernte beschäftigt waren; zweihundert Gläser hatten sie eingemacht.
»Na denn: Die Cacafuego war eine spanische Schebeckenfregatte von zweiunddreißig Kanonen, und Aubrey griff sie mit seiner kleinen Vierzehn-Kanonen-Slup an, zwang sie zur Kapitulation und brachte sie nach Menorca. Was für ein Gefecht! Es war Tagesgespräch in der Marine. Und wenn es nicht diese juristischen Winkelzüge mit ihren Papieren gegeben hätte, weil sie von ein paar Kaufleuten aus Barcelona gechartert und nicht von ihrem regulären Kommandanten befehligt war – damit galt sie zu dem Zeitpunkt als Freibeuter, nicht als Kriegsschiff –, wäre Aubrey sofort zum Vollkapitän befördert und vielleicht sogar geadelt worden; jedenfalls hätte er das Kommando über sie bekommen. Aber wie die Dinge lagen – äußerst verwickelt wegen gewisser Intrigen, von denen ich Ihnen lieber ein andermal erzähle, sie sind unpassend für die Ohren junger Damen –, wurde sie von der Kriegsmarine nicht angekauft. Und auf seine Beförderung wartet Aubrey immer noch, wird sie vielleicht nie kriegen. Sicher, er ist ein tollwütiger, geifernder Tory – sein Vater ist’s jedenfalls –, trotzdem bleibt’s eine Schande. Er mag nicht ganz oberste Kiste sein, aber ich habe vor, ihm die Ehre zu erweisen und ihn morgen zu besuchen – schließlich besitze ich ein Gespür für Tapferkeit. Und für Ungerechtigkeit.«
»Also nicht ganz oberste Kiste, Sir?«, fragte Cecilia.
»Tja, das nicht gerade, meine Liebe. Nicht ganz hoffähig, heißt es. Draufgängerisch soll er ja sein und ist es wohl auch – aber diszipliniert? Bah! Das ist der Haken bei so vielen eurer jungen Burschen, deshalb kommen sie nicht weiter. Nicht bei St Vincent. Es gab viele Klagen über seinen Mangel an Disziplin – seine Ungebärdigkeit – seinen Ungehorsam. Keine Zukunft in der Marine für diese Sorte Offizier, schon gar nicht, seit St Vincent an ihrer Spitze steht. Außerdem fürchte ich, dass er’s mit dem Fünften Gebot nicht so ernst nimmt, wie er sollte.« Die Mädchengesichter bekamen einen nach innen gekehrten Ausdruck, während sie im Geiste die Zehn Gebote aufsagten. Bei der einen früher, der anderen später – je nach dem Grad ihrer Intelligenz – erschien ein leichtes Stirnrunzeln, als sie zur Heiligung des Sabbats kamen, und dann hellten sich die Mienen auf: Sie hatten das Gebot gefunden, das der Admiral meinte. »Es gab allerhand Gerede über Mrs – über die Frau seines Vorgesetzten –, und man sagt, das steckt hinter der ganzen Verzögerung. Ein schwarzes Schaf, fürchte ich. Und undiszipliniert, was noch viel schlimmer ist. Man mag ja gegen den alten Jarvie sagen, was man will, aber bei Disziplinarvergehen ist er unerbittlich. Außerdem kann er einen Tory nicht ausstehen.«
»Ist Jarvie ein maritimer Name für den Gottseibeiuns, Sir?«, fragte Cecilia.
Der Admiral rieb die trockenen Handflächen aneinander. »So nennen wir den Earl St Vincent, meine Liebe, den Ersten Seelord unserer Admiralität.«
Da von einer so hohen Autorität die Rede war, setzte Mrs Williams eine ernste, respektvolle Miene auf. Und fragte nach geziemender Pause: »Erwähnten Sie nicht vorhin Captain Aubreys Vater, Admiral?«
»Gewiss. Das ist jener General Aubrey, der solch einen Skandal auslöste, als er den Kandidaten der Whigs in Hinton auspeitschte.«
»Wie abscheulich! Aber wenn er sich’s leisten konnte, einen Parlamentsabgeordneten auszupeitschen, ist er doch bestimmt ein Mann von großem Vermögen und Einfluss?«
»Mittelprächtig, Madam, nur mittelprächtig. Ihm gehört ein bescheidenes Gut hinter Woolhampton. Mit einer hohen Hypothek darauf, wie man hört. Mein Vetter Hanmer kennt ihn gut.«
»Und Captain Aubrey ist der einzige Sohn?«
»Jawohl, Madam, bisher. Denn wie’s so geht, hat der General kürzlich ein Mädchen aus dem Dorf geheiratet. Es heißt, Aubreys neue Stiefmutter ist eine hübsche, kerngesunde junge Frau.«
»Gott, diese Verruchtheit!«, rief Mrs Williams. »Aber ich nehme doch an, dass keine große Gefahr besteht? Der General ist gewiss schon im reiferen Alter?«
»Keine Rede davon, Madam. Er kann nicht älter sein als fünfundsechzig. An Captain Aubreys Stelle wäre ich höchst beunruhigt.«
Mrs Williams’ Gesicht heiterte sich auf. »Armer Junge«, sagte sie seelenruhig. »Er hat mein Mitgefühl, muss ich gestehen.«
Der Butler räumte das Teegeschirr ab, schürte das Kaminfeuer und begann, die Kerzen anzuzünden. »Wie kurz die Abende schon werden«, seufzte Mrs Williams. »Die Wandleuchter neben der Tür brauchen wir nicht, John. Und zieh die Vorhänge an der Kordel zu! Wenn man den Stoff anfasst, leidet er, außerdem schadet es den Ringen. Und nun, Admiral, was gibt es über den zweiten neuen Bewohner von Melbury Lodge zu berichten, über Captain Aubreys guten Freund?«
»Ach, der«, sagte Admiral Haddock. »Über den weiß man nicht viel. Er war auf dieser Slup Captain Aubreys Schiffsarzt. Mir ist, als hätte ich gehört, dass er der natürliche Sohn von irgendwem ist. Nennt sich Maturin.«
»Bitte, Sir«, meldete sich Frances, »was ist ein natürlicher Sohn?«
»Tja …« Verlegen blickte der Admiral von einer zur anderen.
»Sind denn Söhne natürlicher als Töchter?«
»Pst, meine Liebe«, mahnte Mrs Williams.
»Mr Lever hat in Melbury vorbeigeschaut«, berichtete Cecilia. »Captain Aubrey war gerade in London – er scheint ja dauernd nach London zu fahren –, aber den Doktor hat Mr Lever kennengelernt und sagt, er ist ziemlich merkwürdig, ein richtig ausländischer Gentleman. Er zerteilte im Wintergarten gerade ein Pferd.«
»Wie widerlich«, sagte Mrs Williams. »Hauptsache, sie haben kaltes Wasser benutzt, um das Blut aufzuwischen. Kaltes Wasser ist das einzige Mittel gegen Blutflecken. Meinen Sie nicht auch, Admiral, dass man ihnen dringend zu kaltem Wasser raten müsste?«
»Ich wage zu behaupten, Madam, dass sie einige Erfahrung darin haben, wie man solche Flecken beseitigt«, antwortete der Admiral. »Dabei fällt mir ein«, setzte er hinzu, sich im Zimmer umblickend, »was habt ihr Mädchen doch für ein Riesenglück, zwei so propere Seeleute mit Taschen voller Geld als Nachbarn bekommen zu haben – frei Haus, praktisch an eurer Türschwelle gestrandet. Wenn eine von euch einen Ehemann will, braucht sie nur zu pfeifen, und schon kommen sie angerannt, ha, ha, ha!«
Das Späßchen des Admirals wurde schlecht aufgenommen; keine der Damen stimmte in sein Gelächter mit ein. Sophia und Diana blickten ernst vor sich hin, Cecilia warf den Kopf zurück, Frances funkelte ihn böse an, und Mrs Williams schürzte pikiert die Lippen, reckte die Nase noch höher und sann über eine scharfe Erwiderung nach.
»Wie dem auch sei«, fuhr der Admiral fort, verwundert über die plötzliche Kühle im Raum, »wenn ich’s recht bedenke, lohnt es sich doch nicht, nein, wirklich nicht. Er sagte zu Trimble, der ihm seine Schwägerin anbot, dass er sich aus Frauen ›nichts mehr macht‹. Offenbar hat er sich bei der Letzten die Finger verbrannt und will jetzt von ihnen nichts mehr wissen. Und er ist ja wirklich ein Pechvogel, ganz egal, was man sonst über ihn sagt. Da ist einmal seine verpatzte Karriere und diese teuflisch ungelegene Heirat seines Vaters, und außerdem hat die Admiralität noch ein paar neutrale Prisen von ihm in Verwahrung, um deren Anerkennung er in zweiter Instanz kämpft. Ich wette, deshalb rennt er auch dauernd nach London. Ein glückloser Mann, ohne Zweifel. Gewiss ist ihm das inzwischen selber klar geworden. Deshalb hat er ganz zu Recht jeden Gedanken ans Heiraten aufgegeben, denn dabei ist Glück ja die Hauptsache. Nein, aus Frauen macht er sich nichts.«
»Das stimmt genau«, rief Cecilia aus. »Sie haben keine einzige Frau in ihrem Haus! Mrs Burdett, die ganz zufällig bei ihnen hereingeschaut hat, und auch unsere Molly, deren Vater in der Kate direkt dahinter wohnt und alles mitbekommt – unsere Molly also sagt, es gibt dort keine einzige Frau im Haushalt. Die beiden leben nur so zusammen, mit vielen Matrosen, die sie versorgen. Gott, wie merkwürdig! Trotzdem sagt Mrs Burdett, und auf ihre scharfen Augen kann man sich verlassen, trotzdem hätten die Glasscheiben so hell geglänzt wie Diamanten, und alle Fenster- und Türrahmen seien blütenweiß gestrichen.«
»Wie können sie nur hoffen, ohne Frauen zurechtzukommen?«, fragte sich Mrs Williams. »Das ist doch ganz gewiss verbohrt und unnatürlich. Du lieber Himmel, ich hätte Hemmungen, mich in diesem Haus auch nur auf einen Stuhl zu setzen. Den würde ich aber mit dem Taschentuch vorher gut sauberwischen, das sage ich euch!«
»Wieso denn, Madam?«, protestierte der Admiral. »Auf See kommen wir Männer sehr gut allein zurecht, glauben Sie mir.«
»Na ja, auf See …« Mrs Williams lächelte vielsagend.
»Wer stopft ihnen bloß ihre Sachen?«, fragte Sophia. »Die Ärmsten, wahrscheinlich kaufen sie alles neu.«
»Ich sehe sie schon vor mir, wie sie mit ihren durchlöcherten Strümpfen in der Hand dasitzen.« Frances stieß einen heiseren Juchzer aus. »Und mit Nadel und Faden herumstochern. ›Liebster Doktor, dürfte ich Sie mal um den blauen Twill bitten? Nach Ihnen mit dem Fingerhut, nach Ihnen …‹« Sie schüttelte sich vor Lachen.
»Aber ich wette, sie können kochen«, sagte Diana. »Männer braten Steaks ganz ordentlich. Außerdem gibt’s ja immer noch Eier und Butterbrote.«
»Oh, wie herrlich exzentrisch!«, rief Cecilia aus. »Und wie romantisch! Fast so interessant wie eine Ruine. Oh, ich kann’s gar nicht abwarten, sie kennenzulernen.«
2
Das Kennenlernen ließ nicht lange auf sich warten. Prompt lud Admiral Haddock, ganz der korrekte Marineoffizier, die Damen von Mapes Court ein, in Gesellschaft der neuen Nachbarn bei ihm zu speisen. Anschließend bat man Captain Aubrey und Dr. Maturin zum Dinner nach Mapes Court. Die beiden wurden als prächtige junge Männer eingestuft, als höchst angenehme Gesellschafter, als ausgezeichnet erzogen und als großer Gewinn für die Nachbarschaft. Sophia begriff jedoch sofort, dass der arme Dr. Maturin aufgepäppelt werden musste. »Er war so blass und schweigsam«, klagte sie. Allerdings hätten selbst das weichste Herz, die mitleidigste Seele von Jack nicht das Gleiche behaupten können. Man hörte sein lautes Lachen schon die Auffahrt heraufkommen, und er behielt diese gute Laune bei, war in Höchstform von Beginn der Gesellschaft bis zur letzten langatmigen Verabschiedung unter dem eiskalten Säulenvorbau. Auf seinem sympathischen, offenen, narbenübersäten Gesicht lag die ganze Zeit entweder ein breites Lächeln oder der Ausdruck lebhaften Vergnügens, und obwohl seine blauen Augen ein wenig zu wehmütig an der wie festgewachsenen Weinkaraffe und der zu früh entschwindenden Nachspeise hingen, war der heitere Strom seiner unverbindlichen, aber durchaus liebenswürdigen Bemerkungen nie versiegt. Mit dankbarem Heißhunger vertilgte er alles, was ihm vorgesetzt wurde, bis sogar Mrs Williams eine Art liebevoller Schwäche für ihn entwickelte.
»Na also«, bemerkte sie, als der Hufschlag ihrer Gäste in der Nacht verhallt war. »Das war, scheint mir, eine der erfolgreichsten Dinnerpartys, die ich jemals gegeben habe. Captain Aubrey hat sogar einen zweiten Fasan verspeist – aber sie waren ja auch ausnehmend zart. Die schwimmende Insel sah in der Silberschüssel besonders appetitlich aus, und für morgen ist davon noch genug übrig. Was den Rest des Schweinebratens betrifft, so ergibt der ein köstliches Haschee. Wie kräftig haben die beiden doch zugelangt! Wahrscheinlich bekommen sie nicht oft so gutes Essen wie bei uns. Höchst verwunderlich, diese Ansicht des Admirals, dass Captain Aubrey nicht ganz hoffähig ist. Im Gegenteil, ich halte ihn für sehr hoffähig. Sophia, bitte sag John, dass er den Portwein, den die Herren übrig gelassen haben, unbedingt in eine kleinere Flasche umfüllen soll, ehe er ihn wegschließt; es schadet der Karaffe, wenn Portwein darinbleibt.«
»Ja, Mama.«
»Und nun, meine Lieben«, flüsterte Mrs Williams, nachdem sie Sophias Abgang eine vielsagende Pause hatte folgen lassen, »ich wette, ihr habt alle Captain Aubreys großes Interesse an Sophia bemerkt – er war ganz besonders aufmerksam zu ihr. Ich zweifle nicht daran … ich glaube, es wäre sehr günstig, wenn wir die beiden künftig so oft wie möglich miteinander allein ließen. Hörst du mir zu, Diana?«
»Oh, gewiss, liebe Tante. Ich verstehe dich sehr gut.« Diana, die am Fenster gestanden hatte, wandte sich wieder den anderen zu. Weit draußen in der mondhellen Nacht schlängelte sich die fahle Straße von Polcary nach Beacon Down hinauf, und die beiden Reiter erklommen sie in flottem Trab.
»Ich frage mich«, begann Jack, »ich frage mich, ob uns diese Vielfraße daheim noch etwas von dem Gänsebraten übrig gelassen haben. Aber notfalls können wir uns ja ein Omelett braten und einen guten Weißwein dazu trinken. Eine ganze Flasche guten Weißwein. Ist dir jemals eine Frau begegnet, die etwas von Wein verstand?«
»Nein, niemals.«
»Und auch mit dem Pudding waren sie verdammt knausrig. Aber was für reizende Mädchen! Hast du beobachtet, wie die Älteste durch ihr volles Weinglas verträumt ins Kerzenlicht gestarrt hat? Diese Grazie … Dieses zarte Handgelenk und die langen eleganten Finger …« Aber Stephen Maturin kratzte sich gerade mit genießerischer Ausdauer und hörte nicht zu. Unbeirrt fuhr Jack fort: »Und diese Mrs Villiers, wie stolz sie den Kopf trägt! Bezaubernde Farben … Der Teint vielleicht nicht ganz so makellos wie bei ihrer Cousine – schließlich hat sie in Indien gelebt, glaube ich –, aber diese tiefblauen Augen! Wie alt mag sie sein, Stephen?«
»Noch nicht dreißig.«
»Ich erinnere mich, wie gut sie im Sattel saß … Bei Gott, vor einem oder zwei Jahren hätte ich … Wie sich ein Mann doch verändern kann. Trotzdem liebe ich es, so von Mädchen umgeben zu sein – sie sind ganz anders als wir. Sie machte ein paar kluge Bemerkungen über nautische Dinge – sprach recht kenntnisreich – verstand eine Menge vom Luv-Vorteil. Sie muss Beziehungen zur Marine haben. Ich hoffe sehr, dass wir sie bald wiedersehen. Dass wir alle bald wiedersehen.«
Sie sahen sie wieder, früher, als erwartet. Auch Mrs Williams kam ganz zufällig an Melbury vorbei und ließ Thomas in die wohlbekannte Auffahrt einbiegen. Hinter der Haustür sang eine tiefe kräftige Männerstimme:
Ihr Ladies im Bordell,
küsst mich nur nicht zu schnell,
ha-ha, ha-ha, ha-ha, ha-heee,
denn ich war lange auf See …e
Ungerührt drangen die Ladys bis in die Halle vor, denn keine außer Diana, die nicht so leicht aus der Fassung zu bringen war, verstand das Couplet. Mit Genugtuung bemerkten sie, dass der Diener, der sie einließ, einen langen Zopf trug, der ihm bis auf den halben Rücken hing; aber das Empfangszimmer, in das er sie führte, war enttäuschend sauber. »Als hätten sie gerade Frühjahrsputz veranstaltet«, dachte Mrs Williams und fuhr mit einem Finger prüfend über die Wandtäfelung. Der einzige Unterschied zum Empfangszimmer eines normalen Christenmenschen waren die militärische Ausrichtung der Stühle, die so exakt parallel standen wie Schiffsrahen, und der Klingelzug, der aus einem kunstvoll geflochtenen Plattling bestand, drei Faden lang und in einem Block endend.
Die kräftige Bassstimme verstummte, und Diana malte sich aus, wie jetzt nebenan irgendein Männergesicht verlegen errötete. Und tatsächlich glühten Captain Aubreys Wangen noch, als er eintrat, aber er begrüßte sie gewandt: »Na, das ist aber eine reizende Überraschung – wirklich sehr nett – einen wunderschönen guten Tag, Madam. Mrs Villiers, Miss Williams, Ihr Diener – Miss Cecilia, Miss Frances, freut mich, Sie zu sehen. Bitte, treten Sie näher …«
»Wir sind zufällig vorbeigekommen«, sagte Mrs Williams, »da dachte ich, wir schauen mal herein und hören, wie der Jasmin gedeiht.«
»Der Jasmin?«, rief Jack.
»Ja«, sagte Mrs Williams, den Blick ihrer Töchter meidend.
»Ach so, der Jasmin. Bitte kommen Sie doch weiter. Im Wohnzimmer lassen Dr. Maturin und ich den ganzen Tag den Kamin brennen. Mein Freund ist auch derjenige, der Ihnen alles über den Jasmin berichten kann.«
Das Winterwohnzimmer auf Melbury Lodge war ein ansehnliches Fünfeck, mit zwei Fensterfronten auf den Garten hinaus und einem hell lackierten Pianoforte an der Wand gegenüber, das unter Notenblättern fast verschwand. Dahinter erhob sich Stephen Maturin, verbeugte sich und blickte den Besucherinnen schweigend entgegen. Er trug eine schwarze Hausjacke, die vor Alter an manchen Stellen grün schimmerte, und hatte sich seit drei Tagen nicht rasiert. Ab und zu fuhr seine Hand übers Kinn.
»Oh, dies ist ein musikalisches Haus, wie schön!«, rief Mrs Williams aus. »Violinen – und ein Cello! Ach, ich liebe Musik. Symphonien, Kantaten … Spielen Sie ein Instrument, Sir?«, fragte sie Stephen, den sie sonst nicht sonderlich beachtete. Denn Dr. Vining hatte ihr erklärt, dass Marineärzte oft schlecht ausgebildet und immer schlecht bezahlt waren. Aber heute hatte sie einen leutseligen Tag.
»Ich habe gerade eine Etüde versucht, Madam«, antwortete Stephen. »Aber ich fürchte, das Piano ist fürchterlich verstimmt.«
»Das hier bestimmt nicht, Sir«, sagte Mrs Williams. »Es war das teuerste Modell auf dem Markt, ein Clementi. Ich weiß noch, als wär’s gestern gewesen, wie es auf einem Lastwagen hergebracht wurde.«
»Klaviere verstimmen sich mit der Zeit, Mama«, murmelte Sophia.
»Aber nicht Clementi-Klaviere, meine Liebe.« Mrs Williams lächelte überlegen. »Sie sind das Teuerste, was es in London gibt. Clementi ist Hoflieferant«, fügte sie so vorwurfsvoll hinzu, als hätten es die anderen an Loyalität zur Krone fehlen lassen. »Außerdem, Sir«, damit wandte sie sich an Jack, »hat meine älteste Tochter das Gehäuse bemalt. Die Bilder sind im chinesischen Stil.«
»Das entscheidet den Fall, Madam«, rief Jack aus. »Es wäre ein höchst undankbares Klavier, wenn es sich der Künstlerhand von Miss Williams als unwürdig erwiese. Erst heute Morgen haben wir die Landschaft mit Pagode bewundert, nicht wahr, Stephen?«
»Ja.« Stephen wischte Hummels Sonate in D-Dur vom Deckel. »Hier sind die Brücken, der Baum und die Pagode, die uns so gefallen haben.« Es war ein bezauberndes Motiv, von der Größe eines Teetabletts – einfache, beschwingte Linien, sanfte Pastellfarben und darüber ein Licht wie Mondschein.