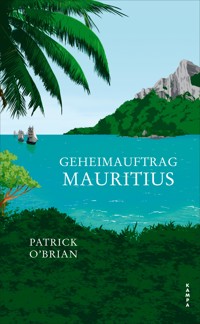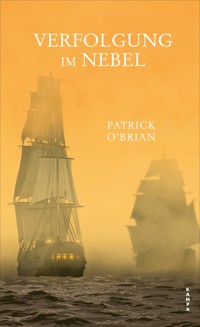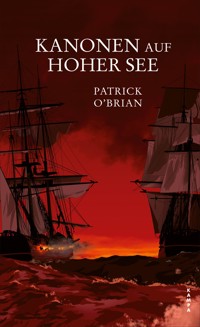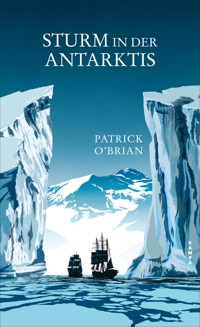
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Kampa VerlagHörbuch-Herausgeber: Kuebler Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Abenteuer von Aubrey und Maturin
- Sprache: Deutsch
Die Mauritius-Unternehmung hat Jack Aubrey so hohe Prisengelder eingebracht, dass er für eine Weile an Land bleiben könnte. Dennoch dauert es nicht lange, bis der Kapitän sich wieder nach unbekannten Meeren sehnt. Zum Glück winkt ein neues Kommando: Aubrey soll in Ostindien Kapitän Bligh zu Hilfe kommen, der wegen der Meuterei auf der Bounty zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt ist. Mit an Bord der HMS Leopard, eines klapprigen Fünfzig-Kanonen-Schiffs vierter Klasse, befinden sich auch drei gefangene Zivilisten, die Aubrey im Auftrag der britischen Krone nach Botany Bay bringen muss. Darunter Louisa Wogan, eine geheimnisvolle Schönheit, auf die Aubreys Freund und Schiffsarzt Stephen Maturin ein Auge geworfen hat. Manches Gerücht rankt sich um diese Frau. Als die Leopard in ein schweres Unwetter gerät, das einige Matrosen das Leben kostet, muss Kapitän Aubrey sein ganzes Geschick aufbringen, um eine Meuterei zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick O’Brian
Sturm in der Antarktis
Das fünfte Abenteuer für Aubrey und Maturin
Roman
Aus dem Englischen von Matthias Jendis
Kampa
I
Das Frühstückszimmer war der heiterste Raum in Ashgrove Cottage. Die Bauleute hatten den Garten mit Haufen von Backsteinen, Sand und ungelöschtem Kalk verunziert, und die feuchten Wände des neuen Flügels, zu dem dieses Zimmer gehörte, rochen noch nach Putz. Aber auf den abgedeckten Silberschüsseln funkelte das hereinströmende Sonnenlicht und ließ das Gesicht von Sophie Aubrey erstrahlen, die dort saß und auf ihren Gatten wartete. Es war ein ausnehmend liebliches Gesicht, waren doch die Sorgenfalten ihrer früheren Armut nun annähernd verschwunden, jetzt aber lag ein bedrückter Ausdruck darauf. Als Frau eines Seemanns wusste sie die überraschend lange Zeit des Zusammenseins mit ihrem Mann zu schätzen: Die Admiralität hatte ihn in ihrer unendlichen Güte (und ziemlich gegen seinen Willen) mit dem Kommando über die örtliche Küstenwacht betraut, in Anerkennung seiner Verdienste im Indischen Ozean, und sie spürte, dass dieser Zeitabschnitt nun zu Ende ging.
Als sie seine Schritte hörte, verwandelte sich ihre sichtbare Sorge in ungetrübte Freude. Die Tür öffnete sich, das Sonnenlicht fiel auf Kapitän Aubreys strahlendes rotwangiges Gesicht mit den hellen blauen Augen, und sie wusste, dass er das Pferd gekauft hatte, das er hatte haben wollen, wusste es so sicher, als ob es auf seiner Stirn geschrieben stünde. »Hier bist du, Liebling«, rief er und ließ sich neben ihr in einen breiten Lehnstuhl fallen, der unter seinem Gewicht ächzte.
»Kapitän Aubrey, ich fürchte, Euer Speck wird kalt«, sagte sie.
»Zuerst eine Tasse Kaffee und dann allen Speck dieser Welt.« Er hob die Deckel mit seiner freien Hand. »Mein Gott, Sophie, das ist ja ein Seemannsparadies hier – Eier, Speck, Koteletts, Räucherhering, Nierchen, Weißbrot … Was macht der Zahn?« Dies galt seinem Sohn George, dessen Geschrei dem ganzen Haus schon seit einiger Zeit Sorgen bereitete.
»Er ist durch!«, rief Mrs Aubrey. »In der Nacht durchgebrochen, und jetzt ist er wieder obenauf, der Arme. Nach dem Frühstück wirst du ihn sehen, Jack.«
Jack lachte vor lauter Freude laut auf, sagte aber nach einer Pause in etwas angestrengtem Ton: »Ich bin heute Morgen zu Horridge rübergeritten, um ihnen Beine zu machen. Ihn habe ich nicht angetroffen, aber sein Vorarbeiter sagte, sie wollten diesen Monat nicht kommen. Der Kalk ist anscheinend nicht genügend gelöscht, und in jedem Fall würde es nicht vorangehen, solange ihr Zimmermann das Bett hütet und die Rohre noch gar nicht ausgeliefert sind.«
»Was für ein Unsinn! Gerade gestern noch hat eine ganze Truppe von denen bei Admiral Hare Rohre verlegt. Mama hat sie im Vorbeifahren gesehen, und hätte Horridge sich nicht hinter einem Baum versteckt, hätte sie ihn auch angesprochen. Bauleute sind schon seltsame und unbegreifliche Wesen. Du warst wohl sehr enttäuscht, Liebster?«
»Nun, ein bisschen geärgert habe ich mich schon, das gebe ich zu, noch dazu mit leerem Bauch. Aber weil ich nun einmal da war, bin ich bei Carroll auf den Hof gegangen und habe das Stutenfüllen gekauft. Er ist bei ihm auch noch vierzig Guineen runtergegangen. Und es ist ein gutes Geschäft, verstehst du, selbst wenn ich mal von den Fohlen absehe, die es werfen wird. Es wird mit Hautboy und Whiskers laufen und aus denen das Beste herausholen. Ich wette fünfzig zu eins, dass ich Hautboy bei den Rennen in Worral unterbringe.«
»Ich bin gespannt auf es«, sagte Sophie, wobei ihr allerdings der Mut sank. Abgesehen von der ganz sanften Sorte mochte sie die meisten Pferde nicht, besonders nicht diese Rennpferde, selbst wenn sie über Old Bald Peg von Flying Childers und dem Darley-Araber höchstpersönlich abstammten. Es gab viele Gründe für ihre Abneigung, aber sie war immer besser als ihr Ehemann darin gewesen, Gefühle zu verbergen, und so fuhr er ohne Punkt und Komma mit einem Ausdruck glücklicher Vorfreude fort: »Irgendwann am Vormittag wird es gebracht. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ist der neue Boden im Stall. Wenn wir nur ein wenig Sonne und eine schöne steife Nordostbrise gehabt hätten, wäre er jetzt vollständig abgetrocknet … Nichts ist so schlimm für Pferdehufe wie so ein Rest von Nässe. Wie geht’s denn deiner Mutter heute Morgen?«
»Es geht ihr wohl ganz gut, Jack, danke. Ein wenig Kopfweh hat sie noch, aber ein paar Eier und eine Schüssel Hafergrütze hat sie schon gegessen. Sie wird nachher mit den Kindern herunterkommen. Wegen der Arztbesuche ist sie schon ganz aufgeregt und war früher angezogen als sonst.«
»Wo Bonden nur bleibt?« Jack warf einen Blick auf seine astronomische Uhr, den strengen Gebieter über seine Zeit.
»Vielleicht ist er wieder einmal von der Leiter gefallen«, sagte Sophie.
»Killick war bei ihm, um ihn zu stützen. Nein, nein – zehn zu eins, dass die im Brown Bear wieder mit ihren Reitkünsten prahlen, die gottverdammten Dummköpfe.« Bonden war Kapitän Aubreys Steuermann, Killick sein Steward. Die beiden zogen mit ihm von einem Kommando zum Nächsten, wann immer es sich einrichten ließ. Beide waren von Kindesbeinen an zur See gefahren – Bonden war sogar zwischen zwei Unterdeckskanonen der Indefatigable zur Welt gekommen –, und obwohl erstklassige Seeleute für ein Kriegsschiff, gaben sie doch kümmerliche Pferdeknechte ab. Die Post für den kommandierenden Offizier der Küstenwacht, dies war allen klar und ziemte sich auch nicht anders, musste jedoch von einem berittenen Diener geholt werden, und so ritten die beiden täglich auf einem kraftstrotzenden, untersetzten Pferd, das passenderweise den Rücken nur wenig über dem Boden trug, über die Downs.
Mrs Williams, eine kräftige, untersetzte Frau und Kapitän Aubreys Schwiegermutter, betrat den Raum, gefolgt von der Amme mit dem Säugling und den zwei kleinen Mädchen in Obhut eines einbeinigen Seemanns. In Ashgrove Cottage waren die meisten der Bediensteten Seeleute, was zumindest teilweise auf die außerordentlichen Schwierigkeiten zurückzuführen war, die es bereitete, Dienstmädchen innerhalb der Reichweite von Mrs Williams’ herrischer Stimme zum Bleiben zu bewegen. Seemänner dagegen ließ ihre scharfe Zunge ungerührt, waren sie doch seit Langem an die Ansprache durch den Bootsmann und seine Gehilfen gewöhnt. Auch zügelte sie auf jeden Fall ihre Zunge merklich, weil sie Männer waren und alles nachweislich so sauber hielten wie auf der königlichen Yacht. Die penibel geraden Linien im Garten und um die angepflanzten Büsche und Sträucher waren vielleicht nicht jedermanns Sache, ebenso wenig die weiß getünchten Begrenzungssteine, die ohne Ausnahme die Pfade säumten. Aber auf jeden, der ein Anwesen führte, musste der Anblick der blitzsauberen Fußböden großen Eindruck machen. Jeden Tag wurden sie noch vor Sonnenaufgang mit Sand gescheuert, abgeschrubbt und trockengefeudelt. Und ebenso eindrucksvoll mussten das blitzende Kupfer in der pieksauberen Küche und die glänzenden Fensterrahmen mit ihrem stets frischen Farbanstrich wirken.
»Ihnen einen guten Morgen, Ma’am«, sagte Jack und erhob sich.
»Sie sind wohlauf, hoffe ich?«
»Guten Morgen, Kommodore – oder besser: Kapitän. Sie wissen, ich beklage mich nie. Aber ich habe hier eine Liste« – dabei wedelte sie mit einem Blatt Papier, auf dem sie alle ihre Symptome aufgelistet hatte –, »und bei der werden die Ärzte Augen machen. Ich frage mich, ob der Friseur vor ihnen hier sein wird. Aber wir sollten nicht über mich sprechen: Hier ist Ihr Sohn, Kommodore – oder besser: Kapitän. Er hat gerade seinen ersten Zahn bekommen.« Mit sanftem Druck auf deren Ellbogen ließ sie die Amme vortreten, und Jacks Blick fiel auf ein kleines, rosarotes, fröhliches und erstaunlich menschenähnliches Gesicht in einem Haufen von Wolle. George lächelte ihn an und gluckste, wobei er seinen Zahn zeigte. Jack stupste seinen Zeigefinger in die wollene Verpackung und sagte:
»Nun, wie geht’s uns denn? Großartig, denke ich doch, erstklassig. Ha, ha.« Das Baby schien verwirrt oder gar erschreckt. Die Amme wich zurück, und Mrs Williams sagte mit tadelndem Blick: »Wie können Sie nur so laut werden, Mr Aubrey?« Sophie nahm das Kind in ihre Arme und flüsterte: »Ist ja gut, mein Herzblatt, ist ja gut.«
Rings um George schloss sich der Kreis der Frauen. Sie sprachen untereinander von den empfindlichen Ohren, die Babys doch hätten – schon ein Donnerschlag könne bei ihnen einen Anfall auslösen – kleine Jungen seien viel empfindlicher als kleine Mädchen … Einen Augenblick lang fühlte Jack einen wenig noblen, eifersüchtigen Stich, als er die Frauen und besonders Sophie sah, wie sie das kleine Wesen mit so viel Zuneigung und Ergebenheit überhäuften. Kaum hatte er angefangen, sich dafür zu schämen und sich innerlich zu sagen, er sei zu lange hier der Hahn im Korb gewesen, als Amos Dray (vormals Bootsmannsgehilfe auf der HMS Surprise und im Dienst der gewissenhafteste und unparteiischste Auspeitscher der ganzen Flotte, bis er ein Bein verlor) eine Hand vor den Mund hielt und mit tiefer Flüsterstimme grummelte: »In Linie antreten, meine Lieben!«
Zwei kleine vollmondgesichtige Zwillingsschwestern in sauberen Schürzenkleidern traten bis zu einer bestimmten Markierung auf dem Teppich vor und piepsten gemeinsam mit hohen und schrillen Stimmchen: »Guten Morgen, Sir.«
»Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen, Fanny«, begrüßte sie ihr Vater und beugte sich mit knarzend protestierenden Hosen hinunter, um ihnen einen Kuss zu geben. »Aber Fanny, du hast ja eine Beule auf der Stirn.«
»Ich bin nicht Fanny!« Charlotte verzog das Gesicht. »Ich bin Charlotte.«
»Aber du hast doch ein blaues Kleidchen an«, erwiderte Jack.
»Ja, weil Fanny meins anhat, und sie hat mich mit ihrem Pantoffel geschlagen, diese Seeziege«, sagte Charlotte mit kaum verhohlener Wut.
Jack warf Mrs Williams und Sophie einen besorgten Blick zu, aber beide waren noch verzückt über das Baby gebeugt. Fast im selben Moment kam Bonden mit der Post herein. Er setzte die lederne Tasche mit dem Messingschild ab, auf dem Ashgrove Cottage eingraviert war, und die Kinder, ihre Großmutter sowie deren Bedienstete verließen den Raum. Er bitte um Verzeihung für seine Verspätung, aber es sei nun einmal Markttag dort unten, mit Pferden und Vieh.
»Bestimmt eine Menge los, nicht wahr?«
»Und wie, Sir. Aber ich habe Mr Meiklejohn gefunden und ihm gesagt, Sie würden bis Samstag nicht ins Büro kommen.« Bonden zögerte, fuhr aber auf Jacks fragenden Blick hin fort: »Tatsache ist, Killick hat einen Kauf gemacht, mit Siegel und allem, und er hat mich gebeten, Ihnen das als Erstes zu melden, Euer Ehren.«
»Ach ja?« Jack öffnete die Tasche.
»Eine Frau, Sir.«
»In Gottes Namen, was will er denn mit einer Frau?« Jack starrte ihn an.
»Nun, Sir«, sagte Bonden, der dabei rot wurde und sich rasch von Sophie abwandte, »das kann ich auch nicht genau sagen. Aber er hat eine gekauft, ganz legal. Drei gab’s da zur Auswahl.«
»Wie kann man nur seine Frau verkaufen? Und Frauen wie Vieh behandeln?«, rief Sophie. »O pfui, Jack, das ist ja völlig barbarisch.«
Als das Paar vor ihm stand – sein Steward, ein langer Schlaks mittleren Alters, den sein schüchternes Auftreten jetzt noch unbeholfener wirken ließ als gewöhnlich, und dessen junge Frau –, sagte er: »Nun, Killick, ich hoffe doch, dass du nicht unüberlegt die Ehe ansteuerst? Die Ehe ist eine sehr ernste Angelegenheit.«
»O nein, Sir. Hab’s mir gut überlegt. Drei gab’s zur Auswahl, und diese hier« – mit stolzem Blick auf seine Frau – »war die Schönste.«
»Na gut«, erwiderte Jack, »ich nehme also an, du willst sie hier bei uns aufnehmen lassen. Da musst du dich erst einmal beim Pfarrer sehen lassen. Ab mit dir zum Pfarrhaus.«
»Aye, aye, Sir«, sagte Killick. »Zum Pfarrhaus, wird gemacht.«
»Herrgott, Sophie«, seufzte Jack, als sie wieder allein waren. »Was für ein Aufmarsch!« Er öffnete die Posttasche. »Ein Schreiben von der Admiralität, noch eins vom Sanitätsamt, und dieses hier sieht aus, als sei es von Charles Yorke an mich – ja, das ist sein Siegel. Und hier, zwei für Stephen, unter deiner Adresse und Obhut.«
»Ich wünschte, er wäre in meiner Obhut, der Arme«, sagte Sophie und besah sich die Briefe. »Diese hier sind schon wieder von Diana.«
Sie legte sie auf ein Beistelltischchen, wo schon ein anderer lag, der in derselben kühnen und entschlossenen Handschrift an Herrn Stephen Maturin, Doktor der Medizin, adressiert war, und betrachtete sie schweigend.
Diana Villiers, Sophies Cousine, war etwas jünger als diese und eine Frau mit wesentlich gewagterem Stil: eine schwarzhaarige Schönheit mit tiefblauen Augen, die von einigen für anziehender gehalten wurde als Mrs Aubrey. Damals, lange vor ihrer Heirat, als Sophie und Jack noch kein Paar waren, hatten beide, Jack und Stephen Maturin, nichts unversucht gelassen, um Dianas Gunst zu gewinnen. Das Ergebnis dieser Anstrengungen hätte Jack beinahe die Karriere wie auch die Ehe gekostet. Stephen dagegen, noch voller Hoffnung auf eine spätere Heirat mit Diana, war durch deren Abreise nach Amerika als Protegé eines Mr Johnson tief getroffen worden – so tief, dass er viel von seiner Lebenslust verloren hatte. Er hatte angenommen, sie würde ihn heiraten. Zwar hatte ihm seine Vernunft gesagt, dass eine Frau mit ihren gesellschaftlichen Verbindungen, ihrem Aussehen, Stolz und Ehrgeiz in dem unehelichen Sohn eines irischen Offiziers in Diensten Seiner Allerkatholischsten Majestät und einer katalonischen Dame nicht gerade eine geeignete Verbindung sehen konnte – besonders dann nicht, wenn dieser uneheliche Sohn ein kleiner, unangenehm unattraktiver Mann mit dem, wie es schien, bescheidenen Status eines Schiffsarztes war. Dennoch hatte er sein Herz völlig an sie verloren, und es hatte ihn unendlich viel gekostet, ihm und nicht seinem Verstand gefolgt zu sein.
»Noch bevor wir erfahren haben, dass sie in England ist, wusste ich, dass den armen Stephen irgendetwas bedrückt«, sagte Sophie. Sie hätte noch ihre kaum überzeugenden Beweise nennen können: eine neue Perücke, neue Jacken und Röcke, ein Dutzend bester Batisthemden. Aber sie liebte Stephen so, wie auch Brüder nur selten geliebt werden, und konnte es nicht ertragen, ihn auch nur in die Nähe von Lächerlichkeit zu rücken. Sie fragte: »Jack, warum besorgst du ihm nicht einen anständigen Diener? Selbst in den schlimmsten Zeiten hätte Killick dich niemals derart schlecht gekleidet aus dem Haus gelassen: das Hemd seit zwei Wochen nicht gewechselt, die Strümpfe nicht zueinander passend, und dann dieser scheußliche Rock. Warum hat er nie einen festen, zuverlässigen Mann gehabt?«
Jack wusste nur zu gut, warum Stephen keinen Diener für längere Zeit beschäftigt hatte, sodass der sich an seine Art hätte gewöhnen können, sondern sich mit achtlosen Seesoldaten und Schiffsjungen, vorzugsweise Analphabeten, oder mit einem etwas beeinträchtigten Mann aus der Achterwache begnügt hatte. Dr. Maturin war nämlich nicht nur Marinearzt, sondern auch einer der am meisten geschätzten Geheimagenten der Admiralität. Diskretion war unerlässlich, wollte er sein Leben und das der vielen Kontakte in dem riesigen, von Bonaparte kontrollierten Gebiet nicht gefährden und überhaupt seiner Arbeit nachgehen können. Im Laufe ihrer gemeinsamen Dienstjahre war Jack dies notwendigerweise nicht verborgen geblieben, aber er wollte dieses Wissen mit niemandem teilen, nicht einmal mit Sophie. So gab er jetzt nur eine Antwort in dem Sinne, dass man zwar hoffen könne, mit viel Mühe und Anstrengung ein halsstarriges Maultiergespann umzustimmen, dass aber nichts, auch nicht eine Breitseite nach der anderen, jemals Stephen von einem einmal eingeschlagenen Weg abbringen würde.
»Diana könnte das, sie bräuchte nur mit ihrem Fächer zu wedeln«, sagte Sophie. Ihr Gesicht eignete sich nicht besonders gut für schlechte Laune, drückte jetzt aber viele Facetten von Verstimmung aus: ein Gefühl von Scham für Stephen, Verärgerung wegen dieser erneuten Komplikation, dazu etwas von der Ablehnung oder gar Eifersucht, die eine Frau mit sehr bescheidenem Geschlechtsdrang für eine andere empfindet, für die genau das Gegenteil zutrifft. Dies alles wurde allerdings durch ihre Abneigung gemildert, von jemandem schlecht zu denken oder zu sprechen.
»Das könnte sie wohl«, erwiderte Jack. »Und wenn sie ihn durch so etwas glücklich machen könnte, würde ich den Tag loben und preisen. Weißt du, es gab mal eine Zeit«, hierbei blickte er durch das Fenster in die Weite, »da dachte ich, es wäre meine Pflicht als sein Freund – da dachte ich, das Beste für ihn wäre, die zwei nicht zusammenkommen zu lassen. Ich hielt sie einfach nur für böse und teuflisch, glaubte, sie würde nur Verderben bringen und sein Untergang sein. Aber jetzt bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht sollte man sich in solche Dinge niemals einmischen, das ist viel zu heikel. Aber wenn man einen Freund sieht, wie er blindlings auf den Abgrund zusteuert … ich habe nur sein Bestes gewollt, so wie ich es sah, aber vielleicht habe ich damals nicht sonderlich gut gesehen.«
»Du hast recht getan, da bin ich sicher.« Sophie legte ihm tröstend die Hand auf die Schulter. »Schließlich hat sie ja gezeigt, dass sie – nun, wie soll ich sagen? – leicht zu haben ist.«
»Also, was das angeht«, versetzte Jack, »halte ich derartige Kapriolen für immer unwichtiger, je älter ich werde. Die Menschen sind so verschieden, auch die Frauen. Es mag Frauen geben, für die sind solche Dinge fast so wie für einen Mann. Für diese Frauen bedeutet es nicht unbedingt etwas, mit einem Mann das Bett zu teilen, es berührt sie in ihrem innersten Wesen nicht, würde ich sagen, und es macht aus ihnen keine Huren. Bitte verzeih mir, Liebes, wenn ich so ein Wort benutze.«
»Willst du damit sagen«, fragte seine Frau, die letzte Bemerkung ignorierend, »dass es Männer gibt, für die ein Verstoß gegen die Zehn Gebote nichts bedeutet?«
»Ich bin hier auf gefährlichem Boden, merke ich gerade«, sagte Jack.
»Was ich meine, ist … ich weiß genau, was ich meine, aber ich kann es nicht so gut in Worte fassen. Stephen könnte es dir viel besser erklären – er könnte es verständlich machen.«
»Ich hoffe nicht, dass Stephen oder irgendein anderer Mann mir verständlich machen könnte, dass es nichts bedeutet, gegen das Ehegelübde zu verstoßen.«
An diesem Punkt der Unterhaltung erschien zwischen den Haufen von Bauschutt ein furchteinflößendes Tier von niedriger Gestalt und mattblauer Farbe, eine Kreatur, die wie ein Pony ohne Ohren aussah. Sie trug einen kleinen Mann und eine große, würfelförmige Kiste auf dem Rücken. »Da kommt der Friseur«, rief Jack. »Zur Hölle mit ihm – er kommt viel zu spät. Deine Mutter wird mit der neuen Frisur bis nach der Untersuchung warten müssen. Die Ärzte wollen in zehn Minuten hier sein, und Sir James ist immer auf die Minute pünktlich.«
»Und wenn das Haus in Flammen stünde, selbst das würde Mama nicht dazu bringen, unfrisiert zu erscheinen«, sagte Sophie. »Wir werden ihnen den Garten zeigen müssen. Stephen wird sich sowieso verspäten.«
»Sie könnte eine Haube aufsetzen«, schlug Jack vor.
»Natürlich wird sie eine Haube aufsetzen«, sagte Sophie mit mitleidigem Blick. »Wie könnte sie auch nur daran denken, unbekannte Gentlemen ohne Haube zu empfangen? Aber darunter muss ihr Haar frisiert sein.«
Die Untersuchung, zu der sich diese Gentlemen nach Ashgrove Cottage aufgemacht hatten, betraf Mrs Williams’ Gesundheit. Früher einmal hatte sie eine Operation, bei der ihr ein gutartiger Tumor entfernt wurde, mit einer Standhaftigkeit ertragen, die selbst Dr. Maturin in Erstaunen versetzt hatte, und der war von seinen Seeleuten Mut und Zähnezusammenbeißen gewohnt. Seither aber klagte sie über Blähungen, was ihre Lebensgeister merklich dämpfte, und sie hofften, das hohe Ansehen dieser hervorragenden Ärzte würde sie überzeugen, in Bath, Matlock Wells oder gar noch weiter im Norden eine Trinkkur zu machen.
Sir James war mit Dr. Lettsome in dessen Kutsche gereist. Sie kamen daher gemeinsam an und lehnten auch gemeinsam Kapitän Aubreys Einladung ab, den Garten zu besichtigen. Also ließ Jack sie mit der Weinkaraffe allein und ging, den Pferdehändler und sein neues Füllen in Empfang zu nehmen.
Schon von Weitem waren die neuen Gebäudeflügel von Ashgrove Cottage den Ärzten ebenso aufgefallen wie der Wagenschuppen für zwei Kutschen, die lange Reihe der Ställe und die glänzende Kuppel des Observatoriumsturms. Jetzt schätzten ihre geübten Augen den offensichtlichen Wohlstand ab, den der Morgensalon mit seinen neuen, wuchtigen Möbeln verriet: Hier hingen Bilder von Pocock und anderen hervorragenden Leuten, die Schiffe und Seegefechte zeigten, außerdem ein Bild von Kapitän Aubrey selbst, den Beechey in der Paradeuniform eines hochrangigen Vollkapitäns mit dem roten Band des Bath-Ordens quer über seine breite Brust gemalt hatte. Er blickte frohen Mutes zu einer explodierenden Mörsergranate hin, in der man das Wappen der Aubreys erkennen konnte, ehrenvoll erweitert durch die Köpfe zweier Mohren – Jack hatte kürzlich die Besitztümer der Krone um die Inseln Mauritius und Réunion vermehrt, und das königliche Heroldsamt, obwohl nur mit einer nebulösen Vorstellung von diesen Besitzungen ausgestattet, war der Meinung gewesen, Mohren seien in diesem Fall angemessen. Während sie am Wein nippten, sahen sich die Ärzte um und kalkulierten mit sichtbarer Befriedigung ihre Gebühren.
»Gestatten Sie mir, werter Kollege, Ihnen nachzuschenken«, sagte Sir James.
»Sie sind zu gütig«, erwiderte Dr. Lettsome. »Wirklich ein ganz ausgezeichneter Madeira. Ich nehme an, der Kapitän hat ein glückliches Händchen in Sachen Prisengeld?«
»Man hat mir erzählt, er habe zwei oder drei unserer Indienfahrer bei Réunion zurückerbeutet.«
»Wo liegt Réunion?«
»Nun, früher nannte man es die Île Bourbon – sie liegt in der Nähe von Mauritius, wissen Sie.«
»Ah ja, tatsächlich?«, sagte Dr. Lettsome, worauf sie sich der Erörterung ihrer Patientin zuwandten. Die belebende Wirkung von Stahl wurde betont, ebenso die überraschenden Nebenwirkungen von Colchicum, im Übermaß verabreicht; der therapeutische Wert von gut zerstoßenem Baldrianwurz wurde diskutiert; auch der einer Schwangerschaft, nicht nur in diesem, sondern tatsächlich in fast jedem Fall; Blutegel, hinter den Ohren angesetzt, hielten sie immer eines Versuches wert; milde Abführmittel brachten sie in die Debatte und deren Wirkung auf die Milz; Hopfenblütenkissen und Schlafstörungen; Abreibungen mit Schwamm und kaltem Wasser, dazu ein Pint Wasser auf nüchternen Magen; Schonkost sowie schwarze Arznei; schließlich erwähnte Dr. Lettsome den Behandlungserfolg, den er in bestimmten, nicht unähnlichen Fällen mit Opium erzielt habe: »Der Saft der Mohnblume macht aus einer kratzbürstigen Alten eine liebliche Rose.« Seine Formulierung gefiel ihm, und mit lauter, wohltönender Stimme sagte er: »Aus einer Kratzbürste macht die Mohnblume eine Rose.« Sir James’ Gesicht aber verfinsterte sich, und er antwortete: »Eure Mohnblume ist gut und schön, dort wo sie hingehört. Wenn ich aber bedenke, wie groß die Gefahr des Missbrauchs oder der Gewöhnung ist, das Risiko, den Patienten zu nichts als einem Sklaven der Arznei zu machen, dann neige ich manchmal zu der Ansicht, dass sie nirgendwo hingehört außer in den Garten. Ich kenne einen äußerst fähigen Mann, der damit in Form von Laudanumtinktur einen derartigen Missbrauch getrieben hat, dass er gewohnheitsmäßig eine Dosis von nicht weniger als achtzehntausend Tropfen pro Tag einnahm – das ist die Hälfte dieser Karaffe. Zwar hat er mit dieser Gewohnheit gebrochen, aber als er neulich in einer Krise steckte, ist er wieder auf seinen Seelenbalsam zurückverfallen. Obwohl er nie das hatte, was man einen Opiumrausch nennt, weiß ich doch aus sicherer Quelle, dass er es keine zwei Wochen lang schaffte, ohne Unterbrechung nüchtern zu bleiben. Und er – oh, Dr. Maturin, wie geht es Ihnen?«, rief er, als die Tür aufging. »Sie kennen doch unseren Kollegen Lettsome, nehme ich an?«
»Zu Ihren Diensten, Gentlemen«, sagte Stephen. »Ich hoffe, dass Ihr Warten nicht mir gegolten hat?«
Keineswegs, versicherten sie. Ihre Patientin sei noch nicht so weit, sie empfangen zu können. Ob Dr. Maturin nicht mit einem Glas dieses hervorragenden Madeira in Versuchung geführt werden könne? Das sei ein Leichtes, sagte Dr. Maturin, und während er trank, bemerkte er, wie horrend teuer Leichen doch geworden seien. Gerade heute Morgen noch hätte er eine herunterhandeln wollen, und die Banditen hätten die Unverschämtheit besessen, vier Guineen dafür zu fordern – ein Londoner Preis für einen Kadaver! Er habe ihnen vorgehalten, derartige Gier sei das Ende der Wissenschaft und damit auch ihres eigenen Geschäfts, aber vergebens, er habe die vier Guineen bezahlen müssen. Nun aber sei er ganz froh, den Kauf getätigt zu haben: Es handle sich dabei um eine der wenigen von ihm sezierten weiblichen Leichen mit dieser merkwürdigen Quasiverkalkung der Palmaraponeurosen, dazu noch ganz frisch. Er sei jedoch im Moment nur an den Händen interessiert – ob sich vielleicht einer der Kollegen die Dame mit ihm teilen wolle?
»Ich bin immer froh über eine schöne, frische Leber für meine jungen Leute«, sagte Sir James. »Wir werden sie im Kutschkasten mitnehmen.« Dabei erhob er sich, denn die Tür wurde geöffnet, und herein trat Mrs Williams, begleitet von einem strengen Geruch nach angesengtem Haar.
Die Untersuchung nahm ihren zähen Lauf. Stephen, der sich ein wenig abseits hielt, gewann den Eindruck, dass die ernsten und aufmerksamen Ärzte alles taten, um ihr Geld wert zu sein, mochten die Gebühren auch noch so exorbitant hoch sein. Beide besaßen ein natürliches Talent für die theatralische Seite der Medizin, das ihm völlig abging, auch wunderte er sich über die Kunstfertigkeit, mit der sie den Redefluss der Dame kontrollierten. Er wunderte sich weiterhin, dass Mrs Williams in seiner Anwesenheit derartige Lügen aufzutischen wagte: Sie sei eine Witwe ohne ein Dach über dem Kopf, und seit man ihren Schwiegersohn degradiert habe, gehe sie nicht mehr aus dem Haus. Tatsächlich hatte sie mehr als ein Dach über dem Kopf. Die Hypothek auf Mapes, ihrem großen und weitverzweigten Anwesen, war mithilfe der Siegesbeute von Mauritius abgelöst worden, sie aber hatte vorgezogen, es zu vermieten. Als Kommandeur eines Geschwaders im Indischen Ozean hatte ihr Schwiegersohn zeitlich begrenzt den Posten eines Kommodore bekleidet; aber es entsprach dem natürlichen Gang der Dinge, dass er zum Rang eines Kapitäns zurückkehrte, sobald der Einsatz beendet und das Geschwader aufgelöst worden war. Eine Degradierung hatte es nicht gegeben. Dieser Sachverhalt war Mrs Williams wieder und wieder erläutert worden, und die recht einfachen Tatsachen hatte sie mit Sicherheit auch verstanden. Wenn sie sich trotzdem nicht enthalten konnte, das alles erneut in Stephens Anwesenheit vorzubringen, und sich dabei auch noch seines Wissens um die Falschheit ihrer Worte bewusst war, dann war dies zweifellos ein Maßstab dafür, wie sehr diese starke, einfältige und herrschsüchtige Frau sich nach Mitleid oder gar Anerkennung sehnte.
Nach einiger Zeit wurde jedoch sogar die Stimme von Mrs Williams heiser und Sir James’ Art und Tonfall immer strenger. Das Dinner stand nun unmissverständlich und unmittelbar bevor, Sophie schaute kurz ins Untersuchungszimmer, und schließlich war die Konsultation beendet.
Stephen ging, um Jack in den Ställen zu suchen, und sie trafen sich auf halbem Wege zwischen rauchenden Kalkhaufen. »Stephen! Was für eine Freude, dich zu sehen«, rief Jack, der seinem Freund bei diesen Worten beide Hände auf die Schultern legte und voller Zuneigung auf ihn herabsah. »Wie geht es dir?«
»Wir haben’s geschafft. Sir James lässt nicht mit sich reden: Scarborough, sonst würde er keinerlei Verantwortung mehr übernehmen, und reisen wird die Patientin unter Betreuung eines Assistenten von Dr. Lettsome.«
»Nun, ich bin sehr froh, dass so gut für die alte Dame gesorgt wird«, sagte Jack mit einem leisen Lachen. »Komm und sieh dir mal meine neueste Errungenschaft an.«
»Was für ein schönes Tier.« Stephen begutachtete das Stutenfohlen, das vor ihnen auf und ab geführt wurde. Ein schönes Tier, vielleicht eine Spur zu schön, vielleicht gar ein Blender. Die Fesseln dick wie bei einem Schaf, und dieser verkürzte Rumpf ließ doch sicher auf eine schwache Ausdauer schließen. Ohren und Augen verhießen nichts Gutes. »Kann ich einmal aufsitzen?«, fragte er.
»Dafür ist einfach keine Zeit.« Jack blickte auf seine Uhr. »Jeden Moment wird zum Essen geläutet werden. Aber« – er warf einen bewundernden Blick zurück, während er Stephen zum Haus drängte – »ist sie nicht ein großartiges Tier? Wie geschaffen dafür, die Oaks in Epsom zu gewinnen.«
»Von Pferden verstehe ich nicht allzu viel, aber um eines bitte ich dich, Jack: Steck kein Geld in dieses Tier, bevor du es nicht mindestens ein halbes Jahr bei dir gehabt hast.«
»Du meine Güte, ich werde lange vorher auf See sein, genau wie du, hoffe ich, wenn deine Angelegenheiten das erlauben – los, wir müssen hetzen wie die Hasen – ich habe große Nachrichten – warte nur, bis die Doktoren fort sind.« Die Hasen stolperten keuchend weiter. Jack rief seinem Freund zu: »Das Gepäck ist in deinem alten Zimmer, versteht sich«, stampfte die Treppe hinauf, wechselte seinen Rock und tauchte mit dem ersten Glockenschlag der vollen Stunde wieder vor seinen Gästen auf, um sie zu Tisch zu bitten.
»Eines von den vielen Dingen, die mir an der Marine gefallen«, sagte Sir James, als die Tafel zum ersten Mal abgeräumt wurde, »ist die Achtung vor der Zeit, die man dort lernt. Bei Seeleuten weiß ein Mann immer, wann er sich zu Tisch begeben wird, und seine Verdauungsorgane danken ihm diese Pünktlichkeit.«
Ich wünschte nur, ein Mann wüsste ebenso, wann er die Tafel verlassen sollte, dachte Jack bei sich, als die Organe von Sir James gut zwei Stunden später immer noch dankbar beschäftigt waren, und zwar nun mit Portwein und Walnüssen. Er brannte vor Ungeduld, Stephen von seinem neuen Kommando zu erzählen und ihn wenn möglich zu bewegen, auf dieser Reise noch einmal mit ihm zu segeln. Auch wollte er ihn in das Geheimnis enormen Reichtums einweihen und war begierig zu hören, was sein Freund in eigener Sache zu berichten hatte. Was seine Unternehmungen während der letzten Abwesenheit anging, war Stephen ungefähr so gesprächig wie ein Grab der stilleren Sorte, aber Jack war gespannt auf alles, was mit Diana Villiers und den Briefen zusammenhing, die in jüngster Zeit im Gästezimmer deponiert worden waren. Laut sagte er nur:
»Komm, Stephen, so geht das nicht. Die Flasche steht und wartet.«
Jacks Worte waren klar und deutlich, und doch reagierte Stephen erst, als sie wiederholt wurden. Dann erwachte er aus seiner Versunkenheit, blickte um sich und reichte die Karaffe weiter, aufmerksam gemustert von den zwei Ärzten, die ihre Köpfe zur Seite geneigt hielten. Jacks freundschaftlicher Blick konnte an ihm keinerlei auffällige Veränderung feststellen. Stephen war bleich und in sich gekehrt, aber kaum mehr als sonst, er wirkte vielleicht etwas verträumter. Trotzdem war Jack heilfroh, als die Doktoren die Einladung zum Tee dankend ablehnten, nach ihrem Diener riefen und sich von Stephen, der eine Säge bei sich trug, in den Wagenschuppen geleiten ließen. Nach einer grässlichen Pause kamen sie wieder heraus, verstauten ein Bündel hinten in der Kutsche (die schon viele solcher Bündel transportiert hatte – Diener und Pferde waren Experten in Sachen Leichenraub), betraten noch einmal das Haus, sackten ihr Geld ein, verabschiedeten sich und fuhren davon.
Sophie saß allein mit Teemaschine und Kaffeekanne im Salon, als Jack und Stephen schließlich zurückkehrten. »Hast du Stephen von dem Schiff erzählt?«, fragte sie.
»Noch nicht, mein Herz«, sagte Jack. »Ich war gerade dabei, davon anzufangen. Erinnerst du dich an die Leopard, Stephen?«
»Die scheußliche alte Leopard?«
»Also wirklich, du bist mir einer. Erst machst du mir das neue Fohlen mies, dabei gibt es kein Pferd, das mehr Chancen hätte, die Oaks zu gewinnen – und eins sage ich dir, mein guter Stephen, bei aller Bescheidenheit: Es gibt in der ganzen Marine niemanden, der sich so mit Pferden auskennt wie ich.«
»Daran, mein Lieber, zweifle ich überhaupt nicht. Marinepferde habe ich ja schon einige gesehen, ha, ha. Denn Pferde sind es wohl, haben sie doch im Allgemeinen annähernd vier Beine, und außerdem gibt es im ganzen Tierreich kein anderes Geschöpf, mit dem sie verwandt wären.« Stephen fand Gefallen am eigenen Witz und ließ für kurze Zeit das krächzende Geräusch vernehmen, mit dem er Lachen am nächsten zu kommen meinte, darauf sagte er: »Die Oaks, bei meiner Seel’.«
»Nun gut«, sagte Jack. »Und jetzt sprichst du von der ›scheußlichen alten Leopard‹. Sicher, sie hatte etwas von einer Schnecke, und zwar von einer abgetakelten alten Schnecke, als Tom Andrews sie hatte. Aber die Werft hat bei ihr gründlich Hand angelegt und sie von Kopf bis Fuß überholt – Snodgrass-Diagonalstreben, neue Innenbeplankung, Kniestücke aus Eisenplatten nach Roberts überall – ich erspar’ dir weitere Einzelheiten –, und jetzt ist sie das schönste Fünfzig-Kanonen-Schiff mit Wasser unter dem Kiel, die Grampus eingeschlossen. Mit Sicherheit das schönste Schiff vierter Klasse in der ganzen Flotte!« Das schönste Schiff vierter Klasse: möglicherweise. Aber wie Jack nur zu gut wusste, gehörten die Schiffe vierter Klasse zu einer armseligen und aussterbenden Art. Seit mehr als einem halben Jahrhundert waren sie nicht mehr als Linienschiffe eingesetzt worden, und die Leopard hatte zudem zu keiner Zeit zu ihren glänzenderen Vertretern gehört. Keiner kannte die Schwachstellen dieses Schiffs besser als Jack. Er wusste, dass sie 1776 auf Kiel gelegt und halb fertiggestellt worden war; dass sie zehn oder mehr Jahre lang in diesem wenig befriedigenden Zustand verharrt hatte und unter freiem Himmel langsam verrottet war; dass sie dann nach Sheerness verholt und dort schließlich 1790 zu Wasser gelassen worden war: der Beginn einer höchst unauffälligen Karriere. Ihre Generalüberholung hatte er jedoch mit aufmerksamem und professionell geschultem Blick beobachtet, und so wusste er, dass von ihr zwar keine atemberaubenden Leistungen erwartet werden konnten, dass sie aber seetüchtig war. Darüber hinaus stand für ihn nicht das Schiff als solches an erster Stelle, sondern sein Ziel, sehnte er sich doch nach unbekannten Meeren und den Gewürzinseln.
»Wenn ich mich recht erinnere, hatte die Leopard mehrere Decks«, sagte Stephen.
»Ja, sicher. Sie ist ein Schiff vierter Klasse, also ein Zweidecker. Sie ist geräumig, fast wie ein Linienschiff. Du wirst allen Platz der Welt haben, Stephen, man wird da nicht so eng zusammengepackt wie auf einer Fregatte. Ich muss schon sagen, diesmal hat die Admiralität mir zur Abwechslung mal etwas Gutes getan.«
»Ich denke, sie hätten dir ein Linienschiff erster Klasse geben sollen«, sagte Sophie. »Und zum Lord hätten sie dich auch machen müssen.«
Jack schenkte ihr ein liebevolles Lächeln und fuhr fort: »Sie haben mich vor die Wahl gestellt: entweder die Ajax, ein neues Vierundsiebzig-Kanonen-Schiff, das noch im Bau ist, oder die Leopard. Die Ajax wird ein sehr schönes Schiff, wie man es sich besser nicht wünschen kann, aber sie würde einen Einsatz im Mittelmeer unter Harte bedeuten. Im Mittelmeer kann man zurzeit keinen Ruhm ernten, und ein Vermögen lässt sich da außerdem auch nicht machen.« Hier war Jack wiederum etwas weniger ehrlich. Zwar traf es zu, dass in diesem Stadium des Krieges für einen Seemann im Mittelmeer wenig zu holen war, jedoch hatte die Person von Admiral Harte bei dieser Bewertung eine größere Bedeutung für ihn, als er jetzt erkennen ließ. Jack hatte ihm in früheren Jahren Hörner aufgesetzt, und der skrupellose Admiral würde in seiner Rachsucht keinen Moment zögern, Jacks Karriere zu ruinieren, sofern sich dazu eine Gelegenheit böte. Während des Aufstiegs in der Marine hatte sich Jack viele Freunde in der Flotte erworben, aber für einen so liebenswürdigen Mann auch erstaunlich viele Feinde: Einige neideten ihm den Erfolg, andere, und zwar seine Vorgesetzten, hatten ihn in jungen Jahren für zu unabhängig oder gar für ungehorsam gehalten, wieder anderen gefiel seine politische Linie nicht (er hasste jeden Whig), und schließlich gab es noch etliche, die aus demselben Grunde schlecht auf ihn zu sprechen waren wie Admiral Harte oder zumindest annahmen, einen solchen Grund zu haben.
»Du hast doch schon allen Ruhm und alle Ehre, die sich ein Mann nur wünschen kann, Jack«, sagte Sophie. »Diese schrecklichen Wunden und Geld genug.«
»Hätte Nelson so gedacht wie du, mein Herz, hätten wir nach St Vincent auf ›unentschieden‹ plädiert und die Sache beendet. Den Nil und Abukir hätte es nicht gegeben, und was wäre dann wohl aus Jack Aubrey geworden? Ein kleiner Leutnant bis ans Ende seiner Tage. Nein, nein: In seinem Beruf kann sich ein Mann gar nicht genug auszeichnen. Und was das Geld angeht, bin ich nicht sicher, ob er davon je genug haben kann. Wie dem auch sei – die Leopard geht nach Ostindien. Nicht, dass wir dort viel Pulver riechen würden«, fügte er mit einem Seitenblick auf Sophie hinzu. »Und das Schöne daran ist, dass in Botany Bay eine undurchsichtige Situation entstanden ist. Die Leopard wird also nach Süden segeln, sich mit der Lage dort unten befassen und dann irgendwo bei Penang zu Admiral Drury stoßen. Unterwegs sollen wir Beobachtungen und Messungen durchführen. Denk nur an die Möglichkeiten, Stephen: Tausende von Meilen fast unbekannter See und unerforschter Küste – Wombats am Strand für den, der will, denn wenn das auch keine von deinen gemütlichen Erkundungsreisen ist, bin ich doch sicher, dass für ein Känguru oder einen Wombat immer Zeit sein wird, wenn irgendein wichtiger Ankerplatz vermessen werden muss – die Position von Inseln bestimmen, die sicher noch nie ein Mensch betreten hat – und dann, bei ungefähr hundertfünfzig Grad Ost und zwanzig Grad Süd genau am richtigen Ort sein für die Sonnenfinsternis, wenn wir das mit der Zeit hinbekommen. Denk an die Vögel, Stephen, denk an die Käfer und an die Kasuare, vom Tasmanischen Teufel ganz zu schweigen! So eine Gelegenheit für einen Kerl mit Wissenschaft im Kopf hat es doch seit den Tagen von Cook und Sir Joseph Banks nicht gegeben!«
»Es klingt nach einer wunderschönen Reise«, sagte Stephen, »und ich wollte schon immer Neu-Holland sehen. Die Fauna dort – Monotremen und Marsupialier … Aber sag mir eins, auf was für eine undurchsichtige Lage spielst du an, was ist denn der Stand der Dinge in Botany Bay?«
»Erinnerst du dich an Brotfrucht-Bligh?«
»Nein, leider nicht.«
»Natürlich erinnerst du dich, Stephen. Der Bligh, den sie vor dem Krieg mit der Bounty nach Tahiti geschickt haben, damit er dort Brotfrüchte für Westindien beschafft.«
»Ja, natürlich! Er hatte einen exzellenten Botaniker an Bord, David Nelson, war ein sehr vielversprechender junger Mann, schade um ihn. Gerade neulich habe ich sein Werk über die Bromelien in der Hand gehabt.«
»Dann wirst du dich erinnern, dass seine Leute gemeutert und ihm das Schiff weggenommen haben?«
»Sicher, ich erinnere mich dunkel. Sie haben das Schiff bei der Insel Tahiti verlassen. Er hat aber überlebt, oder?«
»Ja, aber nur, weil er so ein erstklassiger Seemann ist. Sie haben ihn in ein Boot mit sechs Rudern und sehr wenig Proviant gesteckt, bis an die Dollborde überfüllt mit neunzehn Männern, und er hat es fast viertausend Meilen nach Timor gesteuert. Was für eine erstaunliche Leistung! Mit seinen Untergebenen scheint er nicht so eine geschickte Hand zu haben: Vor einiger Zeit machte man ihn zum Gouverneur von Neusüdwales, und jetzt heißt es, seine Offiziere hätten wieder eine Meuterei gegen Bligh angezettelt, ihn abgesetzt und eingesperrt. Zum größten Teil Leute aus der Armee, wie ich glaube. Wie du dir vorstellen kannst, ist die Admiralität alles andere als glücklich darüber, und sie schicken jetzt einen hochrangigen Offizier mit dem nötigen Dienstalter dahin, der soll die Situation bereinigen und nach eigenem Ermessen entweder Bligh wieder einsetzen oder zurück in die Heimat bringen.«
»Was ist dieser Mr Bligh für ein Mensch?«
»Ich persönlich habe ihn nie getroffen, aber ich weiß, dass er unter Cook als Master gesegelt ist. Dann hat man ihm ein Offizierspatent gegeben, eine dieser seltenen Beförderungen aus der Dienstgradgruppe der Decksoffiziere – als Belohnung für ungewöhnliche seemännische Tüchtigkeit, nehme ich an. Bei Camperdown hat er sich gut geschlagen, hat die Director mit ihren vierundsechzig Kanonen mitten unter die holländischen Linienschiffe gebracht und ist dann beim Admiral der Holländer längsseits gegangen. Blutiger kann man sich einen Kampf kaum wünschen. Und vor Kopenhagen hat er sich auch nicht versteckt. Nelson hat ihn in seinem Bericht ausdrücklich erwähnt.«
»Vielleicht ist er ein weiteres Beispiel dafür, wie Befehlsgewalt einen Mann korrumpiert.«
»Das mag schon sein. Ich kann dir nicht viel über ihn sagen, aber ich weiß einen, der das kann. Erinnerst du dich an Peter Heywood?«
»Peter Heywood? Ein Vollkapitän, der mit uns bei dem Dinner an Bord der Lively war? Der Gentleman, den Killick mit der kochenden Fruchtsoße begossen hat? Ich musste ihn wegen nicht unerheblicher Verbrennungen behandeln.«
»Genau den Mann meine ich.«
»Wie kam es denn, dass die Soße kochte?«, fragte Sophie.
»Der Hafenadmiral war bei uns, und er sagt immer, Fruchtsoße muss kochen, sonst taugt sie nichts, also haben wir ein kleines Stövchen bis knapp achtern von der Luke der Kapitänskajüte verholt. Ja, das ist er: der einzige Vollkapitän in der Marine, der je wegen Meuterei zum Tode verurteilt worden ist. Er war einer von Blighs Kadetten auf der Bounty und einer der wenigen Männer, oder besser Jungs, die man gefasst hat.«
»Wie kam er dazu, etwas so Unüberlegtes zu tun?«, fragte Stephen.
»Er schien mir ein sanfter und friedfertiger Gentleman zu sein. Als ihm der Admiral Vorhaltungen wegen der herumspritzenden Soße machte, hat er das mit einer bescheidenen Art hingenommen, die ihm sehr gut anstand. Und die Soße selbst hat er mit solch spartanischer Härte ertragen, dass mir eine derart unbedachte Verhaltensweise bei ihm kaum vorstellbar scheint. War es jugendlicher Übermut, eine plötzlich aufwallende Abscheu gegen Bligh oder die Liebe zu einer Frau?«
»Hab ich ihn nie gefragt«, sagte Jack. »Ich weiß nur, dass er und vier andere hängen sollten. Ich war damals noch ein Jungspund auf der Tonnant und habe drei von ihnen gesehen, wie sie mit einer Kapuze über den Augen zur Rahnock der Brunswick hinaufklettern mussten. Aber der König sagte, es wäre Unsinn, den jungen Peter Heywood aufzuknüpfen. Also wurde er begnadigt, und bald darauf gab ihm Admiral Howe, der immer schon etwas für ihn übriggehabt hatte, das Offizierspatent. Genaueres über das ganze Hin und Her habe ich nie erfahren, obwohl Heywood und ich auf der Fox Bordkameraden waren. Ein Kriegsgericht ist eine heikle Sache, da rührt man nicht einfach dran! Wir können ihn aber sicher zu Bligh befragen, wenn er am Donnerstag hierherkommt. Es ist wichtig zu wissen, mit was für einem Mann wir es zu tun haben werden. Auf jeden Fall will ich von ihm etwas über die Gewässer dort unten erfahren. Er kennt sie gut, weil er in der Endeavour-Straße einmal Schiffbruch erlitten hat! Und was noch wichtiger ist: Er soll mir ein paar kleine Eigenheiten der Leopard verraten, er befehligte sie nämlich im Jahr fünf. Oder war es sechs?«
Sophies wachsames Ohr fing von ferne ein leises Geheul auf, viel schwächer zwar, als es vor einiger Zeit gewesen wäre, als Ashgrove Cottage noch aus allen Nähten platzte, aber doch vernehmbar.
»Jack«, sagte sie im Gehen, »vergiss nicht, Stephen die Pläne für die Orangerie zu zeigen. Stephen weiß alles über Orangen.«
»Das werde ich«, sagte Jack. »Zuerst aber – Stephen, noch ein wenig Kaffee? Da ist noch genug in der Kanne – zuerst aber will ich dir von einem noch interessanteren Plan erzählen. Hast du den Wald vor Augen, in dem die Wespenbussarde ihr Nest haben?«
»Ja, ja. Die Wespenbussarde.« Stephens Augen leuchteten auf. »Ich habe einen Unterstand für sie mitgebracht.«
»Was sollen die denn mit einem Unterstand? Sie haben ein sehr ansehnliches Nest.«
»Das ist ein tragbarer Unterstand. Ich habe vor, ihn zuerst am Waldrand aufzustellen und dann nach und nach bis auf den Hügel vorzurücken, der ihren Nistbaum überragt. Dort werde ich dann ganz bequem und unbeobachtet sitzen, geschützt vor den Unbilden des Wetters, und die Entwicklung ihrer familiären Verhältnisse verfolgen. Er hat Fensterklappen und ist mit allem ausgestattet, was man zur Observation braucht.«
»Nun gut. Also, ich habe dir doch die römischen Minenschächte gezeigt, erinnerst du dich? Meilenlang und sehr gefährlich – aber weißt du auch, was die Römer dort abgebaut haben?«
»Blei.«
»Und weißt du, woraus alle diese knolligen Hügel bestehen? Auf einem davon willst du deinen Unterstand aufstellen.«
»Schlacke.«
Jack beugte sich vor, den unmissverständlichen Ausdruck überlegenen Wissens im Gesicht: »Jetzt, Stephen, werde ich dir etwas erzählen, was du zur Abwechslung einmal noch nicht wusstest. Diese Schlacke ist voller Blei – vor allem aber: Das Blei enthält Silber. Das römische Schmelzverfahren hat bei Weitem nicht alles Metall herausziehen können. Und da liegen sie nun, tausend und abertausend Tonnen wertvoller Schlacke, und warten nur darauf, mit Kimbers neuer Methode verhüttet zu werden.«
»Kimbers neue Methode?«
»Genau. Du wirst sicher von ihm gehört haben – ein brillanter Bursche. Sein Verfahren besteht darin, dass er mit Auslaugung durch einige besondere Chemikalien beginnt, dann folgt die Trennung nach Grundsätzen, die er selbst entdeckt hat. Das Blei deckt die laufenden Kosten, das Silber ist reiner Gewinn. Die Rechnung würde schon aufgehen, wenn nur ein Teil Blei auf hundertsiebenunddreißig Teile Schlacke käme, dazu ein Teil Silber auf über zehntausend. Nach an die hundert Zufallsproben können wir aber davon ausgehen, dass unsere Schlacke durchschnittlich mehr als siebzehn Mal so viel enthält.«
»Ich bin erstaunt. Dass die Römer in Britannien einmal Silber abgebaut haben, war mir neu.«
»Das war mir auch neu. Aber hier ist der Beweis.« Er trat an ein Schränkchen unter dem Fensterbrett, schloss es auf und entnahm ihm einen großen Bleiklumpen, den er schwankend zum Tisch zurücktrug. Obenauf lag ein kleiner, vier Zoll langer Silberbarren.
»Das ist nur das Ergebnis eines ersten Versuchs«, sagte er. »Nur ein paar Karren Schlacke. Kimber hat einen kleinen Schmelzofen in der alten Feldscheune gebaut, und ich habe das Zeug mit eigenen Augen herausrinnen sehen. Ich wünschte, du hättest dabei sein können.«
»Das wünschte ich auch«, sagte Stephen.
»Es müsste natürlich einiges an Kapital vorgeschossen werden – Straßen, Gebäude, richtige Schmelzöfen und so weiter. Ich dachte, ich könnte die Anteile der Mädchen dafür verwenden, aber wie es scheint, sind das Treuhandgelder, an die ich nicht herankomme. Die sind festgelegt in Konsols und Marineanleihen zu fünf Prozent, obwohl ich nachgerechnet habe, dass es mathematisch unmöglich ist, mit denen auch nur ein Siebtel des hier möglichen Ertrags zu erzielen. Und dabei gehe ich nur von der schlechtesten Probe aus. Ich habe auch nicht vor, das Ganze mit voller Kraft laufen zu lassen, solange ich nicht etliche Jahre an Land vor mir sehe, und zwar ohne Unterbrechung.«
»Liegt das denn im Bereich des Möglichen?«
»O ja. Wenn ich nicht erschlagen oder bei irgendetwas wirklich Schlimmem erwischt werde, müssten sie mir in den nächsten fünf Jahren oder so die Admiralsflagge geben. Vielleicht auch früher, falls die alten Knaben oben auf der Liste nicht mehr so sehr darauf bestehen sollten, am Leben zu bleiben. Es ist schwieriger, für einen Admiral Verwendung zu finden als für einen Kapitän, also werde ich mehr als genug Zeit haben, mir ein Gestüt aufzubauen und meinen Bergbau zu betreiben. Ich will jetzt aber schon einen Anfang machen, ganz bescheiden, nur um die Dinge ins Rollen zu bringen und ordentlich Kapital auf die Seite zu schaffen. Zum Glück stellt Kimber sehr bescheidene Forderungen: Er verpachtet mir sein Patent zur Nutzung und wird die ganzen Arbeiten selbst leiten.«
»Gegen Gehalt?«
»Ja, das und ein Viertel Gewinnanteil. Das Gehalt ist wirklich bescheiden, was ich besonders anständig von ihm finde. Es gibt da nämlich einen Prinzen von Kaunitz, der vor ihm auf den Knien liegt, damit Kimber sich um seine Bergwerke in Transsilvanien kümmert, und der bietet ihm zehn Guineen pro Tag plus ein Drittel Anteil. Er hat mir alle möglichen Briefe von großen Männern in Deutschland und Österreich gezeigt. Aber komm mir jetzt bloß nicht auf die Idee, er wäre einer dieser übereifrigen, pläneschmiedenden Spekulanten, die einem das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Nein, nein, der nicht, das ist ein grundehrlicher Bursche, durch und durch gewissenhaft, und er hat mich fairerweise gewarnt – wir würden vielleicht im ersten Betriebsjahr mit Verlust arbeiten, sagte er. Das ist mir schon klar, trotzdem kann ich’s gar nicht erwarten anzufangen.«
»Aber meine Wespenbussarde wirst du doch wohl in Ruhe lassen, Jack?«
»Um die brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Es gibt da eine lange Anlaufzeit: Kimber braucht mehr Zeit und Geld, um seine Patente wasserdicht zu machen und für bestimmte Experimente. Ich denke doch, die Vögel werden geschlüpft und flügge sein, bevor wir die Schmelzöfen anfahren. Und vor allem eines, Stephen: Du wirst dann schon auf dem Weg zum Wohlstand sein. Eigentlich ist Kimber zwar dagegen, in unser Projekt viel fremdes Risikokapital hineinzulassen, aber er musste mir versprechen, dass du von Anfang an dabei sein darfst, beim Grundsteinlegen, wie er es nannte.«
»Tut mir leid, Jack. Was ich besitze, ist alles angelegt und steckt in Spanien fest. Tatsächlich bin ich hier in England so knapp bei Kasse, dass ich die Absicht habe, dich leihweise um, lass mich sehen« – er warf einen Blick auf einen Zettel – »siebenhundertachtzig Pfund zu bitten.«
»Ich danke dir«, sagte er zu Jack, als dieser mit einem Wechsel auf seinen Bankier zurückkehrte. »Ich bin dir sehr verpflichtet.«
»Ich bitte dich, sprich nicht von Verpflichtung, denk nicht mal daran«, sagte Jack. »Zwischen dir und mir hat so ein Wort einen sehr merkwürdigen Klang. Übrigens ist der auf London gezogen, aber für die kommenden Tage ist reichlich Gold im Haus.«
»Nein, mein Lieber, nein: Das Geld ist für einen besonderen Zweck. Mir persönlich fehlt es an nichts, es geht mir so gut, wie mein bester Freund es nur wünschen kann.«
Der beste Freund musterte ihn zweifelnd. Stephen sah durchaus nicht so aus, als fehle es ihm an nichts, schien er doch innerlich unzufrieden, ja traurig, und äußerlich angespannt und erschöpft zu sein. Allem Anschein nach stand er unter Druck.
»Was meinst du, wollen wir ausreiten?«, fragte Jack. »Ich habe ein paar Männern lose versprochen, sie bei Craddock’s zu treffen. Sie wollen mir Revanche geben.«
»Von ganzem Herzen, ja«, sagte Stephen, aber der Versuch, herzliche Freude vorzutäuschen, verbarg kaum die tiefe Melancholie, und Jack konnte es sich nicht verkneifen zu bemerken: »Stephen, sollte irgendetwas nicht stimmen oder ich dir irgendwie helfen können, verstehst du …«
»Nein, nein, Jack. Aber du bist ein guter Freund. Es stimmt schon, meine Lebensgeister liegen etwas danieder, nur schäme ich mich, dass ich es nicht besser verbergen kann. In London habe ich einen Patienten verloren. Leider kann ich keineswegs sicher sein, ihn nicht durch meinen eigenen Fehler verloren zu haben. Mein Gewissen setzt mir zu, und ich bin tief in Trauer um ihn, er war ein so vielversprechender junger Mann. Und dann habe ich in London auch noch Diana Villiers getroffen.«
»Ach ja«, sagte Jack betreten. »Ganz recht.«
Eine Pause trat ein, in der die Pferde zur Tür gebracht wurden und Stephen Maturin sich an einen dritten Grund für seine Trübsal erinnerte: Er hatte gedankenlos und fahrlässig eine Mappe mit höchst vertraulichen Unterlagen in einer Mietkutsche liegen gelassen. Jack setzte nach: »Villiers hast du gesagt, nicht Johnson?«
»Ja«, antwortete Stephen, während er sich in den Sattel schwang. »Es hat den Anschein, dass der Gentleman in Amerika bereits eine Ehefrau besitzt und eine Eheannullierung – oder was immer sie dort drüben haben – nicht zu bekommen war.«
Das Thema Diana Villiers war für beide heikel, und um seinen Gedanken eine andere Richtung zu weisen, bemerkte Jack, nachdem sie ein gutes Stück geritten waren: »Du denkst doch nicht, dass man für ein Spiel wie Siebzehn und Vier besonderes Talent braucht, oder? Wirklich nicht. Aber diese Kerle ziehen mich immer bis aufs letzte Hemd aus, wenn ich mit ihnen spiele. Du hast beim Pikett das Gleiche mit mir getan, aber das sind zweierlei Stiefel.«
Stephen gab keine Antwort, sondern trieb sein Pferd schneller und schneller über den kahlen Hügel; vornübergebeugt saß er im Sattel mit einem Ausdruck so grimmiger Entschlossenheit im Gesicht, als sei er auf der Flucht. So ritten sie in leichtem und mittlerem Galopp über den festen Grasboden dahin, bis sie den Kamm von Portsdown Hill erreichten. Dort zügelte Stephen sein Pferd vor dem steilen Abhang. Sie verharrten eine Weile, eingehüllt in den Geruch von erhitzten Pferden und Leder, und blickten hinunter in das weite Rund des Hafens mit Spithead, der Isle of Wight und dem Kanal in der Ferne: Kriegsschiffe lagen vertäut an den Liegeplätzen, liefen ein oder aus; ein riesiger Konvoi lief vor der Halbinsel von Selsey mit der Tide aus.
Sie lächelten sich zu, und Jack überkam das Vorgefühl von etwas sehr Wichtigem, das Stephen jetzt sagen würde. Aber die Ahnung trog ihn, Stephen erinnerte ihn lediglich daran, dass Sophie sie gebeten hatte, von Holland’s Fisch mitzubringen, darunter drei Schollen für die Kinder.
Bei Craddock’s gingen gerade die Lichter an, als sie die Pferde dem Stallknecht übergaben. Jack führte Stephen unter einer Reihe edler Kandelaber hindurch zum Spielzimmer, wo er dem Mann am kleinen Tisch hinter der Tür achtzehn Pence gab, seinen Blick durch den Raum schweifen ließ und sagte: »Hoffen wir, das Spiel lohnt die Kerze.« Craddock’s wurde von wohlhabenderen Offizieren, Gentlemen vom Lande, Anwälten, Beamten diverser Regierungsbehörden und anderen Zivilisten frequentiert, und unter diesen erblickte Jack auch die Männer, nach denen er suchte. »Dort sind sie«, sagte er, »im Gespräch mit Admiral Snape. Der mit der Perücke ist Richter Wray, der andere ist sein Cousin, Andrew Wray, ein wichtiger Mann in Whitehall, verbringt die meiste Zeit da unten in Angelegenheiten des Marineministeriums. Ich denke, die werden unseren Tisch schon komplett haben: Carroll sehe ich, wie er wartet, bis sie mit dem Admiral durch sind – der lange Kerl im himmelblauen Rock und weißen Pantalons. Das ist mal ein Mann, der wirklich etwas von Pferden versteht. Seine Ställe hat er drüben hinter Horndean.«
»Rennpferde?«
»Aber sicher. Seinem Großvater gehörte Potoo, also hat er es im Blut. Nimmst du vielleicht ein Blatt? Wir spielen hier französisch.«
»Ich glaube nicht. Aber ich setze mich neben dich, wenn ich darf.«
»Ich würde mich sehr freuen – du wirst mir ein wenig von deinem Glück bringen. Glück im Spiel hattest du ja immer schon. Jetzt muss ich zu dem Tisch dort und ein paar Spielmarken kaufen.«
Jack verschwand, während Stephen von Tisch zu Tisch wanderte. Viele waren bereits besetzt, an anderen spielten ernste Männer konzentriert und tief versunken einen sehr wissenschaftlichen Whist, und doch hatte er das Gefühl, der Abend habe noch gar nicht richtig begonnen. Er traf ein paar Leute, die er aus der Navy kannte, und einer von ihnen, Kapitän Dundas, sagte zu ihm: »Ich hoffe, er wird heute Abend wieder Lucky Jack Aubrey sein. Als ich zuletzt hier war …«
»Da bist du ja, Heneage«, rief Jack, als er zu ihnen stieß. »Kommst du mit? An unserem Tisch wird Siebzehn und Vier gespielt.«
»Nichts für mich, Jack. Wir armen Bettler mit unserem halben Landsold können mit Nabobs wie dir doch nicht mithalten.«
»Dann komm, Stephen. Sie setzen sich gerade.« Er führte Stephen an das andere Ende des Raumes. »Richter Wray«, sagte er, »gestatten Sie mir, Ihnen Dr. Maturin vorzustellen, meinen speziellen Freund. Mr Wray. Mr Carroll. Mr Jenyns.« Sie begrüßten einander, tauschten einige höfliche Bemerkungen aus und nahmen dann an dem breiten, mit grünem Fries ausgeschlagenen Tisch Platz. Der Richter war von seiner beruflich bedingten Unergründlichkeit auch im privaten Bereich derart durchdrungen, dass Stephen keinen Eindruck von ihm mitnahm außer dem Bild eines Mannes, der von seiner eigenen Wichtigkeit zutiefst überzeugt war. Andrew Wray, sein Cousin, war etwas jünger und offensichtlich wesentlich intelligenter. Er hatte unter der politischen Führungsriege der Admiralität gedient; Stephen hatte gehört, er werde mit der Patronagebehörde und dem Schatzamt in Verbindung gebracht. Jenyns ließ sich gar nicht einordnen, der Mann hatte eine große Brauerei geerbt und dazu ein breites, blasses und nichtssagendes Gesicht. Dagegen war Carroll deutlich interessanter, genauso groß wie Jack, aber schmaler, mit einem länglichen Gesicht, das große Ähnlichkeiten mit dem eines Pferdes hatte – jedoch eines Pferdes mit sehr viel Temperament und Verstand. Beim Mischen fiel der joviale Blick seiner blauen Augen (so blau wie die von Jack) auf Stephen, und ein so außergewöhnlich gewinnendes Lächeln überzog sein Gesicht, dass dieser einfach gezwungen war, zurückzulächeln. Ein Strom von Karten floss unter Carrolls Händen gehorsam hin und her.
Jeder zog eine Karte, und es war Mr Wray, der austeilen durfte. Stephen war mit ihrer Version des Spiels nicht vertraut, wenn er auch dessen kindlich einfache Grundregeln sofort begriff, und für eine Weile amüsierten ihn die Rufe wie »Zehn im Kopf«, »Rouge et Noir«, »Sympathie und Antipathie«, »Ich und wir« und »Zifferblatt«. Es bereitete ihm auch einiges Vergnügen, in den Gesichtern der Tischrunde zu lesen: Die Pomphaftigkeit des Richters wich verstohlener Befriedigung, die wiederum einer sauertöpfischen Miene, zu der sich noch ein bösartiges Zucken der Mundwinkel gesellte; die gewollte Nonchalance seines Cousins wurde ab und zu durch das Aufblitzen seiner Augen Lügen gestraft, Carrolls ganze Person strahlte intensiven Tatendrang und eine Lebensenergie aus, die Stephen an seinen Freund erinnerte, wenn er sein Schiff in den Kampf führte. Jack schien mit allen auf sehr vertrautem Fuße zu stehen, selbst mit dem phlegmatischen Jenyns, so als kenne er sie ohne Ausnahme seit vielen Jahren. Aber das musste nichts bedeuten, denn sein offenes, freundliches Wesen ließ ihn in jeder Runde bestens ankommen, und Stephen hatte ihn schon unter Gentlemen vom Lande reüssieren sehen, die von nichts anderem als ihren Jungstieren reden konnten.
Auf dem Tisch lagen anstatt des Geldes nur Spielmarken. Diese wanderten von einem Platz zum anderen, zunächst noch ohne erkennbare Tendenz. Da Stephen nicht wusste, für welche Werte sie standen, verflüchtigte sich sein Interesse am Spiel sehr schnell. Die Form einiger Spielmarken erinnerte ihn an Sophies Fische, daher zog er sich leise zurück und ging die geschäftige High Street hinunter, vorbei am George bis zu Hollands Geschäft, wo er die Schollen und ein paar schöne, dicke Neunaugen erstand (die aß er am liebsten). Mit den eingewickelten Fischen unter dem Arm gelangte er zum Hard, wo die Besatzung der Mentor, die gerade ihren Sold erhalten hatte, mit viel Geschrei und unter lauten Hallorufen rings um ein Freudenfeuer tanzte. Um die Seeleute drängte sich eine wachsende Menge stämmiger und stark gebauter junger Frauen, die als »Pferdchen« bekannt waren, herumlungernde Lehrjungen und Taschendiebe. Das Feuer sandte seinen glutroten Schein weit hinauf in den nächtlichen Himmel. Hoch oben kreisten aufgeschreckte Möwen, die Flügel rosa im Widerschein des Feuers, und inmitten der Flammen hing eine Puppe, die den Ersten Offizier der Mentor darstellen sollte. »Kamerad«, flüsterte Stephen einem benebelten Seemann ins Ohr, dessen »Pferdchen« ihn gerade vor aller Augen bestahl, »habe ein Auge auf deinen Geldbeutel.« Noch während er sprach, fühlte er, wie jemand ihm das Päckchen unter seinem Arm mit einem starken Ruck entriss – weg waren die Neunaugen und Schollen. Der Bösewicht, ein winziger Dreikäsehoch, verschwand blitzschnell in der brodelnden Menge, und Stephen begab sich zurück zum Laden, konnte jetzt aber nur noch einen sündhaft teuren Lachs und zwei vertrocknete Plattfische erstehen.
Je mehr sie sich an seiner Brust erwärmten, desto auffälliger stanken sie, deshalb ließ er das Päckchen bei den Pferden und kehrte dann auf seinen Platz am Tisch zurück. Nichts schien sich verändert zu haben, nur Jacks Vorrat an Spielmarken war sichtbar zur Neige gegangen. Immer noch riefen sie eine Runde »Bezahl die Zahl« oder »Antipathie« aus, aber jetzt hing eine merkliche Spannung über allem. Jenyns’ bleiches, breites Gesicht schwitzte stärker als zuvor, Carroll wirkte durch und durch elektrisiert vor Aufregung, und die zwei Wrays gaben sich jetzt noch kälter und kontrollierter. Jack zog eine Karte und wischte dabei eine der ihm verbliebenen Spielmarken, einen Fisch aus Perlmutt, vom Tisch. Stephen hob ihn auf, worauf Jack sagte: »Danke dir, Stephen, das ist ein Pony.«
»Für mich sieht es eher nach einem Fisch aus«, sagte Stephen.
»Das ist unser Slang für fünfundzwanzig Pfund«, erklärte Carroll und schenkte ihm ein Lächeln.
»Tatsächlich?« Stephen dämmerte es, dass hier um viel höhere Einsätze gespielt wurde, als er je gedacht hätte. Er beobachtete das einfältige Spiel mit wachsender Aufmerksamkeit und begann es bald merkwürdig zu finden, wie viel, wie oft und wie regelmäßig Jack verlor. Die Hauptgewinner waren Andrew Wray und Carroll; der Richter schien weder nennenswert gewonnen noch verloren zu haben; Jack und Jenyns dagegen hatte das Glück verlassen, beide riefen nach neuen Spielmarken, kaum dass Stephen eine halbe Stunde zurück war. Während dieser halben Stunde war er zu der Überzeugung gelangt, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Die Wahrscheinlichkeitsgesetze wurden von irgendetwas außer Kraft gesetzt. Was es genau war, wusste er nicht zu sagen, aber sollte es ihm gelingen, sozusagen den Code zu knacken, würde er Beweise für das Zusammenspiel finden, das er vermutete. Ein fallen gelassenes Taschentuch gab ihm Gelegenheit, ihre Füße zu sehen – ein häufiges Kommunikationsmittel –, aber er fand nichts Ungewöhnliches. Worin bestand das Zusammenspiel? Zwischen wem? Verlor Jenyns tatsächlich so viel, wie es den Anschein hatte, oder hatte er ihn unterschätzt? In diesen Dingen konnte man leicht zu schlau sein und sich übernehmen, am Ziel vorbeischießen: In der Naturwissenschaft wie im politischen Geheimdienst lautete eine bewährte Regel, zuerst das zu prüfen, was offen zutage tritt, und die leichten Teile des Problems zu lösen. Der Richter hatte die Angewohnheit, mit den Fingern auf die Tischplatte zu trommeln, sein Cousin ebenso. So etwas war ja nicht unnatürlich, aber trommelte Andrew Wray nicht auf irgendwie besondere Art? Seine klopfenden Finger schlugen weniger den üblichen rollenden Rhythmus, sie waren vielmehr auf der Suche nach einer Melodie und deren Variationen. Irrte er, wenn er zu beobachten meinte, dass Carroll seine wachen Piratenaugen auf diese Finger gerichtet hielt? Es war unmöglich zu entscheiden, und so bewegte er sich um den Tisch herum, bis er hinter Wray und Carroll zu stehen kam, um zu sehen, ob zwischen dem Trommeln und den Karten in ihren Händen möglicherweise eine Verbindung bestand. Sein Zug brachte ihn jedoch in dieser Richtung nicht weiter. Er hatte erst kurz auf seiner neuen Position gestanden, als Wray nach Sandwiches und einem halben Pint Sherry verlangte und das Trommeln aufhörte – eine Hand, die ein Sandwich hält, ist naturgemäß dazu nicht in der Lage. Mit Ankunft des Weines aber erlangten die Gesetze der Wahrscheinlichkeit ihre Geltung und Wirkung wieder: Jacks Blatt wendete sich, Fische kehrten in kleineren Schwärmen zu ihm zurück, und er stand etwas reicher vom Tisch auf, als er dort Platz genommen hatte.
Man hätte tatsächlich glauben können, alle anwesenden Gentlemen hätten nur zum Vergnügen und um nichts weiter gespielt, so wenig sichtbare Emotionen zeigten sie. Auch sein Freund vermied es, eine unschickliche Selbstzufriedenheit an den Tag zu legen, aber Stephen wusste, dass er sich insgeheim freute.