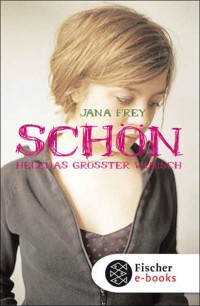Der verlorene Blick - Eine ermutigende Geschichte über Verlust und den Weg zurück ins Leben E-Book
Jana Frey
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Leonie ist 15 Jahre alt, als sich ein entsetzlicher Unfall ereignet, nach dem sie in einer Welt aus Dunkelheit erwacht: Sie ist blind. Und sie droht daran zu zerbrechen. In ihrer Verzweiflung zieht Leonie sich immer mehr zurück und lässt auch ihren Freund Frederik nicht mehr an sich heran. Doch ihre Familie kämpft um Leonie. Letztendlich gelingt es ihr, die Situation zu akzeptieren und sie nimmt ihr Leben wieder selbst in die Hand. Doch kann sie auch Frederik zurückgewinnen? Der Roman fördert Empathie und Toleranz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Leonie und außerdem für Hildegund Hippler, die mein Leben schon seit vielen Jahren sehr fürsorglich begleitet und mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht …
„Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten.
Prolog
Leonie ist hübsch. Als wir uns zum ersten Mal treffen, haben wir schon drei Verabredungen hinter uns, die sie jedes Mal kurzfristig wieder abgesagt hat.
Aber diesmal hat sie nicht abgesagt und wir haben uns in einem italienischen Eiscafé in der Innenstadt verabredet.
Leonie ist schon da, als ich komme.
Ich sehe sie gleich. Sie sitzt alleine an einem der kleinen Bistrotische und hat ihr Kinn in die Hände gestützt. Es sieht ganz danach aus, als beobachte sie eine Gruppe Kinder und Jugendliche, die mit Skateboards und Inlineskates durch die völlig überfüllte Fußgängerzone flitzen.
Leonies Haare sind millimeterkurz geschnitten und hellblond gefärbt. Auf der Nase hat sie ein paar Sommersprossen und ihre Augen sind hinter einer dunklen „Blues-Brothers-Sonnenbrille“ versteckt.
Ihre Fingernägel sind grün lackiert und sie trägt eine alte, verwaschene Jeansjacke mit hochgekrempelten Ärmeln. An ihrem linken Ohr baumelt ein Bart-Simpson-Ohrring und in ihrem rechten Ohrläppchen stecken fünf kleine silberne Ohrstecker in einer ordentlichen Reihe.
Trotzdem ist es nicht zu übersehen, dass Leonie blind ist. Neben ihrem Stuhl lehnt ihr weißer Langstock und an ihren Armen trägt sie über den hochgeschobenen Jackenärmeln jeweils eine gelbe Stoffbinde mit drei schwarzen Punkten, die miteinander ein Dreieck bilden.
Ich habe mich ein paar Minuten verspätet, weil ich mit dem Auto gekommen bin und lange nach einem Parkplatz suchen musste.
Während ich zu dem kleinen Tisch hinübergehe, an dem Leonie sitzt, sehe ich, wie sie mit der rechten Hand eine kleine Klappe an ihrer bunten Armbanduhr öffnet und blitzschnell mit ihren Fingerspitzen das Zifferblatt abtastet.
„Hallo, Leonie“, sage ich schnell und entschuldige mich für meine Verspätung.
„Hallo“, antwortet Leonie, dreht ihren Kopf in meine Richtung und lächelt mir zu.
Ich setze mich und Leonie scheint mich schweigend zu mustern. Plötzlich nimmt sie ihre Sonnenbrille ab und klemmt sie in den Ausschnitt ihres T-Shirts.
„Ich trage sie nämlich nicht nur, weil ich blind bin“, erklärt Leonie. „Ich meine, ich habe sie auch schon vorher getragen. Mein Bruder hat sie mir aus Amerika mitgebracht, als er vom Schüleraustausch zurückkam.“
Leonie seufzt.
Ich schaue mir ihr schönes, blasses, ernstes Gesicht an. Die Wimpern, die ihre geschlossenen Augen umgeben, sind ungewöhnlich lang und schnurgerade. Ihre Augenlider zucken ab und zu und kommen mir sehr verletzlich vor.
„Es ist merkwürdig, an meinen älteren Bruder zu denken“, fährt Leonie fort und seufzt wieder.
„Warum?“, frage ich.
Leonie runzelt die Stirn und schweigt eine Weile, ehe sie weiterspricht. „Er heißt Siemen“, sagt sie schließlich. „Und er ist zwei Jahre älter als ich. Früher haben wir ziemlich viel gestritten, aber natürlich haben wir uns auch gut verstanden, sehr gut sogar. Siemen war immer wichtig für mich – aber jetzt ist er merkwürdigerweise der Erste, an dessen Gesicht ich mich nicht mehr richtig erinnern kann.“
Leonies Finger trommeln gedankenverloren auf den kleinen Bistrotisch. „Es kam ganz allmählich und schleichend. Ich meine, ich habe gemerkt, wie mir die Erinnerung an sein Gesicht nach und nach entglitten ist. Das war ein schreckliches Gefühl. Es war schrecklich, weil ich es, als es einmal angefangen hatte, einfach nicht mehr aufhalten konnte.“
Mühelos greift Leonie nach ihrem Colaglas und trinkt einen Schluck. „Die Gesichter meiner Eltern habe ich aber zum Glück noch im Kopf und das Gesicht meines kleinen Bruders auch. Er heißt Grischa und ist erst sieben.“
Leonie ist seit zwei Jahren blind und in den folgenden Wochen erzählt sie mir eine Menge aus ihrem Leben. Während wir sprechen läuft fast immer ein kleines Aufnahmegerät mit, und Leonie möchte von jeder Aufnahme eine Kopie haben.
„Ich bin durch die Hölle gegangen, damals“, sagt sie einmal. „Ich wollte, nachdem es passiert war und ich es begriffen hatte, lieber tot sein als blind. Ich bin fast durchgedreht vor Verzweiflung. Und vor Entsetzen. Und vor Wut. Ich dachte damals, alles wäre aus und vorbei und mein ganzes Leben eine Ruine …“
Leonie schweigt lange nach diesem Satz und ich habe sie in den vergangenen Wochen gut genug kennengelernt, um zu wissen, dass es in solchen Momenten sinnlos ist, weitere Fragen zu stellen.
Ein paar Tage später ruft mich Leonie an und sagt, sie wolle mich bei unserer nächsten Verabredung nicht wieder in dem Eiscafé und auch nicht in der Pizzeria in ihrer Straße treffen, sondern stattdessen in einem neuen Kulturzentrum in der Nähe des Bahnhofes.
„Siemen bringt mich hin“, erklärt sie. „Es gibt im Keller des Kulturzentrums ein kleines Café. Da will ich mit dir hingehen. Das Café heißt ,Dunkelbar‘. Dort arbeitet ein guter Freund von mir.“
Also treffen wir uns ein paar Tage darauf im Keller des neuen Kulturzentrums vor dem Eingang zur „Dunkelbar“.
Die „Dunkelbar“ ist ein Café, das man durch einen pechschwarzen Samtvorhang betritt, und hinter diesem schwarzen Vorhang ist ein weiterer schwarzer Vorhang, schwer und undurchdringlich, und hinter diesem Vorhang ist ein langer schwarzer Gang, in den von nirgendwoher ein Lichtstrahl fällt, und am Ende dieses Ganges, den ich mich unsicher entlangtaste, ist ein finsteres Nichts.
Ich fühle mich ziemlich hilflos, als ich merke, dass die dunkle Wand, an der ich mich bisher orientiert habe, jetzt verschwunden ist.
„Hier ist ein freier Tisch“, sagt Leonie in diesem Moment ruhig und zupft mich am Jackenärmel. „Komm, setzen wir uns …“
Um uns herum höre ich ein paar vereinzelte Stimmen, und im Hintergrund singt Madonna leise „American Pie“, ganz wie in einem normalen Lokal.
„Na, was wollt ihr beiden trinken?“, erkundigt sich gleich darauf eine männliche Stimme, die noch sehr jung klingt und ganz plötzlich und lautlos neben uns aufgetaucht ist.
Leonie bestellt wieder eine Cola und ich nehme einen Tee.
„Wie gefällt es dir hier?“, fragt Leonie neugierig, nachdem wir unsere Getränke bekommen haben, in völliger Finsternis.
„Es ist merkwürdig und fast ein bisschen unheimlich“, sage ich und taste auf dem unsichtbaren Tisch nach dem unsichtbaren Schälchen mit dem Kandis. Ich stoße dabei leicht gegen Leonies unsichtbares Colaglas.
„Für mich ist es hier drin so wie überall“, sagt Leonie.
Dann schweigt sie wieder und ich schweige ebenfalls und wir hören der Musik zu.
„Heute hasse ich es nicht mehr so sehr, blind zu sein“, sagt Leonie irgendwann. „Aber schwierig finde ich es schon noch oft. Manchmal fühle ich mich sehr einsam und dann sehne ich mich wie verrückt nach Licht. Nach Licht und nach der Sonne und nach Farben. Nach dem blauen Himmel im Frühling und nach dem Gelb der Sonnenblumen im Sommer und dem Grün von Gras und so weiter. Als ich noch klein war, waren wir ein paarmal in Dänemark in den Ferien. Ich erinnere mich gut an die wilden grauen Wolken, die da manchmal über den Himmel jagten, wilde, unordentliche graue Wolkenfetzen – die würde ich auch gerne mal wieder sehen …“
1
Es war vor zwei Jahren und es war Frühling und ich tat eine Menge Sachen, die ich eigentlich nicht tun durfte.
Es fing damit an, dass mein Vater Ende Februar verkündete, er würde im März und April in Australien sein, wo er vorhabe, den März arbeitend und den April freizeitlich zu verbringen. Mein Vater heißt Ben und ist Diplompsychologe. Er betreute damals hin und wieder ein Jugendcamp am Rande von Melbourne, in dem schwer erziehbare, straffällig gewordene Jugendliche aus Deutschland weit weg von allen schlechten Einflüssen resozialisiert werden sollten. Mit Reitkursen und Tauchkursen und Segelkursen und solchen Dingen. Und eben mit psychologischen Gruppentherapien, in denen sie sich mit anderen Jugendlichen und einem Psychologen über ihre Sorgen und ihr bisheriges Leben austauschen sollen. Diese Gruppengespräche leitete damals unter anderem mein Vater. Und im April wollte er sich dann, wie er uns erklärte, endlich einmal selbst wieder eine Brise Freiheit genehmigen und ebenfalls einen Tauchkurs machen. Und vielleicht einen Segelschein. Ganz so wie seine straffälligen Jugendlichen. Nur dass er noch nie eine Straftat begangen hatte. Und er wollte auch nicht am Stadtrand von Melbourne bleiben, sondern querbeet und nach Lust und Laune durch Australien reisen.
Mein Bruder Siemen und ich nickten einträchtig zu diesen Frühlingsplänen unseres Vaters. Schließlich waren wir es von klein auf gewöhnt, dass er mehr unterwegs war als zu Hause.
Und so packte mein Vater Anfang März seine Sachen und wir alle fuhren ihn zum Flughafen.
„Bis in etwa acht Wochen dann, ihr Hottentotten“, sagte er, ehe er durch die Flughafenabsperrung ging, die zu seinem Abflug-Gate führte. Er nahm uns der Reihe nach in den Arm, ganz kurz bloß, in unserer Familie wird von jeher nicht viel geküsst oder in den Arm genommen. „Macht keinen verrückten, irreparablen Blödsinn, solange ich weg bin, verstanden?“
Wir nickten, Siemen und Grischa und ich, wobei Siemen ein bisschen genervt die Augen verdrehte.
„Aber wenn ich in die Schule komme, dann bist du doch ganz sicher wieder zurück?“, erkundigte sich Grischa zum Schluss noch misstrauisch.
„Versprochen“, sagte mein Vater, und diesmal verdrehte Siemen zwar nicht die Augen, aber er warf mir stattdessen einen kurzen, bedeutungsvollen Blick zu, der hieß, dass wir ja alle wussten, was von den Versprechen unseres Vaters zu halten war.
Ganz zum Schluss erst wandte sich mein Vater meiner Mutter zu.
„Bis bald, liebste Helen“, sagte er, lächelte und tippte mit seinem Zeigefinger ein paarmal auf die sommersprossige Nase meiner Mutter. „Pass gut auf unseren werten Nachwuchs auf …“
„So gut wie immer“, antwortete meine Mutter. Sie ist Engländerin und Tänzerin und sehr dünn und sommersprossig und hat einen sehr blassen Teint, aber schöne grüne Augen mit langen, schnurgeraden Wimpern drum herum. Sie riecht immer ein bisschen nach einer Mischung aus Pfefferminz und Lavendel, weil sie ständig kleine Pfefferminzpastillen lutscht und zum Waschen ausschließlich englische Lavendelseife benutzt, die sie sich von meinem englischen Großvater regelmäßig zuschicken lässt. Meine englische Großmutter ist schon vor ein paar Jahren gestorben.
Nachdem wir meinem Vater noch ein bisschen hinterhergewinkt und hinterhergeschaut hatten, machten wir uns auf den Rückweg zum Parkhaus, wo unser Auto stand.
„Wir könnten allerdings auch noch auf die Aussichtsterrasse gehen und Papas Flieger beim Start zuschauen“, schlug Siemen vor. „Was hältst du davon, Einstein Junior?“
Mit Einstein Junior meinte er Grischa.
Aber Grischa hielt nichts davon. Er wollte lieber nach Hause zu seiner Geige. Grischa spielt Geige wie ein Verrückter und er hatte damals schon eine Menge Auszeichnungen und Preise gewonnen. Sein erklärtes Ziel war es, einmal ein weltberühmter Geiger zu werden. Und laut der Meinung seines winzigen, runzeligen russischen Geigenlehrers, der eigentlich schon viel zu alt zum Unterrichten war, nämlich über neunzig, würde er dieses Ziel auch ohne besondere Anstrengung erreichen. Grischa ist überhaupt ein merkwürdiges Kind, darum heißt er bei uns innerfamiliär ja auch Einstein Junior.
Mit einem halben Jahr hatte er laufen gelernt und mit einem Jahr konnte er sprechen und mit zweieinhalb bediente er unseren Videorekorder besser als Siemen und ich. Mit drei konnte er fließend lesen und bekam auf seinen eigenen Wunsch hin seine erste Geige. Es war eine winzig kleine Sonderanfertigung – sie hängt heute in Grischas Zimmer an der Wand. Inzwischen spielt er auch noch Klavier und seit einem Jahr hat er einen Computer.
Grischa ist genauso dünn und sommersprossig und blass wie meine Mutter und dazu ist er sehr klein und schmächtig und hat eine hohe, durchdringende Stimme. Er hat sogar die gleichen rötlich blonden, wirren Haare wie meine Mutter. Nur seine Augen sind ganz anders als die grünen Augen meiner Mutter, die nur ich von ihr geerbt habe. Grischas Augen sind dunkelbraun wie die meines Vaters.
Siemen dagegen ist riesig, beinahe zwei Meter groß. Er hat ebenfalls braune Augen und er ist sehr hübsch. Schon vor ein paar Jahren haben eine Menge Mädchen aus meiner Klasse für ihn geschwärmt. Sobald im Frühling die Sonne scheint, wird Siemen braun und seine Haare sind nicht rötlich blond, sondern richtig blond.
Ich selbst bin weder auffallend klein wie Grischa, noch auffallend groß wie Siemen. Ich habe höchstens zwanzig Sommersprossen und werde im Sommer so gut wie gar nicht braun. Ich bin auch nicht so klug und begabt wie Grischa und nicht so selbstbewusst und witzig wie Siemen. Ich habe weder blonde noch rötlich blonde Haare, stattdessen waren meine Haare damals einfach braun und höchstens ein bisschen widerborstig und zerstrubbelt. Ich spiele auch kein Instrument, nur ein bisschen Blockflöte, weil wir das in der Grundschule eine Weile lang im Musikunterricht gelernt haben. Nicht mal richtig singen kann ich. Wenn ich es versuche, klingt es immer irgendwie schief, weil ich jedes Mal garantiert mindestens einen Halbton danebenliege. Das einzig wirklich Schöne an meinem Gesicht waren wahrscheinlich meine Augen. In der Grundschule hat meine Religionslehrerin einmal gesagt, meine Augen würden so aussehen, wie sie sich Feenaugen vorstellt. Und als ich im Sommer mit meiner besten Freundin Janne auf eine Jugendfreizeit gefahren bin, hat ein Junge, der schon ein paar Jahre älter war als ich, abends beim Lagerfeuer zu mir gesagt, er fände es prima, ausgerechnet neben dem Mädchen mit den schönsten Augen zu sitzen. Und ein anderes Mal hat eine englische Freundin meiner Mutter, die wir in London besuchten, gemeint, wie schön es sei, dass wenigstens einer von uns Mamas Augen geerbt habe. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich war damals vielleicht elf und Mamas Freundin lächelte mich an und sagte diesen Satz: „Es wäre doch wirklich ein Jammer gewesen, wenn diese wahnsinnigen Augen eines Tages aussterben würden …“
Außer meinen Eltern, meinen Brüdern und mir gibt es bei uns zu Hause noch Hobbes, unseren dicken, behäbigen Kater, der schon sehr alt ist und den wir aus England mit nach Deutschland genommen haben. Das war vor ein paar Jahren, als meine Grandma gestorben war und Hobbes für meinen katzenverachtenden Grandpa eine schreckliche Last darstellte, zumal er nicht gerade das Paradebeispiel eines netten Haustieres ist. Er hat am liebsten seine Ruhe und eine warme Heizung, wo er meistens vor sich hin döst. Wenn man ihn stört, dann ärgert er sich und kratzt und faucht und beißt.
Und dann haben wir noch Grischas Au-pair-Mädchen, das jedes Jahr wechselt und sich um Einstein Juniors leibliches Wohl kümmert, wenn meine Eltern aus beruflichen Gründen unterwegs sind.
Und so war es auch in diesem Frühling. Papa war wie gesagt in Australien und meine Mutter hatte eine Einladung zu einem dreiwöchigen Tanzworkshop nach Amsterdam angenommen.
Damals war gerade Katie Crawford aus Amerika Grischas Au-pair-Mädchen.
„Ist es in Ordnung, wenn ich hinfahre?“, fragte meine Mutter Katie.
Katie Crawford nickte und ich konnte ihr förmlich ansehen, wie sie sich darauf freute, drei Wochen ungestört mit Siemen verbringen zu können.
Katie kaute immerzu große Kugeln amerikanischen Kaugummis und hörte gerne Countrymusic, und sie hatte eigentlich auch eine Menge Sommersprossen im Gesicht, genau wie meine Mutter. Aber anders als Mama konnte sie ihre Sommersprossen wohl nicht besonders gut leiden, denn sie puderte sie sich jeden Morgen im Bad sorgfältig zu. Außerdem hatte Katie Crawford ringelige schwarze Locken und oft Kopfschmerzen und sich gleich nach ihrer Ankunft in Siemen verliebt.
„Sie ist eine wahre amerikanische Katastrophe ohne das kleinste bisschen Grips in ihrem zugegebenerweise hübschen Schädel“, hatte Siemen am Anfang einmal gesagt, weil sich Katie Crawford, sobald er nach Hause kam, jedes Mal sofort wie eine dieser Kletten mit unzähligen kleinen Widerhaken an ihn hängte.
Grischa, der, wenn man ihn Geige spielen ließ und ab und zu mit minimalistischem Essen versorgte, sehr pflegeleicht war, brauchte Katies Aufmerksamkeit und Fürsorge sowieso nicht, und darum hatte Katie jede Menge freie Zeit übrig, die sie damit verbrachte, Siemen aufzulauern und für sich einzunehmen.
Siemen hatte damals eigentlich eine feste Freundin, aber es sollte ja der Frühling der verbotenen Dinge werden, und darum kam der Abend, ein paar Tage nach Mamas Abreise nach Amsterdam, an dem Katie Crawford und Siemen sich küssten. Ich hätte es kommen sehen müssen, denn Katie hatte sich an diesem Morgen zum ersten Mal nicht über ihre Sommersprossen hergemacht, um sie unter einer dicken Schicht rosa Puder zu begraben. Stattdessen saß sie sehr sommersprossig und ringellockig und aufreizend im Wohnzimmer auf der Lauer, als Siemen und ich mit Grischa nach Hause kamen. Nicht mal einen ihrer amerikanischen Kaugummis hatte sie im Mund.
Ich schaute Siemen prüfend von der Seite an und beobachtete, wie er Katie Crawford ansah, und ich flüsterte sogar noch warnend: „Denk an Tamara, die ausflippen wird, wenn du sie hintergehst. Und denk daran, dass Katie Countrymusic liebt, nicht besonders viel Grips im Kopf hat und außerdem in einem halben Jahr zurück nach New Jersey fliegt …“
Aber es nützte nichts. Ich war an diesem Abend dabei und Grischa auch und außer uns beiden meine beste Freundin Janne und Jannes Cousin Frederik.
Und mit diesem Abend begannen die verbotenen Dinge.
2
Es war ziemlich kalt und windig in dieser Nacht. Trotzdem setzten wir uns in den Garten mitten auf die Wiese, Siemen und Katie Crawford, Grischa und ich und Janne und ihr Cousin Frederik. Frederik war so alt wie Siemen, siebzehn, und ich kannte ihn schon jahrelang. Jedes Jahr kam er ein paarmal aus Berlin zu Besuch. Normalerweise immer nur in den Ferien und in Begleitung seines Zwillingsbruders Sebastian. Aber vor ein paar Tagen hatte Sebastian versucht, sich das Leben zu nehmen, keiner wusste warum, nicht einmal Frederik. Er war einfach in den Wald gegangen und hatte sich in einem alten, verwitterten Baumhaus versteckt, das die Zwillinge vor vielen Jahren einmal zusammen gebaut hatten, und dort oben hatte er eine Menge Schlaftabletten geschluckt und war zusammengebrochen.
„Wenn ihn nicht zufällig dieser Spaziergänger gesehen hätte, wäre er tatsächlich gestorben“, sagte Frederik kopfschüttelnd.
„Was hat er sich bloß dabei gedacht?“, fragte Siemen.
Frederik zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung“, murmelte er düster. Ich musterte ihn prüfend. Janne hatte mir erzählt, dass Frederik völlig verzweifelt gewesen war, als er erfahren hatte, was geschehen war. Dabei hatten sich die beiden in den letzten Jahren nicht so besonders viel zu sagen gehabt. Als Kinder waren sie praktisch unzertrennlich gewesen, aber je älter sie wurden, desto weniger konnten sie miteinander anfangen. Frederik war groß und hübsch und sportlich und ein richtiger Spaßmacher, und Sebastian war über einen Kopf kleiner als er und blass und still und grüblerisch. Dazu kam, dass er seit ein paar Jahren an einer schweren Augenkrankheit litt und immer kurzsichtiger wurde. Er hatte mehrere komplizierte Augenoperationen hinter sich, aber die hatten nicht viel genützt, und Janne hatte mir erzählt, dass er nur noch sehr schlecht lesen konnte.
Als ich Sebastian das letzte Mal gesehen hatte, trug er eine witzige Woody-Allen-Brille mit ziemlich dicken Gläsern und schien ganz gut mit seinem Leben zurechtzukommen. Aber jetzt hatte er versucht, sich das Leben zu nehmen, und das war ein schrecklicher Gedanke.
Frederik hatte es nicht über sich gebracht, ihn in der Klinik zu besuchen.
„Er hat geheult wie ein Schlosshund“, hat Janne gesagt. „Und dann hat er tagelang nur trübselig herumgehockt und die Wände in seinem Zimmer angestarrt. Und darum ist er jetzt hier. Er sagt, er braucht Ablenkung …“
Erst kurz vor Mitternacht fiel uns auf, dass Grischa immer noch bei uns saß, anstatt im Bett zu liegen, wie es sich für einen kleinen, verfrorenen Fünfjährigen gehörte.
„Los, Einstein, ab in die Koje“, sagte Siemen deshalb streng.
„Ich will aber nicht“, antwortete Grischa störrisch. „Ich will lieber hier sein und euch zuhören.“
„Du hast genug zugehört“, sagte ich.
„Habe ich nicht“, beharrte Grischa. „Ich will wissen, warum Sebastian diese vielen Tabletten genommen hat und was Tamara wohl sagt, wenn sie erfährt, dass Siemen jetzt Katie Crawford küsst, und wann Frederik Leonie küssen wird, weil er sie schon die ganze Zeit so anguckt, als würde er es gleich tun …“
Ich zuckte zusammen, als ich das hörte, und mir wurde für einen Moment ganz schwindelig vor Verlegenheit. Stimmte das? Schaute Frederik mich tatsächlich so an?
„He, du Spinner, steck deine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten“, sagte Janne und lachte leise.
„Los, ins Bett, Grischa“, wiederholte Siemen ungeduldig.
Und da stand Grischa beleidigt auf und trottete ins Haus.
Es war jetzt richtig Nacht und am Himmel stand ein schmaler, blasser Mond.
„Ziemlich kalt inzwischen, was?“, stellte Siemen fest und dann ging er, ohne eine Antwort abzuwarten, ins Haus und kam gleich darauf mit einem Arm voller Decken wieder zurück.
Wir wickelten uns ein wie die Eskimos. Janne und ich teilten uns eine Decke und Siemen und Katie Crawford aus New Jersey teilten sich auch eine. Frederik bekam die dritte Decke für sich alleine. Ich merkte, wie er mich anschaute, und lächelte ihm vorsichtig zu.
„Eine schöne Nacht“, sagte Siemen und streichelte Katie Crawfords hübsches, sommersprossiges Gesicht. Er schien in dieser Nacht völlig vergessen zu haben, dass er sie eigentlich für eine amerikanische Katastrophe hielt.
„Aber kalt“, meinte Frederik und sah mich wieder an.
„Stimmt, es ist ziemlich eisig“, bestätigte Janne und fröstelte ein bisschen.
„Und hier gibt es bestimmt Mücken, Käfer, Ungeziefer …“, murmelte Katie und schaute sich beunruhigt um.
„Für Mücken ist es noch zu früh, für Käfer zu kalt und Ungeziefer gibt es bloß auf Müllhalden“, murmelte Siemen zurück.
„Und im Hotel Chat d’Or“, sagte Janne und stieß mich in die Seite. „Weißt du noch, die dicken fleischigen Kakerlaken an der Wand neben unserem Bett?“
Ich nickte. Natürlich erinnerte ich mich noch. Wir waren im vergangenen Herbst mit unserem Französischkurs in der Bretagne gewesen und hatten für eine Woche in einem billigen Hotel gewohnt, in dem es von Kakerlaken nur so gewimmelt hatte.
Bald darauf ging Siemen erneut ins Haus. „Wer will einen kleinen feinen Ouzo gegen das akute Erfrieren?“, fragte er, als er zurückkam, und schwenkte eine schmale, halb volle Flasche.
Und weil wir alle froren, tranken wir alle einen Ouzo. Es war der erste meines Lebens.
„Ganz schön scharf“, sagte ich.
„Aber lecker“, sagte Janne. „Schmeckt wie Lakritze.“
Ich nickte und merkte, wie mir ganz langsam ein bisschen wärmer wurde.
„Einstein ist übrigens auch noch wach“, sagte Siemen. „Er sitzt in seinem Zimmer auf der Fensterbank, hört Vivaldi und beobachtet uns mit seinem Fernglas.“
„Nicht zu glauben, dieses Wahnsinnskind“, sagte Janne kopfschüttelnd. „Aber mir war er ja immer etwas unheimlich. Damals, gleich nach seiner Geburt, hatte er schon so einen merkwürdigen erhabenen Blick. Wir sollten ihn mal dem Dalai-Lama vorführen. Vielleicht ist er ja eine bedeutende Reinkarnation oder so was …“
Wir lachten.
Frederik saß immer noch neben mir, wie die ganze Zeit schon. In seine Decke gehüllt starrte er vor sich hin. Die Ouzoflasche war jetzt fast leer, Frederik hatte den Rest in einem Schwung ausgetrunken.
„Mir wird jedes Mal ganz flau, wenn ich an Sebastian, diesen Trottel, denke“, sagte er plötzlich, und seiner Stimme konnte man anhören, dass er ein bisschen betrunken war. „Was mir nicht in den Kopf will, ist, warum er diesen Blödsinn gemacht hat. Und warum ich nicht mitbekommen habe, wie schlecht es ihm ging …“
Frederik schaute mich an und ich schaute stumm zurück.
„Ich bin zweiundzwanzig Minuten älter als er“, sagte Frederik und seine Augen sahen plötzlich sehr traurig und mitgenommen aus. „Mann, wenn er gestorben wäre …“
Frederik schlug mit der Faust ins Gras und dann fing er an zu weinen. Er weinte bloß ganz leise und es klang gepresst und seltsam ungeübt. Wahrscheinlich hatte Frederik, bevor die Sache mit Sebastian passiert war, sehr lange nicht geweint.
Da legte ich meinen Arm um seine Schulter und streichelte sie ganz leicht. Zuerst reagierte Frederik überhaupt nicht, aber irgendwann lehnte er sich leicht an mich und ich kroch zu ihm unter die Decke. Frederik roch gut und es fühlte sich schön an, so dicht neben ihm zu sitzen. Mir war ein bisschen schwindelig. Schließlich hatte ich bis auf ein halbes Glas Sekt an meinem fünfzehnten Geburtstag noch nie Alkohol getrunken. Außerdem war es schon so spät und ich hatte eisige Hände und Füße.
„Leonie …“, murmelte Frederik in mein Ohr. Ich dachte, er wolle etwas sagen, aber er sagte dann doch nichts, sondern schob nur ganz vorsichtig seine warme Hand in meine kalte.
Ich musste plötzlich an früher denken, an all die Jahre, die hinter uns lagen. Ich hatte Frederik schon gekannt, als er noch Milchzahnlücken und sommerlich aufgeschlagene Knie hatte. Und ich hatte sein erstes Rennrad gesehen und einmal hatten wir zusammen mit Janne, Sebastian und Siemen einen gigantischen Staudamm am Bach gebaut und auf diese Weise versehentlich einen großen Teil eines Maisfeldes geflutet.
Wir hatten Kaulquappen zusammen gefangen und in irgendwelchen Sommerferien hatten wir einen verletzten jungen Fuchs im Wald gefunden und zum Tierarzt gebracht.
„Wie lange kennen wir uns eigentlich schon, Frederik?“, flüsterte ich schließlich. „Ich meine, wie alt waren wir, als wir uns zum allerersten Mal gesehen haben?“