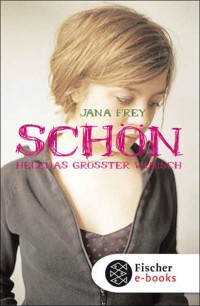6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Suizid häufigste Todesursache bei Jugendlichen So spannend, einfühlsam und psychologisch glaubwürdig, wie man das von ihr gewohnt ist, erzählt Jana Frey die Geschichte der sechzehnjährigen Annis. Sie fühlt sich unscheinbar und ist unglücklich verliebt. Trost sucht sie in Computerforen bei Freunden, die keine sind. Sie schreibt sich selbst SMS, belügt sich und andere – und greift schließlich zu einem Mix aus Tabletten und Alkohol, um dem allen ein Ende zu machen. Doch das Leben geht weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Jana Frey
Schwarze Zeit
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
www.fischergeneration.de
Für Denise Schalow, die schon zu lange weit, weit weg ist. Schön, dass du bald wiederkommst!
1.Fireflies
Kalimera!
Es war Morgen. Ein Sonnenmorgen. Ein Sonnensommermorgen. Die Nacht war vorbei. Zum Glück. Adieu Nacht. Mindestens fünfzehn Stunden Licht lagen vor mir. Vor mir und meinem Leben.
Ich bin ich. Ich bin schwarz. Ich bin nicht Paula.
Ich bin eine Schattengestalt.
Potter war auch schon wach. Potter liebte Licht und Sonne und Wärme genau wie ich.
Potter hatte nur ein Auge und nur drei Beine. Drei und ein halbes. Er stammte aus Griechenland, wie ich.
Und obwohl der Kater hässlich war, war er wunderschön. Weich und wollig und gut und schläfrig und tintenschwarz war er. Sein Fell war immer voller Staub. Wenn er in der Sonne lag, so wie jetzt, konnte man den Staub um ihn herum tanzen sehen im Licht.
Griechenland war Licht und Sonne und Wärme und Zikaden und Olivenbaumhaine und Schafherden und Meer und Strand und windige Luft.
Griechenland war Glück. Mein Glück.
Mein Vater lebte dort. Irgendwo dort.
Von ihm hatte ich meinen Vornamen. Annis. Annis wie Anis. Lakritz ist aus Anis. Und Anisplätzchen sind aus Anis. Und Ouzo, Anisschnaps, ist aus Anis.
Mein Vater war Schafhirte, Dichter, und Schweiger, in dem griechischen Frühling, in dem ich entstanden war. Und er liebte Ouzo. Er hatte ihn mit meiner Mutter getrunken am Strand, während sie zusammen über das Meer schauten. Und noch andere Dinge taten.
Was aus meinem Vater geworden war, wusste ich nicht. Und wo er war, auch nicht.
Ich bin ich. Ich bin, wie schon gesagt, Annis. Aber ich bin auch Elektra, die Geladene. Denn ich sprühe Funken und verteile Stromschläge, das wissen alle, die schon mit mir und meinen Stromhänden, meinen Elektrahänden, zu tun hatten.
Keiner konnte sich das erklären. Meine Freundin Jelena, die meine einzige Freundin war, sagte, es hätte mit meiner Geburt zu tun.
Levi, der im Nachbarhaus wohnte, nannte mich MrsGeller, nach Uri Geller, dem Bühnenmagier mit den telepathischen Kräften.
»Mach es wie er«, sagte Levi manchmal sinnend und zappte sich durch seine zweiundvierzig Fernsehsender, Levi schaute praktisch rund um die Uhr Fernsehen. Tag und Nacht. Nur die Schule zwang ihn zu Vormittagsfernsehpausen wider Willen.
»Bring stehengebliebene Uhren wieder zum Laufen, nur indem du sie ansiehst, verbieg mit deinem düsteren Stahlblick Besteck, nimm Kontakt zu Aliens auf, Annis! Dann bist du eine gemachte Frau. Dann bist du richtig hipp! Schräg bist du doch sowieso.«
Jelena glaubte, wie gesagt, es hinge mit meiner Geburt zusammen, dass ich immer wieder Stromschläge an die Leute verteile, die mich berühren, und sei es auch nur ganz flüchtig. Manchmal reicht es auch schon, einfach dicht neben mir zu stehen. Wenn ich mich im Dunklen ausziehe, tanzen hellblaue Funken um meinen Kopf. Und Fernseher spielen in meiner Gegenwart verrückt. Verlieren die gespeicherten Sendeplätze. Flackern. Schalten das Programm um, ohne dass jemand auch nur die Fernbedienung berührt.
Auch für Handys bin ich Gift. Immerzu verlieren sie in meinen Händen ihr Netz und beenden gegen meinen Willen meine Telefongespräche.
»Es war diese Nacht. Da bin ich mir sicher. Es war dieses Gewitter. Du hast doch gehört, was deine Mutter gesagt hat. Und auch noch mitten im Winter. Das gibt es sonst nie. Im Sommer gibt es haufenweise Gewitter. Aber nicht im Winter. Es war November. Es lag Schnee, Annis! Schnee! Und vergiss nicht den Baum in eurem Garten.«
Ich nickte. Das stimmte. Ein Blitzschlag hatte dem alten Kastanienbaum die halbe Krone abgeschlagen und den Rest in Brand gesteckt. Ein paar Augenblicke später wurde ich geboren. Zu früh. Zuhause. Ganz plötzlich. Unerwartet.
Während sich die freiwillige Feuerwehr unseres Stadtteils um den brennenden Baum kümmerte, kümmerte sich ein Notarztteam um mich. Ich war klein, dünn, hässlich, aber ich hatte viele schwarze, verklebte Löckchen auf meinem winzigen Kopf. Mein griechisches Erbe.
»Und du hattest seine Augen«, erzählte meine Mutter, als sie mir von dieser Gewitternacht erzählte. »Von Anfang an.«
Seine Augen und meine Augen.
Es war ein blassgelber Ring um unsere schwarzen Pupillen in unseren fast schwarzen Augen, mehr nicht.
Ein goldener Ring. So formulierte es meine Mutter.
Sie nannte ihn nie beim Namen, meinen Vater. Sie redete überhaupt so gut wie nie über ihn.
Es gab noch mehr Dinge, über die meine merkwürdige, wortkarge, eigenbrötlerische, schwermütige Mutter schwieg.
Paula, zum Beispiel.
Und die Sache, die damals passiert war. Meine Großmutter sprach einmal davon. Ich hörte es nur zufällig, als ich an einem Abend ganz spät noch am Wohnzimmer vorbeiging, um meine Sportsachen für den nächsten Tag zu holen. »… wegen Annis«, sagte meine Großmutter, und in ihrer Stimme war etwas, das mich aufhorchen und stehen bleiben ließ. »… die Sache in der Küche. An Silvester. Diese schreckliche Nacht, damals. Weißt du noch, Tamara? Himmel, weißt du noch? Weißt du noch? Weißt du noch?«
Das hatte sie an diesem Abend zu meiner Mutter gesagt nach mehreren Gläsern Rotwein, während sie zusammen im Wohnzimmer saßen. Das war, bevor ihr die Zeit abhandenkam.
»Das ist lange her, Mutter! Warum denkst du immer noch daran? Das ist vorbei. Vorbei und vergessen«, antwortete meine Mutter damals.
»Was meinte sie wohl?«, grübelte Jelena manchmal. »Die Sache in der Küche? Diese schreckliche Nacht? Das klingt wie in einem Film. Halloween, die Nacht des Grauens. Unheimlich, spacig. Abgefahren.«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich.
»Frag deine Mutter«, sagte Jelena.
»Das habe ich schon.«
»Frag sie noch mal«, drängte Jelena.
»Das hat keinen Sinn. Wenn sie etwas nicht sagen will, sagt sie es nicht. So ist sie eben.«
Aber eines Tages fragte ich sie doch. Ich erinnerte sie an diese Rotweinnacht und fragte nach der Sache in der Küche, die damals passiert war.
Was war passiert? Wann? Wem?
Mir? Ihr? Uns? Meiner Großmutter?
Etwas Schlimmes? Gefährliches? Ein Unfall?
Meine Mutter bekam diese zwei scharfen, tiefen Senkrechtfalten über der Nasenwurzel und schaute mich mit ihren hellen, unruhigen Augen unruhig an. Aber sie erklärte mir nichts.
»Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst dich verhört haben. Geirrt haben. Etwas falsch verstanden haben.«
Das war alles, was sie sagte.
Jedenfalls waren bei meiner Geburt die Blitze nur so ums Haus gejagt, das Zimmer, in dem meine Mutter sich befand, die eigentlich gerade auf dem Weg ins Bett war, wurde taghell, immer und immer wieder, und dann kam ich. Einfach so. Mitten in Blitz und Donner.
»Elektra, die Geladene«, sagte Jelena und nickte zufrieden, als ich ihr die Geschichte erzählte. Jelena liebte Düsteres.
Verrückt, wie schnell meine Großmutter alles mitbekommen hatte, verrückt, wie schnell der Krankenwagen gekommen war, und nur eine halbe Stunde, nachdem ich das Licht der Welt erblickt hatte, war ich schon in meinem Wärmebettchen auf der Frühgeborenenstation des städtischen Krankenhauses.
Der Baum brannte ebenfalls nicht mehr und stand noch immer dunkel und düster im Garten. Mit verbrannter Krone und krummen, verärgerten Restästen, die krumme, ärgerliche Seitentriebe trieben seitdem.
Wenn ich die Hände spreize, knistert es leise, und es ist, als fielen Funken aus meinen Fingerspitzen.
Wenn ich in ein Auto einsteige oder jemandem die Hand gebe oder in einen Aufzug oder auf eine Rolltreppe steige, kribbeln meine Füße, prickeln meine Hände, laden sich meine Haare elektrisch auf. Ich verteile Stromschläge rund um mich herum.
Meine Großmutter, als sie noch denken konnte und die Zeit und das Leben noch nicht verloren hatte, schenkte mir eine Bernsteinkette dagegen und Jelena eines Tages einen Rosenquarz, dick und kantig und schwer und zartrosa, aber nichts half wirklich.
»Du bist eben ein hoffnungsloser Fall, MrsGeller«, sagte Levi achselzuckend.
Die Zimmertür öffnete sich.
Ich hob den Kopf aus meinem schwarzen Deckenberg.
Ich liebte zwar helles Licht und die Sonne am Himmel, aber alles andere, alles was mich unmittelbar berührte, war schwarz.
Potter. Meine Decken. Cola. After Eight – die einzige Süßigkeit, die ich mochte. Schwarzbrot. Brombeeren. Zartbitterschokolade. Meine Haare. Meine Fingernägel. Meine Anziehsachen.
»Es padingt wieder. Gleich nachdem ich aufgewitscht war. Warum padingt es? Warum? Und wem gehört dieses scheußliche Ding?«
Es war meine verschlafene Großmutter, und mit Ding meinte sie ihren Morgenmantel, den sie mir missmutig entgegenstreckte.
»Das ist dein Mantel, Oma«, sagte ich. »Dein Morgenmantel. Tante Hannah hat ihn dir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Weißt du nicht mehr?«
»Nein. Der gehört jemand anderem. Bestimmt. Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber jetzt lag er da bei meinem Bett. Er hat mich geweckt. Wach geguckt. Ich habe es gesehen. Er ist böse.«
»Mama!«, rief ich und klopfte laut an meine Zimmerwand. »Mama, sie ist wach! Hörst du nicht, sie ist wach …«
Meine Großmutter setzte sich in der Zwischenzeit auf den Boden, und Tränen tröpfelten aus ihren alten, traurigen, verwirrten Augen.
»Ich komme«, rief meine Mutter zurück, und dann war sie auch schon da und half meiner Großmutter beim Aufstehen.
»Juch! Juch! Juch weg! Tücher! Warum? Ich will zapplinden! Wer sind Sie? Ich will zapplinden!«, schimpfte meine Großmutter außer sich und fuchtelte mit den Armen.
Ich drehte mich weg und schaute aus dem Fenster, um etwas anderes zu sehen. Am liebsten hätte ich mir auch noch die Ohren zugehalten.
Potter lag auf der Fensterbank und starrte mich aus seinem einzelnen, grünen Zyklopenauge an, ohne sich zu rühren. Wie versteinert sah er aus. Ich streichelte ihn hastig, um seine Wärme zu fühlen.
»Himmel, sie macht schon wieder alles nass«, stöhnte meine Mutter hinter meinem Rücken. »Wo ist deine Windel, Mutti, verdammt? Sie hat tatsächlich schon wieder ihre Windel ausgezogen.«
Meine Mutter wartete seit Monaten händeringend auf einen Heimplatz für meine Großmutter. Aber es war noch kein Zimmer frei.
Ich wartete ebenfalls.
Zimmer frei.
Wie das klang.
Wenn endlich ein Zimmer frei sein würde, bedeutete das, dass ein anderer Heimbewohner in dem zukünftigen Heim meiner verwirrten Großmutter gestorben wäre. Dahingerafft wäre, wie Levi es ausgedrückt hatte.
Levis Großvater war ebenfalls dement gewesen, ehe es ihn dahinraffte. Zum Schluss wurde er regelrecht bissig, hatte Levi grinsend erzählt. Zweimal sei seine Mutter mit Bisswunden ihres alten Vaters im Krankenhaus behandelt worden.
»Einer der Bisse war ein Nasenbiss«, hatte Levi kopfschüttelnd berichtet.
Unter der Woche kam wenigstens zweimal am Tag eine Pflegerin zu uns. Aber am Wochenende gab es nur meine Mutter und mich.
Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, lebte schon seit Jahren in den USA.
Dafür schrie meine Mutter sie mindestens einmal pro Woche per Skype quer über den Ozean an. Und starrte ihr via Webcam böse ins Gesicht.
»Warum muss ich das alles leisten, Hannah? Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Warum? Warum vergnügst du dich in Arizona? Was ist mit mir? Wo ist da die Gerechtigkeit? Wo?«
»Windel?«, wiederholte meine Großmutter gerade würdevoll und starrte meine Mutter mit zusammengekniffenen Augen abschätzend an.
»Windeln sind für Säuglinge, für Babys. Wo sind meine Babys? Ich glaube, ich habe zwei. Zwei Babys.«
Neue Tränen rollten über ihr faltiges, dünnes Gesicht, das in meiner Kindheit rund und großmütterlich und rosig gewesen war. Und auf alten Fotos aus alten, längst vergangenen Zeiten schön gewesen war. Modelschön. Schöner als das Gesicht meiner Mutter. Und schöner als mein Gesicht.
Altwerden war schrecklich, so viel stand fest. Ich musste wieder an Levis Großvater denken, der früher ein bekannter Opernsänger gewesen war. Lange bevor er anfing, seine einzige Tochter zu beißen.
Ich ging in die Küche, und meine Mutter verfrachtete meine Großmutter in der Zwischenzeit ins Badezimmer in die Dusche.
Ich holte mir eine Scheibe Schwarzbrot aus dem Brotkasten und setzte Teewasser auf. Schwarzer Roibuschtee und eine Scheibe Schwarzbrot mit schwarzem Brombeergelee.
Ich hatte sogar ein Stück schwarze Seife im Badezimmer. Afrikanische Seife. Die hatte ich einmal per Zufall in der Stadt in einem Eine-Welt-Laden entdeckt.
»Zwei Babys habe ich«, rief meine Großmutter wütend, während das Duschwasser rauschte. »Jawohl. Das weiß ich genau, meine Dame. Sind Sie die neue Pflegerin?«
Ich runzelte die Stirn. Meine Mutter war bestimmt schon wieder fix und fertig mit den Nerven, und dabei war es gerade erst einmal – ich warf einen Blick auf die tickende Küchenuhr – Viertel nach neun.
»Annis und Hannah heißen meine Babys. Es sind Mädchen. Mädchen! Schöne Babys! – Nicht wie Sie! Nicht so böse und zerstrubbelt wie Sie. He, Sie! Ich spreche mit Ihnen!«
»Puh«, murmelte ich und füllte Potters Schüsselchen mit Trockenfutter.
Annis war ich. Und Hannah war meine Tante in Amerika.
Meine Mutter hieß Tamara.
Das Duschen war zu Ende.
Meine Mutter kam in die Küche.
»Lange mache ich das nicht mehr mit, Annis«, sagte sie und fing an zu weinen. »Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig leer. Erledigt. Ein Wrack. Jeden Tag habe ich mehr Falten im Gesicht. Ich erkenne mich selbst im Spiegel kaum noch wieder. Dabei bin ich doch gerade erst zweiundvierzig.«
Meine Großmutter war in der Tür stehen geblieben. Ihre Haare waren in einem Handtuchturban eingeschlungen, und sie trug jetzt ihren Hausanzug.
»Annis und Hannah, jawohl«, murmelte sie und setzte sich auf ihren Frühstücksplatz am Fenster. »Meine Kinder. Meine lieben Kinder. – Meine. Lieben. Kinder.«
Gereizt schaute sie meine Mutter an, die sich an der Kaffeemaschine zu schaffen machte.
»Wurpig hier«, sagte sie dann leise und hinter vorgehaltener Hand zu mir. »Wurpig und schleimig und indiskutabel.«
Wirkliche Worte und Wortphantasien in wirren Sätzen waren die neueste Verschlechterung ihrer Krankheit, die so wahnsinnig schnell voranschritt, dass mir ganz schwindelig davon wurde.
Angefangen hatte alles leise und unauffällig.
Damals
Wir wohnten in diesem alten, unordentlichen Haus. Meine Großmutter, der es gehörte, meine Mutter und ich.
Meine Mutter hatte einen eigenen Blumenladen in der Altstadt, in dem sie auch eine Töpferwerkstatt führte, und meine Großmutter arbeitete als Chefsekretärin bei einer bekannten Kosmetikfirma.
Das Haus gehörte meiner Großmutter. Früher hatte es meinem Großvater gehört, er war darin aufgewachsen. Und später waren meine Mutter und Tante Hannah hier aufgewachsen. Und dann ich.
»Ein alter, rumpeliger Wahnsinnskasten! Zum Fürchten eigentlich. Und dauernd ist etwas anderes kaputt!«, sagte meine Großmutter oft, aber eigentlich liebte sie das Haus. Mit Leidenschaft kümmerte sie sich um die vielen Rosen im Garten.
Ich liebte das Haus ebenfalls.
Das Haus und die Rosen und den alten, ärgerlichen Kastanienbaum im hinteren Garten.
Nach und nach begann meine Großmutter vor etwas mehr als einem Jahr auf einmal die Küche und das Wohnzimmer und ihr eigenes Zimmer mit unseren kleinen Post-it-Klebern vollzukleben.
Biotonne rausstellen!, stand da zum Beispiel.
Und Mantel in die Reinigung bringen!
Lottoschein nicht vergessen!
Einkauf erledigen!
Geburtstagsgeschenk für Annis besorgen!
Frau Petri im Krankenhaus besuchen!
WICHTIG: An Frau Hähnlein denken!
Frau Hähnlein war unsere Putzfrau, und meine Großmutter musste da sein, um ihr die Tür zu öffnen, wenn sie kam, weil sie keiner Putzfrau mehr einen eigenen Hausschlüssel anvertrauen wollte, seit sie einmal von Frau Hähnleins Vorgängerin ihr ganzes Silberbesteck geklaut bekommen hatte.
»Mutti, warum plakatierst du das ganze Haus?«, fragte meine Mutter und zupfte einen grünen Post-it-Kleber mit der Aufschrift Schuhe aus der Reparatur holen! von der Küchenanrichte.
»Damit ich es nicht vergesse«, antwortete meine Großmutter und lächelte. »In letzter Zeit habe ich den Kopf so voll.«
»Du arbeitest zu viel. Du bist nicht mehr die Jüngste«, sagte meine Mutter, und an diesem Abend lud sie meine Großmutter ins Theater ein.
»War es schön?«, fragte ich am nächsten Morgen in der Küche beim Frühstück.
»Ganz wundervoll«, sagte meine Großmutter, die eine Leidenschaft für Shakespeare-Inszenierungen hatte. Sie hatten Ein Sommernachtstraum gesehen.
»Eine ganz besondere Sache«, berichtete meine Großmutter weiter und trank ihren Morgenkaffee. »Sehr …«
Sie hielt inne und überlegte.
»Sehr …«
Sie lachte verwirrt und schob sich ihr schönes, gepflegtes, graugesträhntes Haar aus der hohen Stirn.
»Sehr – wuschig«, sagte sie plötzlich unvermittelt.
Dann riss sie die Augen auf.
»Sehr modern, wollte ich sagen. Modern. Eine sehr moderne Inszenierung.«
Meine Großmutter lachte kopfschüttelnd und griff über den Tisch nach einem Brötchen. Aber danach schwieg sie lange. Und kaute lange an jedem Bissen. Und schaute an uns vorbei aus dem Fenster.
Ein paar Tage später kam meine Großmutter in mein Zimmer, wo Jelena, Potter und ich auf meinem schwarzen Bett lagen und Fluch der Karibik schauten.
»Annis?«
»Was ist?«
Meine Großmutter streckte mir ihren Zeigefinger entgegen, an dem ein rosa Post-it-Zettel klebte.
Ich warf einen kurzen, verwirrten Blick darauf. Es war der mit Frau Hähnlein: WICHTIG:An Frau Hähnlein denken!
»Annis, warum will ich an Frau Hähnlein denken?«, fragte meine Großmutter, und ihre Stimme klang dumpf und besorgt.
Jelena und ich sahen uns einen Moment an.
»Um sie reinzulassen«, sagte ich dann.
»Reinlassen?«, wiederholte meine Großmutter. »Wo soll ich sie reinlassen? Und warum?«
»Oma! Bei uns! Zum Putzen! Mittwochs! – Mann, das gibt’s doch nicht. Wie vergesslich willst du eigentlich noch werden?«
Meine Fingerspitzen knisterten, als ich meine Hände zurück auf meine schwarze Decke fallen ließ.
Meine Großmutter gab keine Antwort und ging wieder aus dem Zimmer.
»Das war nicht so nett«, sagte Jelena leise.
»Wieso?«, fragte ich und war auf einmal gereizt.
»Sie … sie macht das doch nicht extra«, sagte Jelena wiederum mit leiser Stimme.
Dazu sagte ich nichts.
Ein paar Tage später gab es einen neuen Post-it-Kleber in der Küche. Sechs Zahlen standen darauf. Ich erkannte sie sofort. Es waren die Lottozahlen meiner Großmutter. Sie tippte schon solange ich zurückdenken konnte auf die gleichen Zahlen.
Schweigend starrte ich die zittrigen Ziffern an.
Am Abend ertappte ich meine Mutter, als sie ebenfalls stumm vor diesem rosa Kleber stand und ihn mit beklommenem Blick betrachtete.
»Was hat sie?«, fragte ich.
Meine Mutter zuckte zusammen, sie hatte mich wohl nicht reinkommen hören.
»Das Alter«, antwortete sie dann vage. »Ich schätze, sie wird einfach allmählich alt. Und sie arbeitet zu viel. Sie wird dieses Jahr schließlich schon dreiundsechzig. Sie sollte sich schonen, kürzer treten, verreisen, das Leben endlich ohne Arbeit genießen.«
Ich nickte.
»Ich habe ihr nahegelegt, endlich Schluss in dem Laden zu machen. Sie ist doch sowieso nur noch ein Relikt in dieser Firma. Sogar ihr neuer Chef ist dreißig Jahre jünger als sie!«
Ich nickte wieder. Wir wussten beide, es war der alte Seniorchef, an dem meine Großmutter hing. Sie und er waren jahrelang ein eingeschworenes Team gewesen, aber diese Zeiten waren eben lange vorbei.
Letztes Weihnachten hörte sie dann endlich auf zu arbeiten.
Ein paar Tage später schrieb sie einen neuen Zettel.
Rebekka Sophia Samland stand darauf. Ihr Name.
Immer neue Rebekka-Sophia-Samland-Zettel tauchten auf. Überall.
»Mutti, jetzt reicht es aber!«, rief meine Mutter wütend und zerknüllte eine Handvoll dieser Kleber.
»Nein, nicht!«, rief meine Großmutter und fing an zu weinen. »Ich brauche diese Notizen!«
»Wozu? Wozu? Wozu?«, rief meine Mutter atemlos vor Nervosität.
»Um … um es zu wissen«, stammelte meine Großmutter und bekam Flecken im Gesicht vor Aufregung.
»Was zu wissen?«, fragte meine Mutter und warf ihrer Mutter einen derart aufgebrachten, wilden Blick zu, dass ich auch nichts mehr hätte sagen können.
Meine Großmutter jedenfalls schwieg drei Tage lang.
Danach ging es nur noch bergab.
Sie stand nachts auf, um in den Garten zu gehen und nach den Rosen zu sehen. Sie weinte, weil die Rosen zurückgeschnitten waren, weil es Januar war. Sie saß stundenlang stumm da und streichelte zärtlich eine einzelne Socke. Sie legte sich ihr Bettzeug in die Küche auf den Fußboden und wollte dort schlafen. Sie ging ins Nachbarhaus und setzte sich zu Levis älterem Bruder Noa ins Wohnzimmer und glaubte, er sei ihr Vater, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war.
»Dass du wieder da bist, dass du wieder da bist«, schluchzte sie und streichelte liebevoll Noas Haare.
Sie tat noch tausend andere verrückte Dinge, und eines Tages erkannte sie meine Mutter nicht mehr.
»Sie sind eine böse, fremde Frau!«, fuhr sie sie an und flüchtete sich zu mir und Jelena in mein Zimmer.
»Oma, bitte«, stotterte ich.
»Pst, Liebling, pst!«, flüsterte meine Großmutter. »Denk an diese schlimme Nacht damals. An diese schlimme Sache. Es war Silvester. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Die Frau ist gefährlich. Unberechenbar. Glaub mir. Glaub mir, Annis.«
Ich begegnete Jelenas wachsamem Blick.
Redete sie wieder wirr – oder erinnerte sie sich tatsächlich an diese Silvesternacht, über die sie damals mit meiner Mutter gesprochen hatte und von der meine Mutter behauptete, nichts zu wissen?
»Was meinst du, Oma?«, fragte ich vorsichtig.
»Ja, was meinen Sie, Frau Samland?«, drängte Jelena.
Meine Großmutter schaute uns eine Weile stumm an.
»Diamantenhimmel«, sagte sie dann.
»Was?«, fragte ich verwirrt.
Jelena seufzte und legte ihre Hand für einen Moment auf meine. Es knisterte elektrisch. Jelena zog ihre Hand zurück und seufzte noch einmal.
»Fireflies«, fuhr meine Großmutter flüsternd fort. »Das ist englisch. Auf Deutsch sind das Glühwürmchen. Aber Fireflies klingt schöner. Romantischer. Sie sind meine Lieblingstiere. Schon immer. Klein, geheimnisvoll und wundervoll. Wenn sie auftauchen, in Scharen, wird aus jedem Nachthimmel ein Diamantenhimmel.«
Wir schwiegen alle drei.
»Aber das damals, das war kein Diamantenhimmel. Das war ein Silvesterhimmel. Voller Raketen, Qualm und Lärm. Das mochte ich noch nie. Aber in jenem Jahr …Da war dieser – schlimme – Turm«, setzte meine Großmutter nach einer Weile wieder an. »Ein Turm mitten in der Küche. An Silvester. Wie gesagt. Der Turm. Und dann Frieden. Und sonst nichts. Mein gutes, gutes Kind.«
Damit stand sie auf und ging hinaus.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: