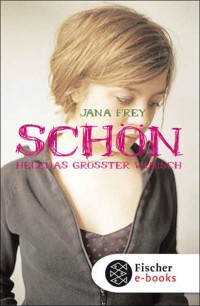Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Jana Frey greift das Thema Magersucht und den daraus resultierenden Teufelskreis in diesem Jugendroman für Mädchen ab 12 Jahren authentisch auf. Ein stets aktuelles Thema, das Aufmerksamkeit verdient. Serafina wiegt 64 Kilo. Sie fühlt sich dick und unglücklich. Wie gerne wäre sie so schön schlank wie ihre Freundin Ernestine oder ihre Schwester Maria. Immer übermächtiger wird dieser Wunsch in ihr, und eines Tages hört sie auf zu essen. Serafina hungert und hungert. Bis fast nichts mehr von ihr übrig ist. Serafinas Schicksal ist kein Einzelfall. Jedes Jahr erkranken in Deutschland tausende von Mädchen an Magersucht – und es werden immer mehr. Wie erschreckend leicht man in einen solchen Teufelskreis aus Diäten und gestörter Körperwahrnehmung hineingerät und wie unglaublich schwer es ist, wieder herauszukommen, das erzählt Jana Frey in diesem bewegenden Roman. ESELSOHR: Fällt aus dem Rahmen (Juli 2005) Dritter Platz der Moerser Jugendbuchjury 2005/2006
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Für Serafina
Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten.
Die Namen und Schauplätze sind von der Redaktion geändert.
Prolog
Serafina ist einen Meter achtundsechzig groß und dünn, sehr, sehr dünn.
Still und nachdenklich sitzt sie mir gegenüber und malt mit der Spitze ihres rechten Zeigefingers unsichtbare Zickzacklinien auf den Tisch zwischen uns.
„Ich weiß selbst nicht genau, wie es angefangen hat“, sagt sie dann plötzlich, schaut mich kurz an und schweigt wieder.
Aber eine Stunde später, am Ende unseres allerersten Gesprächs, weiß ich trotzdem ein paar Dinge aus Serafinas Leben:
Da gibt es Fritz und Moses.
Da ist eine Kuh in Tivoli, die sie mal geküsst und dabei geweint hat.
Da ist eine Oma, die sie nicht mag.
Und eine Oma, die sehr krank ist und von Kuchen spricht.
Außerdem liebt sie das Buch „Schlafes Bruder“.
Und ist Halbitalienerin.
1
Komisch, man kann eine Familiengeschichte lang und kurz erzählen.
Kurz erzählt klingt meine Geschichte so:
Vor siebzehn Jahren lernte meine Mutter, die den Sommer in Rom verbrachte, meinen Vater kennen. Meine Mutter war Studentin und mein Vater Steinmetzlehrling. Sie war Deutsche und er war Italiener. Nach dem Sommer war meine Mutter schwanger und wieder in Deutschland.
Ein halbes Jahr später kam mein Vater auch nach Deutschland. Dann wurde ich geboren und zwei Jahre später meine Schwester Maria.
Lang erzählt klingt meine Geschichte ganz anders.
Meine Mutter ist ein Sprachenwunder. Als sie vierzehn war, fuhr sie für ein paar Wochen nach London zu einer Gastfamilie und lernte Englisch. In der elften Klasse verbrachte sie das zweite Schulhalbjahr in Lyon und lernte Französisch. Und nach dem Abitur, als sie Studentin war, flog sie nach Rom und lernte Italienisch. Und mitten in Rom, mitten im schlimmsten Getümmel an der Piazza Navona, bei den drei berühmten Brunnen, sah sie einen sehr großen, sehr dünnen, sehr jungen Mann, der seinen Kopf gegen einen Laternenpfahl gelehnt hatte und weinte. Er sah so verzweifelt aus, dass meine Mutter neben ihm stehen blieb und vorsichtig die Hand auf seine Schulter legte.
„Kann ich helfen?“, fragte sie. Zuerst auf Deutsch und dann auf Italienisch.
Der Mann hob den Kopf und schaute meine Mutter nachdenklich an. Eine ganze Weile schwieg er, aber dann sagte er plötzlich etwas.
„Es ist, weil Maria tot ist“, sagte er auf Italienisch und wischte sich über die verweinten Augen. Es dauerte bis zum Abend, bis meine Mutter wusste, dass Maria die kleine Schwester des weinenden Italieners war, der Giorgio hieß. Sie war erst sechzehn Jahre alt und schwer herzkrank gewesen.
Meine Mutter fuhr mit dem weinenden Giorgio ans Meer und saß mit ihm am Strand und sang ihm Freude, schöner Götterfunken und Die Ballade von den Seeräubern und eine Menge anderer Lieder vor und hielt seine Hand und begleitete ihn am Abend nach Hause in sein kleines Dorf außerhalb von Rom. Die ganze Familie war da und alle weinten und meine Mutter saß bei ihnen und fühlte sich verloren und aufgehoben zugleich. In Deutschland, in ihrer eigenen Familie, gab es nie Tränen und Gefühle und man saß nicht stundenlang zusammen, einfach nur, um sich nahe zu sein. Und am Ende des Sommers, lange nach Marias Beerdigung, war meine Mutter schwanger.
„Bleib hier bei mir“, sagte mein Vater und streichelte mit den Fingerspitzen den Bauch meiner Mutter, in dem seit ein paar Wochen – noch unsichtbar – ich lag.
„Mein Studium“, sagte meine Mutter. „Ich muss nochmal nach Hause …“
„Dann komme ich nach“, versprach mein Vater. „Sobald ich meine Abschlussprüfung hinter mir habe.“
Meine Mutter nickte, aber sie war sich nicht sicher, ob er es ernst meinte. Stumm schaute sie ihn an.
Aber er kam. Ein paar Wochen vor meiner Geburt stand er plötzlich vor der Tür. Mit einem Koffer in der Hand und einem Rucksack auf dem Rücken.
„Du bist wirklich da!“, sagte meine Mutter und legte ihre Arme um meinen Vater. Sie erreichten sich kaum noch, denn zwischen ihnen war ich. Und jetzt war ich nicht mehr zu übersehen. Meine Mutter hatte, mit mir im Bauch, über zwanzig Kilo zugenommen.
„Ich habe es doch versprochen“, sagte mein Vater und lächelte.
Damals waren sie beide zwanzig. An einem sonnigen Tag, ein paar Wochen später, kam ich.
Und zwei Jahre später wurde meine Schwester Maria geboren. Sie bekam den Namen der kleinen Schwester meines Vaters, weil sie ihr ähnlich sah, von Anfang an.
Sie war winzig und zart und dunkelhaarig und hatte schwarze Augen, bei denen man Pupille und Iris nicht auseinanderhalten konnte.
Maria eben.
Ich war ein kugelrundes, rotblondes, blauäugiges Baby gewesen und sah meiner Mutter und meiner deutschen Oma ähnlich.
Trotzdem heiße ich Serafina Antonia, wie die Mutter meines Vaters. Es ist in Italien so Brauch, das erste Kind nach den Eltern des Vaters zu benennen.
Heute ist meine Mutter Lehrerin an einer Berufsschule, und mein Vater ist Steinmetz und hat eine eigene kleine Firma. Sie leben zusammen und doch nicht richtig zusammen.
Eine Weile, als Maria und ich noch klein waren, haben wir alle in Italien bei unserer Nonna gewohnt. Damals, als unser Nonno, unser italienischer Großvater, gestorben war. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Wir wohnten in einem sehr kleinen grauen Schiefersteinhaus und alle im Dorf hatten uns gern und wir spielten den ganzen Tag draußen mit den anderen Kindern. Meine Nonna hatte eine eigene Kuh, hinten im Garten in einem kleinen Stall. Die Kuh hieß Angeletta und ich liebte sie vom ersten Tag an. Ich war dabei, als sie ihr erstes Kälbchen bekam und Angst hatte und verwirrt war und vor Schmerzen zitterte. Zusammen mit Nonna blieb ich die ganze Nacht bei ihr im Stall und streichelte sie, um sie zu trösten, und rieb vorsichtig ihr verschwitztes Fell mit Heu ab, wie meine Großmutter es mir gezeigt hatte.
Am Morgen war das Kälbchen da und meine Nonna nannte es Fina, nach Serafina, wie sie als Kind gerufen worden war und wie sie mich rief.
„Du wirst mir fehlen, wenn du erst wieder in Deutschland bist, mein blonder Engel“, sagte sie und drückte mich an sich. Ich erinnere mich noch genau an ihren Geruch. Sie roch nach Lavendel und Kernseife und ein bisschen nach Zigarre. Denn ab und zu rauchte meine riesige Nonna, die die größte Frau im ganzen Dorf war, eine von Nonnos zurückgelassenen Zigarren.
„Ich gehe nicht nach Deutschland“, antwortete ich verwundert auf Italienisch.
Aber ich tat es doch, denn kurz nach meinem zehnten Geburtstag zogen wir erneut um. Meine andere Großmutter, an die ich mich kaum erinnern konnte, war krank geworden und wollte uns in ihrer Nähe haben.
„Nein, nein, nein“, weinte ich verzweifelt und verkroch mich bei Angeletta im Stall.
Aber es nützte nichts. Ein paar Wochen später küsste ich Angeletta zum Abschied und weinte dabei. Und dann küsste ich meine Nonna und weinte noch mehr.
Und dann fuhren wir davon. Weg aus unserem winzigen Dorf, in dem mich alle kannten und mochten und wo es mitten im Ortskern eine kleine Allee aus Zitronenbäumen und am Dorfrand einen kleinen, verwunschenen Pinienwald gab und wo ich glücklich war.
Deutschland war ganz anders als Italien. Wir wohnten jetzt in der Stadt und wir sollten Deutsch sprechen und unser Vater baute sich eine eigene Firma auf und hatte nur wenig Zeit für uns.
Es gab keine Zitronenbäume, keinen Pinienwald, kein Meer, keinen salzigen Wind, keine Palmen, keine Kühe im Garten.
„Warum sprechen sie so schlecht Deutsch?“, fragte meine deutsche Großmutter und schaute meine Schwester und mich mit ihren hellblauen Augen missbilligend an. Es waren ähnliche Augen wie meine eigenen. Es waren auch die Augen meiner Mutter. Frühlingshimmelblaue Augen mit kleinen grauen Sprenkeln darin.
„Sie werden es wieder lernen“, sagte meine Mutter, die unser Dorf ebenfalls vermisste.
„Eines Tages gehen wir wieder zurück“, versprach sie uns. Aber sie hielt ihr Versprechen nicht. Obwohl meine deutsche Oma bald wieder völlig gesund war.
„Ich finde es schön hier“, sagte Maria auf Italienisch.
„Ich nicht“, sagte ich, ebenfalls auf Italienisch.
Wir wohnten in einer ganz neuen Wohnsiedlung und es gab auch hier viele Kinder. Aber sie spielten selten draußen auf der Straße. Sie trafen sich in den Wohnungen. Ich fühlte mich alleingelassen und unbedeutend und übersehen.
Ich vermisste meine große, laute Nonna und den sandigen, verwunschenen Pinienwald und Angeletta in ihrem dämmrigen Stall.
Dann fing die Schule an und ich fand das Leben schwer wie einen Stein.
Zu Hause sprachen wir jetzt alle deutsch, auch mein Vater lernte es, und ich fand es merkwürdig und traurig, seine Stimme deutsch sprechen zu hören. Nur einmal in der Woche sprach ich noch italienisch. Immer samstagabends, wenn unsere Nonna anrief, für ein paar Minuten.
„Nonna, hier ist es nicht schön“, flüsterte ich auf Italienisch.
„Nonna, wie geht es Angeletta?“
„Nonna, in der Schule sitze ich alleine an einem Tisch.“
Die Wochen und Monate vergingen.
Manchmal schlich ich mich zu der kleinen, schäbigen Pizzeria, ganz am anderen Ende unseres Viertels, und setzte mich dort auf eine kleine Mauer im Hof. Still und stumm saß ich da und wartete darauf, dass die alte Signora Bellini, deren Sohn die Pizzeria gehörte, über die Hintertreppe geschlurft kam, um auf Italienisch nach ihrer Katze zu rufen. Traurig lauschte ich den vertrauten Worten und fühlte mich einsam und alleine.
Dann vergaß ich die ersten italienischen Worte. Es passierte an einem Samstag am Telefon.
„Nonna, Papa sagt, ich darf …“
Verwirrt hielt ich inne. Ich durfte reiten gehen. Das hatte ich sagen wollen. Aber ich wusste das italienische Wort für reiten nicht mehr.
„Was wolltest du sagen, mein Engel?“, fragte Nonna aus weiter Ferne, in der Leitung rauschte es laut.
„Nichts“, murmelte ich und schwieg.
Am darauf folgenden Samstagabend blieb ich draußen, bis ich mir sicher war, dass das Telefongespräch aus Italien vorüber war.
Ich war so traurig wie noch nie in meinem Leben.
Unser Lehrer in Italien war streng und alt und auf seine Weise Furcht einflößend gewesen. Wenn man ihm nicht gehorchte, klopfte er einem hart mit den Knöcheln seiner Finger auf den Kopf. Wenn er den Klassenraum betrat, mussten wir alle aufstehen und ihn einstimmig begrüßen. Und wer im Unterricht frech war, stand für den Rest der Stunde in der Ecke.
Aber trotzdem hatte ich hier in Deutschland mehr Angst vor der Schule. Immerzu war es laut und alle machten, was sie wollten. Meine neue Klassenlehrerin schimpfte viel häufiger als mein Lehrer in Italien, aber trotzdem waren die Schüler frech zu ihr.
Und ich saß immer noch alleine. Wir waren eine ungerade Anzahl von Schülern und ich war eben als Letzte dazugekommen.
„Ich habe schon drei Freundinnen in meiner Klasse“, sagte Maria auf Deutsch und schaute mich aus ihren schwarzen Augen zufrieden an.
„Vermisst du Nonna nicht?“, fragte ich leise auf Italienisch.
„Nein“, sagte Maria.
„Und das Dorf? Und das Meer? Und die anderen Kinder? Pedro, Paula und Giovanna? – Vermisst du gar nichts?“
Maria schüttelte den Kopf und ging davon. Ich blickte ihr verwirrt hinterher. Dabei sah sie so italienisch aus. Immer wenn ich sie ansah, musste ich an die Kinder aus unserem Dorf denken. Ich dagegen war so hell und blass wie meine kleine, dicke, deutsche Großmutter.
Der darauf folgende Sommer sollte alles verändern.
„Nächste Woche fahren wir nach Italien“, sagte mein Vater und man sah ihm an, wie er sich freute.
Es würde nur zu Besuch sein, das wusste ich. Trotzdem war ich ebenfalls froh. Ich würde endlich alles und alle wiedersehen.
„Bis bald, Oma“, sagte ich zu meiner deutschen Großmutter bei unserem letzten Besuch vor der Abreise. Ich fühlte mich zittrig und fast krank vor Aufregung und Sehnsucht.
Aber dann passierte es. Am Abend vor unserer Abreise klingelte das Telefon.
„Giorgio Giordano …?“, rief mein Vater in den Hörer hinein. Dann war er lange still, eigenartig still. So still, dass ich aus meinem Zimmer in die Diele schlich. Ich hatte plötzlich Angst, obwohl ich nicht wusste, wovor. Die Angst war einfach da. Sie machte, dass mir ganz kalt wurde. Vielleicht war es eine Vorahnung. Irgendwo tief in mir drin.
„Madonna! Madonna mia …“, flüsterte mein Vater in diesem Moment und setzte sich mit dem Telefon am Ohr auf den Boden. „Wann ist es passiert? Wie geht es ihr jetzt? Ist sie bei Bewusstsein? Wird sie es … schaffen?“
Meiner Nonna war etwas zugestoßen!
„Papa …?“, flüsterte ich erschrocken.
Da legte mein Vater den Telefonhörer auf. Tränen liefen über sein Gesicht. „Sie ist krank! Sie hatte einen Schlaganfall. Man hat sie ins Krankenhaus gebracht mit einem Rettungswagen! Es geht ihr sehr, sehr schlecht …“
Noch in derselben Nacht fuhren wir los.
„Lass sie nicht sterben, lieber Gott“, flüsterte ich stundenlang tonlos in mich hinein.
Und der liebe Gott erhörte mich. Er ließ meine große, stolze, schwarzhaarige Nonna am Leben. Aber sie wurde nie mehr so, wie sie mal gewesen war. Tagelang schlief sie in ihrem weißen Krankenhausbett. Sie schien einfach nicht mehr aufwachen zu können. Angeletta zog in einen fremden Stall um, auf einen kleinen Hof am anderen Ende des Dorfes. Meine Nonna würde sie, selbst wenn sie wieder aufwachen würde, nie mehr versorgen können, da waren sich alle sicher.
Ich saß neben ihrem Krankenhausbett und schaute sie so verzweifelt und unverwandt an, bis mir die Augen brannten.
Ich beschwor immer neue Erinnerungen herauf: Meine Nonna, wie sie Nudelteig knetete. Und wie sie schallend lachte und triumphierend den Kopf zurückwarf, wenn sie beim Pokern gewann. Und wie sie in dicken Zigarrenqualm eingehüllt kerzengerade im alten Ohrensessel meines toten Nonnos saß und konzentriert Mozarts Oper Don Giovanni hörte, die ihre Lieblingsoper war. Und wie sie sonntags mit mir und Maria auf den Friedhof ging, um Blumen für alle verstorbenen Familienangehörigen auf den Gräbern zu verteilen, und dabei laut schluchzte und sich alle paar Schritte dröhnend die Nase putzte.
Und dann wachte sie eines Tages auf. Dünn und faltig und blass lag sie da und schaute uns lange stumm an. Durch das Krankenhausfenster schien strahlende Sommersonne und vermischte sich mit dem kalten Weiß des Krankenhauszimmers zu einem eigenartigen vergnügt-traurigen Lichtwirrwarr.
„Nonna“, flüsterte ich erleichtert und streichelte vorsichtig ihre Hand. Der Geruch von Lavendel, Kernseife und Zigarrenrauch war verschwunden. Hier roch alles nach Krankheit.
„Jajaja“, sagte Nonna schließlich sehr leise und seufzte tief.
„Mama!“, rief mein Vater erleichtert und sprang auf. „Du bist wieder wach! Du kannst sprechen! Alles wird gut!“
Aber es wurde nicht gut.
Meine kranke, italienische Großmutter seufzte noch ein zweites Mal tief, und dann sagte sie würdevoll: „Ich habe Glück gehabt, großes Glück. Der Kuchen hätte auch verbrennen können …“
Alle waren still und erschrocken. Und ich glaube, am erschrockensten war meine Nonna selbst. Jedenfalls sahen ihre Augen sehr erschrocken aus. So, als wisse sie gut, dass sie Unsinn redete, aber sie konnte es nicht ändern. Und sie konnte auch nichts aufschreiben, weil sie das Schreiben ebenfalls verlernt hatte. Ihre Hände hatten keine Kraft mehr, einen Stift zu halten und zu benutzen.
Die Sonnenstrahlen im Zimmer kamen mir plötzlich wie böse Verräter vor.
Ich schaute meine Nonna verzweifelt an, tagelang, bei jedem Besuch im Krankenhaus. Und sie schaute traurig zurück. Zu Beginn versuchte sie es immer wieder. Sie drückte leicht meine Hand und öffnete entschlossen den Mund, um etwas zu sagen. Ihr Blick war klar und klug wie immer, aber trotzdem funktionierte ihr Kopf nicht mehr.
„… der Kuchen hätte mir verbrennen können“, sagte sie tagelang.
„Wenn Krieg ist, gibt es keinen Kuchen, weil dann die Zutaten fehlen“, sagte sie dann ein paarmal, während mein Vater neben ihr auf dem Besucherstuhl saß und sein Gesicht in den Händen vergraben hatte.
Irgendwann hörte sie ganz auf zu sprechen. „Fina, der Kuchen …!“, war das Letzte, was sie zu mir sagte. Blass und sehr, sehr dünn lag sie da und ich erkannte sie kaum noch wieder.
Dann wurde ihr Haus verpachtet und meine italienische Oma kam in ein Pflegeheim in Rom, weil wir es uns nicht leisten konnten, sie mit nach Deutschland zu nehmen. Unsere Wohnung war zu klein und meine Mutter musste arbeiten und hatte keine Zeit, sie zu pflegen. Und die deutsche Krankenkasse spielte auch nicht mit.
Die Tanten meines Vaters würden in Zukunft nach meiner Nonna sehen und mein Vater würde ebenfalls ab und zu nach Rom kommen, um für kurze Zeit bei ihr zu sein.
Und wieder nahm ich Abschied von Italien.
Diesmal endgültig.
Und ein letztes Mal küsste ich meine Nonna. Und am anderen Ende unseres kleinen Dorfes – mein Vater war deshalb extra noch einmal quer durch den Ort gefahren – Nonnas Kuh in ihrem neuen Stall.
Die ganze Rückfahrt über sprach ich kein Wort.
2
Als ich in die sechste Klasse ging, kam Moses. Er war der Erste, der nach mir kam, und darum setzte er sich neben mich. „Hallo, ich heiße Moses Evangelista“, sagte er und schaute mich mit zusammengekniffenen Augen prüfend an. Er war dicklich, trug eine Brille, hatte Sommersprossen im ganzen Gesicht und strubbelige, dunkle Haare.
Moses redete viel. In der Pause lief er neben mir her und unterhielt sich mit mir. Vielmehr redete er ununterbrochen auf mich ein und erwartete, dass ich ihm zuhörte. Nach der ersten Woche wusste ich eine Menge von ihm.
Sein Großvater war Spanier, daher hatte er seinen merkwürdigen Namen. Aber er war bisher noch nie in Spanien gewesen. Er sammelte Kakteen und besaß über hundert Stück. Gerade war er dabei, einen Mammutbaum und einen Bananenbaum zu ziehen. Er hatte zu Hause einen alten, grauhaarigen Pudel, den ihm seine Uroma vererbt hatte und der ein bisschen bissig war, wenn er einen schlechten Tag hatte. Außerdem hatte Moses getrennt lebende Eltern. Seine Mutter war Rechtsanwältin und fast nie zu Hause. Sein Vater schrieb Gedichte über die Liebe, die keiner kaufte, und hatte immerzu andere Freundinnen und lebte in einer schäbigen, kleinen Wohnung am Stadtrand, in der – wenn man Moses glaubte – das totale Chaos herrschte und überall volle Aschenbecher und leere Weinflaschen herumstanden.
„Du bist ja ziemlich schweigsam“, sagte Moses am Freitagmittag, als wir nebeneinander zum Bus gingen.
„Bist du Italienerin, Signora Serafina Giordano?“, bohrte Moses weiter und schaute mich aus allernächster Nähe an. Seine Brillengläser glitzerten im Sonnenschein.
Ich nickte.
„Das sieht man dir allerdings gar nicht an“, stellte Moses kopfschüttelnd fest und schaute mich weiter an.
Und dann wurden wir Freunde. Nach und nach erzählte ich Moses alles über meine Nonna und meine Liebe zu Italien und unserem Dorf und zu Angeletta. Ich erzählte auch, dass meine italienische Oma früher immer kubanische Zigarren geraucht hatte und jetzt krank im Kopf war und nur noch über Kuchen sprechen konnte. Aber meistens schaffte sie nicht mal das. An diesem Tag, in Moses’ Zimmer, mit Bruno, seinem halb bissigen Pudel auf den Knien, fing ich an zu weinen über das alles. Ich weinte und weinte und weinte und Moses saß still und stumm und geduldig neben mir und wartete ab, bis ich mit Weinen fertig war.
In der siebten Klasse fingen Moses und ich an, zusammen Saxofon zu spielen, und alles war gut.
Moses war wie ich: Ein bisschen ausländisches Blut, das man aber nicht sah, steckte in ihm und er war gerne draußen und wir gingen zusammen mit Bruno in den Wald oder wir lagen zusammen in dem Sonnenblumenfeld in der Nähe und wir lasen zusammen sämtliche Karl-May-Bücher, die wir auftreiben konnten.
Sein Mammutbaum wuchs wie verrückt und eines Tages schenkte er ihn mir. Der Bananenbaum hatte den letzten Winter nicht überstanden, aber Moses war schon dabei, einen Nachfolger zu ziehen.
„Danke“, sagte ich erfreut und stellte den kleinen, zarten Mammutbaum auf mein Fensterbrett.
„Und wenn er so groß ist …“, erklärte Moses und tippte ein gutes Stück über dem Baum gegen die Fensterscheibe, „… dann fahren wir zusammen nach Italien und besuchen deine Nonna und dein Dorf und Angeletta, die Kuh.“
Wir lächelten uns zu.
Moses war in fast allen Fächern in der Schule schlecht und ich fürchtete mich davor, dass er sitzen bleiben und ich ihn so verlieren würde. Nur in Kunst und Musik war Moses gut.
„Du musst mehr lernen“, sagte ich. „Mathe und Physik und Bio, überall stehst du zwischen vier und fünf.“
Seine eilige Mutter besorgte für Moses einen Nachhilfelehrer, aber Moses gab sich trotzdem keine Mühe. Eines Tages, als ich bei ihm war, hatte ich eine Idee. Ich schrieb ihm aus meinen Heften alle wichtigen Regeln und Formeln auf weiße Blätter und klebte sie überall an die Wände. In seinem Zimmer, im Flur, im Wohnzimmer, sogar im Badezimmer an den Spiegel.
„So wird es funktionieren“, sagte ich.
Moses verzog sein rundes, sommersprossiges Gesicht.
„Egal, was du in Zukunft machst, du lernst immer etwas dabei“, erklärte ich zufrieden. „Beim Kakteengießen und Bananenbaum-Umtopfen Geometrie, beim Frühstück in der Küche Algebra, beim Mittagessen im Esszimmer Vererbungslehre und im Bad beim Zähneputzen physikalische Gesetze.“
„Kotz …“, murmelte mein bester Freund wenig dankbar.
Wir setzten uns gemütlich in die Küche, futterten jeder eine Portion Cornflakes und lasen mathematische Formeln dabei und ich dachte, dass es so funktionieren würde.
Aber das tat es nicht und darum blieb Moses im Sommer sitzen.
„Mist“, sagte ich traurig.
„Egal, wir bleiben trotzdem beste Freunde“, antwortete Moses und schenkte mir eine winzige Paradiesvogelblume, die er mühsam aus einem flauschigen orangefarbenen Samenkern gezogen hatte.
„Ungefähr an deinem achtzehnten Geburtstag blüht sie, wenn alles gut geht, zum ersten Mal“, erklärte er grinsend und stellte die kleine Blume behutsam neben den Mammutbaum, der in der letzten Zeit langsamer wuchs. Er kam noch lange nicht an unsere „Dann-fahren-wir-nach-Italien-Marke“ heran.
„Und wenn sie blüht, küssen wir uns“, schlug Moses vor und schaute mich halb an und halb nicht an.
Dazu sagte ich nichts. Ich hatte schon seit einer Weile den Verdacht, dass Moses ein bisschen in mich verliebt war, irgendwie. Aber er war nicht unbedingt der, den ich mal küssen wollte. Er war einfach nur Moses, mein bester Freund.
Mein bester Freund mit dem runden, sommersprossigen Gesicht und den immerzu zerzausten, widerspenstigen Haaren.
Mit Moses konnte man merkwürdige Urwaldpflanzen ziehen und im Wald herumlaufen und stundenlang zwischen Sonnenblumen liegen und alte Beatles-Songs nachsingen.
Aber ihn zu küssen konnte ich mir nicht vorstellen.
Tagsüber war ich ganz normal. Ich spielte Saxofon mit Moses oder ging mit ihm ins Kino oder in die Stadt oder in den Wald. Manchmal schauten wir auch nur stundenlang zusammen Videos und sprachen die Dialoge in den Winnetoufilmen mit und weinten zusammen, wenn Winnetou starb. Aber nachts war ich eine andere Serafina Giordano, eine ganz besondere Serafina Giordano.
Dann war ich schön und beliebt und andere Jungen als Moses mochten mich.
Es war ein heißer Sommer, ich wurde vierzehn und es regnete wochenlang kein einziges Mal. Es war, als würde die heiße Sommerluft komplett stillstehen.
Mein Vater fuhr alleine für ein paar Tage nach Italien, um im Pflegeheim nach dem Rechten zu sehen, und meine Mutter, meine Schwester und ich fuhren mit unserer deutschen Oma nach Südfrankreich, wo meine deutsche Oma ein kleines Haus am Meer hatte. „Ich will lieber mit Papa nach Italien“, hatte ich vorher gesagt. Aber irgendwie ergab es sich nicht.
Meine Eltern hatten viel Streit in der letzten Zeit.
Einmal, bei einem Streit in der Küche, warf meine Mutter mit einem Töpfchen Basilikum nach meinem Vater, und er fegte als Antwort ihren Terminkalender von der Anrichte. Ich war gerade von der Schule nach Hause gekommen und stand im Flur. Ich hatte keine Ahnung, worüber sie stritten, und ging leise in mein Zimmer.
Ob das eben so war im Leben, dass man irgendwann aufhörte, sich zu lieben? Oder liebte man sich noch, auch wenn man sich anschrie und Basilikum nach dem anderen warf?
Ein paar Tage vor unserer Abreise zog in der Wohnung über uns eine neue Familie ein.
„Ich heiße Ernestine“, sagte das Mädchen, das ich eines Morgens im Treppenhaus traf. Es war der zweite Ferientag, und Moses war bereits fortgefahren – nach Irland mit seinem Vater.
„Ich bin Serafina“, sagte ich und schaute Ernestine neugierig an.
Sie war etwas größer als ich und sie hatte glatte braune Haare, die sich unten an den Spitzen ringelten. Sie war auch dünner als ich und hatte einen kleinen, spitzen Busen und ein schönes, schmales Gesicht. Sie trug ein kurzes hellblaues Top, das den unteren Teil ihres dünnen Bauches frei ließ.
Sie sah wirklich schön aus. Schön und so, wie ich gerne ausgesehen hätte. So, wie ich nachts in meinen Träumen aussah.
„Wir sind gerade erst eingezogen und in meinem Zimmer stehen ungefähr tausend Umzugskisten herum …“, sagte Ernestine und lächelte mir zu. „Wohnst du auch hier?“
Ich nickte.
„Prima“, sagte Ernestine.
„Allerdings fahren wir in drei Tagen in die Ferien“, fiel mir in diesem Moment ein.
„Schade“, sagte Ernestine. „Wie alt bist du?“
„Vierzehn“, sagte ich.
„Ich auch“, sagte Ernestine.
Und dann verabredeten wir, dass Ernestine meinen Mammutbaum und meine Paradiesvogelblume für mich gießen würde, solange ich verreist war.