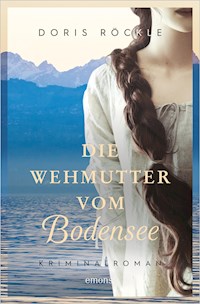6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rheinthal Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Mittelalter im mystischen Rheintal: historische Spannung zum Abtauchen Doris Röckles historischer Roman »Der Wagemut der Burgtochter« erzählt von einer mutigen jungen Edelfrau, einem Mönch in Not und geheimnisvollen klerikalen Schätzen. Burg Gutenberg in Liechtenstein 1499: Ihr neues Zuhause erweist sich für die junge Edelfrau Praxedis von Montani als trostloses Gefängnis, denn ihr Mann zeigt kein Interesse an ihr, dafür lässt ihre Schwiegermutter keine Gelegenheit aus, Praxedis nach Kräften zu schikanieren. Zur selben Zeit erhält der junge Bruder Mauritius den Auftrag, einige Reliquien an einen sicheren Ort zu bringen, die sein Kloster seit Jahrhunderten hütet und geheim hält; darunter ein als Ketzerwerk verdammter Codex und eine geheimnisvolle Himmelsscheibe. Doch unterwegs hat Mauritius einen schweren Unfall und wird verletzt nach Burg Gutenberg gebracht. Während ein Krieg zwischen den Habsburgern und den Schweizer Eidgenossen immer wahrscheinlicher wird, haben es finstere Kräfte auf die wertvollen Reliquien abgesehen … Opulent und farbenprächtig entführt Doris Röckle zum 5. Mal ins mittelalterliche Rheintal und lädt zu einer abenteuerlichen Reise durch Tirol, Liechtenstein und Süddeutschland ein. Entdecken Sie auch die anderen atmosphärischen Mittelalter-Romane der historischen Rheinthal-Reihe: - Die Flucht der Magd - Das Mündel der Hexe - Die Spur der Gräfin - Die List der Schanktochter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 773
Ähnliche
Doris Röckle
Der Wagemut der Burgtochter
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Opulent und farbenprächtig entführt Doris Röckle zum 5. Mal ins mittelalterliche Rheintal und lädt zu einer abenteuerlichen Reise durch Tirol, Liechtenstein und Süddeutschland ein.
Inhaltsübersicht
Widmung
Karten
Dramatis Personae
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Danksagung
Für Flurina
Danke für die liebevolle Freundschaft,
die uns seit Kindesbeinen verbindet
Als König Maximilian I. am 22.3.1459 geboren wurde, regierte sein Vater Friedrich III. über ein Territorium, das kleiner war als das heutige Österreich. Als Maximilian am 12.1.1519 starb, herrschte sein Enkel Karl V. bereits über ein Weltreich. Der Schwabenkrieg, auch Schweizerkrieg genannt (Januar–September 1499), war nur einer von vielen Kriegen, die Maximilian führte. Auslöser war die Eskalation des Vinschgau-Konflikts. Der Krieg tobte im Rheintal, in Graubünden, Tirol, Vorarlberg, auf dem Gebiet um Konstanz, dem Hegau und Klettgau und von Waldshut bis nach Basel. Mit dem Hochrhein, Bodensee und Alpenrhein bildete sich eine feste politische Grenze zwischen der Eidgenossenschaft und den Habsburgern.
Dramatis Personae
Die mit einem *markierten Personen sind geschichtlich belegt.
Ulrich von Ramschwag* Burgvogt
Elisabeth von Marmels* seine Gemahlin
Johann Donat von Ramschwag* ihr Sohn
Goswin von Ramschwag* ihr Sohn und Pfarrer von Ragatz
Klara von Ramschwag* ihre Tochter
Praxedis von Montani* die Gemahlin von Johann Donat
Ursina Kammermagd von Praxedis
Jakob Knecht und Ursinas Geliebter
Alda Köchin
Bruder Gregorius Burgkaplan
Augustin Schmied in der Vorburg
Martha seine Frau
Liesel und Marie Ursinas Schwestern, die bei Martha ein neues Zuhause finden
Meister Berthold Medicus
Sigmund von Brandis* Freiherr der Burg
Katharina von Hewen* seine Gemahlin
Johann Nikolaus von Brandis* Stiefbruder der beiden Freiherren von Brandis
Ludwig von Brandis* Freiherr der Burg
Heinrich von Hewen* Bischof, Onkel von Katharina von Hewen
Johannes von Brandis* Dompropst, Bruder von Sigmund und Ludwig
Paul Ziegler* Domherr, späterer Bischof
Hans Weibel Domherr
Bruder Notker Mönch
Franziskus della Porta* ehemaliger Domkustos
Hans Locher* Bürgermeister der Stadt Curia
Johannes Walser Abt
Matthäus Gerster Prior
Mauritius Klosterbruder
Hans von Königsegg* Burgvogt und Freiherr
Amalia Humpis von Ratzenried* seine Gemahlin
Veit ihr Sohn
Lena Kammermagd
Grit altes Kräuterweib
Zacharias Prior der Johanniterkommende
Anna von Helfenstein* Gräfin und König Maximilians Mätresse
König Maximilian I.*1459–1519, ab 1486 römisch-deutscher König, ab 1508 römisch-deutscher Kaiser
Bianca Maria Sforza* seine 2. Gemahlin, 1472–1510
Gillime* Hofnarr des Königs
Konrad Stürtzel von Buchheim* königlicher Kanzler
Zyprian von Serntein* Pronotarius und königlicher Rat
Ulrich von Habsberg* Hauptmann
Albert von Brandis* Abt und Onkel der Freiherren von Brandis
Nikolaus Prior
Prolog
Kloster Montecassino 1230
Die Abtei lag auf einem felsigen Hügel, an dessen Fuß sich das Dörfchen San Germano schmiegte. Zwei mächtige Türme ragten weit in den azurblauen Himmel, umkreist von einer Schar krächzender Raben. An die zwanzig Mönche und ebenso viele Novizen und Laienbrüder zählte die stolze Benediktinerabtei, die im Valle Latina unweit von Rom lag. Ein steiler Weg führte hinauf zu dem jahrhundertealten Gemäuer, dessen Ruf bis weit über die Landesgrenzen hinaus für Ruhm und Ehre sorgte.
Die Sonne brannte seit Wochen mit aller Kraft auf die rot glühende Erde und alles, was sich bewegte. Die Menschen im kleinen Dorf suchten den Schatten. Umso erstaunter bemerkten sie, dass dieser Tage besonders viele Besucher hinauf zur Abtei strebten. Bei Regen hätten die vornehm gekleideten Kleriker den steilen Weg zu Fuß bewältigen müssen, denn die eisenbeschlagenen Räder der schweren Kutschen wären unweigerlich im Morast stecken geblieben, was ihnen einige Batzen eingebracht hätte. Doch so konnten sie den vornehmen Kutschen nur mit Verwunderung hinterherblicken.
Der Portarius am Tor der Abtei hielt sich mit Fragen zurück und winkte die Besucher mit stoischer Miene in den Innenhof. Der Abt hatte ihn eindringlich ermahnt, die Männer nicht ungebührlich zu mustern. Lediglich der Sonne warf er hin und wieder einen finsteren Blick zu, besonders dann, wenn der aufgewühlte Staub sich in seine Lungen fraß und er zu husten begann.
Im Innenhof warteten bereits zwei weitere Mönche auf die in dunkle Kutten gehüllten Gäste. Die Kleriker hatten Order, die Besucher schnellstmöglich durch den Seiteneingang in den Empfangssaal zu führen. Neugier sollte erst gar nicht aufkommen, weder unter den alteingesessenen Mönchen noch unter den Novizen oder den Laienbrüdern. Unruhe tat nicht gut, brachte die Besinnung zu Gott durcheinander, und das wollte man hier in Montecassino unter allen Umständen vermeiden.
Der Abt schloss deshalb hinter jedem der Besucher eigenhändig die Tür. Selbst dem angesehenen Cellerar und dem nicht minder geachteten Camerarius blieb der Zutritt zum Empfangssaal untersagt. Lediglich dem alten Bibliothekar war es gestattet, die Gäste zu begrüßen und sie auf ihre Plätze zu führen.
Die Unterredungen zogen sich zum Unmut aller Beteiligten in die Länge. Ein Tag löste den andern ab, und die Gerüchteküche des Klosters begann trotz aller Vorsicht zu brodeln.
Die Geheimniskrämerei führte zu Spannungen innerhalb der Klostergemeinschaft, und so war die Disziplin während der Chorgebete immer schwerer aufrechtzuhalten. Hinter vorgehaltenen Händen wurde ungehemmt getuschelt, und bald schon machten die wildesten Spekulationen über die Identität der Besucher die Runde.
Immer häufiger missachteten vor allem die jungen Novizen die Regel der Ruhezeiten und duckten sich neugierig hinter die Steinsäulen, besonders dann, wenn der Abt mit einem der Besucher einen Spaziergang im Kräutergarten unternahm. Die Worte verstand niemand, zumal die Männer sich meist nur flüsternd unterhielten, doch allein die Haltung bezeugte, dass hier Wichtiges verhandelt wurde.
Noch immer trafen neue Besucher ein, und bald war der Gästetrakt bis auf die letzte Bettstatt gefüllt. Dass die Männer nicht wegen der herrlichen Aussicht oder der glockenhellen Stimmen des Knabenchores den Weg nach Montecassino gefunden hatten, war jedermann klar. Zwar nahmen die Besucher regelmäßig an den klösterlichen Liturgien teil und horchten dabei den gregorianischen Gesängen der Klosterschüler, doch so richtig Interesse zeigten sie dabei nicht. Ihren Mienen war zu entnehmen, dass sie ganz andere Sorgen plagten.
Eines Abends blieben der Abt und der Bibliothekar der Vesper fern, ebenso wie die zwanzig Gäste, die mittlerweile den Weg nach Montecassino gefunden hatten. Viele der Klosterbrüder konnten ihre Neugier nur schlecht verhehlen und fügten sich nur ungern der Weisung des Abtes, an diesem Abend die Zellen früher als gewöhnlich aufzusuchen.
Als auch die Nachtfackeln gelöscht wurden und die Gänge des Klosters in völliger Dunkelheit lagen, erreichte die Stimmung im Empfangssaal ihren Höhepunkt. Immer wieder fiel das Wort Secretum magnum. Es kostete den Abt erdenkliche Mühe, die vielen Meinungen unter einen Hut zu bringen, denn offenbar hatte jeder der Besucher eine andere Vorstellung, was das Secretum magnum betraf.
»Meine Brüder«, rief das Oberhaupt von Montecassino mit bereits heiserer Stimme. Als das Raunen im Saal kein Ende nahm, klopfte der Abt erzürnt mit einem Pergamentbeschwerer auf die Tischplatte. »So kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns einigen, die Zeit drängt.«
Der Bibliothekar kam seinem Oberhaupt zu Hilfe, indem er eine kleine Glocke ergriff und diese heftig schüttelte. Augenblicklich kehrte Ruhe ein.
»Wie gesagt«, nahm der Abt das Wort wieder auf, »ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass Kaiser Friedrich gedenkt, nach San Germano zu kommen, um sich hier mit Papst Gregor IX. zu treffen. Wir können uns alle wohl gut vorstellen, dass er sich nicht unten im Dorf in diesen ärmlichen Hütten einquartieren wird.« Ein zustimmendes Nicken machte die Runde. »Meine Quelle sagt, dass er gedenkt, in der Abtei, in der gesamten Abtei wohl bemerkt, Unterkunft zu nehmen. Sein Hofstaat ist immens und braucht viel Platz.«
»Und was geschieht dann mit Euren Brüdern? Man wird sie hier kaum dulden«, warf einer der Zuhörer ein, wobei er seinem Nachbarn zunickte.
»Da stimme ich Euch leider zu, werter Bruder.« Der Abt seufzte. »Wenn es Hermann von Salza nicht gelingt, den Kaiser in der Wahl seines Quartiers umzustimmen, werden wir Mönche wohl ein drittes Mal in der Geschichte von Montecassino vertrieben werden. Deshalb müssen wir eine Lösung für … für unsere Aufgabe finden. Es gilt nicht nur, das Secretum magnum vor fremden Augen zu schützen, auch die verbotenen Codices müssen an sichere Orte gebracht werden. Es ist unsere Aufgabe, diese Bücher zu retten und für die Nachwelt zu erhalten.«
»Ist es denn sicher, dass Papst Gregor den Kirchenbann gegen den Kaiser aufheben wird?«, fragte ein dicker, kleiner Mann, den alle hier im Raum als Kleriker der Reichsabtei Werden kannten.
»Wie mir zu Ohren kam, hat er dies bereits getan. Hermann von Salza hat sich als geschickter Vermittler erwiesen und scheint in diesem Augenblick auf dem Weg zum Kaiser. Er soll eine Bulle mit sich führen, in welcher der Papst Frieden mit dem Kaiser schließen will.«
Der Abt gab seinem Bibliothekar das Zeichen, diesmal das Raunen, das seine Worte ausgelöst hatten, nicht zu unterbrechen. Er wollte den anwesenden Kirchenmännern Zeit geben, sich die Dringlichkeit der Situation zu verinnerlichen.
»Wir müssen befürchten, dass der Kaiser die Abtei womöglich verwüstet, die jahrhundertealten Codices vernichtet. Wenn nicht er selbst, dann bestimmt seine Gefolgsleute.«
Das Oberhaupt von Montecassino fühlte alle Augen auf sich gerichtet. Jetzt galt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bücher wie der Codex der Heiligen Dreifaltigkeit und andere kostbare Schriften des großen Petrus Abaelardus mussten verteilt werden, ebenso wie das Secretum magnum.
»Niemals dürfen die geheimen Codices von Petrus Abaelardus in die falschen Hände gelangen«, fuhr der Abt nach einem Räuspern fort. Er wartete bewusst, bis er wieder alle Augen auf sich spürte. Allmählich rann ihm die Zeit durch die Finger. »Diese Bücher haben die öffentliche Verbrennung im Namen des Papstes nicht überdauert, um jetzt den königlichen Truppen als Lagerfeuer zu dienen. Wir müssen das verhindern. Nicht nur der Codex über die Heilige Dreifaltigkeit muss bewahrt werden, auch die Werke über die Logica sind von größter Wichtigkeit«, erklärte er.
Das Raunen nahm erneut zu, und auf vielen der Gesichter lagen Ratlosigkeit und Hochmut gleichermaßen. Der Abt stieß mit seiner Geduld an die Grenzen. Er wusste um die Gier dieser Männer nach dem Secretum magnum. Jeder der Männer hier im Raum wollte es in seinen Besitz bringen, denn das Geheimnis dieser Kostbarkeit war von solcher Brisanz, dass es jedem Kloster zu Macht und Einfluss verholfen hätte. Viele der Männer hier waren angesehene Äbte, einige sogar Bischöfe.
»Ich habe im Vorfeld mit allen Anwesenden Gespräche geführt und bin zu dem Schluss gelangt, dass die Codices nur dann für die Nachwelt erhalten werden können, wenn wir sie an verschiedenen Orten unterbringen. Es besteht nicht nur vonseiten des Kaisers Gefahr, wie wir alle wissen«, griff der Abt das Wort wieder auf. Dabei blickte er mit ernster Miene in die Runde. »Es gibt auch andere Bruderschaften, die leider von den Kostbarkeiten erfahren haben und jetzt alles versuchen, sie in ihren Besitz zu bringen. Allen voran die Bruderschaft der Schlange.« Der Abt spürte die Erregung im Raum, die seine Worte auslösten. »Diese Männer sind gefährlich, zu allem bereit. Das Secretum magnum hat es ihnen besonders angetan. Wie wir alle wissen, behaupten sie, damit ihren Irrglauben über den unseren stellen zu können. Niemals dürfen diese abtrünnigen Teufelsanbeter diese Kostbarkeit in die Finger kriegen, es wäre unser aller Untergang.«
Zustimmendes Nicken, empörtes Aufschnaufen und erregtes Getuschel, die Reaktionen der Männer waren ganz unterschiedlich.
»Wie konnte diese Bruderschaft überhaupt davon erfahren?«, rief einer von ihnen erbost. »Wir hatten doch Stillschweigen vereinbart.«
Der Abt hob resigniert die Schultern. Er hatte das Wort Verräter absichtlich nicht in den Mund genommen und sich vorhin nur vage ausgedrückt. Doch es war klar, dass irgendeiner dieser Männer hier geplaudert hatte. Er wusste nicht, welcher der Kleriker ein doppeltes Spiel trieb, und würde es wohl auch nie erfahren. Er hoffte nur, dass er die richtige Wahl getroffen hatte und das Secretum magnum nicht in falsche Hände fiel. Einen solchen Klosterschatz herzugeben schmerzte. Bislang war Montecassino ein Fels in der Brandung gewesen, ein Ort, an welchem verbotene Schriften die Ewigkeit überdauert hatten. Doch mit dem Kaiser und den Teufelsanbetern im Nacken war selbst eine so mächtige Abtei nicht mehr sicher.
»Ich hoffe, dass mein Vorschlag auf das Wohlwollen aller hier anwesenden Männer stößt und uns nicht für immer entzweit. Denn das wäre das Todesurteil für die alten Werke, da stimmen mir hoffentlich alle zu«, fuhr der Abt seufzend fort. »Ich werde die Werke von Petrus Abaelardus aufteilen, sie über alle Lande zerstreuen. Nur so können wir sie retten.«
Die Männer in der Runde nickten, einige nur verhalten, andere erwartungsvoll euphorisch.
»Und das Secretum magnum?«, fragte der Kleriker der Reichsabtei Werden lauernd. »Es muss an einem besonders guten Ort versteckt werden, damit es diese Schlangenbrüder nicht in ihre Hände bekommen. Es würde ihre Irrlehre noch nähren.«
»So ist es. Ich habe deshalb auch lange mit mir gerungen, ehe ich einen Entschluss gefällt habe«, beantwortete das Oberhaupt von Montecassino die Frage mit einem Nicken. »Doch erst wollen wir die Codices aufteilen. Da leider auch hier in der Abtei die Wände oftmals Ohren haben, reiche ich eine Liste herum, auf welcher die Namen der Klöster zu lesen sind. Ich bitte euch, meine Brüder, sich nicht darüber laut zu äußern, sondern meinen Entscheid stumm anzuerkennen.«
Der Abt drückte seinem Bibliothekar die Schriftrolle in die Hände und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Der Enttäuschung auf manchen Gesichtern schenkte er ein entschuldigendes Lächeln, der Begeisterung ein eindringliches Nicken.
»Und das Secretum magnum?«, wiederholte der Kleriker der Reichsabtei Werden seine Frage. »Ich sehe es nirgends auf der Liste vermerkt.«
»Es wird eine sichere Zufluchtsstätte finden«, antwortete ihm der Abt. »Und zwar an jenen Ort, wohin auch der Codex der Heiligen Dreifaltigkeit gebracht wird.«
Der Abt hörte das empörte Aufschnaufen seiner Mitbrüder. Die Wahl war auch ihm nicht leichtgefallen. Doch Curia war eine der ältesten Städte jenseits der Alpen, nur schwer zu erreichen und daher von Kriegswirren weitestgehend verschont. Das Raunen im Saal nahm zu, der Unmut wuchs.
Er klopfte mit dem Pergamentbeschwerer heftig auf die Tischplatte und blickte finster in die Runde. Einige der Männer ignorierten ihn völlig und keiften wie Waschweiber. Ihre Stimmen wurden mit jedem Atemzug lauter.
»Ich habe hier die Oberhand, und es bleibt dabei«, rief er lauter als gewollt. »Der Codex der Heiligen Dreifaltigkeit und das Secretum magnum werden nach Curia gehen, genauer gesagt in das kleine Kloster Sankt …«
Der Abt hielt abrupt inne. Innerhalb von Sekunden verstummten die Stimmen. Wie nur hatte ihm dieser Fehler unterlaufen können. Besorgt blickte er zur Tür.
»Schau nach, ob sich dahinter ein Lauscher verbirgt«, wandte er sich mit heiserer Stimme an den Bibliothekar.
Alle Augen lagen auf dem kleinen Kleriker, der hastig zu der Tür lief. Nachdem er seinen Kopf durch den Spalt gestreckt hatte, drehte er sich um. Die Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Gott sei Dank«, sagte der Abt tief Atem holend. »Niemand wird in einem so unauffälligen Kloster Schätze von solcher Brisanz vermuten«, fügte er erklärend hinzu. »Und jetzt wird der Bibliothekar alle Bücher verteilen, und ich möchte die Herrschaften bitten, Montecassino noch in dieser Nacht zu verlassen.«
1. Kapitel
Burg Gutenberg Herbst 1498
Die Nacht hing schwer über dem Tal. Bis zum Morgengrauen würden sich die Stunden dahinziehen, wie sie es immer taten, erwachte die junge Frau zu so früher Stunde. Die kleine Birkenkerze auf dem Nachttisch war längst heruntergebrannt, doch das störte Praxedis von Montani nicht. Sie liebte diese Zeit der Ruhe und Stille, die Zeit, in der die Geister der Nacht die Dunkelheit beherrschten. Dann war noch kein Platz für Feindseligkeiten und Intrigen, die erwachten erst mit der Morgendämmerung. Die Burg Gutenberg war für sie längst zum Ort der Verdammnis verkommen, ein Ort, dem man so schnell wie möglich zu entfliehen versuchte. Doch für sie gab es kein Entkommen, dafür war es zu spät.
Gähnend schälte sie sich aus den wollenen Decken. Der Boden war kalt. Hoffentlich würde ihre Schwäherin bald ein Einsehen haben und die Kohlenpfannen in der Burg verteilen lassen. Allerdings befürchtete Praxedis, dass sie wohl als Letzte eines der begehrten Dinger erhalten würde.
Die Mutter ihres Gemahls war der Grund aller Bitterkeit, der sie sich seit ihrer Ankunft hier im Rheintal gegenübersah. Seit dem ersten Augenblick hatte Elisabeth von Marmels keinen Hehl aus der Abneigung ihr gegenüber gemacht. Die Hoffnung, dass sich die mütterliche Eifersucht irgendwann noch legen und die Burgherrin sie als wohlgeliebte Schwiegertochter in ihr Herz schließen würde, hatte sich längst verflüchtigt. Vier Jahre waren seit ihrer denkwürdigen Ankunft hier auf der Burg nun schon vergangen, vier Jahre, in denen sich an Elisabeth von Marmels’ Haltung nichts geändert hatte. Mittlerweile hatte ihre Schwäherin es geschafft, auch ihre Tochter gegen sie aufzubringen. Nun waren sie zu zweit, die Ramschwager Weiber, und gegen eine solche Übermacht anzukommen war einfach unmöglich.
Beim Gedanken an Klara von Ramschwag konnte sich Praxedis ein Lächeln nicht verkneifen. Gott hatte ihre Mannesschwester weder mit Schönheit noch mit Verstand bedacht. Mit ihrer Leibesfülle und dem watschelnden Gang vertrieb sie jegliche Brautwerber. Zudem stank sie oft dermaßen nach Schweiß, dass selbst das Gesinde die Nase rümpfte. Doch das Schlimmste an Klara war ihre boshafte Geschwätzigkeit. Bei ihr musste man stets auf der Hut sein, zumal sie die Worte gerne zu ihren Gunsten verdrehte.
Praxedis angelte sich das Schultertuch und trat zu dem Fenster ihrer Kemenate. Der Mond stand als dünne Sichel am Firmament, umringt von unzähligen Sternen. Als Kind hatte man ihr eingeredet, dass die Sterne die Seelen der Verstorbenen seien, die auf ihre Lieben herabblickten. Wie leichtgläubig Kinder doch waren. Möglichst versucht, keinen Lärm zu machen, öffnete sie das Fenster einen Spaltbreit.
Dunkel zeichneten sich die mächtigen Bergspitzen gegen den Nachthimmel ab. Das fahle Mondlicht verlieh ihnen etwas Mystisches. Es war ein schönes Tal, das Rheintal, wenn auch etwas rau. Zu beiden Seiten von hohen Bergen flankiert, dazwischen dunkle Wälder, tiefe Schluchten und mittendrin der dominierende Rhein. Im Frühjahr oder nach tagelangem Regen wurde aus dem Fluss ein reißender Feind, der alles mit sich riss, was nicht niet- und nagelfest war. Vielen Menschen hatte der Fluss schon den Tod gebracht. An wenigen Furten schifften erfahrene Flößer die Menschen von einem Ufer ans andere, ansonsten war eine Überquerung aus eigener Hand undenkbar.
Die junge Frau rieb sich die Augen und sog die Nachtluft tief in ihre Lungen. Am Burghügel reiften die letzten Weintrauben, man konnte sie riechen. Zudem glaubte sie einen Hauch des Windes zu spüren, der mit steter Regelmäßigkeit über das Tal hereinbrach und die Herbstfröste für Tage vertrieb. Sie liebte diesen lauen Fallwind, den die Menschen hier im Tal Föhn nannten.
Als sie aus der Nachbarskammer ein Geräusch hörte, drehte sie sich erstaunt um. Es war ungewöhnlich, dass ihr Gemahl bereits zu dieser frühen Stunde auf den Beinen war.
Johann Donat von Ramschwag gehörte nicht zu der Sorte Männer, die noch vor dem ersten Hahnenschrei im Burghof auftauchten. Eigentlich gehörte ihr Gemahl überhaupt keiner Gruppe Männer an. Er liebte weder das Reiten noch die Jagd noch begehrte er die Frauen. Bei diesem Gedanken entwich der jungen Frau ein Seufzer. Sie wandte sich ab. Gedankenverloren strich sie mit einer Hand über die wollene Decke, die über der Stuhllehne lag. Seit ihrer Ankunft hier auf der Burg versuchte sie, ihren Gemahl zu bezirzen, doch vergebens. Johann Donat bemühte sich zwar stets um Höflichkeit, und untertags zeigte er sich auch durchaus galant und von ihr angetan, doch kam die Nacht über die Burg, wurde aus dem groß gewachsenen Mann mit den schulterlangen Haaren und den blauen Augen ein Weichling. Ein anderes Wort fiel ihr nicht ein. Johann Donat war nicht zu mehr fähig als ein paar Küssen, dann verzog er sich geduckt, eine Ausrede murmelnd, in seine Kammer. In solchen Momenten glich er mehr einem geprügelten Hund, dem man den Knochen gestohlen hatte, als einem gestandenen jungen Burgherrn, der hier einst das Zepter übernehmen sollte. Natürlich ahnte auf der Burg niemand, welche Dramen sich regelmäßig in ihrer Kemenate abspielten. Man hielt die fehlende Mutterschaft, wie Elisabeth von Marmels so gerne betonte, für eine Unzulänglichkeit ihrerseits. Wie gerne hätte Praxedis ihrer Schwäherin ins Gesicht gerufen, dass hierfür nicht sie, sondern einzig und allein ihr geliebter Sohn verantwortlich war. Doch dies hätte die Stimmung auf der Burg nur zusätzlich aufgeheizt, sodass es schlauer war zu schweigen. Es war nun mal eine Tatsache, dass Johann Donat nicht Manns genug war, ein Kind zu zeugen, damit musste sie sich abfinden.
Aus der Nachbarskammer drangen noch immer Geräusche. Als sich die Tür mit einem Knarren öffnete und Johann Donat den Kopf durch den Türspalt streckte, kroch Praxedis gerade wieder unter die Decke.
»Habe ich dich geweckt?«, fragte ihr Gemahl leise.
»Nein, ich kann ohnehin nicht mehr schlafen.« Praxedis unterdrückte ein Gähnen. Hoffnungsvoll rückte sie etwas zur Seite. Vielleicht geschah ja doch noch ein Wunder.
»Du hast es vergessen, nicht wahr?« Johann Donat betrat die Kammer. Er band sich die Haare im Nacken zusammen.
Praxedis überlegte angestrengt, dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Gestern Abend hatte ihr Schwäher Ulrich von Ramschwag davon gesprochen, auf die Jagd zu gehen. Da sie keinerlei Interesse an diesem Treiben hatte, hatte sie der Unterhaltung nur mit halbem Ohr gelauscht.
»Ach ja, die Jagd«, versuchte sie sich ihre Enttäuschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Wie nur hatte sie glauben können, dass Johann Donat sie auch nur eine Sekunde begehrte.
»Vater will sich bei Tagesanbruch mit Sigmund von Brandis oben auf der Luzisteig treffen. Auch die Ritter der Burg Grafenberg werden mitmachen, und wenn die Jagd zu lange dauert, werden wir wohl dort übernachten«, fuhr Johann Donat fort, während er durch das offene Fenster auf den Mond schaute.
»Auf der Burg Grafenberg?«, fragte Praxedis nun doch etwas erstaunt. »Der Ruf der beiden Ritter ist nicht der beste, das weißt du.«
»Da hast du recht«, pflichtete ihr Gemahl gähnend bei. »Ich kann mir gut vorstellen, dass Vater genau deshalb dort das Nachtlager aufschlagen will. Im Stillen ist die Jagd vermutlich nur ein Vorwand, um zusammen mit Freiherr Sigmund von Brandis Druck auf die beiden Ritter auszuüben. Die Überfälle auf die Kaufleute müssen aufhören.«
Praxedis nickte. Raubrittertum war verwerflich, und die beiden Ritter der Burg Grafenberg gehörten zu der übelsten Sorte. Immer wieder kam es vor, dass sie ganze Karawanenzüge oben auf dem kleinen Pass Luzisteig überfielen. Die umliegenden Burgherren ärgerten sich zwar über diese üblen Gesellen, doch viel hatten sie deswegen noch nicht unternommen. Ob vielleicht auch etwas Angst im Spiel war? Die Grafenberger besaßen ein hitziges, aufbrausendes Temperament, das nur schwer zu zügeln war. Sogar der Ruf der Mordbrennerei jagte ihnen voraus.
»Gib Sorge auf dich«, meinte Praxedis verkrampft lächelnd, während Johann Donat auf sie zukam. Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich glaube, es kommt Föhn auf. Vielleicht solltest du eine der Stuten nehmen, die scheuen nicht so leicht.«
Ihr Gemahl würde einen ebenso finsteren Tag erleben wie sie selbst, das ahnte Praxedis. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn verrieten seinen Widerwillen gegen die bevorstehende Jagd. Inmitten einer Horde blutrünstiger Männer durch den Wald zu reiten und auf alles zu schießen, was sich bewegte, widerstrebte Johann Donat ebenso wie ihr die Gesellschaft ihrer Schwäherin und Klara.
Als Praxedis die Arme um den Hals ihres Mannes legen wollte, wehrte dieser hastig ab. Beinahe fluchtartig, eine Entschuldigung murmelnd, entschwand er zurück in seine Kammer. Tränen liefen Praxedis über die Wangen, während sie ihr Gesicht in den Kissen vergrub. Niemand sollte ihr Schluchzen hören, diesen Triumpf würde sie den beiden Weibern nicht gönnen.
Durch das geöffnete Fenster hörte Praxedis alsbald das ungeduldige Wiehern der Pferde, dazwischen tiefe Männerstimmen, die zum Aufbruch drängten. Allmählich wichen die Schatten der Nacht der Dämmerung. Ein neuer Tag begann.
Praxedis strich sich die letzten Tränen aus den Augen. Ihre Kammer war gemütlich. An den Wänden hingen ein Wandteppich, der eine Stelle aus der Bibel zeigte, und daneben zwei Gobelins, Andenken an ihre Kindheit. In einem massigen Wandschrank, dessen Vorderseite eine filigrane Schnitzerei aufwies, lagerten ihre Kleider. Ein kleiner Tisch mit Spiegel und zwei Truhen rundeten das Mobiliar ab. Materiellen Mangel litt sie keinen, auch Hunger kannte sie nicht. Dass ihr Gemahl so gar nichts mit ihr anzufangen vermochte, daran musste sie sich gewöhnen, und vielleicht lag der Grund allen Übels ja doch bei ihr. Als sich an der Tür ein zaghaftes Klopfen meldete, schluckte Praxedis ihren Kummer hinunter.
»Herein«, rief sie räuspernd.
Sie schlug die Decke zurück und setzte sich an den Rand der Bettstatt. Über ihr hing der schwere Baldachin, dessen dunkelrote Farbe sie verabscheute und den Elisabeth von Marmels wohl genau deswegen in ihre Kammer hatte bringen lassen.
»Komme ich ungelegen?«, fragte die Kammermagd mit gesenkten Lidern, wobei sie hastig knickste.
»Nein, gerade richtig.« Praxedis wies mit dem Kinn in Richtung des Fensters. »Die Männer sind ja schon längst auf den Beinen, also werde ich es ihnen gleichtun. Such mir das blaue Kleid heraus und leg sicherheitshalber den etwas dickeren Umhang dazu, vielleicht werde ich am Nachmittag noch nach Meyenfeldt fahren, um der Freifrau von Hewen einen Besuch abzustatten.«
Die junge Kammermagd nickte mit glühenden Augen. Praxedis erahnte ihre Hoffnung. Auch Ursina entkam der Enge der Burg nur zu gerne. Ihre Eifrigkeit nahm mit jedem Atemzug zu.
»Das Wetter ist wie für einen Ausflug gemacht, Herrin. Der Föhn vertreibt bestimmt alle Wolken«, meinte sie hoffnungsvoll lächelnd.
Praxedis nickte zustimmend. Sie mochte die junge Frau, die als Einzige auf der Burg ihre Gemütslage verstand. Zudem unterhielt Ursina sie gerne mit dem Burgtratsch, was sie auf andere Gedanken brachte.
»Du meinst, ich sollte den Tag also nutzen, um der Trübsal der Burg zu entkommen?«
»Herrin, das würde ich niemals sagen«, meinte Ursina erschrocken, wobei sich ihre Augen vor Schreck weiteten.
»Aber denken tust du es, nicht wahr, Ursina?«
Die Wangen der Magd röteten sich vor Verlegenheit. Sie wusste kaum noch, wohin den Blick zu wenden.
»Du hast ja recht«, erlöste Praxedis die junge Frau. »Allerdings wird mein Vorschlag unten in der Wohnstube nicht auf große Zustimmung stoßen, doch das ist mir gleichgültig. Ein Blick auf das wunderschöne Farbkleid des Waldes und die Plauderei mit Katharina sind mir eine weitere Auseinandersetzung allemal wert.«
Mit einem Schwung erhob sich Praxedis von ihrer Bettstatt, um in das Kleid zu steigen, das ihr Ursina entgegenhielt. Dann setzte sie sich an den kleinen Frisiertisch. Augenblicklich begann die Magd, die Haare zu entwirren.
»Eure Haare sind so schön«, sagte Ursina, ihrer Herrin im trüben Spiegel zulächelnd. »Das blaue Kleid passt wunderbar zu dem tiefen Rot.«
Praxedis enthielt sich eines Kommentars. Sie mochte ihre kupferroten Haare nicht wirklich. In der Kindheit wurde sie deswegen oft gehänselt. Wäre ihr Vater nicht der Burgherr gewesen, man hätte sie wohl noch deftiger mit Schmährufen bedacht. Allerdings hatte Ursina schon recht, ihre Haare eigneten sich bestens für die herrlichen Zopffrisuren, die dieser Tage beim Adel so in Mode waren. Ursinas geschickte Finger schafften es sogar, Perlen und Spangen in die dicken Haare einzuflechten, ehe das Ganze unter einem feinen Schleier verschwand.
»Sind meine Schwäherin und Klara schon in der Wohnstube?«, fragte Praxedis nach einer Ewigkeit der Stille, in der man nur das Klappern der Haarnadeln hörte, wenn wieder mal eine zu Boden fiel.
»Als ich heraufkam, sah ich die Kammermagd der Burgherrin eben eintreten. Allerdings weiß ich nicht, ob sie nicht schon vorher in der Kammer war und jetzt nur die Waschschüssel holte.«
Praxedis nickte. Mit sichtlichem Wohlwollen begutachtete sie ihr Spiegelbild. Die hohen Wangenknochen, die verspielten Sommersprossen und die vornehm bleiche Haut hätten sie durchaus zu einer Schönheit gemacht, wäre da nicht die Narbe, die sich quer über die rechte Wange zog. Einer ihrer Brüder hatte sich im Spiel zu eifrig gegeben und ihr einen Schwerthieb verpasst. Das anschließende Donnerwetter ihres Vaters hatte ihr den Schmerz wohl vergolten, doch die Narbe war geblieben. Ob vielleicht dies der Grund für Johann Donats Abneigung ihr gegenüber war? Praxedis hielt den Kopf schräg, wie sie es immer tat, wenn sie über etwas nachdachte.
Ein Räuspern vonseiten Ursinas brachte sie in die Wirklichkeit zurück. Hastig strich sie sich etwas von der Salbe über die Narbe, dann erhob sie sich.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie mit einem Lächeln.
»Bezaubernd, wie immer.« Ursina strahlte.
»Dann auf in den Kampf.«
Praxedis zupfte ein letztes Mal an ihrem Schleier, dann verließ sie die Kammer, Ursina im Schlepptau. Als sie vor der Tür zur Wohnstube standen, ergriff Ursina die Klinke. Auf ein Zeichen ihrer Herrin hin klopfte sie kurz, öffnete die Tür und trat einen Schritt zur Seite.
Elisabeth von Marmels und ihre Tochter saßen tatsächlich bereits am großen Eichentisch. Wie es aussah, hatten sie die Jagd nicht vergessen und sich deshalb früher aus ihren Betten geschält, um die Männer gebührend zu verabschieden. Womöglich würde umgehend ein Tadel folgen.
»Richte in der Küche aus, dass man das Morgenmahl für meine Schwiegertochter bringen könne«, rief die Burgherrin mit strenger Stimme in Ursinas Richtung. »Offenbar hat sie es doch noch geschafft aufzustehen, wenn auch verspätet. Die Männer sind bereits aufgebrochen«, wandte sie sich mit gespitztem Mund an Praxedis, wobei Empörung in ihren Augen blitzte.
»Ich habe sie gehört und zudem noch mit Johann Donat gesprochen«, konterte Praxedis trocken schluckend.
In Gegenwart ihrer herrischen Schwäherin schwand ihre Selbstsicherheit so schnell wie Wasser auf einem heißen Stein. Elisabeth von Marmels besaß die Fähigkeit, ihre Gegner allein mit den Augen in die Knie zu zwingen. Dass sie daneben noch über eine Spitzzüngigkeit verfügte, die schmerzte, machte ihre Gegenwart doppelt unangenehm.
Praxedis setzte sich auf den ihr angestammten Platz gegenüber von Klara und zur rechten Seite ihrer Schwäherin. Während Klara sich längst wieder ihrem mit Dörrfrüchten verfeinerten Hafermus widmete, betupfte Elisabeth von Marmels mit einem kleinen Leinentuch ihre Lippen. Sie wollte wohl eben zu einer weiteren Beleidigung ausholen, als Klara die Schüssel weit von sich schob und den Mund angewidert verzog.
»Grauenvoll«, rief die verwöhnte junge Frau, wobei sie ihre Nase rümpfte. »Immer nur dieser Birnensaft. Ich will Honig, Mutter, süßen Honig aus dem Wald.«
Um Elisabeth von Marmels’ Mund zuckte es. Es war unschwer zu sehen, dass die ständigen Nörgeleien ihrer Tochter selbst ihr an diesem Morgen zuwider waren. Das Jagdvergnügen ihres Gemahls missfiel ihr sichtlich.
»Bitte, Mutter, du weißt doch, wie schwer mir der Birnensaft im Magen liegt«, fuhr Klara fort, wobei sie sich zu ihrer Mutter hinüberneigte, sodass der Stuhl unter ihrem Gewicht ein knarrendes Geräusch von sich gab.
Elisabeth von Marmels ergriff die kleine Glocke, doch in diesem Augenblick klopfte es bereits, und Ursina brachte das Morgenmahl für ihre Herrin.
»Mach schon vorwärts«, zischte die Burgherrin. »Und sag Alda, dass sie gefälligst in Zukunft mit dem Honig nicht sparen soll. Und jetzt bring eine gut gefüllte Schüssel davon und auch etwas von dem Mandelgebäck, das Klara so mag.«
Ursina huschte in Windeseile nach draußen, ehe sie wenig später die Köstlichkeiten auf den Tisch stellte.
»Alda lässt ausrichten, dass nicht mehr Honig in der Küche vorrätig sei. Es tue ihr leid, aber die Bienen seien heuer nicht so zahlreich wie sonst und die Nester im Wald deswegen nur schlecht zu finden.«
Elisabeth von Marmels knirschte mit den Zähnen, während Klara eine beleidigte Schnute zog, aber gleichzeitig nach der Honigschüssel und dem Mandelgebäck griff.
»Dann sollen die Knechte eben suchen, bis sie die Viecher finden. Klara braucht ihren Honig. Sag das Alda«, brummte sie. »Warum hast du dich so herausgeputzt?«, wandte sie sich dann zänkisch an Praxedis, die sich gerade einen Löffel Hafermus gönnte. »Es wäre wohl angebrachter, du würdest in Abwesenheit meines Sohnes etwas dezenter auftreten. Ein einfacher Rock hätte es auch getan. Zudem habe ich heute eine Niedergeschlagenheit auf dem Gesicht meines Sohnes gesehen, die mir überhaupt nicht gefiel. Als seine Frau solltest du dich mehr um sein Wohlergehen bemühen.«
»Ihr sprecht wohl wieder einmal meine fehlende Mutterschaft an«, seufzte Praxedis schulterzuckend. »Johann Donat wird Euch doch wohl schon gesagt haben, dass wir uns redlich darum bemühen.«
»An ihm kann es ja wohl nicht liegen«, meinte Elisabeth von Marmels spitz. »Mein Sohn ist kerngesund. Es muss dein Leib sein, der verdorben ist. Aber was soll man auch anderes von einem … einem Bastard erwarten.«
Während Elisabeth von Marmels Klaras Hand tätschelte, versuchte Praxedis, die Tränen wegzublinzeln. Ihre Schwäherin war an diesem Morgen wieder in voller Fahrt. Bastard – dieses Wort mochte sie am allerliebsten.
Den Kopf gesenkt, musste Praxedis hart an sich halten, um nicht zu sagen, was sie wirklich dachte. Ja, sie war eine uneheliche Tochter des mächtigen Balthasar von Montani, dem Herrscher der Burg Obermonani im Vinschgau, und ja, ihre Mutter war eine einfache Magd gewesen, wenn auch eine mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Was man von Elisabeth von Marmels nicht behaupten konnte.
»Meinen Brautschatz habt Ihr aber dennoch mit Freuden genommen, da war meine Herkunft nicht so wichtig«, bemerkte sie mit brüchiger Stimme.
Der Hunger war Praxedis vergangen. Wie immer in Gegenwart ihrer Schwäherin verkrampften sich ihre Eingeweide, und ihre Kehle wurde staubtrocken. Sie war der Boshaftigkeit dieser Frau nicht gewachsen. Alles in ihr drängte nach Flucht.
»Wie redest du mit meiner Mutter«, empörte sich nun auch Klara mit vollem Mund kauend. »Du bist ein freches Weibsbild. Warte, bis Vater zurück ist, dann werde ich davon erzählen.« Klara schob sich einen weiteren Löffel von ihrem Mus in den Mund. »Man sollte sie in ihrer Kammer einsperren, Mutter, dann kann sie uns nicht mehr so frech kommen.«
»Wagt das nicht.« Praxedis schob den Stuhl zurück und erhob sich. Eine Träne kullerte ihr über die Wange. »Ein Wort an meinen … meinen Bruder, und … und …«
»… und was?« Elisabeth von Marmels lachte böse auf. »Hinter uns steht König Maximilian, und hinter deiner Familie?« Sie lachte abermals auf, dieses Mal noch abfälliger. »Ein Tal voller Bauern, die bis vor Kurzem noch unter der Herrschaft des Bischofs von Curia standen. Was wollen die gegen einen König schon ausrichten. Und jetzt setz dich wieder hin!«
»Wenn Euch meine Gegenwart so zuwider ist, werde ich mich lieber zurückziehen.« Praxedis nickte den beiden Frauen zu. »Zudem werde ich den Tag nutzen, um der Freifrau von Hewen einen Besuch abzustatten.« Sie ging mit steifen Schritten zur Tür. Hinter sich konnte sie die Empörung spüren, die ihre Worte ausgelöst hatten.
»Du weißt, dass ich diese Besuche missbillige, meine liebe Söhnerin.« Elisabeth von Marmels betonte das »liebe« so eindrücklich, dass jedem Außenstehenden sofort klar geworden wäre, dass es genau das Gegenteil bedeutete.
»Johann Donat hat Kenntnis davon«, log Praxedis mit leicht zittriger Stimme über ihre Schulter gewandt. Dann drückte sie die Klinke und verließ die Wohnstube mit wild klopfendem Herzen.
Die beiden Weiber würden sich weiter die Mäuler über sie zerreißen und die Unterhaltung so aufbauschen, dass selbst ihr sonst so genügsamer Johann Donat in Rage geraten würde. Doch das würde er ohnehin, erfuhr er von ihrer Lüge. Er war seiner Mutter hörig. Wenn Elisabeth von Marmels ihm etwas befahl, führte er es augenblicklich aus. Sie wartete nur auf den Augenblick, bis er seine Hand gegen sie erheben würde. Die Freude ihrer Schwäherin wäre grenzenlos. Doch in diesem Augenblick war ihr das einerlei. Sie musste weg von der Burg, und wenn es auch nur für einige Stunden war.
In der Küche war der Zwist nicht unbemerkt geblieben. Ursina und auch Alda, die treue Köchin der Burg, standen verlegen lächelnd am Herd, als Praxedis den Kopf hineinstreckte.
»Ursina, du begleitest mich nach Meyenfeldt, und sag im Stall Bescheid, dass wir eine Kutsche brauchen«, raunte sie mit vor Wut und Verzweiflung gleichermaßen getragener Stimme ihrer Kammermagd zu, die augenblicklich nach draußen rannte, um den Befehl in die Tat umzusetzen.
»Ich habe Euch eine Kleinigkeit für die Fahrt gerichtet, Herrin«, bemerkte die alte Köchin mit einem Augenzwinkern. »Süße Wecken mit Honig, die mögt Ihr doch so gerne.«
Jetzt konnte sich Praxedis ein Schmunzeln doch nicht verkneifen. Die alte Alda war ihr mehr zugetan, als das gesamte Ramschwager Pack es je sein würde.
»Ich dachte, es gibt keinen Honig mehr?«
»Für Euch habe ich natürlich ein Schälchen zur Seite gestellt, was glaubt Ihr denn.« Alda zwinkerte abermals.
Praxedis spürte, wie ihr die Tränen erneut in die Augen schossen. Die aufkeimende Rührung unterdrückend, wandte sie sich ab. In diesem Augenblick erschien Ursina mit vor Eifer geröteten Wangen.
»Alles gerichtet, Herrin. Auch Euren Umhang habe ich schon in die Kutsche gelegt.«
»Was würde ich nur ohne euch beide machen.« Praxedis lächelte, wenn auch verkrampft.
Als aus der Wohnstube die Stimmen lauter wurden, raffte sie ihren Rock und rannte die Stiege hinunter. Erleichtert stieg sie wenig später in die Kutsche. Ursina saß neben dem Stallknecht auf dem Kutschbock, der das Gefährt mit sicherer Hand den schmalen Burgweg hinabgeleitete. Die Vorhänge zur Seite geschoben, genoss Praxedis die Eindrücke, die auf sie einstürmten. Die Leute am Wegrand hoben zum Gruß die Hand, viele lächelten, wenn auch nicht alle. Ulrich von Ramschwag, ihr Schwäher und Burgvogt der Gutenberg, verwaltete die Herrschaft im Auftrag der Habsburger mit eiserner Hand. Nicht selten statuierte er ein Exempel, um die Bauern in Schach zu halten. Öffentliche Prügelstrafen gehörten zur festen Ordnung.
Praxedis hieß dies nicht gut. Sie war der Meinung, dass Güte und Verständnis eher den Weg ebneten als Härte und Gewalt. Doch mit dieser Meinung stand sie allein da. Ihr entging auch heute nicht, wie ärmlich die Menschen gekleidet waren, wie ausgemergelt ihre Gesichter wirkten. Das Rheintal war ein enges Tal, oftmals versandet, nicht geeignet, den Boden gewinnbringend zu bewirtschaften. Und doch mussten die Menschen hier ihre Zehnten abliefern, da war Ulrich von Ramschwag unerbittlich.
Als die Kutsche die Straße hinauf zum kleinen Pass nahm, mussten die beiden Pferde Schwerstarbeit verrichten. Auf den teils gepflasterten Wegstücken marschierten schon die Römer auf ihren Feldzügen. Auf der Passhöhe befand sich eine Zollstation nebst einer kleinen Taverne und einem Gotteshaus. Ulrich von Ramschwag kontrollierte als habsburgischer Vogt diesen begehrten Handelsweg vom Bodensee zu den Alpenpässen nach Venedig und in die Lombardei. Die Einnahmen waren beachtlich, gab es doch diesseits des Rheins nur diesen einen Weg. Schwer beladene Karawanen zwängten sich seit Jahrhunderten den Pass hoch. Oftmals wechselten sie hier ihre erschöpften Tiere aus oder gönnten sich eine Rast, sehr zum Wohlgefallen der Ritter der Burg Grafenberg.
Praxedis schob den Gedanken an die grobschlächtigen Raubritter mit einer Handbewegung zur Seite. Die Natur inmitten des dichten Waldes war zu schön, um an die Überfälle zu denken. Sie lehnte sich seufzend auf der Sitzbank zurück und sog die frische Waldluft tief in ihre Lungen. Die Bäume trugen ihr herbstliches Blätterkleid, sodass der Wald in allen Rottönen schimmerte. Der Föhn wollte nicht so richtig in Fahrt kommen, lediglich ein leises Rauschen der Baumkronen war zu hören. Der Anblick der Natur drängte die Streitereien mit ihrer Schwäherin etwas in den Hintergrund. Der Tag war einfach zu schön, um ihn mit schlechten Gedanken zu füllen.
Als ihnen eine Händlergruppe mit fünf Ochsen und ebenso vielen Eseln entgegenkam, brachte der Stallknecht die Kutsche zum Stehen. Neugierig lugte Praxedis durch das Fenster. Die Männer kamen von weit her, wie ihr seltsamer Dialekt bekundete. Auf ihren wettergegerbten Gesichtern lagen Strenge und Freundlichkeit gleichermaßen. Während oben auf dem Septimerpass Säumer die Karawanen sicher ans Ziel brachten, mussten hier im Tal die Händler selbst auf ihr Hab und Gut achtgeben. Die Burg Grafenberg war nicht fern, weshalb die Männer zur Eile drängten. Sichtlich froh darüber, dass die Kutsche ihnen den Weg nicht zusätzlich versperrte, marschierten sie dankend vorüber.
Voller Wehmut musterte Praxedis die gut verpackten Güter auf den Rücken der Tiere. Es war lange her, seit sie das letzte Mal einen Markt besucht hatte, und wie es aussah, würde sich daran auch in nächster Zeit nichts ändern. Feldkirch und Curia, die nächstgelegenen Städte, verfügten über Märkte, ebenso wie die reichen Städte am Bodensee, doch der Weg dahin war lang und beschwerlich, und Elisabeth von Marmels würde sich eher die Zunge abbeißen, als ihr dieses Vergnügen zu gönnen.
Als sich die Kutsche wieder in Bewegung setzte, sonnte sich Praxedis in ihren Erinnerungen. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. An Schlaf war allerdings auf der holperigen Straße und der harten Sitzbank nicht zu denken, also nahm sie sich einen der süßen Wecken. Er schmeckte köstlich. Alda verstand ihr Handwerk.
Als die Kutsche den Pass passiert hatte und der Weg in sanften Windungen hinunter ins Tal führte, tauchte schon bald die Stadtmauer von Meyenfeldt auf. Unter dem Tor kam die Kutsche zum Stillstand.
Praxedis konnte hören, wie der Stallknecht mit den beiden Wachen verhandelte, dann ruckelte die Kutsche den verwinkelten Gassen entgegen. Das Städtchen Meyenfeldt war klein, ebenso wie die Märkte, die hier einmal pro Woche stattfanden. Mehr als alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Besen, Seile und Töpfe wurden nicht angeboten, Tand suchte man vergebens.
Hastig säuberte Praxedis ihre klebrigen Finger an einem Leinentuch, dann schwang der Verschlag der Kutsche auch schon auf.
Vor ihnen lag die Burg, bestehend aus einem sechsstöckigen Hauptturm, einem kleinen Nebenturm und einem Palas. Im Innenhof wurde emsig gewerkelt. Auf dem Zinnenkranz des Turmes glaubte Praxedis weitere Wachen zu erkennen.
Kaum aus dem Innern geklettert, kam Katharina von Hewen auch schon mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Die Freifrau war die Herzlichkeit in Person, ein Fels in der Brandung, eine Freundin in Zeiten der Not.
»Welche Freude, Praxedis«, begrüßte sie ihren Gast mit einem Lächeln. »Wurde aber allmählich auch Zeit, dass du wieder einmal nach Meyenfeldt kommst.« Scherzhaft tadelnd streckte sie einen Zeigefinger in die Luft.
»Du weißt, dass es für mich nicht leicht ist, die Burg zu verlassen. Meine Schwäherin bewacht jeden meiner Schritte, bei Tag und bei Nacht, besonders bei Nacht«, fügte Praxedis mit einem Schmunzeln bei.
»Oje, sie wirft dir deine fehlende Mutterschaft noch immer vor? Die gibt wohl niemals auf.« Katharina umarmte ihre um etliche Jahre jüngere Freundin. »Aber lass uns drinnen weiterreden. Der Föhn bringt mich noch um. Mein Schädel brummt seit dem frühen Morgen, als hätte sich ein Schwarm Hornissen darin eingenistet.«
»Der Föhn?« Praxedis blickte erstaunt auf die alte Eiche an der Mauer. Die Blätter bewegten sich kaum merklich.
»Er kommt. Ich spüre es immer im Voraus.« Die Freifrau massierte sich die Schläfen.
»Und dann überfalle ich dich auch noch mit einem unerwarteten Besuch. Das tut mir leid.« Praxedis trat zögerlich einen Schritt zurück. »Soll ich nicht besser wieder umkehren?«
»Das fehlte gerade noch«, gurrte Katharina. »Deine Gegenwart lenkt mich von den Schmerzen ab. Zudem habe ich eine Überraschung für dich.«
Bevor Praxedis eine weitere Frage stellen konnte, legte die ältere Frau auch schon einen Arm um ihre Schultern und drängte sie sanft, aber bestimmt auf den Hocheinstieg der Burg zu.
Die Wohnstube lag im vierten Geschoss. Die Wände zierten Malereien eines Waltenburger Künstlers, dessen Name niemand kannte. In der Mitte des Raumes stand ein ansehnlicher Tisch, umringt von acht Stühlen. Die Fensternischen schmückten kleine Holzbänke mit bestickten Kissen. Doch das Auffallendste im Raum war der Kamin, der trotz des bald eintreffenden Fallwindes angeheizt worden war. Katharina von Hewen musste die Skepsis auf Praxedis’ Stirn wohl bemerkt haben, denn sie meinte lächelnd, dass der Ofen schon gestern beheizt worden sei und die Wärme sich so lange halte. Praxedis nickte nur, sagte aber nichts. Denn in Zeiten des Föhns war es verboten, die Herdstellen anzufeuern, da machten auch die Burgen keine Ausnahme. Zu groß war die Angst vor einer Feuersbrunst.
»Setz dich, Praxedis«, forderte Katharina ihre Freundin auf, wobei sie ihr einen Stuhl wies.
»Du sprachst vorhin von einer Überraschung?« Praxedis suchte vergeblich nach einer Veränderung im Raum.
»Ja, wir haben Besuch bekommen. Leider war Sigmund schon weg, somit konnte er den Gast nicht mehr begrüßen.«
»Ja, die Jagd mit den Rittern der Burg Grafenberg, ich weiß. Johann Donat und mein Schwäher sind ja mit von der Partie.« Praxedis verdrehte die Augen.
»Ich für meinen Teil glaube ja, dass es gar nicht um die Jagd geht«, meinte die Freifrau geheimnisvoll lächelnd, während sie etwas näher zu ihrer Freundin rückte. »Unser Gast ist wohl ebenfalls auf dem Weg zu diesem Treffen, auch wenn er dies vehement abstreitet.«
Praxedis’ Stirn legte sich in Falten, also sprach ihre Freundin hastig weiter.
»Es ist Johann Nikolaus, der kurz vor dir eingetroffen ist, ein Halbbruder meines Gemahls.«
»Der Rittersöldner? Hast du mir nicht erst kürzlich erzählt, dass er sich auf einem Schlachtfeld wieder ruhmreich hervorgetan habe?«, fragte Praxedis erschrocken.
»Gar so schlimm ist Johann Nikolaus nun auch nicht«, wehrte die Freifrau beruhigend nickend ab. »Er ist halt ein gewissenhafter Kriegsmann, mit dem man nicht in Konflikt geraten sollte, und zudem ein treuer Gefolgsmann von unserem König Maximilian.«
»Sicher, sicher, ich will seine Verdienste in keiner Weise schmälern. Es ist nur so, dass ich Krieg verabscheue. Er bringt stets so viel Leid über die Menschen.« Praxedis zuckte mit den Schultern. »Aber wie kommst du darauf, dass er sich mit unseren Männern treffen will?«
»Johann Nikolaus erzählte mir etwas von Streitigkeiten zwischen dem Gotteshausbund und dem König. Es geht wohl irgendwie um Herrschafts- und Steuerrechte im Vinschgau. So ganz habe ich die Sache nicht verstanden. Mein Oheim, Bischof Heinrich von Hewen, soll ebenfalls darin verwickelt sein.«
»Im Vinschgau ist es schon öfter zu Scharmützeln zwischen dem Gotteshausbund und den Königlichen gekommen, und bislang haben sie sich immer einigen können«, meinte Praxedis voller Vertrauen. »Es wird auch dieses Mal eine gütliche Lösung geben, ganz bestimmt.«
Katharina teilte die Sorglosigkeit ihrer Freundin nicht, wie der ernste Ausdruck ihrer Miene zeigte.
»Es ist nicht nur der Vinschgau, in welchem Konflikte herrschen«, fuhr sie seufzend fort. »Offenbar machen auch die Eidgenossen Druck auf den König. Sie sehen den Beitritt von Konstanz zum Schwäbischen Bund als Provokation. Wenn sich der Gotteshausbund und die Eidgenossen zusammenschließen, wird eine Einigung schwierig werden, so sagte mir mein Mannesbruder.«
Praxedis’ Sorglosigkeit bekam nun doch etwas Risse. Nachdenklich schaute sie auf die prächtige Wandmalerei.
»Der König spaßt nicht lange mit seinen Gegnern, das erzählte man sich schon in meiner Familie, besonders dann, wenn sie auf ihrer Meinung beharren«, bemerkte sie grüblerisch. »Im Vinschgau sind die Meinungen jedoch nicht gar so verhärtet. Die Menschen dort lieben ihr Tal zu sehr, um einen sinnlosen Krieg anzuzetteln.«
»Im Vinschgau vielleicht schon, nicht aber am Bodensee und entlang des Rheins.« Katharina zuckte mit den Schultern. »Ein Krieg in greifbarer Nähe würde uns alle betreffen«, meinte sie seufzend. »Und deshalb ist wohl auch Johann Nikolaus hier.«
Praxedis’ Blick lag irgendwo zwischen den Weinranken des Waltenburger Künstlers.
»Mein Herz gehört nach wie vor dem Vinschgau. Sollte es zum Krieg kommen, stünden wir womöglich auf zwei verschiedenen Seiten«, flüsterte sie.
»Das könnte gut sein«, pflichtete ihr Katharina bei. »Wir Brandiser sind dem König zur Treue verpflichtet. Der springende Punkt ist jedoch, dass Ludwig und Sigmund durch ihre Vorfahren das Burgrecht von Bern besitzen, also Bürger der Stadt sind und somit auch Eidgenossen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt Meyenfeldt und der Große Rat Bündnisse mit den Bündner Bünden eingegangen und somit verpflichtet sind, bei Angriffen stets Partei für die Eidgenossen zu ergreifen.« Katharina lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. Mit einmal war die Leichtigkeit auf ihrem Gesicht verschwunden. »Auf welche Seite sich Sigmund und sein Bruder Ludwig auch stellen werden, Verlierer sind sie ohnehin.«
In diesem Augenblick schwang die Tür auf, und ein kleiner, stämmiger Mann mit schwarzem Bart und schwarzen Haaren betrat den Raum. Erschrocken fuhr Praxedis hoch.
»Dann darf es eben nicht zum Krieg kommen«, meinte der Mann, wobei er vor den beiden Frauen eine Verbeugung vollführte. »Entschuldigt mein Lauschen, aber die Tür war nur angelehnt, sodass ich jedes Wort mühelos verstand.«
»Darf ich dir meinen Schwäher vorstellen, Johann Nikolaus von Brandis«, stellte Katharina den Mann vor, der sich jetzt unaufgefordert auf einen der Stühle setzte. Seine Grobheit vermochte er nur schlecht zu verhehlen, da half auch ein aufgesetztes Lächeln nichts. »Und das ist Praxedis von Montani, die Gemahlin des Johann Donat von Ramschwag und meine liebste Freundin.«
Johann Nikolaus wies mit einem Augenzwinkern auf den leeren Weinkrug. »Wie ich sehe, wartet dein Gast noch immer auf etwas zu trinken.«
»Ach, entschuldige, meine Liebste, das habe ich im Eifer ganz vergessen. Bleib ruhig sitzen, ich werde umgehend nach der Magd rufen.«
Katharina rauschte durch die Tür, und zurück blieb eine beklemmende Stille, die Praxedis nicht behagte. Johann Nikolaus musterte sie so ungehemmt, dass sie spürte, wie sich ihre Wangen allmählich rot färbten.
»Johann Donat ist also Euer Gemahl. Der Mann kann sich glücklich schätzen, ein so schönes Weib an seiner Seite zu haben.«
Vor Verlegenheit kaum noch wissend, wohin sie ihren Blick lenken sollte, nestelte Praxedis nervös in der Falte ihres Rockes. Die Küche lag zwei Stockwerke unter der Wohnstube, getrennt durch eine lange Stiege. Hoffentlich kam Katharina bald zurück, ansonsten würde die Peinlichkeit für sie bald unerträglich werden.
»Ihr braucht mir nicht schönzutun«, sagte sie mit kratziger Stimme. Mit einmal kam ihr ein Einfall. Sollte Katharina recht haben und die Jagd war lediglich eine Ausrede, dann trafen sich die Männer bestimmt auf einer der Burgen. Sie zweifelte, dass es die Grafenberg war, also blieb nur noch die Burg Vadutz. »Solltet Ihr Euch nicht allmählich beeilen, wenn Ihr die Burg Vadutz noch heute erreichen wollt?«, fragte sie mit leicht schräg gestelltem Kopf.
Das Erstaunen auf dem Gesicht des Mannes war nicht zu übersehen, wie Praxedis mit stiller Genugtuung feststellte.
»Woher wisst Ihr vom dortigen Treffen?«, fragte der Rittersöldner skeptisch, wobei er sie noch eindringlicher musterte.
Die Antwort wurde Praxedis erlassen, denn in diesem Augenblick kam Katharina, gefolgt von einer Magd, zurück. Erleichtert, nicht eine Lüge erfinden zu müssen, nahm Praxedis den Weinbecher, den ihr die Magd reichte. Bei der anschließenden Unterhaltung ging es nur noch um Nebensächlichkeiten, und bald schon verlor der Rittersöldner sein Interesse an den beiden Frauen. Eine Entschuldigung murmelnd verließ er die Wohnstube.
»Mein Mannesbruder erhält jährlich sechzig Gulden Sold vom König, zudem für jeden Dienst, jeden Ritt und weiß Gott noch für welche Gefälligkeiten weitere zig Gulden«, brummte Katharina. »Vielleicht wäre es doch einträglicher, wenn sich Sigmund auf die Seite des Königs schlägt. Die Burg zerfällt an etlichen Stellen, und Steinmetze kosten eine Menge Geld.«
»Und du glaubst, der König würde sich spendabel zeigen und euch helfen?«
»Warum nicht. Die Burg Gutenberg unterstützt er auch.« Katharina nickte nachdenklich.
Praxedis verkniff sich weitere Worte. Die Burg Gutenberg stand auf Habsburger Land und war der letzte Außenposten des Landes. Aber Schloss Brandis? Sie zweifelte, dass der König hierzu Geldmittel fließen lassen würde. Zudem müsste Sigmund wohl mit einer stattlichen Anzahl Männern im königlichen Heer dienen, und dazu war der Brandiser allein schon wegen seiner schwächlichen Konstitution nicht in der Lage. Den restlichen Nachmittag mieden sie die Worte Krieg und König. Katharina erzählte von der neusten Mode, die ein fahrender Händler letzte Woche auf Schautafeln vorgeführt hatte.
Als Praxedis Stunden später wieder in ihrer Kutsche saß, dachte sie lange über Johann Nikolaus von Brandis nach. Allein durch die Gegenwart des Rittersöldners bekamen die Feindseligkeiten zwischen dem König und den Bündner Bünden eine Gewichtigkeit, die ihr Angst machte. Sie versuchte, den Gedanken an diesen undurchsichtigen Mann zu vertreiben, was ihr jedoch nur halbherzig gelang. Immer wieder stellte sie sich die Frage, was auf der Burg Vadutz tatsächlich verhandelt wurde und welche Rolle ihr Johann Donat darin spielte.
2. Kapitel
Bischöflicher Hof / Kloster Sankt Luzi in Curia
Der Bischöfliche Hof, gelegen auf einem Hügel inmitten der Stadt Curia, umgeben von einer eigenen Ringmauer, diente den durchreisenden Königen schon in der Vergangenheit stets als idealer Ort, um Quartier zu beziehen. In die Mauer eingelassen, kündeten fünf Flankierungstürme von der Wehrhaftigkeit der Bischofspfalz.
Längst hatten die Glocken der Kathedrale Sankt Mariä Himmelfahrt zur sonntäglichen Messe geläutet. Ganz Curia war auf den Beinen. Das Stimmengewirr drang bis weit in die klösterliche Anlage, während sich der Strom der Besucher schwitzend den steilen Weg hochkämpfte. Der Föhn hatte die Temperaturen nochmals in die Höhe getrieben, den baldigen Winter vergessen gemacht.
Bischof Heinrich von Hewen wandte sich vom Fenster des Empfangssaales ab und ging zu seinem Schreibtisch. Etliche Male hatte er das Schreiben nun schon durchgelesen, das ihn vor wenigen Tagen erreicht hatte.
Seit Jahrzehnten versuchten habsburgische Statthalter, die bischöflichen Rechte im Münstertal und im Vinschgau einzuschränken. Seine Vorgänger hatten sich über diese Vorfälle mehrmals beim Papst beschwert, ohne Erfolg. Vertreter aus den Talgemeinden und dem Großen Rat der Stadt Curia hatten daraufhin den Gotteshausbund ins Leben gerufen.
Mittlerweile war dieser Bund allerdings so mächtig geworden, dass einige Vertreter sich öffentlich gegen ihn als Bischof stellten. Heinrich von Hewen sah den Gotteshausbund längst nicht mehr als Werkzeug für kirchliche Belange. Er betrachtete ihn als Feind, der selbst davor nicht zurückschreckte, den Großen Rat der Stadt Curia gegen ihn aufzuhetzen. Der Rat der Stadt versuchte schon seit Langem, seine Macht zu unterbinden.
Müde rollte er das Schreiben abermals auf. Die Worte verschwammen vor seinen Augen. Der Gedanke, dass die Habsburger ernst machten, erschütterte ihn zutiefst. Er war kein Mann des Kampfes, er liebte seine Ruhe. Und nun drohten die Habsburger, das Frauenkloster Sankt Johann im Münstertal anzugreifen und die Äbtissin zu entführen. Heinrich von Hewen wagte nicht, daran zu denken, was die grobschlächtigen Kerle mit der armen Ordensfrau alles tun würden. Er musste handeln, ob ihm dies nun behagte oder nicht. Zudem musste er unter allen Umständen verhindern, dass König Maximilian auf den Gedanken kam, auch noch in Curia einzumarschieren. Nicht, weil dies den Großen Rat noch mehr gegen ihn aufgebracht hätte, diesen Kampf hatte er wohl schon längst verloren, sondern um das nahe Kloster Sankt Luzi zu schützen. Niemals durfte das Geheimnis, das die Bibliothek des Gotteshauses barg, ans Licht gelangen. Im schlimmsten Fall würde er König Maximilian die Burg Fürstenberg und den Vinschgau überlassen, nur damit Ruhe einkehrte.
Als einer der Novizen den Kopf durch die Tür des Empfangssaales streckte, winkte der Bischof genervt ab. Er würde der sonntäglichen Messe heute fernbleiben.
Der Föhn trieb die Wolken in rasantem Tempo über die Bergspitzen, und als die Glocken abermals ertönten, schrak Bischof Heinrich aus seinen Grübeleien auf. Die Zeit eilte beinahe noch schneller als die Wolken. Seufzend lehnte er sich auf seinem Stuhl zurück.
Er hatte sich einen Plan zurechtgelegt, und wenn Gott auf seiner Seite war, dann konnte er vielleicht auch gelingen. Außer ihm kannte hier in Curia niemand das Geheimnis des kleinen Klosters, auch nicht der Dompropst Johannes von Brandis, den er als seinen einzigen Verbündeten betrachtete. Der Loyalität des jungen Mannes konnte er sich gewiss sein. Was ihn jedoch beunruhigte, war die Neugier des Domherrn Paul Ziegler, der neuerdings wie ein Wolf um den Dompropst herumschlich.
Bischof Heinrich rieb sich müde über die Augen. Zurzeit fühlte er sich von allen Seiten bedrängt. Er durfte die Zügel nicht aus der Hand geben. Er griff nach der kleinen Glocke und läutete nach seinem Kammerdiener.
»Eure Exzellenz, Ihr habt nach mir rufen lassen?«, fragte der Mann in seiner gewohnt devoten Haltung, wobei er den Blick auf seine Hände gerichtet hielt.
»Gib in den Ställen Anweisung, dass man meine Kutsche richten soll, und melde dem Propst, dass ich seine Begleitung auf der Ausfahrt wünsche.«
Der Mann nickte und zog sich leise zurück, während der Bischof das Pergament aufrollte und es zuhinterst in der Lade seines Schreibtisches versteckte. Dann griff er nach dem schlichten dunklen Kapuzenumhang, in der Hoffnung, damit unsichtbar für neugierige Augen zu werden. Die bischöfliche Kutsche am Sonntag herrichten zu lassen würde auch so schon für Gesprächsstoff sorgen. Gemächlichen Ganges schritt er die Treppenstufen hinab. Vor der mannshohen, aus edelstem Holz gefertigten Statue des heiligen Benedikts blieb er kurz stehen und bekreuzigte sich.
»Eure Exzellenz, wie ich sehe, gedenkt Ihr, eine Ausfahrt zu machen?«, hörte er hinter sich eine unliebsame Stimme.
Erschrocken drehte er sich um. Nur einen Katzensprung von ihm entfernt stand der Domherr Paul Ziegler und musterte ihn mit unverkennbarer Neugier in den Augen.
»Ich werde den Tag nutzen, um … um dem Kloster Sankt Luzi einen Besuch abzustatten. Der Abt drängt mich seit Wochen, die Ablassurkunde neu zu siegeln, und heute scheint mir eine günstige Gelegenheit dazu. Wer weiß, wann das Wetter umschlägt und der Winter kommt.« Bischof Heinrich atmete erleichtert auf. Wie ein Geistesblitz hatte sich diese Ausrede in seine Gedanken geschlichen, und wie es schien, zeigte sie Wirkung.
»Ja, auch mir hat man aus der Schreibstube schon so etwas mitgeteilt«, meinte der Domherr nachdenklich. »Die Wallfahrt zum Grab des heiligen Luzius soll wieder eingeführt werden, so verlangen es die Mönche. Einst hatte wohl jeder Haushalt des Vinschgaus einen Pilger mit reichlichen Gaben an das Grab geschickt.«
»Richtig, und da selbst zwei päpstliche Bullen existieren, die diese Wallfahrt ausdrücklich befürworten, werde ich natürlich die Urkunde noch so gerne erneuern. Wenn Ihr mich jetzt entschuldigen würdet, dann …«
»Selbstverständlich, Eure Exzellenz. Entschuldigt meine Neugier. Es liegt mir fern, Euch in Euren Pflichten zu behindern.« Paul Ziegler verbeugte sich und trat einen Schritt zurück.
Bischof Heinrich machte das Kreuzzeichen über das gebeugte Haupt seines Mitbruders, dann trat er durch das steinerne Portal nach draußen. Er wusste, dass der Domherr jeden seiner Schritte beobachtete. Paul Ziegler war nicht zu unterschätzen, seine Hinterhältigkeit und seine Neugier konnten ihm und dem Geheimnis von Sankt Luzi gefährlich werden.
Johannes von Brandis stand bereits bei der Kutsche. Als er den Bischof auf sich zueilen sah, riss er hastig den Verschlag auf.
»Eure Exzellenz, man sagte mir, dass ich Euch begleiten soll?«
Im Gegensatz zu Paul Zieglers verschlagener Neugier war die Frage des Dompropstes keineswegs von Arglist geprägt. In gewisser Weise zählte er ihn sogar zu seiner Familie, denn seine Nichte Katharina von Hewen hatte einen Bruder des jungen Mannes geehelicht.
»Richtig, werter Propst«, antwortete der Bischof tief Luft holend, wobei er kurz über seine Schulter blickte. Hinter einer der Steinsäulen glaubte er eine dunkle Gestalt zu erkennen, und er war sich sicher, dass dies niemand anderes als Paul Ziegler sein konnte.
»Wir fahren ins Kloster Sankt Luzi«, fuhr er deshalb betont laut fort, wobei er dem Propst die Schulter tätschelte. »Und deshalb wollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren.«
Bischof Heinrich drängte seinen Begleiter ins Innere der Kutsche, während er sich näher an den Kutscher stellte und ihm zuflüsterte, erst den Weg nach Meyenfeldt einzuschlagen.
»Wir fahren zu meinem Bruder auf Schloss Brandis?«, fragte der junge Mann erstaunt, als sich der Bischof stöhnend neben ihn setzte.
»Ihr habt Ohren wie ein Luchs«, bemerkte der Bischof erschöpft, wobei sich sein rot geädertes Gesicht in Falten legte.
Seine Behändigkeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er das beste Mannesalter bereits überschritten hatte. Umso dringender wurde es, sein geheimes Wissen an einen Nachfolger weiterzugeben. Verstohlen blickte er auf den Propst neben sich. Johannes von Brandis war gute dreißig Jahre alt, hatte Verstand, und was beinahe noch wichtiger war, er war ihm treu ergeben und verschwiegen. Er würde einen guten Hüter des Geheimnisses abgeben, davon war er überzeugt.
»Was ist?«, fragte Johann von Brandis unsicher. »Ihr schaut mich so merkwürdig an.«
»Nichts, nichts, ist eine alte Angewohnheit von mir. Mir geht die letzten Wochen nur so viel durch den Kopf.« Der Bischof wandte sich ab und schaute durch das Fenster auf die schnell dahinziehende Landschaft.
»Ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet, Euer Gnaden. Was wollt Ihr von meinem Bruder?«
Der Bischof schnaufte auf. Dann drehte er sich zu seinem Begleiter um.
»Ich muss dringend mit Sigmund sprechen. Vor Tagen erreichte mich ein Schreiben von König Maximilian, in welchem er mich bedrängt, die bischöflichen Besitzungen im Vinschgau an ihn abzutreten. Ihr könnt Euch vorstellen, dass das Bistum, besser gesagt Paul Ziegler und die übrigen Domherren dem nie zustimmen werden. Der König droht mit Krieg, und ich muss wissen, wie weit er zu gehen gedenkt.«
»Und Ihr glaubt, dass mein Bruder hier mehr weiß?« Johannes von Brandis’ Stimme haftete ein zweifelnder Klang an.
»Einen Versuch ist es wert. Allerdings werden wir uns beeilen müssen, denn dem Kloster Sankt Luzi werden wir ebenfalls noch einen Besuch abstatten.«
Den Rest des Weges hing jeder der beiden seinen eigenen Gedanken nach. Die Sonne zauberte Schatten auf die ernsten Gesichter der Männer, während der Kutscher die Pferde zur Eile trieb. Da Sonntag war und kaum Bauern die Fahrt mit Karren blockierten, erreichten sie Meyenfeldt zur Mittagszeit.