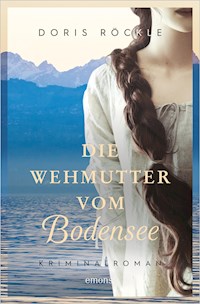7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rheinthal Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Die List der Schanktochter« – Eine romantische und dramatische Reise durch das europäische Mittelalter Rhyntal 1243: Als sich Marianas Vater kurz nach dem Tod ihrer Mutter erneut vermählt, bricht für die junge Schanktochter eine Welt zusammen. Vor allem, da ihre Stiefmutter alles daran setzt, sie loszuwerden. Zum Glück begegnet Mariana bald schon dem jungen Ritter Heinrich, der ihr den Kopf verdreht. Doch eine Vermählung zwischen Adel und Bürgerlichen scheint undenkbar. Als Heinrichs Vater von der Verbindung erfährt, schickt er seinen Sohn fort, während ein dichtes Netz aus Lügen dafür sorgt, dass Mariana in Gefangenschaft gerät. Doch die mutige Schanktochter gibt nicht auf. Die Suche nach ihrem Geliebten führt Mariana nicht nur in das weit entfernte Zypern, sondern auch in den Besitz eines jahrhundertealten Codex, den ein dunkles Geheimnis umgibt. Ein Geheimnis, das nicht nur sie selbst das Leben kosten könnte. Lassen Sie sich von Doris Röckles opulentem Mittelalter-Roman »Die List der Schanktochter« auf eine fesselnde Reise voller Liebe, Intrigen und Geheimnisse entführen. Ein packendes Lesevergnügen, das den Machtkampf zwischen Kirche und Krone lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Ähnliche
Doris Röckle
Die List der Schanktochter
Historischer Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Rhyntal 1243: Als sich Marianas Vater kurz nach dem Tod ihrer Mutter erneut vermählt, bricht für die junge Schanktochter eine Welt zusammen. Vor allem, da ihre Stiefmutter alles daran setzt, um sie loszuwerden. Zum Glück begegnet sie bald schon dem jungen Ritter Heinrich von Schellenberg, der Mariana den Kopf verdreht. Und auch er selbst kehrt auffallend oft zu der Schänke ihrer Familie zurück. Doch Heinrich ist von Adel, was eine Vermählung mit einer Bürgerlichen undenkbar macht. Als sein Vater von der Verbindung erfährt, schickt er seinen Sohn auf Reisen, fort von Mariana, während ein dichtes Netz aus Lügen dafür sorgt, dass diese in Gefangenschaft gerät.
Doch Mariana gibt nicht auf.
Die Suche nach ihrem Geliebten führt die Schanktochter nicht nur in das weit entfernte Zypern, sondern auch in den Besitz eines jahrhundertealten Codex, den ein dunkles Geheimnis umgibt. Ein Geheimnis, das nicht nur sie selbst das Leben kosten könnte.
Wird es ihr gelingen, ihre große Liebe wiederzufinden?
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Dramatis Personae
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Historisches Nachwort
Danksagung
Leseprobe »Der Wagemut der Burgtochter«
Für meinen Mann Emil,
der mein Abtauchen ins Mittelalter
stets mit großer Geduld erträgt
Dramatis Personae
Die mit einem * markierten Personen haben tatsächlich gelebt.
Mariana Schankmagd
Hilarius Büchel ihr Vater und Wirt zum Goldenen Lamm
Alwine Holzer ihre Stiefmutter
Pina und Helma Schankmägde im Goldenen Lamm
Adulf Schankknecht und in Mariana verliebt
Agnesia Kräuterweib im Blutwald
Melchior Fährmann an der Furt am Rhyn
Pater Basilius Prediger auf dem Kirchhügel
Heinrich v. Schellenberg Marianas Geliebter
Marquard v. Schellenberg * sein Vater, Herr der Burg
Ita v. Thumb * seine Mutter
Anna v. Schellenberg * seine Schwester, die gerne Freifrau der Hohensax wäre
Konrad v. Graustein Heinrichs Weggefährte
Hildegund Köchin
Kletus Stallmeister und dem Burgherrn zu treu ergeben!
Kuno Reiterknecht und Kurier
Berchtold v. Falkenstein * Abt des Benediktinerklosters von 1244-1272
Gutta v. Schellenberg * Schwester des Burgherrn der Burg Schellenberg; Ihre Amtszeit ist in den Quellen unterschiedlich dokumentiert
Germana v. Schönfeld Kräuterschwester
Regina Marianas zugeteilte Magd
Volkard v. Neuburg * Bischof von Chur von 1237-1251
Bruder Kletus Cellerar
Bruder Floribertus Infirmarius
Bruder Walafried Bibliothekar
Bruder Berno Eremit in der Höhle am Kalksteinfelsen
Bruder Vigilius Bibliothekar
Bruder Lazarus Klosterbruder
Abt Bonifatius Vorsteher des Klosters
Apollonia v. Feldbach Vorsteherin der Frauengemeinschaft
Schwester Gret Lehrerin
Schwester Agnes Köchin
Schwester Clara Marianas Freundin und Kräuterkundige
Schwester Fidelis Frau für alles, aber vor allem griesgrämig
Schwester Lidwina zuständig für die Waschstube
Schwester Paulina ihre Helferin
Jakob Müllergeselle und Geliebter von Schwester Clara
Johann Fronbauer des Bischofs
Hemma seine Frau, die das Herz auf dem rechten Fleck hat
Papst Innozenz IV. * Papst in Rom von 1243–1254, berief 1245 das Konzil von Lyon gegen Kaiser Friedrich II.
Kardinal Vittorio della casa seine rechte Hand
Don Pedro Anführer der Beutelschneider
Giovanni sein Sohn
Kaiser Friedrich II. * aus dem Hause der Staufer, ab 1212 römisch-deutscher König von 1220-1250 Kaiser des römisch-deutschen Reiches
Bianca Lancia * seine Geliebte, später die 4. Gemahlin des Kaisers, 1210–1244/46
Manfred * ihr Sohn, der spätere König von Sizilien, 1232–1266
Petrus de Vinea * kaiserlicher Kanzler, 1190-1249
Thomas v. Aquino * kaiserlicher Hofjustitiar, gest. 1251, stammt aus der gleichen Familie wie der berühmte Theologe Thomas von Aquin
Theodor v. Antiochien * Arzt und Astrologe am kaiserlichen Hof, 1195-1250
Balian v. Ibelin * Herr von Beirut, 1209–1247
Eschiva v. Montfaucon * seine Gemahlin, gest. ca. 1247
Leonardo Mancini Medicus
Sophia seine garstige Tochter
Prolog
Kloster Sankt Luzi 1204
Donnergrollen und Blitze, keine guten Vorzeichen. Der Mönch stand mit tief in die Stirn gezogener Kapuze im Klosterhof und starrte unschlüssig zu Boden. Die Schläge gegen das Tor wurden mit jedem Atemzug eindringlicher. Trotz des tosenden Sturmwindes, der seit Stunden durch das Tal fegte und alles, was nicht niet- und nagelfest war, mit sich riss, hörte er die Flüche der nächtlichen Besucher. Als ein Blitzstrahl den Nachthimmel zerriss, zuckte der Kleriker zusammen. Hastig raffte er seine Kutte und lief auf das Tor zu. Er öffnete erst bewusst nur die kleine Luke. Zu so später Stunde wurde hier im Kloster niemand mehr eingelassen.
»Was soll der Tumult?«, fragte er den bärtigen Mann, dessen Gesicht keine Handbreit von ihm entfernt auf der anderen Seite des Tores auftauchte. »Almosen werden erst morgen wieder verteilt. Also schert Euch des Weges«, fügte er erschrocken bei, als er das Funkeln in den Augen des Mannes erblickte.
»Wir sind keine Almosenheischer«, presste der Bärtige zischend hervor. »Also macht endlich dieses Tor auf!«
Der Mönch war längst einen Schritt zurückgewichen. Die Angst lähmte seine Bewegungen. Als hätte sich der Mond mit den Besuchern verbündet, lichteten sich die Gewitterwolken für einen kurzen Moment, und das fahle Licht gab einen Blick auf mehrere Gestalten jenseits des Tores frei. Das Dampfen der mächtigen Schlachtrosse, ihr unruhiges Scharren im staubtrockenen Untergrund und die zunehmende Gereiztheit der Männer entgingen so auch den altersmüden Augen des Mönchs nicht. Der Bärtige wollte eben zu einer neuerlichen Fluchtirade ansetzen, als ihn einer seiner Begleiter sachte zur Seite drängte. Der Mann streifte sich die Kapuze vom Kopf, sodass man seine Tonsur erkennen konnte.
»Entschuldigt den groben Ton meines Begleiters«, sprach der Mann mit betont einfühlsamer Stimme, wobei er dem Mönch ein Lächeln schenkte, »aber wir haben einen langen und beschwerlichen Ritt über die Alpen hinter uns.«
»Ich kann Euch und Eure Begleiter aber trotzdem nicht ins Kloster lassen«, bemerkte der Mönch zögerlich. »Die Vorschrift verbietet es mir.«
»An Vorschriften sollte man sich halten, da gebe ich Euch recht, werter Bruder. Aber wir sind in der Tat nicht irgendwelche Bittsteller. Wir sind Gesandte des Papstes und führen ein Traktat bei uns, das wir Eurem Abt zu übergeben haben.«
In diesem Augenblick fielen die ersten schweren Regentropfen. Unschlüssig drehte sich der Pförtnerbruder um. Doch mehr als das sich dunkel gegen den Nachthimmel abzeichnende Gemäuer des Klosters konnte er nicht erkennen. All seine Mitbrüder befanden sich in der Kapelle, versammelt zur Komplet. Ein erneutes Poltern gegen das Holztor ließ den Mönch erschrocken herumfahren. Mittlerweile prasselten die Regentropfen Bindfäden gleich auf alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Der alte Pförtnerbruder strich sich die Nässe aus dem Gesicht, ehe er mit beiden Händen den Querbalken griff und kräftig daran zog. Als das Tor aufschwang, drängten die Männer eiligst in den Klosterhof. Fünf waren es an der Zahl. Der Pförtnerbruder wich erschrocken zur Seite. Die Männer umgab eine Aura des Bösen, er hatte ein Gespür dafür.
»Ich werde augenblicklich jemanden beauftragen, der sich um die Pferde kümmert«, beeilte er sich seine Angst nicht allzu augenscheinlich werden zu lassen.
»Das werden meine Männer schon erledigen.« Der römische Gesandte stülpte sich seine Kapuze wieder über und versuchte sich mit skeptischem Blick inmitten der Dunkelheit zu orientieren. »Sagt uns einfach, wo sich die Ställe befinden, und seid dann bitte so freundlich und führt mich und meinen Begleiter endlich ins Trockene.« Er wies mit dem Kinn auf den besagten Mann, der sich eben aus der Gruppe der Söldner herausschälte und auf sie zukam.
»Selbstverständlich«, sagte der Pförtnerbruder hastig nickend, wobei er mit ausgestrecktem Arm auf die Stallungen zeigte. »Dort drüben finden Eure Männer einen trockenen Platz für die Tiere.« Dann drehte er sich um und gab den beiden Klerikern ein Zeichen, ihm zu folgen. »Meine Brüder und der Abt sind zurzeit noch in der Komplet. Doch geleite ich die Herren gerne in den Schlafsaal.« Der alte Mönch nestelte nervös mit seinen Fingern, während sein Blick hinüber zur Kapelle wanderte. Da vorerst keine Hilfe von dort zu erwarten war, zog er die Kapuze noch tiefer ins Gesicht, um seine Angst zu verbergen. »Eure Begleiter werden die Nacht allerdings im Laientrakt verbringen müsse. Die Klausur verbietet …«
»… das braucht Ihr uns nicht zu sagen. Auch in Rom halten wir uns an Vorschriften«, fiel ihm der zweite Geistliche grob ins Wort.
Die letzten Minuten hatte nicht nur der Regen zugenommen, auch der Ton der Kleriker aus Rom hatte sich hörbar verschärft.
»Wir sollten den Abt noch heute sprechen. Die Sache ist einfach zu dringlich«, hörte der Pförtnerbruder die beiden Männer hinter seinem Rücken sagen. Ihr Unmut war nicht zu überhören.
»Abt Bonifatius ist bei der Komplet, wie schon erwähnt«, erklärte er mit brüchiger Stimme, um die Männer vom möglichen Frevel abzubringen, den Abt in seiner Andacht zu stören.
»Wir sind Gesandte des Pontifex und nicht …«, empörte sich einer der beiden Kleriker. »Was erlaubt Ihr Euch eigentlich!«
»Lasst es gut sein«, fuhr ihm sein Begleiter ins Wort. »Wir werden unser Anliegen morgen vorbringen, wenn wir ausgeruht sind. Also, werter Bruder, zeigt uns jetzt den Schlafsaal und unterrichtet den Abt später von unserer Ankunft.«
Die Erleichterung auf dem Gesicht des alten Mönchs konnten die beiden Besucher nicht sehen, zumal er einen Schritt vor ihnen den Kreuzgang entlanglief. Die wenigen Nachtfackeln erhellten den Gang mehr schlecht als recht. Als der Pförtnerbruder mit seinen beiden Begleitern um die Ecke bog, blieb er erschrocken stehen.
»Bruder Berno!«, rief er erleichtert und erstaunt zugleich aus, nachdem sich sein Herzschlag vom unverhofften Auftauchen des jungen Mitbruders wieder beruhigte. »Ihr kommt wie gerufen. Unsere Gäste werden die Nacht im Besuchertrakt verbringen, und Ihr könnt sie dahin begleiten. Ich für meinen Teil muss zurück zum Tor.«
Die Frage nach dem Grund des Versäumnisses der Gebetsstunde verkniff sich der Pförtnerbruder. In diesem Moment war ihm alles recht, solange er der Gegenwart der beiden Männer nur entkam.
Noch bevor Bruder Berno einen Einwand vorbringen konnte, drehte sich der alte Pförtnerbruder bereits um und rannte mit einer Behändigkeit, die man ihm nicht zugetraut hätte, den Kreuzgang zurück.
»Sollen wir noch lange hier herumstehen, oder werdet Ihr uns jetzt endlich in den Schlafsaal führen?«, drängte sich einer der römischen Kleriker wieder in Erinnerung.
Von der Situation überrumpelt, zuckte Bruder Berno erschrocken zusammen, ehe er mit ausgestrecktem Arm auf den Treppengang wies. Solch scharfe Töne war man hier in Curia nicht gewohnt, schon gar nicht von Fremden, denen man zu so später Stunde noch Einlass gewährte.
»Ihr richtet dem Abt verlässlich aus, dass wir ihn morgen noch vor dem Morgenmahl zu sprechen wünschen. Unser Anliegen ist von höchster Wichtigkeit. Habt Ihr mich verstanden?«
Bruder Berno wusste, wann es besser war zu schweigen. Er nickte deshalb nur ergeben, ehe er mit gesenktem Kopf vor den beiden Männern herging. Hin und wieder drehte er sich aber doch verstohlen um. Zur Zeit der Herbststürme kamen so gut wie nie Besucher ins Kloster am Fuße des Septimerpasses. Die Alpenpässe mied man in dieser Zeit besser, denn mit einem frühen Wintereinbruch musste jederzeit gerechnet werden. Wenn diese Kleriker den gefährlichen Ritt trotzdem gewagt hatten, musste ihr Anliegen wohl doch eine Sache von Brisanz sein.
»Ihr habt Glück, meine Herren«, sagte Bruder Berno mit leiser Stimme, wobei er sich einen Kienspan griff und die kleine Fackel unweit der Tür zum Glimmen brachte. »Der Schlafsaal gehört Euch ganz allein. Wir erwarten auch in den nächsten Tagen keine Brüder auf Pilgerreise.«
»Habt Dank, werter Bruder«, erwiderte der größere der beiden Kleriker mit aufgesetztem Lächeln. »Wir wissen Eure Gastfreundschaft zu schätzen. Doch jetzt lasst uns bitte zur Ruhe kommen, die Reise war äußerst beschwerlich.«
Bruder Berno nickte höflich. »Ich hole noch zwei warme Decken. Die Nächte hier sind jetzt im Herbst bereits empfindlich kalt.«
Der Schlafsaal bot Platz für zehn Besucher. Aufgereiht zu beiden Seiten standen fünf einfache Holzgestelle, auf denen je ein Strohsack lag. Am Kopfende befand sich stets eine Truhe für mitgeführte Habseligkeiten. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch mit fünf Hockern. Die beiden Männer rümpften die Nasen beim Anblick der spartanisch eingerichteten Schlafgelegenheit, was auch Bruder Berno nicht entging. Vielleicht schürte genau dies seine Neugier, denn er ließ die Tür hinter sich einen Spaltbreit offen.
Anfänglich sprachen die Männer so leise, dass Bruder Berno wegen des prasselnden Regens und des pfeifenden Windes kaum etwas verstand, doch allmählich gewöhnten sich seine Ohren an den Flüsterton. Es war lange her, seit ihm seine Mutter die lombardische Sprache beigebracht hatte, zu lange. Er verstand bei Weitem nicht alles, doch das wenige reichte, um ihm einen Schauder über den Rücken zu jagen. Hastig rannte er in eine der angrenzenden Kammern und griff sich zwei der wollenen Decken. Vor der Tür zum Schlafsaal schluckte er hart, ehe er mit regungsloser Miene den Raum wieder betrat. Die beiden römischen Kleriker verstummten auf der Stelle.
»Wenn die Herren möchten, werde ich den Bruder Cellerar nach der Komplet um ein kleines Nachtmahl bitten.« Bruder Bernos Stimme zitterte. Er vermied es, den Männern in die Augen zu blicken, zumal er befürchtete, dass sie ihm die Arglosigkeit nicht abnahmen.
»Wir wünschen kein kleines Nachtmahl, wir haben Hunger wie Bären«, brummte einer der Kleriker in lombardischer Sprache.
Die beiden Kleriker warteten die Reaktion auf die Worte mit Spannung ab. Da Bruder Berno allerdings nur ratlos mit den Schultern zuckte und begann, die Decken auf die Strohmatratzen zu legen, nickten sie sich erleichtert zu.
»Bruder Berno versteht unsere Sprache offensichtlich nicht, umso besser für uns«, bemerkte der Größere der beiden. »So können wir uns angemessen unterhalten und müssen nicht ständig flüstern.« Er nickte seinem Begleiter zu. »Richtet dem Bruder Cellerar aus, dass wir sehr gerne ein kleines Nachtmahl hätten«, wandte er sich jetzt wieder in Latein an Bruder Berno. »Und habt Dank für die Decken. Wir wissen Eure Fürsorge sehr zu schätzen.«
Bruder Berno bemühte sich um ein Lächeln. Da die beiden Kleriker sich ihrer Sache jetzt sicher waren, sprachen sie hastig weiter. Bruder Berno ging langsam auf die Nachtfackel zu und tat, als müsste er dort Hand anlegen. Dabei versuchte er so viel wie möglich von der Unterhaltung zu verstehen.
»Wir werden morgen in aller Frühe damit beginnen, das Kloster auf den Kopf zu stellen«, hörte er den Größeren der beiden eben hinter seinem Rücken sagen. »Papst Innozenz verlangt, dass wir nicht ohne diesen Codex nach Rom zurückkehren. Ich muss nicht betonen, was uns droht, wenn wir versagen. Wie Papst Innozenz bereits angedeutet hat, wird sich der hiesige Abt sträuben, uns die Kostbarkeit auszuhändigen, ja, schlimmer noch, er wird sie verleugnen, wie es so viele Äbte vor ihm getan haben. Doch so leicht werden wir uns nicht geschlagen geben. Im Notfall werden die Söldner ihn halt zum Sprechen bringen.«
Zwar war der Name des Codex nicht ausdrücklich gefallen, doch Bruder Berno wusste auch so, wovon die Männer sprachen. Es kostete ihn alle Kraft, nicht fluchtartig aus dem Schlafsaal zu stürmen und den Codex an einen sicheren Ort zu bringen. Er hatte gewusst, dass dieser Tag einmal kommen würde, und doch stets gehofft, dass dieser bittere Kelch an ihm vorüberging. Der Codex durfte nicht in falsche Hände geraten. Betont langsam drehte er sich um.
»Wolltet Ihr uns nicht etwas zu essen bringen?«, fragte ihn einer der Kleriker genervt.
Bruder Berno nickte demütig, wobei er das Zittern seines Körpers kaum zu verbergen mochte. Bestimmt war die Gebetsstunde bald zu Ende. Wenn ihm das Glück hold war, würde er Bruder Vigilius noch abfangen können, bevor er sich in seine Zelle zurückzog. Hastig rannte Bruder Berno wenig später den halbdunklen Treppengang hinab, ehe er mit wehender Kutte über den Klosterhof lief. Eben verklangen die letzten Takte des Salve Regina, eines marianischen Gesangs, der die Komplet stets abschloss. Bruder Berno drückte sich in eine der dunklen Nischen vor der Kapelle und wartete. Mittlerweile regnete es Bindfäden, und man sah kaum noch die Hand vor Augen.
Als die Mönche mit gesenkten Häuptern an ihm vorbeizogen, hielt er den Atem an. Wie üblich ging Bruder Vigilius, der Bibliothekar, am Ende der Brüder.
»Die Zeit ist gekommen«, sagte Bruder Berno leise, als sich der Mönch auf seiner Höhe befand.
Der alte Mann fuhr erschrocken herum. Der Regen lief ihm über den Kapuzenrand ins Gesicht. »Wovon sprecht Ihr, Bruder Berno?«
»Rom sucht nach dem Codex Henoch. Hätte ich die Komplet nicht verpasst, erführen wir erst morgen davon, und dann wäre es womöglich bereits zu spät gewesen.« Bruder Bernos Stimme zitterte vor Angst, wobei er die Hände faltete und eindringlich gen Himmel schaute.
»Lasst uns zurück in die Kapelle gehen.« Bruder Vigilius fuhr sich mit dem Handrücken über das nasse Gesicht. »Hier draußen holen wir uns noch den Tod, und das hilft niemandem.«
Die beiden Kleriker schüttelten ihre Kutten, ehe sie das Gotteshaus betraten. Die Kerzen am Altar waren nahezu heruntergebrannt, und doch brachte ihr Eintreten die schwachen Flammen zum Beben.
»Jetzt erzählt mir alles von Anfang an, Bruder«, forderte der alte Mönch seinen Mitbruder mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme auf. »Und bitte zappelt dabei nicht so herum, das macht mich ganz nervös.«
»Eben kamen Gesandte des Papstes hier an, die ich auf Geheiß unseres Pförtnerbruders in den Schlafsaal führte«, begann Bruder Berno hüstelnd, wobei er mit gehetztem Ausdruck auf die Tür zur Kapelle starrte. »Ich ließ die Männer im Glauben, dass ich ihre Sprache nicht verstehe, und so habe ich jede Menge erfahren. Sie rechnen damit, dass Abt Bonifatius sich unwissend stellen wird, und deswegen haben sie auch Söldner mitgebracht.« Bruder Berno nickte jetzt eindringlich. »Ihr wisst so gut wie ich, dass Abt Bonifatius die Wahrheit nicht kennt. Auch wenn er wollte, er könnte den Klerikern nichts über den geheimnisvollen Codex verraten. Wir können doch nicht tatenlos zusehen, wie diese grobschlächtigen Kerle unseren Abt womöglich töten?«
Bruder Vigilius schüttelte nachdenklich den Kopf, wobei er sich das Kreuzzeichen auf die Brust schlug.
»Wir können Abt Bonifatius nicht helfen. Er oder der Codex Henoch, eine andere Wahl bleibt uns nicht. Das haben wir einst geschworen.«
»Ihr wollt also zusehen, wie die Männer unseren Abt …«
Bruder Vigilius wandte sich ab. Es kostete ihn Überwindung, das Fassungslose in Worte zu fassen. Die Jahre hatten ihn hart gemacht, Jahre, in denen er stets diesen Moment in Gedanken vor sich gesehen hatte. Der Codex und die dazugehörenden Schriftrollen lagerten nun schon Jahrhunderte hier im Kloster am Fuße des Septimers, verborgen vor fremden Blicken. Niemand wusste mehr genau, wie diese Schriften einst hierhergekommen waren. Stets waren immer nur zwei Männer in das Geheimnis eingeweiht, starb einer davon, nahm ein anderer seinen Platz ein. Jetzt war die Reihe an ihm und Bruder Berno. Sie durften nicht versagen.
»Es bleibt uns in der Tat nicht mehr viel Zeit«, sagte Bruder Vigilius gequält aufschnaufend, wobei er den Kopf näher zu seinem Mitbruder neigte. »Wir werden die Nacht nutzen und die Schriftrollen in Amphoren verstecken. Den Codex Henoch wickeln wir in ein Wachstuch, damit er keinen Schaden nimmt. Morgen in alle Frühe werdet Ihr zusammen mit Bruder Lazarus in die Höhle unter dem Kalksteinfelsen fahren.«
»Bruder Lazarus? Der Irrsinnige?«, fragte Bruder Berno hörbar entsetzt.
»Genau der. Keiner verfügt über solche Bärenkräfte wie er, und zudem spricht er mit niemandem außer Gott. Sollte er zwischen seinen Vaterunser und Ave-Marias trotzdem ein Wort darüber verlieren, hört ihm ohnehin niemand hier im Kloster zu.« Bruder Vigilius ging langsam auf die Tür der Kapelle zu und schaute nach draußen. »Wenn Gott ein Einsehen hat, lässt er dieses Unwetter bald weiterziehen. Der Weg zur Höhle ist schon bei trockenem Wetter eine Prozedur. Es wird daher besser sein, Ihr spannt nicht das Maultier vor den Karren, sondern einen der Esel. Zur Not könnt Ihr die Amphoren auf dessen Rücken in Sicherheit bringen.«
»Und was wird der Cellerar sagen, wenn wir den Karren ohne seine Einwilligung entwenden?«
»Das lasst meine Sorge sein. Bis dahin wird mir eine plausible Ausrede einfallen und wohl auch dazu, warum Ihr das Kloster unverhofft für uns alle verlassen habt, um das Leben in einer Eremitenklause zu führen.«
»Ich soll weg von hier?«
»Ihr seht doch hoffentlich ein, dass wir den Codex nicht dort oben alleine in der Höhle belassen können. Fortan werdet Ihr der alleinige Hüter dieser Kostbarkeit sein. Versteckt den Codex irgendwo im Wald, wo ihn niemand findet. Die Schriftrollen sind längst nicht so kostbar. Sollten sie entdeckt werden, lenkt das vielleicht sogar vom Codex ab.«
Bruder Berno wich erschrocken einen Schritt zurück. Doch die Entschlossenheit auf dem Gesicht seines Mitbruders erstickte jegliche Widerrede.
1. Kapitel
Spätsommer 1243 im Tal des Rhyns
Dunkel ballten sich die Wolkentürme am fernen Horizont. Es war die letzten Stunden merklich kühler geworden.
Mariana stand am Fenster ihrer kleinen Kammer, den Umhang fest um ihre Schultern geschlungen, und blickte nachdenklich auf den langsam schwindenden Tag. Unten in der Taverne hörte man die Zecher grölen. Bald würden sie nach ihr rufen, wie sie es immer taten, stiegen ihnen Wein und Met zu Kopf. Noch nie in ihrem Leben war sich Mariana so einsam und verloren vorgekommen, selbst dann nicht, als sie hilflos am Bett ihrer Mutter gesessen hatte und tatenlos mit ansehen musste, wie sich das Leben langsam aus ihrem Körper schlich.
Mariana gab einen Seufzer von sich. Die Wochen des Dahinsiechens waren nicht einfach gewesen, weder für sie noch für ihren Vater. Während Hilarius Büchel sich in seiner Arbeit vergrub, war sie stets da gewesen, hatte der Mutter Mut zugesprochen, ihr den Körper gewaschen und dafür gesorgt, dass der Krug mit dem Würzwein niemals leer blieb. Doch all dies hatte nicht verhindern können, dass die Mutter den Kampf gegen den Lungenhusten verlor. Einen Medicus hatten sie sich nicht leisten können, dazu warf die Taverne im kleinen Weiler Bendur zu wenig ab. Die Kräutlerin hatte genügen müssen. Die alte Agnesia hatte sich auch weidlich um die Mutter bemüht, doch schlussendlich nützten auch ihre Kräutersäfte nichts mehr. Still und leise war die Mutter gestorben.
Marianas Hand wanderte langsam hinauf zum Amulett, das sie seit Kindesbeinen um den Hals trug. Es zeigte die Göttin Brigida, die Herrscherin des Lichts und des Feuers, geschnitzt in Birkenholz. Die Mutter hatte fest daran geglaubt, dass die Göttin die Dunkelheit aus der Welt vertrieb. Hoffentlich tat sie es auch in ihrem Fall, denn seit dem Tod der Mutter war ihr jegliche Freude abhandengekommen.
Mariana seufzte abermals. Wie sollte es nur weitergehen? Vaters neuerliche Brautschau gefiel ihr überhaupt nicht. Dass er ausgerechnet ein Auge auf die Witwe des Flickschusters geworfen hatte, ärgerte sie. Die Frau war nur unwesentlich älter als sie selber, womöglich würde sie dem Vater noch etliche Kinder gebären. Nicht dass sie eifersüchtig auf die Bälger war, doch irgendwas in ihrem Innern sagte ihr, dass sie damit den Vater endgültig verlor.
Mariana ahnte, dass diese Wahl nichts Gutes für sie und die Taverne brachte. Die Flickschusterin war raffiniert und bekannt für ihren Geiz. Als liebestoller Gockel würde ihr Vater ebenso auf sie hereinfallen, wie es der Flickschuster und vor ihm der Flachsbauer aus Puges getan hatten.
Mariana drehte sich langsam um. In gut einem Monat war ihr achtzehnter Geburtstag, ein Alter, in welchem viele Frauen nebst einem Ehemann auch etliche Kinder hatten. Bislang hatte sie sich erfolgreich gegen jegliche Brautwerber gewehrt. Doch Alwine Holzer, sollte sie die neue Frau an Vaters Seite werden, würde ihr diese Freiheit bestimmt nicht gönnen.
Das Gegröle aus der Schankstube wurde mit jedem Atemzug eindringlicher. Mariana blickte auf die wenigen Habseligkeiten, die ihre Kammer bot. Mehr als eine einfache Bettstatt, einen kleinen Beistelltisch und eine Truhe für die Wäsche konnte sie nicht ihr Eigen nennen. An der Wand hing ein einfacher Rosenkranz als Erinnerung an ihre Mutter. Darunter standen die abgewetzten Holzschuhe, die sie stets zur Apfelernte getragen hatte. Damit sinkt man im weichen Gras nicht so tief ein, hatte die Mutter lächelnd gemeint und ihr sanft über den sittsam geflochtenen Zopf gestreichelt.
Heftiges Donnergrollen ließ Mariana herumfahren. Das Gewitter kam näher, und nicht mehr lange, und die schweren Regentropfen würden auf das Dach prasseln. Sie liebte dieses Geräusch, dieses Klopfen und Hämmern auf die Schindeln. Es gehörte zu ihrer Kindheit. Von den Erinnerungen überwältigt, schlug Mariana die Hände vors Gesicht. Tränen liefen ihr über die Wangen. Die Flickschusterin würde ihr dieses Refugium der Geborgenheit bald streitig machen. Auch wenn der Vater dies im Augenblick noch vehement verneinte, sobald das Trauerjahr für die Mutter um war, würde sich das Leben in der Taverne verändern.
»Mariana? Kommst du?« Pina, eine der beiden Schankmägde, streckte den Kopf durch die Tür. »Unten ist die Hölle los. Eben sind Gaukler eingetroffen. Dein Vater ist bereits in den Keller gegangen, um zwei weitere Fässer Met zu holen.«
»Ich komme.« Mariana strich sich die Tränen aus den Augen.
Just in diesem Moment prasselten die ersten Regentropfen auf das Dach. Mit einem letzten Blick auf den Rosenkranz verließ Mariana die kleine Kammer.
In der Schankstube war kein Platz mehr frei. Pina hatte nicht übertrieben. An den zehn Tischen drängten sich Männer dicht an dicht. Die Gaukler in ihren farbenfrohen Gewändern waren leicht zu erkennen, ebenso wie die zwei Kleriker am hinteren Tisch. Bei den übrigen Gästen handelte es sich um die Trunkenbolde und Taugenichtse, die das Goldene Lamm regelmäßig aufsuchten, um ihre wenigen Pfennige im Alkohol zu ertränken. Helma, die ältere der beiden Schankmägde, drängte sich bereits zwischen den Tischen, emsig darum bemüht, den Wünschen der Männer gerecht zu werden. Dass sich hie und da eine Hand an ihrem Busen vergriff oder ein Übermütiger sie in den Hintern kniff, ließ sie mit Lachen über sich ergehen. Pina und Helma waren keine Kinder von Traurigkeit. Nicht umsonst zahlte ihr Vater den beiden einen guten Lohn. Ihre Willigkeit im Bezug auf mehr als nur Kneifen war kein Geheimnis und war wohl auch ein Grund, warum die Tische im Goldenen Lamm nie leer blieben.
Mariana konnte dies nur recht sein, hielten sich die Kerle ihr gegenüber so zurück. Sicher, manchmal spürte auch sie die gierigen Hände auf ihrem Hinterteil, doch bislang hatte ein scharfer Blick genügt, die Hitzköpfe in die Schranken zu weisen.
»Gut, dass du kommst«, meinte Hilarius Büchel erleichtert, als er seiner Tochter ansichtig wurde. »Die Kerle saufen, dass ich nicht mehr nachkomme.«
»Musst halt die Flickschusterin zu Hilfe holen, macht sie ja so gerne«, entgegnete Mariana schnippischer, als sie eigentlich wollte.
»Nicht jetzt, bitte, Mariana. Ich hab dir doch erklärt, dass Alwine Holzer dir nicht gram ist. Sie will … sie will lediglich …«
»Ach lass es bleiben, Vater«, fiel ihm Mariana resigniert ins Wort. »Es kommt, wie es kommen muss.«
Dabei drehte sie sich um, griff sich einen der Weinkrüge und ging auf die Kleriker am hinteren Tisch zu. Sie mochte die Männer in ihren stinkenden Kutten nicht, doch im Augenblick waren sie ihr tausendfach angenehmer als ihr von Blindheit gestrafter Vater.
»Noch etwas Wein?«, fragte sie freundlich, wobei sie sich zu einem Lächeln zwang.
Die beiden Geistlichen hoben die Köpfe und nickten. Viel sprachen diese merkwürdigen Männer nie, und wenn, dann meist so geschwollen, dass niemand sie im Goldenen Lamm verstand.
»Du musst den Pfaffen nicht freundlich tun«, rief einer der Tagelöhner vom Nachbartisch. »Die versaufen ohnehin nur unser schwer verdientes Geld. Sollen selber mal zur Hacke greifen, dann sehen sie, wie hart Feldarbeit ist.«
Ganz unrecht hatte der Mann nicht. Die beiden Kleriker kamen vom gut zwei Tagereisen entfernten Kloster Sankt Luzi nahe der Stadt Curia. Wie immer zur Zeit der Zehntabgaben tauchten die Kanoniker hier im kleinen Weiler Bendur auf, bezogen ihr Nachtlager oben auf dem Kirchhügel beim Pfaffen und schauten zu, dass ja kein Leibeigener säumig blieb. Auch wenn es Männer Gottes waren, ihre Zehnten-Forderungen waren hart und unerbittlich. Manche Bauernfamilie überlebte den Winter nicht, zu leer waren die Speicher, zu knurrend die Mägen. Doch selbst dies konnte die Kanoniker nicht zu Milde verleiten. Papst und Kaiser hielten die Hand über das Kloster, das war im Rhyntal bestens bekannt. Das Kloster Sankt Luzi sei arm und auf die Einkünfte der Weiler angewiesen, so rechtfertigte sich der Pater, wenn er auf die unübersehbare Armut in den Dörfern angesprochen wurde.
Nun, Mariana zweifelte an der Armut der Kleriker, zumal ihre Kutten nirgends eine Flickstelle aufwiesen und ihre Geldkatzen stets prall gefüllt waren. Unter der Hand wurde gemunkelt, dass die Zehntabgaben dazu angetan waren, den Mönchen eine neue Kapelle in Curia zu bauen. Dass es sich dabei nicht um ein schlichtes Gotteshaus handeln konnte, ahnte jedermann hier in Bendur.
Da die Kleriker nicht auf die Provokation des Tagelöhners eingingen, erhob sich der Mann von seinem Stuhl. Schwankend hielt er sich am Tisch fest.
»Wohl zu fein, um mit einem einfachen Mann zu reden«, rief er grölend über die Köpfe. »Euch sollte man mal zeigen …«
Der Rest seiner Worte ging im allgemeinen Tumult unter. Hilarius Büchel hatte den Mann am Kragen gepackt und zog ihn unter lautstarkem Gezeter nach draußen.
Auf ein Zeichen von Mariana begann einer der Gaukler auf seiner Laute zu spielen. Auch wenn nicht alle Gäste den Wortlaut des alten Gassenliedes kannten, summten und brummten sie doch mit. Im Nu waren der Tagelöhner und sein Unmut vergessen.
»Entschuldigt, meine Herren«, sagte der Schankwirt händeringend, als er wenig später wieder vor den beiden Kanonikern stand. »Der Wein ist dem armen Kerl wohl zu Kopf gestiegen.«
»Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare«, meinte einer der Mönche abwehrend.
Hilarius Büchel musste wohl etwas dümmlich dagestanden haben, denn der Mann wiederholte das eben Gesagte hörbar lauter, dieses Mal jedoch in einer Sprache, die auch Hilarius Büchel verstand.
»Jeder Mensch kann sich irren, aber nur der Tor wird auf seinem Irrtum bestehen.«
Hilarius Büchel nickte zustimmend. Auf seinen Wink hin brachte Pina einen weiteren Weinkrug und stellte ihn mit einem Lächeln vor den beiden Kanonikern ab. Ob sie von Pinas körperlichen Reizen angetan waren oder ob es der gute Wein war, der sie versöhnte, wusste später niemand so recht. Auf jeden Fall schenkten sie der Begebenheit keinerlei Beachtung mehr. Noch bevor sich Pina wieder den Gauklern widmete, steckten sie bereits die Köpfe zusammen und tuschelten erneut in ihrer fremden Sprache.
Bendur konnte es sich nicht leisten, den Unmut der Kleriker auf sich zu ziehen. Der Weiler war arm. Eine Mühle oder eine Schmiede suchte man hier vergeblich, die Leute lebten hauptsächlich vom Ackerbau. Einzig die Furt über den Rhyn brachte etwas Abwechslung in den sonst so tristen Alltag. Der Rhyn, der unberechenbare Fluss in der Mitte des gleichnamigen Tales, war Fluch und Segen zugleich. Oft im Frühjahr überschwemmte er zur Schneeschmelze die Wiesen und Felder mit haushohen Steinen und Geröll, nicht selten kamen ganze Baumstämme seine ausufernden Flussarme herunter. Wie ein gieriges Tentakel fraß sich der Fluss durch das Tal. Hohe Berge, tiefe Schluchten und dunkle Wälder säumten das Tal zu beiden Seiten. Von Curia, der fernen Stadt im Süden, zog es sich bis an den Bodensee. Verstreut klebten die Weiler an den Berghängen oder wie hier in Bendur um den Kirchhügel. Während auf der linken Seite des Flusses die Grafen von Werdenberg ihren Besitz hatten, waren es auf dieser Seite die Kanoniker von Sankt Luzi und die Herren von Schellenberg. Letztere verirrten sich so gut wie nie nach Bendur ins Goldene Lamm, im Gegensatz zu den Klerikern aus Curia, die einem guten Tropfen nie abgeneigt waren.
Die Gaukler wurden jetzt immer ausgelassener. Eben sprang einer der Männer auf den Tisch und übte sich in Kunststücken, zum Wohlwollen der übrigen Gäste, die begeistert in die Hände klatschten.
»Wohin führt Euch Euer Weg?«, fragte Mariana einen der Gaukler über den Lärm hinweg.
»Sobald der Regen aufhört, wollen wir weiter nach Veltkirchen«, erwiderte der Mann. »Dort ist in zwei Tagen Markttag.«
Markttag – Mariana seufzte. Sie war erst einmal auf einem Markt gewesen, wenn auch auf einem deutlich kleineren. Der Trubel, das Gedränge, das Rufen der Händler, die vielen Gerüche und Farben, diese Dinge hatten sich trotzdem in ihre Erinnerungen eingegraben.
»Komm doch mit, Mädchen«, meinte der Gaukler scherzhaft. »Eine so schöne Maid könnten wir in unsere Gruppe gut gebrauchen.«
Mariana lachte und fuhr ihm mit der Hand über den Haarschopf.
»Da hätte mein Vater aber keine Freude. Zudem macht sich auch hier die Arbeit nicht von alleine.«
»Wie du meinst, kannst es dir ja noch überlegen. So wie es aussieht, werden wir die Nacht draußen in der Scheune verbringen und erst morgen bei Tagesanbruch weiterziehen.«
Mariana wollte gerade etwas erwidern, als einer der Fuhrknechte vom Nachbartisch sie am Rock zog.
»Wann bringst du uns endlich den guten Apfelmost? Deswegen sind wir extra aus Eschan hierhergekommen«, brummte er unwirsch.
»Der Apfelmost ist leider ausgegangen.« Mariana zuckte entschuldigend mit den Achseln, wobei sie den Lautenspieler keine Sekunde aus den Augen ließ, der sich eben eine Trommel griff. »Musst dich halt bis zur nächsten Apfelernte gedulden.«
Der Apfelmost im Goldenen Lamm war berühmt. Nicht selten kamen fahrende Händler vorbei und erkundigten sich nach dem sauren Gebräu, von dem sie auf der anderen Talseite gehört hatten. Doch für dieses Jahr waren die Fässer leer. Noch gut zwei Monate, und dann würde es im Keller des Goldenen Lamms wieder anders aussehen.
Mariana sehnte die Zeit der Apfelernte in diesem Jahr besonders herbei. Die Arbeit brachte sie vielleicht auf andere Gedanken. Dieses Jahr würde sie sich wieder in einem neuen Rezept versuchen. Es brauchte stets die richtige Mischung aus Äpfeln, Birnen und Kräutern, um dem sauren Gesöff eine spezielle Note zu verleihen.
»Holt endlich die Suppe aus der Küche«, rief Hilarius Büchel seinen beiden Mägden zu.
Pina und Helma reagierten beinahe gleichzeitig. Hastig entzogen sie sich ihren Verehrern und entschwanden durch die Tür an der hinteren Wand.
»Gilt auch für dich«, fügte Hilarius Büchel in Richtung seiner Tochter hinzu.
Mariana biss die Zähne aufeinander, drehte sich um und verschwand wortlos aus dem Schankraum.
»Warum ist dein Vater so mürrisch?«, fragte Helma erstaunt, als sich die Schanktochter neben sie stellte. »Die Taverne ist voll, und die Münzen klingeln doch.«
»Kannst du es dir nicht denken?«
»Du glaubst, die Flickschusterin ist daran schuld?« Helma zog den schweren Suppentopf vom Herd und tauchte die Kelle hinein.
»Wird sich hier wohl bald einiges ändern, wenn die Flickschusterin kommt. Womöglich musst du einen dieser Saufbolde da draußen ehelichen«, seufzte Pina. »Doch glaub mir, Mariana, so leicht werde ich es Alwine Holzer nicht machen, solltest du einmal nicht mehr hier sein.«
»Danke, Pina, auch wenn ich hoffe, dass sich alles doch noch zum Guten wendet.« Mariana versuchte sich in einem Lächeln.
»Auch auf meine Hilfe kannst du zählen«, zischte Helma mit blitzenden Augen. »Das Weibsbild ist eine Schlange.«
»Lass das nur nicht meinen Vater hören, der würde dir die Leviten lesen.«
Mariana lachte, und dies seit Stunden das erste Mal. Die Gesellschaft der beiden Mägde tat ihr gut, auch wenn die Frauen nicht viel gegen die Flickschusterin und ihre Hinterhältigkeit auszurichten vermochten.
»Die Suppe ist einfach herrlich«, meinte Helma mit verzücktem Blick. »Nur schade, dass wir warten müssen, bis die Kerle sich satt gegessen haben.«
Die Bohnensuppe verströmte in der Tat einen Geruch, der die Mägen zum Knurren brachte. Normalerweise wurde im Goldenen Lamm das Nachtmahl eingenommen, bevor die ersten Gäste erschienen. Doch das unerwartete Auftauchen der Flickschusterin am späten Nachmittag hatte den geordneten Tagesablauf durcheinandergebracht. Wohl ein kleiner Vorgeschmack darauf, was ihnen allen bald schon blühte.
Mit einem letzten verzehrenden Blick auf die riesigen Fettaugen, die obenauf schwammen, griffen sich Helma und Pina den Suppentopf und drängten an Mariana vorbei in die Schankstube.
Mariana stemmte die Arme auf die Tischplatte und schloss die Augen. Sie musste ihren Gram in Bezug auf Alwine Holzer hinunterschlucken. Was half es, wenn sie den Vater gegen sich aufbrachte? Sie musste versuchen, an seinen Verstand zu appellieren und ihn an die Vergangenheit zu erinnern. Warum etwas ändern, wenn es so gut lief?
»Träumst du, Mariana?«
Adulf, der Schankknecht, war so leise in die Küche gekommen, dass Mariana erschrocken zusammenfuhr.
»Nur eine kurze Minute der Erholung«, winkte Mariana schnell ab.
Adulf ließ sich nicht so leicht täuschen. Auch wenn er noch nicht lange im Goldenen Lamm sein Auskommen hatte und Männer bekanntlich alles auf die leichte Schulter nahmen, Marianas Traurigkeit entging auch ihm nicht.
»Dein Vater kommt bestimmt zur Besinnung«, meinte er verlegen, wobei er hilflos mit den Schultern zuckte.
»Will es hoffen.« Mariana seufzte.
Auf Adulfs hagerem Gesicht lag stets ein Lächeln. Ohne Murren verrichtete er jede Arbeit, die ihm aufgetragen wurde. Mariana spürte auch ohne viele Worte, dass der schlaksige Kerl ihr zugetan war. Vielleicht wäre Adulf keine schlechte Wahl, sollte die Flickschusterin auf einer baldigen Vermählung beharren.
»Kannst du deinem Vater sagen, die Scheune sei gerichtet. Die Gaukler können ihr Nachtlager jederzeit beziehen«, rissen Adulfs Worte sie aus ihrem Müßiggang.
Mariana hoffte, dass Adulf ihre Gedanken nicht erriet. Hastig drängte sie sich mit glühenden Wangen am Schankknecht vorbei in die Schankstube.
Bald schon lag ein Schmatzen und Rülpsen über dem rauchgeschwärzten Raum. Der Trommelspieler hatte sein Instrument zur Seite gelegt und langte gierig zu, ebenso wie die übrigen Gaukler. Ihr Vater hatte sich nicht lumpen lassen. Neben den dicken Bohnen schwammen auch ansehnliche Speckstücke in den Schüsseln der Gäste. Pina und Helma kamen kaum nach, die Kanten Roggenbrot zu verteilen. Nur die beiden Kanoniker wehrten dankend ab. Offenbar erwartete sie auf dem Kirchhügel ein noch üppigeres Mahl, wundern würde es niemanden.
»Wirt, wir wollen zahlen«, meldete sich einer der beiden eben zu Wort, wobei er die Geldkatze unter seiner Kutte hervorzog und langsam die Kordel zu lösen begann.
»Wollt ihr die Bohnensuppe nicht doch versuchen?« Hilarius Büchel rieb sich die Hände. »Sie ist wirklich köstlich.«
»Das glauben wir gerne, guter Mann«, erwiderte der Kanoniker, »doch wir müssen weiter.«
»Wie Ihr wollt.« Hilarius Büchel nickte. »Geht es schon bald wieder nach Curia?«
»Deo volente.« Der Kanoniker zählte zwei Kupfermünzen aus seiner Geldkatze und schob sie Hilarius Büchel hin. »So Gott will«, fügte er erklärend hinzu.
Als die beiden Mönche die Schankstube verließen, trat Mariana hinter ihren Vater.
»Seltsame Männer«, meinte sie nachdenklich.
»Seltsam und geizig.« Hilarius Büchel besah sich die beiden Kupfermünzen. »Diese Dinger werden immer dünner. Würde mich nicht wundern, wenn die Händler sie auf den Märkten bald nicht mehr einlösen.«
»Adulf sagt, die Scheune sei für die Gaukler gerichtet.«
Hilarius Büchel nickte, knurrte kurz, ehe er sich wieder seinen verbleibenden Gästen zuwandte. Der Abend verlief aus Sicht von Hilarius Büchel doch noch zu seinem Wohlwollen. Die Ankunft der Gaukler und das hereinbrechende Gewitter trieben immer mehr Gäste in den Schankraum. Bald war kein Platz mehr frei. Trommeln und Lauten vermischten sich mit grölendem Gesang. Während die einen ihr Vergnügen beim Würfelspiel suchten, klatschten die anderen lautstark Beifall, als Pina ihre Röcke auf einem der Tische schwang. Ihre Hüftschwünge wurden mit jedem Atemzug verwegener, und es hätte nicht viel gefehlt, und sie wäre vom Tisch gefallen. Vielleicht war dies auch ihre Absicht, denn Verehrer, die sie aufgefangen hätten, derer hatte Pina genug. Ihre ausladende Oberweite, verbunden mit dem grellen Lachen, animierte die Männer und trieb sie zu Höhenflügen. Auch Helma war kein Kind von Traurigkeit. Im Gegensatz zu der jüngeren Pina waren es bei ihr die wild zerzauste blonde Mähne und ihre Fülle, die Anklang fanden.
Als die Nachtglocke vom Kirchhügel ertönte, ging ein enttäuschtes Raunen durch die Schankstube.
»So, Männer«, rief Hilarius Büchel über die Köpfe hinweg. »Austrinken und zahlen. Und dass ihr mir auf dem Heimweg nicht auf dumme Gedanken kommt. Der Büttel macht dieser Tage besonders strenge Kontrolle.«
Allmählich leerte sich der Schankraum. Zurück blieben verdreckte Tische, umgestoßene Schüsseln und leere Becher. Die beiden Schankhunde suchten bereits den Boden nach Essbarem ab. Doch mehr als ein paar Krümel Roggenbrot hatten die Gäste nicht zurückgelassen.
»Geh du ruhig schlafen«, meinte Helma lächelnd zu Mariana. »Pina und ich schaffen das auch alleine.«
Mariana wusste genau, warum die beiden Schankmägde sie in die Kammer schickten, doch sie enthielt sich der Worte. Diese Nacht würden Pina und Helma ihre Strohsäcke unter der Stiege mit Sicherheit nicht aufsuchen, diese Nacht wartete frisches Heu in der Scheune auf sie. Insgeheim beneidete Mariana die beiden Frauen um ihre Unbefangenheit und ihre Freiheit. Ihnen sagte niemand, was sie zu tun und zu lassen hatten, solange sie ihre Arbeit verrichteten. Mit einem letzten wehmütigen Blick auf die rauchige Schankstube stieg Mariana die Stufen hoch. Die Ruhe in ihrer kleinen Dachkammer tat gut, das monotone Prasseln der Regentropfen beruhigte ihre Nerven. Nicht lange, und sie schlief ein.
2. Kapitel
Obwohl Sonntag war, erwachte das Leben im Goldenen Lamm früh. Die beiden Mägde mühten sich schon seit Stunden, den Badezuber zu füllen, denn es gehörte zum guten Ton, beim Kirchgang stets sauber und im besten Sonntagsgewand zu erscheinen. Auch wenn Bendur im Vergleich zu den Städten Sankt Gallen und Curia nur ein kleiner, unbedeutender Weiler war, der Sonntag war den Menschen auch hier heilig.
Mariana kam gähnend die Stufen herab. Irgendwann in der Nacht hatte der Regen nachgelassen. Nebelschwaden krochen den Rhyn hoch und legten sich einem Schleier gleich über die Landschaft. Es war ungewohnt kalt geworden.
Mariana stieg stets als Erste in den Zuber, doch an diesem Morgen sah sie das mehr als Strafe. Von stechenden Kopfschmerzen geplagt, kam sie kaum aus dem Bett. Langsam streifte sie sich das Leinenhemd über den Kopf, ehe sie im lauwarmen Wasser untertauchte.
»Der Mann, der dich einmal zur Frau bekommt, wird seine Freude haben«, meinte Helma lachend, als sie den Kopf in die Küche streckte. »Deine Brüste stehen wie frische Apfelknospen, und deine Augen glitzern wie Edelsteine.«
Mariana rang sich trotz der pochenden Kopfschmerzen ein Lächeln ab.
»Du übertreibst wie immer, Helma. Erst müsste ich einen Mann finden, der auch mir gefällt, und dies ist hier in Bendur nicht ganz einfach, wie du weißt.«
Um die Antwort der Schankmagd nicht zu hören, tauchte Mariana unter. Das Wasser beruhigte den Schmerz in ihrem Kopf. Schankwirte galten zwar nicht ganz so unehrenhaft wie Henker oder Totengräber, doch als Tavernentochter hatte man trotzdem nicht viele Möglichkeiten. Meinte es das Schicksal gut mit einem, fand man sein Glück in den Armen eines Köhlers oder eines Gerbers. Bei Letzterem lief man Gefahr, innerhalb kürzester Zeit am Milzbrand zu sterben, während man als Frau eines Köhlers niemals mehr aus dem Wald herauskam und bestimmt an Einsamkeit starb.
Prustend tauchte Mariana wieder auf und griff sich die feine Lavendelseife, die der Vater letzte Woche von einem fahrenden Händler gekauft hatte. Dann begann sie sich die Haare einzuseifen. Mariana liebte ihre langen braunen Haare, die ihr in weichen Wellen bis zur Hüfte reichten. Wenn sich die Sonne darin spiegelte, schimmerten sie golden. Doch das Auffälligste an ihrer Erscheinung waren die hellblauen Augen. Mariana sog den lieblichen Duft des Lavendels tief in ihre Lungen. Genüsslich schloss sie die Augen, als sie Helmas Hände auf ihrem Kopf spürte. Genauso hatte die Mutter ihr stets die Haare gewaschen und dabei immer ein Lied gesungen. Mariana kämpfte hinter den geschlossenen Lidern gegen die Tränen.
»So, jetzt ist Schluss«, verkündete Helma mit gespielt strengem Unterton, als sie ihr einen Kübel Wasser über den Kopf kippte. »Pina und ich müssen ebenfalls noch baden, oder sollen wir so verdreckt hinauf zum Kirchhügel?«
Helmas anschließendes Lachen wirkte ansteckend und zauberte sogar ein Schmunzeln auf Marianas Gesicht. Hastig griff sie sich eines der Leinentücher und wickelte es um ihren Leib, dann rannte sie mit klappernden Zähnen an der Magd vorbei die Stiege zu ihrer Kammer hoch. Am Sonntag zog Mariana stets das gute blaue Kleid mit den Spitzenborden an. Anschließend entwirrte sie die Haare mit einem Hornkamm, ehe sie wenig später wieder hinunter in die Schankstube ging. Der Kamin verströmte eine wohlige Wärme, weswegen sie einen Hocker heranzog und sich darauf niederließ. Aus der Küche hörte man das Lachen der beiden Mägde, die das Bad wohl ebenfalls hinter sich gebracht hatten und sich bereits für den Kirchgang rüsteten. Mariana begann die feuchten Haare zu einem dicken Zopf zu flechten. Auch das hatte früher die Mutter getan. Als ein Seufzer ihren Lippen entwich, betrat Hilarius Büchel eben die Schankstube.
Der Vater hatte sich für den Kirchgang ebenfalls fein gemacht. Er trug ein frisch gewaschenes Hemd, ein mit Silberfäden besticktes Wams und Kniebundhose mit Gamaschen. Hilarius Büchel war noch immer ein gut aussehender Mann, trotz der langen Nächte in der Taverne. Kein Wunder, zeigte sich die Flickschusterin von seinem Werben mehr als nur angetan.
»Herr, wir sind fertig.« Pina betrat die Schankstube. Um die Schultern trug sie ein sauberes Tuch, das ihren tiefen Ausschnitt artig verbarg.
»Dann wollen wir«, erwiderte Hilarius Büchel räuspernd, wobei er seiner Tochter einen auffordernden Blick sandte.
Für Hilarius Büchel und sein Gesinde war klar, dass man den Weg hinauf zum Kirchhügel zu Fuß in Angriff nahm, schließlich sollte der steile Anstieg so etwas wie eine sonntägliche Buße sein. Das sahen in den umliegenden Weilern viele so, denn Ochsengespanne erblickte man kaum. Bald schon schlossen sich ihnen immer mehr Männer und Frauen an. Heftiges Gestikulieren, Lachen und Schwatzen begleitete die Kirchgänger, die sich langsam dem Gotteshaus näherten. Pater Basilius sah es nicht gern, wenn sich seine Schäfchen wohlgelaunt und übermütig in den Kirchbänken tummelten, also verstummte die Gruppe beim Eintritt ins Gotteshaus, wie es sich gehörte. Die Augen starr auf die gefalteten Hände gerichtet, spürten die Kirchgänger den mahnenden Blick von Pater Basilius, der oben auf der Kanzel stand und jeden Eintretenden stumm musterte. Bei Pater Basilius wusste man nie so recht, woran man war. Waren die Mönche aus Curia beim Gottesdienst anwesend, legte er eine Strenge an den Tag, die besonders die Kinder in der vorderen Bankreihe zu spüren bekamen. Heute war einer dieser Sonntage. Die Mönche standen mit ernsten Mienen um den Altar und warfen strenge Blicke in Richtung der gottesfürchtigen Männer und Frauen, die kaum zu atmen wagten. Nach dem Singen des Kyrieeleison, unzähligen Gebeten und dem Verkünden des Evangeliums, das Pater Basilius wie immer auf Latein hielt, beendete er den Gottesdienst mit den Worten »Ite, missa est«, worauf die Kirchleute allesamt ein demütiges »Deo gratias« murmelten. Die Köpfe weiterhin gesenkt, verließen die Kirchgänger danach beinahe fluchtartig das Gotteshaus.
Draußen lockte der Frühherbst mit all seiner Farbenpracht. Die Nebelschwaden hatten sich verzogen und der wärmenden Sonne Platz gemacht. Die riesigen Wälder zu beiden Seiten des Tales verfärbten sich bereits rot. Zudem brauste nicht selten der Föhn in dieser Jahreszeit durch das Tal und trieb die Temperaturen nochmals in sommerliche Gefilde. Äpfel, Birnen und Weintrauben dankten es ihm mit herrlicher Süße.
Nach dem Kirchgang begann stets der schönste Teil des Tages. Im Hof der kleinen Kirche tummelte sich, wer gesehen werden wollte.
Hilarius Büchel gesellte sich zur Männerrunde, in dessen Mitte der Fleischhauer das Wort führte. Das Gewitter der letzten Nacht wurde ebenso verhandelt wie das Durchziehen der Gaukler, die sich laut dem Fleischer auch in seiner Scheune bedient hatten. Zwei Hühner und ein halbes Schwein, das er an einem Haken zum Ausbluten aufgehängt hatte, waren verschwunden. Hilarius Büchel verneinte die Frage, ob er wisse, wohin die Gauner gezogen seien, nur aus dem Grund, da er es sich mit den Gauklern nicht verscherzen wollte, schließlich lebte er von der Einkehr und nicht von der Verfolgung vermeintlicher Diebe. Als er der Flickschusterin ansichtig wurde, schmälerte sich sein Interesse an der Unterhaltung schlagartig. Mit einem unverständlichen Murmeln ließ er die Männer weiter ihre Mutmaßungen anstellen, während er Alwine Holzer zuwinkte und hastig in ihre Richtung lief.
Alwine Holzer hatte ihren schwarzen Witwenschleier aufgesetzt und blickte züchtig zu Boden. Auch ihr Trauerjahr war noch nicht zu Ende. Zwar wunderte sich der eine oder andere darüber, was die Witwe hier auf dem Kirchhügel zu suchen hatte, zumal sie doch zum Pfarrsprengel der Sankt-Martinskirche in Puges gehörte, doch laut sagte dies niemand. Hinter vorgehaltener Hand wurde jedoch bereits über die sich anbahnende Liebelei des Wirtes und der Flickschusterin getuschelt, sodass am Ende des Tages wohl jedermann die Wahrheit kannte.
»Wann wirst du mit Pater Basilius sprechen?«, hauchte Alwine aus bewegungslosen Lippen, als Hilarius Büchel endlich neben ihr stand. »Gegen ein Entgelt wird er bestimmt von der Jahresfrist absehen, davon bin ich überzeugt.«
Hilarius Büchel seufzte. Er liebte Alwine, seit er sie das erste Mal gesehen hatte, und dies war nicht erst seit dem Tod seiner Frau. Heimlich hatten sie sich immer wieder getroffen. Es hatte ihn arge Beherrschung gekostet, den körperlichen Vorzügen der Flickschusterin zu entsagen, doch Alwine zeigte sich unerbittlich und wollte ihn erst in ihre Bettstatt lassen, wenn das Ehegelübde gesprochen war.
»Hilarius!«, rief sich die Flickschusterin begleitet von einem Brummen wieder in Erinnerung.
»Keine Sorge, ich werde noch diese Woche mit dem Pater reden. Doch jetzt lass uns zu Mariana gehen, damit sie ihr Missfallen dir gegenüber endlich ändert.«
»An mir soll es nicht liegen, Hilarius, das weißt du. Ich will nur das Beste für das Mädchen.«
Hilarius seufzte abermals. Er wusste selbst nicht, was das Beste für Mariana war. Auf dem Totenbett hatte er seiner Frau versprochen, stets ein Auge auf seine Tochter zu haben und sie nicht gegen ihren Willen zu verheiraten.
»In ihrem Alter war ich bereits verheiratet«, zischte die Flickschusterin, als hätte sie die Gedanken von Hilarius erraten. »Eine Frau braucht den Schutz eines Mannes, nur dann ist sie vor Übergriffen sicher. Eine Schenke ist kein Ort für ein anständiges Mädchen. Du hättest schon lange einen Ehemann für sie suchen müssen.«
»Da hast du sicher recht, Alwine, doch lass uns damit warten, bis wir den Bund der Ehe eingegangen sind. Dann sehen wir weiter. Bestimmt wird Mariana ein Einsehen haben, wenn du ihr gut zuredest. Frauen verstehen einander in diesen Dingen besser.«
»Aber sicher, Hilarius, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich will doch wie gesagt nur das Beste für deine Tochter.«
Alwines Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. Der Schankwirt war wie alle Männer dümmer als Bohnenstroh und blind wie ein Huhn. Ein paar schöne Worte da, ein Lächeln dort, und schon fressen sie einem aus der Hand. Alwine genoss ihre Macht sichtlich.
»Alwine wird das sonntägliche Morgenmahl bei uns in der Schankstube einnehmen«, verkündete Hilarius mit vor Stolz geschwängerter Brust, als er zu der kleinen Gruppe trat. Die beiden Mägde an Marianas Seite schauten erschrocken hoch. »Pina und Helma, ihr geht voraus und richtet alles her. Wir anderen«, dabei schaute Hilarius Büchel mit strengem Blick auf seine Tochter, »werden noch etwas hier im Kirchhof bleiben und den Gesprächen lauschen. Ganz so, wie es sich gehört.«
Mariana zog den Umhang enger um ihre Schultern und warf den Kopf trotzig in den Nacken. »Ich werde den beiden helfen, wenn es dir genehm ist, Vater. Zudem muss ich noch die Hühner füttern.«
Noch bevor Hilarius Büchel Einwände erheben konnte, lief Mariana bereits mit wehendem Rock dem Tor entgegen.
»Also los, auf was wartet ihr noch«, knurrte Hilarius Büchel den beiden Mägden zu, die ein Kichern nur schwer verbergen konnten. Dann rafften auch sie ihre Röcke und rannten hinter der sichtlich erbosten Mariana her.
Dass die Unterhaltung in der Enge des Kirchhofs nicht ungehört geblieben war, sah man dem hämischen Lächeln zweier dicken Matronen an. Hilarius Büchel hatte sich mit der Wahl der Witwe aus Puges nicht nur Freunde gemacht, das wusste er sehr wohl. Vielen hier war die Frau jetzt schon ein Dorn im Auge. Doch er mochte nun mal Frauen, die mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hielten. Das Leben als Frau eines Schankwirts war nicht einfach, ein spitzes Mundwerk kam da gelegen.
»Du musst ihr Zeit lassen«, meinte Hilarius Büchel entschuldigend. »Der Tod ihrer Mutter geht ihr noch immer nahe.«
Alwine biss die Zähne aufeinander und trotzte den gaffenden Blicken der beiden Matronen. Sie warf den Kopf in den Nacken, ehe sie sich zu Hilarius Büchels Erstaunen bei ihm unterhakte und an seiner Seite auf das Tor zuschritt.
Hilarius Büchel winkte dem Fleischer und seinen Mitstreitern etwas verlegen zu. Das Gerede im Kirchhof würde hinter seinem Rücken zur Höchstform auflaufen. Im Stillen war es ihm allerdings nicht unangenehm, denn Neugier trieb die Menschen ebenso in seine Schankstube wie der Durst.
In der Taverne war der Tisch bereits gedeckt, als Hilarius in Begleitung seines Gastes eintraf. Sogar ein Feldblumensträußchen zierte die Tafel. Im Kamin loderte das frisch geschürte Feuer. Sonntags kam stets Hirsebrei mit Pflaumenmus, Dörrobst und Käse auf den Tisch. Dazu gab es Wein, gesüßt mit Honig und Zimt. Pina griff sich gerade eine Birkenkerze und stellte sie auf den Tisch. Nicht dass es im Schankraum an diesem Morgen dunkel gewesen wäre, doch Kerzenlicht verbreite eine gute Stimmung, meinte die Magd mit einem Lächeln. Und gute Stimmung konnte die Schankstube auch dringendst gebrauchen, warf man einen Blick auf Mariana, die mit finsterer Miene neben dem Kamin dastand und den Tisch kritisch musterte.
Hilarius Büchel wies seinem Gast den Platz zu seiner Linken. Die beiden Schankmägde versuchten ihre Erschrockenheit hinter einem starren Lächeln zu verbergen, während Adulf, der eben den Schankraum betrat, mit offenem Mund mitten in der Bewegung innehielt. Der Platz war seit dem Tod von Marianas Mutter stets leer geblieben. Niemand durfte sich auf den Stuhl setzen, das war ein ungeschriebenes Gesetz im Hause von Hilarius Büchel.
Mariana schluckte und kniff kurz die Augen zusammen. Dann trat sie zum Tisch und setzte sich auf ihren Stuhl. Adulf erwachte aus seiner Starre und tat es ihr gleich. Aus seinem Augenwinkel allerdings musterte er Alwine Holzer voller Bewunderung.
Zu Marianas Wut über die Anwesenheit der Flickschusterin gesellte sich nun auch Empörung über Adulfs unübersehbare Begeisterung ob der Witwe. Um die Euphorie des Knechtes zu bremsen, versetzte sie Adulf unter dem Tisch einen so heftigen Tritt, dass ihm beinahe der Weinbecher aus der Hand gefallen wäre.
»Zur Feier des Tages werden wir uns heute ein besonders gutes Sonntagsmahl gönnen. Den Brei mit dem Pflaumenmus kannst du getrost in der Küche lassen«, wandte sich Hilarius Büchel an Helma. »Stattdessen gönnen wir uns ein gutes Stück geräucherten Schinken.«
»Wir hätten auch noch etwas von der Hühnerpastete, die die Fleischerin letzte Woche als Dank für den Wein brachte«, ereiferte sich Helma mit diebischem Grinsen. »Wenn Ihr wollt, hole ich die Pastete aus dem Erdloch.«
Es war kein Geheimnis, dass Helma gerne viel und gut aß. Für diesen Genuss schluckte sie sogar ihre Abneigung gegen die Flickschusterin hinunter.
»Eine sehr gute Idee, Helma. Für meine … für unseren Gast ist mir nichts zu teuer.« Hilarius Büchel tätschelte Alwine Holzer sanft die Hand.
Mariana saß die ganze Zeit nur stumm da und starrte auf einen imaginären Fleck auf dem Tischtuch. Sie würde keinen Bissen hinunterbringen, davon war sie überzeugt. Als die guten Sachen schließlich auf dem Tisch lagen, bediente Hilarius Büchel eigenhändig seinen Gast. Die anschließende Unterhaltung verlief dann aber äußerst einsilbig, und hätten Hilarius Büchel und Adulf keine Anekdoten der letzten Wochen zum Besten gegeben, man hätte wohl eine Feder zu Boden fallen hören.
Alwine Holzer ignorierte Marianas Stummheit ebenso wie die misstrauischen Blicke der Mägde. Sie lachte überlaut, machte einen Scherz und gab sich betont einfühlend, als Adulf von seinem Magengrimmen erzählte. Als das Essen endlich zum Ende kam, entfloh Mariana der Gesellschaft mit einer gemurmelten Ausrede. In der Küche griff sie sich einen der Weidenkörbe und zog ihren Umhang vom Haken.
»Du darfst deinen Unmut nicht so offen zeigen«, flüsterte Helma ihr aufmunternd zu, als sie die Küche betrat. »Männer mögen es nicht, wenn man sie bloßstellt. Und dein Vater schon gar nicht.«
»Ich habe ja nichts gesagt«, konterte Mariana verstockt.
»Genau, das ist es. Du musst versuchen, dich mit der Flickschusterin gut zu stellen, wenigstens solange dein Vater im Raum ist. Was du wirklich von ihr denkst, nun, das kannst du ihr ja heimlich kundtun oder noch besser für dich behalten.«
»Ist wohl eine deiner Weisheiten.«
»Glaub mir, Mariana, wenn du selber mal so alt bist wie ich, dann weißt du, wie du die Kerle nehmen musst, damit sie dir aus der Hand fressen.«
»Aus der Hand fressen tut mein Vater wohl eher der Flickschusterin.«
Helma seufzte, ehe sie mit den Achseln zuckte.
»Er wird sie heiraten, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, meinte sie schnaubend. »Hilarius Büchel hat sich noch nie etwas sagen lassen, und er wird es auch dieses Mal nicht tun. Also denk an meine Worte. Stell dich gut mit der Witwe, ansonsten wird dein Leben hier eine einzige Mühsal.«
Wütend stapfte Mariana über die Schwelle. Helma hatte recht. Sie musste gute Miene zum bösen Spiel machen, wollte sie ihren Vater nicht gänzlich verlieren. Sie liebte den alten Griesgram, seine von Silberfäden durchzogenen Haare und sein schelmisches Grinsen, auch wenn er sich wie ein liebestoller Gockel aufführte.
»Mariana!«
Erschrocken drehte sie sich um. Ihr Vater stand mit der Flickschusterin unter der Tür der Taverne und winkte ihr zu.
»Ich werde Alwine nach Puges begleiten. Vielleicht hast du Lust, mitzukommen?«
»Würde ich gerne«, log Mariana mit hochrotem Kopf, »doch heute ist der richtige Zeitpunkt, nach den Pilzen im Wald zu sehen. Wenn sich der Nebel lichtet, sprießen die Dinger wie … wie …«
»Ist schon gut, Hilarius«, wehrte die Flickschusterin ab. »Lass uns zusehen, dass wir die Fähre noch erwischen, bevor der alte Melchior auf den Gedanken kommt, sich seiner sonntäglichen Faulheit zu widmen.«
Hilarius Büchel zögerte. Bevor er einen weiteren Versuch unternehmen konnte, seine Tochter doch noch von seiner Idee zu überzeugen, zog ihn die Flickschusterin sanft, aber bestimmt in Richtung ihres Eselgespanns.
Mariana rang sich zu einem kurzen Winken durch, mehr schaffte sie an diesem Tag nicht. Den Weidenkorb an die Brust gedrückt, wartete sie, bis die beiden um die Wegbiegung verschwanden, dann rannte sie zu dem kleinen Waldstück. Eigentlich mochte sie Pilze nicht so sehr, und noch weniger mochte sie das stundenlange Durchsuchen des morastigen Waldbodens, doch schien es der einzige Ausweg, dem Goldenen Lamm für einige Stunden zu entfliehen.
Der gestrige Regen hatte den schmalen Waldweg aufgeweicht, Moder und Fäulnis lagen schwer in der Luft. Die Nässe hatte das Laub zu einer pampigen Masse verwandelt, in welcher die zarten Pilzkörper nur schwer zu finden waren. Den Rock bis zu den Knien hochgeschoben, stapfte Mariana auf eine der Eichen zu.
Eigentlich war der beste Tag zum Pilzesuchen der Donnerstag, das wusste auch Mariana. Selbst wenn es der Pater auf dem Kirchhügel nicht gerne hörte, die alten Weiber hier hielten die heidnischen Bräuche aus uralter Zeit noch immer am Leben. Und der Gott Donar war der Herr des Waldes, der Pilzgott schlechthin. Mit einem vergewissernden Blick über die Schulter, ob womöglich der Pfaffe vom Kirchhügel nicht doch noch zwischen den Baumstämmen auftauchte, griff sie sich einen kleinen Ast und ritzte das Drudenzeichen in die weiche Rinde. Jetzt war sie sicher vor dem Bösen, sicher vor Hexen und der Unbill der Geister. Schneller als gedacht füllte sich der Korb mit Kaiserlingen und Steinpilzen. Mariana trotzte der Versuchung, nicht heimlich eine Stinkmorchel in ihrer Tasche verschwinden zu lassen. Ihr Vater war nicht dumm, und wenn Alwine Holzer dieses Ding in ihrem Essen fand, fiel der Verdacht zu schnell auf sie. Erschöpft ließ sich Mariana auf einem Baumstrunk nieder, den Korb zu ihren Füßen, das Gesicht in Richtung des bunten Blätterdaches gerichtet. Hie und da schafften es die Sonnenstrahlen, das Dickicht zu durchbrechen. Dann glitzerte der Wald für einen kurzen Augenblick in allen Farben. Mariana schloss die Augen und sog die Ruhe in sich auf. Irgendwo im Geäst schrie ein Vogel. Bald schon wurden ihre Lider immer schwerer, und sie ergab sich ihrer Müdigkeit. Sie träumte von Geistern und von Hexen, und als Alwine Holzer ihren Traum streifte, schrak sie erschrocken hoch. Nebelschwaden krochen bereits zurück in den Wald, und auf einmal war es ungemütlich kalt. Mariana packte den Weidenkorb und rannte zurück auf den Waldweg. Der Nebel wurde jetzt mit jedem Atemzug dichter. Was, wenn ein Wildschein auftauchte oder gar ein Bär? Mariana schluckte und lief weiter. Als sich die Taverne aus dem Nebel schälte, klopfte ihr Herz hart gegen die Brust. Adulf trat gerade mit einer Handvoll Holz aus der Scheune.
»Hast du den Teufel gesehen?«, rief er lachend, wobei er hinter Mariana in die Schankstube trat.
»Den Teufel nicht, aber die Geister des Waldes, und die haben mir gereicht.«
»Mach das Kreuzzeichen, dann können sie dir nichts Böses«, meinte Adulf gelassen, während er das Holz neben den Kamin legte.
»Ist Vater schon zurück?«, fragte Mariana.
»Nein. Ich habe ihn noch nicht gesehen.«