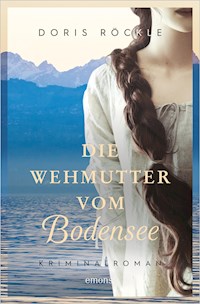7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rheinthal Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Ein spannender historischer Roman um das Grabtuch Christi 1341: Um das ungeheuerliche Geheimnis des Grabtuches Christi zu wahren, wird der neugierige junge Graf Albrecht auf eine Pilgerreise ins gelobte Land geschickt. Kurz nach seiner Vermählung muss Graf Albrecht, Herrscher der Grafschaft Werdenberg-Heiligenberg, erkennen, dass seine Gemahlin, Gräfin Mechthild, an einer seltsamen Krankheit leidet. Als die junge Frau eines Tages spurlos verschwindet, reist der Graf in seiner Verzweiflung an den Bischöflichen Hof in Curia. Doch statt ihm, wie erhofft, zu helfen, nutzt der Bischof die Gelegenheit den Grafen loszuwerden, und schickt ihn im Auftrag der Rosenkranzbruderschaft auf eine Pilgerreise ins Gelobte Land, von der er nicht mehr lebend zurückkehren soll. Doch das Glück ist Graf Albrecht hold, und er erfährt nicht nur von dem Mordkomplott gegen ihn, sondern lüftet bei einem alten Templer das Geheimnis um das Grabtuch Christi, welches die Bruderschaft fälschen möchte, um die Ungeheuerlichkeit, die die Reliquie zeigt, zu verbergen. Nach den beiden Vorgängertiteln "Die Flucht der Magd" und "Das Mündel der Hexe" nun der nächste Mittelalterroman von Doris Röckle
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Ähnliche
Doris Röckle
Die Spur der Gräfin
Historischer Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
1341: Um das ungeheuerliche Geheimnis des Grabtuches Christi zu wahren, wird der neugierige junge Graf Albrecht auf eine Pilgerreise ins Gelobte Land geschickt.
Kurz nach seiner Vermählung muss Graf Albrecht, Herrscher der Grafschaft Werdenberg-Heiligenberg, erkennen, dass seine Gemahlin, Gräfin Mechthild, an einer seltsamen Krankheit leidet. Als die junge Frau eines Tages spurlos verschwindet, reist der Graf in seiner Verzweiflung an den Bischöflichen Hof in Curia. Doch statt ihm, wie erhofft, zu helfen, nutzt der Bischof die Gelegenheit den Grafen loszuwerden, und schickt ihn im Auftrag der Rosenkranzbruderschaft auf eine Pilgerreise ins Gelobte Land, von der er nicht mehr lebend zurückkehren soll.
Doch das Glück ist Graf Albrecht hold, und er erfährt nicht nur von dem Mordkomplott gegen ihn, sondern lüftet bei einem alten Templer das Geheimnis um das Grabtuch Christi, welches die Bruderschaft fälschen möchte, um die Ungeheuerlichkeit, die die Reliquie zeigt, zu verbergen.
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter,
die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin.
Danke
Personenverzeichnis
Die kursiv markierten Daten und Personen sind historisch belegt. Manche Dinge in der Geschichte allerdings kann niemand wissen, und eben darin liegen Reiz und Herausforderung des fiktiven Schreibens …
Hugo I. von Montfortlässt die Burg in den 1220er-Jahren erbauen. Ab 1259 erscheint erstmals der Familienname »von Werdenberg«.
Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg, der Stammvater der Burg, gründet ein Jahr später das Städtchen Werdenberg. 1428 stirbt der letzte Graf der Werdenberg. Die Burg gerät anschließend unter die Glarner Landvögte und wird 1803 vom Kanton St. Gallen gekauft.
Heute sind Schloss und Städtchen begehrte Anziehungspunkte. Die Häuser stammen zu einem Großteil aus den Jahren um 1261 und sind Zeugen längst vergangener Zeiten.
Graf Albrecht II. Herrscher der Grafschaft Werdenberg-Heiligenberg (1322–1373)
Graf Albrecht I. sein Vater (1297–1365)
Gräfin Katharina dessen Frau und Mutter von Graf Albrecht II. aus dem Hause von Kyburg (1301–1342)
Gräfin Mechthild erste Gemahlin Graf Albrechts II. aus dem Hause Montfort-Tettnang (1324–1344)
Gräfin Agnes zweite Gemahlin Graf Albrechts II. aus dem Hause Hohenzollern-Nürnberg (1324–1364)
Adelheid Zofe von Gräfin Katharina von Kyburg
Gisine Zofe von Gräfin Mechthild von Montfort-Tettnang
Ehrenfrieda Zofe von Gräfin Agnes von Hohenzollern-Nürnberg
Hannes Montaschiner Stallmeister der Werdenberg
Regina Köchin der Werdenberg und Gemahlin des Stallmeisters. Ihr Sohn Lucas stirbt am Antoniusfeuer.
Frotlina junge Magd
Lena alte Magd
Nikolaus Leibarzt der Grafen v. Werdenberg, heiratet Gisine
Die erste Bruderschaft wurde erstmals im Jahre 1468 in Flandern erwähnt. Es war eine Laienbruderschaft mit dem Ziel der Vertiefung der Frömmigkeit der Menschen durch das Rosenkranzgebet.
Bischof Verendarius bürgerlicher Name Ulrich Ribi, Bischof im heutigen Chur von 1331–1355
Bruder Timotheus Magister Venerabilis, Oberhaupt der Bruderschaft. Bürgerlicher Name Walter Kerlinger,Dominikaner und von Papst Urban V. um 1364 zum Inquisitor ernannt. Er ging rigoros gegen Beginen und Flagellanten vor. Ich habe mir die Freiheit genommen und das Ganze um gute zehn Jahre vorverlegt.
Bruder Erasmus Bibliothekar des Bischöflichen Hofes von Curia
Bruder Franziskus ehemaliger Lehrer Graf Albrechts II., Mönch in Curia
Bischof Berthold v. Eichstätt Bruder von Gräfin Katharina (1320–1365). Obwohl er keine Klerikerweihen empfangen hatte, wurde er von Papst Clemens VI. 1351 zum Bischof von Eichstätt bestimmt. Er gilt als Erbauer der Willibaldsburg/Bischofssitz bei Eichstätt.
Bischof Friedrich v. Regensburg Bruder von Gräfin Katharina (1325–1368). Vom Regensburger Rat und dem Papst zum Bischof ernannt, stand er mit Heinrich III., der von Kaiser Ludwig dem Bayern zum Gegenbischof ernannt wurde, lange Zeit im Streit. Als Heinrich starb, akzeptierte der Kaiser ihn als Bischof von Eichstätt.
Abt Diethelm v. Castell Abt der Richenow (heutige Insel Reichenau) 1306–1343
Abt Eberhard v. Brandis Abt der Richenow (1328–1379). Dank ihm erhielt die Insel Reichenau die Immunität und die Reichsunmittelbarkeit. Allerdings wird ihm auch vorgeworfen, das Klostergelübde gebrochen zu haben und einen illegitimen Sohn gezeugt zu haben.
Abt Rudolfo Abt des Klosters Como
Fra Mathäus Prior des Klosters Como
Hugo I. von Montfort ließ die Höhenburg im Vorarlberger Rheintal Ende des 12. Jahrhunderts erbauen. Im Appenzellerkrieg um 1405 wurde die Burg völlig zerstört. Heute erinnern nur noch wenige Mauerreste an die glorreiche Zeit der Montforter Grafen.
Graf Wilhelm II. Herrscher über Montfort-Tettnang, Vater von Mechthild (1290–1352)
Gräfin Kunigunde v. Rappoltstein seine Gemahlin und Mutter von Mechthild (1298–?)
Wilhelm Bruder von Gräfin Mechthild
Heinrich Bruder von Gräfin Mechthild
Alberta Köchin der Burg Montfort
Bischof Verendarius bürgerlicher Name Ulrich Ribi, Bischof im heutigen Chur von 1331–1355
Bruder Erasmus Bibliothekar
Bruder Franziskus ehemaliger Lehrer Graf Albrechts II. von Werdenberg-Heiligenberg
Bruder Remigius alter Mönch und Freund des Grafen
Bruder Rimus junger Mönch
Bruder Rigoberto Mönch und Pferdekenner
Bruder Theodor junger Mönch und Freund von Bruder Rimus
Abt Rudolfo Abt des Klosters
Fra Mathäus Prior des Klosters
Fra Emilio Infirmarius (Kräuterbruder)
Fra Ambrosius Bibliothekar
Fra Fadri junger Mönch und Weggefährte Graf Albrechts
Fra Benedetto alter Mönch, stets auf Wanderschaft
Zwischen 1309–1377 befand sich der Papstsitz in Avignon. Diese Zeit wird auch als babylonische Gefangenschaft der Kirche bezeichnet. Sieben Päpste verbrachten ihre Amtszeit in der Stadt.
Papst Clemens V. Verbündeter König Philipps IV. gegen die Templer. 1309 ließ er den Papstsitz nach Avignon verlegen. Regierte von 1305–1314.
Papst Clemens VI. Bürgerlicher Name Pierre Roger, verschrien als Nepotist und Verschwender, Freund König Karls IV. Regierte von 1342–1352 in Avignon.
Papst Innozenz VI. Bürgerlicher Name Étienne Aubert, Disziplin und Gelehrsamkeit zeichneten ihn aus, trug maßgeblich zum Friedensschluss zwischen England und Frankreich bei. Regierte von 1352–1362 in Avignon.
Kardinal de Ridefort Neffe Papst Clemens’ VI.
Francesco Petrarca ital. Dichter und Geschichtsschreiber (1304–1374)
Amelie seine Tochter und Magd der Werdenberg
Roger Fournier Alchimist in den Katakomben von Curia, stammte aus Avignon
Abu Inan Faris Herrscher der Meriniden (Marokko), Regentschaft von 1351–1358
Prinzessin Esra seine Tochter
Samira ihre Dienerin
Iman Safi Leibarzt von Abu Inan Faris
Oman Idis Liebdiener von Abu Inan Faris
Isabella van der Velden Haremsgefangene, Tochter von Frank van der Velden aus Venedig
Nadira ihre Dienerin
Amaris erste Haremsfrau
Molini Kapitän des Dreimasters
Thumart Kapitän der Galeere nach Akkon
Malik Schiffsjunge
Adelinda Klosterfrau
Alfonso de Moleste Pilger aus Toledo
Karim letzter lebender Templer, Eremit in der Wüste
Andrea Dandolo Doge der Lagunenstadt, letzter Doge, der in San Marco begraben wurde, war mit dem Dichter Petrarca befreundet und verfasste die Chronik der Republik Venedig bis 1280 (1306–1354).
Paolo Dandolo sein Sohn
Frank van der Velden Kaufmann, Vater von Isabella
Beatrice Fournier Schwester von Roger Fournier, dem Alchimisten
Die Burg wurde um 1300 von den Herren von Wildenberg erbaut. Im Laufe der Zeit wechselte die Burg mehrmals ihre Besitzer. Da sie ab dem 17. Jahrhundert unbewohnt blieb, zerfiel das Gemäuer allmählich. Heute ist die Burg Warthow eine Ruine.
Ulrich Walter v. Belmont Freiherr der Burg Warthow, verantwortlich für die Belmonter Fehde
Floribella von Sax seine Gemahlin
Pauli ein Knabe aus Rannes; nur dank seinem Scharfsinn konnte das Rätsel um das Grabtuch gelöst werden.
Hemma ein Walsermädchen aus den Bergen, Freundin von Pauli
Geoffroi de Charny Franz. Ritter und Herr von Lirey. Besitzer des Turiner Grabtuches (1300–1356), in der Schlacht von Maupertuis gefallen.
Jeanne de Vergy seine Gemahlin (1329–?)
Henri de Poitiers Bischof von Troyes, versucht mit allen Mitteln, das Grabtuch in seinen Besitz zu bringen.
Pierre Morerod Dekan der Stiftskirche in Lirey
Prolog
Ich, Geoffroi de Charny, Großpreceptor der Normandie, erkläre mich aller gegen mich erhobenen Vorwürfe, die da wären: Häresie, Sodomie und Ketzerei sowie Anstiftung zu blasphemischen Handlungen, für schuldig!«
Die Hand des Tempelritters zitterte, als er seine Unterschrift unter das Dokument setzte. Krampfhaft bemüht, seine Erregung vor den beiden Männern zu verbergen, hielt er den Kopf gesenkt.
»Es ist der einzige Weg, wenn Ihr Eure Familie vor dem Untergang retten wollt!« Gekleidet in eine unauffällige Reisekutte, trat Papst Clemens V. aus der Dunkelheit der Zelle und kam langsam auf den Tisch zu.
Geoffroi de Charny blickte auf. Seine Augen wirkten müde. Von dem einst so stolzen Ritter war nicht mehr viel übrig geblieben. »Euer Wort in Gottes Ohr«, hauchte er mit einer Stimme, der die Spuren von Folter und Qual anzuhören waren.
»Ich habe mich redlich um Eure Freilassung bemüht, das dürft Ihr mir glauben, doch König Philipp weicht nicht von seinem Urteil ab.« Der Papst drehte sich kurz um, nickte seinem Begleiter zu, ehe er sich wieder Geoffroi de Charny zuwandte. »Es ist nicht meine Schuld, dass so ausführlich über die Missstände in Euren Klosteranlagen berichtet wurde, und es ist auch nicht meine Schuld, dass diese Urkunden ausgerechnet König Philipp in die Hände gespielt wurden. Wir sind uns doch bewusst, dass in nahezu allen Klöstern zuweilen Dinge geschehen, die der Öffentlichkeit besser verborgen bleiben. Doch warum um Himmels willen musstet ihr Templer dies schriftlich machen? Hättet ihr euch darauf beschränkt, gottesfürchtige Pilger sicher ins Gelobte Land zu geleiten, wäre uns allen viel Leid erspart geblieben.« Der Papst schüttelte den Kopf.
Der Templer hatte den Worten des Papstes nur stumm gelauscht. Auf seinem Gesicht zeigte sich keinerlei Regung. Die Vorwürfe prallten an ihm ab wie Regentropfen auf trockenem Stein.
»Was hat es mit diesen sonderbaren Praktiken der Gotteslästerung auf sich, von denen König Philipp mir erzählt hat?«, fragte der Pontifex in die Stille, wobei er dem Templer auffordernd zunickte.
Papst Clemens V. wusste, dass er das Vertrauen Geoffroi de Charnys gewinnen musste, wollte er sein Ziel erreichen, und dies schaffte er nicht mit Tadel.
»Ihr sprecht von der Aufnahmezeremonie in den Orden, nehme ich an.« Der Templer stöhnte und rieb sich die Augen. »Keine große Sache, es lässt sich vergleichen mit den Praktiken im Heer. Werden dort nicht auch sonderbare Forderungen an die Neulinge gestellt?«
»Ihr weicht vom Thema ab.«
»Ein Anwärter muss Christus drei Mal verleugnen, dabei drei Mal auf das Abbild und das Kreuz spucken«, fuhr der Templer leise fort. »Verweigert er dies, wird er vom Preceptor gemaßregelt und ihm wird mit Kerkerhaft gedroht. Bleibt er trotzdem standhaft, ist ihm die Aufnahme in den Templerorden gewiss.«
»Großer Gott!« Der Pontifex tat, als höre er dies zum ersten Mal. Händeringend drehte er sich zu seinem Begleiter um. »Welche Blasphemie! Und was hat es mit der Verehrung des Baphometen auf sich?«, wandte er sich abermals an den Templer.
»Davon weiß ich nichts. Alles Lügen«, wehrte Geoffroi de Charny ab.
»König Philipp ist da anderer Ansicht. Die Anklageschrift gegen den Orden umfasst mehr als zweihundert Seiten und beschreibt Dinge, die ich kaum in den Mund zu nehmen wage.«
Papst Clemens schloss die Augen. Einem christlichen Orden stand es nicht an, Geldverleih zu betreiben, von Kreditbriefen gar nicht erst zu sprechen. Die Tempelhäuser im Osten waren zu Schatzkammern voller Gold und Silber verkommen.
»Würdet Ihr mir etwas Wasser besorgen?«, fragte Geoffroi de Charny mit heiserer Stimme. Offenbar kämpfte er gegen aufsteigende Übelkeit an.
Auf ein Zeichen des Papstes löste sich sein Begleiter aus der Dunkelheit und ging auf die Zellentür zu. Nachdem er dem Wächter den Befehl übertragen hatte, gesellte er sich an die Seite des Papstes. Die Unterredung hatte bislang den einzigen Zweck gehabt, das Vertrauen des Templers zu gewinnen. Der Preceptor war ein schlauer Fuchs, dies wusste der Pontifex aus der Vergangenheit.
»Ihr wolltet mir doch eine Gegenleistung für mein Geständnis anbieten.« Geoffroi de Charny rieb sich die Schläfen.
Papst Clemens warf seinem Begleiter einen verschwörerischen Blick zu, ehe er einen Schritt auf den Templer zumachte. »Ihr habt mein Wort, dass Eurer Familie kein Leid geschehen wird. Im Gegenzug verratet Ihr mir, wo sich der Schatz der Templer befindet.«
»Mein Geständnis und den Schatz, dies alles für eine Burg und ein paar Morgen Land. Ihr verlangt viel von mir.«
»Und das Leben Eurer Familie, das dürft Ihr nicht vergessen«, fügte der Pontifex salbungsvoll bei.
Die anschließende Stille lag schwer über der Zelle. Alles hing von den nächsten Minuten ab. Wenn der Orden der Templer nicht ausgelöscht wurde, drohte König Philipp mit der Kirchenspaltung. Längst waren nicht alle Templer gefangen genommen worden, und der Schatz würde ihnen einen Neuanfang ermöglichen. So weit durfte es nicht kommen.
»Unter dem Schatz der Templer befindet sich eine Schatulle aus Rosenholz«, nahm Geoffroi de Charny das Wort nach einer Ewigkeit wieder auf. »Sie enthält eine Reliquie. Wenn ich Euch verrate, wo sich der Schatz der Templer befindet, erhält meine Familie diese Schatulle. Gold und Silber für Euch, die Reliquie für meine Familie. Das ist meine Bedingung.«
Clemens V. sah sich am Ziel seiner Wünsche. Diese ominöse Schatulle konnte nur das Grabtuch Christi beinhalten. Gerüchte kursierten schon lange, dass die Templer im Besitz der heiligsten aller Reliquien wären. Sein Herz raste vor Aufregung. »Ihr wisst, dass König Philipp fortan ein Auge auf die Familien der Templer haben wird. Jeden ihrer Schritte wird er kontrollieren«, erwiderte er gespielt seufzend, wobei er seine Hände zum Gebet faltete. »Es wäre nicht klug, Eure Familie unnötig der Gefahr auszusetzen. Sollte König Philipp vom … von dem Grabtuch erfahren, dann kann ich für Eure Familie nicht mehr bürgen.«
»Ihr wisst von dem Grabtuch?« Die Skepsis in der Stimme des Templers war nicht zu überhören.
»Auch ich habe meine Quellen«, bemerkte Clemens mit einem Lächeln, »und zudem eine Lösung für dieses Problem.«
Hätte Geoffroi de Charny in diesem Augenblick nicht so verzweifelt auf seine Hände gestarrt, wäre ihm der Triumph in den Augen des Pontifex nicht entgangen.
»Ich schlage vor, das Grabtuch erst in fünfzig Jahren Eurer Familie zu übergeben, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. So lange bleibt es in den Händen der Kurie, bestens verborgen vor neugierigen Blicken.«
»Welche Gewissheit habe ich, dass Ihr Euer Wort haltet? Fünfzig Jahre sind eine lange Zeit, da kann viel geschehen.« Geoffroi de Charny blickte mit rot umränderten Augen auf die beiden Kleriker.
Statt einer Antwort zuckte der Papst lediglich mit den Schultern und wandte sich zu seinem Begleiter um.
»In einer Höhle in Jerusalem … findet Ihr den Schatz«, fuhr Geoffroi de Charny händeringend fort. Das Keuchen machte deutlich, wie schwer ihm die Worte fielen. »Gebt mir Pergament und Tinte, damit ich Euch einen Plan zeichnen kann.«
Als Clemens V. und sein Begleiter wenig später die Zelle verließen, trat der Kerkermeister mit einem Krug Wasser ein.
»Ihr wollt der Familie de Charny in fünfzig Jahren das Grabtuch überlassen?«, drangen die Worte des Papstbegleiters durch die offene Tür in die Zelle.
Der Wächter legte einen Finger auf die Lippen, während er den Templer zu sich herwinkte.
»Ich werde zu meinem Wort stehen, wenn auch nicht vollumfänglich«, entgegnete der Papst eben voller Hohn. »Soll der Templer ….« Der Rest der Worte wurde durch den Widerhall der sich entfernenden Schritte der beiden Kleriker aufgefressen.
»Ihr habt es mit eigenen Ohren gehört«, wandte sich der Kerkermeister an den Templer. »Papst Clemens wird uns verraten.«
»Ich hatte keine Wahl. Würde der Schatz Philipp in die Hände fallen, wäre er für immer verloren. So bleibt er wenigstens im Besitz der Kirche. Und wenn unsere Männer das Unmögliche fertigbringen und dem Orden zu neuer Blüte verhelfen, werden sie wissen, wo sich der Schatz befindet.« Der Preceptor klopfte seinem Gegenüber aufmunternd auf die Schulter. »So schwer es Euch auch fällt, Bruder, Ihr müsst Euch still verhalten. Wenn sie herausfinden, dass auch Ihr ein Mitglied des Ordens seid, ist Euer Leben keinen Pfifferling wert, und der Orden braucht Männer in Freiheit.« Geoffroi de Charny blickte nachdenklich auf den Mann vor ihm, dessen Finger sich krampfhaft um den Wasserkrug krallten. »Besorgt mir ein neues Stück Pergament, damit ich einen Brief an meine Familie verfassen kann.«
Zwei Monate später saß Papst Clemens V. in den Privatgemächern im Papstpalast von Avignon und starrte auf das ausgebreitete Leinentuch zu seinen Füßen. Seit Stunden hatte er weder gegessen noch getrunken, zu sehr hatte ihn der Anblick der Reliquie aufgewühlt. Bis heute hatte er geglaubt, lediglich eine originalgetreue Kopie in Auftrag geben zu müssen, die der Familie de Charny im Jahre 1359 überreicht werden sollte. Doch das, was sich jetzt seinen Augen offenbarte, überstieg seine schlimmsten Albträume. Der menschliche Abdruck, der sich auf dem Leinen abzeichnete, zeigte … Nein, niemals durfte die Menschheit erfahren, welches Geheimnis das Grabtuch barg. Die Kirche würde in ihren Grundfesten erschüttert werden. Recht und Ordnung würden nicht mehr aufrechterhalten werden können.
Geoffroi de Charny hatte bis zum Ende geschwiegen. Selbst als er zusammen mit Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war, war kein Wort über seine Lippen gekommen. Insgeheim bewunderte er den Mann dafür, denn die Christenheit wäre all ihrer Werte beraubt, die Kirche mit einem Schlag ausgelöscht, sollte die grausame Wahrheit je das Licht der Welt erblicken. Nicht auszudenken, wenn das Grabtuch König Philipp in die Hände gefallen wäre!
Clemens V. erhob sich schwerfällig von seinem Sessel und ging auf eines der Fenster zu, das zum Innenhof des Palastes führte. Seine Tage waren gezählt, er spürte es mit jeder Faser seines Körpers, und er war darüber keineswegs traurig. Das Jahr 1359 lag in weiter Ferne, sollten sich seine Nachfolger die Köpfe darüber zerbrechen, wie die Christenheit vor ihrem Untergang bewahrt werden konnte, er würde bis dahin längst seinen Frieden mit Gott gemacht haben.
1. Kapitel
Dunkel und unheilvoll türmten sich die Wolkenberge am fernen Horizont. Nicht mehr lange, und Wind und Regen würden mit aller Härte über die Berghänge peitschen. Der Winter war nicht mehr fern.
Seit Stunden saßen sich die beiden Männer im Rittersaal gegenüber, vertieft in ein heftiges Wortgefecht. Langsam kroch die Dämmerung durch die Staffelfenster und ließ ihre Mienen im Schattenspiel der Fackeln beinahe verschwinden. Sie waren sich nicht einig, auch wenn der Widerstand des jungen Mannes allmählich schwand, was ein wohlwollendes Lächeln auf das Antlitz seines Vaters zauberte.
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg konnte sich des Stolzes nicht erwehren, wenn er seinen Sohn betrachtete. In achtzehn Jahren war aus dem einst schwächlichen Kind ein Mann gereift, der jeden Feind in die Flucht schlug und Frauenherzen magisch anzog. Das Lederwams spannte sich über seinen Oberarmen und ließ die darunterliegende Muskelkraft erkennen. Er konnte es den Weibsbildern nicht verübeln, dass sie danach gierten, in diesen Armen zu liegen und sich vom Blick der türkisblauen Augen verzaubern zu lassen. Insgeheim war er froh, dass er seinen Sohn nicht nur in Astronomie, Latein und griechischer Mythologie unterrichten ließ, sondern den schwarz gelockten Adonis auch der Obhut seines Stallmeisters unterstellt hatte, der aus ihm einen Meister der Reit- und Waffenkunst gemacht hatte.
»Diese Verbindung wird uns den langersehnten Frieden bringen«, säuselte der Graf mit siegessicherer Miene, wobei er sich in seinem Sessel zurücklehnte. »Und wenn du es geschickt anstellst, wird deine zukünftige Gemahlin schon in der Hochzeitsnacht mit einer Leibesfrucht gesegnet sein, was dir weitere unliebsame Nächte an ihrer Seite ersparen wird.«
Das Murren des jungen Albrecht hatte an Kraft verloren. »Dein Wort in Gottes Ohr. Der Gedanke, mich jede Nacht mit der Montforterin abzuplagen, behagt mir nämlich gar nicht.«
»Auch Liebesehen taugen nichts, bringen nur Unglück und Verdruss«, konterte sein Vater, wobei sein Blick unmerklich zur Decke wanderte. Das Zucken der Mundwinkel verriet die Anspannung, während ein wehmütiger Ausdruck in seinen Augen lag. Er hatte den Rückzug seiner Gemahlin in die Dachkammer nie überwunden. Dass seine Katharina das Leben einer Eremitin seiner Gegenwart vorzog, schmerzte ihn.
»Dann sind wir uns einig?«, fragte er, während er seine Erinnerungen mit unwirscher Geste abtat und sich stöhnend von seinem Hocker erhob. Den Rücken mit einer Hand stützend, ging er auf den Kamin zu. Das Zipperlein machte sich unbarmherzig bemerkbar. »Morgen ist ein guter Tag, um auf die Burg Montfort zu reiten. Nicht mehr lange, und die Winterstürme fegen durch das Tal. Wenn man den Wetterpropheten glauben kann, wird es auch bald schneien.«
In diesem Augenblick prasselten die ersten Regentropfen gegen die Butzenscheiben. Der Graf drehte den Kopf. Die Ehe mit der Montforterin würden die unsäglichen Fehden endlich beenden, davon war er überzeugt.
»Du weißt, dass mein Vetter Wilhelm dazu neigt, seine Entschlüsse schneller zu ändern, als ein Blitz am Horizont erscheint. Also nutzen wir die Gunst der Stunde«, fuhr er fort. »Erst wenn Friede herrscht, werden wir in der Lage sein, Veltkirchen den Rang abzulaufen, schließlich liegt auch Werdenberg auf dem Weg zum Septimerpass.«
Der Grafensohn nickte. Während das ferne Bregenz mit Buchhorn im Wettstreit lag, waren es hier im Rhyntal Veltkirchen und Werdenberg, die um die Gunst der Kaufleute buhlten.
Anderntags, die morgendliche Dämmerung hatte die Schatten der Nacht kaum besiegt, standen die Banner der Werdenberger steif im Wind. Das Unwetter der vergangenen Nacht hatte eine unangenehme Kälte über das Tal gelegt. Vasallen und Söldner saßen auf ihren Pferden und gierten dem Ritt auf die Burg Montfort entgegen, beobachtet von den neugierigen Blicken des Gesindes.
Die Burg Werdenberg mit ihrem dreistöckigen Palas und dem mit Zinnen bewehrten Turm zeichnete sich dunkel gegen den Morgenhimmel ab, als der Graf und sein Sohn die Stufen herabschritten.
»Glaubst du, der junge Herr Albrecht wird dort eine Braut finden?«, flüsterte eine der Mägde aufgeregt, wobei sie den Hals reckte, um einen Blick auf die kostbaren Gewänder ihrer Herren werfen zu können. »Die Montforter sollen es wild treiben, hat mir ein Händler erzählt, womöglich gilt dies auch für die Weibsbilder«, fügte sie mit einem Grinsen hinzu.
»Unser Albrecht wird sie schon zähmen«, ereiferte sich die dralle Magd an ihrer Seite und verdrehte die Augen.
»Womöglich gefällt ihm gerade diese Wildheit, williges Fleisch hat er ja zur Genüge«, mischte sich eine der älteren Mägde barsch in die Unterhaltung, während sie den beiden Frauen einen tadelnden Blick zuwarf.
»Wollt ihr wohl still sein!« Wie aus dem Nichts tauchte die Köchin hinter den drei Frauen auf. »Wenn ich noch ein Wort höre, werdet ihr alle heute Abend auf das Nachtmahl verzichten.«
Die Mägde verstummten augenblicklich. Regina vertrug keinen Spaß, schon gar nicht, seit sie die Frucht der Liebe unter dem Herzen trug. Als Frau des Stallmeisters schwang sie ein strenges Zepter in der Küche. Und mit Hunger schlief es sich schlecht, das wussten sie alle.
»Träumst du schon mit offenen Augen?« Lachend trat der Stallmeister an die Seite seiner Frau.
»Die alte Adelheid beobachtet uns«, flüsterte Regina mit bewegungslosen Lippen, wobei sie mit dem Kinn in Richtung der Dachkammer zeigte. »Sie ist eine Hexe. Ihre Bösartigkeit wird uns eines Tages einholen, glaub mir, Hannes.«
»Du siehst Gespenster, Frau. Die alte Zofe sollte dir leidtun. Seit Jahren zusammen mit der Gräfin dort oben im Turm zu hausen ist bestimmt nicht einfach.« Schnell drückte er ihr einen Kuss auf die Stirn, um ihren Unmut zu vertreiben.
»Glaubst du, es ist etwas Wahres an der Geschichte um ihre Herkunft?«, fragte Regina bereits eine Spur versöhnlicher.
»Ich denke nicht. Der Vater unseres alten Grafen war bestimmt kein Heiliger, doch dass er es mit Adelheids Mutter getrieben haben soll, erachte ich als plumpe Lüge.«
»Vermutlich hast du recht, auch wenn ich bezweifle, dass Adelheid es genauso sieht. Sind die beiden Grafen nämlich nicht auf der Burg, tyrannisiert sie uns in der Küche mit ihrer angeblich so hochnoblen Geburt. Eines Tages würde sie die Herrin der Burg sein, hat sie erst letzte Woche herausposaunt.« Regina verdrehte die Augen.
»Da siehst du es, sie ist verrückt, und jetzt denk an etwas anderes. Ich werde drüben bei den Ställen gebraucht.«
Regina sah ihm nach, wie er mit langen Schritten in Richtung der Ställe verschwand, ehe sie die Augen schloss und hart schluckte.
Ihr Unbehagen ließ sich jedoch nicht so leicht vertreiben, als sie an ihre Vorgängerin dachte, die eines Morgens mit blau gefärbter Zunge und weit aufgerissenen Augen in der Burgküche gefunden worden war. Das hämische Grinsen der alten Adelheid war ihr noch in bester Erinnerung. Von Tollkirschen oder Fingerhut hatte der Medicus gesprochen, und der Schultheiß und seine Büttel hatten eine harte Befragung durchgeführt. Natürlich fand sich unter dem Gesinde niemand, der der alten Köchin Böses wollte, warum auch, die Frau war bei allen beliebt. Lediglich mit der alten Adelheid hatte die Arme Querelen gehabt, doch als Zofe der Gräfin war diese über jeden Verdacht erhaben. Zudem hatte Adelheid betont, dass sie selbst aus gutem Hause stamme und sich nicht mit Gesinde abgebe. Der Schultheiß hatte ihr ohne eine Spur von Zweifel geglaubt, und die Suche nach der Giftmörderin war im Sand verlaufen. Regina versuchte, den aufkeimenden Ärger zu unterdrücken, doch so ganz gelang ihr dies nicht. Sie drehte sich um und bahnte sich einen Weg durch die gaffende Mägdeschar.
Hinter ihrem Rücken stieg der Grafensohn eben auf seinen Rappen, den Blick auf die Turmkammer gerichtet. Ein wehmütiger Zug lag um seine Mundwinkel, als er das schwarze Tuch vor dem Fenster bemerkte. Dahinter lag seine Mutter, die weder Anteil am Leben auf der Burg noch an ihm nahm. Das Fragen nach dem Warum hatte er längst aufgegeben. Dass er seine Verbitterung doch noch hatte überwinden können, verdankte er seinem damaligen Lehrer, einem Mönch aus dem Gefolge des Bischofs von Curia. Die Wehmut auf seinem Gesicht gebührte nicht seiner Mutter, sondern ebenjenem Mann, der ihm Lesen und Schreiben beigebracht hatte. Vor gut vier Wochen war er an das Sterbebett des Mannes gerufen worden. Die Wangen hohl, der Körper durch Krankheit und Entbehrung ausgemergelt, hatte er den Gelehrten kaum wiedererkannt. Mit dem Aufbäumen seiner letzten Kräfte hatte Bruder Franziskus ihm ein Astrolabium und einen Codex in die Hand gedrückt. Noch heute hörte er die Stimme des alten Mannes, die ihn krächzend bat, diese beiden Dinge vor fremden Augen zu schützen. Ein Geheimnis sollten sie enthalten, ein Geheimnis, das die Menschheit erschüttern würde. Er hatte Franziskus schwören müssen, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, das Geheimnis zu entschlüsseln und dann zu gegebener Zeit die richtigen Schritte einzuleiten.
Allerdings konnte er sich nur schwer vorstellen, was an einem scheibenförmigen Sternenmesser so brisant sein konnte. Sicher, es war aus purem Gold gearbeitet und mit unzähligen orientalischen Gravuren verziert, doch ein Geheimnis sah er keines. Dem Wunsch eines Sterbenden allerdings sollte man nachgeben. Also hatte er die beiden Geschenke vorerst in einer Truhe auf der Burg versteckt.
Das Wiehern seines Pferdes riss den Grafensohn aus den Gedanken. Der Tross drängte zum Aufbruch. Der Bariton seines Vaters hallte über den Burghof. Mit über dreißig Vasallen, Söldnern und ebenso vielen Knappen, Wagen und Pferden bot die Kavalkade ein prächtiges Bild. Die Brautschau konnte beginnen. Begleitet vom Lachen und Rufen der Zurückgebliebenen trieb der Tross durch das Burgtor. Der Tag erwachte zum Leben.
Sie nahmen die Furt bei Bendur, anschließend umrundeten sie Veltkirchen in weitem Bogen. Ihre Befürchtung, in einen Hinterhalt zu geraten, hatte sich bislang nicht bestätigt. Zwar zeigte sich auf den Mienen der Menschen, die ihren Weg kreuzten, Skepsis und Misstrauen, doch dies konnte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Erinnerung an die letzte Fehde noch gegenwärtig war.
Graf Albrecht und sein Sohn ritten an vorderster Front. Lediglich Petar, der Dienstälteste unter den Vasallen, ritt eine Pferdelänge vor seinen Herren. Während seine linke Hand die Zügel fest im Griff hielten, drehte er mit seiner Rechten das Banner stets so in den Wind, dass das Hoheitszeichen bis weit hinter die nächste Hügelkette zu sehen war.
Der junge Albrecht gab sich wortkarg. Seit Stunden versuchte er, sich mit dem Gedanken an die bevorstehende Vermählung anzufreunden. Insgeheim hoffte er aber, dass bereits ein Junker um die Montforter Tochter freite und er sich vielleicht doch noch eine der Töchter des Grafen von Toggenburg ins Bett holen konnte.
»Mein Vetter scheint eine Vorliebe für Flachs zu haben.« Mit ausgestrecktem Arm wies Graf Albrecht auf die von der Sonne golden gefärbten Felder. »Eine harte Arbeit mit Sichel und Raufe, die allerdings eine stattliche Anzahl Gold- und Silbermünzen einbringt. Die Händler am Bodensee reißen sich um den Flachs, denn die Konstanzer Leinwand ist bis in die Lombardei begehrt.«
Sein Sohn zuckte mit den Achseln. All dies interessierte ihn im Augenblick herzlich wenig.
Mit den letzten Sonnenstrahlen im Rücken erreichten sie den Weiler Klus am Fuße der Burg Montfort. Inmitten der herumlungernden Hunde und entlaufenen Schweine schafften sie es kaum, die Schlachtrosse sicher durch die lichtlosen Gassen zu leiten, zumal immer wieder Mägde kreischend herbeieilten, um die Tiere einzufangen. Erleichtert, der Enge des Dorfes schließlich entkommen zu sein, folgten sie dem steilen Weg hinauf zur Burg.
Als die Trutzburg mit den drei Wehrtürmen wie aus dem Nichts auftauchte, entlockte dies so manchem Werdenberger einen erstaunten Ausruf. Von den bis an die Zähne bewaffneten Kriegern oben auf den Zinnen beobachtet, ritt der Tross durch das Burgtor. Eine Gruppe Mägde am Brunnen hatte ihr Getuschel eingestellt und starrte den Neuankömmlingen mit neugierigen Mienen entgegen. Auf ein Handzeichen des Grafen stiegen die Männer aus ihren Sätteln. In diesem Augenblick schwang die schwere Eichentür der Burg auf, und Graf Wilhelm erschien unter dem Portal. Flankiert von zwei Vasallen stieg er die Treppenstufen herab und kam mit festem Schritt auf seine Besucher zu.
»Werter Vetter, welche Ehre!«, hallte seine Stimme über den Burghof.
»Ganz meinerseits«, erwiderte Graf Albrecht ebenso laut wie sein Vetter. »Eindrücklich, Euer Empfang.« Dabei wies er mit schräg gestelltem Kopf auf die Zinnen.
»Schwierige Zeiten, man muss auf alles gefasst sein. Aber das muss ich Euch ja nicht sagen.«
Mit Genugtuung nahm Graf Wilhelm den Eindruck wahr, den er auf die Männer seines Vetters machte. Er fuhr sich durch die blonde Lockenmähne, wobei er die Hand so drehte, dass das Funkeln seiner Goldringe niemandem entging.
»Für Eure Männer wird in der Burgküche gesorgt werden. Doch jetzt folgt mir in die Burg. Hier draußen wird es allmählich ungemütlich.« Graf Wilhelm lachte, wobei er seinem Vetter einen Arm um die Schulter legte. »Mein Magen knurrt wie ein Wolf nach dem Winterschlaf. Ich nehme doch an, die Reise hat auch Euch hungrig gemacht.« Wilhelm von Montfort-Tettnang genoss seinen Auftritt in vollen Zügen.
Die Burg verfügte nicht nur über drei Flankierungstürme, wie erst angenommen, sie besaß sogar deren fünf, und alle waren sie mit hölzernen Wehrgängen verbunden. Argwohn und Neugier lagen auf den Mienen der diensttuenden Krieger, die die Besucher mit Argusaugen beobachteten.
Das Innere der Burg unterschied sich kaum von dem der Werdenberg, sah man vom Dreck und Unrat ab, den die frei herumlaufenden Schweine im untersten Stockwerk hinterließen. Erst ein Stockwerk höher zeigte sich der viel gerühmte Reichtum der Montforter. Mit Gold- und Silberfäden verzierte Gobelins schmückten jede freie Lücke zwischen den Ahnenportraits, die allesamt finster dreinblickende Männer in gesetztem Alter zeigten, darunter standen Zedernholztruhen und Waffenvitrinen.
»Tretet ein, meine Freunde. Das Nachtmahl ist gerichtet. Es soll Euren Gaumen verwöhnen und Eure Sinne betören, so Gott will«, trompetete Wilhelm voller Inbrunst, wobei er die Tür zum Rittersaal mit Schwung aufstieß. Die anwesenden Gäste an der Tafel hoben erschrocken ihre Köpfe. »Euer Besuch kommt gerade recht«, wandte sich Graf Wilhelm mit einem Augenzwinkern an seinen Vetter. »Morgen beginnt die Herbstjagd, weshalb ich die treffsichersten Schützen eingeladen habe.«
Lachend wies Graf Wilhelm auf die beiden freien Plätze in unmittelbarer Nähe des Kamins, während er selber auf die Stirnseite der großen Tafel zuschritt. Die Hitze des Feuers und der beißende Rauch machten schnell klar, warum genau diese Plätze frei geblieben waren. Während die Mägde alle Hände voll zu tun hatten, die Becher der Gäste mit Wein zu füllen, verfielen die beiden Werdenberger immer mehr in Schweigen.
»Ihr schlaft mir doch nicht etwa ein, werter Vetter? Ich zähle auf Euch bei der morgigen Jagd, oder wollt Ihr den Tag in Gesellschaft meiner Gemahlin verbringen?«, rief Graf Wilhelm über die Tafel hinweg, wobei er seinen Weinbecher schwang.
Das zustimmende Hüsteln und die verschmitzten Blicke der anwesenden Gäste machten deutlich, dass ihnen der Spott in der Stimme ihres Gastgebers nicht entgangen war.
Allein der Gedanke an Kunigunde von Rappoltstein trieb Graf Albrecht Schweißperlen auf die Stirn. Mit Schaudern dachte er an seine eigene Brautschau zurück. Damals befand sich die Rappoltsteinerin unter den Brautjungfern, die seine Katharina wie Motten umschwärmten. In einer unbedarften Sekunde hatte er sich abfällig über Kunigunde geäußert, sie sogar eine hässliche Kröte genannt. Zu seinem Leidwesen waren seine Worte in die Kammer der Rappoltsteinerin vorgedrungen und dort nicht auf Wohlwollen gestoßen. Beinahe wäre seine Vermählung mit Katharina deswegen geplatzt.
Auch wenn sein Rücken nach den heutigen Strapazen brannte wie Feuer und seine Fingerknöchel dick aufgeschwollen waren, den Tag in Gesellschaft der Montforterin zu verbringen war deshalb schlimmer als alles, was er sich vorstellen konnte.
»Es ist mir eine Freude, werte Gräfin, Euch bei bester Gesundheit anzutreffen«, heuchelte Graf Albrecht mit galanter Geste.
Die Frau saß ihm gegenüber und musterte ihn stumm. Das Zucken der Mundwinkel verriet ihre Anspannung. Zu mehr als einem Nicken gab sie sich nicht hin.
»Gott steh mir bei«, raunte der Grafensohn seinem Vater zu. »Wenn die Tochter nach der Mutter schlägt, werde ich die Schlafkammer auf der Werdenberg nur selten sehen. Dieses Weibsbild ist ja eine Ausgeburt an Hässlichkeit.«
In diesem Augenblick öffneten sich die Türen, und an die zehn Mägde mit dampfenden Schüsseln traten ein. Im Nu füllte sich die Tafel mit geräucherten Seefischen, Hühnerpasteten, Teigtaschen mit Speck und Äpfeln, knusprigem Hirschbraten und verführerisch duftendem Wildbret. Lautstarkes Schmatzen und Rülpsen ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Innerhalb kürzester Zeit glich die Tafel einem Schlachtfeld, was Graf Wilhelm nicht daran hinderte, die Mägde mit weiteren Wünschen auf Trab zu halten.
»Vielleicht sollten wir uns unauffällig zurückziehen. Wir könnten uns ja auf den beschwerlichen Ritt berufen«, flüsterte Albrecht hinter vorgehaltener Hand, da ihm die Qual seines Vaters nicht entging.
»Wir werden bleiben, auch wenn ich hier fast ersticke.« Ein Husten unterdrückend, beugte sich Graf Albrecht nach vorne. »Siehst du die zwei Knaben am Tischende?«, fragte er in Richtung seines Sohnes. »Wenn ich mich nicht täusche, handelt es sich um die Söhne Wilhelm und Heinrich.«
»Mich würde eigentlich mehr eine Tochter interessieren«, bemerkte sein Sohn spöttisch. »Die Damen an Kunigundes Seite dürften wohl kaum Töchter von Wilhelm sein.«
»Ich denke, damit hast du recht, obwohl Wilhelm seine Manneskraft nur zu gerne unter Beweis stellt. Soviel mir bekannt ist, hat Wilhelm aber tatsächlich nur eine Tochter, und die kann ich nirgends entdecken.«
Das Gelage schien kein Ende zu nehmen. Kurz vor Mitternacht trug das Gesinde erneut Platten voller Honig- und Aniskuchen, Brezeln und Nüsse herein. Manch einer der Gäste hatte sich längst der Müdigkeit ergeben und gab ein Schnarchen von sich. Einzig Graf Wilhelm schien noch in Höchstform und unterhielt die Gäste mit Gesang. Dann endlich, irgendwann zwischen Mitternacht und Dämmerung, schien auch Wilhelm ein Einsehen zu haben und löste die Tafelrunde mit einem Grunzen auf.
Tags darauf stand die Sonne bereits hoch, als der Grafensohn durch ein Klopfen geweckt wurde. Der schwere Wein war ihm nicht bekommen. Sein Schädel brummte.
»Entschuldigt, Herr, ich bringe das ausgebürstete Gewand zurück«, wisperte die Magd verlegen. »Gräfin Kunigunde lässt Euch ausrichten, das Morgenmahl sei schon … längst gerichtet.«
»Schläft mein Vater noch?«
»Nein, mein Herr. Euer Vater ist heute, zu früher Morgenstunde, mit Graf Wilhelm und seinen Getreuen zur Jagd aufgebrochen. Ihre Rückkehr wird erst am späten Nachmittag erwartet.«
Die Magd legte das Gewand über einen Stuhl, ehe sie einen Knicks machte und die Kammer mit hochrotem Kopf verließ. Noble Herren in Leinenhemden zu sehen, das war ihr wohl nicht allzu oft untergekommen.
Bereits den ersten Morgen zu verschlafen warf wahrlich kein gutes Licht auf ihn angesichts der bevorstehenden Brautschau. Hastig schlüpfte der Grafensohn in seine Kleider. Auf der Treppe begegneten ihm lediglich zwei Diener, die ihn mit einem diskreten Kopfnicken bedachten. Aus der Burgküche drang erregtes Stimmengemurmel und das Klimpern von Töpfen. Trotz des knurrenden Magens mied der Grafensohn die Küche und suchte sich stattdessen den Weg nach draußen. Langsam schlenderte er auf den Brunnen zu in der Hoffnung, eine Schöpfkelle vorzufinden, um den galligen Geschmack in seinem Mund loszuwerden. Er hatte kaum den ersten Schluck genommen, als zwei Mägde mit Bottichen auf ihn zukamen. Da sein Schädel noch immer brummte, verspürte er wenig Lust, sich in eine Unterhaltung verstricken zu lassen. Er drehte sich um und ging in Richtung der Pferdeställe. Bei seinem Eintreten wirbelten Myriaden von Staubpartikeln durch die Luft.
»Warum seid Ihr nicht auf der Jagd?« Hinter einem der Pferderücken tauchte ein schlaksiger Junge auf und blickte finster in Richtung des Grafensohnes.
»Du bist Wilhelm, nicht wahr?«, fragte Albrecht statt einer Antwort. »Herrliche Tiere habt ihr hier.«
»Allesamt aus bester Zucht. Wir auf der Montfort haben nur gute Pferde. Mein Vater …«
Der Grafensohn winkte ab. Eine fadenscheinige Ausrede murmelnd, ließ er den prahlerischen Wilhelm hinter seinem Rücken zurück.
Die nächsten Stunden verbrachte Albrecht in seiner Kammer. Als in der Burgküche endlich Ruhe eingekehrt war, gönnte er sich ein kurzes Mahl, ehe er sich einen Sitzplatz unter der Burglinde suchte. Allmählich verschwand die Sonne hinter den Bergen. Schlagartig kehrte die Kälte zurück. Albrecht überlegte eben, wie er den Rest der Zeit vertreiben sollte, als der Boden unter seinen Füßen zu beben begann. Der Jagdtross trieb eine Wolke aus Schweiß und Erregung vor sich her, er konnte es riechen, lange bevor er die Männer sah.
»Bringt die Beute in die Burgküche!«, rief Graf Wilhelm euphorisch seinen Mägden zu, die plötzlich aus allen Türen strömten. Nicht nur Fasane und Hasen zählten zur Beute, auch drei Wildschweine und zwei Hirsche hatten sich den Gelüsten der gräflichen Jagdgesellschaft beugen müssen.
»Nun, Vetter, die Jagd scheint wohl nicht so ganz Eurer Verfassung entsprochen zu haben.« Heftiges Lachen quittierte den Spott, den Graf Wilhelms Worte auslöste. »Ihr solltet Euch ausruhen, ehe wir uns zum festlichen Mahl im Rittersaal versammeln.« Graf Wilhelm streifte sich seine Lederhandschuhe von den Händen und tätschelte seinen Rappen.
Graf Albrecht biss die Zähne zusammen und ließ sich aus dem Sattel gleiten. Es schien keinen Muskel und keinen Knochen an seinem Körper zu geben, der nicht vor Schmerz brannte. Hastig trat der Grafensohn an die Seite seines Vaters.
»Warum lässt du dir dies gefallen?«, zischte Albrecht wütend und bedachte Graf Wilhelm mit bitterbösem Blick.
Statt einer Antwort wehrte sein Vater mit einer Handbewegung ab. »Zwist und Gehässigkeiten bringen uns nicht weiter. Wir werden jetzt auf unsere Kammer gehen und tun, was Wilhelm gesagt hat.«
Im oberen Stockwerk angelangt, setzte sich Albrecht auf einen Hocker und betrachtete mit Skepsis, wie sein Vater mit geschwollenen Fingergelenken versuchte, die Hornknöpfe seines Hemdes zu öffnen.
»Ich lege keinen Wert darauf, länger auf der Montfort zu bleiben«, machte der Grafensohn seinem Unmut Luft. »Dein Vetter scheint die Demütigungen zu genießen.«
»Damit triffst du den Nagel auf den Kopf. Und doch werden wir bleiben, zu viel steht auf dem Spiel.«
»Ich hatte heute Gelegenheit, die Ställe zu besichtigen«, bemerkte Albrecht trocken. »Dabei habe ich nicht nur die Bekanntschaft des widerlichen Wilhelm gemacht, sondern auch die Pferde in den Boxen gesehen. Graf Wilhelm hätte es nicht nötig, mit uns ein Bündnis einzugehen.«
»Wilhelms Reichtum ist nicht von der Hand zu weisen, und deswegen müsste er auch keine Verbindung mit uns eingehen«, erwiderte sein Vater. »Aber es ist noch keine zwanzig Jahre her, da hat Herzog Leopold, Gott habe ihn selig, die Stadt Tettnang gebrandschatzt. Die Warnung des Habsburgers war unmissverständlich, und seine Enkel stehen ihm da in keiner Weise nach. Noch nie war Wilhelm so auf Bündnispartner angewiesen wie jetzt.«
Die Erklärungsversuche seines Vaters entlockten Albrecht lediglich ein Knurren.
Das Nachtmahl schien auch an diesem Abend kein Ende zu nehmen. Graf Wilhelm genoss es, jede noch so kleinste Begebenheit der Jagd lautstark in Erinnerung zu rufen. Das Feuer im Kamin war mittlerweile heruntergebrannt. Die Kälte der Nacht kroch langsam, aber sicher durch das Gemäuer und lähmte die Stimmung. Dann endlich erklärte Graf Wilhelm das Gelage für beendet. Kunigunde von Rappoltstein erhob sich sichtlich erleichtert von ihrem Stuhl und folgte den Gästen, die allesamt der Tür entgegendrängten.
»Ich habe mir das Bündnis durch den Kopf gehen lassen«, rief Graf Wilhelm in Richtung der beiden Werdenberger, die sich ebenfalls erhoben hatten und Anstalten machten, den Saal zu verlassen.
»Die Verbindung bringt uns Frieden«, erwiderte Graf Albrecht müde, aber voller Hoffnung. »Die sinnlosen Fehden nützen nur unseren Feinden.«
»Eine Verbindung zwischen Eurem Sohn«, hier nickte Wilhelm kurz in Richtung des Werdenberger Grafensohnes, »und … meiner Tochter, ein guter Einfall.«
»Eurer legitimen Tochter, sie ist kein Bastard«, bemerkte Graf Albrecht schnell, da ihm das Zögern seines Vetters nicht entgangen war.
»Seid unbesorgt, bei Mechthild handelt es sich unbestritten um das Ergebnis der Ehe zwischen mir und Kunigunde.« Wilhelm lachte mit einem Anflug von Zynismus.
Minutenlang sprach keiner der Männer ein Wort. Während sich auf Wilhelms Antlitz ein wohlwollendes Lächeln abzeichnete, kämpfte der Grafensohn mit Widerwillen gegen den Gedanken, womöglich ein Ebenbild von Kunigunde ehelichen zu müssen. Die zwei Jagdhunde vor dem Kamin hoben kurz die Köpfe angesichts der plötzlichen Stille, ehe sie sich mit einem Seufzer wieder ihrem Schlaf ergaben.
»Richte meiner Gemahlin aus, sie soll Mechthild herbringen!«, wandte sich Graf Wilhelm barsch an den Diener im Hintergrund. Der Mann verschwand einem flüchtenden Reh gleich durch die Seitentür.
»In drei Tagen werde ich beim Grafen von Thüringen erwartet«, sprach Wilhelm weiter. »Es wäre somit auch in meinem Sinne, die Verbindung so schnell wie möglich zu besiegeln.«
Graf Albrecht bekundete seine Einwilligung mit einem Nicken. Das Warten zog sich in die Länge. Einmal huschte eine der Mägde herein und schürte das Feuer erneut, während sich die drei Männer in Schweigen hüllten. Als sich die Seitentür endlich öffnete, gab Graf Wilhelm ein Brummen von sich. Gräfin Kunigunde schob ihre Tochter in den Schein einer Fackel. Viel konnte man von der jungen Frau unter dem Seidenschleier allerdings nicht erkennen, lediglich Mechthilds dralle Brüste zeichneten sich unter ihrem Kleid ab.
»Eurer Mechthild scheint es an Liebreiz nicht zu fehlen«, sprach Graf Albrecht mit hörbarer Erleichterung in der Stimme. »Auch wir wären für eine rasche Vermählung. Und ich kann Euch versichern, werter Vetter, Eurer Tochter wird es auf der Burg Werdenberg an nichts mangeln, dafür gebe ich Euch mein Wort.«
Gräfin Kunigunde hielt sich mit Worten zurück. Lediglich das Zucken ihrer Mundwinkel verriet, dass sie mit den Plänen ihres Gemahls nicht einverstanden war. Sie kannte den Grafen der Werdenberg seit frühester Kindheit, seine schneidenden Worte, die er hinter ihrem Rücken stets höhnisch von sich gegeben hatte, waren ihr damals nicht verborgen geblieben. Aus ihrer Abneigung gegen den Grafen machte sie kein Geheimnis.
Als Wilhelm Mutter und Tochter wenig später wie lästige Insekten hinausscheuchte, bedachte die Gräfin die Werdenberger mit wütendem Blick.
»Dann werde ich also noch diese Nacht alles in die Wege leiten«, wandte sich Graf Wilhelm wieder an seine beiden Gäste. »Wir halten die Zeremonie hier klein. Die kirchliche Trauung im Beisein des Bischofs kann auf der Werdenberg stattfinden.« Mit einem selbstgefälligen Lächeln auf den Lippen entließ Graf Wilhelm seine Gäste.
Anderntags erschien der Notar noch vor Sonnenaufgang mit den Verträgen in den Kammern der Werdenberger Grafen. Nach eingehendem Studium aller Vereinbarungen und Abwägung allen Nutzens waren sich Graf Albrecht und sein Sohn einig. Der Verbindung mit dem Hause Montfort stand nichts mehr im Wege.
Im Gerichtssaal herrschte eine eigentümliche Stille, als Mechthild in Begleitung ihrer Mutter eintrat. Auf den Schleier hatte man dieses Mal verzichtet. Die weizenblonden Haare zu dicken Zöpfen geflochten, stand die junge Frau da. Die Augen starr zu Boden gerichtet, ließ sie alles mit stoischer Gelassenheit über sich ergehen. Selbst als das Bündnis zur Unterzeichnung kam, gab sie keinen Laut von sich. Die ganze Szenerie hatte etwas Bizarres, und doch war man auf beiden Seiten froh, als das Siegel auf der Urkunde prangte.
Am darauffolgenden Tag verließ der Tross der Werdenberger die Burg Montfort. Dichte Nebelschwaden verdeckten die Sicht. Sie mussten langsam reiten, denn auch den Schlachtrossen gefiel die eigentümliche Stimmung nicht, die der Nebel mit sich brachte. Die beiden Werdenberger ritten schweigend Seite an Seite. Die Ereignisse des gestrigen Tages hingen wie das Schwert des Damokles über ihren Köpfen. Die Vertragsunterzeichnung war zu glatt gegangen, die Einwilligung Graf Wilhelms zu schnell gekommen. Normalerweise stellte Wilhelm Forderungen, pickte sich in Verträgen stets die Rosinen heraus, damit ihm alles zum Vorteil gereichte. Die beiden Werdenberger wurden das Gefühl nicht los, dass an der Sache etwas faul war, doch sie konnten nicht sagen, was.
Stunden später passierte der Werdenberger Tross ein kleines Waldstück. Es roch nach feuchter Erde und verschimmeltem Laub. Irgendwo im Geäst schrie eine Eule, woraufhin ein Schwarm Raben fluchtartig das Weite suchte. Nebelschwaden schlängelten sich um die Stämme der Bäume und verschlangen Freund wie Feind.
»Männer, seid auf der Hut! Die Stille gefällt mir nicht«, rief Graf Albrecht mit lauter Stimme über seine Schulter.
Kaum zu Ende gesprochen, bäumte sich das Pferd eines der Vasallen. Das erregte Wiehern ließ den Tross erstarren. Dann plötzlich flogen von allen Seiten Pfeile heran. In Windeseile glitten die Werdenberger Vasallen aus ihren Sätteln, duckten sich und griffen ebenfalls zu Pfeil und Bogen. Den dichten Nebel nutzend, robbten sie auf ihre Feinde zu. Von der Gegenwehr ihrer Opfer überrascht, zogen sich die Angreifer hastig zurück. Genau in dem Moment, als sich Petar, der hünenhafte Vasall der Werdenberger, die Streitaxt vom Gürtel riss und sie triumphierend über seinem Kopf schwang, erscholl der Ruf, der ihnen allen das Blut in den Adern gefrieren ließ: »Graf Albrecht ist verletzt!«
2. Kapitel
So viele merkwürdige Besucher wie heute hatte der Fährmann schon lange nicht mehr hinüber zur Insel Richenow geschifft. Die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, mieden die Kleriker jeglichen Blickkontakt mit ihm. Alle Versuche seinerseits, die noblen Herren, zu denen zweifellos auch Bischöfe gehörten, in Gespräche zu verwickeln, scheiterten bereits in den Anfängen. Schließlich hatte er es aufgegeben und sich an seinem Geldbeutel erfreut, der von Überfahrt zu Überfahrt schwerer wurde. Waren ihm die Silbermünzen aus den Münzstätten Konstanz und Ravensburg noch bekannt, so staunte er nicht schlecht, als er eben zwei kleine Goldmünzen aus Venetien in seinem Beutel entdeckt hatte. Zu gerne würde er in der Taverne damit prahlen, doch wäre ihm damit der Zorn seines Weibes gewiss. Wenn er sich nicht bald entschied, Reinhilde oder Taverne, so würden ihn die Nachtwächter in Kürze aufgreifen und in den Turm sperren. Die Dämmerung kroch bereits über den Bodensee.
»Fährmann! Bring uns rüber zur Richenow!« Ein Hüne von einem Mann kam mit ausladendem Schritt in seine Richtung. »Bist du taub? Der Bischof wünscht, unverzüglich zur Richenow gebracht zu werden.«
Erschrocken fuhr der Fährmann hoch. Die hereinbrechende Dunkelheit verschlang jegliche Gesichtskonturen, und doch glaubte er den stechenden Blick des Mannes wie Nadeln auf sich zu spüren.
»Zu dieser späten Stunde ist eine Überfahrt zu gefährlich«, versuchte er einen zaghaften Vorstoß.
»Du weißt wohl nicht, wen du hier vor dir hast«, donnerte es barsch durch die Nacht.
Das wusste der Fährmann in der Tat nicht. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, das Wappen auf der Kutschentüre zu erkennen. Wenn ihn nicht alles täuschte, kam die Kutsche aus Curia. Eine Überfahrt in der Nacht war ebenso harmlos wie bei Tag, zumal er den Gnadensee bestens kannte, doch das musste er den Klerikern aus dem Rhyntal ja nicht auf die Nase binden.
»Der Preis erhöht sich aber in der Finsternis, mein Herr«, bemerkte er gespielt zögerlich.
»Gebt ihm zwei Silbermünzen, damit das Gerangel endlich ein Ende nimmt«, meldete sich nun auch der zweite Mann zu Wort, der eben aus der Kutsche kletterte.
»Vielleicht würde eine Tracht Prügel die Wirkung auch nicht verfehlen«, riss der Hüne das Wort abermals an sich und machte dabei einen Schritt auf den um zwei Köpfe kleineren Fährmann zu.
»Bitte, meine Herren«, jammerte der Fährmann in unterwürfiger Manier, wobei er seine Hände flehend gen Himmel streckte. »Ich habe zehn hungrige Mäuler zu stopfen und ein Weib dazu, das nicht zum Haushalten geeignet ist. Warum wohl bin ich zu dieser späten Stunden noch …«
»Gebt ihm vier Silbermünzen!« Der Kirchenmann schnaubte verächtlich, wobei er einen Schritt auf das Fährboot zumachte.
Vier Silbermünzen waren das Doppelte von dem, was der Fährmann normalerweise bei einer Überfahrt verdiente. Mit einem Grinsen griff er sich an die Geldkatze, die hart gegen seine Brust drückte. Im Stillen sah er sich bereits in der Taverne bei einem großen Krug Wein.
Die Überfahrt verlief schweigend. Hin und wieder gestattete sich der Fährmann einen verstohlenen Blick in Richtung der beiden Fahrgäste. Der Hüne schien sich wieder beruhigt zu haben und starrte ununterbrochen auf die schemenhaft zu erkennende Insel, deren Umrisse als bizarres Gebilde aus dem Wasser ragten und sich dunkel gegen den Nachthimmel abzeichnete.
»Gedenken die Herren, lange auf der Richenow zu bleiben?«, fragte der Fährmann, nachdem er seine Gäste sicher am Ufer abgesetzt hatte.
»Es würde Euch besser anstehen, Ihr würdet Eure Neugier zügeln«, bemerkte der Hüne schroff, wobei er dem Fährmann die versprochenen Silbermünzen in die Hand drückte.
Irgendwo in der Dunkelheit stieß ein aufgeschreckter Teichrohrsänger einen Warnruf aus, als die nächtlichen Besucher den Bootssteg verließen und dem Pfad hinauf zum Kloster folgten. Die kleine Eintrittspforte zerriss mit ihrem Ächzen die Stille der Nacht, als die beiden Männer den Kräutergarten betraten.
»Ihr kommt spät«, empfing sie der herbeieilende Abt vorwurfsvoll. »Wir warten schon seit Stunden auf Euch.«
»Kurz nachdem wir Curia verlassen haben, brach ein Rad unserer Kutsche. Ihr könnt Euch vielleicht vorstellen, wie schwierig es war, in der Einöde einen geschickten Stellmacher aufzutreiben«, rechtfertigte sich Bischof Verendarius zerknirscht, wobei er sich an Bruder Erasmus vorbeidrängte.
»Die Bruderschaft ist vollzählig, beinahe jedenfalls. Der Vorfall in der Schatzkammer, den Ihr zu verantworten habt, ist von solcher Brisanz, dass der Magister mit Strafe gedroht hat, sollte jemand ohne schwerwiegenden Grund der Versammlung fernbleiben«, brummelte Abt Diethelm mit altersheiserer Stimme vor sich her, während er die Pforte wieder zu verriegeln begann. »Eigentlich wollte der Magister Venerabilis mit Euch zuerst unter vier Augen sprechen, doch dies ist jetzt nicht mehr möglich.«
»Ihr könnt Euch diese Belehrungen sparen, Abt Diethelm, ich bin keiner Eurer Novizen, den Ihr maßregeln müsst!«
Verendarius war müde und erschöpft, zudem gehörte Abt Diethelm von Castell nicht unbedingt zu jenen Menschen, deren Gesellschaft er besonders schätzte. Das Schnauben hinter ihm machte deutlich, dass es seinem Bibliothekar wohl nicht anders erging. Der alte Abt neigte in den letzten Jahren immer mehr zu Vergesslichkeit, zudem machte sich eine Starrköpfigkeit bemerkbar, die an den Nerven zehrte.
Die Versammlung fand wie üblich in den Katakomben der Heiligkreuzkapelle statt. Abt Diethelm hielt die klägliche Nachtfackel wie eine Trophäe vor sich und marschierte mit wackeligem Schritt auf das kleine Gotteshaus am Ende der Klosteranlage zu. Bischof Verendarius hielt seinen Kopf hoch erhoben. In wenigen Minuten würde er sich vor versammelter Bruderschaft für sein Versagen als Hüter des Schatzes rechtfertigen müssen, und dies auch noch in Gegenwart seines Bibliothekars. Einem seiner Mitbrüder war es gelungen, in die Schatzkammer einzudringen. Zwar entwendete der Dieb lediglich ein Astrolabium und einen kleinen Codex, doch er ärgerte sich noch immer darüber, dass ihm dieser Lapsus unterlaufen war.
Ein unterschwelliger Geruch nach Rauch schlug ihnen entgegen, als sie die Kapelle betraten. Vor knapp einem Jahr hatte es hier gebrannt, aber wie durch ein Wunder war der Zugang zu den Katakomben unentdeckt geblieben. Lautlos bewegten sich die drei Männer auf die Krypta zu. Kaum hatte Abt Diethelm den Eisenring angehoben und nach oben gedrückt, schob sich die Mauer zur Seite. Das Malmen der Steine zerriss die Stille der Nacht. Die in den Fels gehauenen Stufen zogen sich kreisförmig in die Tiefe. Aus der Dunkelheit drangen die an- und abschwellenden Rhythmen gregorianischer Gesänge. Vier riesige Fackeln, gleich den Himmelsrichtungen, aus denen die versammelten Rosenkranzbrüder kamen, tauchten das Geschehen in der Mitte der Krypta in ein flackerndes Licht. Wie nicht anders zu erwarten, knieten die Brüder vor ihren Hockern, die Hände zum Gebet gefaltet, und gaben sich mit jeder Faser ihres Körpers dem Gesang hin. Nur der Magister Venerabilis, Bruder Thomas von Visperola, stand auf seinem Podest. Als Einziger hatte er die Kapuze abgestreift, was den Blick auf seinen ergrauten Haarkranz freigab.
»Ich hoffe doch sehr, Ihr könnt Eure Verspätung rechtfertigen«, empfing er die Besucher mit altersbrüchiger Stimme, nachdem er den Gesang mit einer Handbewegung zum Erliegen gebracht hatte. »Brüder, setzt euch, damit wir endlich mit der Versammlung beginnen können!«
Wie bei allen Zusammenkünften der Rosenkranzbrüder ließ es sich der Magister Venerabilis auch dieses Mal nicht nehmen, seinen Mitbrüdern ins Gedächtnis zu rufen, warum ausgerechnet sie damit beauftragt worden waren, das Geheimnis der Christenheit zu wahren.
»Verschwiegenheit und Unsichtbarkeit waren seit jeher die obersten Gebote unserer Bruderschaft«, rief Thomas von Visperola mit leidenschaftlicher Stimme, wobei er seine Hände gen Himmel streckte. »Denn nur ein Geheimbund, der nicht auffällt, kann seine wahre Bestimmung erfüllen. Unsere Mitglieder sind heute über alle Lande verteilt und erfüllen ihre Aufgaben mit Bravour. Es ist an uns, dem inneren Zirkel, sie zu leiten und zu führen.« Thomas von Visperola wartete, ehe er seine Rede fortsetzte. »Als die Bruderschaft gegründet wurde, hat wohl niemand geahnt, welche Bedeutung sie eines Tages erlangen würde. War es früher entscheidend, verirrte Schafe wieder auf den rechten Weg zu führen, so haben wir heute eine viel weitreichendere Aufgabe, die nur mit strikter Geheimhaltung zu erfüllen ist. Seit Clemens V.«, hier wurde die Stimme des Magisters noch lauter und eindringlicher, »seit Clemens V. uns zum Wächter des Schatzes gemacht hat, ist dies entscheidender denn je. Ein Wort gelangt an die Öffentlichkeit, und alles, wofür wir stehen, wäre dem Untergang preisgegeben.«
Thomas von Visperola blickte mit stiller Genugtuung auf die gesenkten Köpfe. Nur er allein kannte die Namen, die sich unter den Kapuzen verbargen.
»Nach außen hin müssen wir in Zukunft noch stärker den Schein einer harmlosen Bruderschaft wahren, was uns auch gleich zu unserem eigentlichen Problem bringt, weshalb wir uns heute hier versammelt haben«, nahm er das Wort abermals auf, wobei er seine Arme sinken ließ und mit ernster Miene in Richtung des Bischofs von Curia blickte. »Es ist Sitte und Brauch, dass der Schatz alle fünfundzwanzig Jahre seinen Standort wechselt. Seit nunmehr fünf Jahren befindet er sich am Bischöflichen Hof in Curia, gut verborgen hinter dicken Mauern, so jedenfalls haben wir bislang geglaubt. Doch nun ist mir zu Ohren gekommen, dass einer unserer Mitbrüder das Schweigen gebrochen hat.«
Das Raunen machte klar, welche Bestürzung dieser Vorwurf hervorrief. Thomas von Visperola ließ die Männer bewusst einen Augenblick gewähren.
»Verräter sollten bestraft werden! Wie es überall geschieht, im Notfall sogar mit dem Tod«, erhob einer der anwesenden Männer das Wort, noch bevor Thomas von Visperola in seiner Rede fortfahren konnte.
Dem Mann war im Eifer des Gefechts die Kapuze vom Kopf gerutscht, und ein durch Pockennarben entstelltes Gesicht starrte wütend in die Runde. Die Härte auf dem jungen Gesicht jagte so manchem einen Schauder über den Rücken.
»Würdet Ihr Euch bitte mäßigen, Bruder Timotheus! Wenn ich mich recht entsinne, ist dies erst Eure zweite Versammlung, und somit sehe ich Euch diesen Frevel noch nach. Doch Ihr wisst sehr wohl, dass sich niemand hier im Kreise zu erkennen geben darf.«
Bruder Timotheus setzte sich zurück auf seinen Hocker, wobei er die Kapuze nur widerwillig über sein Haupt stülpte.
»Selbstverständlich haben wir den Verräter zur Rechenschaft gezogen. Der Abtrünnige wurde auf eine Wanderschaft geschickt, von der er bedauerlicherweise«, bei diesem Wort rieb sich Thomas von Visperola die Hände, »mit einer Krankheit zurückkehrte, die sehr schnell zu seinem Tod geführt hat. Dies haben wir dem Hüter des Schatzes zu verdanken, der das Problem zu unserer Zufriedenheit gelöst hat.«
Bischof Verendarius atmete erleichtert auf. Offenbar war Thomas von Visperola im Alter gemäßigter und auch umsichtiger geworden. Dass einer seiner Mitbrüder in Curia Teile des Schatzes entwendet hatte, ohne dass er es hatte verhindern können, war eine schwere Verfehlung. Allerdings fragte er sich immer wieder, warum ausgerechnet dieses Astrolabium und dieser Codex verschwunden waren. Was war daran so kostbar? Hatte er womöglich etwas übersehen?
Noch vor wenigen Jahren wäre er niemals so glimpflich davongekommen und hätte stattdessen wohl mit einer Abmahnung rechnen müssen, die ihm vielleicht sogar den Rang als Hüter des Schatzes gekostet hätte. Es gierten ohnehin schon etliche der Brüder hier im Kreis nach diesem ehrenvollen Amt. Die anschließende Diskussion verdeutlichte die Aufregung inmitten der Bruderschaft. Thomas von Visperola kam nicht darum herum, den Namen des Verräters doch noch bekannt zu geben. Als sich die Versammlung auflöste, verschwand die dünne Mondsichel bereits hinter den Bergen.
Kurz nach Tagesanbruch läuteten die Glocken zur Prim und luden die Mönche der Richenow zur Messe. Zur selben Zeit versammelten sich die Brüder des Rosenkranzes im Refektorium. Thomas von Visperola stellte mit Genugtuung fest, dass alle ihre Kapuzen wieder tief ins Gesicht gezogen hatten, selbst der junge Heißsporn Bruder Timotheus. Eines Tages würde es von Vorteil sein, auch solche Männer in den Reihen zu wissen, doch im Augenblick war ein streitsüchtiger Rechthaber der Geheimhaltung des Schatzes mehr hinderlich als dienlich. Bruder Timotheus hätte die Tatsache, dass sich unter den kapuzenbedeckten Häuptern nicht nur Männer der Kirche befanden, mit Sicherheit mit Empörung aufgenommen.
Das karge Morgenmahl, bestehend aus Pflaumenmus und Roggenbrot, war nicht jedermanns Sache, doch dies war bewusst so gewählt. Niemand sollte unnötig lange sitzen bleiben und Argwohn unter den Mönchen des Klosters wecken. Noch bevor sich die Sonne am fernen Horizont zeigte, mussten die Gäste die Insel verlassen. Dies war seit jeher so Sitte, und daran würde sich auch heute nichts ändern.
»Würdet Ihr mich in meine Zelle begleiten?«, fragte Thomas von Visperola leise in Richtung des Bischofs an seiner Seite.
Verendarius zuckte erschrocken zusammen. Nach einer Nacht, in der er kein Auge zugetan hatte, bedurfte es nicht viel, und seine Hände begannen zu zittern.
Thomas von Visperola erhob sich mit regungsloser Miene von seinem Platz. Er tat, als bemerke er die Nervosität seines Gegenübers nicht, während er diesem mit einem Nicken zu verstehen gab, ihm zu folgen. Bischof Verendarius ahnte, dass sich hinter der Maske der Gleichgültigkeit noch immer der Wolf im Schafspelz verbarg.
»Euer verspätetes Eintreffen hat mich leider daran gehindert, Euch ein paar Fragen zu stellen«, begann Thomas von Visperola in vorwurfsvollem Ton, nachdem sich die Zellentür hinter ihnen geschlossen hatte. »In Eurem Brief habt Ihr mir geschrieben, dass Bruder Franziskus an der Pest gestorben sei. Ich hoffe doch sehr, dass dies auch der Wahrheit entspricht.«
»Selbstverständlich. Alles spielte sich so ab wie in meiner Kunde geschrieben.« Verendarius wirkte jetzt noch nervöser als im Refektorium.
»Ihr seid Euch nach wie vor sicher, dass lediglich ein unscheinbares Astrolabium aus dem Bestand des Schatzes entwendet wurde? Wozu brauchte Bruder Franziskus diese Himmelsscheibe? Befasste er sich etwa mit Astronomie?«
»Viele Fragen, auf die auch ich keine Antwort weiß«, entschuldigte sich Verendarius hastig in der Hoffnung, damit allfällige weitere Fragen des Magisters im Keim zu ersticken.
Thomas von Visperolas Augen verengten sich. »Eine letzte Frage, die Ihr mir hoffentlich beantworten könnt.« Thomas von Visperola stand jetzt so dicht vor Verendarius, dass dieser den fahlen Atem des alten Mannes riechen konnte. »Bruder Franziskus war doch sehr belesen und in vielen Sprachen bewandert. Soviel mir bekannt ist, übte er auch das Amt eines Lehrers aus. Gab es vielleicht einen Schüler, dem er unser Geheimnis hätte anvertrauen können?«
Diese Frage hatte sich Verendarius selbst des Öfteren gestellt. Eine klare Antwort kannte auch er nicht.
»Bruder Franziskus war vor seinem Tod lange Zeit auf Wanderschaft und daher seit Jahren nicht mehr um die Ausübung des Lehramtes besorgt«, versuchte er das Misstrauen seines Gegenübers zu mindern, wobei er alle Kraft zusammennahm und dem Magister tief in die Augen blickte. Das Blut rauschte ihm in den Ohren, und die Zunge klebte unnatürlich am Gaumen. Dass sein Mitbruder auf dem Sterbebett ein längeres Gespräch mit dem jungen Grafen der Werdenberg geführt hatte, verschwieg er wohlweislich.
Thomas von Visperola nickte nachdenklich.
3. Kapitel
Obwohl es selbst in der Osternacht noch einmal zu schneien begonnen hatte, verkündete der Kaplan sie voller Inbrunst als Nacht des Lichtes. Gott belohnte den Enthusiasmus des Kaplans schließlich, und eine Woche nach Ostern kam der ersehnte Frühling. Die Sonne gewann jeden Tag mehr an Kraft und vertrieb den Winter endgültig.