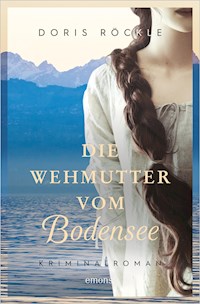6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rheinthal Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine mutige Magd, ein adeliger Junge und eine schicksalhafte Flucht ins Rheintal des 14. Jahrhunderts. Rhyntal 1322: Die Leibeigene Hanna wird als Magd auf die Burg Montfort gebracht, wo sie fortan für den Grafen arbeitet. Bald macht das Gerücht die Runde, dass es in der Dachkammer spukt. Doch die neugierige Hanna entdeckt, dass es sich dabei um einen entführten Jungen handelt. Um sein Leben zu retten, beschließt Hanna ihre gemeinsame Flucht ins ferne Rhyntal. Doch der Arm des Grafen reicht weit... In einer Zeit der Machtkämpfe zwischen Kirche und Krone müssen Hanna und der Junge nicht nur um ihr Überleben kämpfen, sondern auch gegen Aberglauben und Hexenjagd. Auf ihrer Reise kreuzen sich ihre Wege mit der verfluchten Lanze des Longinus, die eine besondere Rolle in diesem fesselnden historischen Roman spielt. Doris Röckles "Die Flucht der Magd" entführt die Leser in eine Welt voller Gefahren, Intrigen und Tapferkeit im Deutschland des Mittelalters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Ähnliche
Doris Röckle
Die Flucht der Magd
Historischer Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Opulenter historischer Roman um eine junge Magd, ein adeliges Kind, die verfluchte Lanze des Longinus und die Machtkämpfe zwischen Kirche und Krone.
Rhyntal 1322: Die Leibeigene Hanna wird als Magd auf die Burg Montfort gebracht, wo sie von nun an für den Grafen arbeitet. Bald macht das Gerücht die Runde, dass es in der Dachkammer spukt. Doch die neugierige Hanna entdeckt, dass es sich dabei um einen entführten Jungen handelt. Um das Leben des Jungen zu retten, beschließt Hanna ihre gemeinsame Flucht ins ferne Rhyntal. Doch der Arm des Grafen reicht weit …
Inhaltsübersicht
Meinem Vater, der am Fusse der Burg Hohensax seine Kindheit verbrachte.
Prolog
Abt Ulrich von Sax hatte diese Stelle mit Bedacht gewählt, auch wenn das endlose Warten an den Nerven zehrte. Der Wald war zu dieser Jahreszeit kaum ein Ort, an dem sich jemand freiwillig aufhielt. Es war nicht nur der beißende Wind, der jegliches Getier in seine Höhlen verbannte, auch der modrige Geruch machte das Warten zur Qual. Der Nebel wurde mit jedem Atemzug dichter und bald würde man weder Bäume noch Weg erkennen.
Der Schrei einer Eule zerriss die Stille. Eulenrufe galten als schlechte Omen, das wusste auch der Mann in der braunen Mönchskutte. Mit einem Blick in Richtung der Eiche, in deren Geäst er die Eule vermutete, scheuchte er den Gedanken mit einer Handbewegung zur Seite. Aberglauben und Fantastereien hatten bei ihm keinen Platz. Mit einem Ruck drehte er sich zu seinen Begleitern um.
Die Söldner kauerten mit grimmigen Mienen unter einem Felsvorsprung. Auf den wettergegerbten und mit Narben übersäten Gesichtern der Männer konnte Abt Ulrich von Sax die Gier sehen und genau diese Gier brauchte es, um Skrupel erst gar nicht aufkommen zu lassen. Seine eigenen Gefolgsleute hätten sich seinem Befehl womöglich widersetzt oder zumindest unnötige Fragen gestellt. Diese Männer taten es nicht. Für sie zählte einzig und allein die prallgefüllte Geldkatze, die sie nach Erhalt des Auftrages ihr Eigen nennen würden. Danach würden sich ihre Wege scheiden und so Gott wollte, würde er sie niemals mehr zu Gesicht bekommen.
Die berüchtigten Söldner jenseits der Berge für diese heikle Aufgabe zu gewinnen war ein genialer Einfall gewesen, er lobte sich im Stillen dafür.
Abt Ulrich von Sax ging langsam auf den Unterstand zu. Er hatte es sich seit Jahren zur Gewohnheit gemacht, jegliche Gefühle hinter einer starren Maske zu verbergen, so zuckte auch jetzt kein Muskel in seinem Gesicht.
»Vielleicht hat es sich Abt Benedetto doch anders überlegt, schließlich hätte er schon vor Stunden hier eintreffen müssen!«, knurrte ihm einer der Söldner entgegen. Als müsste er seinen Unmut noch untermalen, spuckte er einen grünlichen Schleimklumpen auf einen der Steinbrocken.
»Er wird kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, erwiderte Abt Ulrich von Sax. »Doch willst du auf deinen Anteil verzichten, steht es dir frei zu verschwinden.«
Der Angesprochene wollte erst etwas erwidern, überlegte es sich dann aber doch anders und schwieg. Ein Blick in die Runde seiner Kumpane machte ihm deutlich, dass diese nur danach gierten, seinen Anteil unter sich aufzuteilen.
Abt Ulrich von Sax sandte ein stummes Stoßgebet gen Himmel. Sollte der Tiroler Abt tatsächlich nicht kommen, wäre nicht nur seine Autorität gegenüber seinen Begleitern infrage gestellt, auch seine Familie wäre dem Untergang geweiht. Es stand zu viel auf dem Spiel, als dass er sich eine Niederlage hätte leisten können. Sein fingierter Ruf aus Rom musste einfach Wirkung zeitigen! Schließlich hatte er jedes Wort sorgfältig abgewogen, hatte Drohung und Verlockung gleichermaßen bedacht. Sollte dieser Frevel je entdeckt werden, sein Leben wäre keinen Pfifferling mehr wert, aber das wäre es wohl ohnehin nicht, sollten die Söldner nicht bald zum Einsatz kommen. Die Eidgenossen waren bekannt für ihre Skrupellosigkeit, und Geduld gehörte nicht zu ihren Tugenden. Die Männer würden mit Sicherheit keine Sekunde zögern, ihn anstelle des Tiroler Abtes über die Klinge springen zu lassen, nur um ihre Mordlust zu befriedigen.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Der Konvoi war im Anzug. Das stundenlange Bangen und Hoffen hatte ein Ende. »Ihr wisst, was ihr zu tun habt«, wandte er sich hastig an seine Begleiter.
Die Söldner griffen blitzschnell zu ihren Waffen und verteilten sich lautlos inmitten der Nebelschwaden.
»Es darf keine Zeugen geben!«, mahnte Abt Ulrich, raffte seine Kutte und verschwand im Dickicht.
Der Konvoi bestand lediglich aus einer Kutsche und drei Reitern. Bekannt dafür, äußerst spartanisch zu reisen, hatte Abt Benedetto auch dieses Mal auf großes Gefolge verzichtet. Selbst der Ruf aus Rom hatte ihn nicht zu Prunk verleiten können.
Die Söldner preschten so unverhofft aus dem Unterholz, dass sich die Pferde aufbäumten. Noch bevor die kirchlichen Gefolgsleute auch nur den Hauch einer Möglichkeit erhielten, ihre Schwerter aus den Halterungen zu ziehen, bohrten sich die Lanzen der Söldner bereits in ihre Lenden. Das Wiehern der Pferde erstarb mit den Schreien der Männer. Als die Kutschentür mit harter Hand aufgerissen wurde, trieben die regungslosen Leiber bereits im Fluss.
»Was wollt ihr von mir?«, ertönte es mit brüchiger Stimme aus dem Inneren der Kutsche.
Ohne auf die Frage des verstörten Klerikers einzugehen, packten zwei der Söldner den Mann und zerrten ihn ins Freie. Kreidebleich und am ganzen Körper zitternd, stand Abt Benedetto da. Von seinen Gefolgsleuten war nichts mehr zu sehen, einzig ihr Blut färbte den Waldboden rot.
»Ich bin ein Mann Gottes. Wenn ihr euch … wenn ihr euch an mir vergeht, vergeht ihr euch an Gott!«, wimmerte er und suchte nach einer Fluchtmöglichkeit. Als er die Schwertspitze an seinem Hals fühlte, geriet er ins Straucheln und fiel der Länge nach hin. Die Söldner lachten, als er auf allen vieren zu entkommen versuchte.
Das war der Augenblick, auf den Abt Ulrich von Sax gewartet hatte. Er drückte seinen Rücken durch und trat mit versteinerter Miene aus dem Dickicht.
Sie kannten sich, er und Abt Benedetto, wenn auch nur flüchtig. Vor vielen Jahren waren sie sich auf einem Konzil begegnet.
»Ihr?«, fragte Abt Benedetto erstaunt und erschrocken zugleich. »Was in Gottes Namen soll das Ganze?« Als sein Gegenüber nicht auf die Frage einging, sondern ihn stattdessen nur spöttisch musterte, versuchte Abt Benedetto mühsam, auf die Beine zu kommen.
»Ich bin auf dem Weg nach Rom. Der Papst höchstpersönlich hat nach mir schicken lassen«, verkündete er.
Abt Ulrich unterbrach ihn mit einer Handbewegung. Das stundenlange Warten hatte seine Geduld erschöpft, das Letzte, was er jetzt wollte, war ein sinnloser Disput mit einem Mann, der seiner nicht würdig war.
»Ach ja, der Ruf aus Rom«, bemerkte er spöttisch. »Kaum zu glauben, dass Ihr auf diesen Schwindel hereingefallen seid!«
Jegliche Farbe wich aus Abt Benedettos Gesicht. Die Erkenntnis, dass die Bulle aus Rom eine Finte gewesen und er blind darauf hereingefallen war, traf ihn im Innersten.
»Was wollt Ihr von mir?«, fragte er kaum hörbar.
»Die Heilige Lanze. Gebt sie mir und Ihr seid ein freier Mann!«
»Die Lanze? Welche Lanze?« Ein Lauern trat in seine Augen, als er den Abt des Klosters Sankt Gallen musterte.
»Ihr wisst, von welcher Lanze ich spreche. Versucht nicht, mich für dumm zu verkaufen!«, brauste Abt Ulrich auf, dabei machte er einen Schritt auf seinen Kontrahenten zu, packte ihn am Ärmel und zog ihn so dicht zu sich heran, dass er dessen Angst zu riechen glaubte. »Denkt Ihr wirklich, ein Wicht wie Ihr sei würdig, die Lanze des Longinus sein Eigen zu nennen? Die Lanze gebührt Männern, die bereit sind, die Welt zu verändern, Männern wie einst Karl dem Großen, der mithilfe der Reliquie die heidnischen Franken in die Flucht schlug, und nicht einem unbedeutenden Abt aus den Tiroler Bergen, der nicht einmal einen Verräter in den eigenen Reihen erkennt.«
Die Kälte in Abt Ulrichs Stimme ließ keinen Zweifel aufkommen, dass er zu allem bereit war, um die heilige Reliquie in seine Hände zu bekommen.
Abt Benedettos Befreiungsversuch geriet zu einem hilflosen Zappeln. Er war dem Sankt Galler Abt nicht nur körperlich unterlegen, auch sein Verstand schien auszusetzen. Ein Stöhnen entwich seinen Lippen.
»Die Lanze für euer Leben!«, zerriss Abt Ulrichs tiefer Bariton die Stille.
»Niemals!« Abt Benedetto gab sich einen Ruck und blickte seinem Gegenüber unter Aufbringung seiner letzten Kräfte direkt ins Gesicht.
Abt Ulrich von Sax lachte auf. Er ließ seinen Abtbruder so abrupt los, dass dieser wie ein Sack zu Boden fiel. Mit verschränkten Armen stand er vor seinem Opfer und fixierte den Mann mit eiskaltem Blick.
»Wie Ihr wollt!«
Auf sein Zeichen preschten zwei der Söldner herbei und packten den verzweifelt um sich schlagenden Kleriker an Händen und Füßen. Ehe sich Abt Benedetto versah, wurde er von vier kräftigen Armen in die Höhe gerissen. Sein Jammern schien die Söldner zu amüsieren. Ihr Lachen hallte durch die Stille des Waldes. Mit Schrecken sah Abt Benedetto das Seil, das einer der Männer eben um einen Ast schwang, dann wurde ihm auch schon der Boden unter den Füßen weggezogen und er baumelte kopfüber am Ast der Eiche. Dass ihm dabei die Kutte in Richtung seines Kopfes rutschte und den Blick auf sein Gemächt freigab, steigerte den Hohn seiner Angreifer, die selbst vor blasphemischen Schimpftiraden gegen Papst und Curie nicht zurückschreckten.
Abt Ulrich von Sax wartete lange, ehe er dem Schauspiel ein Ende setzte. Er gönnte den Eidgenossen den Spaß, schließlich hatten sie auch lange genug darauf gewartet. »Die Lanze!« Seine Stimme hatte einen gefährlichen Unterton erreicht. Der Starrsinn seines Abtbruders brachte ihn an den Rand seiner Beherrschung.
Abt Benedetto versuchte verzweifelt, seine Blöße mit den Händen zu bedecken. Fast schien es, als habe er die Worte seines Gegenübers nicht verstanden.
Abt Ulrichs Geduld war jetzt zu Ende. Er trat einen Schritt auf den Gepeinigten zu.
»Ihr wollt es nicht anders. Meine Männer werden das Schauspiel genießen und glaubt mir, sie haben einen langen Atem.«
Abt Benedetto biss die Zähne aufeinander und wandte den Kopf energisch zur Seite.
Sein Abtbruder würde den Märtyrer nicht lange spielen, das wusste Abt Ulrich. Mit vorgestrecktem Kinn gab er den Söldnern das überfällige Zeichen.
Abt Benedettos Schreie hallten durch den Wald. Die Eidgenossen waren nicht zimperlich und es hätte nicht viel gefehlt und der Kleriker hätte sein Geheimnis mit ins Grab genommen.
»Und?«, fragte Abt Ulrich von Sax hart.
Abt Benedetto schloss seine Augenlider. Blut tropfte ihm aus Mund und Ohren. Die Männer hatten seinen Körper mit Peitschen und Messern malträtiert und dabei nicht mit der Wimper gezuckt. Sie würden ihn töten, würde er ihnen nicht sagen, was sie hören wollten.
»Ohne das Losungswort wird man euch nicht zur Lanze führen«, flüsterte er mit bebenden Lippen. »Doch lasst mich erst hinunter. Der Schmerz raubt mir sonst den Verstand.«
»Das Losungswort, wie lautet es?«
Abt Benedetto zögerte. Er konnte kaum noch atmen, lange würde er nicht mehr durchhalten. Schon traf ihn der nächste Schlag.
»Clavus Dominicos!«, kam es röchelnd über seine aufgeplatzten Lippen.
»Und das ist alles?«, fragte Abt Ulrich skeptisch.
Abt Benedetto nickte.
Zum ersten Mal seit Stunden zeigte sich so etwas wie ein Lächeln auf Abt Ulrichs Gesichtszügen.
»Schneidet ihn ab!«
Er hatte das Dokument zur Aushändigung der Lanze längst vorbereitet, ebenso wie er vor Wochen einen Mittelsmann ins Kloster eingeschleust hatte. Mit dessen Hilfe würde es ein Kinderspiel sein, die dicken Klostermauern zu überwinden. Es bedurfte nur noch der Unterschrift von Abt Benedetto und die Reliquie gehörte ihm. Langsam zog er die Pergamentrolle aus seiner Kutte und strich sie glatt. Federkiel und Tintenfass stellte er auf einen flachen Stein.
»Unterschreibt!«
Das Klirren des Morgensterns in der Hand des Söldners ließ Abt Benedetto erstarren. Mit zittrigen Fingern griff er sich den Federkiel und kritzelte seinen Namen unter das Dokument. Keinen Atemzug später holte ihn die Dunkelheit ein.
Abt Ulrich von Sax saß längst auf seinem Rappen, als der leblose Körper des Klerikers in den Fluten des Flusses verschwand.
1. Kapitel
Die Sonne stand schon tief und bald würde sie gänzlich hinter den Bergen verschwinden. Zu dieser Jahreszeit kam die Nacht schnell, zu schnell, und die Kälte mit ihr. Schon jetzt kam der Tross nur schleppend voran. Die Strapazen der vergangenen Stunden machten sich bemerkbar. Hannas Bein schmerzte und sie hinkte noch stärker als sonst.
»Los, ich habe keine Lust, die Burg erst bei Dunkelheit zu erreichen!«, knurrte der Vasall über seine Schulter und musterte die zerlumpten Männer und Frauen.
Stolz und Hochmut lagen in seinem Blick. Eine Horde Leibeigener aus Veltkirchen abzuholen gehörte wahrscheinlich nicht unbedingt zu jenen Obliegenheiten, die er sich als Vasall des großen Wilhelm von Montfort-Tettnang vorgestellt hatte. Bedeutend lieber wäre er bestimmt mit seinem Herrn in die Schlacht gezogen oder hätte ihn auf eine der vielen Burgen begleitet, die er regelmäßig mit großem Gefolge aufsuchte.
»He, du da«, rief er in Hannas Richtung, als sie ins Straucheln geriet und sich an einen Findling klammerte. »Für Müßiggang ist keine Zeit. Lauf weiter wie die anderen!«
Hanna blickte auf.
»Du hast gut reden. Hoch zu Ross und mit guten Stiefeln an den Füßen ginge es mir auch besser«, zischte sie zwischen den Zähnen hervor.
Angesichts so viel Beherztheit verschlug es dem Vasallen die Sprache. Frauen verhielten sich für gewöhnlich still, sprachen nur, wenn sie gefragt wurden, und begehrten schon gar nicht gegen Vasallen auf.
»Zügle dein freches Mundwerk, Frau!«, rief er mit lauter Stimme, sodass ihn ja auch alle hören konnten. Gleichzeitig griff er sich die lange Peitsche und ließ sie über den Köpfen der erschrockenen Männer und Frauen knallen.
»Graf Wilhelm von Montfort-Tettnang ist kein Freund von Müßiggang und schon gar nicht von Widerrede. Ich gebe dir und allen anderen den guten Rat, das Maul in Zukunft nicht mehr so weit aufzureißen, sonst könnte es nämlich leicht geschehen, dass bald einem von euch die Zunge fehlt!« Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Hanna duckte sich und verschwand inmitten der zerlumpten Horde.
Es war ein zusammengewürfelter Haufen, der sich da den Weg entlang mühte. Einige waren ausgemergelt, sichtbar von Hunger und Durst gequält, andere hatten wohl mehr Glück gehabt und den letzten Winter besser überstanden.
»Dummer Kerl!«, knurrte sie hinter seinem Rücken.
»Sei still oder willst du eine Tracht Prügel kassieren?«, zischte eine der elenden Gestalten an ihrer Seite, wobei ihr der Mann einen Stoß verpasste, der sie nach vorne stolpern ließ.
»Hast wohl Angst vor ihm«, hänselte sie ihren Peiniger. »Glaube kaum, dass Graf Wilhelm an solchen Jammergestalten, wie du eine darstellst, seine Freude haben wird.« Hanna wartete die Reaktion ihrer Worte mit zusammengekniffenen Lippen ab. Als der Mann jedoch müde abwinkte, machte sie ihre Ellbogen breit und bahnte sich ihren Weg nach vorne. Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus den Augenwinkeln.
»Nur weil wir Leibeigene sind, brauchen wir uns nicht alles gefallen zu lassen«, murmelte sie mehr zu sich selber als zu ihren Leidensgenossen.
Die Männer und Frauen schienen sich in ihr Schicksal ergeben zu haben und würden ihretwegen keinen Finger rühren, sollte der Vasall nochmals zu seiner Peitsche greifen. Trotzig warf sie den Kopf in den Nacken und hielt ihr von Pockennarben entstelltes Gesicht der untergehenden Sonne entgegen, die eben hinter der weit entfernten Bergkuppe zu verschwinden drohte.
»Du bist sehr mutig.«
Neugierig drehte Hanna ihren Kopf. Das Mädchen neben ihr wagte kaum, den Blick vom Boden zu heben.
»Gott hat uns einen Kopf zum Denken gegeben, also sollte man ihn auch nutzen«, entgegnete Hanna.
Das Mädchen neben ihr schien zu überlegen, zuckte dann aber nur ergeben mit den Schultern.
»Ruhe da hinten!«, hallte die Stimme des Vasallen über den Köpfen. »Lauft endlich schneller oder soll ich euch Beine machen!«
Ein Ruck ging durch die gut zwanzig Männer und Frauen, die sich vor Kälte und Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten konnten. Die meisten von ihnen hatten nicht einmal Stofffetzen für die Füße und die spitzen Steine hatten auf dem langen Weg tiefe Wunden in ihren Fußsohlen hinterlassen.
»Wie heißt du?«, fragte Hanna das Mädchen an ihrer Seite leise.
»Lena. Und du?«
»Ich heiße eigentlich Johanna, doch Hanna reicht. Dort, wo ich herkomme, geben wir nicht viel auf Namen.«
Hanna wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. Sie schwitzte und dies trotz der Kälte. Seit zwei Tagen fieberte sie, doch dies hatte die Mutter nicht erwähnt, als die Vasallen ins Dorf gekommen waren, um sich fünf der ihren zu holen. Sie wäre lieber in den Sümpfen geblieben, als auf eine Burg zu kommen. Man hörte nur Schlechtes von der Montfort, und wenn sie die Vasallen betrachtete, glaubte sie diese Schauermärchen auch.
»Warst du schon einmal auf der Montfort?«, wollte Lena wissen. Mittlerweile hatte sie sich dazu durchringen können, Hanna direkt ins Gesicht zu schauen. Zu Hannas Erstaunen schreckte sie vor ihren von den Pockennarben entstellten Zügen nicht zurück.
»Nein, wird wohl sein wie überall.« Hanna zuckte mit den Achseln. »Die Armen schuften und die Reichen sehen ihnen dabei zu.«
»Was glaubst du, zu welcher Arbeit werden sie uns einteilen?« Die Worte kamen Lena so leise über die Lippen, dass Hanna sie kaum verstand.
»Ich weiß nicht, ist mir auch egal, solange sie uns genügend zu essen geben.«
Hanna musterte ihre Weggefährtin. Es war ihr ein Rätsel, warum man Lena für diesen Tross ausgesucht hatte. Das Mädchen wirkte so zerbrechlich, dass man daran zweifeln konnte, dass sie die Montfort überhaupt erreichte.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, fügte sie hinzu, als sie bemerkte, dass Lena den Blick gesenkt hielt, damit man ihre Tränen nicht sehen konnte. »Schließlich bin ich ja da.«
Den Rest des Weges sprachen sie nicht mehr miteinander. Im monotonen Gleichschritt kam der Tross der Montfort näher.
Auf Hannas Gesicht lag wieder die starre Maske, die sie stets dann aufsetzte, wenn niemand ihre wahren Gefühle erraten sollte. Sie war längst nicht so überlegen und stark, wie sie sich nach außen gerne gab. Doch sie hatte gelernt, Trauer und Hilflosigkeit ebenso wie Schwäche und Angst nur dann an die Oberfläche kommen zu lassen, wenn sie sicher sein konnte, dass sie niemand beobachtete. Hier, inmitten der fremden Männern und Frauen, würde sie sich nicht gehen lassen.
Hanna zog sich das Kopftuch tiefer in die Stirn. Mit monotoner Regelmäßigkeit setzte sie Schritt vor Schritt, im Gleichklang mit Lena, die sich so eng an ihre Seite drängte, dass sich ihre Röcke berührten. Gerne hätte Hanna einen Arm um die schmalen Schultern ihrer Begleiterin gelegt und sie tröstend an sich gezogen, doch dies hätte nur wieder die Aufmerksamkeit des Vasallen auf sie gelenkt. Also beließ sie es bei einem kleinen Lächeln, als Lena kurz den Kopf hob und den Arm unter ihren schob, obwohl der Mann neben ihnen erschrocken den Kopf schüttelte.
Kurz vor Einbruch der Dämmerung erreichte der Tross schließlich Klus, den kleinen Weiler am Fuße der mächtigen Trutzburg. Es roch nach Fäulnis und Moder, wie es überall der Fall war, wenn es tagelang geregnet hatte. Hin und wieder lief ihnen ein Huhn über den Weg oder irgendwo in den verwinkelten Gassen bellte ein Hund, aber kein menschliches Wesen war weit und breit zu sehen. Nur hinter den mit Fellen verhangenen Luken glaubten sie die Blicke der Dorfbewohner zu spüren.
Für einmal erleichtert darüber, dass die Vasallen zur Eile trieben, ließen sie den Weiler hinter sich. Längst spürte niemand mehr die Steine auf dem Weg hinauf zur Burg. Die Kälte hatte nicht nur die Zehen betäubt, auch die Muskeln ihrer Beine fühlten sich starr und hölzern an, ließen ihre Schritte staksig erscheinen. Mittlerweile hatte es wieder zu regnen begonnen. Immer wieder rutschten die Männer und Frauen auf dem steilen feuchten Waldweg aus. Selbst die sonst so trittsicheren Schlachtrosse der Vasallen hatten ihre Mühe.
Sie war mächtig, die Montfort, als sie plötzlich aus dem Nebel auftauchte. Ihre fünf Wehrtürme ragten majestätisch gegen den Nachthimmel. Auf den mit Zinnen bewährten Wehrgängen ließen sich trotz der Düsternis Wachmänner erkennen, bewaffnet mit Bogen und Armbrüsten. Ihre Haltung verriet, dass sie keine Sekunde zögern würden, die Waffen gegen die Neuankömmlinge zu erheben. Als die Männer und Frauen das Burgtor endlich passiert hatten und im Burghof standen, ging ein erleichtertes Aufatmen durch die Reihen. Der Anführer der Vasallen trieb die Gruppe auf die Pferdeställe zu, ehe er von seinem Pferd stieg und aus ihrem Blickfeld verschwand. Die Frauen drängten ihre durchfrorenen Leiber eng an die Holzwand. Außer zwei Hunden, die neugierig um sie herumschnüffelten, war der Burghof wie ausgestorben. Selbst die Wachtposten zeigten keinerlei Interesse mehr an den zerlumpten Gestalten. Aus den Ställen drang das Wiehern der Pferde, irgendwo grunzten Schweine.
Nach einer schier endlosen Zeit des Wartens kam der Vasall zurück. Der Kies unter seinen Stiefeln knirschte bei jedem seiner Schritte.
»Ihr habt Glück!«, verkündete er. »In der Burgküche gibt es für jeden von euch eine Schüssel Bohnensuppe.«
Mit einmal kam Leben in den müden Haufen. Die Röcke raffend, stolperten die Frauen hinter dem Vasallen die durch zwei Nachtfackeln erhellten Stufen hoch. Die Aussicht auf Wärme, Essen und in Kürze auf eine trockene Bettstatt weckte ihre Lebensgeister.
Die Burgküche erwies sich als riesiger, rauchgeschwängerter Raum mit zwei Feuerstellen. Brodelnde Töpfe verrieten, dass sie gerade zur rechten Zeit eingetroffen waren, ansonsten wäre es wohl nichts geworden mit der Bohnensuppe, denn an die zwanzig Mägde und Knechte drängten sich um die drei großen Eichentische, gierig auf das Nachtmahl wartend. Die missmutigen Mienen machten keinen Hehl daraus, dass einige befürchteten, an diesem Abend mit knurrendem Magen auf die Strohsäcke zu kommen, da die Schüsseln heute wohl kein zweites Mal gefüllt werden würden.
»Dort hinten am letzten Tisch sind noch Plätze frei«, rief die Köchin mit rauchiger Stimme, wobei sie mit der Kochkelle in Richtung der Strohhaufen zeigte. »Und ihr anderen macht nicht so ein Gesicht. Es hat für alle genug!«
Geduckt und die Blicke zu Boden gerichtet, verzogen sich die Neuankömmlinge in die Ecke. Hanna spürte die feindseligen Musterungen wie Nadelstiche. Sie waren nicht willkommen, nicht zur Essenszeit und wohl auch sonst nicht. Es war besser, den Unmut nicht weiter zu schüren.
Die Küche wirkte schmutzig, die Tische klebrig und der Boden hätte längst frische Binsen vertragen. Hanna und Lena hatten die denkbar schlechtesten Plätze erwischt. Unweit der Feuerstelle, auf welcher sich ein Spanferkel drehte, drängten sich die Hunde.
»Würde mich nicht wundern, wenn uns die Biester in die Füße beißen«, knurrte Hanna.
»Sei still!«, entgegnete Lena leise. »Die Kerle dort drüben beobachten uns.«
Ein Blick auf den Nachbartisch verriet, dass die Knechte den Neuankömmlingen deutlich versöhnlicher gegenüberstanden.
»Wirst wohl bald einen Verehrer haben.« Hanna schüttelte den Kopf. »Vor lauter Gier vergessen die noch ihre Bohnensuppe.«
Mit Pockennarben und einem Hinkebein musste man sich wenigstens keine Sorgen machen, bei Nacht von unliebsamen Angriffen überrascht zu werden, dachte Hanna.
»Was für schreckliche Weibsbilder schleppst du mir da an!«
Das Gezeter der Köchin war bis an den letzten Tisch zu hören.
»Die eine hinkt, die anderen sind viel zu mager und beim Rest bin ich mir nicht sicher, ob sie nebst Krätzen und Läusen nicht noch andere Krankheiten einschleppen.«
»Was kann man schon anderes erwarten aus Veltkirchen«, verteidigte sich der Anführer der Vasallen, wobei er seine Arme vor der Brust verschränkte und finster in Richtung der Neuankömmlinge starrte. »Die Blonde gefällt unserem Grafen bestimmt. Wenn du ihr ordentlich zu essen gibst, hat unser Herr was für die einsamen Stunden.«
Der Mann lachte und mit ihm die gesamte Tischrunde.
Lena drückte sich enger in die Bank und hielt den Kopf gesenkt. Ihre Hände zitterten vor Angst.
»Unser Herr braucht nichts für die einsamen Stunden. Muss ich dich daran erinnern, dass in wenigen Tagen seine neue Braut erwartet wird?«, belehrte ihn die Köchin.
»Ich hab gehört, diese Kunigunde von Rappoltstein soll nicht unbedingt … Also, ich meine …«
»Ich mag kein Geschwätz.« Die Köchin winkte ab. »Wie oder was Kunigunde von Rappoltstein ist, kann uns egal sein. Für uns wird sie die neue Herrin.«
Die neugierigen Blicke seiner Kameraden auf sich wissend, trumpfte der Vasall noch einmal auf.
»Herrin hin oder her«, rief er laut. »Der Graf ist auch nur ein Mann!«
Dann hob er seinen Weinbecher und prostete seinen Kumpanen zu, um zu unterstreichen, dass er sich von einem Weibsbild nicht über das Maul fahren ließ, auch nicht von der Köchin der Montfort.
Unbeobachtet betrat eine alte Magd die Küche. Sich auf ihren Stock stützend, humpelte sie auf den letzten freien Platz zu.
»Rückt zur Seite!«, murrte sie aus zahnlosem Mund. »Das ist mein Platz.«
Hanna wollte aufbegehren, hielt dann aber inne. Irgendetwas im Gesicht der Alten stimmte sie versöhnlich. Als die Alte zitternd nach dem Tonkrug griff, kam sie ihr zuvor.
»Warte, ich helfe dir.«
Die Alte quittierte ihr Angebot mit einem Knurren.
»Der Graf heiratet?«, fragte Hanna leise, nachdem sie den Becher der Alten mit verdünntem Wein gefüllt hatte.
Zu ihrem Leidwesen reagierte die alte Magd nicht.
»Vielleicht ist sie schwerhörig?«, vermutete Lena. »Auch mit ihrem Augenlicht scheint es nicht mehr weit her zu sein.«
Unter Mühe gelang es der Alten, ihren Becher zum Mund zu führen. Als die Köchin einen Topf Bohnensuppe auf den ersten Tisch stellte und eine der Mägde anwies, die Schüsseln zu füllen, kam Hektik auf.
Nach dem tagelangen Marsch, lediglich versorgt mit altem Brot und getrocknetem Fisch, gierten die Neuankömmlinge nach etwas Warmem.
»Pech gehabt«, sagte die Alte zerknirscht. »Heute ist kein Fleisch drin.«
Erstaunt drehte Hanna den Kopf. Die Alte hatte gesprochen und dies keineswegs so laut, wie es Schwerhörigen sonst eigen war.
Auch ohne Fleisch schmeckte die Bohnensuppe einfach köstlich. Die wohlige Wärme machte dem Knurren der Gedärme ein Ende.
»Willst du auch einen Kanten Brot?«, fragte Hanna die Alte, wobei sie sich streckte, um eines der letzten Stücke zu ergattern, die eine der Mägde eben auf dem Tisch verteilt hatte.
»Danke«, murmelte die Alte, wobei sie das Weiche aus dem Stück herauspulte und den Rest Hanna hinschob.
»Ja, bereits das dritte Mal.«
»Was, das dritte Mal?«, fragte Hanna zwischen zwei Bissen.
»Unser Graf heiratet bereits das dritte Mal. Der Gute hat Pech mit den Frauen.«
Hanna schmunzelte. Die Alte hörte offenbar nicht nur gut, sie war auch eine Fundgrube für Tratsch. Von den übrigen Mägden würden sie dagegen so schnell nichts erfahren.
»Die eine stirbt im Kindbett, mitsamt dem Jungen, die andere erliegt den Pocken, kaum war sie hier«, fügte die Alte achselzuckend hinzu.
Bei der Erwähnung der Pocken fuhr Hanna zusammen. Sie selbst war dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Der jetzige Fieberschub war ein lästiges Überbleibsel der Krankheit. Vor den Pocken war sie so gut wie nie krank gewesen, sah man von ihrem Fehltritt in eine der Fallen ab, bei dem sie beinahe ihren Fuß verloren hätte. Seither hinkte sie.
»Wollen wir hoffen, dass unser Herr dieses Mal mehr Glück hat. Die Montfort braucht Söhne, starke und gesunde Männer«, fuhr die Alte kichernd fort.
Zu gerne hätte Hanna der Alten weiter gelauscht, wäre nicht in diesem Augenblick die Köchin auf sie zugekommen. Offenbar musste das Spanferkel mit einer Paste eingestrichen werden, wie der Topf in ihren Händen verriet. Neuerlicher Qualm würde sich ausbreiten und das Atmen zur Qual machen.
»Gertrud mag keine Tratscherei!«
Die Alte duckte sich über ihre Schüssel und begann mit zittrigen Fingern die mittlerweile weichen Brotstücke aus der Bohnensuppe zu picken.
Als das Spanferkel wie eine Speckschwarte glänzte und Gertrud wieder vor ihren Kochtöpfen stand, ließ Hanna es sich nicht nehmen, einen Blick über ihre Schulter zu werfen. Mit Gertrud durfte man es sich nicht verscherzen, dies bezeugte der Respekt, den ihr die Gesindeschar entgegenbrachte. Zu gerne hätte sie die Alte weiter ausgefragt, doch sie wollte die Frau nicht in Bedrängnis bringen, zumal die Köchin immer wieder in ihre Richtung starrte.
Hanna seufzte.
Die Strapazen der letzten Tage, verbunden mit der wohligen Wärme der Burgküche zeigten allmählich Wirkung. Etliche der Neuankömmlinge waren bereits eingeschlafen, während an den anderen Tischen die Stimmung stieg. Die Vasallen und Knechte sangen gemeinsam von Wein, Weib und Kampf, wobei jeder den anderen in Lautstärke und Gestik übertrumpfen wollte.
»Für wen ist denn das Ferkel?«
Hanna nutzte die Gunst der Stunde, um ihre Neugier zu befriedigen. Gertrud stand zwei Tische entfernt und unterhielt sich eben mit einem der Vasallen.
»Unser Graf erwartet hohen Besuch.« Die Alte kicherte. »Wenn wir Glück haben, bringt der Bischof wieder sein Magenleiden mit.«
Offenbar war der Met auch der Alten zu Kopf gestiegen. Hanna schenkte ihr ein mitleidiges Lächeln, wobei sie den würzigen Duft des Ferkels tief in ihre Lungen sog. Was hätte sie für ein Stück saftigen Fleisches gegeben!
»Wenn der Bischof sein Zipperlein mitbringt, bekommt er keinen Bissen herunter.« Ein Stupsen der Alten brachte sie in die Wirklichkeit zurück. »Das Ferkel … Wenn er nicht essen kann, bleibt für uns mehr übrig. Bist wohl etwas schwer von Begriff, aber das lernst du hier schon noch.«
Das erneute Kichern der Alten erregte ihren Unmut. Sie wollte ob der Beleidigung bereits zur Gegenwehr ausholen, besann sich dann aber doch eines Besseren.
»Hier, nimm!«, sagte die Alte versöhnlich, dabei steckte sie Hanna unter der Tischplatte ein Stück geräucherten Schinken zu. »Versteck es unter deinem Rock. Soll niemand wissen, dass ich mir heimlich die guten Stücke hole.« Wieder kicherte die Alte, doch dieses Mal fühlte sich Hanna alles andere als beleidigt.
Hastig ließ sie das gute Stück in der Falte ihres Rockes verschwinden. Sollte Gertrud sie erwischen oder eine der Mägde sie beobachtet haben, dann würde sie hier auf der Montfort nichts mehr zu lachen haben. Hanna schluckte hart, als sie an das Büßerloch dachte. Auch wenn sie noch nie eine Burg betreten hatte, das Wissen um diesen Kerker gehörte zu den Schauermärchen, die die Alten in ihrem Dorf erzählt hatten. Ihr Körper war gespannt wie ein Flitzbogen.
»Los, aufstehen!« Mechanisch langsam wandte Hanna ihren Kopf, dabei umklammerten ihre Finger das Stück Fleisch in der Rockfalte. Erst als die beiden Frauen ihr gegenüber sich ebenfalls erhoben, entspannten sich ihre Muskeln.
»Komm, Lena, raff dich auf!«, flüsterte sie leise in Richtung ihrer schlafenden Freundin. »Wir sollten den Mann nicht weiter verärgern.«
Der Vasall stampfte bereits ungeduldig mit dem Fuß, ein Zeichen, dass seine Geduld am Ende war.
»Wollen wohl nicht ganz so wie du«, hänselte ihn einer seiner Kumpane am Nachbartisch. »Musst ihnen halt zeigen, wer hier der Meister ist!«
Der Vasall ließ seine Faust auf die Tischplatte krachen. Die Schmach zuckte um seine Mundwinkel.
»Wenn ihr weiter so trödelt, könnt ihr die Nacht draußen im Burghof verbringen! Mir soll’s recht sein!«
Lena fuhr erschrocken hoch. Der barsche Tonfall des Mannes riss sie aus ihrer Lethargie.
»Bin ich eingeschlafen?«
Hanna nickte. »Bist nicht die Einzige«, dabei zeigte sie mit vorgestrecktem Kinn in Richtung der Männer und Frauen, die sich gähnend erhoben.
»Macht vorwärts! Ich habe keine Lust, mir wegen euch die Nacht um die Ohren zu schlagen.«
»Recht so. Nimm sie nur hart ran, damit sie wissen, was sie hier erwartet!«, rief sein Kumpan vom Nachbartisch abermals, wobei er seinen Becher hob und allen zuprostete.
Allgemeines Gejohle bezeugte, dass er mit seiner Meinung nicht alleine dastand. Die Stimmung nahm mit jedem Atemzug an Spannung zu.
»Komm, Lena. Wir wollen ihn nicht unnötig reizen. Reicht schon, wenn es seine Freunde tun.«
Der Vasall legte seine Hand auf die Peitsche, deren Knauf gut sichtbar am Gürtel hing. Als ein älterer Mann neben Hanna ins Straucheln geriet, nutzte er die Gelegenheit und versetzte ihm einen Tritt. Beifall rufend wurde seine Tat vom Nebentisch zur Kenntnis genommen, womit der Nimbus der Überlegenheit wiederhergestellt war.
Erleichtert, der aufgeheizten Stimmung entkommen zu können, taumelten die Neuankömmlinge dem Ausgang entgegen. Der Vasall griff sich eine der Nachtfackeln und schwang sie wie eine Trophäe über seinem Kopf.
Kalte Luft schlug ihnen entgegen, kaum hatten sie die ersten Schritte im Burghof getan. Wolkenberge hatten sich vor den Mond geschoben, sodass sich die Silhouetten der Wirtschaftsgebäude dunkel gegen den Nachthimmel abzeichneten.
Stolpernd versuchte die Schar mit dem Vasallen Schritt zu halten.
Das Gesindehaus verdiente seinen Namen kaum. Doch es war trocken und das zählte im Augenblick mehr als saubere Binsen und ein lausfreier Strohsack. Mit Erleichterung nahm Hanna die Trennung von Männern und Frauen wahr, wenn sie auch nur aus einer dünnen Holzwand bestand. Den Geräuschen nach zu urteilen besaßen die Knechte der Montfort jedoch noch genügend Ausdauer, die dünne Holzwand zu umgehen und sich ihr Vergnügen zu suchen. Als endlich so etwas wie Stille einkehrte, begann irgendwo in der Tiefe des Raumes jemand so lautstark zu schnarchen, dass selbst Ratten und Mäuse das Weite suchten.
Hanna hielt sich die Ohren zu. Was würde sie morgen erwarten? Sollte sie dem Rat des Vasallen folgen und ihr Mundwerk zügeln? Sie konnte das nur schlecht, es war eine dumme Angewohnheit von ihr, alles infrage zu stellen. Das gehört sich nicht für eine Leibeigene, hatte ihre Mutter stets gesagt, doch sie konnte nicht anders. Deine Neugier bringt dich noch einmal ins Grab, war ein anderer Lieblingssatz ihrer Mutter gewesen. Ob sie damit recht behalten würde?
Allmählich wurden Hannas Augenlider doch schwer. Das Letzte, was sie spürte, war Lenas magerer Körper, der sich eng an sie schmiegte.
Mit dem ersten Hahnenschrei kam die Aufregung. Einer der Vasallen polterte ins Gesindehaus. Der Unmut der alteingesessenen Gesindeschar ließ nicht lange auf sich warten. Die Beschimpfungen mit einer Geste abwinkend, stand der Mann breitbeinig in der Mitte des Raumes, die Arme in die Hüften gestemmt und blickte mürrisch auf die Neuankömmlinge.
»Die Neuen in den Burghof!«, rief er mit heiserer Stimme. Der Met der letzten Nacht hatte seine Spuren hinterlassen, nicht nur an seiner Stimme, auch im Gesicht. Rot geschwollene Augen und dunkle Ringe zeugten vom übermäßigen Alkoholgenuss.
»Macht vorwärts!«
Schlaftrunken rappelten sich die Frauen auf. Die Kälte der Nacht hatte ihre geschundenen Glieder noch steifer werden lassen. Hustend und von Flüchen begleitet, bahnten sie sich ihren Weg in Richtung des Ausgangs. Die Nacht hatte es nicht geschafft, ihre Kleider zu trocknen. Sie froren jetzt schon entsetzlich.
Die Natur war in diesem Landstrich hart und unerbittlich, dies wurde ihnen bewusst, kaum hatten sie den ersten Schritt im Burghof gemacht. Die Arme um die Brust geschlungen, drängten sich die Frauen zusammen.
Vom Sodbrunnen her drang Geschnatter. Eine Schar Gänse stürmte in wildem Aufruhr dem Stall entgegen, getrieben von der Haselrute eines Jungen. Zwei Mägde, ihre Kopftücher tief ins Gesicht gezogen, traten hinter ihnen aus dem Gesindehaus und beäugten sie misstrauisch, ehe sie langsam, eine Atemwolke vor sich hertreibend, über den Burghof in Richtung des Sodbrunnens gingen.
Jetzt, im Morgengrauen, wirkte die Burg noch imposanter. Der Palast war riesig und die vielen Türme mit ihren Zinnen machten Eindruck. Dunkel und einsam verlief der Hocheinstieg entlang der Burgmauer. Noch immer tummelten sich jede Menge Wächter auf den Wehrgängen, die Armbrüste griffbereit. Der Burghof selber war jedoch kleiner, als Hanna in der gestrigen Dunkelheit geglaubt hatte.
Die Einteilung der Neuankömmlinge war schnell gemacht. Der Stallmeister, ein Hüne mit flammend rotem Haar, hatte das Zepter übernommen. Während er den Großteil der Männer zur Feldarbeit oder in den Weinberg schickte, wies er die Frauen an, sich in der Burgküche zu melden. Dort würde ihnen Gertrud mitteilen, was sie zu tun hätten. Mit einer unmissverständlichen Geste forderte er die Männer auf, ihm zu folgen.
Die etwas ratlos zurückgebliebenen Frauen bissen sich auf die Zähne. Da sich die Schweinekoben unterhalb des Treppenaufstiegs befanden und ausgerechnet jetzt mit Wasser ausgespritzt werden mussten, fraß sich der Gestank zusätzlich in ihre nassen Lumpen.
Gertrud erwartete sie bereits. Mit zusammengekniffenen Augen musterte sie die Schar, die sich ängstlich in die Küche schob.
»Habt ihr euch etwa im Schweinematsch gesuhlt?« Sie schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
Hanna machte einen Schritt vor, denn sie spürte die Wut, die ihren Nacken hochkroch. Ein sanftes Zupfen ließ sie jedoch herumfahren. Lena schüttelte den Kopf.
»Die Blonde und ihr zwei, ihr helft in der Küche«, sprach Gertrud weiter, ohne von Hanna Notiz zu nehmen. »Die übrigen werden in der Waschstube arbeiten.«
Lenas Hoffnung, zusammen mit Hanna eingeteilt zu werden, war mit einem Schlag zunichtegemacht.
»Es gibt viel zu tun, also haltet euch ran!«, fuhr Gertrud mit fester Stimme fort. »Graf Wilhelm will alles blitzblank vorfinden. Dies gilt sowohl für die Kemenate der zukünftigen Gräfin wie auch für die unzähligen Wäschestücke, die sich noch in den Kästen befinden, bald jedoch den Weg in die Waschstube finden werden.«
Mit durchgedrücktem Rücken musterte Gertrud die Frauen, wobei sie sich ein Stöhnen nicht verkneifen konnte. Sie war nicht zufrieden mit dem Haufen und sie machte auch gar keinen Hehl daraus.
»Die Kästen und Truhen sind prall gefüllt, also jede Menge Arbeit für die Waschstube! Ich muss wohl nicht extra betonen, dass es sich hierbei um äußerst kostbare Stoffe handelt. Also behandelt die Stücke mit Vorsicht. Sollte mir auch nur der Hauch einer Zuwiderhandlung zu Ohren kommen, werde ich dem Grafen Meldung machen.«
Mittlerweile füllte sich die Burgküche langsam, aber stetig.
Die Arme in ihre wohlgeformten Hüften gestemmt, blickte die Köchin von einem Gesicht ins andere. Ihr üppig gewachsener Busen blähte sich bei jedem Atemzug und untermauerte ihre eindrückliche Gestalt. Niemand zweifelte daran, dass sie mit Unruhestiftern und Aufwieglern auch ohne den Grafen fertig werden würde. Sie war die Herrin des Gesindes und dies zeigte sie mit aller Deutlichkeit. In diesem Augenblick steckten zwei Mägde ihre Köpfe in die Küche.
»Hier sind die Decken und Kissen. Sollen wir sie in die Waschstube bringen?«
»Nein, lasst sie dort liegen. Dies können die Neuen machen.«
Mit einem Räuspern zog Gertrud die Frauen wieder in ihren Bann, die ihre Blicke kaum von den in allen Farben schillernden Kissen und Decken abwenden konnten.
»Kunigunde von Rappoltstein soll es an nichts fehlen, wenn sie hier eintrifft. Also macht euch an die Arbeit! Doch zuvor werdet ihr euch am Sodbrunnen die Hände waschen.«
Als ob die Wascherei etwas dazu beitragen könnte, dem Grafen einen weiteren Verlust einer Gattin zu ersparen, dachte Hanna trotzig. Ihren Kopf reckend, suchte sie die Küche nach der Alten von gestern Abend ab. Dabei blieb ihr Blick auf Lena haften, die nervös mit ihren Fingern am Rocksaum nestelte.
»Kopf hoch, Lena, wird schon nicht so schlimm werden«, flüsterte Hanna. »In der Küche ist es wenigstens warm und trocken.«
»Du hast gut reden«, wisperte Lena zwischen bewegungslosen Lippen.
»Hunde, die bellen, beißen nicht. Gilt sicher auch für Gertrud.« Hanna versuchte sich in einem Lächeln.
»Es ist auch nicht Gertrud, vor der ich mich fürchte. Erinnerst du dich an gestern, als der Vasall von Graf Wilhelm gesprochen hat?«
»Das war bestimmt ein Scherz. Den Grafen werden wir wohl kaum zu Gesicht bekommen.«
Gertrud schlug so laut mit der Kelle gegen die Kupferpfanne, dass die Frauen zusammenzuckten.
»Die Arbeit macht sich nicht von alleine.«
Auf einen Wink der Köchin löste sich eine der Mägde aus der Gesindeschar und trat auf die Frauen zu. Mit vorgeschobenem Kinn gab sie zu verstehen, dass sie ihr folgen sollten.
»Gib jeder von ihnen ein Paar der Holzpantinen!«, rief Gertrud der Magd nach, ehe diese mitsamt ihrer Schar in Richtung der Diele verschwand.
Mittlerweile war das Grau der Dämmerung dem beginnenden Tag gewichen, doch dies machte die Kälte nicht angenehmer. Mit Wehmut dachte Hanna an die Holztruhe ihrer Mutter, in der sich die warmen Beinlinge und der wollene Rock für den Winter befanden. Was hätte sie um die guten Stücke gegeben. Die Arme eng um ihren Leib geschlungen, stolperte sie über den Burghof. Auf der Höhe der Schweinekoben kam ihnen der Gänsejunge entgegen. Er musterte die Gruppe der Frauen mit hämischem Grinsen.
»Die Hübschen in die Küche, die Hässlichen in die Waschstube!«, neckte er.
»Die Dreckigen in den Koben, die Sauberen zu den Pferden!«, entgegnete Hanna schlagfertig, was ihr einen zornigen Blick des Jungen einbrachte.
»Hat dir wohl die Sprache verschlagen!«, rief Hanna spöttisch über ihre Schulter.
Hannas Schlagfertigkeit war ein Schutz, um ihre wahren Gefühle zu verbergen. Hier auf der Burg würde sie ihr Mundwerk allerdings zügeln müssen, wollte sie nicht nur den Gänsehirten gegen sich aufbringen.
»Wascht euch die Hände am Brunnen!« Die Magd hatte die Arme vor der Brust verschränkt und wippte ungeduldig mit dem Fuß. »Beeilt euch gefälligst, es ist saukalt!«
Hastig tauchten die Frauen ihre Hände in den mit Wasser gefüllten Bottich, trockneten die Finger an ihren Röcken, ehe sie der Magd in Richtung der Wäscherei folgten.
Die Waschstube, ein aus Stein gemauertes Wirtschaftsgebäude, befand sich am hinteren Ende des Burghofs. Schon beim Eintreten stach der scharfe Geruch in der Nase. Die kleinen Fensterluken unterhalb des Daches reichten kaum aus, um den Kaskaden von Dampfwolken Herr zu werden. Innerhalb weniger Minuten klebten die Kleider am Körper.
Von Neugier getrieben, ging Hanna auf einen der drei großen Waschzuber zu, die in der Mitte des Raumes standen. Sie war ihren ganzen Lebtag noch nie in einer Waschstube gewesen. In Veltkirchen wuschen sie die Wäsche im See, brachten sie anschließend auf den Bleichanger oder trockneten sie an einer Leine.
»Großer Gott!«, rief die Obermagd händeringend, als sie der neuen Hilfskräfte ansichtig wurde. »Was schleppst du mir denn da an?«
Die Frage war an die Magd gerichtet, die entschuldigend die Hände hob.
»Sie sollen in der Waschstube helfen, hat Gertrud befohlen. Hier sind übrigens auch die Decken und Kissen aus der gräflichen Kemenate.«
»Stell sie da drüben hin. Ich möchte nicht, dass sie unter die Schmutzwäsche der Knechte geraten. Die neue Gräfin soll nicht glauben, dass wir alle nach Pferdescheiße stinken.«
Die Obermagd warf erst einen Blick auf den prall gefüllten Weidenkorb, ehe sie die Frauen einer kritischen Musterung unterzog.
»Dass ihr mir diese kostbaren Stücke ja nicht mit euren dreckigen Händen betatscht!«, befahl sie, während die Magd unter dem Türsturz verschwand.
»Wie immer bleibt das Gesindel an mir hängen. Also, als Erstes wascht ihr euch da hinten im Bottich Hände und Füße. Wie ich sehe, hat euch Gertrud bereits neue Holzpantinen gegeben. Gut so, denn hier drinnen geht es sauber zu. Anschließend kommt ihr wieder zu mir!«
Die Frauen nickten. Die Köpfe eingezogen, schlichen sie wie geprügelte Hunde auf den besagten Bottich zu. Das Wasser war eiskalt, und doch tauchte jede von ihnen wie befohlen Hände und Füße hinein. Selbst Hanna traute sich nicht zu erwähnen, dass sie die Hände bereits am Sodbrunnen gewaschen hatten. Die eindrückliche Gestalt der Obermagd mahnte sie zu Gehorsam.
»Wir waschen hier mit gutem alten Urin«, verkündete die Obermagd in salbungsvollem Ton. Dabei zeigte sie auf die unzähligen Holztröge an der hinteren Wand. »Normalerweise reicht dies völlig aus, um die Wäsche sauber zu bekommen. Doch da wir in den nächsten Tagen hohen Besuch erwarten, geben wir dem Waschwasser seit gestern Kreide und Laugensalz bei. Sollte uns auch nur der kleinste Fleck entgehen, wird Gertrud es uns büßen lassen.«
Ein Raunen machte die Runde, nicht zuletzt wohl auch deswegen, da in diesem Augenblick die übrigen Waschmägde die Waschstube betraten und die Frauen in die Ecke drängten. Insgesamt waren sie jetzt an die zwanzig Frauen, die Kinder nicht eingerechnet, die ebenfalls hier zu arbeiten schienen.
»Zwei zu jedem Zuber, die Restlichen an die Stöcke!«, hallte der scharfe Befehl der Obermagd durch das Gemäuer.
Noch bevor Hanna und ihre Begleiterinnen reagieren konnten, waren alle Waschzuber besetzt, was ein hämisches Grinsen auf die Gesichter der Waschmägde zauberte. Übrig blieben nur noch die Stöcke und bald schon merkten die Neuankömmlinge auch warum. Kaum hatte die Obermagd ihnen erklärt, was zu tun war, öffnete sich die Tür und Unmengen von Tüchern, Decken und Gewändern wurden hereingetragen. Innerhalb kürzester Zeit war kein freier Flecken auf dem Steinboden mehr auszumachen. Anschließend erschienen die Knechte mit den dampfenden Bottichen und dann ging es auch schon los.
Die Mägde an den Zubern glucksten vor Vergnügen, als das heiße Wasser in alle Himmelsrichtungen spritzte. Dann rafften sie ihre Röcke und kletterten immer zu zweit in die Zuber. Kreischend griffen sie sich an den Händen, um den Halt auf den Kleiderbergen nicht zu verlieren. Allein mit der Kraft ihrer Füße stampften sie die guten Wäschestücke immer tiefer in die Lauge. Dies taten sie so lange, bis die Obermagd mit einem Wink Einhalt gebot. Nach einem skeptischen Blick griff sie sich die saubersten der Wäschestücke und warf sie mit geübter Hand in den nächsten Zuber. Dort wurde der beißende Gestank des Urins wieder ausgewaschen, ebenfalls mit Hilfe blanker Füße, ehe die Wäsche zu den Stöcken kam.
Hanna spürte schon nach wenigen Minuten ihre Arme kaum noch. Während die beiden Frauen an ihrer Seite damit beschäftigt waren, den Wäschestücken mit Schlegeln und Stöcken zu Leibe zu rücken, war ihr die undankbare Aufgabe des Drehens zugedacht worden. Es war Schwerarbeit, die nassen Decken und Tücher zu wringen, bis kein Tropfen Wasser mehr entwich. Erst dann durfte sie die guten Stücke in einen der Körbe legen, damit sie auf Seile gehängt werden konnten. Die Obermagd kontrollierte jede ihrer Bewegungen mit Argusaugen, was die Arbeit nicht leichter machte. Unter der Dunstwolke ließ sich kaum noch atmen.
Hanna schwankte. Sie kämpfte verzweifelt gegen die Übelkeit. Doch es war zu spät. Mit letzter Kraft drehte sie sich von der Wäsche ab und dann schoss die Galle in hohem Bogen auf den Steinboden, unmittelbar neben dem Korb mit dem kostbaren Bettüberwurf der neuen Gräfin.
»Was ist mit dir?«, rief die Obermagd entgeistert, wobei sie ruckartig den Korb mit dem kostbaren Stoff zur Seite riss. »Bist du etwa krank?« Mit zusammengekniffenen Augen fixierte sie erst Hanna, dann den grünlichen Schleim auf dem Boden.
»Nein, nein«, versicherte Hanna schnell. »Es ist nichts. Der lange Fußmarsch und … und …«
»… und jetzt ist ohnehin Zeit für eine Stärkung! Das wird sie wieder auf die Beine bringen«, kam ihr eine der älteren Mägde zu Hilfe. »Bestimmt ist Gertrud in der Küche mit dem Morgenmahl bereit.«
Die Arme vor der Brust verschränkt, stand die Obermagd da.
»Erst wischst du den Dreck aber weg«, sagte sie einlenkend. »Und wehe dir, wenn das noch einmal vorkommt!«
Hanna fuhr sich mit der Hand über den Mund. Doch der gallige Geschmack ließ sich nicht so leicht vertreiben.
»Warum hilfst du mir?«, fragte Hanna leise, nachdem sie sicher sein konnte, dass die Obermagd sie nicht mehr hörte.
»Wenn ihr nicht wäret, würden wir die schwere Arbeit allein erledigen müssen«, entgegnete die Frau achselzuckend. »Die Arbeit an den Stöcken hält niemand lange durch.«
Die übrigen Mägde schüttelten die Köpfe, woraufhin die Frau hastig wieder an ihren Zuber ging. Was Gertrud in der Burgküche war, war die Obermagd in der Waschstube. Man konnte es wohl nur als Dummheit bezeichnen, dass sich eine von ihnen für die Neue einsetzte.
»Wisch den Dreck endlich weg!«, rief die Obermagd abermals, diese Mal jedoch hörbar gereizter, durch die Waschstube. »Ansonsten wird es für dich kein Morgenmahl geben. Und ihr anderen haltet hier nicht Maulaffen feil! Die Wäsche in die Körbe, erst dann gehen wir in die Küche!«
Hannas Hände zitterten, als sie den Wasserkrug griff, um ihr Malheur zu beseitigen. Zum Glück zeigte der Boden grobe Fugen zwischen den einzelnen Steinen, sodass die Galle im Nu verschwunden war. Der Schwächeanfall kam nicht von der Arbeit, das wusste Hanna, das Fieber war während der letzten Stunden gestiegen. Als die Obermagd endlich das Zeichen zum Aufbruch gab, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Sie wagte nicht, daran zu denken, was mit ihr geschehen würde, wenn das Fieber entdeckt wurde. Nach Veltkirchen würde sie bestimmt niemand zurückbringen, der Aufwand für eine einzelne Magd wäre zu groß. Da machte sie sich keine Illusionen. Sie konnte froh sein, wenn man sie nicht wie einen räudigen Hund einfach bei Nacht und Nebel über die Burgmauer werfen würde.
Den Gang über den Burghof brachte Hanna mehr strauchelnd als aufrecht gehend hinter sich. Warum nur musste sich das Hinken ausgerechnet in solchen Situationen verstärken? Reichte es Gott nicht, sie mit dem wiederkehrenden Sumpffieber zu strafen, warum auch noch der Makel eines hinkenden Beines? Solche Gedanken sind Blasphemie, hatte ihre Mutter stets gesagt und sie deshalb gescholten.
Hanna sog die Feuchte des Morgens tief in ihre Lungen. Dichte Nebelschwaden umhüllten die Burg. Noch immer bellte irgendwo in der Nebelsuppe der Hund.
Zu ihrem Erstaunen hielt die Obermagd nicht auf den Hocheinstieg zu, sondern schwenkte unmittelbar davor ab, auf eine kleine Holztür zu. Dies musste wohl ein zweiter Eingang zur Burg sein, wie Hanna der Selbstverständlichkeit entnahm, mit welcher ihr die Mägde folgten. Als die Tür hinter Hanna in die Angeln fiel, war es mit einem Schlag stockfinster. Einzig das Keuchen der Magd vor ihr verriet, welche Richtung sie nehmen musste. Zum Glück war der Gang so eng, dass ans Umfallen nicht zu denken war. Schritt für Schritt kämpfte sie sich die Treppenstufen nach oben.
Die Burgküche war bereits zum Bersten voll. Knechte, Mägde und Vasallen drängten sich auf den Holzbänken. Die Stimmung war ausgelassen, ja beinahe übermütig. Der Lärmpegel erreichte seinen Höhepunkt, als Gertrud das Zeichen gab, die dampfenden Schüsseln auf den Tischen zu verteilen.
Hanna setzte sich wieder an den hintersten Tisch. Die Alte von gestern warf ihr ein zahnloses Lächeln zu. Zu ihrem Leidwesen war von Lena weit und breit nichts zu sehen.
»Heute gibt’s Blutwürste«, frohlockte die Alte, wobei sie sich die Hände rieb. Speichel tropfte ihr aus dem Mund. »Gestern war Schlachttag, ein Glück für uns.«
Der alleinige Anblick der dunkelroten Würste reichte, um Hannas Magen erneut in Aufruhr zu bringen. Den Würgereiz unterdrückend, blickte sie hastig zur Seite.
»Magst du keine Blutwürste?«, fragte die Alte hoffnungsvoll.
»Kannst meine Portion gerne haben.«
Hanna schob der Alten ihren Teller hin. Sie schluckte hart, doch der gallige Geschmack ließ sich nicht vertreiben. Ihre Kehle brannte. Als das Roggenbrot gereicht wurde, steckte sie sich vorsorglich ein Stück in die Tasche.
»Du brauchst nicht zu hamstern«, sagte die Alte grinsend. »Auf der Montfort leiden wir keinen Hunger.«
Die Alte konnte gut reden, dachte sich Hanna. Wenn herauskam, dass sie krank war, würde man sie kaum noch in die Burgküche lassen. Es war allemal besser, sich einen kleinen Vorrat anzuhäufen, als irgendwo im Dreck zu verhungern.
»Hast du meine Freundin, die Lena, gesehen?«, fragte Hanna leise, wobei sie den Kopf nach beiden Seiten reckte. »Sie ist zum Küchendienst eingeteilt, doch ich kann sie nirgends entdecken.«
»Einige der Mägde sind noch draußen beim Schlachter. Müssen wohl noch warten, bis die Würste fertig sind.«
»Die Würste? Wir essen doch gerade welche.«
»Die Räucherwürste«, entgegnete die Alte unwirsch, wobei sie sich gierig ein weiteres Stück Blutwurst in den Mund schob. »Leberwurst, Hirnwurst, Schinkenwurst, Speckwurst, bei uns wird alles geräuchert. Darum hat Gertrud auch den großen Kamin angefeuert. Da oben ist die Rauchkammer.« Die Alte wies mit dem Kinn gegen die Decke. »Wird bei euch in Veltkirchen nicht geräuchert?«
»Doch, doch«, versicherte Hanna schnell.
In den Binsen lebten sie vom Fischfang und dieser wurde eher in Salzlauge eingelegt oder an der Luft getrocknet.
»Willst du wirklich nichts von der Blutwurst?«, fragte die Alte zwischen zwei Bissen. »Sie schmeckt herrlich.«
Hanna schüttelte den Kopf und hielt weiterhin Ausschau nach Lena. Gerade kamen zwei Mägde durch die Tür, doch Lena war wieder nicht dabei.
Je länger das Morgenmahl dauerte, desto schwieriger wurde es für Hanna, sich aufrecht zu halten. Sie fror und schwitzte beinahe gleichzeitig. Ihr Rock klebte mittlerweile wie eine zweite Haut am Körper. Jede Faser ihres Körpers sehnte sich nach dem Strohsack im Gesindehaus. Doch bis sie ihrem Bedürfnis nach Schlaf nachgeben durfte, würden noch Stunden vergehen. Sie wusste nicht, wie sie diese in der feuchten Waschstube überstehen sollte.
Allmählich fielen ihr die Augen zu. Das Letzte, was sie wahrnahm, waren die beiden riesigen Kästen an der gegenüberliegenden Wand, die das gute Tafelsilber und die kostbaren Decken für die Bankette des Grafen enthielten, Decken, die wohl die nächsten Tage in die Waschstube kommen würden.
»Jetzt wird nicht geschlafen, die Arbeit wartet!« Die Obermagd stand mit in die Hüften gestemmten Armen hinter Hanna. »Mach schon, die anderen sind bereits auf dem Weg in die Waschstube!«
Hanna murmelte etwas von einer Entschuldigung, dann erhob sie sich mit einem Seufzen.
Die Burgküche war bereits nahezu leer. Selbst die Alte an ihrer Seite war verschwunden, einzig Gertrud und zwei Mägde standen noch an der Feuerstelle. Die Geduld der Obermagd schien am Ende. Hanna biss die Zähne zusammen, erhob sich und schritt schwankend hinter der Obermagd der Tür entgegen.
Draußen empfing sie die Schroffheit dieses Landstrichs mit aller Härte. Nieselregen hatte eingesetzt und machte den wolkenverhangenen Nebeltag noch unangenehmer. Dampfende Misthaufen bezeugten, dass die Stallknechte bereits emsig bei der Arbeit waren. Hin und wieder drang die mahnende Stimme des Stallmeisters durch die Nebelschwaden, während der unsichtbare Hund noch immer bellte.
Hanna zitterte. Krampfhaft versuchte sie das Klappern ihrer Zähne zu unterdrücken, schlang die Arme um ihre Brust und folgte der Obermagd schweigend über den Burghof.
Die Montfort besaß die edelsten Pferde weit und breit, konnte man der Prahlerei der Stallknechte Glauben schenken. Zwei der Tiere standen an der Tränke, ihr Fell so schwarz wie Rabengefieder, ihr Körperbau muskulös und anmutig.
Unwillkürlich machte Hanna einen Bogen um die Tiere. Sie beschleunigte ihre Schritte, zumal die Obermagd die Waschstube bereits erreicht hatte und sich ungeduldig nach ihr umdrehte.
»Du kannst zusammen mit Heinrike die Arbeit am Urinzuber übernehmen«, sagte sie beim Eintreten. »Lass dir zeigen, wie es geht!«
»Sie mag dich«, empfing Heinrike sie. »Die Arbeit am Urinzuber ist wohl für die Nase eine Pein, nicht jedoch für die Muskelkraft.«
Hanna versuchte sich in einem Lächeln, was ihr jedoch nur halbherzig gelang, doch für Heinrike reichte es. Ihre anfängliche Feindseligkeit verschwand ebenso schnell, wie ihr Mundwerk in Fahrt geriet.
Gegen Mittag schwitzte Hanna bereits so sehr, dass ihr Kaskaden von Schweißbächen den Rücken hinabliefen. Eingelullt unter einer Dunsthaube von Urin und ätzenden Dämpfen rührte sie die Holzkelle. Das Fieber gaukelte ihr einmal ein Glitzern vor, ein anderes Mal glaubte sie, Hände zu sehen, die nach ihr greifen wollten. Von Panik ergriffen, umklammerte Hanna die Holzkelle fester. Sie kam sich vor wie ein einsamer Schiffer auf hoher See, ein Schiffer auf dem See hinter Veltkirchen. Als sie ihre Augen schloss, sah sie das Gesicht ihrer Mutter vor sich. Die alte Frau weinte und rief nach ihr. Hanna schluckte, dabei lockerte sie unmerklich den Griff, was zur Folge hatte, dass ihr die Holzkelle entglitt und mit einem schmatzenden Geräusch inmitten der Brühe verschwand.
»Macht vorwärts!«, rief die Obermagd mürrisch. »Die Wäsche macht sich nicht von alleine!«
»Kann jedem passieren«, sagte Heinrike achselzuckend, wobei sie sich die Kelle angelte und sie Hanna hinhielt. »Wenn du sie weiter unten fasst, geht dir die Arbeit leichter von der Hand.«
Dankbar für den Hinweis umklammerte Hanna die Holzkelle fortan mit eisernem Griff. Wie viele Decken, Kissen, Tücher und Röcke sie untergetaucht, gedreht und geschlagen hatte, konnte sie am Ende des Tages nicht mehr sagen, doch als das letzte Tageslicht schwand, sackte sie erschöpft neben den Rand des Zubers zusammen.
»Heinrike und Hanna, ihr bringt die Flickwäsche noch nach drüben. Anschließend kommt auch ihr in die Burgküche!«
»Dort drüben, die beiden Körbe.« Heinrike wies mit dem Kinn auf die zwei Weidenkörbe. »Sie sind nicht schwer und die Flickstube ist nicht weit.«
Die Flickerinnen waren nicht sehr erfreut, als sie die Körbe hinstellten, doch dies war Hanna egal. Auf das Nachtmahl verzichtete sie mit der Ausrede, zu müde zu sein. Heinrike starrte sie verständnislos an, gab sich aber damit zufrieden.
Mit einem Seufzen ließ sich Hanna wenig später auf ihrem Strohsack nieder. Mittlerweile schmerzte jeder einzelne Muskel ihres Körpers und auch die Zunge klebte unnatürlich an ihrem Gaumen. Doch all dies war ihr in diesem Augenblick egal, Hauptsache sie konnte schlafen. Als sich Lena irgendwann in der Nacht neben sie drängte, nahm Hanna kurz den Geruch nach Feuer und Kohle wahr. Doch sie war zu schwach, um die Augen zu öffnen.
Anderntags kam Hanna nicht von ihrem Strohsack hoch. Das Fieber hatte sie fest im Griff. Lena und Heinrike beschlossen, dies vorerst für sich zu behalten, denn Fieber war auf keiner Burg erwünscht.
Die Obermagd zu täuschen war ein Leichtes, zumal heute Bleichtag war. Heinrike bekräftigte glaubwürdig, dass sie Hanna inmitten der Mägdeschar in Richtung Bleichanger marschieren gesehen hatte. Die Arbeit dort würde den ganzen Tag über dauern, somit blieb ihr genügend Zeit, sich bis zum Abend eine neue Ausrede einfallen zu lassen, sollte Hanna noch nicht genesen sein.
Bei Gertrud war die Sache schon schwieriger. Die Köchin war bekannt für ihren Scharfsinn. Lenas Stottern tat ihr Übriges.
»Wo ist sie?«, unterbrach Gertrud die eingeschüchterte Lena schroff.
»Im … im Gesindehaus.« Lena hielt dem Druck der Köchin nicht lange stand. »Ich … wir dachten, es sei besser, sie …«
»… sie was?«
Gertrud schlug die Hände über dem Kopf zusammen ob so viel Dummheit. Ihr Instinkt hatte sie nicht getäuscht.
»… sie liegen zu lassen«, schloss Lena ihren Satz, wobei sie den Blick starr auf ihre Holzpantinen gerichtet hielt.
»Ausgerechnet jetzt, wo doch der Graf jeden Augenblick in Begleitung des Bischofs erwartet wird. Womöglich hat diese Hanna noch die Pest!«
»Pest? Wer hat die Pest?« Hellhörig geworden trat eine der jungen Mägde näher heran.
»Niemand hat die Pest.« Gertrud schob die Magd beiseite, doch die ließ nicht so leicht locker.
»Ist es diese Neue? Die mit dem Hinkebein?«
»Wenn du nicht sofort dein Maul hältst, kannst du den heutigen Tag im Keller bei den Mäusen verbringen.«
Gertruds Unmut wuchs mit jedem Atemzug, was die Magd keineswegs daran hinderte, weiterhin in der Küche zu bleiben. Sie tat zwar so, als interessiere sie das Gespräch zwischen Lena und der Köchin nicht, doch die Ohren hielt sie wohlwissend offen.
»Also, was ist mit Hanna?«, fragte Gertrud jetzt zwar deutlich leiser, dafür jedoch umso schärfer. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und fixierte Lena wütend.
Hilflos zuckte Lena mit den Schultern. Woher sollte sie wissen, was ihrer Freundin fehlte? Vielleicht war es wirklich die Pest, sie wagte nicht, daran zu denken.
»Ich weiß nicht«, murmelte sie verlegen. »Sie hat einfach nur Fieber, vielleicht von der Arbeit in der Waschstube.«
»Papperlapapp!«, zischte Gertrud. »Sie war schon krank, als sie hier ankam. Ich habe es an ihren Augen gesehen.« Die Köchin griff sich so ruckartig den großen Schürhaken, dass Lena erschrocken zurückwich.
»Weißt du, was Blatternfieber ist?« Gertruds Finger krallten sich so fest um den Griff des Schürhakens, dass ihre Fingerknöchel weiß hervortraten.
Lena zuckte abermals mit den Schultern. Blatternfieber? Also doch nicht die Pest? Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Man muss kein Medicus sein, um zu erkennen, dass deine Freundin die Pocken gehabt hat. Ihr Gesicht gleicht dem einer Kröte. Wollen wir hoffen, dass das Fieber wirklich nur daher rührt, sonst Gnade uns allen Gott!«
Lena hoffte, dass Gertrud mit ihrer Vermutung nicht falsch lag. Auch wenn sie nicht so recht wusste, was das Blatternfieber war, es hörte sich allemal besser an als die Pest.
»Du wirst hinab ins Dorf gehen und die alte Wibratha aufsuchen. Sie bewohnt die letzte Hütte. Du kannst sie nicht verfehlen, denn dahinter gibt es nur noch Wald«, sprach Gertrud leise weiter, wobei sie kurz über ihre Schulter blickte.
»Und was soll ich da?«, fragte Lena ebenso leise. Sie hatte keine Ahnung, wer oder was Wibratha war, doch irgendwie hatte sie kein gutes Gefühl bei der Sache, zumal ihr Gertruds Unruhe nicht entging.
Die Magd am Herd hielt den Kopf gesenkt. Auch wenn sie die Kelle rührte und so tat, als interessiere sie das eben Gehörte nicht, verriet ihre Haltung das Gegenteil.
»Du erzählst Wibratha vom Fieber«, beantwortete Gertrud die Frage seufzend. »Sie wird dann schon wissen, was zu tun ist. Wibratha weiß alles.«
Während Lena nickte, drehte sich Gertrud um.
»Und du«, jetzt wandte sie sich barsch an die neugierige Magd, »du verschwindest in den Holzschuppen. Ich will dich den ganzen Tag nicht mehr sehen. Und sollte auch nur ein Wort hiervon über deine Lippen kommen, wirst du die ganze Woche dort verbringen!«
Die Magd biss die Zähne aufeinander und ließ die Kelle in den Topf fallen, ehe sie aus der Küche stürmte.
»Das Gleiche gilt übrigens auch für dich«, wandte sich Gertrud wieder an Lena. »Ich will nicht, dass jemand von diesem gottverdammten Fieber erfährt. Hast du mich verstanden?«
Lena griff sich den Weidenkorb. Sie war froh, der Burg und seinen Bewohnern für eine Weile entfliehen zu können. Unter dem Portal zum Hocheinstieg blieb sie kurz stehen.
Nach Tagen voller Nebel und Regen blinzelte die Sonne erstmals zwischen den Wolkentürmen durch. Am Sodbrunnen stand eine Gruppe Mägde und blickte in ihre Richtung. Lena konnte nicht verstehen, worüber sie sprachen, doch die Art und Weise, wie sie sie musterten, bedeutete nichts Gutes. Von der neugierigen Magd war nichts zu sehen.