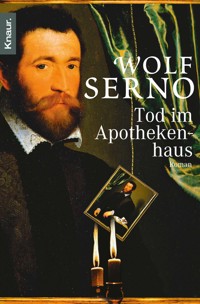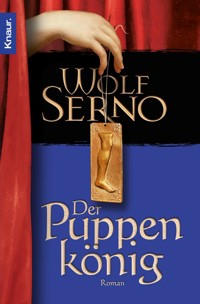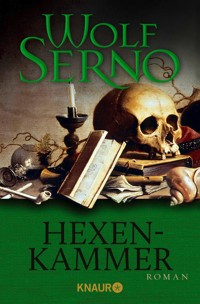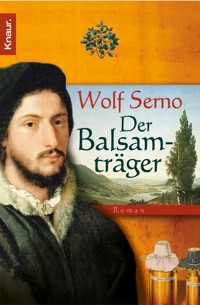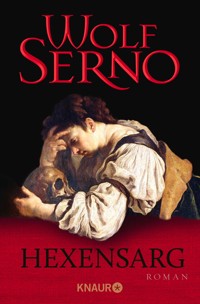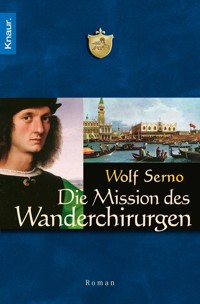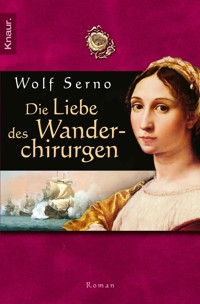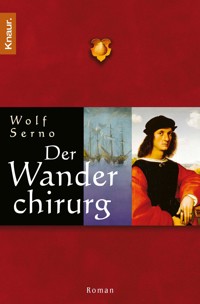
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderchirurgen-Serie
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1576 stirbt im nordspanischen Kloster Campodios der alte Abt. Kurz vor seinem Tod gesteht er seinem Lieblingsschüler Vitus, dass dieser ein Findelkind ist. Vitus lässt dieses Geständnis nicht mehr los: Er will das Geheimnis seiner Identität lüften – des Rätsels Lösung vermutet er in England. Auf seinem Weg quer durch Spanien muss er zahlreiche Abenteuer bestehen und macht sich als begnadeter Chirurg einen Namen. Der Wanderchirurg von Wolf Serno: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 968
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wolf Serno
Der Wanderchirurg
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Motto
Vorbemerkung
Widmung
Prolog
Der Abt Hardinus
Der Fuhrmann Emilio
Der Zwerg Toxil
Der Magister García
Der Landsknecht Martínez
Der Inquisitor Ignacio
Der Kerkermeister Nunu
Der Angeber Ozo
Der Bischof Mateo
Der Abt Gaudeck
Das Stotterkind Gago
Der Fechtmeister Arturo
Der Doctorus Bombastus Sanussus
Das Zigeunermädchen Tirzah
Der Glasschleifer Joaquin
Der Wirt Pancho
Der Kapitän Miguel de Nájera
Der Navigator Fernandez
Der Korsar Sir Hippolyte Taggart
Der Schlossherr Collincourt
Epilog
»Siehe, ich treibe böse Geister ausund mache gesund heut und morgen,und am dritten Tage werde ich am Ziel sein.Doch muss ich heute und morgenund am Tage danach noch wandern.«
Lukas 13, 32–33
Die Operationen und Behandlungen in diesem Buch spiegeln den wissenschaftlichen Stand des 16. Jahrhunderts wider. Zwar gab es schon damals Eingriffe, die sich im Prinzip bis in unsere Tage nicht verändert haben, und auch die Kräuter wirken heute nicht anders als vor über vierhundert Jahren, doch sei der geneigte Leser dringend vor Nachahmung und Anwendung gewarnt.
Für mein Rudel:
Micky, Fiedler und Sumo
Prolog
Das Wimmern der Frau drang durch die Decksplanken hinauf bis zum Achterkastell der großen Galeone. Es war ein Wimmern, wie Kapitän Hippolyte Taggart es noch nie gehört hatte: lang gezogen, klagend, immer wieder unterbrochen von einem kurzen, keuchenden Stöhnen. Es erinnerte Taggart an die Laute, die manche Huren ausstießen, wenn sie dem Freier höchste Lust vorgaukeln wollten. Doch Taggart wusste, dass hier nicht ein Akt der Fleischeslust stattfand, sondern vielmehr die Folge davon:
Im Unterdeck seines Schiffs wurde ein Kind geboren.
Taggart wandte sich um und blickte mit grimmiger Miene achteraus. Sein Gesichtsausdruck rief bei manchem seiner Männer noch immer eine Gänsehaut hervor, obwohl jeder wusste, dass Taggart nicht anders dreinblicken konnte. Dafür hatte vor Jahren ein spanisches Schwert gesorgt, das ihm die linke Gesichtshälfte gespalten hatte. Die Wundränder hatten sich beim Zusammenwachsen verzogen, wodurch ihm fortan der linke Mundwinkel herabhing.
Heute jedoch entsprach seine Miene genau seiner Stimmung. Auf ihrer Reise in die Neue Welt, zu der sie am 28. Januar anno 1556 von Portsmouth ausgelaufen waren, hatten sie vor zwei Tagen die Scilly-Inseln an Steuerbord passiert, und bis dahin war die Fahrt planmäßig verlaufen. Dann aber schien sich alles gegen sie verschworen zu haben. Das Wetter war umgeschlagen, schwarze Wolken hatten sich am Horizont zusammengeballt. Stürmische Böen aus West hinderten sie seitdem hartnäckig daran, sich von der französischen Küste freizusegeln. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, als so hoch wie irgend möglich an den Wind zu gehen, um wenigstens Kurs Südwest zu halten – immer in der Hoffnung, dem Sturm davonzusegeln und ablandigen Wind zu erwischen. Doch sie waren jetzt schon fast auf Höhe von La Rochelle, und wenn das so weiterging, würden sie an der nordspanischen Küste zerschellen. Taggart schnaufte verächtlich. Die Galeone, die er befehligte, war kaum besser zu segeln als das Nachtgeschirr einer alten Jungfer. Das Schiff, das man vor kurzem in Thunderbird umgetauft hatte, war zwar riesig in seinen Ausmaßen, aber wie alle in Spanien gebauten Galeonen auch äußerst hochbordig, mit schwerem Kastell auf dem Vorund Achterschiff. Das hatte zur Folge, dass es bei rauem Seegang wie ein Rohr im Winde schwankte und schlecht auf Kurs zu halten war.
Doch Taggart hatte sich sein Schiff nicht aussuchen können. Nachdem bei der Admiralität in London wieder einmal Ebbe in der Kasse geherrscht hatte, war es ihm wie vielen seiner Marinekameraden ergangen: Man hatte sie vorübergehend ausgemustert und auf Halbsold gesetzt. So war er froh gewesen, diesen Posten überhaupt bekommen zu haben. Maggy und die Kinder zu Hause in Cowes auf der Isle of Wight mussten etwas zu beißen haben, und überhaupt waren die Zeiten nicht rosig.
Wieder erklang das Wimmern.
Eine Frau an Bord!, dachte Taggart zornig. Er bildete sich zwar ein, nicht abergläubisch zu sein, aber er hatte trotzdem ein ungutes Gefühl dabei. Frauen an Bord zogen nichts als Ärger nach sich. Und die Frau, die jetzt da unten ihrer schwersten Stunde entgegensah, war dafür der beste Beweis.
Abermals das Wimmern.
Taggart musste zugeben, dass die Frau ausgesehen hatte wie eine richtige Lady, als sie vor wenigen Tagen an Bord gekommen war, auch wenn sie, wie Lord Pembroke betont hatte, weder seine Gattin war noch sonst irgendwie mit ihm verwandt. Aber wer war die Lady dann? Eigentlich eine krasse Unhöflichkeit des Lords, sie ihm nicht vorgestellt zu haben! Und schwanger war sie auch noch! Taggart zuckte mit den Schultern und beschloss, sich wieder seinen Pflichten zu widmen. Aus steifen Böen war in der letzten halben Stunde ein ausgewachsener Sturm geworden. Ihm davonzusegeln schien aussichtslos. Jetzt durfte keine Zeit mehr vergeudet werden.
»Mister Gordon! Mister Loom!«
»Sir?« Zwei Männer, die in respektvollem Abstand an der Querreling gestanden hatten, eilten herbei und nahmen Haltung an. Sie wussten, dass Taggart auf strenge Disziplin achtete und niemals ein Fehlverhalten durchgehen ließ, auch bei Offizieren nicht. Gordon, der Erste Offizier, war der Kleinere von beiden, ein drahtiger Mann mit flachsblondem Haarschopf und hektischen Bewegungen. Loom, der Segelmeister, war das genaue Gegenteil: groß, schwer, mit gewaltigem Brustkorb, über dem sich ein salzfleckiges Lederwams spannte.
»Mister Loom, was haltet Ihr von der Lage? Werden wir dem Sturm noch entwischen können?«
Der Segelmeister zögerte. Sein Kopf wanderte nach Steuerbord, wo eine turmhohe Wolkenwand nur noch wenige Meilen entfernt war. »Ich sag’s nicht gern, Sir«, meinte er dann, »aber wir schaffen’s wohl nicht. Fürchte, wir haben’s bisher nur mit ’nem kleinen Vorgeschmack zu tun. Das dicke Ende kommt erst noch. Wir sollten Tuch wegnehmen, um westlicher halten zu können.«
Seine Hand rieb unwillkürlich über das Wams. Taggart sah, dass die Stelle darunter wie eine Speckschwarte glänzte. »Können nur hoffen, dass der Orkan erst dann richtig einsetzt, wenn wir uns ums Cabo de Finisterre herumgestohlen haben. Anderenfalls …« Seine Hand rieb stärker. »Die Strömungen an Spaniens Küste sind so zahm wie ein Pitbull in der Grube.«
»Hm.« Was Loom gesagt hatte, entsprach genau Taggarts Befürchtungen. Himmel und Hölle und bei den Arschbacken Poseidons! Was würde er jetzt für ein gutes Schiff geben! Für eine englische Galeone mit niedrigem Schwerpunkt, die höher an den Wind gehen konnte und dadurch bessere Möglichkeiten böte, schnell aus diesem Schlamassel herauszusegeln! Taggart gab sich einen Ruck. Es half nichts, er musste es auch so schaffen.
»Ihr habt Recht, Mister Loom! Wir müssen da durch.« Sein Kopf wies in Richtung Wolkenwand. »Auf Biegen oder Brechen! Mister Gordon, bitte lasst ›Alle Mann!‹ pfeifen.«
»Aye, aye, Sir!« Gordon beeilte sich, den Befehl weiterzugeben.
»Bis auf das Marssegel am Fockmast sind sämtliche Segel in zehn Minuten gerefft, oder die Neunschwänzige tanzt einen Hornpipe auf den Rücken der Männer!«
»Aye, aye, Sir!«
Täuschte er sich, oder hatte der Wind tatsächlich nach Nord gedreht?
»Wind dreht nach Nord, Sir!«, meldete Gordon in diesem Moment.
»Was Ihr nicht sagt! Das Marssegel vom Fockmast wird als Vortrieb genügen, gleichzeitig fangen wir nicht mehr so viel Wind, die Krängung wird geringer, und die Steuerfähigkeit erhöht sich.«
»Recht so, Sir«, pflichtete Loom ihm bei, »wenn wir dem Sturm schon nicht entwischen können, sollten wir ihn abwettern! Was meint Ihr, Sir, sollen wir für alle Fälle Ersatztuch bereitlegen, falls uns das Marssegel wegreißt?«
»Macht das. Und lasst Äxte und Entermesser ausgeben, damit wir notfalls stehendes Gut kappen können.«
»Aye, aye, Sir!«
»Wer steht am Ruder?«
»Higgins, Sir.«
»Ablösen, den Mann. Er ist nicht erfahren genug. Wir sind dabei, dem Teufel ein Ohr abzusegeln. Rushmont soll seinen Posten einnehmen. Clyde unterstützt ihn. Ich will, dass wir mindestens Westsüdwest steuern. Die Männer sollen den Kolderstab so ruhig halten wie ein Waliser seinen Langbogen!«
Taggart hielt inne und überlegte kurz. »Mister Gordon!«
»Sir?«
»Ihr begebt Euch ebenfalls hinunter an den Kolderstab und achtet persönlich darauf, dass jede Mütze Wind genutzt wird, um auf ablandigen Kurs zu kommen!«
»Aye, aye, Sir!«
Beide Männer beeilten sich, die Befehle ihres Kommandanten auszuführen. Taggart war fürs Erste beruhigt. Er hatte getan, was man unter diesen Umständen tun konnte. Der Rest lag in Gottes Hand. Sein Blick ging nach vorn, wo das Vorschiff mit dem gewaltigen Kastell mühsam durch die immer höher werdenden Wogen stampfte. Weiß schäumende Gischt spritzte an Backbord und Steuerbord hoch und setzte das Hauptdeck wieder und wieder unter Wasser. Die Mannschaft, die unter äußerster Anspannung schuftete, war bereits völlig durchnässt. Taggart wünschte sich sehnlichst, die Männer würden ihr Handwerk besser verstehen, aber sie waren, wie so oft in dieser Zeit, ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der von guter Seemannschaft so viel verstand wie die Kuh vom Tanzen. Auch die Decksoffiziere und Offiziere waren nicht mehr das, was er seinerzeit als Captain Seiner Majestät Heinrichs VIII. gewohnt war. Gut, Gordon und Loom vielleicht ausgenommen …
Taggart seufzte. Sein Blick wanderte weiter nach Westen, dorthin, wo das Unwetter sich immer drohender zusammenzog. Er schätzte, dass der Sturm innerhalb der nächsten Minuten Orkanstärke erreichen würde. Doch die Maßnahmen, die er befohlen hatte, zeigten jetzt erste Wirkung. Die Männer am Kolderstab korrigierten behutsam die Kursrichtung. Gut so!, dachte er. Noch hatte er alles unter Kontrolle. Seine Hand packte die reich verzierte Reling der Steuerbordseite fester, während er mit den Beinen das Schlingern des Schiffsrumpfes ausglich. Er würde diesen Riesenkahn schon über das Westmeer bringen. Auch wenn die Thunderbird das erste Schiff spanischer Bauart war, das er führte. Lord Pembroke, dem es gehörte, hatte es der Englischen Krone abgekauft, die es ihrerseits einem Korsaren verdankte, der es unter dem Namen Santa Esmeralda gekapert hatte. Nun, Taggart sollte das recht sein, auch wenn eine Laune des Schicksals es wollte, dass die Galeone nun wieder in die Gewässer zurücksegelte, in denen sie einst aufgebracht worden war.
Er hatte sein Wort gegeben, Pembroke mitsamt seiner schönen Unbekannten an einen Ort zu bringen, der Roanoke Island genannt wurde und rund fünfhundert Meilen nördlich einer Halbinsel lag, die auf spanischen Seekarten als La Florida bezeichnet wurde. Er würde es schon schaffen! Zumal der Lord ihm für den erfolgreichen Abschluss der Reise ein hübsches Sümmchen zugesichert hatte.
Bildete er es sich ein, oder hatte das Wimmern aufgehört?
Er schnaufte ärgerlich. Lord Pembroke würde es ihm gleich höchstpersönlich verraten. Sein Kopf schob sich in diesem Augenblick Stufe um Stufe den Niedergang empor.
»Captain Taggart, Sir! Ich muss dringend mit Euch reden!« Die Stimme von Lord Pembroke wirkte alles andere als adelig. Der Mann hatte offenbar Angst.
»Was gibt’s, Mylord?« Taggart bemühte sich, seinen Tonfall nicht allzu gereizt klingen zu lassen. Er schätzte es nicht, wenn Landratten seinen Kommandostand auf dem Achterkastell enterten – und wenn sie zehnmal Lord Pembroke hießen. »Nun … äh …«, Pembroke suchte nach Worten, »Captain Taggart, ich mache mir offen gestanden große Sorgen um meine … äh … Schutzbefohlene. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass sie … äh … in gesegneten Umständen ist und ein Kind bekommt?«
»Das habe ich allerdings gehört, Mylord.« Taggart hoffte, dass die Doppeldeutigkeit seiner Worte dem Lord nicht entgehen würde.
»Nun … äh …«, die müden Züge von Pembroke nahmen jäh eine grüne Farbe an; er wandte sich nach Steuerbord und beugte den Kopf über die Reling, um sich zu erleichtern.
»Nicht hier!«, schrie Taggart barsch und dirigierte den Mann blitzschnell nach Backbord. »Solche Dinge erledigt man besser in Lee.« Mein Gott, womit habe ich das verdient!, dachte er. Ich halte hier diesen zuckenden Blaublüter über Bord, nur damit er sauber abkotzt, als hätte ich nichts anderes zu tun!
Pembroke zuckte und würgte eine kleine Ewigkeit. Dann richtete er sich keuchend wieder auf. »Ich danke Euch. Ich fürchte … äh … ich habe keine besonders gute Figur gemacht.« Seine Gesichtsfarbe wurde wieder etwas menschenähnlicher. »Ich möchte Euch bitten … äh … mir in die Kabine der Lady zu folgen, damit Ihr Euch selbst ein Bild von ihrem Zustand machen könnt.«
»Lord Pembroke«, Taggart merkte, wie ihm die Galle endgültig hochkam, »nicht nur, dass Ihr mir eine Frau an Bord gebracht habt, nicht nur, dass Ihr mir ihren Zustand verschwiegen habt, nein, jetzt soll ich auch noch den Geburtshelfer spielen.« Er tat einen Riesenschritt auf den Lord zu, denn in diesem Augenblick hob ein gewaltiger Brecher das Achterkastell hoch und brachte selbst seine seefesten Beine aus dem Gleichgewicht. »Nein, Mylord!«, schrie er unmittelbar vor Pembrokes gequältem Gesicht. »Ich stehe zwar in Euren Diensten, aber was zu weit geht, geht zu weit!«
»Sie stirbt, Captain Taggart!«
Des Lords Gesicht war aschfahl geworden. Taggart nahm es nur schemenhaft wahr, denn der Westwind, der jetzt Orkanstärke erreicht hatte, hüllte das gesamte Schiff in Millionen feinster Wasserpartikel ein.
»Was? Bei Satan, Beelzebub und Luzifer!« Taggart war jetzt richtig wütend. Ein toter Matrose an Bord, das mochte angehen und war fast etwas Normales, aber ein toter Passagier? Zudem eine Lady, die schwanger war und die Geburt nicht überlebt hatte? Bei Gott, das roch nach Ärger. Außerdem war er sicher, dass der Lord, wenn sie jemals wieder heil an Land kämen, nicht mehr so kleinlaut sein würde. Taggart beschloss, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Sein Blick prüfte noch einmal Kurs und Segelstellung der Thunderbird, dann ergab er sich in sein Schicksal.
»Gehen wir, Mylord«, sagte er, jetzt wieder ruhiger, »aber ich sage Euch gleich, mehr als zehn Minuten habe ich nicht. Das Schiff braucht mich.«
Beim Eintreten in die schmale Kabine wäre Pembroke fast über das Süll gestolpert und der Länge nach hingeschlagen. Taggart folgte ihm und erblickte eine füllige Person, auf deren Nase eine gewaltige Warze den Mittelpunkt bildete. »Äh … das ist Miss Bloomsdale, die Hebamme!«, stellte Pembroke vor.
Die Geburtshelferin nickte nur kurz, während sie sich an ein Balkenknie klammerte. Offenbar hielt sie nicht viel von Männern, die in ein Geburtszimmer eindrangen.
»Ich bin Captain Taggart!«, knurrte Taggart, der sich ebenfalls kaum Mühe gab, höflich zu sein. »Habt die Güte und tretet einen Schritt beiseite, damit ich mir ein Bild machen kann.« Er umkurvte die Dicke und näherte sich der Koje. Seine Hand schob den Vorhang beiseite. Auf dem Rand saß breitbeinig eine leichenblasse junge Frau, die stark schwitzte und heftig nach Luft rang. Ihre Kleider waren nach oben gerafft, darunter wölbte sich der Leib, einem Kürbis gleich, nach vorn. Die Oberschenkel schimmerten weißlich im Dämmerlicht.
»Halt!« Die Stimme der Hebamme übertönte spielend das Heulen des Sturms. »Ihr mögt der Kapitän sein, aber der Anstand verbietet, dass Ihr auch nur einen einzigen Blick auf die Gebärende werft.« Sie stemmte die Arme in die Hüften. »Solange Emily Bloomsdale noch einen Atemzug tun kann, wird sie verhindern, dass lüsterne Männeraugen sich am Fleisch einer Frau erfreuen.«
Taggart staunte.
Noch nie hatte es jemand gewagt, in diesem Ton mit ihm zu reden. Es juckte ihm in den Fingern, die dreiste Person eigenhändig über Bord zu werfen, doch er wusste, dass es keinen Zweck hatte, jetzt einen Streit vom Zaun zu brechen. Ihr großflächiges, maskenhaftes Gesicht erinnerte ihn an die Galionsfigur unter dem Bugspriet – einen aztekischen Krieger in voller Rüstung. Er stellte sich vor, dass anstelle des Indianers die Hebamme dort hinge. Das erheiterte ihn.
»Ihr habt ganz Recht, ich bin der Kapitän dieses Schiffs«, sagte er laut, »deshalb erwarte ich auch von jedem an Bord, dass er sein Handwerk beherrscht. Das gilt für die Offiziere ebenso wie für den jüngsten Matrosen.« Seine Stimme nahm einen drohenden Unterton an: »Und das gilt erst recht für Hebammen! Warum also, Miss Bloomsdale, seht Ihr Euch nicht in der Lage, die Aufgabe zu erfüllen, um deretwillen Ihr an Bord gekommen seid?«
Die Dicke schnappte nach Luft und wollte etwas sagen, doch Taggart kam ihr zuvor: »Warum holt Ihr das Kind nicht aus dem Bauch dieser Frau heraus?« Die Geburtshelferin schluckte. Taggart setzte nach: »Warum sorgt Ihr nicht dafür, dass ich wieder meiner Arbeit nachgehen kann und dieses Schiff rette?«
»Nun, Captain Taggart«, die Hebamme hatte ihre Sprache wieder gefunden, wenn auch einiges von ihrer Selbstsicherheit verschwunden war, »vielleicht wisst Ihr, dass ein Fötus normalerweise mit dem Kopf nach unten liegt. Hier aber ist das nicht der Fall, und darin besteht die Schwierigkeit. Das Fruchtwasser ist bereits vor Stunden abgegangen, seitdem quält sich die Arme.«
»Ich fürchte, ich kann Euch nicht ganz folgen.« Taggart hatte mit Maggy zwar selbst drei Kinder, aber keine Ahnung, wie sie auf Gottes Welt gekommen waren.
»Das Kind hat eine komplizierte Stellung, es liegt seitlich vor der Geburtsöffnung und kann nicht heraus. Ich habe versucht, es zu drehen, aber es war vergebens. Dazu kommt, dass die Mutter kaum noch in der Lage ist, richtig zu pressen.«
»Was bedeutet das?«
»Nun, wenn das Kind nicht innerhalb der nächsten Stunde geboren wird, dann stirbt es höchstwahrscheinlich. Und die junge Mutter dazu. Überhaupt ist es eine Sünde, so ein junges Ding mit einem derart schmalen Becken zu schwängern. Man sollte …«
»Schon gut!« Taggart hatte keine Lust auf einen weiteren Disput mit der streitbaren Hebamme. »Irgendwie muss das Kind doch herauszuholen sein! Gibt es denn gar keine Möglichkeit?«
»Es gibt eine. Aber ich habe von dieser Methode nur gehört: Man schneidet der Kreißenden den Leib auf, öffnet die Gebärmutter und holt den Fötus auf diese Weise heraus. Für das Kind mag diese Möglichkeit gut sein, für die Mutter allerdings …« Miss Bloomsdales Stimme nahm fast einen mitleidigen Klang an: »Doch ich denke, alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Und wenn Mutter und Kind sterben sollen, so haben wir Menschen das hinzunehmen.« Sie blickte nach oben zu den hin- und herschwingenden Decksbalken und schlug ein Kreuz.
»Nein!« Lord Pembrokes Stimme mischte sich überraschend scharf ein: »Ich habe die Verantwortung für die junge Lady, und ich bestehe darauf, dass alles Menschenmögliche unternommen wird, um wenigstens sie zu retten.«
Die Hebamme schnaubte wütend: »Bei allem Respekt, Mylord, aber …«
»Genug jetzt!« Taggart war zu einem Entschluss gekommen. Er steckte den Kopf aus der Kabinentür, wo ihm augenblicklich der Orkan den Kopf zur Seite riss, und schrie nach einem Läufer.
Kurz darauf meldete sich John, ein klatschnasser Schiffsjunge, der kaum älter als vierzehn Jahre alt war. Taggart betrachtete missbilligend die Wasserbäche, die sich auf die Teppiche ergossen, sagte aber nichts. »Meine Empfehlung an Mister Whitbread, den Wundarzt. Er möge umgehend in die Kabine der jungen Lady kommen.«
»Aye, aye, Sir!« Der Junge drehte ab und wollte loslaufen.
»Halt! Mister Whitbread soll sein chirurgisches Besteck mitbringen. Du bist mir persönlich dafür verantwortlich, dass er es nicht vergisst.«
»Aye, aye, Sir!«
Einige Zeit später erschien Jonathan Whitbread – und mit ihm eine mächtige Alkoholfahne. Rasch versuchte Taggart abzuschätzen, wie stark Whitbread dem Branntwein schon zugesprochen hatte. Ein betrunkener Chirurg nützte hier so viel wie gar keiner.
»Ihr habt mich rufen lassen, Captain?«
Gottlob, Whitbreads Zunge war nicht so schwer, dass er sich nicht ausreichend verständlich machen konnte. Seine Chirurgentasche hatte er ebenfalls bei sich, der Junge trug sie für ihn. Trotzdem war es ein nicht hinzunehmender Ungehorsam, dass er während des Dienstes Alkohol trank. Taggart musste an sich halten, um Whitbread, der immerhin Offizier war, nicht vor den Anwesenden abzukanzeln. Er schob den Gedanken beiseite. Was er jetzt brauchte, war ein Chirurg, der sein Fach wahrlich verstand. Und Whitbread tat das. Wenn er sich nicht gerade dem Alkohol widmete, war er ein Mediziner, der mit großem Geschick Stoß-, Hieb- und Splitterwunden versorgen konnte. Er hatte jahrelange Erfahrung im Richten von gebrochenen Knochen und verstand darüber hinaus einiges von der Urinschau. Aber wusste er auch etwas von der Anatomie einer Schwangeren? Taggart bezweifelte es. Trotzdem musste der Versuch gewagt werden.
»Mister Whitbread, ich möchte, dass Ihr Euch diese junge Frau anseht und dafür sorgt, dass sie entbinden kann. Sie versucht seit Stunden, das Kind herauszupressen, aber irgendwie klappt es nicht. Das ist alles.«
»Aber Sir, ich habe noch nie …«
»Das kann ich mir denken!«, unterbrach Taggart barsch. »Lasst Euch von Miss Bloomsdale einweisen und tut Eure Pflicht.« Es war immer gut, die Männer an ihre Pflicht zu erinnern. Es führte dazu, dass sie weniger darüber nachdachten, ob das, was sie tun sollten, richtig oder falsch war. Sie taten es einfach. »Ich verlasse mich auf Euch. Ich habe mich um das Schiff zu kümmern. Meine Damen, Mylord …« Er verneigte sich und verließ die Kabine.
Whitbread stand da und wusste kaum, wie ihm geschehen war. Eben noch hatte er in seiner Kammer gesessen und den Herrgott um besseres Wetter angefleht, wobei ihm ein Krug mit Brandy Gesellschaft geleistet hatte, jetzt fand er sich in einer Situation wieder, wie er sie noch nie hatte bestehen müssen. Seine Ausbildung, wenn man von einer solchen überhaupt sprechen konnte, hatte er in jungen Jahren im Süden Englands erfahren, genau genommen in Plymouth, wo anno 1539 ein privates Seemannshospital gegründet worden war. Dort hatte er zunächst als Mädchen für alles, später als Knochenschiener und Wundenvernäher gearbeitet. Weil er sich dabei geschickt angestellt hatte und sein Wissen im Laufe der Jahre immer größer geworden war, hatte man ihn eines Tages gefragt, ob er nicht als Wundchirurg auf einem Schiff Seiner Majestät fahren wolle. Der Sold und der Status eines Offiziers, der sich damit verband, hatten ihn gereizt, und er hatte zugesagt. Damals pflegte man noch nicht lange zu fragen, ob ein Schiffsarzt über ein anerkanntes Examen verfügte – wenn er nur sein Handwerk verstand.
Und nun diese blasse Frau dort auf dem Kojenrand. Whitbreads Schädel schmerzte, die Gedanken brummten wie Fliegen in seinem Schädel. Abgesehen von der Tatsache, dass seine Erfahrungen mit dem weiblichen Genitalbereich sich nur auf die Tätigkeit beschränkten, die jedem Mann geläufig war, verbot ihm auch der Kodex eines Arztes, diesen näher in Augenschein zu nehmen. Andererseits musste er sich ein Bild von der Problematik machen.
»Untersteht Euch, die junge Lady anzuschauen, geschweige denn anzufassen!« Miss Bloomsdale wollte weiteren Sittenverfall von vornherein im Keim ersticken. Sie schob ihren breiten Körper vor die Koje, sodass Whitbread die Sicht versperrt war. »Ihr könnt mir glauben, dass alles getan wurde, um eine Geburt einzuleiten, aber der Herrgott im Himmel hat anders entschieden.«
Sie blickte Whitbread streng an, wobei ihre Warze im fahlen Licht schimmerte. »Dennoch kann ich Euch Eure Arbeit nicht verbieten. Wenn Ihr also eine Idee habt oder einen Handgriff ausführen wollt, so werde ich Euer Werkzeug sein!«
»Tja, hm.« Whitbread wusste nicht, was er sagen sollte.
»Ich sehe, dass Ihr mit Eurem Latein am Ende seid, noch bevor Ihr mit der Behandlung begonnen habt.« Miss Bloomsdale konnte eine gewisse Genugtuung kaum verbergen: »Macht Euch nichts draus. Bei einer Geburt sind wir Hebammen ohnehin die besseren Ärzte.«
»Mag sein.« Whitbreads Kopf wurde allmählich klarer, er begann sich über diese fette Person zu ärgern. Immerhin galt er unter seinen Kollegen als einer der Geschicktesten mit dem Skalpell. Im Übrigen hatte er einen Befehl vom Kapitän. Und der hob alles andere auf. Auch das Anstandsempfinden von Hebammen. Sein Blick fiel auf die Wasserschüssel und die blutigen Tücher. Er wusste zwar noch nicht, was er unternehmen würde, aber er hatte in vielen Jahren gelernt, dass heißes Wasser und saubere Tücher bei der Wundbehandlung von Nutzen waren. Bedauerlich nur, dass man beides viel zu selten während eines Gefechts zur Hand hatte. »John!«
»Sir?«
»Du besorgst mir heißes Wasser, so viel wie möglich, und dazu dünnes Leinen. Außerdem«, er überlegte kurz, »benötige ich drei Sturmlaternen. Überprüfe, bevor du sie bringst, ob noch genug Öl drin ist.«
»Mit Verlaub, Sir«, John wirkte verlegen, »die Laternen und die Tücher dürften kein Problem sein, aber Ihr wisst selbst, dass bei Sturm das Feuer in der Kombüse gelöscht werden muss, heißes Wasser gibt es zurzeit auf dem ganzen Schiff nicht.«
»Dann muss das Feuer neu entfacht werden. Wenn der Koch sich nicht traut, besorge dir eine Extragenehmigung vom Kapitän.« Whitbread wirkte jetzt sehr entschlossen: »Und wenn du schon in der Kombüse bist, halte Ausschau nach einem gebratenen Hühnchen oder einem anderen Federvieh. Die Wahrscheinlichkeit, dass du so etwas findest, ist zwar gering, aber …«
»Möglicherweise besteht da doch eine Aussicht, Mister Whitbread.« Pembroke mischte sich vorsichtig ein: »Wir … äh … hatten gestern Morgen in Erwartung der Geburt, sozusagen zur Feier des Anlasses … äh … eine Gans in der Kombüse braten lassen …« Er schien froh, etwas zum Gespräch beitragen zu können, auch wenn ihm schleierhaft war, wozu eine Gans bei der Geburtshilfe dienlich sein sollte.
»Umso besser. Alles kapiert, John?«
»Aye, aye, Sir! Bin schon unterwegs.« John stürzte hinaus auf das sturmgepeitschte Deck.
Langsam fühlte Whitbread sich wohler. Er hatte etwas unternommen, und das war allemal besser als gar nichts zu tun. Er kramte in seiner Erinnerung, ob er jemals bei einer Geburt dabei gewesen war, aber das war natürlich nicht der Fall. Er hatte von den einzelnen Schritten, in denen so etwas ablief, nicht den leisesten Schimmer. Das Einzige, was er ein paarmal gesehen hatte, waren Muttersäue, die Ferkel warfen. War das so viel anders als eine menschliche Geburt?
Er wandte sich erstmals an die junge Lady, die noch immer apathisch auf der Koje saß. »Mylady, könnt Ihr mich hören?«
Keine Antwort.
»Mylady, ich werde versuchen, Euch zu helfen. Aber es wird unumgänglich sein, dass ich Euch dabei … ahem … anschaue. Wenn Euch das stört, sagt es bitte gleich.«
Wieder bekam er keine Antwort. Die junge Frau stöhnte lediglich ein paarmal leise. Dann begann sie wieder zu wimmern. Whitbread griff behutsam nach ihrer linken Hand, die ein rotes Damasttuch umklammert hielt. »Bitte lasst einen Augenblick los, damit ich Euch den Puls fühlen kann.«
Die Frau schien ihn nicht zu hören und wimmerte weiter. Whitbread wurde von einer plötzlichen See zur Seite geschleudert und landete unsanft vor einer eichenen Wiege in der Ecke des Raums. Er rappelte sich auf, ohne die schadenfrohen Blicke der Hebamme zu beachten.
»Mylady, bitte …« Er nahm abermals ihre Hand und löste sie mit sanfter Gewalt von dem Tuch. Ihr Puls war unregelmäßig und schwach. Im Übrigen war sie so kalt, dass ein Aderlass sich von selbst verbot. Ein Blutverlust würde ihr nur weitere Wärme entziehen. Aber Wärme war genau das, was sie jetzt am dringlichsten brauchte. Er griff zu seinem Chirurgenkoffer, öffnete ihn und betrachtete eine kleine braune Flasche. Sie enthielt hochprozentigen Branntwein. Ihn der Lady einzuflößen, sollte seine erste medizinische Maßnahme sein. Er wandte sich an den Lord und die Hebamme, die an einem Wandregal Halt gesucht hatten. »Bitte stützt die Lady von beiden Seiten ab, ich will versuchen, sie auf der Koje festzuschnallen.«
»Wir werden unser Bestes tun«, versprach der Lord. Beide traten heran, und die Hebamme zog als Erstes das Kleid der jungen Frau herunter.
Whitbread zeigte ihnen, wie sie Oberarm und Schenkel halten sollten. Dann wandte er sich der gegenüberliegenden Wand zu, an der einige Waffen befestigt waren, darunter eine Harpune mit einem langen Seil. Er löste das Seil mit einiger Mühe vom Stiel und reichte es seinen beiden ungewöhnlichen Assistenten. »Bitte schlingt das Seil in Achselhöhe um ihren Körper, am besten unter den Armen hindurch.«
Sie taten, wie er es gewünscht hatte. Er nahm beide Enden und verknotete sie an der Wand hinter der Koje, wo einige Krampen im Schiffsleib steckten. Offenbar dienten auch sie als Waffenhalterungen.
»Wozu soll das Ganze eigentlich gut sein?«, fragte Miss Bloomsdale misstrauisch.
»Das will ich Euch gerne sagen«, entgegnete Whitbread. »Das Wichtigste vor einer Operation ist das Fixieren des Körpers. Ihr seht selbst, dass der Oberkörper der Lady jetzt fest mit der Bordwand verschnürt ist. Das Becken hat sich dadurch wie von selbst nach vorn geschoben, und die Lady sitzt sicher auf der Kojenkante.«
»Ein Gebärstuhl wäre sehr viel nützlicher, das habe ich Seiner Lordschaft auch schon gesagt und …«
»Haben wir einen Gebärstuhl?«
»Natürlich nicht, sonst hätte ich …«
»Da seht Ihr, wozu das Ganze gut ist!« Whitbread fühlte sich immer besser. Da bei diesem Seegang ein wohl dosiertes Einflößen des Branntweins aussichtslos war, hielt er der Lady kurzerhand die Nase zu, was sie dazu zwang, ihre Lippen zu öffnen. Er kippte die Flasche über ihrem Mund aus, und die Flüssigkeit gluckerte hinein. Dies wiederholte er drei-, viermal.
Plötzlich begann die Lady zu husten, sie zuckte und schüttelte sich. Ihr Gesicht bekam etwas Farbe. Sie blickte ihn kurz an und schloss erneut die Augen. Eine gehörige Alkoholisierung, dachte Whitbread, konnte ihr bei der Sache, die da auf sie zukam, nur gut tun. Er setzte die Branntweinflasche an die eigenen Lippen und nahm selbst einen kräftigen Schluck.
Dann betrachtete er seine Hände, spreizte die Finger und sah mit Befriedigung, dass sie nicht zitterten.
»Ich habe alles, Sir!«, rief John stolz, als er bald darauf in Begleitung eines kräftigen Matrosen auftauchte. Gemeinsam schleppten sie eine größere Kiste herbei, in der die gewünschten Dinge verstaut waren.
»Gut, mein Junge, häng als Erstes die Laternen auf, dann leg die Tücher bereit. Was ist in der bauchigen Flasche da?«
»Das heiße Wasser, Sir!«
»Sehr gut, lass es erst mal drin, wir geben es später in die Schüssel. Hast du auch die Gans?«
»Ja, Sir, ich konnte sie gerade noch vor den langen Fingern der Mannschaft retten.«
»Fein. Dann werde ich mich ihr jetzt widmen.«
»Unerhört!« Miss Bloomsdale stemmte die Arme in die Hüften. »Wie könnt Ihr in dieser Minute ans Essen denken!«
»Verehrte Miss Bloomsdale«, freute sich Whitbread, denn die Dicke reagierte genauso, wie er es vorausgeahnt hatte, »Ihr irrt, mir geht es keineswegs ums Essen. Aaah … sehr gut, John!« Der Schiffsjunge hatte inzwischen die Sturmlaternen an die Decksbalken gehängt. Die Lampen schwangen zwar klappernd hin und her, aber die Helligkeit, die sie abgaben, war ausreichend.
Whitbread bedeutete John, den knusprigen Vogel zu halten, während er nach einem kleinen Skalpell aus seinem Koffer griff. Zwei Zoll vom Bürzel entfernt vollzog er damit einen ringförmigen Schnitt. Dann umschloss er mit beiden Händen die gesamte Brustseite der Gans, drückte fest zu und schob die Finger kraftvoll in Richtung Bürzel. Aus dem ringförmigen Einschnitt quoll weißliches Gänsefett hervor wie aus einer Ölpresse. Whitbread strich es ab und sammelte es in einem kleinen Porzellangefäß.
»Was hat das nun wieder zu bedeuten?«, verlangte Miss Bloomsdale zu wissen.
»Das werdet Ihr gleich sehen«, versetzte Whitbread, der sich nochmals an John wandte: »Ich brauche dich nicht mehr. Nimm deinen Kameraden, und melde dich beim wachhabenden Offizier.«
»Aye, aye, Sir!«
»Mister Whitbread, wenn Ihr nichts dagegen habt, würde auch ich mich gern entfernen«, ergriff der Lord die Gelegenheit beim Schopf, »ich müsste in meiner Kabine noch einiges … äh …«
»Selbstverständlich, Mylord«, sagte Whitbread. Ihm war es recht, der Lord war sowieso keine große Hilfe. »So, und nun zu uns, Miss Bloomsdale, bitte habt die Freundlichkeit und geht mir zur Hand, wie Ihr’s vorhin versprochen habt. Als Erstes hebt den Rock der Lady wieder hoch, damit ich selbst sehen kann, welcher Umstand das Kind an seiner Geburt hindert.«
Zu Whitbreads Verwunderung erhob die Hebamme keine Einwände. Er nahm eine gehörige Portion des eben gewonnenen Fetts und rieb sich damit Hände und Unterarme ein. Dann trat er vor die junge Frau, die abermals nur halb bei Bewusstsein schien, und kniete sich hin. Er blickte in eine große, oval geöffnete Vagina mit Schamlippen, die so intensiv leuchteten, dass sie sich farblich von den überall vorhandenen Blutspuren kaum unterschieden. Seine Gefühle waren zwiespältig. Einerseits war ihm der Anblick des weiblichen Geschlechts peinlich, andererseits bestätigte er ihn in dem Einfall, den er vorhin gehabt hatte:
Er hatte sich erinnert, was Bauern bei schwierigen Geburten im Stall taten: Sie rieben sich den Arm bis zur Schulter mit Fett ein und schoben ihn in den Geburtskanal, um die Position des Fötus zu erkunden. Wenn nötig, konnten sie dann seine Lage verändern und die Geburt einleiten. Genau das wollte er hier auch versuchen. Das Licht war ausreichend. Doch er musste alles noch genauer sehen. Er ließ sich von Miss Bloomsdale ein frisches, in heißes Wasser getauchtes Tuch reichen und begann den Bereich um die Schamlippen zu säubern. Plötzlich stöhnte die Schwangere heftig, eine Wehe durchzog ihren Leib. Sie presste. Whitbread beobachtete, wie die Vagina sich faustgroß öffnete, und blickte fasziniert darauf wie auf ein lebendes Tier. Er sah ein winziges Körperteil in der Öffnung erscheinen, konnte aber nicht sagen, ob es sich dabei um ein Bein oder einen Arm handelte.
Die Wehe ging vorüber, der Spalt wurde wieder kleiner. Whitbread machte seine rechte Hand so schlank wie möglich, schob zunächst die Fingerspitzen in den Kanal, dann die halbe Hand. Es ging überraschend leicht, das Gänsefett tat seinen Dienst. Er versuchte, etwas zu erfühlen, und bekam zwischen Daumen und Zeigefinger ein Händchen zu fassen. Es war so klein wie das einer Puppe. Das winzige Ärmchen und die Schulter dazu lagen links davon. Irgendwo dahinter vermutete er das Köpfchen.
»Ich glaube, Ihr habt Recht«, wandte er sich an die gespannt zusehende Miss Bloomsdale, »das Kind liegt seitlich vor dem Geburtskanal.«
»Und was gedenkt Ihr zu tun?«
»Nun«, Whitbread zögerte, »ich werde mich bemühen, die Schulter des Kindes zu erfassen und seinen Körper nach rechts hinten zu drücken, somit müsste es in die richtige Stellung rutschen. Wenn das gelungen ist, sollte die Mutter das Kind herauspressen können.«
»Wenn sie dazu noch in der Lage ist.«
»Hoffen wir’s«, sagte Whitbread und tastete sich erneut vor. Er glaubte die Rundung der kleinen Schulter zu erfühlen und schob sie sanft ein wenig nach rechts hinten. Der Körper des Kindes machte die Bewegung mit. Er drückte weiter, wobei die rechte Schamlippe sich stark nach außen dehnte. Er wunderte sich, wie außerordentlich dehnungsfähig das weibliche Geschlecht war. Wie selbstverständlich erschien plötzlich die Schädeldecke des Kindes in der Öffnung. Ein paar blonde, verklebte Härchen wurden sichtbar. Whitbread jubelte innerlich. Das war geschafft! Jetzt musste die Mutter nur noch pressen.
»Nun, Miss Bloomsdale«, sagte er und versuchte, seine Stimme nicht allzu stolz klingen zu lassen, »ich denke, das war’s. Überlassen wir den Rest der Natur.« Er stand schwankend auf, denn der Orkan hatte weiter an Stärke gewonnen, doch die Hebamme hielt ihn zurück:
»Mister Whitbread, ich fürchte, Ihr freut Euch zu früh. Seht nur, das Köpfchen ist schon wieder verschwunden.« Zu Whitbreads Überraschung schwang in ihrer Stimme Bedauern mit.
Er versuchte es insgesamt noch neunmal, aber immer wieder rutschte der Kopf zurück in die falsche Lage. »So kommen wir nicht weiter«, sagte er schließlich verzweifelt. »Die Mutter wird außerdem mit jeder Minute schwächer. Ich sehe nur eine einzige Möglichkeit, aber die ist eher theoretischer Natur.«
»Was meint Ihr?«, fragte Miss Bloomsdale.
»Ich meine, man müsste es schaffen, die Geburtsöffnung so stark zu vergrößern, dass durch sie das Kind bequem herauskommt. Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass die Mutter nicht mehr pressen muss.«
»Es gibt eine andere Möglichkeit«, nahm Miss Bloomsdale den Gedanken auf, »man nennt sie Bauchschnittmethode, dabei wird der Leib geöffnet und das Kind herausgehoben.«
»Vielleicht ist das die beste Lösung. Wie wird der Schnitt angesetzt – längs oder quer?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Hm«, der Wundarzt überlegte laut, »egal, ob längs oder quer, er müsste wohl sechs bis acht Zoll lang sein.« Er betrachtete den dick geschwollenen Leib und dann seine chirurgischen Instrumente. Die vor ihm liegende Aufgabe verlangte viel Feingefühl, sie war ganz anders als die Tätigkeiten, die er üblicherweise auszuführen hatte. Sein Blick fiel auf eine Reihe kleinerer Skalpelle. Er überlegte und entschied sich für eines, das einen langen, gebogenen Griff aufwies und dadurch besonders gut in der Hand lag. Der Stahl selbst war nur so kurz wie das Glied eines Fingers. Sollte er während des Schnitts abrutschen, würde die Klinge nicht allzu tief eindringen.
Er nahm das Skalpell und kniete sich abermals breitbeinig vor die junge Frau. Es war nichts Neues für ihn, in den Leib eines Menschen zu schneiden, denn er hatte schon viele Stichwunden im Bauchraum versorgt. Er wusste, dass er zunächst die Hautschichten durchtrennen musste, wobei darauf zu achten war, dass die Blutung ihn nicht zu sehr behinderte. Miss Bloomsdale würde die Wunde mit zwei Haken auseinander halten und das Blut mit einem Schwamm wegtupfen. So weit, so gut. Dann würde er auf das Bauchfell stoßen und darunter …
Er zögerte. Was erwartete ihn darunter? Das Kind? Nun, er würde es sehen. Er hob die Hand zum Schnitt – und ließ sie wieder sinken. Er spürte einen heftigen Widerstand in sich. Eine Bauchoperation war grundsätzlich hochinfektiös, er hatte selten gesehen, dass ein Mann sie überlebte. Hier aber handelte es sich um eine Frau, wobei erschwerend hinzukam, dass sie äußerst geschwächt war und ihr Puls sehr unregelmäßig schlug. Whitbread zögerte noch immer. Er fragte sich, ob er nicht verpflichtet sei, wenigstens das Kind zu retten.
Da plötzlich kam ihm eine Idee.
Er selbst hatte von einer Vergrößerung der Vaginaöffnung gesprochen. Dabei hatte er allerdings an einen die Vagina verlängernden Schnitt nach oben, in Richtung Bauch, gedacht, was natürlich völlig unmöglich war. Das verbot die Anatomie des Weibes. Auf das Naheliegendste war er nicht gekommen: auf den Schnitt, der am unteren Ende der Vagina ansetzte und in Richtung Damm führte!
»Miss Bloomsdale, ich bin zu einem Entschluss gekommen«, sagte er, sich umwendend, zu der Hebamme: »Ich werde nicht die Bauchschnittmethode anwenden, sondern versuchen, den eigentlichen Geburtskanal operativ zu vergrößern.«
»Und wie wollt Ihr das anstellen?«
Whitbread erklärte es ihr. Die schwere Frau war sofort einverstanden. Es schien so, als hätte sie vorübergehend das Kriegsbeil begraben.
Er beugte sich vor, setzte die Spitze des Skalpells an und schnitt so vorsichtig ins Fleisch, dass es einem Ritzen gleichkam. Doch durch die Spannung sprangen die Schnittränder sofort auseinander. Miss Bloomsdale tupfte ein wenig Blut fort.
Er wollte erneut das Skalpell ansetzen, doch durch die Schwangere lief plötzlich ein Zittern, und sie bäumte sich auf.
»Was ist los?«, fragte Whitbread entsetzt.
»Eine Wehe steht bevor, vielleicht können wir sie nutzen.«
»Hoffen wir’s.« Rasch und konzentriert schnitt Whitbread zum zweiten Mal ein. Plötzlich sprang der Damm auseinander, der Geburtsweg vergrößerte sich, Blut schoss ihm entgegen. Geistesgegenwärtig griff er mit der ganzen Hand in die Öffnung, tastete, fühlte und bekam den Kopf zwischen seine Finger. Er dirigierte ihn vor die Öffnung, während Miss Bloomsdale leicht und rhythmisch auf den Bauch der Schwangeren drückte.
Der Kopf trat ein Stück hervor. »Ich glaube, es kommt!«, schrie Whitbread.
»Ja, jetzt lasst mich den Rest erledigen.« Mit wenigen geschickten Handgriffen holte die Hebamme das Kind heraus und hielt es an den Beinchen hoch. Dann gab sie ihm einen Klaps auf das winzige Hinterteil. Augenblicklich fing es an zu schreien.
»Ein schönes Kind«, sagte Whitbread. Und es waren seine letzten Worte. Denn in dieser Sekunde brach der Hauptmast und schlug krachend auf das Achterkastell nieder. Er durchbrach die Decksbalken wie eine riesige Axt, traf auf den Kopf des Wundarztes und zerschmetterte ihm den Schädel.
Taggart befand sich auf seinem Kommandostand und betrachtete das Schiff, das aussah wie nach einem schweren Gefecht. Überall schwangen Taue lose herum, gebrochene Planken ragten aus dem Schiffskörper empor, Spieren und Grätings waren zerschlagen, von den drei Masten der Thunderbird stand keiner mehr.
Doch Taggart wollte sich nicht beklagen. Alle Männer, bis auf Whitbread, waren mit dem Leben davongekommen, sogar die weiblichen Passagiere. Und er selbst hatte es geschafft, wenn auch um Haaresbreite, mit einem Notrigg um die Nordwestspitze Spaniens herumzumanövrieren. Natürlich ließ der Zustand des Schiffs es nicht mehr zu, den großen Schlag über das gefährliche Westmeer zu segeln, aber die Schäden waren reparabel. Er nahm sich vor, die Hafenstadt Vigo anzulaufen und das Schiff dort in die Werft zu geben. Pembroke und seine Lady würden sich für die Zeit der Reparaturen in Geduld üben müssen. Und zahlen würde Pembroke auch, denn er konnte es sich leisten.
Wie auf Bestellung kam der Lord in diesem Augenblick aufs Achterkastell geklettert.
»Captain Taggart, Sir!«
»Was kann ich für Euch tun, Mylord?«
»Ich möchte Euch aus ehrlichem Herzen ein Kompliment machen. Ihr habt mit Eurer Mannschaft während des Sturms wirklich Großartiges geleistet. Meine Gebete sind erhört worden. Ihr habt uns allen das Leben gerettet! Ich danke Euch, auch im Namen der … äh … der jungen Lady, der Hebamme und natürlich des Kindes.«
»Nicht der Rede wert, Mylord. Was ist es denn, ein Junge oder ein Mädchen?«, fragte Taggart höflich.
»Nun … äh … ein Junge.«
Der Abt Hardinus
»Ich war mir sicher, dass es dich reizen würde,dem Geheimnis auf den Grund zu gehen.Aber es will wohl überlegt sein,wohin du dich wendest.«
Gott hat mich vergessen«, pflegte Abt Hardinus lächelnd zu sagen, wenn man ihn auf sein hohes Alter ansprach. Und um Missverständnissen vorzubeugen, fügte er stets noch ein spitzbübisches »Bisher jedenfalls« hinzu. Denn natürlich wusste er, dass Gott keine Fehler machte und auch ihn eines Tages zu sich rufen würde.
Schließlich, in seinem zweiundneunzigsten Lebensjahr, spürte Hardinus, dass es bald so weit sein würde. Begonnen hatte es fast unmerklich. Kurze Momente waren es zunächst gewesen, in denen er nichts mehr sehen konnte. Schwindelanfälle waren hinzugekommen. Es folgten Lähmungserscheinungen in den Füßen, den Beinen und sogar in den Armen. Einzig sein messerscharfer Verstand hatte noch keinen Schaden genommen. So war er in der Lage, den Verfall seines Körpers interessiert wie ein Arzt zu verfolgen.
An dem Tag, da er morgens fühlte, dass er sein Lager nicht mehr verlassen würde, war er deshalb nicht unvorbereitet. Er blieb ganz ruhig, obwohl er spürte, dass seine Lebensuhr fast abgelaufen war. Er legte seine Hände zusammen, schloss die Augen und betete:
»Allmächtiger Gott, Du Gnadenreicher,ich bitte Dich, gib mir in meinen letzten Stundendie Weisheit, das Richtige zu tun.Auf dass ich mein Haus bestelle und fröhlichvor Dich hintreten kann …«
Er hielt inne und versuchte, die ihm verbliebenen Kräfte zu sammeln. Er hoffte, sie würden ausreichen, um die notwendigen Gespräche mit den Brüdern zu führen und um anschließend, noch bei Bewusstsein, das heilige letzte Sakrament zu empfangen.
Würde Gott ihm diese Gnade erweisen?
Er öffnete die Augen wieder und blickte nach oben, in stiller Zwiesprache mit seinem Schöpfer. Dann glitt ein Lächeln des Verstehens über seine Züge. Er kannte jetzt die Antwort.
»Amen!«, sagte er fest.
Mühsam wandte er sich zur Seite und tastete nach dem Glöckchen, das neben ihm auf einem Holzschemel lag.
Er klingelte.
Wenige Augenblicke später erschien Gaudeck, sein persönlicher Sekretär. Pater Gaudeck stammte aus dem Fränkischen; er war Mitte vierzig, groß, kräftig – und die Zuverlässigkeit in Person. Er diente dem Abt schon seit zehn Jahren und war unverbrüchlich treu.
»Guten Morgen, Ehrwürdiger Vater«, sagte Gaudeck freundlich, als er sich dem Lager näherte, »die Brüder haben Euch schon bei der Prim vermisst. Ich hoffe, Ihr habt gut geschlafen? Darf ich Euch etwas bringen?«
»Danke. Du bist fürsorglich wie stets, mein lieber Gaudeck. Aber alles, was ich brauche, ist Ruhe. Und die habe ich schon.«
»Kann ich denn gar nichts für Euch tun?«
»Doch. Bitte lasse Pater Thomas und Pater Cullus rufen. Und gib auch Vitus Bescheid. Ich möchte, dass sie, zusammen mit dir, in meinen letzten Stunden bei mir sind.«
»Wie Ihr wünscht, Ehrwürdiger Vater.« Gaudeck tat zwei Schritte und erstarrte mitten in der Bewegung. Die ganze Tragweite der Bitte wurde ihm erst jetzt bewusst. Ungläubig hob er die Hände. »Eure letzten Stunden?« Rasch trat er ans Bett. »Ehrwürdiger Vater, Ihr macht einen Scherz!«
»Ich scherze nicht.«
»Ihr wolltet doch immer hundert Jahre alt werden, und ich bin sicher, dass Ihr das …«
»Gib dir keine Mühe, mein Sohn«, unterbrach ihn Hardinus sanft, »du warst noch nie ein guter Lügner. Tue lieber, um was ich dich bitte.« Sacht legte er Gaudeck seine Hand auf den Kopf. »Und freue dich mit mir, dass Gott mich nicht vergessen hat.«
Pater Thomas, der Prior und Arzt des Klosters, wurde am Ausgang des Refektoriums von der Nachricht überrascht, gerade als er auf dem Weg zum Herbularium war, dem medizinischen Kräutergarten. Hier hatte er nach einigen seiner Neuzüchtungen sehen wollen, die er aus dem Schwarzen Senf und dem Ruchgras gewann. Sie standen zur Zeit im Mittelpunkt seiner Forschungen, und er durfte von sich behaupten, mit ihnen schon einige beachtliche Erfolge gegen den Rheumatismus erzielt zu haben.
»Nein!«, war das einzige Wort, das er hervorbrachte, als er die Botschaft vernahm. Seine hohe Gestalt schien plötzlich von aller Spannkraft verlassen. »Es ist unvorstellbar …«, murmelte er verstört, »einfach unvorstellbar.«
Seine Hände suchten an der Gebäudewand Halt. Schwarzer Senf und Ruchgras waren vergessen. »Doch des Allmächtigen Wille geschehe.«
Pater Cullus, ein überaus dicker, freundlicher Mann, saß in seiner Zelle und freute sich auf ein paar erbauliche Stunden in strenger Abgeschiedenheit. Er wollte sich wieder einmal mit den Werken des Publius Ovidius Naso beschäftigen, jedoch nicht mit den bekannten Metamorphosen, sondern mit der Ars amatoria, dem Lehrbuch des Liebens. Mit einer Lektüre also, die sich für ihn verbot, denn sie war nicht nur heidnisch, schlimmer noch, ihr Genuss kam einer Sünde gleich. Doch auch Pater Cullus war nur ein Mensch, und wer ihn zur Rede gestellt hätte, warum er Ovid lese, dem hätte er geantwortet, dass es nur wegen des herrlich elegischen Versmaßes sei. So war er mit sich und der Welt zufrieden, zumal ihm eine gut gefüllte Schüssel rotbackiger Äpfel Gesellschaft leistete.
Da donnerten jählings Faustschläge gegen seine Tür, und eine hektische Stimme rief: »Bruder, Bruder!«
Cullus schreckte auf. »O tempora, o mores!«, rief er. »Was hat das zu bedeuten?«
»Abt Hardinus liegt im Sterben! Kommt schnell zu seiner Schlafkammer!«
Mit einer für seine Leibesfülle erstaunlichen Geschwindigkeit sprang Cullus auf die Füße, versteckte das Buch, ergriff geistesgegenwärtig noch einen Apfel und eilte hinaus.
Unweit des Klosters, in einem hölzernen Verschlag, der gewöhnlich ein paar Ziegen als Unterschlupf diente, kniete ein junger Mann von zwanzig Jahren. Er hatte eine Reihe chirurgischer Instrumente vor sich im Stroh ausgebreitet und wirkte sehr konzentriert. Neben ihm hockte ein Knabe, der angestrengt auf einen kleinen Hütehund einsprach:
»Ruhig, Pedro, ganz ruhig, gleich ist es vorbei.«
Der Schwanz des Hundes klopfte wild auf den Boden. Es war unverkennbar, dass die Unsicherheit des Knaben sich auf das Tier übertrug. »Ich weiß nicht, ob ich ihn halten kann!«, jammerte er laut.
»Du kannst es.« Der Jüngling prüfte zwei verschieden große Lanzetten und entschied sich für die kleinere. »Du musst dem Hund den Fang so weit wie möglich aufhalten, nur dann komme ich heran und kann die Entzündung aufstechen.«
»Werdet Ihr ihm sehr wehtun?«, fragte der Knabe ängstlich.
»Nein, es wird nur ein kurzer Schmerz sein. Wenn es ein Stielabszess ist, was ich vermute, kommt es nur darauf an, den Eiterkanal richtig zu treffen.«
»Und dann?«
»Dann weicht der Druck aus der Wunde, weil die kranken Säfte abfließen können. Es wird eine große Erleichterung für Pedro sein.«
Die Stimme des Jünglings war ruhig, ebenso wie seine Bewegungen. Nichts deutete darauf hin, dass er innerlich ähnlich erregt war wie der Knabe. Diese Fähigkeit, sich zu beherrschen, war eine Eigenart an ihm, die ihn älter wirken ließ, als er an Jahren war. Er hob die rechte Hand und führte das Instrument behutsam gegen die linke Innenseite der Lefze. Ein schneller, entschlossener Stich, eine Drehung, und der Hund heulte auf.
»Pedro, es ist schon vorbei!«, schrie der Junge erleichtert. Der kleine Mischlingsrüde schüttelte heftig den Kopf, schnaubte und schmatzte und riss die Schnauze mehrmals auf, während er mit der Pfote von außen gegen die Stelle fuhr. Plötzlich schoss ein gelblicher Strahl zur Erde und zeigte an, dass die Operation geglückt war.
»Siehst du, die schlechten Säfte fließen schon ab, gleich geht es ihm besser«, versicherte der junge Mann.
»Ich kann’s gar nicht glauben, dass es wieder gut sein soll«, stammelte der Knabe, »ich danke Euch, Vater, ich danke Euch so sehr …«
»Mach nicht so große Worte.« Der Jüngling legte dem Knaben die Hand auf die Schulter. »Und sag nicht ›Vater‹ zu mir. Das Schlimmste ist jetzt vorbei. Die Wunde wird sich in zwei oder drei Tagen schließen. Bis dahin fließt noch ein paarmal Eiter ab, aber das ist normal. Lass Pedro jetzt für eine Weile in Ruhe, dann kann er dir schon morgen wieder beim Hüten deiner Herde helfen.«
Über die energischen Gesichtszüge des jungen Mannes huschte ein Lächeln. Er gab dem Hund einen leichten Klaps und wandte abrupt den Kopf, denn draußen hatte ein großes Geschrei angehoben. Er konnte zwar nichts Genaues verstehen, aber er hörte mehrfach seinen Namen:
»Vitus!«
Nacheinander betraten sie die Sterbekammer. Gaudeck, Thomas, Cullus und zuletzt Vitus. Schweigend stellten sie sich an der Längsseite des Raums auf und bekreuzigten sich angesichts des kleinen Kruzifixes, das über dem Lager hing. Dann senkten sie die Köpfe.
»Setzt nicht solche Leichenbittermienen auf, Brüder, nur weil ich bald dem Erhabenen gegenüberstehe!«, kam es aufmunternd aus der anderen Ecke. Abt Hardinus winkte sie mit der Hand heran. »Wenn ich nicht irre, schreiben wir heute Dienstag, den 13. März im Jahre des Herrn 1576, und dieser Tag ist wunderbar – wie jeder Tag, den der Allmächtige werden lässt. Mein Tod ändert daran überhaupt nichts!«
»So solltet Ihr nicht sprechen, Ehrwürdiger Vater.« Pater Cullus hob sein rosiges Gesicht. Er hatte sich als Erster gefangen. »Bedenkt nur, was Ihr noch alles in Eurem Leben schaffen wolltet. Und vergesst nicht, es ist allein Euer Verdienst, dass dieses Kloster als ein Hort der Frömmigkeit, der Gelehrsamkeit und des Friedens gilt!«
»Unsinn, Bruder.« Die Stimme von Hardinus klang überraschend kräftig: »Wie kannst du nur glauben, alles sei mein Verdienst? In diesem Kloster leben einhundertvierundzwanzig Mönche, neun Novizen und elf Pueri oblati. Alle tun ihre Arbeit und loben den Herrn. Und da soll ich allein wichtig sein? Nein, Schluss damit!«
Hardinus winkte den dicken Mönch heran. »Klage nicht, Bruder, sondern freue dich. Und hole mir einen Becher Wasser, es gibt noch manches zu sagen.«
Cullus schniefte, murmelte eine Entschuldigung und eilte hinaus.
»Er trägt sein Herz auf der Zunge, aber ich liebe ihn dafür«, sagte Hardinus lächelnd. »Ich liebe euch alle, kein Mensch ist ohne Schwächen. Ich selbst bin der beste Beweis dafür. Ich bin so schwach, dass mein Körper euch noch in dieser Stunde verlassen wird. Aber mein Geist wird weiter bei euch sein.«
Er musterte Gaudeck, Thomas und Vitus, und ihm wurde bewusst, wie jung sie waren. Selbst Pater Thomas, der Älteste unter ihnen, war mehr als dreißig Jahre später als er geboren. Doch was waren schon dreißig Jahre! Seine Gedanken begannen zurückzuwandern in eine Zeit, da er selbst noch ein junger Mann war, vor fünfundsiebzig Jahren …
Damals, im Juli anno 1501, war er über das Asturische Hochgebirge hinunter an den Golf von Biscaya gekommen. Ein 600-Meilen-Fußmarsch hatte hinter ihm gelegen, von Pamplona am Fuß der Pyrenäen quer durch den Norden Spaniens, westwärts, den beschwerlichen Jakobsweg entlang, durch Burgos und León und viele andere Städte, bis hin nach Santiago de Compostela, den Ort des heiligen Jakobs, wo die Wallfahrer sich seit Hunderten von Jahren in der Kathedrale treffen. Dort hatte er das ersehnte Zertifikat empfangen, das ihn zum echten Jakobspilger machte – die Garantie, dass ihm zweihundert Tage des Fegefeuers erlassen werden würden.
Doch nachdem das erste Glücksgefühl gewichen war, hatte sich ein sehr irdisches Problem bei ihm gemeldet: der Hunger. Er war kein Pilger mehr, und die Leute gaben ihm nicht länger Almosen. Das Einzige, was er noch besessen hatte, waren die drei Begleiter des Jakobspilgers: der kräftige, mannshohe Wanderstab, der gleichzeitig Waffe gegen Wölfe und Wegelagerer ist, der Kürbis als Flüssigkeitsbehältnis und die Jakobsmuschel, die als Löffel dient.
Von keinem dieser Gegenstände wurde man satt.
Ein paar Wochen hatte er sich durchgeschlagen, indem er den Fischern beim Netzeflicken half. Dann war er nach Osten weitergezogen und hatte sich als Wasserholer verdingt. Die Arbeit war sehr hart gewesen. Er hatte sie schon nach wenigen Tagen wieder aufgeben müssen. Sein Körper war schwächer und schwächer geworden. Deshalb hatte er der Küste wieder den Rücken gekehrt, in der Hoffnung, landeinwärts sein Brot verdienen zu können. Wegen der unsicheren Zeiten wäre er gern zu zweit oder zu dritt marschiert, doch niemand hatte sich gefunden, der denselben Weg nahm wie er. So hatte er sich, wie schon zuvor, auf seinen mannshohen Stecken verlassen müssen.
Eines Morgens, er wanderte gerade durch ein ausgetrocknetes Flussbett, hatte er ein liebliches Tal erblickt, an dessen Ende, dort, wo die Hänge bereits wieder sanft anstiegen, ein uraltes Zisterzienserkloster stand – Campodios. Er hatte den Stecken in den Boden gerammt und sich schwer atmend darauf gestützt. Andächtig hatten seine scharfen Augen den von strengen Regeln geprägten Baustil bewundert. Er hatte die lange, kreuzförmige Basilika erkannt und an der Ostseite des Querhauses eine Reihe von Kapellen entdeckt. Die gesamte Anlage mit ihren einfachen Formen, den hohen Rundbogenfenstern und den roten, spitz zulaufenden Satteldächern hatte einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Und er hatte die Unerschütterlichkeit gespürt, die diesen Mauern innewohnte.
Dann, plötzlich, war ihm, als wolle der Stecken sich seiner Hand entwinden, doch konnte er sich auch getäuscht haben, weil er im gleichen Augenblick ohnmächtig wurde. In jedem Fall war Campodios sein Schicksal und seine Erfüllung geworden.
Eine rasche Bewegung schreckte Hardinus auf. Pater Cullus stand vor ihm mit einem Becher Wasser. »Ganz frisch aus dem Brunnen, Ehrwürdiger Vater!«
»Danke, lieber Cullus.« Hardinus nahm schlürfend einen Schluck, während seine Gedanken wieder in die Gegenwart zurückkehrten. Er fragte sich, wie die Brüder wohl seine letzten Wünsche aufnehmen würden – besonders Pater Thomas. Thomas war ein großer, ernster Mann von asketischer Gestalt, der sich seit frühester Jugend der Cirurgia und der Kräuterheilkunde verschrieben hatte. Er war Autor eines Werkes namens De morbis hominorum et gradibus ad sanationem, kurz De morbis genannt, eintausendzweihundert Seiten stark, mit prachtvollen Illustrationen. Ein Werk, das ihn mit Stolz erfüllte – und deshalb manchmal dazu verleitete, Novizen, die des Lateinischen nicht so mächtig waren, die Übersetzung des Titels gleich mitzuliefern: Von den Krankheiten der Menschen und den Schritten zur Heilung. So gesehen, bildete das Buch für ihn auch eine ständige Mahnung, dass Stolz eine Untugend war.
Seine Hände waren die eines Chirurgen, lang, schmal und außerordentlich geschickt. Schon manches Mal waren sie seine wichtigsten Instrumente gewesen. So auch vor einigen Jahren, als Pater Cullus es zu lange versäumt hatte, seinen stark entzündeten Daumen behandeln zu lassen. Am Ende hatte der Finger wie eine Runkelrübe ausgesehen. Eine Amputation war unvermeidlich geworden. Dennoch konnte Cullus sich nicht beklagen: Durch Thomas’ ärztliche Kunst und Vitus’ geschickte Assistenz war die Operation ohne Komplikationen verlaufen, wenngleich der Daumen ihm fortan fehlte. Doch war es ohnehin nur der linke. So tat der Verlust weder seinem fröhlichen Gemüt noch seinem nie endenden Appetit Abbruch.
Daneben Gaudeck, der die Mathematik so liebte! Seit mehreren Jahren leitete er astrologische Seminare, die sich unter den Brüdern großer Beliebtheit erfreuten. Auch einen regen Schriftwechsel führte er, unter anderem mit einem gewissen Tycho Brahe, einem für seine jungen Jahre schon recht berühmten dänischen Astronomen. Ja, Gaudeck ist ein kluger Kopf und ein treuer Freund!, dachte Hardinus. Er wird mir ein guter Nachfolger sein.
Endlich war da noch Vitus, sein persönlicher Schützling, den er wie einen Sohn liebte. Mit ihm würde er ganz zuletzt reden. Allein.
»Thomas, würdest du mir einen Wunsch erfüllen?«
»Alles, was in meiner Macht steht, Ehrwürdiger Vater.«
»Ich möchte, dass du dein Wissen um die Heilmöglichkeiten nicht nur in Buchform festhältst, sondern es mit möglichst vielen Menschen teilst.«
»Aber Ehrwürdiger Vater, wie soll das geschehen?« In Pater Thomas’ Gesichtszügen begann es zu arbeiten.
»Ich möchte, dass du eine Schule aufbaust, in der du den Menschen dein medizinisches Wissen mündlich vermittelst – in ihrer Umgangssprache. Es ist zwar in vielen Familien üblich, dass die Mutter ihre Hausrezepte an die Tochter weitergibt und diese wiederum an ihre Tochter. Ein gewisses Grundwissen darf also vorausgesetzt werden. Dennoch ist die Hausmedizin etwas, das sich nur auf die Erfahrungen der Alten verlässt und neue Erkenntnisse nahezu ausschließt. Die Menschen aber sollen nach dem Neuen fragen: nach besseren, wirksameren Behandlungsmöglichkeiten. Nicht jedes böse Leiden muss gottgewollt zum Tode führen. Du, Thomas, sollst derjenige sein, der sie anleitet. So werden sie lernen, was bei Krankheiten, die sie bislang nicht heilen konnten, zu tun ist. Was hältst du von meinem Vorschlag?«
»Nun, Ehrwürdiger Vater …« Pater Thomas versuchte, sich für den Plan zu erwärmen. Eine Schule aufbauen und Unterricht abhalten! Wenn das so einfach wäre! Bei den Pueri oblati, jenen Knaben, die unter der Obhut des Klosters standen, damit sie etwas lernten und den Weg zum rechten Glauben fanden, lag der Fall anders: Die beherrschten leidlich Latein und hatten schon einen gewissen Bildungsgrad. Aber die Menschen da draußen? Immerhin, man konnte zunächst mit einer kleinen Klasse beginnen. Allerdings würde der Unterricht Zeit kosten. Zeit, die er eigentlich für seine Forschung brauchte. Andererseits, die Überlegungen des Abtes waren nicht von der Hand zu weisen …
»Ich stimme Euch zu«, sagte er schließlich. »Ich denke an einen Unterricht nach athenischem Vorbild, bei dem die Erkenntnisse in freier Rede und Gegenrede erarbeitet und auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Das scheint mir didaktisch am sinnvollsten. Der Unterricht sollte winters in einem überdachten Raum stattfinden. Sommers und bei schönem Wetter dagegen im Klostergarten unter der alten Platane.«
Er ertappte sich dabei, wie er sich vorstellte, als eine Art Sokrates inmitten seiner Schüler zu sitzen. Der Gedanke gefiel ihm.
»Schau einfach dem Volk aufs Maul, und sprich mit ihnen über das, was du weißt«, lächelte Hardinus und unterbrach damit Thomas’ gedanklichen Höhenflug.
»Äh … jawohl, Ehrwürdiger Vater.«
»Aber auch die Kunst des Lesens sollte unterrichtet werden.«
»Den Leseunterricht könnte ich übernehmen!«, schaltete sich Pater Cullus eifrig ein. »Und natürlich auch den Schreibunterricht, denn beides ist gleich wichtig einzuschätzen. Ich kann mich noch genau entsinnen, wie eine alte Frau im letzten August einen Gemüsehändler fragte, ob seine Pferdebohnen auch wirklich frisch seien. ›Aber natürlich, gute Frau‹, antwortete der mit treuherzigem Augenaufschlag und deutete auf zwei Wörter, die an seinem Karren standen, ›hier steht es.‹ Er las die Wörter einzeln vor: ›Frische Pferdebohnen‹. Natürlich hätte jeder, der des Lesens mächtig ist, den Schwindel sofort durchschaut. Dort stand ›José Gonzales‹, also nichts weiter als der Name des Schwindlers.«
»Ich danke dir für diese Geschichte, Cullus«, sagte der Abt leise, »ein besseres Beispiel für die Bedeutung des Leseunterrichts hättest du nicht geben können. Was jetzt noch fehlt, ist jemand, der dem Volk das Rechnen beibringt.« Fragend schaute er Gaudeck an.
»Ehrwürdiger Vater, diese Aufgabe werde ich übernehmen.«
»Aber eines ist dabei sehr wichtig, mein lieber Gaudeck.« In den Augen des alten Mannes blitzte Schalk auf.
»Ja, Ehrwürdiger Vater?«
»Lass Gnade walten beim Unterricht. Vergiss nie, es sind Unwissende, von denen viele gerade nur so weit zählen können, wie sie Finger an den Händen haben.«
»Gewiss, Ehrwürdiger Vater. Doch beispielsweise die Winkelfunktionen …«
»Gnade, Gaudeck! Lehre sie einfach, Zahlen zusammenzuzählen, voneinander abzuziehen, malzunehmen und zu teilen. Das genügt, um auf dem Wochenmarkt nicht betrogen zu werden.« Hardinus’ Atem rasselte. »Komm, gib mir noch etwas von dem Wasser, das Cullus gebracht hat.«
Gaudeck setzte ihm behutsam den Becher an die Lippen. Der alte Abt trank langsam, mit kleinen vorsichtigen Schlucken. Sein Gesicht, einst von kraftvollen Zügen geprägt, wirkte jetzt wie eine Totenmaske. Er spürte, dass seine Füße bereits abgestorben waren und dass die Kälte unaufhaltsam in seinen Beinen hochkroch. Aber noch steckte Leben in ihm. Und das, was er zu sagen hatte, würde er auch zu Ende bringen.
»Höret, Brüder«, sagte er, bemüht, trotz seiner Schwäche deutlich zu sprechen, »die Dinge, die mir am Herzen liegen, sind damit fast alle geklärt. Vielleicht wundert ihr euch, dass meine letzten Gedanken den Menschen da draußen vor unseren Mauern gelten. Aber sie sind Gottes Werk, und unser Schöpfer liebt sie alle, jeden Einzelnen. Gott, meine Brüder, ist groß, gütig und allwissend. Er steckt in jedem Stückchen Brot, das uns sättigt, in jedem Sonnenstrahl, der uns wärmt, in jedem Lächeln, das uns begegnet. Vergesst das nie. Gebt den Menschen da draußen ein wenig mehr von diesem Gott. Gerade auch, weil die Inquisition Seinen Namen befleckt, indem sie im Zeichen des Kreuzes so verblendet tötet.«
Er trank abermals.
»Was nun das Innere dieser Mauern betrifft, so wird in ihnen ein neuer Abt zu wählen sein. Ich habe auch hier einen letzten Wunsch, und es wäre schön, wenn alle Brüder ihn bei der Wahl berücksichtigen würden.«
Seine Stimme klang jetzt sehr offiziell: »Ich möchte, dass Pater Gaudeck an meine Stelle rückt. Ich weiß selbst«, fuhr er rasch fort, »dass eigentlich Pater Thomas als unser Prior mein natürlicher Nachfolger wäre. Aber Thomas ist mit Leib und Seele Heilkundiger, und man täte ihm einen schlechten Dienst, würde man ihn mit der Bürde des Klostervorstehers belasten. Nicht wahr, Bruder?«
Thomas nickte ernst. Er dachte an seine Forschungen und die einzurichtende Schule. Beides würde ihm in der Tat kaum Zeit lassen, den Pflichten eines Abtes nachzukommen. »Ihr habt Recht, Ehrwürdiger Vater. Niemand kennt mich besser als Ihr.«
»Dann wäre das geklärt. Gaudeck, würdest du mir ein zweites Kissen unter den Kopf schieben?«
Der Sekretär, der wie die anderen von dem Wunsch des alten Mannes völlig überrascht war, griff zerstreut zu einem mit Rosshaar gefüllten Leinenkissen. »Äh, ja, sofort.«
»Ich helfe Euch«, sagte Vitus. Vorsichtig hob er Kopf und Oberkörper des Greises an, damit Gaudeck das Kissen darunter stopfen konnte.