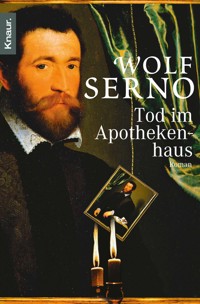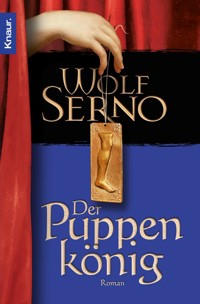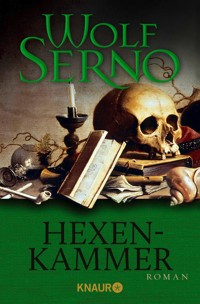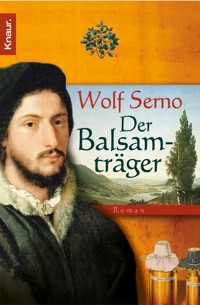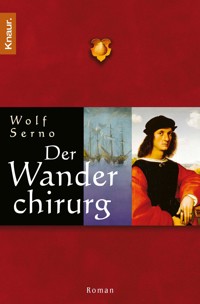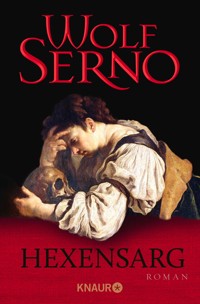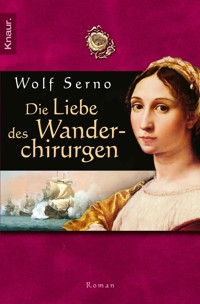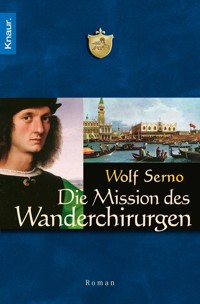
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderchirurgen-Serie
- Sprache: Deutsch
Vitus, der weit gereiste Wanderchirurg und mutmaßliche Erbe von Schloss Collincourt, ist untröstlich: Seine geliebte Arlette, nach der er so lange gesucht hat, stirbt in seinen Armen an der Pest. Doch vorher nimmt sie ihm das Versprechen ab, ein Heilmittel gegen den Schwarzen Tod zu finden. Mit seinen Freunden reist er nach Padua, weil er hofft, an der berühmten Universität dieser Stadt eine Arznei gegen die Seuche zu finden. Aber das Schicksal scheint sich erneut gegen den tapferen Cirurgicus verschworen zu haben ... Der neue Bestseller des Erfolgsautors von Der Wanderchirurg! Die Mission des Wanderchirugen von Wolf Serno: Historischer Roman im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 935
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Wolf Serno
Die Mission des Wanderchirurgen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vitus, der weit gereiste Wanderchirurg und mutmaßliche Erbe von Schloss Collincourt, ist untröstlich: Seine geliebte Arlette, nach der er so lange gesucht hat, stirbt in seinen Armen an der Pest. Doch vorher nimmt sie ihm das Versprechen ab, ein Heilmittel gegen den Schwarzen Tod zu finden. Mit seinen Freunden reist er nach Padua, weil er hofft, an der berühmten Universität dieser Stadt eine Arznei gegen die Seuche zu finden. Aber das Schicksal scheint sich erneut gegen den tapferen Cirurgicus verschworen zu haben … Der neue Bestseller des Erfolgsautors von Der Wanderchirurg!
Inhaltsübersicht
Motto
Vorbemerkung
Widmung
Prolog
Die Gebieterin Âmina Efsâneh
Der Feigenvertilger Mehmet Pascha
Der Fettwanst Ma’rûf ibn Abram
Die Dienerin Rabia
Der Karawanenführer Hadschi Abdel Ubaidi
Der Handelsherr Hadschi Moktar Bônali
Die Braut Budûr
Der Vasen- und Weinhändler Montella
Der Pestarzt Doktor Sangio
Der Zugmeister Arnulf von Hohe
Der Anatom Professor Girolamo
Der Riese Enano
Der Überlandfahrer Fabio
Die Bürstenbinderin Antonella
Der Geigenbauer Guido
Der Jakobspilger Ernesto
Der Arzt und Prior Thomas
Die Schülerin Nina
Der Spion Sir Francis Walsingham
Die Herrscherin Elisabeth
Der Earl of Worthing
Epilog
Er wird dich mit Seinen Fittichen decken,
und deine Zuversicht wird sein unter Seinen Flügeln.
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken müssest
vor dem Grauen des Nachts,
vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,
vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die im Mittag verderbet.
Psalm 91,4–6
Die religiösen Zitate des Romans stammen aus:
DIE BIBELDie ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen TestamentsSiebenundzwanzigster AbdruckGedruckt und verlegt von B. G. Teubner in Leipzig, 1877
sowie
DER KORANAus dem Arabischen nach der Übersetzung von Max HenningVMA-Verlag, Wiesbaden
Die Operationen und Behandlungen in diesem Buch spiegeln den wissenschaftlichen Stand des 16. Jahrhunderts wider. Zwar gab es schon damals Eingriffe, die sich im Prinzip bis in unsere Tage nicht verändert haben, und auch die Kräuter wirken heute nicht anders als vor über vierhundert Jahren, doch sei der geneigte Leser dringend vor Nachahmung und Anwendung gewarnt.
Für mein Rudel:Micky, Fiedler († 16), Sumo und Buschmann
Und diesmal auch für Heiner, den »Olden«,
mein Urgestein
Prolog
Zum wiederholten Male verspürte Pater Thomas an diesem Morgen eine gewisse Unruhe, ein unbestimmtes Gefühl, ja, eine dumpfe, wenn nicht gar dräuende Vorahnung – Zeichen, die er kannte, aber keineswegs schätzte, denn sie erwiesen sich häufig genug als berechtigt. Dabei lief auch heute wieder alles seinen gewohnten Gang. Es war ein schöner, wenngleich kalter Märztag im Jahre des Herrn 1579, und nichts deutete auf eine Besonderheit hin. Wie immer waren kurz nach der Prim seine Schüler aus den umliegenden Dörfern eingetroffen, hatten mit ihm ein Morgengebet in der Kapelle gesprochen und saßen nun in dem kleinen, mehr schlecht als recht beheizten Raum, dessen Fenster zum Innenhof des Klosters hinausführten. Tief über ihre Schiefertafeln gebeugt, kritzelten sie eifrig Buchstaben.
Pater Thomas seufzte unhörbar. Es war schon ein recht zusammengewürfelter Haufen, der da vor ihm hockte, neun Jungen und Mädchen unterschiedlichsten Alters, die sich mühten, die Kunst des Schreibens und des Lesens zu erlernen, und sich darüber hinaus mit den Vokabeln der lateinischen Sprache abplagten.
Abermals seufzte Thomas. Diese Schüler waren wie ein Klumpen feuchter Ton, dem man auf der Töpferscheibe Form geben musste. Geduld, Geduld und nochmals Geduld waren vonnöten, ihnen etwas beizubringen, viel mehr als bei den Pueri oblati, den offiziellen Klosterschülern, die sorgfältig ausgewählt wurden und demzufolge rasch Fortschritte machten. Wenn er auch nur geahnt hätte, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen würden, als der alte Abt Hardinus ihn kurz vor seinem Tode bat, eine Schule aufzubauen und Unterricht zu erteilen! Er hatte zugestimmt, obwohl ihm schon damals vor drei Jahren klar gewesen war, wie viel Zeit diese Aufgabe ihm abverlangen würde. Zeit, die er eigentlich für seine Forschungen brauchte. Er war Arzt und Prior in Campodios, dem altehrwürdigen Zisterzienserkloster im Nordspanischen, und darüber hinaus Autor eines Werkes namens De morbis hominorum et gradibus ad sanationem, eintausendzweihundert Seiten stark, mit prachtvollen, von kunstbegabten Mitbrüdern in zahllosen Stunden angefertigten Illustrationen. Das Werk, kurz De morbis oder Über Krankheiten genannt, stellte eine Sammlung der wichtigsten ärztlichen Erkenntnisse dar und teilte sich auf in die Kräuterkunde, die Lehre der Pharmakologie sowie die Wundchirurgie nebst dem Wissen zur Geburtshilfe. Pater Thomas war nicht wenig stolz auf das gewaltige Kompendium, zumal seine eigenen bescheidenen Beiträge neben denen so berühmter Meisterärzte wie Susruta von Benares, Hippokrates von Kos, Galenos, Dioskurides, Avicenna und vielen anderen darin auftauchten.
Er seufzte zum dritten Male. Und diesmal laut. Noch immer kritzelten die Schüler auf ihren Tafeln herum. Wie gern würde er jetzt seine Forschungen über den Schwarzen Senf und das Ruchgras vorantreiben! Beide Kräuter, dazu ihre Wirkverbindung mit Teufelskralle und Arnika, hatten ihm bereits achtbare Erfolge gegen das Reißen beschert. Doch er war dazu verdammt, hier zu sitzen, und musste Bruder Cullus, der eigentlich für das Vermitteln der Lese- und Schreibkunst verantwortlich war, vertreten. Cullus. Ein fröhlicher, sangesfreudiger, allseits beliebter Bruder, der allerdings gerne kräftig aß und noch lieber ein gehöriges Maul voll Wein nahm.
Thomas, der die asketische Lebensweise bevorzugte, war sicher, dass er die heutige Vertretung nur Cullus’ Schwäche für die Freuden der Tafel verdankte. Wer sich so wie er ernährte, musste sich nicht wundern, wenn die Gicht ihn in die große Zehe biss. Auf sein Jammern hin war Thomas mitten in der Nacht zu ihm geeilt und hatte sich das Fußglied im Schein mehrerer Kerzen angesehen. Es war rot wie der Kehlsack eines Truthahns gewesen und angeschwollen, als hätte jemand es aufgepumpt. Cullus hatte gestöhnt und alle Heiligen um Hilfe angefleht und behauptet, die bloße Berührung mit der Bettdecke bereite ihm schon Höllenqualen.
»Du isst zu fett und zu viel, und du verdünnst den Wein nicht«, hatte Thomas vorwurfsvoll gesagt.
»Oh, oh, oh, Bruder, so pack doch nicht so fest zu, ja, ja, da am Gelenk, da zwickt’s mich wie mit Feuerzangen!«, hatte der Dicke geheult, und Thomas war nichts anderes übrig geblieben, als ihm einen Weidenrindentrank und einen Pflanzenpresssaft der Herbstzeitlose zu verabreichen.
»Danke, danke, Bruder! Ich werde dich in meine Gebete einschließen und eine Kerze für dich in der Kapelle entzünden – wenn ich denn jemals wieder laufen kann. Oh, oh, oh …!«
»Ich lasse dir ein Fläschchen Herbstzeitlosensaft hier«, hatte Thomas erwidert, »nimm alle Stunde einen Löffel voll, insgesamt fünf Male, aber um des lieben Herrgotts willen keinen einzigen mehr. Denke daran, was die heilige Hildegard von Bingen über die Herbstzeitlose geschrieben hat: ›… und wenn ein Mensch sie isst‹, sagte sie, ›davon stirbt er oft, weil darin mehr Gift als Gesundheit ist.‹«
»Oh, oh, oh!«
»Cullus, so höre doch! Nur einen einzigen Löffel! Und nur jede Stunde einen. Fünf Mal. Viel hilft nicht immer viel! In diesem Fall ist es genau umgekehrt.«
Pater Thomas schreckte auf. Zwei oder drei der Lausebengel hatten, während er mit seinen Gedanken weit fort gewesen war, ein munteres Schwätzchen begonnen. Das ging denn doch zu weit. »Ruhe!«, donnerte er und erhob sich. »Wollen doch einmal sehen, ob ihr mit dem Griffel genauso schnell seid wie mit dem Mund.«
Er steuerte durch die Reihen der Sitzenden und spähte auf das Gekritzel. Es handelte sich dabei um den ersten Satz aus einer Satire des Seneca. Thomas hatte die Aufgabe mit Bedacht gewählt, schien sie ihm doch gleich drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Zum einen übten die Schüler sich dabei im Schreiben, zum anderen lernten sie, das Geschriebene zu lesen, und zum Dritten konnten sie sich dabei, wie von selbst, ein paar neue Vokabeln Latein aneignen. Thomas verehrte Seneca, jenen römischen Staatsmann, Philosophen und Dichter, der eine Zeit lang Berater des Kaisers Claudius war, bevor er zum Lehrer seines Nachfolgers Nero berufen wurde.
Wie nicht anders erwartet, waren die Ergebnisse seiner Anbefohlenen dürftig. Zu ungelenk standen die Buchstaben auf den Schiefertafeln, zu krakelig, als dass er damit hätte zufrieden sein können. Einzig Nina bildete eine Ausnahme. Ihre Lettern waren sauber niedergeschrieben, Wort für Wort. Ja, Nina, die älteste Tochter von Carlos Orantes, einem kleinen Landpächter aus der Gegend von Punta de la Cruz, hatte ihre Sache wie immer gut gemacht. Sie war ein ernstes Mädchen, lernbegierig und sehr begabt, womit sie sich deutlich von ihren Mitschülern unterschied. Sie interessierte sich sehr für die Heilkunst, hatte Freude an der Kräuterkunde und war zu alledem bildhübsch. Ihr Gesicht glich dem einer Madonna, mit makelloser Haut und ausdrucksstarken schwarzen Augen, die von langen, seidigen Wimpern umrahmt wurden. Ihre Nase war ein Näschen, gerade und kurz, ihre Lippen waren rot und voll, vielleicht sogar ein wenig zu rot und zu voll für eine Madonna, doch zweifellos wunderschön …
Etwas erschreckt gebot Pater Thomas seinen davongaloppierenden Gedanken Einhalt. Hatte er soeben gegen sein Keuschheitsgelübde verstoßen? Nein, nein, beruhigte er sich. Auch ein Priester hatte Augen, um zu sehen, und diese Augen sagten ihm, dass Nina kein Kind mehr war. Übernächsten Monat, im Mai, würde sie siebzehn Jahre zählen und damit ein Alter erreicht haben, in dem viele andere schon verheiratet waren. Aber Orantes, ihr Vater, schien sich darum nicht zu scheren. Er schickte seine Tochter an drei Tagen in der Woche zur Schule, und es schien ganz so, als sei er stolz auf ihr kluges Köpfchen.
»Ihr müsst noch viel üben!«, sagte Thomas laut, wobei er sich bemühte, streng zu klingen. »Schreibt den Satz noch dreimal nieder. Anschließend lesen wir ihn gemeinsam und übersetzen ihn. Du, Nina, kannst einen Augenblick Pause machen.«
»Ja, Vater.« Orantes’ Tochter legte den Griffel beiseite.
Einer der Jungen fragte: »Was ist das eigentlich für’n Satz, Vater?«
Thomas runzelte die Stirn. »Die Worte stammen aus einer Satire des Seneca. Seneca war nicht nur ein Poet, sondern auch Advokat, Quästor und Senator im alten Rom.«
»Und was ist, äh, eine Satire?«
»Das Wort kommt vom Lateinischen ›satira‹, worunter man eine mit Früchten gefüllte Schüssel versteht. Hier ist das natürlich anders gemeint. Die Satire ist eine Literaturform, in der mittels Ironie bestimmte Menschen oder Zustände der Lächerlichkeit preisgegeben werden sollen.«
»Und was ist Ironie?«
Pater Thomas, der mittlerweile an seinen Platz zurückgekehrt war, setzte sich. »Ich habe den Eindruck, du fragst nur, damit du um das Schreiben herumkommst, Pedro, aber das wird dir nicht gelingen.«
Pedro blickte ertappt zu Boden.
»Aber ich will dir trotzdem antworten. Die Ironie ist eine Art Spott.«
Jetzt war es José, der fragte: »Wer soll denn überhaupt von diesem Seneca verspottet werden, Vater?«
»Nun, dazu muss man wissen, dass Seneca dem römischen Kaiser Claudius als Berater diente. Claudius war ein belesener Mann, von dem sogar einige wissenschaftliche Schriften überliefert sind. Er galt zeit seines Lebens als eigenwillig, harmlos und unkriegerisch. Sein herausragendstes Merkmal war aber wohl seine Schrulligkeit. Nachdem er gestorben war, schrieb Seneca deshalb eine Satire auf den Tod und die Vergöttlichung des Claudius. Nun weißt du Bescheid.«
»Ja, Vater. Und wie heißt die, äh, die Satire?«
»Das spielt doch keine Rolle. Doch warum soll ich es dir nicht sagen. Sie heißt Apocolocyntosis Divi Claudii.«
»Apo … Alopo …?«
»Ich sehe, du bist wirklich noch nicht weit fortgeschritten in der Sprache der Wissenschaft. Apocolocyntosis Divi Claudii heißt so viel wie die ›Verkürbissung des Kaisers Claudius‹.«
»Die … die was?« José verdrehte die Augen, blies die Backen auf und hielt sich die Hand vor den Mund. Doch er konnte den Lachanfall nicht mehr unterdrücken. Lauthals prustete er los: »Verkürbissung, Verkür … kürbissung … hoho, huhu, Verzeihung, Vater, aber das ist vielleicht ’n komisches Wort!«
Alle anderen fielen mit ein. Sogar Nina lächelte.
Pater Thomas musste sich eingestehen, dass er den Titel so noch niemals betrachtet hatte. Aber der Junge hatte Recht. Welch skurrile Wortschöpfung! Er spürte, wie das Lachen der Klasse ihn anzustecken drohte, und gestattete sich ein Schmunzeln. »Nun gut«, sagte er, »ich merke schon, ihr könnt euch nicht mehr richtig konzentrieren, wechseln wir deshalb das Fach.« Er wartete eine Weile, bis sich alle beruhigt hatten, und sagte dann: »Wo wir gerade von Kürbissen reden – weiß jemand, wozu diese Pflanze arzneilich nütze ist?«
Nina hob die Hand. »Kürbisfleisch ist gut für brennende Augen.«
»Sehr gut«, lobte Thomas. »Ein altes Hausrezept. Man schneidet dünne Streifen von der Schale ab und legt sie behutsam auf den Augapfel. Am besten, wenn der Patient liegt. Aber das ist beileibe noch nicht alles, was die Kürbispflanze Cucurbita kann.« Er blickte fragend in die Runde.
Als keine Antwort kam, fuhr er fort: »Aus den Kernen lässt sich ein treffliches Öl pressen. Es wirkt gut gegen Würmer in den Eingeweiden. Ebenfalls ein altes Hausrezept. Wozu sind Kürbissamen außerdem nütze?« Er wartete. »Nun, da ihr es nicht wisst, will ich es euch sagen. Wer regelmäßig dreimal täglich eine Hand voll davon kaut, kann …« Er unterbrach sich, denn er spürte, wie Nina ihn unverwandt ansah. Sie hörte genau zu. Das machte ihn ein wenig verlegen, denn er war im Begriff, auf die Schwierigkeiten des Wasserlassens bei alten Männern zu kommen. Seltsam, fuhr es ihm durch den Kopf, wenn statt ihrer dort eine breithüftige Bäuerin säße, würde mir das nichts ausmachen. Nicht das Geringste! Ob es daran liegt, dass sie so jung und hübsch ist? Er schob die lästigen Gedanken beiseite und sprach betont sachlich weiter: »… kann wirksam dafür sorgen, dass sein Wasser besser abfließt. Ich meine damit besonders die betagten Herren, die häufig Schmerzen dabei verspüren. Wir Ärzte nennen das ›schneidend Wasser‹. Wohl jeder hat in seiner Familie jemanden …« Er fuhr herum, denn die Tür war unvermittelt aufgerissen worden. Auf der Schwelle stand Bruder Castor, der greise Torsteher, neben sich einen halbwüchsigen Burschen, der seine Kappe in den Händen drehte.
»Der junge Mann hier ließ sich nicht fortschicken«, sagte Castor mit seiner brüchigen Stimme.
»Und was will er?« Pater Thomas klang wenig freundlich. Er schätzte es nicht, wenn sein Unterricht gestört wurde.
Castor winkte Thomas zu sich heran. »Das will er nur dir sagen, Bruder. Na, mir soll’s egal sein, ich muss zurück, das Tor bewacht sich nicht von allein.«
»Ich heiße Felipe«, sagte der Bursche draußen auf dem Gang und drehte weiter seine Kappe. »Die alte Tonia schickt mich. Tonia, die Stoffweberin …«
»Ja? Was ist mit ihr?« Thomas kannte die Frau, die regelmäßig in die Klosterkirche zum Beten kam.
»Ich soll sagen, ich soll sagen …« Die Kappe drehte sich jetzt noch schneller. Felipe senkte die Stimme. »Ich soll sagen, sie hat einen großen Klumpen in der Brust, und der tut höllisch weh, soll ich sagen. Tonia liegt zu Bett, Schweiß auf der Stirn, es geht ihr schlecht, ganz schlecht. Und sie hat kein Geld für den Bader, und da soll ich fragen …«
»Schon gut. Setz deine Kappe auf und laufe zu ihr zurück. Sage ihr, ich käme so bald wie möglich.« Ohne eine Antwort abzuwarten, kehrte Thomas dem Jungen den Rücken. Das war es also! Jemand litt Not und brauchte sofort seine ärztliche Hilfe. Seine Vorahnung hatte sich wieder einmal bestätigt! Er eilte zurück in den Klassenraum. »Für heute ist Schluss, Kinder, geht nach Hause. Ich muss zu einer Patientin.«
Den verhaltenen Jubel der Schüler im Ohr, lief er nach draußen, vorbei am Badehaus des Klosters, auf dem Weg zum Nosokomium, dem Hospital von Campodios. In seinem Kopf schwirrten die Gedanken, was es mit dem »Klumpen in der Brust«, wie Felipe es ausgedrückt hatte, wohl auf sich habe. Zweifellos handelte es sich um eine Geschwulst, wobei sich die Frage stellte, ob diese gutartig oder gefräßig war. Traf Letzteres zu, sprach der Arzt von Brustfraß. Die Krankheit zerstörte zuerst das Gewebe, dann die Organe und zuletzt das Leben. Eine niederschmetternde Diagnose, bei der alle Therapiekunst fast immer vergebens war. Die alten Meister empfahlen, den Knoten so früh wie möglich zu entfernen, zu einem Zeitpunkt, da er nicht größer als ein Pisum, eine Erbse, war. Aber welche Frau tastete schon täglich ihre Brüste ab, um erbsengroße Verdickungen aufzuspüren! Die gute Tonia hatte gewiss anderes zu tun. Seit ihr Mann vor vielen Jahren gestorben war, hatte sie schon Mühe genug, sich mit der Weberei ihr täglich Brot zu verdienen.
Mit diesen und anderen Gedanken betrat Thomas das Hospital, einen kargen Raum mit acht Betten, von denen allerdings nur drei belegt waren. Die Kranken hatten Influenza, fieberten, niesten und husteten, und Bruder Paulus, sein Assistent, erneuerte gerade die heißen Wadenwickel.
»Laudetur Jesus Christus!«, grüßte Thomas geistesabwesend, und Paulus murmelte die Antwortformel: »In aeternum, in aeternum.«
Rasch strebte Thomas einem kleinen Nebenraum zu, in dem er seinen Instrumentenkasten und ein Quantum ausgesuchter Kräuter verwahrte. Beides packte er auf ein Tragegestell und schulterte es. »Bitte sei so gut, Bruder, und entschuldige mich bei Abt Gaudeck, ich muss zu einer Kranken und werde deshalb die nächsten Stundengebete nicht einhalten können«, sagte er, während er überlegte, ob er seinen Assistenten bitten sollte, ihn zu begleiten. Eine Brustoperation, und eine solche würde wohl vonnöten sein, war keine Kleinigkeit. Und vier Hände bewirkten nun einmal mehr als zwei. Doch dann sah er, wie beschäftigt Paulus war, und beschloss, es allein zu versuchen.
»Ist recht. Geh mit Gott, Bruder!«, rief Paulus ihm hinterher.
Thomas verlor keine Zeit. Mit großen Schritten strebte er zum Nordtor, nickte Bruder Castor kurz zu – und blieb wie angewurzelt stehen. »Nina!«, entfuhr es ihm, »was machst du denn noch hier?«
Orantes’ Tochter löste sich aus dem Schatten des Gittertors und trat vor ihn. Sie reichte dem großen, hageren Mann kaum bis zur Schulter. »Ich dachte, ich begleite Euch, Vater«, sagte sie ruhig. »Ich kenne die alte Tonia gut. Ich möchte ihr gerne helfen, indem ich Euch helfe. Außerdem kenne ich den Weg zu ihrem Haus.«
»Tja, hm.« Thomas war für einen Augenblick sprachlos. Nina wollte ihm bei der Operation zur Hand gehen? Eine Frau, die fast noch ein Mädchen war? Noch niemals hatten ihn weibliche Hände bei einer derart diffizilen Tätigkeit unterstützt, und er wusste auch nicht, ob er das gutheißen konnte. »Tja, hm«, wiederholte er unentschlossen. »Höre, Nina, ein solcher Eingriff ist ein blutiges Geschäft. Das ist nichts für zartbesaitete Seelen.«
Eine kleine Falte erschien über Ninas Nase. »Ich bin nicht zartbesaitet, Vater. Außerdem können wir Frauen eher Blut sehen als mancher Mann. Weil wir es regelmäßig sehen. Ihr wisst schon, was ich meine.«
Thomas wurde die Sache ein wenig peinlich. »Hm, ja, ja, schon gut.«
»Wisst Ihr überhaupt, wo Tonia wohnt?«
Der Pater musste einräumen, dass er keine Ahnung hatte. Er war einfach so, den Kopf voller Überlegungen, losgelaufen.
»Dann komme ich mit. Gestattet, dass ich vorgehe.« Mit kleinen, schnellen Schritten eilte Nina voraus, den schmalen Pfad entlang, der sich in sanften Biegungen den Hang hinabschlängelte. Kurz bevor sie das Tal erreichten, fragte Thomas:
»Woher kennst du eigentlich die alte Tonia?«
Nina wandte sich im Gehen um. »Ich habe viele Geschwister, Vater, und es ist nicht immer leicht, alle satt zu bekommen, aber noch schwieriger ist es, gute, feste Stoffe zu beschaffen, aus denen Mutter und ich Hosen, Hemden und Röcke nähen können. Denn irgendwann, wenn es das dritte oder vierte Mal an den Nächstjüngeren weitergegeben wurde, ist auch das beste Beinkleid zerschlissen. Stoffe sind teuer, wisst Ihr, und wenn der Winter lang ist, so wie dieser es war, werden sie nur immer noch teurer. Tonia hat uns manches Mal mit Leinen ausgeholfen und beileibe nicht immer gleich auf Bezahlung gepocht.«
Thomas nickte. Ihm fiel auf, dass Nina ein einfaches, hübsch anzusehendes Kleid mit einem warmen Brusttuch darüber trug. Beides, das dunkelblaue Kleid und das weiße Tuch, standen ihr sehr gut.
»Ich mag sie.«
»Wen? Ach so, Tonia, natürlich.«
»Wir müssen uns jetzt rechts halten, Vater, sonst kommen wir direkt nach Punta de la Cruz, und das wäre falsch.« Nina bog ab und wanderte zielstrebig in ein kleines Wäldchen hinein. Nach wenigen hundert Schritten machte sie Halt und wies auf ein windschiefes Holzhaus, dessen verwahrlostes Äußeres darauf hindeutete, dass in seinen Wänden schon lange kein Mann mehr wohnte.
Als Thomas das baufällige Gebäude betrat, mussten seine Augen sich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Er verweilte für einen Moment, blickte um sich, entdeckte einen hölzernen Webstuhl zu seiner Linken und im hinteren Teil des Raums eine Bettstatt aus Stroh. Darauf lag Tonia, die sich nun mühsam aufrichtete. »Seid Ihr es, Pater Thomas?«
Der Arzt trat ans Krankenlager, und die Alte versuchte, seine Hand zu ergreifen und diese zu küssen. Mit furchtsamer Stimme flüsterte sie: »Gottes Segen über Euch, dass Ihr gekommen seid!«
Thomas zog seine Hand zurück. »Leg dich nur wieder hin, Abuela«, sagte er und hoffte, dass die Anrede »Großmutter« die Kranke ein wenig beruhigen möge. »Mach dir keine Sorgen, wie du siehst, bin ich nicht allein gekommen. Nina ist bei mir, sie wird mir, wenn nötig, zur Hand gehen.«
Die Stoffweberin nickte Orantes’ Tochter dankbar zu. »Du bist ein gutes Kind, ein gutes Kind …«
Thomas setzte das Tragegestell ab und war weiter um einen freundlichen, Vertrauen erweckenden Ton bemüht: »Felipe sagte mir, du hättest einen Klumpen in der Brust. Ich werde dich deshalb sorgfältig abtasten müssen, Abuela, auch wenn es dir unangenehm ist. Es wird nicht wehtun. Denke daran, dass es die Hände des Heilkundigen sind, die dich berühren. Sei zuversichtlich. Denn schon bei Moses in der Bibel steht: Ich bin der Herr, dein Arzt, und wenn Gott in seiner Barmherzigkeit es will, so wirst du wieder gesund.«
Während er das sagte, war er zu den beiden kleinen, mit Tierhäuten verhängten Fenstern geschritten und ließ Licht herein. Dann überprüfte er die Kochstelle in der Ecke des Raums und stellte fest, dass nur noch wenig Glut vorhanden war. »Nina, lege etwas Holz nach und fache das Feuer an. Dort liegt ein Blasebalg.«
»Ja, Vater.«
»Zuerst aber entzünde ein paar Kerzen, es muss hell sein für die Untersuchung.«
Nina tat, wie ihr geheißen.
»Und nun zu dir, Abuela. Am besten, wir ziehen dir das Hemd über den Kopf. Ja, so … richte dich ein wenig auf … das genügt. Nein, du brauchst gar nichts weiter zu tun.« Thomas legte der Kranken behutsam die Hand auf die Stirn, konstatierte eine erhöhte Körpertemperatur, griff nach dem Puls und stellte fest, dass dieser sehr unruhig war. Die Kranke schien noch immer von Angst geplagt zu sein. »In welcher Brust sitzt denn die Geschwulst«, fragte er wie nebenbei, nur um irgendetwas zu sagen, denn er hatte längst erkannt, dass der Knoten sich rechts befand.
Stumm wies die Alte auf die Stelle.
Thomas begann mit der Tastuntersuchung. Im Gegensatz zu der erschlafften, welken Brust fühlte der Knoten sich fest und elastisch an. Er befand sich oberhalb der Brustwarze, dicht unter der Haut, und er war so groß wie eine Kinderfaust. Thomas versuchte, ihn hin und her zu schieben, doch das misslang. Ein weiterer Versuch schlug ebenfalls fehl. Ein störrisches Stück! Andererseits lag darin ein Vorteil. Mit ein wenig Glück konnte er den Knoten mit der Fasszange ergreifen, nach oben herausdrücken und ihn dann von dem umgebenden Gewebe abtrennen. Die andere Methode war radikaler. Sie sah die gesamte Amputation der Brust vor, eine Maßnahme, die von vielen der alten Meister empfohlen wurde. Denn falls das Gewebe bösartig war, wurde es auf diese Weise besonders weiträumig herausgeschnitten. Man nahm zwei lange, leicht gebogene Nadeln, an deren Ende ein gedrehter Flachsfaden befestigt war, und stieß sie kreuzweise unter der Geschwulst hindurch. Dann nahm man die vier Fadenenden gleichzeitig auf und konnte so den Knoten gesamtheitlich hochziehen und mit dem Skalpell von seinem Untergrund abtrennen. Die zweite Methode war zweifellos viel blutiger.
Nina trat heran. »Ich habe alles gemacht, Vater. Was soll ich jetzt tun?«
»Warte, meine Tochter«, erwiderte Thomas. »Ich will nur rasch meine Instrumente herrichten.« Er breitete ein sauberes Stück Leinen vor dem Strohlager aus, legte seine Zangen, Nadeln, Skalpelle, Scheren, Sonden, Haken, Spreizer, Kauter, Lanzetten und all die anderen Utensilien darauf und griff endlich zu einem Fläschchen mit der Beschriftung Tct. Laudanum. Er gab es Nina. »Flöße Tonia den Inhalt ein, dann wird sie sich rasch entspannen.«
»Ja, Vater. Was bedeutet Tct. Laudanum?«
»Es heißt vollständig Tinctura Laudanum. Ein Schmerz- und Beruhigungsmittel, bestehend aus Alkohol und Drogen, vor allem aber aus dem Saft, der in der Kapsel der Opiumpflanze zu finden ist.«
»Habt Ihr es selbst hergestellt?«
»Natürlich.«
Nina wollte noch weiter fragen, fühlte aber, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Sie hob der Alten leicht den Kopf an und setzte das Fläschchen an ihre Lippen. Gehorsam trank die Kranke.
»Und jetzt lege diese beiden Kauter ins Feuer. Achte darauf, dass ihre Spitzen zur Gänze mit Glut bedeckt sind. Und fache die Flammen nochmals mit dem Blasebalg an.«
Während Orantes’ Tochter gehorchte, verfiel Thomas ins Grübeln. Er zog sich eine Kiste heran und stützte das Kinn in die Faust. Welche Methode sollte er wählen? Wie immer bei einer Operation galt es Risiken und Möglichkeiten abzuwägen. Der Eingriff mit der Fasszange war zwar kleiner und unblutiger, aber im Fall der Bösartigkeit kam der Brustfraß leichter wieder zurück. Die große Operation mit den Flachsfäden hingegen versprach mehr Hoffnung auf Heilung, konnte aber zum alsbaldigen Tode führen, etwa durch Verbluten. Es half nichts, er musste sich entscheiden. Thomas atmete tief durch und erhob sich. Zuvor wollte er noch die linke Brust auf Verhärtungen abtasten. Fand sich in ihr nichts, sollte die Fasszange genügen, saß jedoch auch dort ein Knoten, sollten die Nadeln mit den Flachsfäden zum Einsatz kommen. Und dann gleich bei beiden Brüsten.
Er kniete sich vor die Kranke und begann die Untersuchung. Er nahm sich Zeit. Die alte Tonia befand sich bereits in einem gnädigen Dämmerzustand und nahm das Geschehen um sich herum kaum noch wahr. Dann stand fest, dass die linke Seite nicht befallen war. Das gab den Ausschlag. »Ich werde mit der Fasszange arbeiten«, sagte Thomas zu Nina, »hilf mir, die Patientin mehr ins Helle zu drehen. Licht ist das Wichtigste bei einer Operation, ohne Licht nützen die geschicktesten Hände und die besten Instrumente nichts.«
Nachdem sie die Lagerstatt mit der Patientin in die wenigen von außen hereindringenden Sonnenstrahlen geschoben und auch noch die Kerzen dazugestellt hatten, ließ Thomas sich auf der rechten Seite des Bettes nieder. Er bedauerte, dass es im Haus keinen Tisch gab, auf dem die Kranke hätte liegen können. Alles wäre dann einfacher gewesen. So aber musste er den Eingriff auf Knien vornehmen, ein Umstand, der ihn schmerzlich daran erinnerte, dass er die Sechzig schon überschritten hatte. »Du setzt dich am besten an der Kopfseite nieder, dann kannst du mir leichter behilflich sein«, sagte er.
»Ja, Vater.« Ninas Augen blitzten. Pater Thomas hatte sie als seine Helferin bezeichnet! Mit einer graziösen Bewegung sank sie in den Schneidersitz.
»Ich werde den Knoten mit der Fasszange packen und empordrücken. Das tue ich, indem ich die beiden Griffe zusammenpresse. Ich werde es so machen, dass die Griffenden dabei zu dir zeigen, dann kannst du sie später leichter übernehmen. Drücke die Zange nur weiter fest zusammen. Alles andere überlasse mir.« Er setzte das Instrument an, und schon beim zweiten Mal gelang es ihm, die Geschwulst von unten zu umfassen. Langsam drückte er zu. Die alte Tonia gab einen seufzenden Laut von sich. Gott sei Dank schien sie von alledem nichts mitzubekommen. Der Gewebeknoten wanderte nach oben. Durch den Druck spannte die Haut sich jetzt so, dass die Konturen der Geschwulst scharf hervortraten.
»Der Knoten sieht aus wie eine harmlose Birne, die auf der Seite liegt«, sagte Thomas. »Hoffentlich ist es kein Brustfraß.«
»Warum heißt es eigentlich Brustfraß?«, fragte Nina, die das Vorgehen des Arztes gebannt verfolgt hatte.
Thomas antwortete: »Die Lehre der Meisterärzte geht dahin, dass eine tödliche Geschwulst wächst, indem sie sich von dem umliegenden Gewebe nährt. Sie frisst gewissermaßen das Fleisch in ihrer Nachbarschaft auf wie ein Raubfisch die Stichlinge in einem Teich. Deshalb Brustfraß oder auch Fressgeschwulst. Das Böse im Körper wird immer größer, und das Gleichgewicht der Säfte gerät mehr und mehr aus den Fugen. Am Ende herrscht vollständige Diskrasie im Leib; die unvermeidliche Folge ist der Tod. Hier, nun halte die Griffe.«
Thomas nahm ein scharfes Skalpell und führte einen schnellen, geübten Schnitt halb um den Knoten herum aus. Blut begann zu fließen, doch Nina hielt die Griffe eisern fest. Er sah es mit Genugtuung. Der Eingriff verlangte seine ganze Konzentration. Während er die andere Hälfte unter dem Knoten freilegte, hoffte er, dass die Geschwulst am Unterboden ebenso glatt und flächig sei, dann wäre das Herauslösen ein Kinderspiel, eine saubere Sache, bei der man sicher sein konnte, dass nichts in der Wunde verblieb …
»Hebe die Zange ein wenig an, meine Tochter, ja, so ist es gut. Noch mehr. Gut.« Mit kleinen Schnitten arbeitete Thomas weiter, und je mehr er vordrang, desto sicherer wurde er, dass der Tumor trotz aller Größe keine Schwierigkeiten machen würde.
Und so war es. Wenig später hatte er den Fremdkörper mit Stumpf und Stiel herauspräpariert. Er jubelte innerlich, ließ sich aber nichts anmerken. »Lege den Knoten dort in die Schale, und dann hole mir rasch den Kauter aus der Glut, den kleineren, der wird gottlob genügen.«
Es zischte hässlich, als Thomas den glühenden Kauter in die offene Wunde drückte, doch die martialische Prozedur hatte Erfolg. Der Blutstrom versiegte. Die alte Tonia zuckte mehrmals, keuchte und wurde halbwach. Thomas fuhr ihr beruhigend über die Stirn, während er eine Heilsalbe auftrug. »Es ist überstanden, Abuela, bald sitzt du wieder hinter dem Webstuhl«, sagte er betont munter. »Schließ nur wieder die Augen.«
Als Nächstes wandte er sich dem Knoten in der Schale zu. Er schnitt ihn mit dem Skalpell an und zog ihn mit zwei Wundhaken auseinander. Dann betrachtete er eingehend die Struktur. Und wurde enttäuscht. Die Masse war von unregelmäßiger graugelber Farbe und damit zweifellos verdächtig. Thomas schüttelte den Kopf. Dann beugte er sich weit vor, um den Geruch aufzunehmen. Auch hier dieselbe Erkenntnis: verdächtig! Hätte er doch besser die große Operation wählen sollen? Müßig, jetzt darüber nachzudenken! Die Geschwulst war heraus, und sie war – böse.
Ibn Sina fiel ihm ein, jener berühmte arabische Arzt des 11. Jahrhunderts, der in Europa unter dem Namen Avicenna bekannt war. Ibn Sina hatte interessante Beiträge zu Form und Farbe von Fressgeschwülsten verfasst. Thomas war sicher, der Araber wäre in diesem Fall zu derselben Diagnose gekommen.
Die alte Tonia gab Lebenszeichen von sich. Sie winkte matt mit der Hand. »Seid … Ihr fertig … Vater?«
»Ja, Abuela, der Übeltäter ist entfernt.«
»Wird … wird alles gut?«
Thomas räusperte sich. Das war die Frage, die er befürchtet hatte. Der Tumor war bösartig, das schien klar. Er war zwar entfernt, aber deshalb noch lange nicht besiegt. Alles hing davon ab, ob seine nachwirkende Kraft reichen würde, aus sich selbst heraus wiederzuerstehen. An gleicher oder anderer Stelle. Dann wäre alle ärztliche Kunst vergebens gewesen. »Das liegt in Gottes Hand, Abuela!«, antwortete er.
»Ja, ja, wie alles.« Die Alte kam jetzt mehr und mehr zu sich. »Aber … wie ist Eure Meinung?«
Thomas hielt es für wenig wahrscheinlich, dass die Stoffweberin das nächste Weihnachtsfest noch erleben würde, aber das wollte er ihr natürlich nicht sagen. Außerdem gab es immer wieder Wunder, die Gott der Herr bewirkte, und warum sollte er seine gnadenreiche Hand nicht über diese alte Frau halten? Doch genauso gut konnte es sein, dass er sie zu sich nahm. Seine Wege waren unergründlich, sein Wille hatte zu geschehen. »Ich muss dir noch einen Verband anlegen, Abuela«, sagte er. »Nina und ich werden dich aufrichten, damit ich die Binden um deinen Oberkörper wickeln kann.«
Sie taten es, und als Thomas der Alten unter die Achsel fasste, schrak er innerlich zusammen. Er hatte dort weitere Knoten gefühlt! Kleinere zwar, aber zweifellos Knoten, Töchter des einen großen aus der Brust! Das hieß: Die Schlacht war endgültig verloren.
»Ist da was … Vater?«
Thomas biss die Zähne zusammen. Was sollte er sagen? Seine Gelübde verboten ihm strikt das Lügen. »Nun ja, Abuela, in der Tat hast du einige Verdickungen unter der Achsel, aber das muss nicht von Bedeutung sein. Vielleicht ist es nur eine Abwehrhandlung deines Körpers gegen den Übeltäter dort in der Schale.«
Die alte Tonia schwieg. Sie sah Thomas mit großen Augen an.
Der Pater konnte ihrem Blick nicht standhalten. Mit Ninas Hilfe legte er rasch den Verband an. »Begebe dich nur in des Erhabenen Hände, Abuela. Dann wird es dir an nichts mangeln.«
Immer noch schwieg die Alte. Thomas begann seine Instrumente einzupacken. Als er fertig war und sein Tragegestell schulterte, sagte er: »Ich komme übermorgen wieder, Abuela, dann wechsele ich den Verband. Einstweilen lasse ich dir noch Arznei hier. Ein Fläschchen mit weiterem Laudanum, dazu Pulver zum Aufbrühen von Weidenrindentrank. Hast du jemanden, der sich in der Zwischenzeit um dich kümmert?«
Die Alte schüttelte den Kopf.
»Sie hat mich«, sagte Nina. »Ich werde mich um sie kümmern.«
»Du?«
»Warum nicht? Sonst tut es ja keiner.« Orantes’ Tochter schob das zierliche Kinn vor.
»Aber, aber … die Schule, deine Eltern …?«
»In der Schule werdet Ihr mich gewiss für ein paar Tage entschuldigen, Vater, und meine Eltern werden mich nicht vermissen. Ich schicke Felipe zu ihnen, er wird ihnen erklären, warum ich hier bleiben muss.«
»Du hast zu Hause doch sicher ebenfalls Aufgaben?«
»Das stimmt, Vater. Aber ich denke, diese hier ist für den Augenblick wichtiger. Ich tue bestimmt das Richtige; es gibt keine andere Möglichkeit. Oder könnt Ihr Tonia in Euer Hospital aufnehmen?«
»Wo denkst du hin!« Thomas schüttelte energisch den Kopf. »Es ist ein reines Männerhospital, gedacht für die kranken Brüder auf Campodios.«
»Seht Ihr.« Nina setzte ein bezauberndes Lächeln auf. »Es geht nicht anders. Ich bleibe. Vorausgesetzt natürlich, Tonia ist einverstanden.«
»Oh, das bin ich, Kind, das bin ich«, kam es vom Lager.
»Nun denn, wenn ihr Frauen das so beschlossen habt, will ich dem nicht im Wege stehen.« Thomas rückte sein Tragegestell zurecht. »Gott sei mit euch, gesegnet seist du, Tonia, meine Tochter.« Er machte das Kreuzzeichen. »Und auch du, Nina Orantes, die du einen ziemlichen Dickkopf hast.« Abermals schlug er das Kreuz.
Lächelnd verließ er das Haus.
Am anderen Tag sah Bruder Cullus sich noch immer nicht in der Lage, mehr als zehn Schritte auf einmal zu tun, was dazu führte, das Thomas ihn erneut in seiner Zelle aufsuchen musste. Als er eintrat, sah er, wie der Dicke mit flinken Fingern ein ledernes Büchlein zu verstecken suchte. »Was hast du da, Cullus?«, fragte er.
»Oh, nichts, nichts.«
»Gib mal her.« Thomas griff nach dem Buch und schlug es auf, dort, wo das Lesezeichen steckte. Er las:
Sunt quae praecipiant herbas satureia nocentes
sumere; iudiciis ista venena meis.
Aut piper urticae mordacis semine miscent
tritaque in annoso flava pyrethra mero …
Und während er las, staunte er mehr und mehr, denn er erkannte, dass er es mit der Ars amatoria, dem Werk des Ovid über die Liebeskunst, zu tun hatte, und hier mit einem Abschnitt über Anregungsmittel.
Manche schreiben vor, das schädliche Kraut Saturei
einzunehmen. Das ist meines Erachtens Gift.
Oder sie mischen Pfeffer mit dem beißenden Samen
der Brennnessel und geriebenes gelbes Betramkraut
in altem Wein …
So oder ähnlich hätte ein guter Lateinschüler die Worte übersetzt. Thomas schluckte. Cullus wollte doch nicht etwa diesen unzüchtigen Text seiner Klasse vermitteln? Das ging denn doch zu weit! Fassungslos legte er das Buch beiseite.
»Oh, Thomas, glaube jetzt nichts Falsches!«, rief Cullus, als habe er die Gedanken seines Mitbruders erraten. »Ich lese Ovid doch nur wegen des herrlich elegischen Versmaßes, nur deshalb, niemand beherrscht den Gleichklang der Worte so wie dieser große Dichter!«
»Es scheint dir ja doch nicht so schlecht zu gehen. Vielleicht haben die Anregungsmittel für die Liebe ja auch die Heilung deiner großen Zehe beschleunigt?« Thomas gab sich kaum Mühe, die Ironie in seiner Stimme zu verbergen.
»Thomas, Bruder! So glaube mir doch, es ist nur wegen des wunderbaren Versmaßes …«
»Ja, ja, setz dich und zeig die Zehe.« Thomas untersuchte das Gelenk und kam zu dem Schluss, dass Cullus entweder ein meisterhafter Imitator war – oder wirklich noch erhebliche Schmerzen verspürte. Da er ihm nichts Böses unterstellen wollte, ging er von Letzterem aus.
»Nun gut«, sagte er, »ich muss wohl noch für ein paar Tage deine Stunden in der Schule übernehmen. Aber nur, wenn du meine Medizin weiter wie vorgeschrieben einnimmst. Willst du das tun?«
Cullus grinste erleichtert. »So wahr mir Gott helfe!«
»Den Saft der Herbstzeitlose muss ich erst neu pressen und anmischen, vor heute Abend bekommst du ihn nicht. Lass bis dahin die Mahlzeiten weg und trinke auch keinen Rotspon, umso schneller wird es dir besser gehen.«
»Ja, Bruder, ich tue alles, was du sagst. Auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt.«
»Schön.« Thomas wollte die Zelle verlassen, wurde aber von seinem Mitbruder zurückgehalten, der ihm mit treuherziger Miene nachrief: »Wenn im nächsten Monat das Grün wieder ins Kraut schießt, helfe ich dir beim Pflücken im Herbalgarten, Thomas! Das ist so gewiss, wie Gott die Erde in sechs Tagen erschuf!«
Pater Thomas war versöhnt und ging.
Einem wie Cullus konnte man nicht lange gram sein.
»Gallia est omnis divisa in partes tres … Ganz Gallien ist in drei Teile geteilt … Gallia est omnis divisa in partes tres … Ganz Gallien ist …« Der leiernde Singsang der Schüler wirkte einschläfernd auf Thomas. Aber er war notwendig. Das ständige Repetieren eines Textes stellte noch immer die beste Methode dar, das Gefühl für Latein zu entwickeln. Und die einfache Sprache aus Caesars De bello Gallico tat ein Übriges. Dennoch hatte er nicht den Eindruck, als wären die Schüler mit Begeisterung dabei. Sie wirkten lustlos, allesamt. Nina fehlte.
Nina. Was Orantes’ Tochter wohl in diesem Augenblick tat? Sicher pflegte sie die alte Tonia mit großer Umsicht. Wieder stand ihm die Operation mit dem schrecklichen Ergebnis vor Augen – wie so oft in den letzten Stunden. Er hatte vor der Prim für die Stoffweberin gebetet und sich danach etwas besser gefühlt. Die Zwiesprache mit dem Herrn hatte ihn gestärkt. Doch nun bemächtigten sich seiner wieder Enttäuschung und Bitterkeit. Was nützte die beste chirurgische Arbeit, wenn sie völlig umsonst war? Welche Antwort gab Gott auf diese Frage? Thomas faltete unbewusst die Hände. Vielleicht war es einfach so, dass der Mensch mehr glauben als fragen sollte. Ja, so war es wohl.
»… quarum unam incolunt Belgae … einen davon bewohnen die Belgier … quarum unam incolunt Belgae … einen dav …« Der Singsang brach unvermittelt ab. Pater Thomas schreckte auf. Was war los? Alle Schüler blickten auf einmal zur Tür. Und in der Tür stand – Nina.
Thomas war so überrascht, dass er im ersten Augenblick kein Wort hervorbrachte. »Was machst denn du hier?«, fragte er schließlich.
»Entschuldigt, Vater, dass ich störe, aber ich muss Euch dringend sprechen.«
»Ist etwas mit der alten Tonia?« Der Pater sprang auf und war mit wenigen Schritten bei Orantes’ Tochter.
»Nein, oder … eigentlich doch.«
»Ja, was denn nun?« Thomas konnte seine Ungeduld nicht zügeln. Er war voller Sorge und zog die junge Frau hinaus auf den Gang. »Lebt sie?«
»Ja, ja. Es geht ihr soweit gut. Es ist etwas anderes. Sie hat mir etwas erzählt. Ich glaube, es ist sehr wichtig!«
»So, sie lebt.« Thomas war einigermaßen beruhigt. »Setzen wir uns dort drüben in das Bogenfenster. Ich höre, meine Tochter.«
Nina begann etwas unschlüssig. »Nun, Vater, ich muss wohl damit anfangen, dass die alte Tonia Euch angesehen hat, wie es um sie bestellt ist. Sie sagte, sie habe nicht mehr lange zu leben, sie sei ganz sicher, und deshalb müsse sie mir etwas erzählen. Eine Begebenheit, die lange zurückliege und die ihr noch immer wie ein Mühlstein auf der Seele laste.«
»Ja? Worum handelt es sich?«
»Nun, Vater, es ist eine lange Geschichte.«
Und dann berichtete Nina, was Tonia erzählt hatte. »›Vor ungefähr zwanzig Jahren‹, hatte sie gesagt, ›schleppte sich eine junge, völlig entkräftete Frau über die Schwelle unseres Hauses. Mein Mann lebte damals noch. Er wollte sofort den Bader holen, aber die Fremde lehnte ab. ‚Mein Leben hat sich erfüllt‘, flüsterte sie. ‚Mein Sohn liegt vor dem Tor des Klosters. Man wird für ihn sorgen.‘ Ich wollte ihr heiße Brühe geben, aber sie schüttelte den Kopf. Ich bot ihr Brot an, dann Käse, dann Suppe – vergebens. Die Frau verweigerte jegliche Nahrung. ‚Ich will nur noch sterben‘, sagte sie wieder und wieder. Und dann verriet sie uns ihren Namen und ihre Herkunft, und wir konnten kaum glauben, wen wir vor uns hatten. Kaum glauben konnten wir’s. Und dann, kurz bevor sie ihren letzten Atemzug tat, bat sie uns, sie in dem kleinen Gärtchen hinterm Haus zu begraben, und wir mussten bei der heiligen Mutter Maria schwören, niemals etwas über sie zu verraten. Niemals. ‚Der Schande wegen‘, wie sie sagte. Doch heute, angesichts meines nahenden Todes, muss ich es tun. Ich kann sonst nicht in Ruhe sterben …‹«
Nina endete und stellte zu ihrem Erstaunen fest, dass Pater Thomas’ Gesichtszüge bebten.
»Was du da sagst, ist von ungeheurer Tragweite, meine Tochter, von ungeheurer Tragweite!«, rief er. »Es gab in unserem Kloster einen Jungen, den der alte Abt Hardinus im Gebüsch vor dem Klostertor gefunden hatte, eingewickelt in ein rotes Damasttuch. Wir nannten ihn Vitus, und er wuchs in unseren Mauern auf. Er war im Fach der Cirurgia der begabteste Schüler, den ich jemals hatte!«
»Ich weiß, ich kenne ihn doch, Vater. Was glaubt ihr, warum ich sofort hierher gerannt bin, nachdem Tonia mir das alles erzählt hatte.«
»Großer Gott, ich bräuchte einen Stuhl, wenn ich nicht schon säße! Vitus zog hinaus in die Welt, auf der Suche nach seiner Familie. Er glaubt, sie in England gefunden zu haben. Und wenn er sich nun doch geirrt hat? Höre, Nina, nannte die alte Tonia den Namen der Mutter?«
»Nein, bisher noch nicht.«
»Ich muss sofort zu ihr. Nach so vielen Jahren könnte der Schleier über Vitus’ Herkunft endlich gelüftet werden und das letzte Glied in der Beweiskette gefunden sein. Wenn der alte Abt Hardinus das noch erlebt hätte! Ich muss sofort zu Tonia und mit ihr sprechen. Anschließend geht ein Bote nach Greenvale Castle. Noch heute. Hoffentlich trifft er Vitus dort an!«
Und Pater Thomas, der Arzt und Prior von Campodios, fiel auf die Knie, und er spürte den harten Stein unter sich nicht, während er aus tiefstem Herzen betete:
»Oh, Herr, wie unverständlich sind Deine Wege,
wie unergründlich ist Dein Ratschluss,
wie unantastbar Dein ewiger Wille,
doch wollen wir Menschen an Dir nicht zweifeln,
sondern Dich loben heute und immerdar.
Amen.«
»Amen«, wiederholte Nina.
Die Gebieterin Âmina Efsâneh
»Bei Allah, dem Kämpfenden, dem Listigen!Du hast mich benutzt wie eine Bodenvase,in die du deinen Stängel hineingestoßen hast.Das wirst du mir büßen!«
Niemand in der Medina von Tanger konnte sich daran erinnern, jemals so heiße Maitage erlebt zu haben. Der stete Wind, der gewöhnlich vom Dschebel al-Tarik über die Meerenge heranwehte, schien für immer eingeschlafen zu sein. Schon am frühen Vormittag stand die Luft wie eine Mauer auf den zahllosen Plätzen, erdrückte jegliche Betriebsamkeit, schnürte der Stadt den Atem ab. Wo sonst gelärmt, gefeilscht und gegaukelt wurde, wo Geldwechsler ihre Kurse priesen, Trickdiebe betrogen, Schreiber ihre Dienste anboten, wo Trommler, Hornbläser und Flötisten musizierten, Magier und Jongleure Sprachlosigkeit verbreiteten, wo Schiffsmatrosen zechten, Huren nach Freiern Ausschau hielten, Sklaven den Besitzer wechselten, wo Fischer ihren Fang verkauften und Handwerker ihrem Tagewerk nachgingen, überall da herrschte Stille. Gassen, Gässchen, Hinterhöfe waren wie leer gefegt. Wer dennoch sein Haus verließ, glaubte, in der Gluthitze die Steine der Zitadelle hoch über der Stadt knacken zu hören.
Am Fuße der alten Festung, auf einem kleinen vorgelagerten Souk, gab es eine einzige Ausnahme. Fünfundzwanzig oder dreißig Männer hockten in typischer Haltung am Boden, einfach gekleidet, bärtig, den Kopf durch einen Turban geschützt. Sie saßen starr, wie gelähmt, doch war der Grund dafür nicht die alles versengende Glut, sondern ein kleiner, drahtiger Mann, der vor ihnen stand und mit Händen und Füßen redete. Er bediente sich dabei des Spanischen, was durchaus verstanden wurde, denn Tanger gehörte anno 1579 zum portugiesischen Reich. Der Mann hatte eine marokkanische Dschellabah an, eine Art lange Tunika, braun-weiß gestreift, mit halblangen Ärmeln und Kapuze, doch war er kein Berber und auch kein Beduine, wie seine Gesichtszüge verrieten. Seine Haut wies nicht das tiefe Braun der Wüstensöhne auf, sondern eher die Farbe von Oliven. Seine Stirn war hoch, und seine Augen waren schwach. Er blinzelte häufig, weil er kurzsichtig war und die beiden Berylle, die er trug, seine Sehschwäche nur unzureichend ausgleichen konnten.
Ein solches Nasengestell mit Linsen hatten die Zuhörer noch niemals gesehen, und das, obwohl sie in einer weltoffenen Hafenstadt lebten. Phönizier, Römer, Goten, Wandalen, Byzantiner, Araber und wohl noch ein halbes Dutzend andere Völker hatten in ihren Mauern gelebt, sie manches Mal zerstört, doch immer wieder aufgebaut. Die Bewohner, ihre Kinder und Kindeskinder hatten sich als so überlebensstark erwiesen, dass Eroberer und Zuwanderer immer wieder im Schmelztiegel der Rassen aufgegangen waren – hier an diesem ganz besonderen Ort, wo das Westmeer auf das Mittelländische Meer traf, der Islam auf das Christentum prallte und das Tor nach Afrika aufgestoßen wurde.
Der kleine, drahtige Mann machte eine Pause, denn als guter Erzähler wusste er, dass dadurch eine Geschichte nur noch spannender wurde. »Gieße etwas Wasser auf die Plane über uns, Enano«, sagte er zu dem Zwerg neben sich. »Sonst dörrt es uns allen das Hirn aus.«
»Wui, wui, Magister«, fistelte der Winzling mit seinem Fischmündchen und blickte nach oben, wo über den Köpfen der Lauschenden ein großes Stück Segeltuch gespannt war. Er nahm einen Holzeimer und kletterte wie ein Äffchen das Stützgestänge hinauf. Hier und da ertönte Gelächter. Der Kleine mit seinen roten Haarbüscheln, dem hellblauen Kindergewand und dem fassähnlichen Buckel erinnerte an eine Mischung aus Kobold und Narr, und in gewisser Hinsicht war er das auch. Auf dem höchsten Punkt angekommen, goss er den Inhalt nach und nach aus. »Wui, der Plempel spreizt sich dull!«, rief er fröhlich und schien sich nicht im Mindestens daran zu stören, dass seine Rotwelschbrocken von niemandem verstanden wurden.
Das Wasser verteilte sich auf dem Tuch, feuchtete es auf breiter Fläche an und schaffte so Verdunstung und Linderung für die darunter Sitzenden. Beide, der drahtige Mann, der Magister gerufen wurde, und Enano, der Zwerg, waren eine Zeit lang zur See gefahren, wo sie diese segensreiche Erfindung kennen gelernt hatten.
»Erzähle weiter, Magister!«, forderte ein dürrer Alter und wischte sich ein paar der hartnäckigen Fliegen von den Augen.
»Ja, erzähle weiter!«, erklang es von mehreren Seiten. »Was ist eine eiserne Jungfrau?«
»Eine eiserne Jungfrau?«, fragte der Magister mit überraschend dunkler Stimme zurück. »Sagte ich das nicht schon?«
»Nein, das sagtest du nicht.«
Der drahtige Mann spitzte die Lippen und machte ein geheimnisvolles Gesicht. Unwillkürlich beugten sich die Zuhörer vor. »Nun, so wisset, die eiserne Jungfrau ist weder Mensch noch Tier, denn sie ist nicht aus Fleisch und Blut. Sie steht tief unten im Kerker von Dosvaldes, einem Provinznest in Nordspanien. Sie steht dort, solange es Menschen gibt, und manche sagen, es gab sie schon, bevor Gott der Herr oder, um es mit euren Worten zu sagen, Allah der Allmächtige die Welt erschuf. Satan ist zugleich ihr Vater, ihr Sohn und ihr Bruder. Ihr Lächeln ist tot, ihr Mund ist so schmal wie der Rücken eines Dolchs, ihr Gewand ist aus Stahl und reicht bis zum Boden hinab.«
Ein Raunen lief durch die Reihen. Die Männer steckten die Köpfe zusammen.
»Ich sah sie im unruhigen Licht der Fackeln, Freunde, und ihr totes Lächeln bekam plötzlich Leben. Ich ging auf sie zu und wollte sie untersuchen, doch der junge Lord hielt mich davon ab. ›Tu’s besser nicht, ich habe ein ungutes Gefühl‹, sagte er, ›irgendetwas stimmt mit ihr nicht.‹ Ich ließ von ihr ab, und wir fanden ein Buch, in dem stand, dass die eiserne Jungfrau auch ›Schmerzensreiche Mutter‹ oder Madre dolorosa genannt wird. Sie war also ein verborgenes Folterinstrument!
Ich fragte: ›Und wie funktioniert die Dame? Steht das auch da?‹ Und der junge Lord las vor:
›… item muss der verurteilte Suender verbundenen Auges dem weiblichen Automath entgegenschreiten, alsdann dieser sich oeffnet wie die Schenkel eines wollüstigen Weibes und also ihn zerstöret.‹
Vorn an ihrem Mantel befanden sich zwei Griffe, dort, wo auf einer Schürze die Taschen sitzen«, fuhr der Magister fort, »wir wollten daran ziehen, doch plötzlich hörten wir ein geheimnisvolles Rauschen. Es kam von der Figur. Wir zögerten, dann öffneten wir sie links und rechts mit entschlossenem Ruck, und siehe da …!«
Wieder machte der kleine Mann eine Kunstpause und erreichte prompt, was er beabsichtigt hatte.
»Ja? Was sahst du da?«
»Nun sag schon, sag’s doch!«
»Mach’s nicht so spannend!«
»Nun, Freunde, die Jungfrau war gänzlich hohl, in den Mantelhälften blinkten Dutzende nach innen gerichtete Stacheln und Klingen. Um zu erfahren, was das zu bedeuten hatte, blickten wir abermals in das Buch. Und dort stand:
›… der Haerethiker mag sein letztes Sprüchlein sagen, bis dass die Jungfrau sich schließet und ihn vielthausendfach durchbohret. Solcherart perforirt zu werden, ist als der ‚Kuss der Jungfrau‘ bekannt.‹
Mittlerweile hatte sich das Rauschen verstärkt, es war jetzt so mächtig wie ein Wasserfall. ›Ich glaube, ich weiß, was die Ursache ist‹, sagte mein Freund und Leidensgefährte, ›es ist der Pajo, der unter uns fließt. In dem Buch steht auch, dass der Delinquent beim Schließen des Mantels zerstückelt wird, woraufhin er nach unten in fließendes Wasser fällt und seine Überreste fortgeschwemmt werden.‹
Ich entgegnete: ›Wenn das so ist, muss es hier irgendwo etwas geben, das eine Falltür oder etwas Ähnliches auslöst. Wahrscheinlich außerhalb der Dame, irgendwo hier im Raum.‹ Ich blickte mich suchend um, dann entdeckte ich einen hölzernen Hebel, der aus dem Mauerwerk neben der Jungfrau herausragte. Ich zog daran. Mit lautem Knarren schwang der Boden unter der Figur beiseite. Der junge Lord und ich traten an den Rand der Öffnung und starrten nach unten, im Bemühen, etwas zu erkennen. Doch wir blickten nur in finstere, völlig gegenstandslose Schwärze.
›Wie tief man wohl fällt?‹, fragte ich meinen Leidensgefährten. Ich bekam keine Antwort. Beide dachten wir dasselbe: Wer hier noch bei lebendigem Leibe nach unten fiel, kam spätestens im Fluss durch Ertrinken zu Tode. Eine Flucht war unmöglich. Schweren Herzens gingen wir wieder zurück in unsere Zelle.«
Ein jüngerer Mann, der auf der Brust eine Kette mit der Fatima-Hand trug, rief: »Aber ihr seid doch geflohen, sonst wärest du nicht hier? Oder ist alles, was du uns erzählst, nicht mehr als ein Märchen aus Alf laila waleila?«
»Aus was?« Der Magister blinzelte verständnislos.
»Alf laila waleila!« Der junge Mann lächelte spöttisch. »Ihr Ungläubigen nennt dieses Werk Tausendundeine Nacht.«
»Selbstverständlich ist alles, was ich erzähle, die reine Wahrheit! Aber wenn du an meinen Worten zweifelst, kann ich ja aufhören.«
»Bei Allah, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, nein!« Der Jüngling wirkte plötzlich sehr beunruhigt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass seine vorlaute Bemerkung so drastische Folgen haben könnte. Überdies spielte es keine Rolle für ihn, ob die Geschichte erfunden war oder nicht, Hauptsache der Erzähler fuhr fort. Denn er erzählte gut. Die Nebenmänner des Mannes dachten ähnlich und versetzten ihm ein paar Rippenstöße, damit er still sei.
Der Magister, dem das alles nicht entgangen war, wirkte versöhnt. »Nun, Freunde, ob ihr es glaubt oder nicht, wir flohen wenig später tatsächlich durch den eisernen Schoß der Jungfrau, stürzten uns in die reißenden Fluten des Pajo, der uns durch die halbe Stadt trieb, bis wir endlich in einem Teich landeten, glücklich und wohlbehalten, wenn man von den unzähligen Mückenstichen absieht, die wir im Uferschilf davontrugen. Wir konnten es zunächst nicht fassen, Freunde. Wir waren frei! Die Flucht vor den Häschern der Inquisition war gelungen. Die grausamen Torturen, die der junge Lord und ich in der Folterkammer ertragen mussten, hatten ein Ende! Nie wieder würden uns die Daumenschrauben angelegt werden, nie wieder würden wir auf dem Stachelstuhl sitzen, nie wieder würden wir mit dem Feuereisen gebrannt werden. Nie wieder …«
Ein empörter Ruf unterbrach die lebhaften Ausführungen. »Barbarisch, einfach barbarisch, das Verhalten der Ungläubigen! Allah akbar! Er hätte so etwas niemals zugelassen!«
Der Magister war für einen Moment verwirrt. Dann beschloss er, darüber hinwegzugehen. Es wäre unklug gewesen, darauf hinzuweisen, dass Gott und Allah seiner Meinung nach nur zwei anders lautende Namen für den Einen, den Allmächtigen, waren und dass der Glaube an ihn sich nur durch die Propheten und ihre Auslegungen unterschied. Und unklug wollte er nicht sein. Der Aufenthalt im Kerker von Dosvaldes reichte ihm für ein ganzes Leben. Wer weiß, dachte er, was die Muselmanen an Quälereien bereithalten, wenn man nicht fünfmal am Tag den Gebetsteppich ausrollt und ihn gen Mekka ausrichtet! Laut sagte er:
»Es ist Zeit für einen neuen Guss, Enano! Hinauf mit dir, befeuchte das Segeltuch!«
»Wui, wui … hui, hui, bin schon am Kreipeln.« Der Wicht turnte nach oben und entlehrte aufs Neue den Holzeimer. Dabei passierte es ihm – Zufall oder Absicht? –, dass ein Schuss Wasser nach unten spritzte und geradewegs im Nacken des Zwischenrufers landete. Der schreckte auf und machte ein verdattertes Gesicht.
Schadenfreude ist die schönste Freude, das gilt überall auf der Welt, und Tanger mit seinen Einwohnern machte da keine Ausnahme. Die Umsitzenden lachten. Der Moment der Anspannung war verflogen.
Der Magister sah es mit Erleichterung. In den Landen der Barbaresken war mit Allah nicht zu spaßen. So gastfreundlich man sich hier auch gab, Koran, Scharia und Sunna waren ehernes Gesetz. Genauso, wie es die Heilige Schrift in seiner Heimat Spanien war, wo die Allerkatholischste Majestät Philipp II. auf dem Thron saß.
»Wui, Magister, kannst weitertruschen!«
»Nun, also, ja. Auf unserem Weg nach Santander schlossen wir uns einer Gauklertruppe an …«
»Nicht so schnell, nicht so schnell!« Wieder war es der vorlaute Jüngling, der unterbrach. »Was für eine Gauklertruppe? Und was wolltet ihr überhaupt in San …, in dieser Stadt?«
»Santander ist eine Hafenstadt an der nordspanischen Küste. Wir wollten dort eine Schiffspassage hinüber nach England nehmen …«
»Nach England? Was wolltet ihr denn in England?«
Der kleine Mann biss sich auf die Lippen. »Mein Leidensgefährte hatte die Vermutung, er könne seine Familie dort finden.«
»Seine Familie? Aber du sagst doch die ganze Zeit, er wäre ein junger Lord, da muss er seine Abstammung doch gekannt haben?«
»Zum damaligen Zeitpunkt kannte er sie noch nicht, mein scharfsinniger junger Freund. Er hatte als Hinweis nur das Wappen seiner Familie, wusste aber nicht, wem es zuzuordnen war und wo seine Träger ansässig waren. Mittlerweile darf als nahezu sicher gelten, dass er ein leibhaftiger englischer Lord ist …«
»Und wie ist sein Name, ich …«
»Pssst!« Diesmal war es der Magister, der unterbrach. »Wir wollen doch nicht alles vorwegnehmen.« Mit Sorge stellte er fest, dass die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer nachließ, was die alleinige Schuld dieses vermaledeiten Jünglings war. Ruhig Blut!, ermahnte er sich. Ich muss dafür sorgen, dass man mir nicht dauernd ins Wort fällt, und das tue ich am besten, indem ich die Spannung wieder steigere. »Höret, ich sagte, wir schlossen uns einer Gauklertruppe an, ihr Name ist übrigens Los artistas unicos, aber keine Sorge, ich will euch nichts über das fahrende Volk erzählen, dessen Künste ihr ja täglich auf den Plätzen eurer schönen Stadt seht, nein, ich will berichten über den Medicus, der bei den Artistas unicos mitfuhr. Er nannte sich Doctorus Bombastus Sanussus, und er war der größte Scharlatan, der mir je im Leben begegnet ist.«
»Wui, wui!« Der Zwerg nickte eifrig und rollte mit den Augen.
»Dieser so genannte Arzt quälte und betrog seine Patienten, statt sie zu heilen, er log sie an, statt ihnen die Wahrheit zu sagen, und er war geldgierig, so geldgierig, dass er im Zweifelsfall sogar von den Allerärmsten nahm. Er behauptete, aus dem Urin und seiner Farbe auf die Figur eines Menschen schließen zu können, wollte sage und schreibe daraus erkennen, ob jemand groß oder klein, dick oder dünn ist!« Der Magister schaute sich beifallheischend um.
Einige der Zuhörer taten ihm den Gefallen und lachten ungläubig.
»Ihr zweifelt an meinen Worten, Freunde, und doch war es so. Dieser Mann operierte Narrensteine aus den Schädeln Schwachsinniger heraus und behauptete anschließend, sie wären wieder bei Verstand. Dabei waren sie so wenig geheilt, wie sich Steine in ihren Köpfen befunden hatten. Quacksalberei! Damit nicht genug, verhökerte Bombastus Sanussus ein Gebräu, das er Balsamum vitalis nannte und das gegen alle Leiden dieser Welt helfen sollte. Innerlich wie äußerlich. Gegen Reißen und Grimmen ebenso wie gegen Pein und Kolik, gegen weiße und rote Scheißerei ebenso wie gegen Aussatz und schwarzes Erbrechen, gegen Krätze ebenso wie gegen Lues, jene Geißel, die aus Neu-Spanien über uns gekommen ist, und die auch Scabies grossa, Morbus gallicus, Lustseuche, Geschlechtspest oder Syphilis genannt wird. Gegen dieses alles sollte das Balsamum vitalis helfen – nur gegen eines nicht: faule Zähne. Dagegen empfahl der Beutelschneider … die Jauche vom Schwein!«
»Die Jauche vom Schwein? Brrrrr!« Einige der Männer schüttelten sich vor Ekel. »Möge Allah geben, dass ihm die Hand abfällt!«
»Das Schlimmste aber, meine Freunde, ist das, was er mit dem Augenlicht seiner Patienten machte. Ihr kennt sicher das Leiden, das sich ›graue Augen‹ nennt; manche bezeichnen es auch als ›grauer Star‹?«
Die Zuhörer nickten eifrig. Ihr Interesse schien jetzt wieder auf dem Höchststand angelangt. Im heißen Nordafrika waren Augenkrankheiten weit verbreitet, dafür sorgten das ewig gleißende Licht und die Schwärme von Fliegen, die sich unablässig im Gesicht niederließen.
»Die grauen Augen wollte er mit einer Rezeptur behandeln, die ihr nicht glauben werdet: Er nahm dazu die Eier der Roten Ameise und gab sie in ein Gläschen, welches er verklebte. Anschließend schlug er es in schwarzen Teig ein, formte ein Brot daraus und tat es in den Backofen. Nach dem Erkalten öffnete er das Gläschen und verkündete stolz, aus den Ameiseneiern sei nun Ameisenwasser geworden – die ideale Arznei gegen trübe Augen!«
»Haha! Wer sich ein solches Wirkloswasser aufschwatzen lässt, ist selber schuld!«, ereiferte sich der vorlaute Jüngling. »Kennt die Medizin der Ungläubigen nicht den Starstich? Es würde mich nicht wundern, wenn es so wäre.«
Der Magister musste an sich halten, um nicht aus der Haut zu fahren. Schon wieder hatte der Bursche seine Geschichte unterbrochen! Er bezwang seinen Ärger und redete scheinbar ungerührt weiter: »Natürlich kennt man auch außerhalb Afrikas und Arabiens den Starstich, aber es gibt nur wenige Ärzte, die ihn meisterhaft beherrschen. Bombastus Sanussus, der Kurpfuscher, gehörte nicht dazu. Aber er musste ihn ausführen, denn die Söhne des Patienten, eines schüchternen alten Mannes, bestanden auf der Operation. Der Scharlatan machte sich also mit großen Gesten und noch mehr Worten an den Eingriff. Er hieß den Alten, sich in die Sonne zu setzen, nahm ihm gegenüber Platz und ergriff mit der Rechten die Starstichnadel. Da bemerkte er, dass er sie mit der Linken führen musste, denn das rechte Auge des Alten war erkrankt. Seine linke Hand jedoch war offensichtlich ungeschickter, dennoch gelang es ihm, den Stich von der Schädelseite aus ins Weiße zu führen und die Linse nach unten zu drücken, bis sie verschwunden war. Sowie er dies getan hatte, sprang er auf und ließ sich von den herbeigeströmten Zuschauern feiern. Doch es kam, wie es kommen musste: Nur wenige Tage später erschien der Alte wieder; die Linse war nach oben gerutscht, die Sehkraft erneut eingetrübt. Eine ganz und gar misslungene Operation! Diesmal nahm mein Freund und Leidensgefährte, der junge Lord, den Eingriff vor. Und er wiederholte nicht den Fehler, den Bombastus Sanussus gemacht hatte. Er drückte die Linse mit der Lanzette genügend weit nach unten, bis die Aufhängebänder nachgaben, dann wartete er eine geraume Weile, bis feststand, dass die Linse nicht wieder emporwandern würde.«
Ein anderer Zuhörer meldete sich. »Der junge Lord nahm also den Starstich vor. Woher hatte er denn die Kenntnisse? Junge Lords pflegen in der Regel nicht zu arbeiten.« Kaum hatte er das gesagt, lachte er über seine eigenen Worte. Weitere Männer fielen in sein Gelächter ein.
Der Magister hob die Hände. »Ruhe, meine Freunde, Ruhe! Wie die meisten von euch wissen, stehe ich hier jeden Tag, und jeden Tag erzähle ich einen Teil der Abenteuer, die der junge Lord und ich in den letzten drei Jahren erlebt haben.«
»Wui, wui, un mit mir!«, krähte der Zwerg.
»Und mit Enano«, bestätigte der Magister. »Vor ein paar Tagen berichtete ich, dass der junge Lord im Kloster Campodios in den Artes Liberales ausgebildet wurde, und ich erwähnte auch, dass er jahrelang Lektionen in der Cirurgia und der Kräuterkunde bekam. Der Arzt des Klosters, Pater Thomas, gab ihm sein ganzes Wissen mit, und dieses Wissen, meine Freunde, kann sich mit jenem der größten Ärzte messen.«
»Wo ist eigentlich der junge Lord, von dem du dauernd sprichst?«, fragte ein sehr schlanker, dunkelhäutiger Mann mit heller Stimme. Es war das erste Mal, dass er sprach, und sein Gesicht war kaum zu sehen, denn er blickte auf seine Hand, in der er die neunundneunzig Perlen seiner Gebetsschnur emsig hin und her wandern ließ.