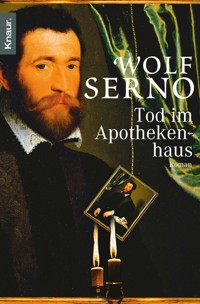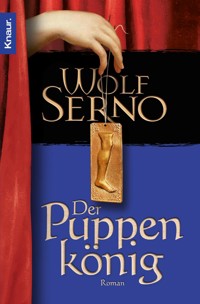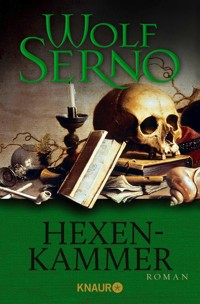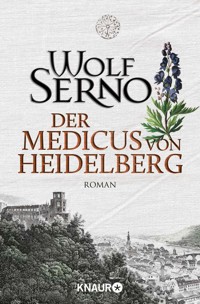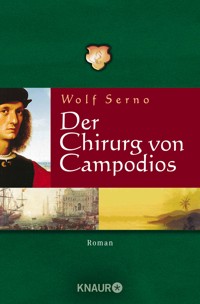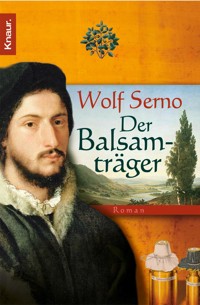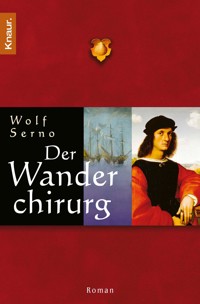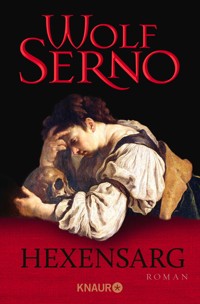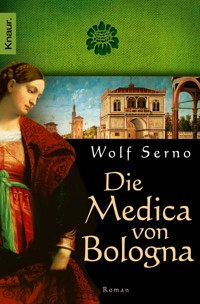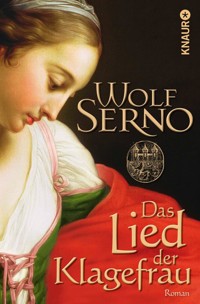Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschichte einer Hamburger Arztfamilie
- Sprache: Deutsch
Liebe zwischen Hoffen und Bangen.
Hamburg, 1961. Mit Lucie zur Haiden ist die nächste Generation in das Haus in der Großen Elbstraße eingezogen. Nach dem Wunsch ihrer Mutter soll Lucie ebenfalls Ärztin werden, doch ihr kommen immer größere Zweifel. Helfen möchte sie den Menschen schon, aber das Studium ist ihr zu theoretisch. Dann lernt sie Richard kennen, einen Modeschöpfer, der vorgibt, mehr zu sein, als er ist. Lucies Mutter hält ihn gleich für einen Blender, Lucie hingegen verliebt sich in ihn. Sie gibt ihr Studium auf. Der Haussegen hängt mächtig schief. Dann bricht auch noch die Sturmflut über Hamburg herein und scheint das Haus an der Großen Elbstraße komplett zerstört zu haben ...
Hamburg zur Zeit der Beatles und der neuen Mode. Der dritte Teil der faszinierenden Familiensaga vom Bestsellerautor Wolf Serno.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Familie zur Haiden hat schon viele Stürme erlebt. Doch in den heraufziehenden sechziger Jahren wird ihr Zusammenhalt auf eine harte Probe gestellt. Lucie zur Haiden beginnt ein Medizinstudium. Als ihre engste Freundin schwanger wird und heiraten muss, lernt sie Richard kennen, der sich französisch „Rieschar“ nennen lässt und im Geschäft seiner Mutter Brautkleider verkauft. Richard wirbt um Lucie und schließlich erliegt sie seinem Charme. Zum Leidwesen ihrer Eltern gibt sie ihr Studium auf und beschließt, ebenfalls Mode zu entwerfen. Alle Versprechungen, die Richard ihr gemacht hat, lösen sich mit der Zeit jedoch in nichts auf. Victor, ein entfernter Verwandter aus dem Elsass, gelingt es, Lucie zur Wiederaufnahme ihres Studiums zu bewegen. Bei einem Vortrag lernt sie den Referenten kennen – einen groß gewachsenen, sympathischen Arzt, in den sie sich auf der Stelle verliebt. Er sagt, er arbeite in Afrika, und verabschiedet sich. Wird Lucie den „Afrikaner“ jemals wiedersehen?
Hamburg in den wilden sechziger Jahren – die wechselvolle Geschichte einer jungen Frau auf der Suche nach Freiheit, Liebe und dem wahren Glück.
Über Wolf Serno
Wolf Serno war, bevor er begann, Romane zu schreiben, viele Jahre erfolgreich als Werbetexter und als Dozent tätig. Mit »Der Wanderchirurg« gelang ihm ein internationaler Bestseller. Er lebt mit seiner Frau und zwei Hunden in Hamburg und Nordjütland.
Bei Rütten & Loening und im Aufbau Taschenbuch sind von ihm »Große Elbstraße 7 – Das Schicksal einer Familie« und »Große Elbstraße 7 – Liebe in dunkler Zeit« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wolf Serno
Große Elbstraße 7 – Stürme des Lebens
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Widmung
Prolog — 8. April 1949
Erster Teil — 17. März bis 20. Juli 1961
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Zweiter Teil — 13. August 1961 bis 8. März 1962
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Dritter Teil — 26. Juni 1963 bis 28. April 1965
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Einige Nachbemerkungen
Die wichtigsten Personen der Handlung
Im Haus Große Elbstraße 7
In den Brautmoden am Jungfernstieg
In der Augenklinik des UKE
Auf St. Pauli
Im Bernhard-Nocht-Institut
Sonstige
Dank
Erläuterungen
Impressum
Wer von dieser großen Saga begeistert ist, liest auch ...
Senat und Bürgerschaft soll leben! Die Oberalten hoch daneben, Das hochachtbare Fundament Von Hamburg’s gutem Regiment! Heil über dir, Heil über dir, Hammonia, Hammonia! O wie so kräftig stehst du da! …1
Traditionell meinem Rudel gewidmet: Micky, Olli und Magda
Sowie Fiedler, Buschmann, Sumo und Eddi, die schon auf der anderen Seite der Straße gehen
Prolog
8. April 1949
Liebe Familie zur Haiden, liebe Freunde der Familie, liebe Trauergemeinde«, begann Pastor Ingwersen mit klarer Stimme seine Andacht. Er stand in Kapelle 2 des Ohlsdorfer Friedhofs, neben sich einen üppig mit weißen Lilien geschmückten Sarg, vor sich die dicht besetzten Stuhlreihen mit schwarz gekleideten Menschen. »Wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von einer Frau, deren Schicksal wohl genauso wechselhaft war wie das Wetter in diesen kühlen Apriltagen. Ein Schicksal, das stets von Sonne und Regen, von Freude und Leid bestimmt wurde. Ja, Frau Doktor Dreyer hatte ein bewegtes Leben, bevor der Herr sie in seinem unergründlichen Ratschluss zu sich nahm. Im Jahre 1872 als Viktoria zur Haiden geboren, hatte sie das Glück, ihren sechsundsiebzigsten Geburtstag noch im Kreise ihrer Lieben begehen zu dürfen. Denn ›Vicki‹, wie sie von ihren Freunden gerufen wurde, war unheilbar krank. Sie litt seit Jahrzehnten an multipler Sklerose und fühlte, dass es zu Ende gehen würde. Die engsten Verwandten sorgten sich sehr um sie. Allen voran Benno, ihr jüngerer Bruder, mit dem sie eine glückliche Kindheit im Haus an der Großen Elbstraße 7 verbrachte. Benno, der ›Luftikus‹, wie sie ihn manchmal nannte, weil er in jungen Jahren sein Zeichentalent dazu nutzte, um die Kneipenwände auf St. Pauli mit, äh, nicht ganz jugendfreien Akten zu verschönern, bevor er mit seiner Anni nach New York auswanderte, um dort ein berühmter Kunstmaler zu werden. Florence, seine Tochter, wuchs dort auf und wurde eine erfolgreiche Augenärztin. Sie zögerte jedoch keine Sekunde, mit dem Vater nach Hamburg zurückzukehren, nachdem sie erfahren hatte, dass Vicki aller Lebensmut zu verlassen drohte – aus Verzweiflung über den Tod von Hannes, ihrem geliebten Mann. Doktor Johannes Dreyer war mit Leib und Seele Arzt gewesen und hatte Vicki darin bestärkt, selbst Medizin zu studieren, ein Wunsch, der ihr als junges Mädchen im Kaiserreich noch verwehrt worden war, weshalb sie zunächst eine Ausbildung zur Erika-Schwester im Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf machte. Hannes starb im Jahre 1934, wie die Verstorbene mir neben vielen anderen Dingen anvertraute. Die Gewissheit, ab heute hier in Ohlsdorf an seiner Seite zur letzten Ruhe gebettet zu werden, war ihr ein großer Trost.«
Ingwersen hielt inne und ließ seinen Blick über die erste Reihe der Trauernden schweifen. Er musterte Benno, einen hageren Mittsiebziger, der einen schwarzen Stetson trug, und die neben ihm sitzende Florence, eine blonde, immer noch schöne Frau um die fünfzig. An ihrer Seite saß ein Herr mit grau melierten Locken, der den Arm um ein etwa zehnjähriges Mädchen gelegt hatte. Es handelte sich um Aron von Stolten, Florence’ Ehemann, mit Lucie, der gemeinsamen Tochter. Die Kleine trug ein schwarzes Käppi, unter dem zwei kurze blonde Zöpfe hervorlugten. Ihre Augen waren braun wie die des Vaters. Sie blickte ernst und konzentriert, ganz anders, als Ingwersen es von Mädchen ihres Alters kannte.
Er fuhr fort: »Benno ging während des Dritten Reiches in die Schweiz nach Genf, weil die Nationalsozialisten seine Kunst als entartet einstuften und ihm Bilder geraubt hatten, doch Florence blieb an Vickis Seite. Gemeinsam durchstanden die Frauen die Nazizeit mit all ihren Nöten, Schikanen und Bombennächten und versteckten im Keller einen Mann, der Halbjude war und sich Götz Vahrenfeld nannte, in Wahrheit aber Aron von Stolten hieß. Aron, der von allen, die ihm nahestanden, ›Ari‹ gerufen wurde, gehörte zu jenen tapferen Männern der Jewish Agency of Israel, die verzweifelten Juden heimlich aus Deutschland hinaushalfen, um sie nach Palästina ins Gelobte Land zu bringen. Mit Ari in seinem Kellerversteck saßen beide Frauen wahrlich auf einem Pulverfass – immer dann, wenn die Geheime Staatspolizei das alte Haus auf den Kopf stellte, um ihn zu finden. Doch gottlob gelang es der Gestapo nie. Ari hatte einen guten Schutzengel.«
Wieder legte Ingwersen eine Pause ein. Die kleine Lucie nickte lebhaft, als wolle sie jedes seiner Worte bekräftigen.
»Aber es gab auch Erfreuliches in dieser düsteren Zeit. Ein ganz besonderes Ereignis war die Geburt von Lucie, Florence’ Tochter, die 1938 das Licht der Welt erblickte und gleich zwei Väter hatte: Ari, den leiblichen Vater, den sie ›Daddy‹ nannte, und Finn Flögl, den sie ›Papa‹ rief. Finn war ein guter Freund der Familie und ist es bis heute geblieben. Damals war er Laboraufseher im Universitätskrankenhaus Eppendorf und kannte Vicki noch aus Cholerazeiten. Florence bat ihn, die Vaterrolle für Lucie zu übernehmen, denn Ari musste aus verständlichen Gründen im Verborgenen bleiben. Wenn er sich öffentlich zu seiner Tochter bekannt hätte, wäre er noch am selben Tag von den Nazis ins Konzentrationslager gesteckt worden. Finn jedoch stellte sich selbstlos zur Verfügung, obwohl dies für ihn mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war. Er erwies sich als treuer Weggefährte in schweren Zeiten.«
Ingwersen blickte auf. In der zweiten Reihe saß ein älterer Mann mit Halbbrille. Er lächelte und strich sich mit der Hand über den eisgrauen Schnäuzer. Offenbar Finn Flögl.
»Finn Flögl war nicht der Einzige, der viel Mut bewies, um Vicki und Florence in ihrem Kampf gegen Hitlers Häscher zu unterstützen; es waren auch die alten Gefährtinnen aus dem Eppendorfer Krankenhaus, wie Schwester Annerose, zu der die Verstorbene ein besonders enges Verhältnis hatte, außerdem die Leute von St. Pauli, die sie über Benno, ihren Bruder kennengelernt hatte. In ihren Schilderungen spielte dabei Willi Höller, der Wirt von Höller’s Hölle, eine besondere Rolle, ebenso wie Vira, die zusammen mit ihrem Sohn ›Schatzi‹ nach Höllers Tod die Gaststätte weiter betrieb. Es gibt noch viele andere Menschen, die den Lebensweg der Verstorbenen säumten, von ihnen seien hier Edith Göbe, ›Aale-Edith‹, erwähnt, die noch heute auf der Reeperbahn ihre Ware verkauft, Harald, der Friseur, den jedermann ›Tütchen‹ nennt, nicht zu vergessen Chang und JinJin aus dem ehemaligen Chinesenviertel, dazu Christian Warlich, der Tätowierkünstler, Frederik Rosen, der dänische Widerstandskämpfer, und Günter Discher, der Swing-Boy, der so oft Moonglow von Benny Goodman auf dem Trichtergrammophon spielte. Sie alle ließen es sich nicht nehmen, heute der Verstorbenen das letzte Geleit zu geben, sie waren treue Freunde, ganz im Sinne der Lehre unseres Heilands. Denn so steht es im Buch Jesus Sirach, Kapitel 6, Vers 14 und 15 geschrieben …« Ingwersen breitete die Arme aus und deklamierte:
»Ein treuer Freund ist ein starker Schutz,
wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden.
Für einen treuen Freund gibt es keinen Gegenwert,
seine Kostbarkeit lässt sich nicht aufwiegen …«
Er nannte weitere Beispiele aus der Bibel, zog immer wieder die Parallele zum Leben der lieben Verstorbenen und befahl Gott Vickis unsterbliche Seele an. Dann hieß er die Trauergemeinde aufstehen, segnete sie und betete mit ihr laut das Vaterunser.
Danach ließ er die Gesangbücher aufschlagen und Lied 37 anstimmen:
Von Gott will ich nicht lassen,
Denn er lässt nicht von mir,
Führt mich auf rechten Straßen,
Da ich sonst irrte sehr …
Zum Abschluss sagte er: »Nun mag noch jeder von Ihnen sein eigenes Lied für die Verstorbene haben, ein Lied, das gemeinsame Erinnerungen an schöne Stunden weckt. Wir wollen es im Stillen singen.«
Er wartete zwei Minuten, die er dazu nutzte, in seinen Unterlagen auf dem Altar zu blättern, denn er hatte an diesem Tag noch zwei weitere Trauerandachten zu halten, und führte die Hinterbliebenen anschließend hinaus aus der Kapelle zur Grabstätte. In der ersten Reihe schritten Benno, Florence und Ari, die sich untergehakt hatten. Florence, die während der ganzen Zeit die Tränen tapfer zurückgehalten hatte, fing plötzlich an zu weinen.
»Weine nicht, Flo, meine Liebste«, flüsterte Ari an ihrer Seite. »Vicki wäre es nicht recht, dich so verzweifelt zu sehen.«
»Ja, ja, ich weiß.« Flo drückte ein zerknülltes Taschentuch an die Augen. »Aber es tut so weh.«
Benno sagte ernst: »Das tut es. Aber bedenke: Vicki ist erlöst von allem. Sie schaut jetzt von oben auf uns herab. Auf dich, auf Ari, auf mich, auf die kleine Lucie …«
»Lucie?« Flo blickte sich um. »Wo ist sie überhaupt?«
»Ich habe sie zuletzt in der Kapelle gesehen.« Ari spähte bis ans Ende des Trauerzugs, doch er konnte sie nirgendwo entdecken. »Ich laufe rasch zurück.«
»Ich komme mit«, sagte Flo kurz entschlossen.
»Aber ihr könnt doch jetzt nicht einfach …«, protestierte Benno, doch Flo und Ari waren schon losgerannt. Atemlos kamen sie vor der Kapelle an und schauten in das alte Gebäude hinein. Was sich ihren Blicken darbot, war erstaunlich. Die Bestattungshelfer hatten bereits sämtliche Kränze und Gebinde auf einen Transportwagen geladen und wollten ihn zusammen mit dem Sarg zum Grab schieben, doch sie standen unschlüssig da. Etwas hielt sie davon ab. Es war Lucie. Sie hatte ihre kleine Hand auf den Sargdeckel gelegt und sang mit leiser Stimme:
»Der Mond ist aufgegangen
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar …«
»Erinnerst du dich?«, fragte Flo leise. »Wir haben das Lied gemeinsam mit Vicki im Krieg gesungen. Es war im Garten der Großen Elbstraße 7, und es war der erste Vollmond, den Lucie in ihrem Leben sah. Sie muss sich daran erinnert haben und singt das Lied jetzt für Vicki. Sie singt es nicht im Stillen, wie Pastor Ingwersen es wünschte, sondern so, dass jeder es hören kann.«
»Ja«, meinte Ari fast andächtig. »Unsere Kleine ist eben ein ganz besonderes Mädchen.«
»Das ist sie«, sagte Flo.
Erster Teil
17. März bis 20. Juli 1961
Kapitel 1
Das rosa-goldene Fabergé-Ei war der Mittelpunkt im Verkaufsraum der Brautmoden am Jungfernstieg von Irma Plath. Es stand in einer Vitrine zwischen drei in Satin, Tüll und Strass gekleideten Schaufensterpuppen und war, wie Madame Irma gern erwähnte, ein persönliches Geschenk der Großfürstin Anastasia von Russland.
»Anastasia?«, hakten viele Kundinnen nach. »Meinen Sie die Anastasia?«
»Gewiss«, antwortete Madame Irma dann. »Sie war die einzige Überlebende bei dem schrecklichen Mord an der Zarenfamilie im Jahre 1918. Ich lernte sie 1956 bei der Premiere des Films Anastasia, die letzte Zarentochter kennen und freundete mich mit ihr an. Für ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen brauchte sie einige standesgemäße Kleider, die ich nach ihren Wünschen anfertigen ließ. Sie zeigte sich von den Kreationen so begeistert, dass sie mir eines der Fabergé-Eier überließ, die ihr Vater, Zar Nikolaus II., gern verschenkte. Ich wollte es nicht annehmen, aber wie Sie sehen, bestand Anastasia darauf.«
Die wenigsten Damen glaubten die Geschichte, manche belächelten sie sogar, doch sie war so ungewöhnlich, dass sie in der feinen Hamburger Gesellschaft immer wieder die Runde machte und auf diese Weise für einen kleinen, aber stetigen Zustrom an Neukundinnen sorgte.
Allerdings war das dubiose Ei nicht der einzige Trumpf, den Madame Irma im Ärmel hatte, wenn es darum ging, den Verkauf ihrer Hochzeitskleider zu beflügeln. Es war auch die über jeden Zweifel erhabene Verarbeitung ihrer Erzeugnisse, die sie den drei türkischen Näherinnen in den hinteren Atelierräumen verdankte. Und nicht zuletzt Richard, ihr Sohn, der sich seine modischen Sporen bei bekannten Couturiers in Paris verdient hatte, und sich deshalb gern mit »Maître Richard« anreden ließ. Wobei »Richard« sich natürlich »Rieschar« aussprach.
Dies alles zusammengenommen hatte dazu geführt, dass Madame Irmas Modegeschäft innerhalb weniger Jahre zu einer der ersten Adressen in der Hansestadt wurde.
Doch an diesem trüben Vormittag im März 1961 schien kaum jemand einen Fuß vor die Tür setzen zu wollen, geschweige denn Interesse an einem Brautkleid zu haben. Madame Irma blickte durch die Schaufensterscheibe hinaus auf den Jungfernstieg und die Binnenalster. Sie stellte fest, dass nur wenige Autos unterwegs waren. Nun fing es auch noch an zu nieseln. Die Treppe, die schräg gegenüber zur U-Bahn-Station hinabführte, war wie leer gefegt. Nur ein großer schwarzer Regenschirm wurde plötzlich sichtbar. Er bewegte sich aufwärts, Stufe für Stufe. Unter ihm erschien eine junge, blonde Frau. Sie trug einen der modernen silbernen Lackmäntel, dazu verwaschene Jeans und Turnschuhe. Neben ihr ging eine kleinere Frau, dunkel, dicklich, in einem Dufflecoat, der eine Nummer zu groß war. Das sah Madame sofort. Was sie ebenfalls sah, war, dass die Frauen ihr Geschäft ansteuerten. Benötigte eine von ihnen ein Brautkleid? Vielleicht sogar beide? Nein, die Dickliche mit Sicherheit nicht. Wer würde ein solches Mauerblümchen schon heiraten wollen! Am besten, überlegte Madame Irma, wäre es, die Beratung Richard zu überlassen. Der konnte, wenn er wollte, sehr viel Charme versprühen und würde der Blonden sicher zu einer der teuersten Kreationen im Angebot verhelfen.
Sie ging nach hinten ins Atelier, wo sie Richard dabei überraschte, wie er bei Ipek, einer der Näherinnen, saß und mit ihr schäkerte. Das sah sie nicht gern, doch für eine Rüge blieb keine Zeit. Sie erklärte ihrem Sohn, worum es ging.
»Junge blonde Damen sind meine Spezialität«, sagte Richard selbstgefällig. Er war Ende zwanzig, trug stets ein Nadelkissen am Arm und einen Zopf am Hinterkopf. Böswillige Zungen hätten behauptet, dass er etwas weibisch aussah, aber seine Mutter vergötterte ihn.
»Ich könnte mir vorstellen, dass eines deiner neuen Modelle für die Blonde infrage käme«, sagte Madame Irma. »Sie sind modisch sehr aktuell.«
»Meinst du? Wir werden sehen.« Richard erhob sich ohne Hast und verließ das Atelier. Er ging nach vorn in den Verkaufsraum und stellte fest, dass die beiden Frauen noch vor dem Schaufenster standen und die Dekoration betrachteten. Sie bestand aus dem »Brautkleid des Monats«, dem Modell Soraya, mit einer Reihe von mehr oder weniger unabdingbaren Accessoires, als da waren: Schuhe, Nylonstrümpfe, Gürtel, Schmuck, Handschuhe und ein bunter Strauß aus Seidenblumen.
Wollten die Frauen nur mal gucken? Hatte seine Mutter sich geirrt?
Richard war drauf und dran, wieder nach hinten zu gehen, als er sah, dass die Blonde den Schirm zuklappte und sich der Ladentür zuwandte. Er eilte zum Dual-Plattenspieler, der hinter der Empfangstheke mit der Registrierkasse stand, und überlegte, welches Stück er auflegen sollte. Musik wirkte immer anregend auf die Stimmung und die Entscheidungsfreude der Kundinnen. Doch welche Musik würde bei diesen beiden am besten ankommen? Schlager? Etwa der Babysitter Boogie von Ralf Bendix? Nein. Der konnte als Wink mit dem Zaunpfahl verstanden werden. Marina von Rocco Granata? Nein. Der Text war italienisch, das verstand kein Mensch. Ich zähle täglich meine Sorgen von Peter Alexander? Nein. Sorgen hatte jeder selbst schon genug. Immerhin ging es um den schönsten Tag im Leben einer jeden Frau: die Vermählung ganz in Weiß. Dann vielleicht den Hochzeitsmarsch von Mendelsson Bartholdy? So weit war es noch nicht, der gehörte in die Kirche. New-Orleans-Jazz? Kid Ory? Chris Barber? Viel zu speziell. Am besten etwas Zeitloses, etwas Klassisches, das passte immer. Sein Blick fiel auf Die Vier Jahreszeiten von Vivaldi. Ja, das war das Richtige!
Rasch nahm er die Platte aus der Hülle und legte sie auf.
Während der erste Satz des Frühlings erklang, traten die beiden Frauen ein, die Blonde zuerst. Ihr Blick schweifte über die Sitzgruppe aus Nierentisch und Cocktailsesseln, die sich vor der Empfangstheke befand, wanderte weiter zu dem roten Plüschsofa in der Ecke mit dem Spiegelkabinett, musterte die drei lebensechten Schaufensterfiguren von Adel Rootstein aus London und verweilte schließlich bei dem von einem glitzernden Kristalllüster angestrahlten Fabergé-Ei.
Richard ging mit federnden Schritten auf sie zu. »Es wird Mandelblüten-Ei genannt«, erklärte er. »Eine Arbeit des Sankt Petersburger Juweliers Peter Carl Fabergé,«
»Es ist ziemlich groß für ein Ei«, meinte die Blonde.
Richard lachte und verbeugte sich schwungvoll. »Verzeihung, ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin Maître Richard. In diesem Hause zeichne ich für alle Schnitte und Kreationen verantwortlich. Und natürlich für die Zufriedenheit meiner Kundinnen. Ich ruhe nicht eher, bis jede restlos glücklich ist! Womit kann ich dienen?«
»Mit einem Schirmständer.«
»Wie? Ach so.« Richard war für einen Moment verwirrt. Er nahm der Blonden den Schirm ab und brachte ihn zur Garderobe. Während er ihn wegstellte, dachte er, dass ihm selten eine so attraktive junge Frau begegnet war. Die meisten Mannequins, die er kannte, mussten eine Art Metamorphose durchmachen, bevor sie auf den Laufsteg durften. Sie kamen als eher unscheinbare Mädchen in die Maske und verwandelten sich durch Lippenstift, Rouge, Eyeliner und falsche Wimpern in strahlende Prinzessinnen. Die Blonde jedoch schien von alledem nichts zu benötigen. Sie war von Natur aus schön, knapp eins achtzig groß, schlank, hatte braune Augen und einen ausgesprochen hübschen Mund. Richard war der Meinung, dass gut aussehende Frauen meistens nicht viel auf dem Kasten hatten, dafür aber ziemlich hochnäsig daherkamen. Kluge Frauen dagegen waren fast immer hässlich. So wie die Begleiterin der Blonden. Die war höchstens eins fünfundfünfzig groß, pummelig, mit Brille und einer Bubikopffrisur, die ihr Gesicht noch breiter machte. Aber das konnte ihm egal sein. Er setzte sein Maître-Richard-Lächeln auf und blickte die Blonde verschwörerisch an. »Ich sage nur ein Wort: Grace!«
»Wie bitte?«
Richard breitete die Hände aus. »Ich meine ein Modell aus meiner Kollektion Très chique!, ein Kleid aus reiner Seide, ein Traum in Weiß von der Art, wie ihn Grace Kelly, die heutige Princesse de Monaco, bei ihrer Hochzeit trug. Sie werden darin phantastisch aussehen und eine wunderbare Braut abgeben.«
»Ich bin keine Braut.« Die Blonde blickte amüsiert.
»Ach? Ich dachte …«
»Der Mann, den ich einmal heirate, muss erst noch geboren werden.«
Richards Lächeln kehrte zurück. »Dann wäre dieser Mann zwanzig Jahre jünger als Sie.«
»Zweiundzwanzig Jahre, wenn Sie es genau wissen wollen.«
»Oh, das hätte ich nicht gedacht! Ich hätte Sie höchstens auf …«
»Um mich geht es gar nicht. Ich bin nur mitgekommen, um meine Freundin bei der Auswahl zu beraten.« Die Blonde wies auf ihre Begleiterin. »Sie ist die Braut. Ich darf vorstellen: Mildred Renzberg.«
»Sehr angenehm.« Richard bemühte sich, seine Enttäuschung zu verbergen. Wie gern hätte er der Blonden zu einer festlichen Robe verholfen! Wie gern die Maße ihres Körpers genommen! Das Anfertigen eines Kleides bedeutete stets viel mehr als nur die Entscheidung für einen Stoff und einen Schnitt, es war immer auch ein Vorgang aus vielen kleinen Schritten, mit oftmals sehr vertraulichen Gesprächen, bei denen man der Braut näherkommen konnte – auch wenn sie schon vergeben war.
Und nun diese kleine, farblose Person! Es half nichts, er musste sie genauso professionell bedienen wie alle anderen. Das war er seiner Mutter und sich selbst schuldig. Wie war ihr Name noch? Renzberg? Den Namen hatte er doch schon gehört …
»Mildred ist die Tochter von Jakob Renzberg, dem bekannten Reeder«, erklärte die Blonde.
»Ja, natürlich!« Jetzt fiel es Richard ein. Renzberg gebot über eine Flotte von schneeweißen Stückgutfrachtern, die allesamt nach bekannten Sternbildern benannt waren und zwischen Hamburg und Südamerika fuhren. Er wohnte mit seiner Familie in einer Villa auf dem Süllberg und gehörte zu den wichtigsten Persönlichkeiten der Hansestadt. Seltsam nur, dass über eine Heirat seiner Tochter nichts in der Presse gestanden hatte. Nicht einmal die Bild-Zeitung hatte etwas darüber berichtet. Doch das spielte jetzt keine Rolle. Renzbergs Tochter musste das Beste vom Besten erhalten, damit sie zufrieden war, allein schon, weil die Brautmoden einen Ruf zu verlieren hatten. »Wollen Sie nicht ablegen, Fräulein Renzberg?«
»Ja, doch«, sagte Mildred zögernd. »Wenn Sie Lucie … ich meine Fräulein zur Haiden … auch ihren Mantel abnehmen würden?«
»Selbstverständlich.« Richard nahm den Dufflecoat und den Lackmantel und hängte beides an die Garderobe. »Wann ist denn die Hochzeit? Ich meine, wie viel Zeit haben wir für das schönste Brautkleid, das Sie je gesehen haben?«
Mildred errötete leicht. »In gut drei Wochen, am achten April.«
»Das wird nicht ganz leicht werden.« Richard täuschte Bedenken vor. »Meine Näherinnen sind zurzeit sehr ausgelastet. Wie heißt es so schön: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.«
»Oh.« Mildred seufzte.
Richard lächelte. »Doch bei Ihnen soll ein Wunder wahr werden.« Er streifte mit einem Blick ihre Kleidung. Sie trug einen langen, grünen Kasack mit V-Ausschnitt, der an den Kittel einer Putzfrau erinnerte. Das Kleidungsstück war teuer gewesen, das sah man. Doch es war im Schnitt auch ziemlich weit. Sollte da etwas unterwegs sein? Der knappe Hochzeitstermin sprach dafür. Nur gut, dass er vorhin nicht den Babysitter Boogie aufgelegt hatte!
»Heißt das, Sie schaffen es?«, fragte Lucie.
»Wir fangen am besten gleich an. Der Termin ist zwar knapp, aber bevor der erste Stich gesetzt wird, sollte man sich trotzdem Zeit nehmen. Ich schlage vor, wir machen es uns gemütlich und besprechen alles in Ruhe bei einer Tasse Kaffee. Eine Sekunde bitte.«
Richard verschwand nach hinten und kam kurz darauf mit Ipek wieder. Die junge Türkin bedachte Lucie mit einem schrägen Blick und begann hinter der Empfangstheke, Filterkaffee aufzubrühen.
Richard wies einladend auf die mintfarbenen Cocktailsessel und bot, nachdem sie sich gesetzt hatten, aus der Astor-Zigarettendose an. »Rauchen Sie?«
»Nein, danke«, sagte Mildred.
»Ich nehme eine.« Lucie ließ sich Feuer geben und blies einen Ring in die Luft.
Kurz darauf wurde der Kaffee serviert. »Danke, Ipek«, sagte Richard. »Du kannst wieder an deine Arbeit gehen.« Er trank einen Schluck und wies auf die drei Schaufensterfiguren, die um das Fabergé-Ei herumstanden. »Jede der Puppen repräsentiert eine meiner drei Modellserien«, erklärte er geschäftsmäßig. »Links sehen Sie ein Kleid aus der Serie Mon Dieu! Es sind Kreationen, die ein betontes Dekolleté und einen tiefen Rückenausschnitt aufweisen, zu empfehlen für Damen mit makelloser Haut, die ihren Busen betonen möchten. Rechts sehen Sie ein Kleid aus der Serie Superbe! Dabei handelt es sich um Entwürfe mit klassischer, seriöser Linie, unter Verwendung sehr feiner, hochwertiger Stoffe. Die Puppe in der Mitte steht stellvertretend für die schon erwähnte Serie Très chique! Sie ist modisch sehr aktuell und überzeugt mit originellen, individuellen Accessoires.« Richard hielt inne und schaute Lucie vielsagend an. »Dieses Beispiel heißt Grace und eignet sich besonders für hochgewachsene Frauen mit Traumfigur.«
Lucie blies einen weiteren Rauchring.
Mildred räusperte sich. »Ich glaube, für mich kommt nur etwas aus der Serie Superbe! infrage.«
Gott sei Dank!, dachte Richard. Sie zwingt mich nicht, einem Bauern einen Frack anzudienen. Laut sagte er: »Eine sehr gute Wahl! Bei dem hier gezeigten Modell wurde besonderer Wert auf …«
»Die Schleife über dem Po sieht etwas albern aus«, unterbrach ihn Lucie.
»Finde ich auch«, sagte Mildred.
Richard lachte. »Sie haben beide ein gutes Auge! Aber die Geschmäcker sind verschieden. Die Libelle, wie wir sie nennen, wird immer wieder gern genommen. Natürlich ist sie kein Muss. Sie kann durch etwas anderes ersetzt werden oder ganz entfallen. Grundsätzlich sind die Modelle meiner Serien sehr individuell zu vervollkommnen. Warten Sie!«
Er sprang auf und holte einen dicken Katalog. Auf der Vorderseite stand in zierlicher Schreibschrift: Brautmoden am Jungfernstieg und darunter: Der gute Rat heißt Irma Plath!
»Irma Plath ist meine Mutter, sie hat das Geschäft gegründet«, erklärte Richard und schlug den Katalog auf. Eine Fülle an Fotos und Skizzen wurde sichtbar. »Hier werden wir das ideale Kleid für sie finden. Aus der Serie Superbe! schlage ich das Modell Troja vor.« Richard kniff schelmisch ein Auge zu. »Ohne Libelle.«
Es folgte eine rege Unterhaltung über Pailletten und Stickereien, über florale Muster und aufgestickte Perlen. Mehrmals versuchte Richard, Mildred ein teures Extra aufzudrängen, doch diese erwies sich als rechnende Tochter ihres Vaters. Schließlich einigte man sich auf Bild 18 im Katalog. So sollte die Robe aussehen, die Mildred an ihrem schönsten Tag tragen würde: das Modell Troja in A-Linien-förmigem Schnitt mit innen liegender Korsage, damit das Erscheinungsbild der Trägerin schlanker wirkte. Dazu ein U-Boot-Ausschnitt und ein durchsichtiger Überrock aus Tüll mit zarten Mustern in Blüten- und Blätterform. Der hinten liegende Reißverschluss sollte beidseitig mit aufgenähten Perlmuttknöpfen kaschiert werden.
»Und das Material für das Kleid?«, fragte Mildred.
»Seide, was sonst!«, rief Richard. »Sie ist die Königin unter allen Stoffen, meine jungen Damen! Sie wird aus den Fäden gewonnen, mit denen die Seidenraupe ihren Kokon spinnt. Und: Sie bietet den perfekten Tragekomfort bei allen Temperaturen, denn sie kühlt bei Hitze und wärmt bei Kälte. Stellen Sie sich vor, liebes Fräulein Renzberg, sie steigen am achten April mit Ihrem Bräutigam aus der Hochzeitskutsche, und es herrscht ein eisiger Wind! Ich sage Ihnen, Seide ist in Ihrem Fall das Nonplusultra! Bitte zwingen Sie mich nicht, Ihnen etwas anderes anbieten zu müssen.«
»Seide ist bestimmt sehr kostspielig?«
»Nun ja, ganz billig ist sie nicht.«
Lucie drückte ihre Zigarette aus und meinte: »Es gibt doch bestimmt noch andere Materialien?«
Richard seufzte unhörbar. »Gewiss.« Er sprang auf und holte ein weiß schimmerndes Stoffmuster herbei.
»Was ist das?«, fragte Mildred.
»Satin.« Richards Stimme klang feierlich. »Ein Material, das aus Seide hergestellt wird und seinesgleichen sucht! Durch seine glänzende, glatte Oberseite wirkt es ausgesprochen edel und elegant. Es schmeichelt in der Hand und schmiegt sich an jede Körperform.«
»Hm.« Mildred und Lucie befühlten den Stoff.
»Durch sein hohes Eigengewicht ist Satin nahezu knitterfrei.«
»Das ist praktisch«, sagte Lucie.
»Nicht wahr? Früher bezeichnete man diese Stoffart als Atlas, abgeleitet von dem arabischen Wort für ›glatt‹.«
»Aha«, sagte Mildred. »Und ist Satin teuer?«
»Etwas preiswerter als Seide.« Bevor die jungen Frauen weitere Einwände erheben konnten, bat Richard sie, ihm zu dem kleinen Holzpodest zu folgen, das neben dem Spiegelkabinett stand. »Stellen Sie sich darauf, Fräulein Renzberg, damit ich Ihre Maße nehmen kann«, sagte er. »Stehen Sie aufrecht, die Schultern entspannt, die Arme hängen locker herab. Ja, so ist es recht.«
Richard trat neben Mildred und begann mithilfe eines Zentimeterbandes, den Schulterumfang, die Armlänge, die Taille und andere Maße zu nehmen. Als er in die Tasche seiner Weste greifen wollte, um sein Notizbuch hervorzuholen, bewegte sich der Vorhang, der in die hinteren Atelierräume führte, und seine Mutter erschien. Frisch geschminkt und toupiert, wie er sofort bemerkte.
»Suchst du dies, mon Cher? Du hast es vorhin vergessen«, rief sie und gab ihm das Büchlein. »Oh, ich sehe, du hast Kundinnen!« Madame Irma tat überrascht, obwohl sie die ganze Zeit hinter dem Vorhang gelauscht hatte.
»So ist es, Maman. Ich nehme gerade die Maße von Fräulein Renzberg. Sie will am achten April heiraten.«
»Oh, meine Gratulation! Wie ich mich für Sie freue!« Madame Irma war die Herzlichkeit in Person. »Wer ist denn der Glückliche?«
Mildred blickte unschlüssig. »Also, es ist alles noch sehr geheim …«
»Fräulein Renzberg ist die Tochter des bekannten Reeders«, erklärte Richard.
»Aber das weiß ich doch!« Richards Mutter schüttelte Mildred ausdauernd die Hand. »Ich bin Madame Irma, die Besitzerin der Brautmoden, aber das haben Sie sich bestimmt schon gedacht.« Sie wandte sich an Lucie. »Und Sie sind?«
»Lucie zur Haiden, eine Freundin.«
»Sehr angenehm.«
Richard deutete auf sein geöffnetes Notizbuch. »Maman, wenn du erlaubst, würde ich jetzt gern die Maße not…«
»… notieren, ich weiß. Aber nicht, bevor ich Fräulein Renzberg ein bisschen ausgequetscht habe.« Madame Irma lächelte verschmitzt. »Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass uns jemand mit einem so berühmten Namen beehrt, nicht wahr? Wenn ich mich nicht irre, hatte eines Ihrer Schiffe, die Andorra, vor Kurzem in Rio de Janeiro einen Blechschaden. Die Zeitungen waren ja voll davon.«
»Das stimmt«, sagte Mildred höflich. »Allerdings handelte es sich nicht um die Andorra, sondern um die Andromeda, die in Buenos Aires gegen die Kaimauer trieb, weil ihre 9-Zylinder-Maschine plötzlich ausgefallen war.«
»Ja, natürlich!« Madame Irma strahlte. »Das müssen Sie mir ganz genau erzählen. Eine Geschichte aus der großen, weiten Welt! Alles andere kann warten.« Sie hakte sich bei Mildred unter und führte sie zurück zur Sitzgruppe. »Kommen Sie, wir setzen uns und trinken noch einen Kaffee. Hat man Ihnen auch Gebäck angeboten? Nein? Oh, manchmal ist mein Herr Sohn wirklich ein schlechter Gastgeber …«
Während Mildred von Madame Irma entführt wurde, schaute Richard so betreten drein, dass Lucie lachen musste. »Scheint so, als würden Sie meine Freundin so bald nicht wiedersehen.«
»Stimmt.« Richard rang sich ein Grinsen ab. »Meine Mutter ist immer auf der Jagd nach interessanten Geschichten, die sie bei Gelegenheit weitererzählen kann. Aber das Maßnehmen bei Fräulein Mildred war sowieso abgeschlossen.« Er kritzelte aus dem Gedächtnis ein paar Zahlen in sein Notizbuch und blickte auf. »Tja, das war’s. Ich will dafür sorgen, dass schon Ende nächster Woche die erste Anprobe stattfindet.«
»Das wäre schön.«
»Werden Sie wieder dabei sein?«
»Nein. Ich bin heute nur für Mildreds Mutter eingesprungen, sie hatte andere Verpflichtungen.«
Schade, dachte Richard. Ich würde dieses Mädchen gern wiedersehen. Es scheint, als ginge die Sonne auf, wenn sie lacht. So ist es mir bisher bei keiner ergangen. Er spürte, wie er verlegen wurde, und suchte nach Worten, um seine Befangenheit zu überspielen. »Nun, äh«, sagte er, »das Modell Grace würde Ihnen wirklich gut stehen.«
Wieder lachte Lucie. »Sie sind sehr geschäftstüchtig.«
»Ich sage nur die Wahrheit.«
Eine Pause entstand.
Dann hatte Richard eine Idee. »Vielleicht interessiert es Sie, wie ich Grace und meine anderen Modelle entwickelt habe? Ich könnte Ihnen die Vorskizzen in meinem Studio zeigen.«
Lucie zögerte. Ihr Blick ging zu der Sitzgruppe, wo Madame Irma sich angeregt mit Mildred unterhielt. Es sah nicht so aus, als sei das Gespräch in Kürze beendet. »Warum nicht?«
Richard führte Lucie hinter den Vorhang in die Atelierräume und weiter in sein kleines Studio. Rechts neben der Eingangstür stand wie ein Wachsoldat eine lebensgroße verstellbare Schneiderpuppe und dahinter, in der Mitte des Raumes, ein Tisch mit überquellenden Stapeln an Papieren und Schnittmustern. In der Mitte des kreativen Chaos lag der Entwurf eines Kleids, das mit wenigen gekonnten Strichen aufs Papier geworfen war: eine Skizze, die durch ihre Schlichtheit faszinierte. Das Kleid war knapp geschnitten und extrem kurz. Der Saum reichte kaum bis zur Mitte der Oberschenkel.
»Als Brautkleid ist es wohl ziemlich ungeeignet.« Lucie lachte.
»Sie haben gerade wieder gelacht.«
»Wieso?«
»Ach, nichts.« Richard blickte auf das Papier. »Der Entwurf hat natürlich nichts mit Grace oder anderen Brautkleidern zu tun. Es ist der Versuch, etwas Neues zu wagen. Eine Idee für die Prêt-à-porter-Mode, damit junge Frauen etwas Schickes von der Stange kaufen können.«
»Ziemlich mutig, so etwas zu tragen, meinen Sie nicht?«
»Würden Sie ein solches Kleid anziehen?«
»Kommt drauf an. Es ist ja knalleng und geht gerade über den Po. Im Sommer vielleicht?«
»Moment.« Richard drehte sich um und holte ein Buch aus einem Wandregal. »Es heißt Bunte Bilder – Deutsche Bühne und ist von 1934.« Er schlug es auf. »Sehen Sie, hier sind Fotos von Frauen abgebildet, die einen sehr kurzen, sehr engen Rock tragen, zusammen mit hochhackigen Lederstiefeln.«
Lucie schaute sich die Ablichtungen genau an. »Es sind Kostüme wie beim Varieté.«
»Ich habe mich von ihnen inspirieren lassen. Wirklich neu ist in der Mode bekanntlich nichts. Irgendjemand hat mal gesagt: ›Ich sehe das Neue nahen, es ist das Alte.‹«
Lucie nickte. »Allerdings muss man ein Gespür dafür haben, wann das Alte wieder als neu empfunden wird, oder?«
»Stimmt. Dieses Kleid habe ich Bonheur fragile genannt.«
»Was heißt das?«
»So viel wie ›kurzes Glück‹.«
»Klingt hübsch.«
Richard freute sich. Von seiner affektierten Art, die er im Verkaufsraum gezeigt hatte, war kaum etwas übrig. »Ich habe noch eine Menge weiterer Skizzen.« Er griff in die Fächer des Schneidertisches und nahm verschiedene Papierrollen heraus. Nachdem er sie glatt gestrichen hatte, erläuterte er die Zeichnungen. Jede einzelne war auf ihre Art außergewöhnlich.
Lucie war beeindruckt: »Mit Brautkleidern haben die wenig zu tun.«
»Um ehrlich zu sein, seit einiger Zeit langweilen mich Brautkleider. Sie werden einzig und allein für den Tag der Hochzeit angefertigt. Anschließend verschwinden sie für immer im Kleiderschrank. Dabei gibt es unzählige Anlässe im Alltag, für die man Mode entwerfen kann. Aber sagen Sie das bloß nicht meiner Mutter, die will davon nichts wissen.«
Darauf wollte Lucie nicht eingehen. Sie blickte wieder auf die Entwürfe. »Und die sind alle von Ihnen?«
»So ist es.«
»Als ich klein war, habe ich auch gern gezeichnet. Nun komme ich leider nicht mehr dazu.«
»Darf man fragen, warum?«
»Weil ich Medizin studiere, im fünften Semester.«
»Medizin?« Richard staunte insgeheim. Seine Erfahrung, nach der hübsche Frauen nicht viel auf dem Kasten hatten, kam ins Wanken. »Das ist sicher sehr anspruchsvoll?«
»Vor allem anstrengend. Man paukt unzählige lateinische Begriffe in sich hinein, von Knochen und Muskeln, von Adern und Venen, man hört von chemischen Prozessen, physikalischen Zusammenhängen und so weiter. Reine Theorie, nichts Praktisches, mit dem man etwas anfangen kann.«
Richard lächelte schief. »Ja, Büffeln ist nicht jedermanns Sache. Meine schon gar nicht. Bei der Schneiderei ist es zum Glück anders, man hat einen Stoff zum Anfassen, zum Tasten und Fühlen, man kann ihn bearbeiten, formen, man sieht sofort, was unter den eigenen Händen entsteht.«
Lucie seufzte. »Ich stehe kurz vor dem Physikum, danach kommt die klinische Ausbildung, dann wird es hoffentlich ein bisschen konkreter. Aber ich glaube, ich sollte jetzt nach Mildred sehen, sonst denkt sie noch, ich bin verschüttgegangen. Danke, dass Sie mir Ihre Entwürfe gezeigt haben.«
»Gern geschehen.« Richard führte Lucie zurück durch die Atelierräume, in denen Ipek und ihre Kolleginnen an surrenden Pfaff-Nähmaschinen saßen. Es herrschte eine emsige Atmosphäre und roch nach türkischem Zitronen-Cologne. »Soll ich Ihnen noch kurz das Stofflager zeigen?«, fragte er. »Wir nennen es unsere Schatzkammer, weil sich darin die erlesensten Materialien befinden: Chiffon, Crêpe, Mikado, Organza, Seide, Satin, Spitze, Tüll …«
»Nein, vielen Dank.«
Im Verkaufsraum schien Madame Irma weder ihren Sohn noch Lucie vermisst zu haben, denn sie redete lebhaft auf Mildred ein: »… Glück, liebes Fräulein Renzberg, ist eine ganz besondere Pflanze, die unter den verschiedensten Voraussetzungen gedeiht! Wo die Liebe hinfällt, da wächst und blüht sie, mögen die Unterschiede auch noch so groß sein. Denken Sie nur an Pablo Picasso, der vor wenigen Tagen seine Lebensgefährtin Jaqueline Roque geheiratet hat. Sechsundvierzig Jahre jünger ist sie, und ich habe gehört, Picasso selbst soll beim Entwurf des Hochzeitskleids mitgewirkt haben. Sie, meine Liebe, werden eine Robe tragen, hinter der ähnlich berühmte Namen stehen, denn mein Sohn hat in den besten Modehäusern von Paris gearbeitet, er entwarf zauberhafte Kreationen, zusammen mit Yves Saint Laurent, dem Assistenten von Christian Dior. Ich nehme an, die Namen sagen Ihnen etwas?«
»Ja, gewiss.«
»Ich versichere Ihnen, Sie werden hochzufrieden sein und unser Label Richard Camus mit Stolz in Ihrem Brautkleid tragen!«
Richard hüstelte, um sich bemerkbar zu machen. »Die erste Anprobe habe ich für Ende nächster Woche vorgesehen, Maman.«
»Wie? Ach so. Ja, wunderbar!« Madame Irma drohte Richard schelmisch mit dem Finger. »Hast du etwa meine letzten Worte mitgekriegt? Dir müssen ja die Ohren geklungen haben.«
Richard winkte bescheiden ab.
»Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben«, sagte Mildred. »Wir müssen jetzt gehen. Bist du einverstanden, Lucie?«
»Bin ich.«
Richard half den jungen Frauen in ihre Mäntel, während seine Mutter pausenlos weiterredete. Sie bedankte sich für den Besuch, bat Mildred, ihre Familie unbekannterweise zu grüßen, warf einen Blick aus dem Fenster, stellte fest, dass sich draußen ein paar Sonnenstrahlen zeigten, versicherte, sie freue sich schon heute auf den Termin in einer Woche – dann vielleicht mit der Frau Mutter –, wünschte noch ein schönes Wochenende und ging vor, um persönlich die Ladentür zu öffnen. »Auf Wiedersehen und Au revoir!«
Als die jungen Frauen fort waren, sagte Richard: »Du hast dich ja ganz schön ins Zeug gelegt, Maman.«
»Ich sorge nur dafür, dass der Rubel rollt«, entgegnete Madame Irma. »Und was hast du die ganze Zeit mit der Blonden gemacht?«
»Ihr ein paar Skizzen gezeigt.«
»Mehr nicht?« Madame Irma kannte ihren Filius. Sie wusste, dass er eine Schwäche für hübsche Mädchen hatte. Und sie wusste auch, dass keines dieser Mädchen jemals gut genug für ihn sein würde.
»Mehr nicht, Maman.«
»Dann bin ich beruhigt.« Sie tätschelte ihm die Hand. »Ich gehe wieder nach hinten. Du kannst hier die Stellung halten.«
»Mach ich.«
Madame Irma verschwand, und Richards Blick fiel auf die leere Garderobe, an der bis eben noch die Mäntel gehangen hatten. Nur der Regenschirm stand noch da.
Sein erster Gedanke war, damit hinterherzulaufen.
Doch dann hatte er eine bessere Idee.
Kapitel 2
Harald, der von aller Welt »Tütchen« genannt wurde, war ein kleiner Mann mit zarten Händen, der den eigenartigsten Frisiersalon auf St. Pauli betrieb, denn sein Laden lag im ehemaligen Klubzimmer einer Kneipe.
Die Kneipe hieß Höller’s Hölle, wurde von Kennern aber nur als Hölle bezeichnet.
Am Ende des langen Tresens von Höller’s Hölle befand sich eine Tür mit einem Hängeschild daran. Auf einer Seite stand Offen, auf der anderen Seite Geschlossen. Zeigte das Schild Offen, durfte der Kunde Tütchens spärlich eingerichtetes Reich betreten. Es bestand aus zwei Frisierstühlen mit Waschbecken und Spiegel, zwei Sitzgelegenheiten für die wartende Kundschaft und einem Tischchen für die Zeitschriften vom Lesezirkel. An der Wand hing das verblichene Foto eines Mannes mit pomadig glänzender Frisur, der Reklame für fit machte, die »leichte Frisiercreme« der Firma Schwarzkopf.
Das war schon alles an Einrichtung, wenn man von dem Barbierbecken absah, das von der Decke baumelte, und von dem Präserautomaten, der zwischen den Spiegeln Platz gefunden hatte. Letzterer war ein Vorkriegsmodell, das seit Langem nicht mehr befüllt werden konnte, weil die Verpackungsgröße der Marke Fromms sich mit den Jahren geändert hatte.
Und über allem hing der Duft von Birkin-Haarwasser und Rasierseife.
»Nu, Werner«, sagte Tütchen zu dem Jüngling, der vor ihm im Frisierstuhl saß, »hast dich lange nicht sehen lassen. Ist das Jahr schon wieder rum?«
Werner antwortete nicht. Er blickte interessiert auf den Präserautomaten. »Der ist wohl aus der Steinzeit?«
»Nee, aus der Nazizeit. Da warst du noch Quark im Schaufenster.«
Werner grinste. »Heißt du eigentlich Tütchen, weil du damals Gummis verkauft hast?«
»Grins nicht so blöd.« Tütchen griff zu Kamm und Schere und betrachtete Werners lange Mähne. »Eins sag ich dir gleich: Rockerwelle und Entenscheitel gibt’s bei mir nicht, verstehst du? Und ’ne Schmalzlocke wie bei diesem Bill Haley gibt’s auch nicht.«
»Kann ich mir sowieso nicht erlauben. Ich lern jetzt Blechschlosser auf der Howaldtswerft.«
»Nu, das hört man gern. Kriegst ’n schönen Fassonschnitt von mir, das ist was Reelles, nä?« Tütchen begann mit seiner Arbeit, indem er sich auf einen Fußschemel stellte. Werner war nicht gerade ein Sitzriese, aber Tütchen maß nur eins achtundfünfzig, und deshalb brauchte er den Schemel. Eine Zeit lang war nur das Klappern der Schere zu hören, doch wie viele Vertreter seiner Zunft konnte Tütchen auf Dauer das Wasser nicht halten. Ohne ein kleines Schwätzchen ging es nicht. »Wenn du’s genau wissen willst«, sagte er, »das mit den Tütchen stimmt sogar. Die Dinger gingen damals weg wie warme Semmeln. In meinem ersten Laden war’s. Haarald’s Frisiersalon. Nur ein paar hundert Meter von hier. Der Automat war dauernd leer. Die vielen Matrosen und Werftarbeiter, weißt du. Denen hab ich immer beim Bezahlen gesagt, sie sollen ein Tütchen mitnehmen, für alle Fälle. Da hatte ich den Spitznamen weg.«
»Der passt zu dir.«
»Werd bloß nicht kiebig, nur weil ich dir was aus meinem Leben erzähl. Jedenfalls hat mir der Apparat gutes Geld eingebracht. Aber auch Ärger. Die Nazis hatten was gegen Verhütungsmittel. Bei denen konnten die Frauen gar nicht genug Kinder kriegen, weil sie Soldaten brauchten. Weißt du, was das ›Mutterkreuz‹ war?«
»Nö.«
»Ein Orden, von Hitler persönlich gestiftet. Das Mutterkreuz in Gold kriegte jede Frau mit acht oder mehr Kindern. Weibliche Gebärmaschinen waren das. Schreckliche Zeit, noch gar nicht so lange her. Sei bloß froh, dass du damals noch nicht gelebt hast.«
»Bin ich bald fertig?«
»Immer langsam. Ich mach dir den Scheitel links. Sieht besser aus.«
»Wieso das denn?«
»Hitler trug ihn immer rechts.«
»Ja und?«
»Ich will nicht, dass du aussiehst wie der.« Tütchen hielt für einen Moment inne und dachte an die braunen Herren, die ihm das Leben schwergemacht hatten. Nicht nur wegen des Präserautomaten, sondern auch, weil er vom anderen Ufer war und deshalb monatelang im Gefängnis am Holstenglacis einsitzen musste. Als sogenannter Hundertfünfundsiebziger. Zu allem Unglück war im August 1943 bei der Operation Gomorrha auch noch Haarald’s Frisiersalon ausgebombt worden, und wenn Schatzi, der Wirt der Hölle, nicht gewesen wäre, hätte Tütchen auf der Straße gesessen. Seitdem lebten sie in einer der beiden Wohnungen über der Kneipe. Dass sie ein Paar waren, wussten nur Eingeweihte und ging niemanden etwas an. Offiziell war Tütchen ein entfernter Cousin aus Kötzschenbroda, was insofern glaubhaft war, als sein Sächsisch auch nach Jahrzehnten auf dem Kiez noch immer durchklang.
»Nu isses überstanden. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, nä?« Tütchen hielt Werner einen Spiegel an den Hinterkopf und fragte: »Und?«
»Ist okay.«
Werner wollte aufstehen, doch Tütchen drückte ihn zurück in den Frisierstuhl. »Warte.« Er nahm dem Jüngling den Umhang ab und bürstete ihm den Hemdkragen sauber. Dann griff er zu einem Zerstäuber mit ziegelrotem Gummiball und sprühte sein Kunstwerk von allen Seiten ein. »So, nu kannste dich erheben. Macht ’n Heiermann.«
Werner stand auf und zahlte grinsend die fünf Mark. »Schade, dass der Automat nicht mehr funktioniert. Ich hätt sonst Interesse an einem Tütchen … Tütchen.«
Der kleine Mann kicherte. Das lose Mundwerk des Jungen gefiel ihm. »Bist frech wie Oskar, was? Na, schon gut, ich komm mit raus, mache dicht für heute.« Er drehte das Schild an der Tür auf Geschlossen und rief Werner einen Abschiedsgruß hinterher: »Bis bälde!«
***
Anders als Tütchens provisorischer Salon machte der Schankraum der Hölle keinen spärlichen Eindruck. Dafür sorgte eine seltsame Mischung aus maritimen und exotischen Stücken, die den Blick des Besuchers sofort auf sich zogen. Besonders das von der Decke herabhängende Haigebiss konnte dem nichts ahnenden Gast einen Schrecken einjagen. Weniger gefährlich wirkten der daneben baumelnde Kugelfisch und die zwei an der Decke angebrachten Schildkrötenpanzer, die dem Raum die Anmutung einer Tropfsteinhöhle verliehen. Die Abbildung der japanischen Seespinne an der Wand mit den freizügigen Liebesstellungen an den Enden ihrer zehn Schreitbeine war verblasst. Irgendjemand hatte einen Fächer australischer Jagdbumerangs und ein vielfach geblasenes Didgeridoo darübergehängt. Von den sieben Früchten der Seychellenpalme, die Willi, der Erstbesitzer der Hölle, einst gegen sieben Säcke Nusskohle eingetauscht hatte, blätterte die Farbe ab, weshalb es einiger Phantasie bedurfte, sie als knackige Ärsche zu erkennen.
An dem Tisch unter dem Kugelfisch trank Schatzi, der jetzige Wirt, ein Danziger Goldwasser. Er stellte das genaue Gegenteil dessen dar, was man sich unter dem Betreiber einer Kneipe auf St. Pauli vorstellte: Er war schlank und drahtig und wirkte mit seinen sechsundfünfzig Jahren nicht älter, als er war. Die Nickelbrille auf der Nase ließ ihn harmlos und ein bisschen professoral aussehen, doch das täuschte. In Wirklichkeit war Schatzi sturmerprobt in jeder Lage, besonders, wenn die Wellen in der Hölle hochschlugen und der Wind von vorne wehte.
Heute allerdings hatte er es mit einem Problem zu tun, das ungleich schwerer zu lösen war. Das Problem hieß Aale-Edith und saß ihm gegenüber.
Normalerweise stand Aale-Edith vor dem Eingang zur Hölle und hielt geräucherten Schlangenfisch stückweise feil. Dazu trug sie auf dem Kopf eine Melone mit Papierblumen und sang den Passanten skurrile Lieder vor, etwa: »Alle Vögel sind schon da, Aale, Aale, Aale …« Oder: »Alle meine Aale schwimmen in der See, schwimmen in der See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’…« Um anschließend fortzufahren: »Ob Kopf, ob Mitte oder Schwanz, der Genuss ist immer ganz! Ab zwei fuffzig beginnt das Vergnügen, Leute! Den Kurzen dazu gibt’s in der Hölle.«
Heute jedoch hatte Aale-Edith keinen Fischkorb dabei. Stattdessen einen nagelneuen Koffer von Klockmann am Hauptbahnhof. Der Grund dafür war, dass sie nach Genf reisen wollte, um dort ihren alten Freund Benno zu pflegen. Und genau das war das Problem. Schatzi wollte, dass Aale-Edith blieb. Ebenso wie Tütchen, der deshalb früher Feierabend gemacht hatte und sich nun zu den beiden setzte.
»Menschenskinder, willste dir das nicht noch mal überlegen?«, fragte Tütchen.
»Nee«, sagte Aale-Edith. »Ich hab mir das Taxi für viertel nach drei bestellt.«
»Dann bestell’s einfach ab«, drängte Schatzi. »Du weißt doch nicht mal, was Benno fehlt.«
»Er ist krank, das genügt mir.«
Schatzi schüttelte verständnislos den Kopf und verteilte den letzten Schluck aus der Flasche mit dem Danziger Goldwasser. »Hör mal, Aale-Edith, du stehst seit über dreißig Jahren vor der Tür zur Hölle und baggerst die Leute an, tagein, tagaus, sogar in den lausigen Kriegszeiten war es so, da kannst du jetzt nicht einfach gehen.«
»Doch, kann ich.« Wenn Aale-Edith, die eigentlich Edith Göbe hieß, sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann führte sie es auch aus.
Tütchen fragte: »Nu, woher weißt du überhaupt, dass der Benno krank ist?«
»Er hat mir am Telefon gesagt, er fühlt sich nicht.«
»Und das ist alles?«, platzte Schatzi heraus.
»Benno ist siebenundachtzig, da weiß man nie.«
»Du bist auch nicht mehr die Jüngste.«
»Ich bin unsterblich.«
Schatzi seufzte. Bei jeder anderen hätte er an dieser Stelle gesagt: »Dann lass dich nicht aufhalten«, doch bei Aale-Edith ging das nicht. Sie gehörte zur Familie. Sie hatte mit Vira, Schatzis Mutter, in der Nachbarwohnung über der Hölle gelebt und Vira bis zu deren Tod umsorgt. Und ebendies schien sie jetzt mit Benno vorzuhaben. Schatzi erinnerte sich, dass sie schon immer eine Schwäche für Benno gehabt hatte, auch damals, als die Nazis seine Bilder als entartet einstuften und er deshalb nach Genf in die Schweiz ging. Aale-Edith hätte es niemals zugegeben, doch Schatzi wusste, dass sie Benno seitdem vermisste. Und dass sie ihn auf ihre Art liebte. »Was soll denn aus deiner Wohnung werden?«, fragte er.
»Die könnt ihr vermieten.«
»Und deine Möbel?«
»Die könnt ihr verkaufen.«
Tütchen nahm Aale-Ediths Hand. »Nimm’s mir nicht krumm, nä, aber du warst schon immer ’n bisschen meschugge, wenn’s um Benno ging.«
Aale-Edith zuckte mit den Schultern.
Schatzi versuchte es noch einmal anders: »Wenn du hier sämtliche Zelte abbrichst, wo willst du dann wohnen, wenn du zurückkommst?«
»Ich bleibe bei Benno. Er braucht mich.« Aale-Edith rückte entschlossen die Melone auf ihrem Kopf zurecht. Der Kranz aus bunten Papierblumen war entfernt. Zusammen mit dem schwarzen Mantel, der silbernen Salamanderbrosche und dem Kragen aus Kunstpelz sah sie geradezu damenhaft aus. Sie stand auf. »Es ist gleich viertel nach«, sagte sie, und für einen kurzen Augenblick ließ ihr Gesicht den weichen Kern erkennen, der unter ihrer rauen Schale steckte. »Spielt für mich noch mal Moonglow von Benny Goodman.«
Schatzi gab es auf. Wortlos ging er hinüber zu dem alten Trichtergrammophon, das einer Musikbox von Wurlitzer hatte Platz machen müssen. Es stand noch immer auf einer Teekiste aus Kalkutta, jetzt allerdings neben der Tür zum WC, und wurde nur einmal am Tag benutzt. Immer dann, wenn die Kneipe öffnete – zur Erinnerung an Willi Höller, der die Hölle zu Kaisers Zeiten gegründet hatte. Schatzi zog das Grammophon auf und legte Moonglow auf den Teller.
Aale-Edith beugte sich hinunter zu ihrem Koffer und nestelte an den Schlössern, obwohl das gar nicht nötig war. Niemand sollte sehen, dass ihr die Augen feucht wurden.
Das Stück begann, es rauschte und knisterte, der Gesang ertönte:
»It must have been moonglow,
way up in the blue,
It must have been moonglow
that led me straight to you …«
In den letzten Takt hinein rief eine Stimme: »Taxi!«
Aale-Edith wollte ihren Koffer aufnehmen, doch Schatzi kam ihr zuvor. »Gib mal her.« Taktvoll, wie er war, tat er so, als habe er ihre Tränen nicht bemerkt. »Fass mal mit an, Tütchen, wir schaffen das Ding zur Tür.«
An der Tür übernahm der Taxifahrer das schwere Behältnis und wuchtete es hinaus.
Aale-Edith hatte sich unterdessen gefangen. Sie war wieder ganz die Alte und schalt: »Du sollst doch mit deinem steifen Bein nicht so schwer heben, Schatzi.«
Schatzi grinste. »Unterschätz mein kaputtes Bein nicht. Es war der Freifahrtschein von Tobruk direkt nach Hause. Danach musste der Krieg ohne mich stattfinden.«
Tütchen grinste auch. »Nu, wahrscheinlich haben wir ihn deswegen verloren.«
Aale-Edith schniefte. »Ihr seid unverbesserlich.« Sie umarmte beide kurz und heftig, wandte sich ohne ein weiteres Wort ab und stieg ins Taxi.
»Schreib wenigstens mal!«, rief Schatzi.
»Oder ruf an!«, rief Tütchen.
Doch Aale-Edith antwortete nicht mehr.
***
»Komisch«, sagte Schatzi wenige Minuten später, nachdem er seinen gewohnten Platz hinter dem Tresen eingenommen hatte, »ohne Aale-Edith ist die Hölle irgendwie leer.«
Tütchen stand ihm gegenüber und schluckte. »Ich kann’s noch gar nicht glauben, dass sie weg ist.«
Einer der Gäste trat an die Musikbox, warf eine Münze hinein und wählte Ramona, den neuesten Hit von den Blue Diamonds:
»Ramona, zum Abschied sag ich dir Goodbye …«
»Auch das noch.« Tütchen griff zum Taschentuch, weil er weinen musste. »Hätte der Blödmann nicht was anderes wählen können?«
Ein anderer Gast, der neben dem Didgeridoo saß, rief nach einem weiteren Bier. Schatzi zapfte ein Helles und brachte es ihm. Dann kam er zu Tütchen zurück. »Irgendwie leer«, wiederholte er. »Weißt du eigentlich, dass nur noch wir zwei Hübschen übrig sind? Alle anderen sind weg. Willi ist seit Ewigkeiten tot, Günter, der plietsche Bengel, legt woanders Platten auf, und Vira ist im letzten Jahr mit dreiundneunzig gestorben.«
»Ja, ja, ich hab immer noch ihre Piepsstimme im Ohr. Heute klingt’s mir wie Vogelgezwitscher.« Tütchen tupfte sich die Augen mit dem Taschentuch ab und steckte es weg.
»Sie war nach Willi die Seele der Hölle. Und nun geht auch noch Aale-Edith nach Genf.«
»Ja, nu, wir sind die letzten Mohikaner.«
Schatzi holte eine zweite Flasche Danziger Goldwasser und goss ein. »Vicki ist auch tot. Und Flo, Ari und Lucie haben sich lang nicht sehen lassen. Dasselbe gilt für Chang und JinJin aus der Talstraße.«
»Ja, ja.«
»Finn ist auch seit Ewigkeiten nicht hier gewesen.«
»Nu, der ist im Altersheim. Den haben sie da an die Kette gelegt.«
»Warte mal.« Schatzi ging hinüber zu Heribert, einem Stammgast, der zahlen wollte. Er zählte die Striche auf dem Bierdeckel und kassierte. »Tschüs, Heri, grüß zu Hause, wenn du zu Wort kommst.«
Er kehrte zu Tütchen zurück an den Tresen und begann, ein paar Bier auf Vorrat zu zapfen. »Ich hab Finn zuletzt auf Viras Beerdigung gesehen. Da haben wir uns kurz unterhalten. Ich glaube, das Altersheim ödet ihn an. Er meinte, die seien da alle schon scheintot, spielten nur noch Mensch ärgere dich nicht, und das Essen sei was für Magenkranke: Graubrot mit Marmelade und Margarinestern morgens, mittags Gemüsefrikadellen mit Pfanni-Püree und abends Milchreis mit Zimt. Am schlimmsten sei die Kaffeeplörre mit Hängepulver drin. Dabei bestünde für die alten Omis überhaupt keine Gefahr, dass sie unsittlich bedrängt würden, jedenfalls nicht von seiner Seite. Die Zeiten, in denen er mit Nelli zusammen gewesen sei, kämen sowieso nie wieder.«
»Ja, ja.«
Schatzi beschäftigte sich weiter mit den Bieren. Die Gäste in der Hölle warteten ungern auf Nachschub. Doch als er den Zapfhebel für das nächste Helle nach unten ziehen wollte, hielt er mitten in der Bewegung inne. »Ich glaube, ich hab eine Idee.«
»Was hast du nun wieder ausgebrütet?«
»Wir holen Finn aus dem Altersheim raus. Jetzt, wo Aale-Ediths Wohnung frei ist, kann er sie doch haben.«
»Nu?«
»Wir täten ein gutes Werk!« Schatzi erwärmte sich für den Gedanken. »Außerdem könnte er hier ein bisschen kellnern. Und geschickte Hände hat er auch, falls mal was kaputt geht. Überleg doch mal: Ich wär sonst ganz allein im Laden, wenn du den Leuten die Haare schneidest.«
»Ein Dreimännerbetrieb? Ich weeß nicht.«
Schatzi grinste. »Bist wohl eifersüchtig?«
»Blödsinn!«
»Also ja.« Schatzis Grinsen wurde breiter. »Finn ist achtzig, der ist keine Konkurrenz für dich. Gegen den bist du junges Gemüse.«
»Ich bin auch schon achtundsechzig …«
»… und siehst aus wie achtundfünfzig.« Schatzi tätschelte Tütchens Arm. »Nun hab dich nicht so, sag Ja!«
»Na ja.« Tütchen zögerte. »Aber nur auf Probe.«
»Fein!« Schatzi freute sich. »Darauf stoßen wir an: Prost, Danziger Goldwasser!«
»Prost. Und du meinst wirklich …?«
»Aber klar. Wir holen Finn zu uns. Der ist doch fürs Altersheim noch viel zu flott dabei.«
Kapitel 3
Der junge Mann trug einen fliederfarbenen Seidenschal mit Paisleymuster, der sich über dem Kragen seines schwarzen Gehrocks bauschte, darunter ein weißes Hemd mit Mandarinkragen, eine schwarze Schlaghose und schwarze Stiefeletten. Auf seinem Kopf saß eine schwarze barettähnliche Kopfbedeckung, und über seinem Arm hing ein Regenschirm, ebenfalls in Schwarz, obwohl die Sonne von einem blauen Himmel herablachte.
Richard Plath, »Mâitre Richard«, war auf dem Weg in die Große Elbstraße.
Als er das Anwesen mit der Nummer 7 erreicht hatte, machte er halt und schaute sich das Gebäude näher an. Es war ein imponierendes Haus, im Gründerstil erbaut, zweiflügelig, mit einer fünfstufigen Marmortreppe, die zu der großen Eingangstür hinaufführte.
Hier also wohnte Lucie zur Haiden.
Richard musste zugeben, dass er weniger erwartet hatte. Offenbar zählte die Familie zur Haiden ebenso zum Bürgeradel wie die Renzbergs, die elbabwärts auf dem Süllberg residierten. Nur war sie weniger bekannt. Vielleicht mit Absicht? Wer Geld oder Einfluss in der Hansestadt hatte, musste nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Hamburgisches Understatement nannte man das.
Richard verscheuchte die nutzlosen Gedanken und stieg die fünf Stufen empor. Ein Klingelschild an der Tür suchte er vergebens, nur eine Klingel gab es – blitzblank poliert, aus Messing. Er drückte auf den Knopf. Ein leises Summen ertönte. Doch nichts geschah.
Richard drückte noch einmal. Die Tür öffnete sich. Eine Frau stand im Rahmen. Schlank, um die sechzig, sehr gepflegt. In ihren blonden Haaren zeigten sich graue Strähnen. Irgendwie erinnerten sie an Lucies Haare.
»Ja bitte?«
»Habe ich das Vergnügen mit Frau Doktor zur Haiden?«
»Ja.« Flo runzelte die Stirn. »Kennen wir uns?«
Richard nahm schwungvoll das Barett ab und verbeugte sich. »Leider nein. Oder besser: noch nicht. Mein Name ist Richard.«
»Rieschar?«
»Genau. Vor Ihnen steht der Couturier der Brautmoden am Jungfernstieg.«
»Ah, es dämmert.« Flo lächelte. »Lucie und Mildred waren vorgestern bei Ihnen wegen des Brautkleids.«
»So ist es, gnädige Frau. Wäre es möglich, Fräulein Lucie zu sprechen?«
»Ich denke schon.« Flo amüsierte sich insgeheim. Das Auftreten des jungen Mannes war ziemlich gekünstelt, aber sie ließ sich nichts anmerken und wies auf die Garderobe mit dem großen Kristallspiegel. »Legen Sie doch erst mal ab.«
Während Richard sich seines Gehrocks entledigte, hatte sie Gelegenheit, ihn genauer zu betrachten. Er war sehr modisch, um nicht zu sagen auffällig gekleidet, durchaus mit Geschmack, doch ein bisschen überkandidelt, wie man in Hamburg sagte. Seine Gesichtszüge waren weich, der Zopf am Hinterkopf wirkte etwas albern. Aber jeder durfte nach seiner Fasson selig werden.
»Ich hoffe, ich störe nicht allzu sehr?«, fragte er.
Flo schüttelte den Kopf. »Um zwölf steht ohnehin das Essen auf dem Tisch. Bis dahin wollte Lucie eigentlich für ihr Physikum lernen, doch wie ich sie kenne, ist sie für jede Abwechslung dankbar.«
»Und ob ich das bin!« Lucie stand auf der Treppe, die in den ersten Stock führte.
Richard verbeugte sich erneut. »Guten Tag, Fräulein Lucie!«
»Hallo!« Lucie kam die Treppe herunter und gab ihm die Hand. »Was führt Sie zu mir?«
»Oh, nichts Besonderes. Es steht im Schirmständer.«
»Wie? Ach so!« Lucie lachte. »Den Schirm habe ich noch gar nicht vermisst. Wahrscheinlich, weil er Daddy, also meinem Vater gehört. Vielen Dank.«
»Nichts zu danken.«
Flo sagte taktvoll: »Ich lasse euch dann mal allein«, und wollte gehen, doch ihr fiel noch etwas ein. »Soll ich euch Tee in den Kleinen Salon bringen lassen?«
»Ja, danke, Mom.«
Flo entfernte sich.
Lucie führte Richard die Treppe hinauf in den linken Flügel, wo der Kleine Salon lag. Sie hätte nichts dagegen gehabt, mit ihm in ihrem Zimmer zu reden, aber ihrer Mutter schien es so lieber zu sein. »Woher wussten Sie, wo ich wohne?«, fragte sie und bot Richard einen Platz an dem alten Lyra-Tischchen an.
»Oh, das herauszukriegen war nicht schwer«, antwortete Richard, während er sich setzte. »Ich habe in der Uni angerufen und nach der Adresse einer Medizinstudentin namens Lucie zur Haiden gefragt.«
»Verstehe. Und warum haben Sie den Schirm nicht einfach geschickt?«
»Ich wollte ihn persönlich abgeben.« Richard lächelte entwaffnend. »Ich war neugierig auf Ihr Zuhause.«
»Jedenfalls vielen Dank.«
»Gern geschehen.« Richard blickte Lucie an. Sie trug wieder die ausgewaschenen Jeans, die er schon kannte, und einen pinkfarbenen Schlabberpulli. Er fand, sie sah hinreißend aus.
»Der Tee wäre da.« Gertrude, die Haushaltshilfe der zur Haidens, brachte ein Tablett und stellte es auf dem Tischchen ab. Interessiert musterte sie Richard.
»Danke, ist gut, Trudi«, sagte Lucie. »Ich schenke uns selbst ein.«
Gertrude verschwand.
»In diesem Haus wird den Gästen seit ewigen Zeiten Earl Grey serviert«, erklärte Lucie. »Ich hoffe, Sie mögen Earl Grey?«
»Mein Lieblingstee!«
»Da haben Sie ja Glück gehabt.«
Richard lachte.
Eine Pause entstand, während der Tee zog.
Richard sagte höflich: »Das ist ein sehr schönes Service mit einem ungewöhnlichen Dekor.«
»Es ist das Hauswappen der zur Haidens: ein springender Karpfen auf grünem Grund. Meine Vorfahren besaßen Fischteiche in der Lüneburger Heide.«
»Sehr schön, wirklich sehr schön … Wedgwood?«
»Ja, Wedgwood-Porzellan.« Lucie schenkte von dem Tee ein. Beide tranken. »Das Service gehört zu den wenigen Gegenständen, die im Zweiten Weltkrieg nicht kaputtgingen. Das ganze Haus wurde zerstört, nur das Erdgeschoss blieb stehen. Alles, was Sie hier sehen, wurde nach den alten Plänen wieder aufgebaut. Mein Vater ist Architekt.«
»Architekt? Welch faszinierender Beruf! Er verlangt ähnlich viel Kreativität wie der des Couturiers. Ich hoffe, Ihr Vater hat den Schirm gestern nicht vermisst? Das Wetter war doch grausam.«
»Mein Vater ist gar nicht in Hamburg. Er leitet zurzeit ein größeres Projekt in der Schweiz.«
»Sehr interessant.«
Wieder entstand eine Pause.