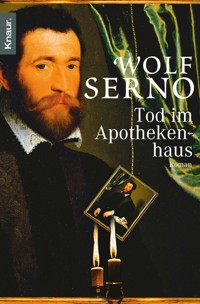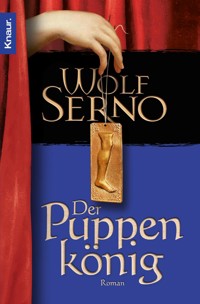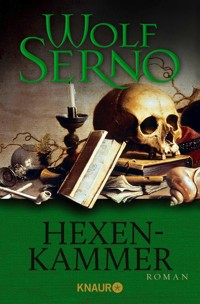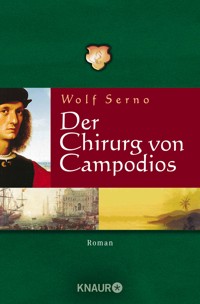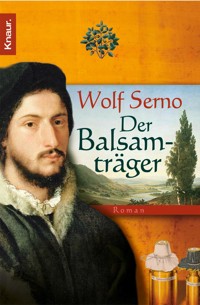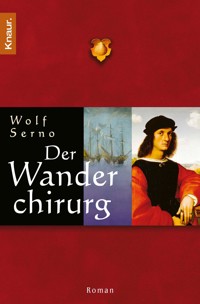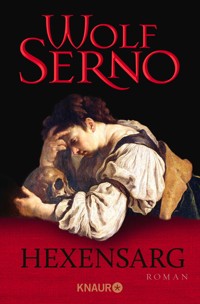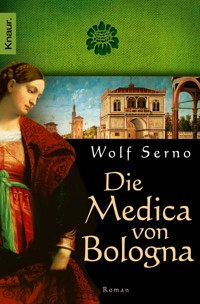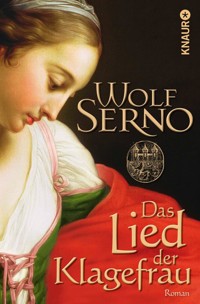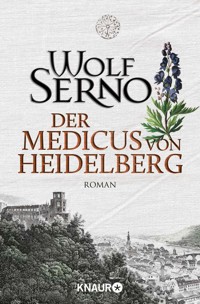
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem SPIEGEL-Bestseller "Der Medicus von Heidelberg" verbindet Erfolgsautor Wolf Serno detailgenaues Wissen um die Geburtsmedizin des 16. Jahrhunderts, eine anrührende Liebes- und eine fesselnde Lebensgeschichte zwischen Basel und Erfurt, Heidelberg und Oppenheim zu einem packenden historischen Lesevergnügen. Wie schon in seinen zahlreichen Romanerfolgen, unter anderem "Der Wanderchirurg", "Der Balsamträger", "Der Puppenkönig" oder "Die Hexenkammer", fasziniert Wolf Serno auch diesmal durch eine packende Mischung von genau recherchierten historischen Fakten, enormer Spannung und hoher Lebendigkeit in der Darstellung historischer Realität.. Kanton Thurgau, anno 1500. Niemals zuvor hat es jemand gewagt, eine Schwangere bei lebendigem Leib aufzuschneiden, um das Kind herauszuholen. Zu groß ist die Gefahr, zu streng das Verbot der Kirche. Als der Schweinekastrator Jacob Nufer dennoch die Operation an seiner Frau durchführt und mit Gottes Hilfe glücklich beendet, kennt sein Sohn Lukas nur ein Ziel: Er will ein Medicus werden. Für Lukas beginnt ein langer Weg, gesäumt von Gewalt, Gefahren und großen Gefühlen … "Meisterhaft verbindet der Erfolgsautor historische Zusammenhänge und Details über die Medizin jener Zeit mit der Erzählhandlung." Ärzteblatt Baden-Württemberg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 944
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wolf Serno
Der Medicus von Heidelberg
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Kanton Thurgau 1500. Als Junge erlebt Lukas, wie sein Vater Jacob Nufer um das Leben seiner geliebten Frau, der Stiefmutter von Lukas, kämpft. Elisabeth liegt in den Wehen, eine normale Geburt ist nicht möglich, weil das Kind sich nicht gedreht hat. Ebenso wie seine erste Frau, Lukas’ Mutter, droht Jacob auch Elisabeth zu verlieren. Es gibt jedoch eine Chance, Elisabeth und das Kind zu retten: Jacob müsste eine Schnittentbindung durchführen. Doch Jacob ist kein Arzt, vielmehr Schweinekastrator, und gegen diese Operation spricht die Tatsache, dass sie von der Kirche verboten ist. Doch Jacob erzwingt sich die Erlaubnis und kann Elisabeth retten.
Für Lukas wird die Operation, bei der er assistiert, zu einem prägenden Erlebnis. Er will studieren und Arzt werden, zumal er über die geheimnisvolle Fähigkeit, Patienten während der Behandlung in eine Art Schlaf versetzen zu können, zu verfügen scheint. Jahre später steht Lukas vor der Entscheidung, die riskante Schnittentbindung bei seiner geliebten Odilie durchführen zu müssen.
Inhaltsübersicht
Für mein Rudel:
Micky, Eddi und Olli.
Und für Fiedler, Buschmann und Sumo,
die schon auf der anderen Seite
der Straße gehen.
»Wo er nit ein Chirurgus darzu ist,
so steht er do wie ein Ölgöz,
der nichts ist als ein gemalter Aff.«
Paracelsus (1493–1541)
Die religiösen Zitate des Romans stammen aus:
DIEBIBEL
Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Siebenundzwanzigster Abdruck
Gedruckt und verlegt von B.G. Teubner in Leipzig, 1877
Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge ihres Auftritts
Lukas Nufer
Magister der Künste und Medicus
Jacob Nufer*
Kaponenmacher, Lukas’ Vater
Elisabeth Alespachin*
Lukas’ Stiefmutter
Konrad Bindschedler
Prälat in Frauenfeld
Thérèse, vormals Resi
Lukas’ Jugendfreundin
Johann Heinrich Wentz*
Baseler Professor, Lukas’ Freund
Fischel Blau, »Pisculus Caerulus«
Jude, Lukas’ ältester Freund
Gertrud
Kutschenlenkerin, Bundschuh-Mitglied
Johann Ephraim Steisser
Zunftmeister aus Würzburg
Abeline Steisser
Steissers Frau
Odilie
Tochter Philipps des Aufrichtigen*, Lukas’ Geliebte
Adam Wernher von Themar*
Doktor beider Rechte, Lehrer Odilies
Hans Talacker von Massenbach*
Raubritter
Götz und Philipp von Berlichingen*
Ritter, Gefolgsleute Talackers
Ysengard
Schmied in Sinsheim
Mathilde Ysengard
Ysengards Frau
Hartmut
Isengards Geselle
Justus Rating de Berka
Professor der Medizin in Erfurt, Nachfahre des Amplonius Rating de Berka*
Anselmus Engelhuss
Magister der Künste, Lukas’ Feind
Faustus Jungius, »der Römer«
Barward Tafelmaker*
Tilman von Prüm
Martin Luther*
Hiob Rotenhan
Eobanus Koch*
Bursarier in der Georgenburse zu Erfurt
Meister Karl
Prosektor, Lukas’ Vertrauter und Gehilfe
Ulrich von Hutten*
Bursarier in der Georgenburse zu Erfurt
Eustach
Kärrner von Pesttoten
Muhme Lenchen
Eine alte Frau und Köchin
Hinz
Muhme Lenchens Ziehsohn
Lilott
Opfer des Beulenfiebers, Hinz’ Freundin
Hermann Koutenbruer*
Medizinprofessor in Heidelberg
Berthold Waldseer
Spitalmeister im Hospital am Kornmarkt
Rahel und Simon
Fischels Frau und Sohn
Rosanna
Kundige Frau im Hospital am Kornmarkt
Heddi
Hure in »Der gemeinen Frauen Haus«
Muttchen
Bordellmutter ebenda
Junker Christoph, der »Weiberfreund«*
Pommerscher Adliger, Odilies Ehemann
Und natürlich: Schnapp, der große treue Mischlingsrüde, der Lukas auf Schritt und Tritt folgt …
Die mit einem * gekennzeichneten Personen haben tatsächlich gelebt.
Teil 1Der Magister
Kapitel 1
Siegershausen, Kanton Thurgau, 24. März bis 3. April 1500
Nach drei Tagen und Nächten verstummten die Schreie meiner Stiefmutter. Das Kind in ihrem Leib, das allem Pressen zum Trotz nicht kommen wollte, hatte sie an den Rand des Todes gebracht. Weiß wie die Wand war sie, ihr Atem so flach wie ihr Puls. Mein Vater rannte vor ihrem Bett auf und ab und fluchte gotteslästerlich. Im Allgemeinen war er ein ruhiger, besonnener Mann, aber die Angst um seine Frau hatte ihn völlig außer Fassung gebracht. »Tut endlich was und steht nicht da wie die Ölgötzen!«, schrie er uns an. »Holt mir das Kind heraus!«
»Wo nichts zu machen ist, ist nichts zu machen, Nufer«, sagte der Mann neben mir. Es war Gotthard Iwein, der Bader aus Alterswilen, einem Nachbardorf.
»Fürwahr, er hat recht«, bekräftigte Alphons Wyss, der Wundarzt. »Willst du, dass wir dein Weib bei lebendigem Leibe aufschneiden? Abgesehen davon, dass es verboten ist und wir in Teufels Küche kämen, wenn wir’s täten, würde sie eines elendigen Todes sterben.«
»Ich will, dass das Ganze ein Ende hat!«
»Nun hör mal zu, Jacob Nufer.« Eine der herumstehenden Wehmütter stemmte die Hände in die Hüften. »Das Kind hat eine Steißlage, ich hab’s dir schon gesagt. Wir haben mindestens ein Dutzend Mal versucht, es zu drehen, damit der Kopf nach unten zeigt, wie sich’s gehört. Aber es geht nicht. Das Becken ist zu eng. Es ist, als wär’s da drinnen eingemauert. Da hilft alles Fluchen nichts, nur Warten und Gottvertrauen.«
Die anderen Wehmütter und ein paar Nachbarinnen nickten einträchtig.
Vater war stehen geblieben. »Das ist mir zu wenig«, knurrte er. Er stieß den nutzlos gewordenen Gebärstuhl beiseite und trat an das Bett meiner Stiefmutter. Seine Hand strich über ihre schweißnasse Stirn. Sie zeigte keine Regung. Nur ihre geschlossenen Lider flatterten leicht. »Elisabeth«, flüsterte er heiser, »ich schwöre beim Heiland, dass ich dir helfen werde, und wenn’s das Letzte ist, was ich auf dieser Welt tue.« Dann stürmte er aus der Stube.
Wir anderen schauten ihm betreten nach. Er tat uns leid in seinem Schmerz. Fast so leid wie Elisabeth Alespachin, seine zweite Frau, meine Stiefmutter. Er hatte keine Kosten und Mühen gescheut, damit sie ihr erstes Kind ohne Komplikationen gebären könnte, hatte nicht weniger als dreizehn kundige Köpfe um sie herum versammelt und musste trotzdem mit ansehen, wie ihr Lebensfunke mehr und mehr erlosch.
Ich hatte so etwas schon einmal erlebt. Drei Jahre zuvor, anno 1497. Hier, in derselben Stube. Nur dass damals nicht Elisabeth Alespachin in dem Bett gelegen hatte, sondern meine leibliche Mutter. Sie war an einem Kopffieber erkrankt. Einem Leiden, so tückisch wie der Teufel selbst. Und genau wie heute war Alphons Wyss, der Wundarzt, aus Hugelshofen gerufen worden. Er hatte die Krankheit als Hirnwut bezeichnet und von einer inflammatio gesprochen. Hatte weitere lateinische Ausdrücke vor sich hin gemurmelt. Hatte kalte Umschläge und aufgekochte Weidenrinde verordnet und eine Reihe anderer Arzneien empfohlen. Aber genützt hatte das alles nichts. Meine Mutter war heißer und immer heißer geworden. Und noch am selben Tag verglüht.
Wartete ein ähnlich armseliger Tod auf meine Stiefmutter? Ich hatte große Angst davor, denn obwohl Elisabeth, wie ich sie nannte, mich nicht großgezogen hatte, stand sie mir doch nahe. Sie war eine Frau der Berge, von natürlichem Wesen und ansteckender Fröhlichkeit. Vor zwei Jahren bei einem Dorffest war es gewesen, als sie mit ihrer gewinnenden Art das Herz meines Vaters eroberte – und meines gleich dazu. Ein halbes Jahr später wurde Hochzeit gefeiert. Und nun sollte Elisabeth, die starke, fröhliche Elisabeth, schon bei der Niederkunft ihres ersten Kindes sterben? Ich konnte, ich wollte es nicht glauben.
In meine Gedanken hinein öffnete sich die Tür. Vater stand auf der Schwelle. Er trug Reisemantel und Reitstiefel. »Komm, Lukas«, befahl er, »wir reiten nach Frauenfeld.«
Nach langem, scharfem Ritt kamen wir glücklich in Frauenfeld an. »Unserer lieben Frauen Feld« hatte man das der Muttergottes geweihte Fleckchen Erde einst genannt und eine Kirche daraufgesetzt. Die Kirche stand noch, wenn auch vom Zahn der Zeit verwittert. Sie befand sich in der Mitte des Ortes und war von ein paar Dutzend Häusern und Höfen umgeben. Es waren stabile Gebäude, sämtlich aus dem Holz der nahegelegenen Wälder gezimmert. Das einzige Haus mit steinernen Grundmauern und gläsernen Fenstern war das Haus des alten Prälaten Konrad Bindschedler. Zu ihm wollte mein Vater.
Der Küster, der die Knechtkammer des Hauses bewohnte, ließ uns ein. Bindschedler saß in der großen Stube am Ofen, las in der Heiligen Schrift und wärmte sich die Füße in einem Sack aus Lammfell. Man schrieb bereits den vierundzwanzigsten März, aber die Tage waren noch immer kalt.
Vater entbot die Tageszeit, senkte den Kopf und schlug das Kreuz. Mechanisch tat ich es ihm nach.
»Was führt euch zu mir?« Bindschedlers Stimme klang, als käme sie aus dem Sumpf. Auch sein Gesicht glich in Form und Farbe dem einer Kröte. Doch abgesehen von seinem wenig ansprechenden Äußeren, galt er als glaubensstarker Gottesmann. Streng im Wort, aber gütig im Herzen. Ich musste es wissen, denn ich hatte in den vergangenen sechs Jahren die Frauenfelder Lateinschule besucht, deren Leiter er war.
Vater bat um Entschuldigung, dass er so unverhofft hereinplatze, aber ein dringlicher Grund führe ihn hierher. Seine Frau läge seit mehreren Tagen in den Wehen, doch das Kind wolle nicht kommen. Der Kreißenden drohe der baldige Tod.
Bindschedler riss die Augen auf. »Das ist, bei Gott, eine Hiobsbotschaft! Bist du sicher, dass es zu Ende geht?«
»Ja, Euer Gnaden.«
»Nun, nun. Wir alle müssen uns dem unerfindlichen Ratschluss des Herrn beugen. In guten wie in schlechten Tagen. Willst du, dass ich dich nach Siegershausen begleite und deiner Frau die Sterbesakramente erteile?«
»Nein, Euer Gnaden.«
»Was willst du dann? Steht es ähnlich schlimm um das Kind? Muss Taufwasser in den Geburtskanal der Mutter gespritzt werden, damit es vor seinem Tod noch den Bund mit Gott eingehen kann?«
»Nein.« Vater suchte nach Worten. »Ich möchte mich nur Gottes Beistand versichern, wenn ich den Leib meiner Frau öffne und das Kind heraushole.«
»Eine Schnittentbindung? Bist du von Sinnen?«
»Nein, Euer Gnaden, ich habe es mir genau überlegt. Ihr wisst, dass ich mein Brot als Schweinekastrator verdiene. Bei dieser Arbeit habe ich die Anatomie des Viehs genau kennengelernt. Ich traue mir zu …«
»Willst du den Körper deiner Frau mit einer Sau vergleichen?«
Vater fiel auf die Knie. Während ich hastig seinem Beispiel folgte, hörte ich ihn sagen: »Bitte, vergebt mir, aber meine Kenntnisse der Anatomie rühren nicht allein von meiner Arbeit als Kaponenmacher her. Ich habe im letzten Jahr auch als Feldscher gedient. Es war im Schwabenkrieg gegen den deutschen König Maximilian I.«
Bindschedler schlug die Bibel zu und legte sie beiseite.
»Auf diese Weise habe ich, bei aller Bescheidenheit, mein Scherflein zum Sieg der Eidgenossen beigetragen.«
»So, hast du das? Nun ja, das war brav.« Bindschedler schien ein wenig besänftigt.
»Niemand traut sich, den Eingriff zu wagen, Euer Gnaden. Gotthard Iwein, der Bader, nicht, Alphons Wyss, der Wundarzt, nicht, und von den Wehmüttern ganz zu schweigen. Sie sagen, das Kind hätte eine Steißlage. Man müsse den Tod der Mutter in Kauf nehmen, um wenigstens das Kind retten zu können. Doch damit will ich mich nicht abfinden. Ich liebe meine Frau.«
»Das ehrt dich.«
»Es wäre schon die zweite Frau, die ich verliere. Ihr wisst es. Ich bitte Euch inständig, mir Euren Segen für die Operation zu geben!«
»Warum sollte ich dir meinen Segen für etwas geben, das ohnehin misslingt? Noch nie hat eine Frau die Schnittentbindung überlebt.«
»Euer Gnaden …«
»Die Kirche lehrt, dass der Tod der Mutter abgewartet werden muss, um anschließend das Kind, sofern es noch lebt, herauszuschneiden. Der selige Abt Purchart von St. Gallen, der auf diese Weise auf die Welt kam, ist ein leuchtendes Beispiel dafür. In jedem Fall ist das Leben des Kindes höher zu bewerten als das der Mutter.«
»Aber bedenkt doch, Euer Gnaden, mit Gottes Hilfe kann ich beider Leben retten! Verbietet es die Kirche denn, gleichermaßen für Mutter und Kind zu beten?«
»Natürlich nicht. Welch eine Frage.«
»Dann betet für beide. Es soll mir zwölf schön gezogene Bienenwachskerzen zum Schmuck Eurer Kirche wert sein. Ich bitte Euch herzlich. Und überlasst alles andere mir.«
Bis dahin hatte das Gespräch den von mir erwarteten Verlauf genommen. Doch nun, da Vater angedeutet hatte, er würde auch ohne den Segen der Kirche zum Skalpell greifen, musste eine Wendung eintreten. Gespannt wartete ich auf Bindschedlers Reaktion. Würde er Vater scharf zurechtweisen? Ihm mit dem Fegefeuer drohen? Ihn gar exkommunizieren?
Nichts von alledem geschah. Der alte Mann blickte auf seine Füße im Lammfellsack. Eine Weile verging. Schlief er etwa? Nein, er nahm die Heilige Schrift wieder zur Hand und schlug sie auf. »Matthäus zweiundzwanzig, Vers fünfzehn bis einundzwanzig«, murmelte er. Ein Lächeln stahl sich auf sein Krötengesicht. »Welch ein Zufall. Da spricht unser Herr Jesus bei seiner Begegnung mit den Pharisäern und den Herodiern folgende Worte: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wohlan, Jacob Nufer, in diesem Sinne will auch ich dir antworten.«
»Was meint Ihr damit, Euer Gnaden?«
»Ganz einfach: Gib deiner Frau die Hilfe, die sie braucht, und Gott den Gehorsam, den er verlangt.«
Vater schluckte. »W… Wie kann das geschehen?«, stotterte er. »Ich …«
Aber schon verstummte er, denn Bindschedler hielt ihm die Hand hin, und ihm blieb nichts anderes übrig, als den edelsteinbesetzten Ring daran zu küssen.
Die Unterredung war beendet.
Während des ganzen Ritts zurück fragte ich mich, ob Bindschedler die Bibelstelle zufällig oder absichtlich aufgeschlagen hatte. Am Ende kam ich zu dem Schluss, dass es Absicht gewesen war – der kluge Schachzug eines alten Mannes, der einerseits meinem Vater nicht die vorgetragene Bitte abschlagen mochte, andererseits die Interessen der Kirche wahrnehmen musste. Geschickt hatte er es vermieden, weder ja noch nein zu sagen. Und Vater die Entscheidung überlassen. Meine Achtung für den Gottesmann, über dessen Aussehen meine Mitschüler und ich uns so häufig lustig gemacht hatten, stieg erheblich.
»Hüa!«, rief Vater und gab seinem Braunen einen aufmunternden Klaps. »Wir haben es gleich geschafft. Da vorn ist schon Siegershausen.«
Im letzten Abendlicht betraten wir unser Haus. Gotthard Iwein, Alphons Wyss und die Wehmütter hielten sich allesamt noch in der Gebärstube auf, gerade so, als wäre die Zeit stehengeblieben. Was sie in den sieben oder acht Stunden unserer Abwesenheit getrieben hatten, mochte der Himmel wissen. Doch immerhin war meine Stiefmutter noch am Leben.
»Hast du den Segen der Kirche für die Schnittentbindung eingeholt?«, fragte Gotthard Iwein neugierig.
Vater würdigte ihn kaum eines Blickes, während er seiner Frau eine Haarsträhne aus der Stirn strich. »Der Prälat Bindschedler wird für dich und das Kind beten«, brummte er. Dann verließ er die Stube und kam kurz darauf mit seinem Operationsbesteck zurück. In seinen Augen lag eine Entschlossenheit, die ich nie zuvor bei ihm gesehen hatte. »Jetzt wird alles gut, Elisabeth«, rief er. »Der Prälat hat gesagt, ich soll dir die Hilfe geben, die du brauchst.«
Ein schwaches Lächeln belohnte seine Worte. Die Stimme meiner Stiefmutter kam wie aus weiter Ferne: »Hol das Kind heraus. Das Kind, das Kind … sorg dich nicht … um mich.«
»Du wirst leben, Elisabeth. Und das Kleine auch. Ich weiß, was ich tue.«
Ich fragte mich, ob Vater wirklich so zuversichtlich war, wie er sich gab, aber ich hatte keine Gelegenheit, länger darüber nachzudenken, denn er blickte auffordernd in die Runde: »Nun, wer traut sich, mir zu assistieren?«
»Willst du es wirklich wagen?«, fragte Alphons Wyss.
»Hast du dir das auch gut überlegt?«, fragte Gotthard Iwein.
Die Wehmütter und die Nachbarinnen fragten nichts. Sie traten von einem Bein aufs andere, tuschelten Unverständliches und verließen den Raum. Vater blickte ihnen nach. Zuckte mit den Schultern. Und befahl Iwein und Wyss, ein paar Laternen anzuzünden und sie an dem Deckenbalken über dem Bett aufzuhängen. Er brauche Licht, sagte er, sehr viel Licht.
Während beide taten, wie ihnen geheißen, wandte er sich abermals an meine Stiefmutter. »Elisabeth«, sagte er mit rauher Zärtlichkeit, »die Schnitte mit dem Skalpell werden nichts sein gegen das, was du bisher an Schmerzen erleiden musstest.« Dann griff er zu einem Becher Wein, hielt ihn ihr an die Lippen und ließ sie ein paar Schlucke zur Stärkung trinken.
Als die Laternen über dem Bett hingen, traten Iwein und Wyss einen Schritt zurück und verschränkten die Arme vor der Brust. In ihren Gesichtern stand Ablehnung. Ich fragte mich, warum sie blieben, wenn sie Vaters Vorgehen nicht guthießen. Wollten sie ihn scheitern sehen? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ihr Verhalten mir Gelegenheit gab, Vater zu helfen. Und das erfüllte mich mit Stolz.
»Fass mit an, Lukas«, befahl Vater und schlug die Decke der Lagerstatt zurück. Gemeinsam zogen wir an den Beinen der Kreißenden, bis ihr Gesäß sich über dem Fußende des Bettes befand. Im Schein der Laternen wirkte ihr Leib wie ein mächtiger Kürbis. Die gespreizten Schenkel schimmerten blass. Vater trat zwischen die Beine und wies Iwein und Wyss an, sie sollten seiner Frau ein Kissen unter den Rücken schieben und ihr, wenn nötig, den Kopf stützen. Nachdem das geschehen war, zog er einen Holztisch heran und deckte ihn mit einem frischen Leinentuch ab. Dann breitete er seine Instrumente darauf aus. Sie waren vielfach gebraucht, doch sie blitzten und funkelten wie neu. Ich wusste, dass er häufig wegen seiner Reinlichkeit verspottet wurde, aber das kümmerte ihn wenig. »Weißt du«, hatte er einmal zu mir gesagt, »es muss seinen Grund haben, warum mir noch nie ein Tier an vergiftetem Blut gestorben ist. Und dieser Grund heißt: Säuberung des Bestecks. Sorgfältige Säuberung nach jeder Benutzung.«
»Aber die Chirurgen behaupten, das sei Unsinn, da die Instrumente beim nächsten Eingriff ohnehin wieder schmutzig würden«, hatte ich entgegnet.
»Kennst du den Kaponenmacher Nyffenegger aus Unterwalden?«, hatte er gefragt. »Der wurde vor zwei Sommern zu einer Kuh gerufen, die nicht kalben konnte. Er hat sie stehend an der Seite aufgeschnitten und das Junge herausgeholt. Drei Tage danach ist die Kuh an Wundbrand verreckt. Ich schwör dir, es hat nur an seinem schmutzigen Werkzeug gelegen. Überhaupt ist dem Nyffenegger schon so manches Vieh unter den Händen krepiert. Und nun frage ich dich: Willst du, dass mir so etwas auch passiert?«
»Nein«, hatte ich hastig versichert.
»Na siehst du«, hatte mein Vater gesagt.
Jetzt sagte er zu Gotthard Iwein: »Wenn du dich nützlich machen willst, geh raus und frag die Wehmütter nach heißem Wasser und frischen Tüchern.« Und zu mir sagte er: »Gib mir das Schermesser, Lukas. Das mit der kurzen Klinge.« Ich gab es ihm, und er prüfte mit der Fingerkuppe die Schärfe. Er schien zufrieden. Mit kurzen, geschickten Bewegungen schabte er das Schamhaar fort. Es war eine Prozedur, wie er sie manchmal auch im Stall vornahm, um die Verletzung eines Tieres besser in Augenschein nehmen zu können, und ich glaubte zu spüren, wie meine Stiefmutter sich innerlich dagegen sträubte. Sie tat mir leid. Ich suchte ihren Blick und wünschte ihr, sie möge schlafen, tief schlafen, und von alledem nichts mitbekommen. Nichts von der Situation. Und nichts von der Operation.
»Träum nicht, Lukas«, ermahnte mich mein Vater. »Du blickst schon wieder so seltsam drein. Gib mir ein warmes, feuchtes Tuch.« Ich reichte ihm eines, und er wischte damit die restlichen Härchen vom Schamhügel fort. »Es gibt eine schmale Linie im Gewebe unter der Haut«, murmelte er, wobei er auf den Leib meiner Stiefmutter blickte und gleichzeitig die Hand in meine Richtung ausstreckte. Ich nahm an, er wollte ein Skalpell, und reichte ihm das mit dem geschnitzten Horngriff. Ich hatte es gewählt, weil ich wusste, dass er es am liebsten verwendete, und freute mich, als er damit zufrieden schien.
»Eine schmale Linie«, wiederholte er. »Längs verlaufend. In der Mitte des Bauches, oberhalb und unterhalb des Nabels. Das ist beim Tier so, und das ist beim Menschen nicht anders. Wir jedoch interessieren uns nur für die Linie unterhalb des Nabels. Man nennt sie auch die weiße Linie. Wenn man in sie einschneidet, blutet es kaum, was sehr von Vorteil ist …«
Vater erklärte noch manches mehr, und an das meiste erinnere ich mich nicht, aber ich weiß noch, dass ich mich fragte, warum er ständig vor sich hin sprach. Vielleicht wollte er sich selbst beruhigen, vielleicht auch meine Stiefmutter, jedenfalls – ich hatte für einen Augenblick weggeschaut – sah ich auf einmal, wie er das Skalpell mit sicherer Hand durch die Bauchdecke zog. Meine Stiefmutter lag ruhig da und hatte die Augen geschlossen. Iwein und Wyss standen bereit, um sie, wenn nötig, festzuhalten.
»Du bist sehr tapfer, meine Elisabeth. Es ist gut, dass du schlank wie eine Gerte bist. Das erleichtert den Einschnitt ungemein. Siehst du, schon haben wir uns bis zur Gebärmutterwand vorgearbeitet. Der Schnitt ist gut sieben Zoll lang. Er soll die Pforte bilden, durch die unser Kind das Licht der Welt erblickt. Jetzt heißt es nur noch, die Wand zu durchtrennen. Wir wollen es behutsam tun. Die Blase liegt zwar tiefer, doch wir müssen vorsichtig sein …«
Er redete immer weiter, befahl mir, heranzutreten und die Schnittränder mit zwei Wundhaken auseinanderzuziehen, und hielt plötzlich einen winzigen Fuß in der Hand. Dann einen zweiten. Und dann zog er das ganze Kind heraus. Es war blutig und schleimig, und er hielt es an den Füßen, den Kopf nach unten. Unwillkürlich musste ich daran denken, dass Vater genauso die kleinen Ferkel hielt, bevor er sie … nein, dieser Gedanke gehörte nicht hierher. Zumal Vater etwas ganz anderes tat. Er gab dem Kind einen Klaps auf den Po. Augenblicklich gellte ein Schrei durch die Gebärstube.
»Es ist ein Junge!«, rief mein Vater froh. »Elisabeth, wir haben einen kleinen Jungen!«
Meine Stiefmutter rührte sich nicht. Erst, als ich sie sanft berührte, öffnete sie die Augen und erblickte das Kind. Sie gab einen schwachen Laut des Entzückens von sich, wollte sich aufrichten, wurde aber von Iwein und Wyss mit sanftem Druck daran gehindert. Hinter uns öffnete sich die Tür. Die Wehmütter und Nachbarinnen hatten den Schrei des Neugeborenen gehört. Sie machten lange Hälse. Mein Vater durchtrennte die Nabelschnur und übergab meinen kleinen Bruder an die Frauen, damit sie ihn reinigten und die Nabelschnur verknoteten. Dann forschte er nach dem Mutterkuchen und der Eihaut, entnahm beides, überzeugte sich von deren Vollständigkeit und begann mit dem Vernähen der Gebärmutterwand. Er tat es mit einem sauberen Faden aus Schafsdarm, den er auf eine gerundete Nadel gezogen hatte. Die Stiche, die er setzte, zeugten von großer Erfahrung. Ich bewunderte ihn dafür.
»Warum nähst du die Gebärmutter zu?«, fragte Alphons Wyss, der Wundarzt. »Das ist überflüssig. Weißt du nicht, dass die Gebärmutter zur Retraktion neigt? Sie zieht sich von selbst zurück, sobald das Kind heraus ist. Das wird dir jede Wehmutter bestätigen.«
Mein Vater blickte auf und erwiderte ruhig: »Was ich durchtrennt habe, nähe ich auch wieder zusammen. So habe ich es immer gehalten. Nichts ist sinnlos auf der Welt. Wenn die Gebärmutterwand von Natur aus geschlossen ist, wird es seinen Grund haben.« Er ließ sich von mir ein weiteres der bereitgelegten Tücher geben, tupfte die Wunde mit großer Umsicht sauber und griff abermals zur Nadel. Wenig später war auch der Leib verschlossen.
»Leg mir den Kleinen an die Brust, Jacob«, bat meine Stiefmutter mit schwacher, aber glücklicher Stimme.
Vater gehorchte. Er hatte Tränen in den Augen.
Eine Woche war ins Land gegangen. Zum Erstaunen des gesamten Dorfes erholte sich meine Stiefmutter ungewöhnlich rasch. Ihre Operationswunde, die mein Vater regelmäßig mit einer Ringelblumensalbe einrieb, verheilte gut.
Da mein kleiner Bruder am vierundzwanzigsten März geboren worden war, wollten wir ihn Elias nennen – nach Elija, dem Namenspatron für diesen Tag. Meine Stiefmutter meinte: »Lukas und Elias, das passt hübsch zusammen.«
Zur Taufe war die Familie auf einem Heuwagen nach Frauenfeld gefahren, und Seine Gnaden, der Prälat Bindschedler, hatte es sich nicht nehmen lassen, eigenhändig die heilige Handlung vorzunehmen. Das Taufwasser stammte aus dem Flüsschen Murg, das durch Frauenfeld fließt. Es war quellklar und zuvor im Rahmen einer besonderen Zeremonie geweiht worden. Danach hatte Bindschedler es mit der Hand aus dem steinernen Taufbecken geschöpft und eine geringe Menge über Elias’ Stirn gegossen, wogegen der Täufling kräftig schreiend protestierte. Die Liturgie mit ihrem steten Wechsel aus Gesang und Gebet war lang und für die Mutter ermüdend, doch schließlich war auch sie zu Ende gegangen. »In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti … Amen.«
Der langen Rückfahrt wegen hatten wir in Frauenfeld übernachten müssen und erst am darauffolgenden Morgen den Heimweg antreten können. Davor jedoch war Vater noch einmal zu Bindschedler gegangen und hatte ihm das Geld zum Kauf von zwölf Kirchenkerzen übergeben, dazu ein paar Silbermünzen für den Opferstock. »Ich bin Euch so dankbar, Euer Gnaden«, hatte er noch einmal versichert, und Bindschedler hatte sein Krötengesicht in gütige Falten gelegt und geantwortet: »Danke nicht mir, mein Sohn, danke dem Herrgott, um dessen Beistand ich für dich und deine Familie gebetet habe.«
Auf der Rückfahrt saß mein Vater oben auf dem Kutschbock und sang aus voller Brust die alten Lieder, weil er so glücklich war.
Und auch jetzt, da wir wieder zu Hause waren, sang er. Leise zwar, weil meine Stiefmutter und der kleine Elias im Nebenzimmer schliefen, doch voller Inbrunst. Es war das Lied von dem Jüngling, der hoch in den Walliser Alpen das zauberstarke Edelweiß sucht, um es seiner Liebsten ans Kleid zu stecken und dadurch ihre Liebe zu gewinnen. »Warum singst du nicht mit, Lukas?«, fragte er mich augenzwinkernd. »Bist du unglücklich verliebt?«
Die Frage war scherzhaft gemeint, weil ich erst vierzehn Jahre zählte, aber mir war nicht nach Neckereien zumute, deshalb antwortete ich stirnrunzelnd: »Vater, jetzt, wo sich alles so gut gefügt hat, könnte ich doch nach Basel an die Universität gehen?«
»Großer Gott, fängst du schon wieder damit an«, sagte Vater und begann mit der zweiten Strophe.
»Ich meine es ernst, Vater.«
Vater brach seinen Gesang ab. »Daran zweifle ich nicht.« Er griff nach dem Weinkrug, um sich einen Becher vollzuschenken.
»Wozu sonst habe ich die Lateinschule besucht, wenn ich nicht studieren darf?«
Vater trank einen Schluck. »Die Schule ist ein gutes Rüstzeug fürs Leben. Das hat der Prälat Bindschedler selbst gesagt.«
»Er hat auch gesagt, dass aus mir einmal ein guter Arzt werden könnte.«
»Ich weiß, mein Sohn.« Vater seufzte und trank einen weiteren Schluck. »Aber Gott hat jedem von uns seinen Platz zugewiesen. Und dein Platz ist hier in Siegershausen. Du sollst einmal mein Nachfolger werden. Schweine zu kastrieren ist ein ehrenwerter Beruf, der seinen Mann ernährt. Sieh dich nur um. Alles in diesem Haus habe ich durch meiner Hände Arbeit erworben.«
Dagegen konnte ich schlecht etwas sagen, ohne Vater zu kränken. Er war ein Mann der Tat und nicht der Bücher. An jenem Abend zählte er siebenunddreißig Jahre, war kerngesund und hatte noch alle Zähne im Mund. Sein Geschick als Kaponenmacher war weit über die Landesgrenzen bekannt. Die von ihm behandelten Schweine überstanden die Eingriffe unbeschadet, sie wurden schneller fett, und ihr Fleisch hatte nicht den strengen Geschmack der unkastrierten Tiere. Vater liebte seinen Beruf über alles und dachte, seinem Sohn müsse es zwangsläufig genauso ergehen, weshalb unser Gespräch an dieser Stelle normalerweise endete. Aber heute wollte ich nicht aufgeben. Ich fragte: »War meine Assistenz bei der Schnittentbindung denn so schlecht?«
Vater runzelte die Stirn. »Daher also weht der Wind?« Dann glitt ein Lächeln über sein Gesicht. »Fürwahr, du schlägst dich recht wacker im Gefecht der Worte. Deshalb will ich dir ehrlich antworten: »Nein, deine Assistenz war beileibe nicht schlecht. Obwohl ich kurz vor dem Einschnitt dachte, du hättest wieder einmal von deiner seltsamen Fähigkeit Gebrauch gemacht. Du weißt schon, was ich meine. Du siehst dann aus, als würdest du träumen, und steckst mit deiner Träumerei die anderen an. Ich sage dir, das ist Teufelswerk. Nur gut, dass Elisabeth den Eingriff auch so überstanden hat.«
»Ja, Vater.« Ich sagte zu dem Vorwurf nichts, aber ich wusste, dass ich entgegen Vaters Meinung meine Stiefmutter sehr wohl in Schlaf versetzt hatte: mit einer Kraft, die ich ein paar Jahre zuvor zum ersten Mal an mir entdeckt hatte. Ausgerechnet bei der Heuhoferin, einer zänkischen Alten, die den lieben langen Tag auf der Bank vor ihrer Hütte saß und die Kinder beschimpfte. Sie waren ihr zu laut, wenn sie spielten. Besonders die kleine Resi. Sie rief Resi zu sich und versetzte ihr eine kräftige Maulschelle. Resi weinte. Da Resi meine Freundin war, musste ich ihr beistehen. Ich streckte der Heuhoferin die Zunge raus und rief, sie sei eine böse, alte Hexe. Da wollte sie auch mich schlagen. Fortlaufen konnte ich natürlich nicht, weil Resi mich dann für einen Feigling gehalten hätte. Also entschuldigte ich mich hastig und redete auf die Alte ein. Was, das weiß ich nicht mehr. Nur noch, dass ich sie zu beruhigen versuchte. Ich sah ihr in die Augen und sagte mit schmeichlerischen Worten, sie sei gar keine Hexe, ich hätte mich geirrt. Sie sei ein liebes Mütterchen, und wir Kinder würden sie alle sehr gern haben. Tatsächlich wurde sie ruhiger, aber ich traute dem Frieden nicht. Am liebsten hätte ich sie gebeten, im Haus zu verschwinden, damit wir weiter spielen konnten. Doch das ging natürlich nicht. Deshalb sagte ich zu ihr: »Heuhoferin, mach doch ein Nickerchen. Ein erholsames, entspannendes Nickerchen. Gleich jetzt. Das wird dir guttun. Schlafe ein, schlafe ein …« Und während ich das sagte, sah ich, dass ihr der Kopf langsam auf die Brust sank. Ich war erstaunt, weil sie tatsächlich tat, was ich ihr vorgeschlagen hatte, und redete rasch weiter: »Schlafe, schlafe tief, damit wir spielen können und dich nicht länger stören, schlafe, schlafe, schlafe, und nachher will ich dich wieder wecken.«
So war es gewesen. Vater, dem ich danach alles erzählte, sagte, so etwas gäbe es nicht, und wenn, dann ginge es nicht mit rechten Dingen zu. Ich solle zu niemandem darüber reden. Schon gar nicht zu dem alten Prälaten Bindschedler, denn die Kirche lasse bei so etwas nicht mit sich spaßen. Ich versprach es ihm und hielt mich daran, doch ein paar Tage später war ich einfach zu neugierig und probierte meine neue Fähigkeit abermals aus. Diesmal an Resi, im Schuppen hinter dem Haus. Auch Resi schlief sofort ein, als ich sie darum bat, und alles wäre gut gewesen, wenn Vater nicht plötzlich dazugekommen wäre. Es hatte ein gehöriges Donnerwetter gesetzt und sogar ein paar Schläge. »Hatte ich dir nicht befohlen, den Unsinn mit dem Schlafbefehl zu lassen!«, rief er. »Was ist, wenn das arme Ding nicht wieder aufwacht?«
»Sei unbesorgt, Vater«, hatte ich geantwortet, denn ich war sicher, Resi würde genau das tun, wenn ich es nur wollte. Kurz danach schlug Resi die Augen wieder auf und wunderte sich, dass mein Vater vor ihr stand. Von seinem Zornesausbruch hatte sie nichts bemerkt.
Seitdem hatte ich mich an Vaters Gebot gehalten. Bis zu diesem Tag, da ich sicher war, meine Stiefmutter würde die Operation im Schlaf besser ertragen. Dennoch schien es mir klüger zu sein, nichts davon zu erwähnen, schon gar nicht, weil ich Vater die Erlaubnis zum Studium abringen wollte. Doch was konnte ich noch sagen? Da kam mir ein Einfall. »Jetzt, wo Elias da ist, könnte er es doch sein, der dein Nachfolger wird«, sagte ich. »Und ich könnte nach Basel gehen.«
Mein Vater stutzte. An diese Möglichkeit hatte er noch nicht gedacht. »Elias?«, fragte er.
Wie auf ein Stichwort erschien in diesem Augenblick meine Stiefmutter in der Tür. Sie hielt meinen kleinen Bruder auf dem Arm und sagte: »Hattest du ›Elias‹ gesagt, Jacob? Hier ist er. Er hat gerade getrunken, ist satt und schläft. Willst du ihn nehmen?« Und sie legte meinem Vater den Kleinen in die Armbeuge.
»Elias«, flüsterte Vater beglückt und wiegte ihn sanft hin und her. »Er ist wahrhaftig ein kleiner Prachtkerl.«
Meine Stiefmutter lachte leise. Dann sah sie zu mir herüber, denn ich war aufgestanden, um die Stube zu verlassen. »Nanu, Lukas?«, fragte sie. »Was ziehst du für ein Gesicht? Ist dir eine Laus über die Leber gekrochen?«
»Nein«, sagte ich.
»Sag schon, was hast du?«
»Nichts.«
»Nun setz dich wieder und erzähle, was dich bedrückt!« Meine Stiefmutter konnte sehr energisch werden.
Also setzte ich mich wieder und berichtete ihr von dem Gespräch, während Vater kaum zuzuhören schien, weil er die ganze Zeit den kleinen Elias hätschelte.
»Stimmt das, Jacob?«, fragte sie, als ich geendet hatte.
»Was? Ach ja. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wir können ein andermal darüber reden.«
»Ich finde, wir sollten jetzt darüber reden. Wir alle sind glücklich, du, ich und der kleine Elias. Nur Lukas ist es nicht. Das darf nicht sein, Jacob. Das ist nicht gerecht. Erfülle Lukas seinen Wunsch.«
»Nun ja«, sagte Vater. »Nun ja.«
So kam es, dass ich zwei Tage später, am dritten April des Jahres 1500, nach Basel aufbrach, um an der dortigen Universität die Artes liberales, die »Freien Künste«, zu studieren.
Kapitel 2
Basel, 10. bis 13. März 1504
Ich saß an einer langen Tafel, an der nicht weniger als dreißig Männer lachten, tranken und sangen. Eigentlich hätten es noch mehr Männer sein können, doch der Gastgeber war nicht gerade gut bei Kasse. Er musste jeden Pfennig zweimal umdrehen, bevor er ihn einmal ausgab. Der Gastgeber war ich. Und der Grund für meine ungewöhnliche Freigebigkeit war, dass ich mein Examen zum Magister Artium bestanden hatte.
Punkt zehn Uhr am Morgen hatte ich im ehrwürdigen Doktorsaal der Basler Universität die Urkunde erhalten, die mir schwarz auf weiß bescheinigte, dass ich nach dem Trivium der Freien Künste auch das Quadrivium, also das weiterführende Studium der Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie, mit Erfolg absolviert hatte. Übergeben hatte mir das Dokument mein Lehrer und väterlicher Freund Johann Heinrich Wentz. Wentz bewohnte, seinem Stand geziemend, ein prächtiges Haus in der Rittergasse, ganz in der Nähe des Münsters. Und eben dieses Haus hatte er mir für meine Examensfeier zur Verfügung gestellt.
Jetzt saß er neben mir, inmitten all der fröhlich zechenden Kollegen und Kommilitonen. Ein wenig fehl am Platze wirkte er und ein wenig betreten ob der Ausgelassenheit um ihn herum, aber nachsichtig lächelnd und sich immer wieder mit einem Tuch den Schweiß von der geröteten Stirn wischend. Während ich ihn ansah, wanderten meine Gedanken zurück zu jenem Tag, als ich ihm zum ersten Mal begegnete.
Es war Anfang April des Jahres 1500 gewesen. Nach einwöchigem, anstrengendem Fußmarsch entlang des Rheins hatte ich die Mauern von Basel vor mir auftauchen sehen. Klopfenden Herzens passierte ich im Süden das St.-Alban-Tor und gelangte in die Stadt. Nie zuvor hatte ich so viele dichtgedrängte Häuser, so viele Kirchen, Klöster und Kapellen gesehen. Es kam mir vor, als ginge ich durch ein steinernes Meer. Nachdem ich geraume Zeit durch die Straßen geirrt war, lernte ich in der Nähe des Gerberbrunnens einen Burschen kennen, der nicht ohne Stolz verkündete, er sei ein »Artist«, also einer, der die Artes liberales studiere. Ich sagte ihm, genau das wolle ich auch, um später einmal Arzt werden zu können. Er lachte und meinte, das sei ein langer Weg. Ob ich nicht lieber mit ihm einen trinken gehen wolle? Das wollte ich nicht, und so gab er mir den Rat, mich als Erstes in einer Burse einzuquartieren. Er schickte mich zu einem Haus, das »Die Burse im Kollegium am Rheinsprung« genannt wurde.
Was eine Burse ist, wusste ich damals noch nicht. Aber ich sollte es bald erfahren. Sie ist ein Wohnort für Studenten, kostet ein bestimmtes Handgeld und ist ein Mittelding zwischen Kloster und Kastell. Disziplin geht darin über alles, und es gibt nichts, was nicht bis ins Kleinste geregelt wäre, von der Weckzeit am Morgen bis zum gemeinsamen Gebet am Abend. Doch das Wichtigste sind die Repetierstunden am Nachmittag, wenn die Inhalte von Grammatik, Arithmetik oder Dialektik wieder und wieder geübt werden. Die Aufsicht darüber hat der Leiter der Burse, der Regent. Und mein Regent sollte Johann Heinrich Wentz werden.
Er stand in der Mitte eines dichtbesetzten Raumes und verfolgte aufmerksam den Disput zweier Studenten, die mit scharfsinnigen Argumenten um die Erkenntnis rangen, ob der Tod ein Teil des Lebens sei oder das Leben ein Teil des Todes. Da mich das nichts anging, stellte ich mich in eine Ecke und hoffte, man würde mich früher oder später bemerken. Der Dialog über Leben und Tod schien mir nicht sonderlich interessant, mehr noch, ich fand ihn überflüssig. Später jedoch sollte ich erfahren, dass die Kunst des Disputierens ein wesentlicher Bestandteil des Studiums ist und dass kein Geringerer als Aristoteles das Durchspielen gegensätzlicher Positionen als geistige Übung zur Erörterung philosophischer Probleme bezeichnet hatte.
»Was machst du hier?« Wentz war auf mich aufmerksam geworden. »Hast du dich verlaufen?«
»Nein, Euer Gnaden«, antwortete ich verlegen. »Ich möchte die Freien Künste studieren.«
»Soso.« Er musterte mich von oben bis unten, und ich versuchte, einen möglichst vorteilhaften Eindruck zu machen. Ob mir das gelang, weiß ich nicht, doch nach ein paar bangen Augenblicken fragte er mich: »Wie heißt du, wie alt bist du, wer sind deine Eltern und warum glaubst du, zum Studium der Künste befähigt zu sein?«
Das alles fragte er mich auf Latein, und ich begriff, dass dies eine Prüfung war. Sollte ich sie nicht bestehen, würde er mich umgehend wieder nach Hause schicken. Also antwortete ich, so gut ich konnte, in der Sprache der Wissenschaft und erwähnte zum Schluss, dass ich sechs Jahre lang die Lateinschule in Frauenfeld besucht hätte.
Er musterte mich noch immer. Dann schürzte er die Lippen und sagte: »Du brauchst mich nicht mit ›Euer Gnaden‹ anzureden.«
»Äh, jawohl.«
»›Herr Professor‹ genügt. Das Bursengeld beträgt zwei Schilling in der Woche. Das ist für manchen recht viel, doch dafür ist das Studium umsonst.«
»Jawohl, Herr Professor.« Ich fasste mir ein Herz und fragte: »Heißt das, ich darf bleiben?«
Wentz nickte. »Dein Latein ist nicht schlecht. Von den anwesenden Herren könnte sich mancher eine Scheibe bei dir abschneiden.«
Danach erklärte er mir, an wen ich mich wenden solle, um mich in der Burse zurechtzufinden. Morgen früh müsse ich zeitig im Universitätsgebäude sein, damit ich mich einschreiben könne. Ich müsse den Immatrikulationseid leisten und abschließend sechs Schilling bezahlen. Das sei die Gebühr. Falls es Komplikationen gebe, möge ich mich auf ihn berufen, dann würde das Notwendige seinen Gang gehen.
Das alles lag vier Jahre zurück, und Johann Heinrich Wentz, den ich mittlerweile privat Johann nennen durfte, hatte mich von der ersten Stunde an unter seine Fittiche genommen und gefördert. Nicht dass ich stets ein fleißiger Student gewesen wäre – es gab andere, die ihre Nase öfter in die Bücher steckten –, aber Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit lagen einfach in seinem Wesen. Darüber hinaus war er hoch angesehen, weshalb man ihn vor zwei Jahren für ein Semester zum Rektor der Universität gewählt hatte, was einerseits eine große Ehre darstellte, ihn andererseits aber viel Zeit kostete. Zeit, die ihm fehlte, um die Repetierübungen und den Unterricht in der Burse zu beaufsichtigen. So hatte er mich nach meinem Baccalariat zum Vizeregenten ernannt und mir damit die Möglichkeit eröffnet, ein wenig Geld zu verdienen, um von den Zuwendungen meines Vaters unabhängiger zu werden.
Dennoch herrschte in meiner Geldkatze ständig Leere, und das sorgsam verpackte Geschenk, das ich Wentz nun übergeben wollte, hatte nicht gerade dazu beigetragen, meine finanziellen Verhältnisse zu verbessern. Natürlich hätte ich etwas Preisgünstigeres erwerben können, etwa ein Barett, eine Agraffe oder ein Paar Handschuhe – übliche Dinge, die andere Promovierte übergaben, um dem guten Brauch Genüge zu tun, aber ich wollte etwas ganz Besonderes schenken. Und ich war gespannt, wie Wentz darauf reagieren würde.
Ich stand auf und hob Ruhe gebietend die Arme. »Hochgeschätzter Herr Professor!«, rief ich, beugte mich zu ihm hinab und fügte leise hinzu: »Lieber Johann.«
Ich wollte weiterreden, konnte es aber nicht, weil die meisten der Anwesenden das Malvasierfässchen auf dem Zapfbock und das Zuckerwerk auf dem Tisch wichtiger fanden als meine Worte. Ich verübelte ihnen das nicht, denn ihr Leben in der Burse und ihr Alltag an der Universität waren mit Verboten gespickt. Sie durften nachts ihre Schlafräume nicht verlassen, nicht fragwürdige Häuser besuchen, nicht über die Stadtmauer klettern, sie durften nicht mit Karten oder Würfeln spielen, nicht Pluderhosen, Schlitzärmel oder gehörnte Schuhe tragen, nicht raufen, nicht trinken, nicht tanzen, sie durften keine Waffen tragen, keine Tiere halten, keine Versammlungen besuchen und keinem hübschen Mädchen hinterherpfeifen. Das Einzige, was sie durften, war lernen, lernen und nochmals lernen. Kein Wunder, dass ein Anlass wie meine Examensfeier für sie ein willkommenes Ventil war, einmal jegliche Disziplin zu vergessen.
Nach einem weiteren Versuch, mir Gehör zu verschaffen, schrie ich schließlich: »Silentium!« Das half. Wenn auch nur vorübergehend. Denn nun riefen sie mit gespieltem Entsetzen: »Eine Rede! Er will eine Rede halten!« Und Gotthold Curtius, ein hünenhafter Bursche aus dem Elsass, stöhnte: »Auch das noch.«
»Verschone uns!«, flehte Freimut Walth, den alle nur Silvanus nannten.
»Lass uns leben!« Cordt von Bechstein, ein Adliger aus der Wetterau, rang die Hände.
»Leben? Jedes Lebewesen ist ein Wesen!«, dozierte Eugenius Röist, ein Luzerner Kaufmannssohn, mit leicht verwaschener Aussprache. Es war eine Eigenart von ihm, immer dann die Argumentationsketten des Petrus Hispanus herunterzuleiern, wenn er zu viel getrunken hatte.
»Jedes Lebewesen ist ein Wesen
Jeder Mensch ist ein Lebewesen
Also: Jeder Mensch ist ein Wesen.
Kein Lebewesen ist ein Stein
Jeder Mensch ist ein Lebewesen
Also: Kein Mensch ist ein Stein …«
»Aufhören!«, ertönte es von verschiedenen Seiten, und ich rief abermals: »Ruhe!« Dann hielt ich mein Geschenk wie eine Trophäe in die Höhe. »Ihr werdet nicht erraten, was ich dem Herrn Professor zur Feier des Tages und als Zeichen meines Dankes überreichen möchte.«
In das erneut einsetzende Stimmengewirr, das überwiegend aus unsinnigen und albernen Vermutungen bestand, sagte Wentz: »Lukas, das ist doch nicht nötig.«
»Doch, das ist nötig«, beharrte ich, »und jeder, der hier sitzt, wird das bestätigen.«
»Jaja!« – »Wohl wahr!« – »Recte, der Herr!«
Ich begann meine Rede und dankte meinem Förderer mit artigen Worten, versuchte, launig die eine oder andere Episode aus dem Studium zum Besten zu geben, erlaubte mir einen oder zwei Seitenhiebe auf die träge Verwaltung der Universität und überreichte schließlich, bevor ich zu langatmig wurde, das Präsent. Wentz wickelte es umständlich aus und sagte nur: »Oooh.«
Was er in den Händen hielt, war ein Kuttrolf, ein bauchiges, aus grünem Waldglas hergestelltes Trinkgefäß mit zwei umeinandergewundenen Flaschenhälsen. Der Kuttrolf hatte mich eine Stange Geld gekostet, doch er war jeden Pfennig wert. Umso mehr, als ich sah, wie Wentz’ Augen aufleuchteten. Er war ein großer Freund der Tafelfreuden, schätzte einen guten Tropfen und war darüber hinaus von allem Schönen angetan. Trotzdem winkte er ab: »Lukas, das kann ich nicht annehmen.«
»Doch!«, rief ich. »Das müsst Ihr sogar.«
»Wie meinst du das?«
»Schaut nur genau hin.«
Das tat Wentz, und was er entdeckte, waren drei kunstvoll in den Flaschenkörper geschliffene Buchstaben: JHW – seine Initialen.
»Seht Ihr«, sagte ich fröhlich, »Ihr könnt gar nicht anders, Ihr müsst das Geschenk annehmen.«
»Wo hast du das nur aufgetrieben?«
Ich grinste. »Wird nicht verraten. Ich schlage vor, wir füllen den Kuttrolf mit Malvasier und überprüfen gemeinsam die Ausgießqualitäten der beiden Hälse.«
Mein Vorschlag wurde begeistert aufgenommen und sofort in die Tat umgesetzt. Zunächst mit Wein, dann mit Bier und zuletzt mit hochprozentigem Enzian. Und je länger meine Gäste sich von der Qualität des Kuttrolfs überzeugten, desto höhere Wellen schlug die Stimmung. Irgendwann sah sich mein gütiger Lehrer gezwungen, dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Er stemmte seine nicht unbeträchtliche Leibesfülle in die Höhe und sagte: »Liebe Kollegen, liebe Studiosi, liebe Freunde …« Und während er das sagte, wurde es – anders als bei mir – sofort still. Wentz lächelte und sprach weiter: »Bei all dem Frohsinn wollen wir nicht vergessen, dass dieses Meisterwerk der Glasbläserkunst nicht der Mittelpunkt des heutigen Abends ist.«
Er machte eine Pause, um auch die Aufmerksamkeit des Allerletzten zu gewinnen, und hob erneut an: »Ebenso wenig wie ich. Es ist vielmehr unser Freund und Kollege Lukas Nufer oder besser: Lucas Nufer ex Siegershausen, wie er in der Matrikel steht, der am heutigen Abend unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Dem möchte ich gerecht werden, indem auch ich das Wort ergreife. Nun, bekanntlich ist niemand vollkommen, deshalb werde ich für meine Rede unseren verehrten Aristoteles bemühen, dem wir die klassische Form der oratio verdanken. Aristoteles sagte dem Sinne nach: ›Durch seine Erscheinung gewinnt der Redner Vertrauen, und das ist dann der Fall, wenn er als rechtschaffener oder freundlich gesinnter Mensch oder beides überzeugt.‹ Nun, ich bin nicht sicher, ob mir das gelingen wird, aber …«
Wie erhofft, protestierten einige der Anwesenden.
»Gut, gut. Offenbar ist es mir halbwegs gelungen, das Wohlwollen deiner Gäste, lieber Lukas, sowie deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nach der Schilderung des Sachverhaltes – in diesem Fall dein heute bestandenes Examen und die damit verbundenen Begleitumstände – will ich zur Beweisführung kommen, das heißt, ich will nach allen Regeln der Kunst darlegen, warum du dein Examen mit Auszeichnung bestanden hast, und ich verspreche, meine Ausführungen nach nicht allzu langer Rede zu beenden, um mich auf diese Weise noch einmal des Wohlwollens aller Anwesenden zu versichern …«
So sprach er, und die Rede, die er hielt, war sehr schön. Gehalten in geschliffenem, elegantem Latein. Lediglich die Passage, in der er ein Loblied auf meine Artistenkünste anstimmte, brachte mich ein wenig in Verlegenheit. Umso erleichterter war ich, als der bezechte Eugenius Röist plötzlich dazwischenlallte:
»Jedes Lebewesen is ein Wesen
Irgendein Mensch ist ein Lebebesen, äh, -wesen
Äh, also: Irgend’n Mensch is ein Wesen …«
Er wurde zum Schweigen gebracht. Wentz fuhr fort, als wäre nichts geschehen: »Lieber Lukas, du hast deinen Magister wie heutzutage üblich nach der Methode der Via moderna gemacht und zählst damit zum großen Kreis der Nominalisten, jener also, für die ein Begriff wie ›Glück‹ lediglich ein Name ist, ein Ab-straktum, das nur dann real wird, wenn es mit etwas anderem eine Bedeutung erlangt, etwa als Glückspfennig, als Liebesglück, als Glücksgöttin. Nun, der ›glückliche‹ Umstand, dem wir diesen Abend zu verdanken …«
»Kein Lebewesen is ein S… Stein
Irgend’n Mensch is ein Lebewesen
Also: Irgend’n Mensch is kein Stein …«
»Jaja, schon gut.« Der Nachbar von Eugenius Röist, ein junger Bursche namens Wolfhart Schaler, hielt ihm energisch den Mund zu. Der Betrunkene gab einen gurgelnden Laut von sich.
»Jedes Lebebesen-wesen is ein …«
Wentz lächelte etwas gequält und wiederholte: »… der ›glückliche‹ Umstand, dem wir diesen Abend zu verdanken haben, ist dein bestandenes Examen, lieber Lukas. Und um weiter im Terminus zu bleiben: Du bist ein Glückspilz, der …«
Wieder wurde er unterbrochen, doch diesmal war es das Geräusch quietschender Angeln, als eines der Bleiglasfenster von der Straße her aufgerissen wurde. In der Öffnung erschien ein Pferdekopf, und eine Stimme rief: »Gratulatio, lieber Lukas! Der Examensschmaus oder besser: die Prandia Aristoteles, wie man als gelehrter Herr zu sagen pflegt, ist also schon in vollem Gange!« Da der Gaul in diesem Augenblick das Maul bewegte, sah es aus, als wäre er es gewesen, der gesprochen hatte. Welch erheiternder Anblick!
Doch schon erschien neben dem Pferdekopf ein Menschenkopf. Er gehörte Pisculus Caerulus – einem leicht verrückten, aber liebenswerten Artisten, der nichts als Flausen im Kopf hatte und deshalb sein Studium ständig vernachlässigte. Dieser Bursche war es auch gewesen, der mir an meinem ersten Tag in Basel vorgeschlagen hatte, mit ihm einen trinken zu gehen. Sein eigentlicher Name war Fischel Blau – die deutsche Übersetzung von Pisculus Caerulus.
»Gratulatio, Lukas!«, rief Fischel noch einmal. »Ich hatte soeben das Vergnügen, die letzten Sätze unseres hochverehrten Herrn Professors durch den Fensterspalt mit anzuhören und stimme voll und ganz mit ihm überein: »Glück ist nur ein Name, ein nomen, ein Abstraktum, eine Buchstabenfolge aus G-l-ü-c-k, die für jeden anderen Begriff stehen könnte, wenn die Erfinder des Alphabets es so gewollt hätten.«
»Mein lieber Pisculus!« Wentz zog die buschigen Augenbrauen hoch. Sein gütiges Gesicht wirkte nicht mehr ganz so gütig. »Wenn ich nun fortfahren dürfte …«
»Aber selbstverständlich, Herr Professor! Ich habe mir nur erlaubt, ganz Eurer Meinung zu sein. Lasst mich für Euch ergänzen: Wenn Glück nur eine Buchstabenfolge ist, die für jeden anderen Begriff stehen kann, dann könnte Glück auch Pech bedeuten. Oder Dienstag. Oder Wassermelone. Habe ich recht?«
»Pisculus, bitte!«
»Verzeihung, Herr Professor, nur diesen einen Satz noch.« Fischel schaute mich spitzbübisch an und sprach mit einigem Pathos: »Glück Glück, Glück Glück Glück Glück Glück Glück! Glück Glück Glück Glück Glück Glück Glück Glück Glück.«
Wentz wurde nun sichtlich ärgerlich. Doch bevor er Fischel zurechtweisen konnte, sagte dieser mit treuherzigem Augenaufschlag: »Verzeiht, Herr Professor, ich habe nur mein eigenes Verständnis des Nominalismus zum Ausdruck gebracht und gesagt: ›Lieber Lukas, ich freue mich sehr für dich! Du wirst eines Tages sicher ein großartiger Arzt sein.‹ Mehr nicht.«
»Du wirst morgen zwei Stunden extra aus dem Doctrinale repetieren!«
»Jawohl, Herr Professor.« Fischel gab sich zerknirscht. Dann wackelten er und das Pferd gleichzeitig mit dem Kopf. Es sah seltsam lächerlich aus, und ich dachte, jetzt treibt er es zu weit, doch dann wurde mir klar, dass es nicht nur ihm, sondern uns allen so ergangen war. Wir alle hatten gezuckt. Unfreiwillig. Und schon wieder schien uns eine unsichtbare Kraft durchzuschütteln. Der Boden unter uns erzitterte. Das Gebälk über uns ächzte. Putz und Staub fielen herab. »Ein Erdbeben!«, schrie jemand. »Ein Erdbeben!« Alles hastete zur Tür. Ein Dachbalken fiel mit Getöse herab und begrub mehrere Gäste unter sich. Ein zweiter folgte. Schreien, Husten, Hilferufe. Ich bekam einen Stoß in die Seite, wirbelte herum, verlor das Gleichgewicht. Mühsam rappelte ich mich hoch. »Unter den Tisch!«, rief ich. »Kriecht alle unter den Tisch!« Ich packte Wentz, der mit weit aufgerissenen, ungläubigen Augen auf das Tohuwabohu starrte. »Unter den Tisch, Johann!« Ich drückte ihn zu Boden, wollte ihn unter den Tisch drängen, doch es gelang nicht. Da warf ich mich über ihn, um ihn zu schützen.
»Lukas, pass auf!«, hörte ich ihn unter mir stöhnen, doch das nahm ich kaum noch wahr. Ich hatte das Gefühl, jemand würde ein schwarzes Laken über mich werfen. Mir schwanden die Sinne.
Eine große Leere umfing mich.
Als ich aufwachte, blickte ich in ein strenges Gesicht, das umrahmt war von einer großen weißen Haube. Es war das Antlitz einer Nonne, die mir mit einem feuchten Tuch die Stirn kühlte. »Wo bin ich?«, fragte ich. »Wie komme ich hierher? Wo sind die anderen?«
»Fragt nicht so viel auf einmal. Ihr habt noch Fieber. Ihr müsst Euch ausruhen.«
Die Nonne, eine Frau mittleren Alters, legte das Tuch zur Seite und schlug ein Kreuz. »Jesus Christus sei Dank, dass Ihr wach geworden seid. Es scheint, als hättet Ihr das furchtbare Beben unbeschadet überstanden.«
»Das Beben? Ach ja …« Plötzlich waren sie wieder da, die schrecklichen Bilder. Sie drängten sich mir auf, packten mich, ließen mich erschauern. Doch ich wollte sie nicht sehen. Ich musste einfach an etwas anderes denken. »Wo bin ich?«, fragte ich abermals.
»Ihr seid im Spital am Barfüßerplatz. Gottlob ist es eines der wenigen Gebäude im Quartier, das nichts abbekommen hat.«
»Was ist mit den anderen?«
»Ihr meint Herrn Professor Wentz und die Gäste Eurer Examensfeier? Der Professor liegt in der Bettenreihe gegenüber, fünf weitere Herren wurden ebenfalls aufgenommen.«
»Ich muss zu ihnen.«
»Ihr müsst gar nichts, außer gesund werden.« Der Ton der Nonne ließ keinen Widerspruch zu.
»Ihr habt eben selbst gesagt, dass ich das Erdbeben unbeschadet überstanden habe.«
»Mag sein. Aber Euer Zustand erlaubt es nicht.«
»Wer seid Ihr überhaupt, dass Ihr so mit mir redet?«
»Ich bin Schwester Edelgaard. Und nun schlaft weiter.«
Ich sah ein, dass ich der strengen Frau nicht gewachsen war, und gab nach. »Nun gut«, sagte ich, »vielleicht schlafe ich ein bisschen. Aber danach muss ich zu Wentz.«
»Jaja.« Sie tätschelte mir flüchtig das Gesicht, wie man es bei einem Kind tut, und entfernte sich. Ich blickte mich um. Ich lag in einem Saal mit zwanzig Betten, jedes aus groben Latten gezimmert, versehen mit Strohmatratzen und Bettzeug aus Nesselgarn. Insgesamt zehn auf jeder Längsseite. In den Wänden befanden sich quadratische Fenster, deren Läden geöffnet waren. Dazwischen hatte man einfache Öllämpchen aufgehängt. Viel Tageslicht drang nicht durch die Fenster. Alles in allem wirkte der Saal wenig einladend. Ein trister Ort, um gesund zu werden.
Nach einem weiteren Blick, der mir verriet, dass die schroffe Schwester den Saal verlassen hatte, schwang ich die Beine aus dem Bett und erhob mich. Das heißt, ich bemühte mich darum, denn der erste Versuch scheiterte kläglich. Erst beim zweiten Mal kam ich halbwegs auf die Füße. Vor meinen Augen drehte sich alles, mein Kopf brummte. Ich vermutete, dass ich eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Wahrscheinlich hatte die strenge Nonne recht gehabt, als sie mich aufforderte weiterzuschlafen.
Ich wartete eine Weile und ging dann mit staksenden Schritten hinüber zu meinem Lehrer. Wentz lag, das Gesicht halb verbunden, in seinem Bett. Sein linker Arm ruhte fixiert in einer Bruchlade. Er war wach. »Johann«, sagte ich leise, »wie geht es dir?«
»Lukas«, fragte er verwundert, »du bist aufgestanden?«
»Wie du siehst.« Trotz meines Schwindelgefühls musste ich grinsen. Eine so überflüssige Frage hätte mein Lehrer unter normalen Umständen nicht gestellt. »Was fehlt dir?«, wollte ich wissen.
»Ach, nichts weiter. Ein paar Kratzer im Gesicht und ein glatter Bruch von Elle und Speiche. Die Knochenflicker haben alles wieder geradegezogen und geschient, wie du siehst.«
Ich sah mir das Werk der Wundärzte genau an und fragte dann: »Hast du Schmerzen?«
»Ach, es geht.« Er bewegte sich mühsam, um seine Lage zu verändern. »Die Schwester, dieser weibliche Drache, hat mir Mohnsaft gegeben. Damit lässt sich’s ertragen.«
»Was ist denn in deinem Haus geschehen? Ich kann mich an nichts mehr erinnern.«
»Das glaube ich dir. Du lagst ja auf mir wie tot. In gewisser Weise warst du der Tisch, unter den du mich zerren wolltest.« Wentz räusperte sich und begann zu erzählen. Er berichtete, dass er mich noch vor dem herabfallenden bronzenen Deckenleuchter habe warnen wollen, aber es sei zu spät gewesen. Der Leuchter habe mich am Kopf getroffen und sei dann scheppernd zu Boden gefallen.
Unwillkürlich betastete ich meinen Schädel und erfühlte am Hinterkopf eine gewaltige Beule. Sie also war der Grund für meine Schwindelanfälle.
Wentz erzählte weiter. Ihm selbst sei kein Haar gekrümmt worden, was er allein mir zu verdanken habe. Allerdings habe das tückische Beben zu einem Zeitpunkt, als die Aufräumarbeiten in vollem Gange waren, erneut eingesetzt. Mehrere Erdstöße hätten sein Haus vollends zum Einsturz gebracht und ihn, den Hausherrn, dieses Mal nicht verschont. Doch er habe insgesamt gesehen noch Glück gehabt, denn Eugenius Röist, dem betrunkenen Deklamierer, habe man ein Bein amputieren müssen. Ob er überleben werde, wisse nur Gott allein. Freimut Walth habe ein paar hässliche Quetschwunden und Einblutungen am Körper davongetragen, Gotthold Curtius mehrere Gliedmaßen verrenkt und Cordt von Bechstein ein paar Rippen gebrochen, überdies stecke ihm ein fünf Zoll langer Splitter im Oberschenkel. Der Wundbrandgefahr wegen müsse der Splitter beizeiten herausoperiert werden, sofern einer der vielbeschäftigten Wundärzte Zeit dazu fände. So habe jeder das Seine davongetragen, der eine mehr, der andere weniger, aber für drei unserer Bursarier sei jede Hilfe zu spät gekommen. Sie seien in den Trümmern seines Hauses gestorben. Er nannte die Namen, und ich schwieg betroffen. »Woher weißt du das alles?«, fragte ich schließlich.
Wentz lächelte schwach. »Mein lieber Lukas. Du scheinst nicht zu wissen, wie lange du ohnmächtig warst. Das Erdbeben liegt bereits zwei Tage zurück. Es hat Verwüstungen in vielen Quartieren der Stadt angerichtet. Die Erdstöße sollen so schlimm gewesen sein wie bei den großen Beben anno 1356 und 1444, als halb Basel in Schutt und Asche lag. Gott gebe, dass es diesmal nicht so schlimm ist. Das ganze Ausmaß der Zerstörungen wird man wohl erst in ein paar Wochen kennen.«
»Bis dahin bist du sicher wieder gesund.« Mir lagen noch mindestens ein Dutzend Fragen auf der Zunge, aber Wentz würde die wenigsten davon beantworten können. Außerdem wollte ich ihn schonen. Ich musste mir selbst Klarheit verschaffen. »Gute Besserung, Johann«, sagte ich und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich will mal nach den anderen sehen.«
»Tu das«, sagte er.
Am nächsten Morgen fühlte ich mich deutlich kräftiger, was ich Schwester Edelgaard auch umgehend mitteilte, als sie an meinem Bett erschien. Sie schaute mich prüfend an, fühlte mir den Puls und entschied: »Ihr müsst liegen bleiben. Glaubt nicht, ich hätte nicht gesehen, wie Ihr gestern trotz meines Befehls, weiterzuschlafen, zum Herrn Professor hinübergewankt seid.«
»Aha.« Ich wollte sie fragen, warum sie meine Zuwiderhandlung nicht unterbunden habe, verkniff es mir aber. Mit der Frau war wirklich nicht gut Kirschen essen. Ich ließ ihre Pflegebemühungen, die im Wesentlichen in der Darreichung eines heißen, wie Hühnergalle schmeckenden Tranks bestanden, über mich ergehen und dankte innerlich dem Herrgott, als sie wenig später den Saal verließ. Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass sie tatsächlich fort war, raffte ich meine Kleider zusammen und stahl mich hinaus. Im angrenzenden Wirtschaftsgebäude fand ich eine Kammer, in der ich mich unbemerkt ankleiden konnte. Ich war in diesem Augenblick froh, dass mir wegen der kostspieligen Examensfeier das Geld gefehlt hatte, mich als frischgebackener Magister standesgemäß einzukleiden. Denn das kuttenähnliche, schlichte Kapuzengewand, das für jeden Bursarier Vorschrift war, ließ sich viel schneller überstreifen als Hemd, Spitzenkragen, seidene Beinkleider, Wams, Mantel, Handschuhe und was sonst noch zur Ausstattung eines promovierten Herrn gehörte.
Auf leisen Sohlen verließ ich das Spitalgelände und betrat die Straße. Ich war auf einiges gefasst, aber was ich erblickte, war ärger als alles, was ich jemals gesehen hatte. Der Barfüßerplatz, auf dem zuvor der Holzmarkt abgehalten worden war, lag da wie eingeäschert. Über weite Strecken stand kein Stein mehr auf dem anderen, Schutt und Trümmer bedeckten die Wege. Keine spielenden Kinder waren zu sehen, keine schwatzenden Mägde, keine fliegenden Händler. Aus dem einst fröhlichen, lebenssprühenden Basel war eine Totenstadt geworden. Nur ab und zu begegnete ich einer Gruppe Männer mit Schaufeln und Hacken, die unter ständigem Rufen nach Überlebenden in den Ruinen arbeitete. Vereinzelt streunten Hunde herum, auf der Suche nach etwas Fressbarem.
Unten am Rhein kam ich zur Ulrichskirche und zum Münster. Ich hielt den Atem an. Das Dach des Kirchenschiffs war eingebrochen, als hätte eine riesige Faust es gespalten. Weiter ging ich und kam zu den Universitätsgebäuden. Auch sie hatten stark unter den Erdstößen gelitten. Ob unter diesen Umständen Lesungen gehalten werden konnten, schien mir kaum wahrscheinlich.
Ich ging weiter, wie benommen von den düsteren Eindrücken. Plötzlich stolperte ich, und ein leises Fiepen drang an mein Ohr. Ich blickte nach unten. Zu meinen Füßen sah ich ein kleines schwarzes Knäuel. Ein Hundewelpe. Von Hunden verstand ich nicht viel und noch viel weniger von Hunderassen, aber trotz meiner geringen Kenntnis glaubte ich zu erkennen, dass es sich um einen Mischling handelte. Es war ein kleiner Rüde. Er schaute mich aus großen und – wie ich mir einbildete – vorwurfsvollen Augen an. Sein linkes Ohr war abgeknickt, was ihm einerseits einen unvollkommenen, andererseits einen verwegenen Ausdruck verlieh. Wie der Kleine vor meine Füße gelaufen war, konnte ich mir nicht erklären. Vielleicht hatte er den Kontakt zu seiner Mutter verloren. Ich ging drei Schritte – und blieb stehen. Das kleine Gesicht wollte mir nicht aus dem Sinn. Der Welpe würde sterben, wenn ich ihn seinem Schicksal überließ. Niemand würde sich um ihn kümmern.
Andererseits war es nur ein Hund. Ich ging weiter und blieb wieder stehen. Dann kehrte ich um. Ich nahm den Kleinen auf. Er war so winzig, dass er bequem auf meine Handfläche passte. »Ich werde dich mitnehmen«, sagte ich zu ihm. »Vielleicht finde ich jemanden, der sich um dich kümmert.« Dann steckte ich ihn in die Tasche meiner Kutte.
Ohne es recht zu merken, lenkte ich meine Schritte zum Kollegium, in dessen Mauern meine Burse lag. Zu meiner Verblüffung sah ich, dass sie kaum Schaden genommen hatte. Vor dem Eingangstor begegnete ich einem kleinen, drahtigen Burschen. Es war Fischel. Er führte sein Pferd am Zügel und wirkte lange nicht so aufgekratzt wie vor zwei Tagen. Aber das war angesichts der grausamen Ereignisse kein Wunder. »Salve, amicus«, sagte er.
»Ich grüße dich auch, mein Freund«, antwortete ich. »Du scheinst einer der wenigen zu sein, denen das Beben nichts anhaben konnte.«
»Dir, wie’s scheint, aber auch nicht. Obwohl du wie ein Fuchs in der Falle saßest.«
»Du meinst, im Haus von Wentz?«
»Das meine ich. Du hast unglaublichen Massel gehabt. Viele sind verletzt worden, auch der Professor. Wie man hört, hat es drei von unseren Bursariern sogar tödlich erwischt.«
»Ich weiß, ich komme gerade aus dem Spital.«
Fischel ging nicht darauf ein. Er fuhr fort: »Hunderte sind in ihren vier Wänden verschüttet oder getötet worden. Da haben Aaron und ich noch Glück gehabt.« Er tätschelte seinem Braunen den Hals. »Aber wir waren ja auch nicht drin in Wentz’ Falle, sondern standen davor.«
»Das tatet ihr.« Ich musste daran denken, dass Fischel nicht wie so viele Baseler Studenten ein Sohn der Eidgenössischen Ehrbarkeit war, sondern jüdischer Abstammung. Und als Jude hatte er nicht an meiner opulenten Feier mit Malvasier, Bier, Enzian und Zuckerwerk teilnehmen dürfen. Das verbot ihm die Kaschrut,