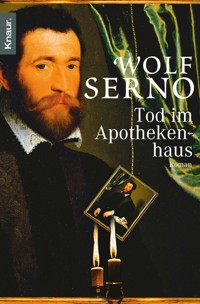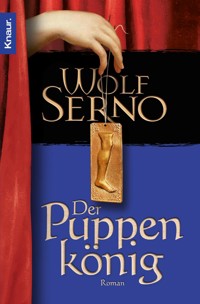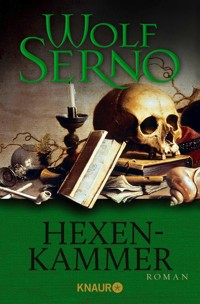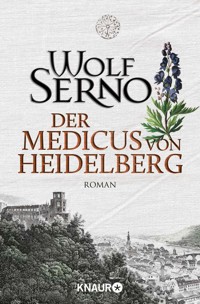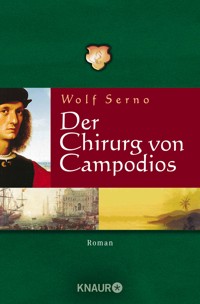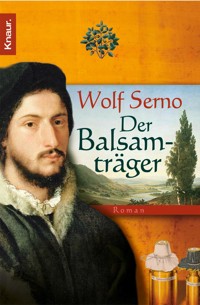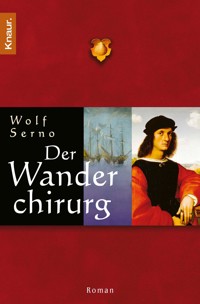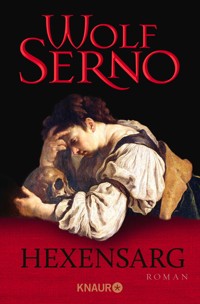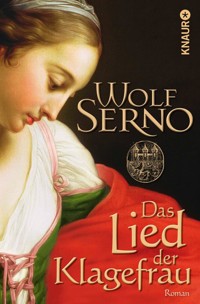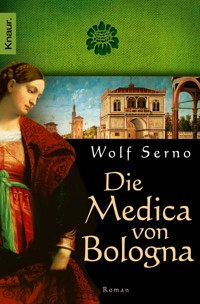
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bologna 1552. Mit einem entstellenden Feuermal – für die Inquisition ein Schandmal der Sünde – kommt Carla zur Welt. Um sich von diesem Makel zu befreien, träumt sie davon, eine Medica zu werden. Doch ein Medizinstudium ist ihr als Frau verwehrt. Sie gibt nicht auf. Heimlich besucht sie Vorlesungen an der Universität, wo der charismatische Chirurg Gaspare Tagliacozzi die Kunst der Gesichtsoperationen lehrt. Sie hofft auf seine begnadeten Hände und verliebt sich dabei rettungslos in ihn. Doch Gaspare, der ihre Liebe nur zum Schein erwidert, schickt sie auf eine tödliche Mission … Die Medica von Bologna von Wolf Serno: Historischer Roman im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolf Serno
Die Medica von Bologna
Roman
Knaur e-books
Für alle Zwei- und Vierbeiner in meinem Rudel: Micky, Fiedler († 16), Sumo, Buschmann († 9), Eddi und Olli
»Weil ich hier keinen hab, Gespräch zu treiben,
muss ich, befriedigend mein heißes Streben,
Dir, was ich Gutes denk und sinne, schreiben.«
Dante Alighieri (1265 – 1321)
Der interessierte Leser findet am Ende des Buches einen Anhang mit sechs Abbildungen, die deutlich machen, wie im 16. Jahrhundert eine Nasenrekonstruktion durchgeführt wurde.
Teil 1
Marco
Das Feuermal
La voglia di vino
ch bin eine vergessene Frau. Von den achtundvierzig Jahren, die ich auf dieser verrückten Welt lebe, habe ich die letzten sechzehn Jahre in strenger Abgeschiedenheit verbringen müssen, getrennt von den Menschen, die mir nahestanden, verlassen von ihrer Liebe, ihrer Güte, ihrer Treue.
Zum Schweigen verdammt.
Sechzehn Jahre sind eine halbe Ewigkeit, in der ich mühsam gelernt habe, mich in mein Schicksal zu fügen und meinen Kopf in Demut zu beugen. Und doch: Immer wieder denke ich, dass ich meine Stimme erheben und die Geschichte meines Lebens erzählen soll. Nicht, um meiner Eitelkeit Genüge zu tun, sondern um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Ich will deshalb die Dinge beim Namen nennen, ich will berichten, wie sie wirklich waren, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne schmückendes Beiwerk und ohne etwas zu verschweigen. Denn die Wahrheit, so heißt es, ist unteilbar, und schon die halbe Wahrheit kommt einer Lüge gleich.
Wer diese Zeilen liest, wird es wahrscheinlich in einer fernen Zeit tun, wenn die Arkaden der Universität von Bologna schon lange nicht mehr stehen und der Wind ihre Überreste bis zur Unkenntlichkeit glattgeschliffen hat. Unzählige Wasser werden bis dahin den Reno und die Savena hinabgeflossen sein, doch die Wahrheit wird ihre Gültigkeit behalten, denn sie ist unabänderlich bis zum Tage des Jüngsten Gerichts.
Mein Name ist Carla Maria Castagnolo. Ich wurde anno 1552 im Zeichen des Widders geboren, weshalb ich die Eigenschaften dieses Sternzeichens von jeher im Blut habe: das heiße Herz und den kühlen Kopf. Feuer und Wasser waren es, die in mir um die Oberhand rangen, solange ich denken kann. Doch war ich bisweilen auch halbherzig, eigensinnig und sogar rachsüchtig, was dazu führte, dass ich mir selbst im Wege stand und mich hasste. So manches Mal war mein Fleisch stärker als mein Kopf, mein Eigensinn größer als die gebotene Einsicht. Viele Fehler habe ich deshalb in meinem Leben gemacht, Fehler, aus denen ich gelernt habe, auch wenn ich keineswegs sicher bin, ob ich einige von ihnen nicht wiederholen würde – denn mein Wille, die Welt gerechter zu machen, ist ungebrochen.
Vor Gott sind alle Menschen gleich, so steht es in der Heiligen Schrift. Doch warum gilt ein Bauer weniger als ein Adliger, ein Armer weniger als ein Reicher, eine Frau weniger als ein Mann? Warum soll das Leben des Einfältigen weniger wert sein als das des Klugen, das Leben eines Sklaven weniger als das seines Herrn?
Und warum ist das Geschick des Arztes umso größer, je schwerer der Geldbeutel des Kranken wiegt?
Wir alle werden nackt und ohne Sünde geboren. Jedes Kind, ob Junge oder Mädchen, wird von Gott gleichermaßen geliebt und hat für die Dauer seines Lebens den gleichen Anspruch auf Gesundheit, Geborgenheit und Entfaltung – unabhängig davon, in welches Haus es hineingeboren wurde. Das ist die Erkenntnis, die der Wahrheit entspringt. Der ganzen Wahrheit.
Warum erzähle ich das alles? Weil ich, bevor meine Geschichte beginnt, keinen Zweifel daran lassen will, wie ich denke. Und weil ich deutlich machen will, wie das Glas gefärbt ist, durch das ich die Welt betrachte.
Während ich dieses sage, liegt meine Hand auf einer goldenen Maske. Es ist eine Venusmaske, gewidmet der Göttin der Liebe, des Verlangens und der Schönheit. Sie ist kühl und glatt, und die Berührung mit ihrer Oberfläche inspiriert meine Sinne. Ihr Schein ist so funkelnd hell, dass sie sogar einen dämmrigen Raum mit Licht erfüllen kann. Warum sie das Kostbarste ist, was ich noch besitze, werde ich später berichten, ebenso, wie ich später von meinem Diener Latif berichten werde, der sich bereit erklärt hat, diese meine Worte aufzuschreiben. Latif ist treu und verschwiegen, und nichts Menschliches ist ihm fremd. Er wird mir helfen, meine Geschichte festzuhalten – auch dann, wenn es um Dinge geht, über die ich eigentlich niemals sprechen wollte.
Denn ich selbst kann nicht mehr schreiben. Seit einigen Jahren hat mich die Schüttellähmung geschlagen, eine Krankheit, die sich neben anderen tückischen Symptomen im Zittern der Hände äußert. Doch ich will nicht klagen, finchè c’e vita, c’e speranza, wie es heißt.
Also fange ich an.
Meine erste Erinnerung, ich war drei oder vier Jahre alt, ist ein Streit. Ein heftiger Streit zwischen zwei Frauen, von denen ich nur eine kannte – meine Mutter. Die andere Frau hieß Signora Donace. Sie war eine Kundin meiner Mutter, die als Schneiderin für die vornehmen Damen Bolognas arbeitete. Doch Signora Donace wirkte an jenem Morgen alles andere als vornehm, denn sie schrie wie das Weib eines Kesselflickers, während sie ein Kleid in die Höhe hielt und heftig an dessen Ärmeln zerrte. Das Kleid kam mir riesengroß vor, so groß wie eine Wolke am Himmel, nur dass es nicht weiß war, sondern feuerrot. Es war gänzlich aus Seidenorganza gefertigt, mit hochgesetzter Taille und tiefem Dekolleté. Das Mieder und die Oberärmel zierten filigrane Goldgitter, und an den Seiten wurde es mit farblich zu den Gittern passenden Schnürungen geschlossen.
Aber all das wusste ich damals noch nicht. Ich sah nur die gewaltige rote Wolke, während die Worte der fremden Frau wie ein Wasserfall auf meine Mutter einstürzten: Sie habe keine festgenähten, sondern abnehm- und austauschbare Ärmel gewollt, zeterte Signora Donace, Ärmel, die resedagelb seien, Ärmel, die im unteren Bereich weiter seien, bauschiger, großzügiger, Ärmel, die überdies Schlitze aufwiesen, tiefe Schlitze, wie es die Mode vorschriebe, ob die hochgelobte Signora Castagnolo noch nie etwas von der neuesten Mode gehört habe, mit diesem Fetzen könne sie sich als Gattin eines Patriziers niemals auf der Piazza Maggiore sehen lassen, sie würde sich vor ihren Freundinnen unsterblich blamieren und so weiter und so weiter.
Je lauter Signora Donace wurde, desto leiser sprach meine Mutter. Sie wandte immer wieder ein, sie habe nur angefertigt, was die gnädige Frau bei ihr in Auftrag gegeben hätte. Genau das habe sie getan, mehr könne sie doch nicht tun.
Die Signora schimpfte weiter und herrschte meine Mutter an, was sie sich einbilde, ob sie eine Dame der ersten Gesellschaft Bolognas Lügen strafen wolle, das ginge nun wirklich zu weit. Das müsse sie sich nicht bieten lassen. Und sie riss die rote Wolke hoch und schleuderte sie wütend von sich.
Ich hatte mich bis dahin hinter den Stoffballen neben dem Schneidertisch aufgehalten und dort mit meinen Puppen gespielt, doch durch den immer lauter werdenden Streit bekam ich Angst und wollte fortlaufen. Ich kam nicht weit. Denn die rote Wolke flog auf mich zu, füllte plötzlich das ganze Zimmer aus und begrub mich unter sich. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich strampelte. Ich verhedderte mich, konnte nicht vor und zurück. Panik stieg in mir hoch, ich begann aus Leibeskräften zu brüllen.
»Wer schreit da so?«, begehrte Signora Donace zu wissen. »Ist das ein Kind?«
»Ja, Signora«, antwortete meine Mutter, »es ist meine Tochter.«
»Ihr solltet ihr das Schreien abgewöhnen. Es zeugt von schlechtem Benehmen!«
»Ja«, sagte meine Mutter tonlos.
Signora Donace entfernte sich rasch.
Sie kam nie wieder.
Einige Jahre später, ich erinnere mich noch genau, bat ich meine Mutter, sie zu einer Kundin in die Stadt begleiten zu dürfen. Wir wohnten damals in einem einfachen Haus am Ende der Strada San Felice, im äußersten Westen, wo das Stadtbild noch weitgehend von Feldern und Wiesen geprägt war. Die Menschen, die dort lebten, hatten wenig zu beißen, und auch meine Mutter fragte sich oftmals am Morgen, was sie am Abend kochen sollte. Doch das wusste ich natürlich nicht, meine Sorgen waren ganz anderer Art. Mich reizte die große Stadt, deren Dächer und Türme täglich aus der Ferne herübergrüßten und deren Geräusche in meinen Ohren wie das Summen von tausend Bienen klangen.
»Kann ich mit, Mamma?«, fragte ich.
»Nein, Carla.« Meine Mutter schüttelte den Kopf. »Es ist besser, wenn du hierbleibst.«
»Bitte, Mamma! Ich war noch nie mit, immer lässt du mich allein.«
»Glaub mir, es ist besser so.«
»Nur dieses Mal, bitte!« Ich begann zu weinen. Die Aussicht, wieder viele Stunden auf meine Mutter warten zu müssen, bedrückte mich. Es gab keine Menschenseele, die mir während ihrer Abwesenheit Gesellschaft leisten konnte, denn ich hatte weder Geschwister noch Verwandte. »Bitte, bitte!«
Meiner Mutter fiel es schwer, mir meinen Wunsch abzuschlagen, das sah ich, deshalb weinte ich noch lauter, doch der Moment ihres Zögerns war schon vorbei. »Sei vernünftig«, sagte sie, »ich bin bald zurück, und wenn Signora Vascellini heute ihre Rechnung bezahlt, kaufe ich ein Hühnchen auf dem Markt und koche uns eine Suppe.«
»Nein!« Ich stampfte mit dem Fuß auf. »Nein, nein, nein!« Aber auch dieser Protest half nichts. Meine Mutter seufzte nur und wandte sich ab. Ich sah, wie sie den großen Weidenkorb nahm, in dem sie die Produkte ihrer Nähkunst zu transportieren pflegte, und auf die Haustür zuging. »Du kannst nicht mitkommen, Carla. Wenn du älter bist, wirst du verstehen, warum es nicht geht. Nun weine nicht mehr. Arrivederci, meine Kleine.«
Die Tür fiel ins Schloss, meine Mutter sperrte von außen ab, und ich blieb zurück.
Ich schluchzte noch ein wenig, dann beruhigte ich mich. Es machte keinen Sinn mehr, zu weinen. Ich setzte mich im Schneidersitz auf den Boden und nahm Bella, meine Lieblingspuppe, auf den Arm. Ich begann, sie hin und her zu wiegen, und fragte: »Bella, warum nimmt Mamma mich nie mit?« Aber Bella, die wie alle meine Puppen sprechen konnte, schwieg diesmal.
Das verdross mich. Ich legte sie zurück in ihr Bettchen und stand auf. Mein Blick ging zur Tür, durch die meine Mutter vor wenigen Augenblicken verschwunden war. »Ich will zu den Bienen«, murmelte ich, »ja, zu den Bienen.« Und kurz entschlossen schlüpfte ich durch das offene Fenster, das auf der Hinterseite des Hauses zum Garten hinauswies.
Als ich draußen war, musste ich wegen der grellen Sonne blinzeln, aber ich war den Weg in die Stadt schon so viele Male in Gedanken gelaufen, dass ich mich sogar blind zurechtgefunden hätte. Meine Mutter, die an diesem Tag ein hochgeschlossenes Kleid aus lindgrünem Tuch und ein mit Glasperlen verziertes Haarnetz trug, war schon ein gutes Stück entfernt. Sie hatte bereits die Brücke passiert, die über den Canale di Castiglioni führte, und auch die kleine Kirche Santa Maria de la Carità hinter sich gelassen. Ich fing an zu rennen und hatte sie bald darauf eingeholt. Damit sie mich nicht entdeckte, ging ich auf der anderen Straßenseite und folgte ihr im Schatten der Häuser.
Je näher wir der Stadt kamen, desto belebter wurde die Strada San Felice. Staunend beobachtete ich, wie immer mehr Menschen vor mir auftauchten, Menschen, die in unterschiedlichste Richtungen strebten, bunt gekleidet, schwatzend, lachend, pfeifend oder fluchend, dazwischen Karren, Kutschen und oftmals ein Reiter, der hoch zu Ross vorbeipreschte. Immer wieder blieb ich stehen, um zu schauen. Ich konnte mich nicht sattsehen an dem lebhaften Treiben um mich herum.
Viel fehlte nicht, und ich hätte meine Mutter aus den Augen verloren, denn plötzlich wandte sie sich nach links und schlug den Weg zur Piazza Maggiore ein. Dieser belebte Platz im Zentrum Bolognas dient seit jeher vielerlei Zwecken; er ist der Ort für Feste, Paraden und Versammlungen, für Märkte und Messen und sogar für Hinrichtungen, die vor dem Palazzo del Podestà stattfinden. Vor allem aber ist dort der große Neptunbrunnen, Fontana del Nettuno genannt, ein Treffpunkt für alle Bürger der Stadt.
Meine Mutter jedoch schien niemanden auf dem Platz treffen zu wollen. Sie schritt zielstrebig über die weiträumige Fläche und bog bald darauf in die Via de Foscarari ein, wo sie in einem prächtigen Patrizier-Palazzo verschwand.
Unbemerkt folgte ich ihr und stand wenig später vor der hohen zweiflügeligen Eingangstür. Wieder eine Tür, die im Weg ist, dachte ich enttäuscht. Doch während ich noch unschlüssig von einem Bein aufs andere trat, bemerkte ich, dass einer der Flügel nicht ganz geschlossen war.
Sollte ich es wagen?
Ich wagte es. Ich nahm all meinen Mut zusammen und betrat das große Haus. Drinnen empfingen mich Kühle, Halbdunkel und ein unangenehmer Geruch nach abgestandenen Speisen. Ich fröstelte. Mein Herz, das mir zuvor schon bis zum Hals geklopft hatte, begann zu rasen. Angst kroch in mir hoch. Nein, hier wollte ich auf keinen Fall bleiben! Doch plötzlich hörte ich Stimmen aus dem oberen Stockwerk. Ich lauschte. Eine davon war mir vertraut. Sie gehörte meiner Mutter. Welch eine Erleichterung! Wo meine Mutter war, war Sicherheit. Schnell lief ich die Stufen der großen Treppe empor und stürmte in das Zimmer, aus dem die Stimmen kamen. Ich war froh, das Verfolgungsspiel beenden zu können, sehr froh sogar. Und weil ich mich so freute, war ich sicher, dass meine Mutter sich ebenfalls über das unverhoffte Wiedersehen freuen würde.
Es kam ganz anders. Als sie mich erblickte, riss sie den Mund auf, als sei der Leibhaftige in sie gefahren, und gab einen erstickten Laut von sich. Mehrere vornehme Damen, die an einem ovalen Tisch saßen, auf dem Wein, Gebäck, kandierte Früchte und weiteres Zuckerwerk standen, schauten ebenso entsetzt drein. Eine von ihnen, eine Frau mit üppigem Busen, rief: »Sant’lddio!«, und zeigte mit dem Finger auf mich. »Was ist das für eine Kreatur?«
Meine Mutter rang um Fassung, bevor sie mühsam die Antwort hervorbrachte: »Verzeiht, Signora Vascellini, das ist … meine Tochter.«
Signora Vascellini bekreuzigte sich. »Der Allmächtige schütze uns. Sie trägt eine voglia di peccato!«
»Glaubt mir, Signora, das hat nichts zu bedeuten, wirklich nicht.«
»Woher wollt Ihr das wissen? Was sagt der Herr Pfarrer Eurer Gemeinde dazu? Weiß die heilige Kirche überhaupt davon?«
Meine Mutter streckte sich. »Das Kind ist vor Gott und der Welt in San Pietro getauft.«
»Verlasst sofort mein Haus«
»Aber Signora, gentilissima Signora! Bitte, habt ein Einsehen! Wir gehen sofort, nur, äh, da ist noch die offene Rechnung für das taubenblaue Brokatkleid. Ich brachte es Euch schon vor zwei Wochen. Könntet Ihr nicht wenigstens einen Teil …?«
»Darüber reden wir ein anderes Mal. Die Kreatur hat mich so erschreckt, dass ich zu keinem klaren Gedanken mehr fähig bin.« Signora Vascellini blickte in die Runde. »Oder ergeht es euch anders, meine Lieben?«
Die Damen am Tisch verneinten einstimmig.
»Dann geht jetzt.«
Meine Mutter sank in sich zusammen. »Jawohl, Signora«, murmelte sie, »aber das Kind kann nichts dafür, das arme Kind kann nichts dafür …« Sie nahm ihren Weidenkorb, in dem die Schaustücke lagen, von denen sie so gern eines veräußert hätte, und ergriff meine Hand. Beim Hinausgehen drehte sie sich noch einmal um und fragte leise: »Darf ich nächster Tage noch einmal wiederkommen, Signora?«
»Ja, ja, meinetwegen.« Für Signora Vascellini war das Gespräch beendet. Doch wenige Schritte später rief sie meiner Mutter nach: »Aber kommt ohne das Kind!«
Der Rückweg verlief schweigend. Meine Mutter schaute weder nach links noch nach rechts, während sie immer schneller ging und ich Mühe hatte, Schritt zu halten. Ich spürte, wie sehr sie gedemütigt worden war, und ich spürte auch, dass die Demütigung etwas mit mir zu tun hatte. »Mamma, was ist eine Kreatur?«, fragte ich.
Meine Mutter presste die Lippen aufeinander und eilte weiter.
Ich wiederholte meine Frage.
»Das brauchst du nicht zu wissen, dafür bist du noch zu jung.«
»Immer bin ich für alles zu jung.«
»So ist das nun mal, wenn man Kind ist.«
Je schroffer die Antworten meiner Mutter ausfielen, desto unwohler fühlte ich mich in meiner Haut. Gewiss, ich hatte nicht gehorcht und war ihr heimlich zu der dickbusigen Signora Vascellini in den Palazzo gefolgt, was sicher falsch gewesen war. Aber dass die Signora und ihre Freundinnen so heftig reagiert hatten, musste einen anderen Grund haben. Einen, den ich nicht kannte. Damals wusste ich noch nichts von dem Aberwitz, der in den Köpfen vieler herumgeisterte, denn ich kannte die Menschen nicht. Ich wusste nichts von ihrer Engstirnigkeit, ihrer Eitelkeit, ihrer Bosheit, ich wusste nicht, dass ihr Herz härter als Stein sein konnte und ihre Seele schwärzer als der Tod. Manches Mal denke ich, es wäre besser gewesen, ich hätte das alles niemals erfahren, aber diese Überlegung ist lächerlich und schwach. So schwach, wie ich mich an jenem Tage fühlte, als ich mit meiner Mutter auf dem Nachhauseweg war.
Ich fing an zu weinen: »Und was ist eine voglia di … voglia di …?«
Meine Mutter blieb stehen und wandte mir ihr Gesicht zu. »Hör auf zu weinen, Carla, bitte.«
»Aber die Frau war so hässlich zu uns.«
»Kümmere dich einfach nicht um das, was Signora Vascellini gesagt hat.«
»Ja, Mamma. Was ist eine voglia di …?«
»Was eine voglia di peccato ist, wirst du noch früh genug erfahren. Viel zu früh, fürchte ich. Merke dir lieber ein anderes Wort: Es lautet ›abiuro!‹«
»Abiuro!«, wiederholte ich folgsam. »Was heißt denn das?«
Der Gesichtsausdruck meiner Mutter bekam etwas Feierliches. »Es heißt: Ich schwöre ab.«
»Klingt komisch.«
»Die Bedeutung erkläre ich dir ein anderes Mal. Abiuro ist vielleicht ein sehr wichtiges Wort für dich.«
»Ja, Mamma.«
Den Rest des Weges legten wir wieder wortlos zurück. Doch kurz bevor wir ans Ende der Strada San Felice kamen, wurde unser Schweigen jäh unterbrochen. Ein paar freche Nachbarskinder hatten sich im nahen Gebüsch versteckt. »Strega!«, brüllten sie laut, und: »Maliarda!«
Die Schelte galt mir. Es war schon öfter vorgekommen, dass sie mich als Hexe und Zauberin beschimpft hatten. Sie waren laut, dreckig und aggressiv. Eine Begegnung mit ihnen hatte ich stets vermieden und war jedes Mal so schnell wie möglich davongelaufen.
Doch heute war das nicht nötig. Ich war in Begleitung meiner Mutter, und meine Mutter verscheuchte die Bande. »Hör nicht auf die Rotznasen«, sagte sie und zog mich fort. »Da vorn ist unser Haus.« Sie schloss die Tür auf und ging an den Herd, wo sie das Feuer neu entfachte und Reis zu kochen begann, denn Signora Vascellinis Geiz hatte den Kauf eines Suppenhuhns verhindert. »Reis tut es auch«, meinte sie und verteilte anschließend etwas Gorgonzola auf den dampfenden Körnern.
»Ja«, sagte ich.
Wir sprachen gemeinsam das Tischgebet und aßen.
Als wir fertig waren, legte meine Mutter den Löffel beiseite: »Und nun will ich wissen, warum du mir in die Stadt gefolgt bist. Ich hatte es dir ausdrücklich verboten, und du hast es trotzdem getan. Warum also?«
Diese Frage hatte ich die ganze Zeit befürchtet, denn ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich zog die Stirn kraus und beschloss, es mit der Wahrheit zu versuchen: »Ach, nur so, ich wollte in der Stadt die Bienen angucken.«
»Was für Bienen?«
»Die Bienen, die immer summen.«
»Wie bitte?«
»Ich hab sie genau gehört, Mamma! Hier hab ich sie gehört, die ganze Zeit, aber in der Stadt sind überhaupt keine Bienen.«
Meine Mutter sah mich lange an. In ihren Augen standen Zweifel und Angst. Dann sagte sie wie zu sich selbst: »Vielleicht ist es nur das Summen in deinem Kopf.«
Später hörte ich sie inbrünstig vor dem kleinen Hausaltar beten. »O Herr, du großer, gütiger Gott«, flehte sie, »sei gnädig und barmherzig. Gib, dass nicht wahr wird, was im Zweiten Buch Mose steht, verhindere es, verhindere es mit all deiner Macht … und lasse die Zauberinnen am Leben!«
Sie unterbrach sich und fuhr dann so leise fort, dass es kaum zu vernehmen war: »Denn manchmal, o Herr, sind sie es nur zum Schein.«
Von jenem Tag an achtete meine Mutter strikt darauf, dass ich ihr nicht in die Stadt folgen konnte. Ich bin sicher, sie meinte es nur gut, doch ich fühlte mich verletzt und zurückgestoßen. Ich weinte viel. Das Einzige, was mich tröstete, war, dass Bella und ihre Gefährtinnen mein Schicksal teilten. Sie wurden krank und bedurften meiner Hilfe.
Tagelang behandelte ich sie. Ich machte ihnen Wickel gegen das Fieber, kühlte ihnen die Stirn und sorgte dafür, dass sie gehörig schwitzten, indem ich sie in dicke Decken hüllte. Wenn sie geschwitzt hatten, zog ich sie aus, trocknete sie ab und streifte ihnen frische Wäsche über.
Höschen, Jäckchen, Kleidchen, alles, was meine Mutter in ihrer wenigen freien Zeit für meine Puppen angefertigt hatte, wurde von mir sorgsam gehütet; alles musste stets sauber sein und wurde, wenn nötig, mit Seifenkraut gewaschen, ausgespült und ordentlich auf eine kleine Leine gehängt. Löcher wurden, wenn ich sie entdeckte, liebevoll gestopft, nachdem meine Mutter mir gezeigt hatte, wie man mit Nadel und Faden umgeht. Sogar einen hölzernen Knopf nähte ich einmal an. Er saß zwar nicht besonders fest, aber Bella und ihre Freundinnen versicherten mir, ich hätte es gut gemacht.
Wenn ich nicht Löcher stopfte oder Knöpfe annähte, riss ich schmale Stoffbahnen aus Kleiderresten und stellte auf diese Weise Leinenstreifen für Verbände her, die ich mehr oder weniger geschickt anlegte.
Ich fertigte Kompressen aus alter Wolle und drückte sie auf die Stellen, wo Bella und die anderen Puppen sich beim Spielen verletzt hatten.
Ich holte Wasser für sie, gab ihnen zu trinken und rührte Reisbrei für sie an. Ich tat Apfelstückchen in den Brei und fütterte sie, bis sie satt waren. Und wenn sie satt waren, gab ich ihnen eine Extraportion, obwohl sie es nicht wollten, denn wer krank ist, braucht viel gutes Essen, um wieder gesund zu werden.
Ich setzte sie nacheinander auf einen winzigen Topf, damit sie ihre Notdurft verrichten konnten, und ich putzte ihnen anschließend den kleinen Po ab.
Langsam, ganz langsam genasen sie.
»Du siehst in letzter Zeit besser aus«, sagte meine Mutter eines Abends, als sie nach Hause kam. »Das ist schön. Vielleicht spielst du in Zukunft nicht mehr nur mit deinen Puppen, sondern versuchst es mal mit den Nachbarskindern?«
»Nein!«
»Ich weiß, sie haben dich gehänselt, aber das werden sie bestimmt nicht mehr tun. Kinder vergessen schnell. Sie können sich nicht ewig darüber lustig machen, dass du im Gesicht dieses, äh …« Meine Mutter hielt inne.
»Ich will nicht mit den Kindern spielen! Ich hab Angst vor ihnen. Bella und die anderen sagen auch, ich soll nicht rausgehen.«
Meine Mutter setzte sich und zog mich auf ihren Schoß. »Hör mal, meine Kleine, wie alt bist du jetzt?«
»Ich werde schon sieben«, sagte ich stolz.
»Richtig. Da bist du alt genug, um zu wissen, dass Puppen nicht sprechen können. Sie sind nett und hübsch anzusehen, aber wenn man es genau nimmt, sind sie nur Spielzeug. Das hast du doch sicher schon selbst bemerkt, oder?«
Ich antwortete nicht. Natürlich hatte ich mich schon gefragt, warum meine Gefährtinnen nicht so lebendig waren wie eine Katze oder ein Hund, die sich aus eigener Kraft bewegten, die miauten oder bellten, die fraßen, wenn sie hungrig waren, gähnten, wenn sie müde waren, oder fortliefen, wenn ihnen der Sinn danach stand. Aber ich hatte diese Überlegungen immer unterdrückt, weil ich unbedingt glauben wollte, dass Bella und meine anderen Lieblinge lebten. Nun sollten sie plötzlich nur noch Gegenstände sein? Tote Gegenstände? Meine Lippen begannen zu zittern, Tränen traten mir in die Augen.
»Aber, aber, meine Kleine«, sagte meine Mutter,»wer wird denn gleich weinen. Du bist doch schon ein großes Mädchen, oder?«
Ich schniefte und nickte.
»Na siehst du.« Sie schaute mich wieder mit jenem Blick an, den ich schon öfter an ihr beobachtet hatte. Es war ein Blick, in dem Zuneigung und Liebe lagen, aber auch Sorge und Zweifel. »Vielleicht«, sagte sie, »ist es gar nicht so wichtig, mit den Nachbarskindern zu spielen, vielleicht ist es sogar besser, es zu lassen.«
»Bestimmt, Mamma«, sagte ich.
»Hör mal, meine Kleine, ich würde dich gern in eine Schule schicken, damit du lesen und schreiben lernst, aber eine Schule kostet Geld, sehr viel Geld …«
»Ich will nicht zur Schule!«
»Hm, das dachte ich mir. Ich könnte dich auch zu Pater Edoardo von der Gemeinde San Salvatore schicken. Sein Gotteshaus San Rocco steht nicht weit von hier in der Via delle Lame. Hochwürden erwartet für seinen Unterricht nur ab und zu eine kleine Spende und ist im Übrigen sehr freundlich …«
»Ich will nicht!«
»Nun«, sagte meine Mutter, und fast schien es mir, als sei ihr meine Weigerung nicht unrecht, »dann ist es vielleicht am besten, wenn ich selbst dir Unterricht erteile. Ich würde dann auch nicht mehr so oft von zu Hause fort sein. Willst du das?«
»Ja, Mamma!«, rief ich begeistert. »Das will ich.«
»Dann werden wir es so machen.«
Doch einige Zeit später, man schrieb noch das Jahr 1558, hatte meine Mutter mehrere Aufträge, die häufig ihre Anwesenheit in der Stadt erforderten. So kam es, dass sie ihr Versprechen nicht einlösen konnte. Viele Tage hoffte ich, sie würde bei mir bleiben und mit dem Unterricht beginnen, und viele Tage wurde meine Hoffnung enttäuscht. Wie zuvor blieben mir nur Bella und ihre Gefährtinnen, deren Lebensfunke allerdings erloschen war und deren Gesellschaft mir deshalb nicht mehr so viel bedeutete. Statt mit ihnen zu spielen, lief ich im Haus umher und stand immer öfter vor der Tür zu dem Zimmer, das meiner Mutter als Schneiderwerkstatt diente.
An diesem Tag war sie nicht verschlossen.
Mit klopfendem Herzen drückte ich die Klinke nach unten und ging hinein. Der Raum war groß und hell. In der Mitte stand ein Tisch, der Schneidertisch meiner Mutter. Als ich ihn sah, trat plötzlich ein Bild vor meine Augen, das mir bekannt vorkam: Zwei Frauen standen da, die sich stritten, und eine der Frauen schleuderte eine große rote Wolke in meine Richtung. Unwillkürlich sprang ich einen Schritt zurück. Ich wusste, dass ich kein Trugbild gesehen hatte. Vor langer Zeit war ich schon einmal in diesem Raum gewesen. Ich blickte mich um und fragte mich, warum meine Mutter mir den Zutritt so lange verwehrt hatte. Ich fand keine Antwort, denn alles sah noch genauso aus, wie es in meinem Gedächtnis gespeichert war: die zwei hölzernen, sich gegenüberstehenden Schneiderbüsten, die Stoffballen auf dem Beistelltisch, die Zuschnitte, die Garnrollen, die Nadeln, die Scheren, die Schachteln für Knöpfe, Bänder, Spitzen und mancherlei mehr.
Und dann sah ich einen großen Spiegel und erblickte etwas, das ich noch nie zuvor gesehen hatte: mich selbst.
Mich selbst und mein Gesicht.
Man sagt, kein Tier dieser Welt könne erkennen, wenn der Spiegel ihm sein eigenes Abbild zeigt. Ich aber wusste sofort, dass ich es war, die da mit zaghaften Schritten auf sich selbst zuging. Staunend betrachtete ich mich. Ich war nicht sehr groß gewachsen, schlank, mit gerader Haltung und gleichmäßigen Proportionen, nur mein Kopf mit den schulterlangen kastanienbraunen Haaren war für meinen Körper ein wenig zu groß, was aber, wie ich heute weiß, für ein Kind meines damaligen Alters völlig normal ist.
Keineswegs normal jedoch war mein Gesicht.
Die gesamte linke Hälfte war violett verfärbt. Fremd und abstoßend wirkte die Fläche auf mich, fast monströs. Sie zog sich von der Stirn über das Auge an der Nase vorbei bis hinunter zur Wange, vom Ansatz des linken Ohrs bis in den Mundwinkel hinein. Ich sah zum ersten Mal, wie entstellt ich war, und ich sah, wie mein Gesicht sich veränderte. Eben noch neugierig und voller Erwartung, nahm es einen Ausdruck der Angst und des Abscheus an. Meine Lippen begannen zu zittern – wie häufig, bevor ich weinen muss. Doch diesmal weinte ich nicht, ich war viel zu entsetzt. Ich strich mit meiner Hand über den Spiegel, dort, wo die rote Fläche mir entgegenleuchtete. Sie fühlte sich glatt und nichtssagend an. Dann legte ich die Hand an mein Gesicht – und ich spürte den Unterschied, über den ich mir niemals zuvor Gedanken gemacht hatte: Die Haut der linken Gesichtshälfte fühlte sich rauher an als die der rechten. Viel rauher und, wie ich glaubte, auch wulstig. Das war zu viel für mich. Ich schluchzte auf und begann hemmungslos zu weinen.
Eine Tür schlug zu. »Ich bin zurück, meine Kleine, wo steckst du?« Schritte näherten sich. »Ach, hier bist du, sag mal, wer hat dir erlaubt …?«
Meine Mutter erkannte die Situation mit einem Blick. Sie nahm mich in den Arm und führte mich aus der Werkstatt. In der Küche setzte sie sich und nahm mich auf den Schoß. »Weine nicht«, sagte sie. »Irgendwann musste es ja so kommen.«
Ich heulte weiter, meine Tränen flossen, meine Schultern zuckten, ich war der hässlichste Mensch auf Erden! »Mach das weg, Mamma!«, rief ich.
»Ich fürchte, das geht nicht weg, meine Kleine«, sagte meine Mutter. Sie wollte mir über die schreckliche Stelle streichen, aber ich stieß ihre Hand fort.
»Mach das weg, ich will das nicht haben!«
»Das ist ein Feuermal, eine voglia di vino«, sagte sie. »Niemand weiß, wofür es steht.«
Diese Worte konnten mich nicht trösten, und auch die nächsten Sätze meiner Mutter, die sicher gut gemeint waren, vermochten es nicht: »Damit wirst du dein ganzes Leben leben müssen, meine Kleine. Ja, das wirst du wohl. Nun, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass du es schon heute erfahren hast. Umso frühzeitiger kannst du dich daran gewöhnen. Es gibt vieles im Leben, an das man sich gewöhnen muss, vieles, was schlimmer ist, glaub mir. Hauptsache, du bist gesund. Du bist ein großes, gesundes Mädchen und musst jetzt nicht mehr weinen. Nicht wahr, du musst jetzt nicht mehr weinen?«
Ich heulte weiter und sprang von ihrem Schoß. Ich lief zu meinem Bett, auf dem meine Puppen lagen, und vergrub mein Gesicht in ihnen.
Meine Mutter folgte mir. »Ja«, sagte sie, »so ist es recht, spiele nur mit Bella, das wird dich ablenken.«
Ich fuhr hoch und funkelte sie an: »Bella ist tot, du hast es selbst gesagt!«
»Sicher, sicher.« Meine Mutter machte eine hilflose Geste. »Natürlich ist sie tot, meine Kleine. Aber das ist doch nicht so schlimm, sie hat ja niemals gelebt.«
Von diesem Tage an war der Spiegel mein Feind. Einerseits mied ich ihn wie der Teufel das Weihwasser, weil er mir gnadenlos aufgezeigt hatte, wie hässlich ich bin – andererseits fühlte ich mich unwiderstehlich zu ihm hingezogen, weil ich hoffte, ein Wunder wäre geschehen und meine Entstellung über Nacht verschwunden. Doch jedes Mal enttäuschte er mich.
Ich verabscheute ihn dafür. Ich verfluchte ihn. Ich gab ihm den Namen »hässlicher Feind«, brutto nemico, und ich schrie ihn an, warum er das mit mir mache.
Natürlich antwortete er nicht. Er hing nur da, goldumrahmt, und zeigte mir immer das gleiche Bild. Denn er war nur ein Gegenstand. So tot wie meine Puppe Bella.
Immerhin brachte er mich zum Nachdenken. Ich erkannte, warum die dickbusige Signora Vascellini und ihre vornehmen Freundinnen so entsetzt auf mein Äußeres reagiert und mich abfällig als Kreatur bezeichnet hatten, und ich konnte mir auch einen Reim darauf machen, warum die Nachbarskinder mich mit Schmähworten wie Strega und Maliarda beschimpft hatten. Nur an den seltsamen Begriff, mit dem Signora Vascellini meine Entstellung bezeichnet hatte, erinnerte ich mich nicht.
So vergingen Monate.
Meine Mutter bekam von alledem nichts mit. Nur ein Mal, als ich erneut mein Spiegelbild betrachtete, schlug ich voller Verzweiflung nach meinem Feuermal. Es war eine Entgleisung, ebenso unbedacht wie töricht, die schlimme Folgen nach sich zog: Der Spiegel wies ein paar Sprünge auf und meine Hand eine blutende Schnittwunde. Als meine Mutter die Bescherung sah und sich von ihrem ersten Schrecken erholt hatte, machte sie mir bittere Vorwürfe, denn sie dachte, ich hätte nicht aufgepasst, wäre ausgerutscht und gegen das Glas gefallen.
Ich ließ sie in dem Glauben, wenn auch mit schlechtem Gewissen, und beobachtete interessiert, wie sie mir einen Verband anlegte. Sie schimpfte und haderte weiter mit mir, und weil ich sie ablenken wollte, stellte ich ihr die Frage, die ich schon häufiger an sie gerichtet hatte: »Wo ist mein Vater, Mamma?«
»Dein Vater ist tot.« Die Antwort kannte ich bereits. Diesmal jedoch wollte ich mich nicht damit zufriedengeben. »Wenn mein Vater tot ist, muss er mal gelebt haben. Wo war er denn da, Mamma?«
»Das ist eine lange Geschichte, und sie hat kein glückliches Ende.«
»Bitte erzähle sie mir.«
»Vielleicht später.«
»Bitte, Mamma!«
»Nein.«
Wenn meine Mutter auf diese Art nein sagte, wusste ich, dass jedes weitere Betteln zwecklos war. Deshalb zuckte ich mit den Schultern und gab auf.
Immerhin, von dem kaputten Spiegel hatte ich sie abgelenkt.
Wenn meine Mutter wieder einmal die Nacht durchgearbeitet hatte und sich am frühen Morgen nach Bologna aufmachte, um das Ergebnis ihrer Schneiderkunst abzuliefern, ließ sie – im Gegensatz zu früher – stets die Tür zu ihrem Werkstattzimmer offen, vermutlich weil sie dachte, ich hätte mich an meinen Anblick im Spiegel gewöhnt. Welch ein Irrtum! Ich sollte mich nie daran gewöhnen können, aber das ahnten damals weder ich noch sie.
Am späten Nachmittag kam sie meist wieder zurück und erkundigte sich, ob ich die Schulaufgaben, die sie mir am Tag zuvor gestellt hatte, erledigt hätte. Es war eine ungewöhnliche Zeit, um über Schulaufgaben zu reden, aber dank dieser Regelung war es ihr gelungen, ihr Versprechen einzulösen und mir Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen.
Das Lernen fiel mir leicht, so leicht, dass ich jedes Mal schnell mit meinen Aufgaben fertig war und danach nicht wusste, was ich mit dem Rest des Tages anfangen sollte.
So begann ich zu malen. Ich saß in der Werkstatt und malte Tiere und Pflanzen, den Mond und die Sterne. Ich malte Häuser und Türme und alles Mögliche, nur Menschen malte ich nie. Da ich keine bunten Farben hatte, benutzte ich nur Rötel, aber meine Mutter meinte, meine Bilder seien derart lebendig, dass man die Farben auch so sehen könne.
Ich malte weiter und versank mehr und mehr in einer Welt der Formen und Perspektiven, wurde immer scheuer und verschlossener. Ich sprach kaum noch. Wenn meine Mutter mich etwas fragte, antwortete ich einsilbig oder gar nicht. Nachts machte ich in mein Bett und wurde am Morgen dafür von ihr gescholten – aber ich hatte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Natürlich bemerkte sie meine Veränderung, und sie ahnte sicher auch, dass mein Verhalten mit meiner Einsamkeit zu tun hatte. Trotzdem fragte sie mich ein ums andere Mal: »Was ist mit dir, Kind?« Und ein ums andere Mal antwortete ich: »Nichts.«
Drei mehr oder weniger ereignislose Jahre gingen ins Land, ich war fast zehn Jahre alt, als meine Mutter die Schulausbildung für beendet erklärte; sie könne mir nichts mehr beibringen, sagte sie. In der Tat vermochte ich mittlerweile recht passabel zu schreiben, zu lesen und zu rechnen.
Doch das war mir gleich. Mir war alles gleich. Und so hatte ich auch nichts dagegen einzuwenden, als meine Mutter eines Tages beschloss, mir das Schneiderhandwerk beizubringen. »Du musst etwas lernen, meine Kleine«, sagte sie und begann noch in der gleichen Stunde, mir die Unterschiede der einzelnen Nähte zu erklären. Ich nickte gelangweilt und sagte nichts, denn die Beschaffenheit der Nähte kannte ich seit langem. Ich hatte oft genug gesehen, wie meine Mutter sie setzte.
In der Folgezeit lernte ich die Schneiderei von Grund auf. Meine Mutter sagte, ich hätte eine natürliche Begabung, geschickte Hände und ein gutes Auge. Aber die Tätigkeit machte mir wenig Freude, obwohl sie mir kaum Schwierigkeiten bereitete. Ich saß an einem zweiten Tisch, den meine Mutter in die Werkstatt gestellt hatte, und arbeitete ihr zu. Ich setzte am Anfang nur die inneren Nähte der Kleider, die sie anfertigte, später, als meine Stiche gerader und gleichmäßiger wurden, durfte ich auch die äußeren, die für jedermann sichtbaren Nähte setzen.
Meine Mutter lobte mich für meine Arbeit. Sie sagte: »Du machst gute Fortschritte, meine Kleine.« Und: »Wenn du so weitermachst, wird es bald nichts mehr geben, was ich dir beibringen kann, genau wie bei den Schuldingen.«
Ich antwortete: »Ich bin nicht klein.«
Sie lachte. »Nun sei nicht so verstockt. Du und ich, wir sind zusammen, das ist die Hauptsache, und das wolltest du doch immer, nicht wahr?«
»Ja, Mamma«, sagte ich.
Im nächsten Jahr liefen die Geschäfte meiner Mutter schlechter. Nicht, weil die reichen Damen von Bologna sich weniger leisteten, sondern weil in unserer Nähe drei Häuser fertiggestellt worden waren, in die ein paar kinderreiche Familien einzogen. Die neuen Nachbarsfrauen hatten bald herausgefunden, dass meine Mutter gute Arbeit leistete, und sie bestellten bei ihr ein paar einfache Kleider. Meine Mutter hätte die Aufträge am liebsten abgelehnt, aber weil die Frauen Nachbarinnen waren, mit denen sie ein gutes Verhältnis haben wollte, musste sie die Arbeiten annehmen – zu Preisen, die deutlich unter denen lagen, die sie von den reichen Bologneser Patrizierinnen verlangen konnte.
Mir jedoch war das recht. Es gab mir die Möglichkeit, andere Menschen zu sehen und zu beobachten.
Die Frauen waren einfach, aber herzlich, vor allem aber ohne Dünkel. Eine von ihnen war die Mutter eines Jungen, den das Schicksal mit einer Hasenscharte geschlagen hatte. Sie war es, die als Erste auf mich zuging und zu mir sagte: »Du bist Carla, nicht wahr? Ich bin Mamma Rosa. Sag einfach Rosa zu mir, dann plaudert es sich netter.« Und während sie das sagte, schaute sie mir völlig unbefangen ins Gesicht; sie blickte nicht krampfhaft an meinem Feuermal vorbei, und sie starrte auch nicht wie gebannt darauf, nein, der Anblick schien für sie völlig normal zu sein. Ich mochte sie von Anfang an.
Rosa wurde meine erste Kundin. Ich schneiderte ihr ein Kittelkleid aus gestrichener Wolle für die tägliche Arbeit. Das Kleid hatte halblange, eng anliegende Ärmel und eine leicht zu lösende Schnürung am Dekolleté, damit man es nach der Arbeit einfach über den Kopf ziehen konnte, um sich seiner zu entledigen. Die Farbe war grau.
»Keine schöne Farbe«, erklärte Rosa lachend, »aber praktisch! Da sieht man die Flecken nicht so. Du wirst noch sehen, Carla, manchmal ist es im Leben wichtiger, dass Dinge praktisch sind, nicht schön.« Sie hielt inne und fuhr ernster werdend fort: »Und du wirst sehen, dass teure Kleidung nicht mit Verstand gleichzusetzen ist.«
»Das habe ich schon gemerkt«, sagte ich und dachte an Signora Vascellini und ihre Freundinnen.
»Va bene«, meinte Rosa und strich mir sanft über mein Feuermal.
Es war das erste Mal, das ich jemandem diese Berührung erlaubte.
Vier Wochen später zog Rosa mit ihren Kindern wieder aus. Ihr Mann, ein gargiolaro, wie man die Seilmachergesellen in Bologna nennt, hatte einen Nervenschlag erlitten und war gelähmt. Da er nicht mehr arbeiten konnte, musste sie für sich und ihre Kinder eine billigere Bleibe suchen.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. »Rosa ist weg«, sagte ich zu meiner Mutter am Abend. »Sie kann das Haus allein nicht halten.«
»Oh, das tut mir leid«, sagte meine Mutter. »Rosa war eine nette Frau. Aber jeder muss sehen, wie er zurechtkommt, und vielleicht ist es ja ganz gut, dass sie fort ist. Jetzt kannst du mir wieder mehr bei den teuren Kleidern helfen. Alles im Leben hat seine zwei Seiten, man muss die Dinge nur richtig sehen.«
»Wenn das so ist«, sagte ich, »will ich die Dinge nicht richtig sehen.«
»Komm, sei nicht so widerborstig. Hast du für uns schon etwas zum Abendessen vorbereitet?«
»Nein«, sagte ich, »ich habe keinen Hunger.«
In der Folgezeit blickte ich dutzendmal am Tag aus dem Fenster, immer in der Hoffnung, Rosa würde vorbeikommen, mich anlachen und mir sagen, alles wäre nur ein Spuk gewesen. Doch natürlich war es nicht so. Ich senkte den Blick wieder auf meine Schneiderarbeit und setzte Stich um Stich, während meine Mutter mit ihrem großen Weidenkorb in Bologna war, um Auftragsarbeiten entgegenzunehmen oder fertige Kleider abzuliefern.
Die Arbeit, die sie mir gab, missfiel mir immer mehr. Ich wünschte mir, selbst einen der wichtigen Aufträge ausführen zu können. Ich sehnte mich danach, Vorschläge für neue Schnitte zu machen und beim Abstecken und bei der Anprobe dabei zu sein, wenn die reichen Kundinnen sich dazu herabließen, uns in unserem alten Haus aufzusuchen. Doch meine Mutter lehnte alle diese Bitten ab, indem sie nur den Kopf schüttelte: »Ich sage es nicht gern, meine Kleine, aber du weißt, wie deine, äh, Stelle auf die Damen wirken könnte. Verstehe das bitte.«
Ich stampfte mit dem Fuß auf. »Ich bin nicht klein, ich bin dreizehn Jahre alt, und ich verstehe das nicht! Rosa hat sich auch nicht an meinem Feuermal gestört.«
Die Augen meiner Mutter wurden schmal. »Rosa ist fort«, sagte sie leise. »Und jetzt geh wieder an deine Arbeit.«
Tränen der Wut schossen mir in die Augen, ich stampfte abermals mit dem Fuß auf, aber in diesem Augenblick spürte ich, wie etwas feucht an meinem Bein herunterlief. Ich blickte nach unten und unterdrückte einen Schrei.
Ich hatte zum ersten Mal meine Regel bekommen.
Als ich fünfzehn Jahre alt war, hatte ich meine Schneiderlehre abgeschlossen. Mein Gesellenstück, das ich auf Geheiß meiner Mutter anfertigen musste, war ein Kleid aus fuchsfarbenem Batist mit eingewebten Goldornamenten und Metallborte. Es hatte eine deutlich hochgesetzte Taille, einen farblich abgestimmten Samtgürtel sowie enge Oberärmel, die an der Schulter und am Ellbogen angenestelt waren. Der Rock war weit und nach vorn offen. Dieses Kleid hatte ich vom ersten Maßnehmen bis zum letzten Stich selbst gefertigt. Die höher als normal liegende Taille und die angenestelten engen Oberärmel waren meine Idee gewesen, die ich trotz der Einwände meiner Mutter durchgesetzt hatte.
Signora Carducci jedoch hatte sich vom ersten Augenblick an begeistert gezeigt. Sie war eine gutmütige, für ihre Jahre schlank gebliebene Frau aus der Nachbarschaft, deren Figur mir als Vorlage gedient hatte. »Grandioso, grandioso!«, rief sie immer wieder, und ich freute mich, dass mein Werk sie so begeisterte. Andererseits bedauerte ich, ihr das Kleid nicht schenken zu dürfen, aber das kam, nach den Worten meiner Mutter, auf keinen Fall in Frage, weil der Stoff viel zu teuer gewesen war. Vielmehr sollte versucht werden, es einer ihrer vornehmen Damen zu verkaufen.
Leider blieb mein Gesellenstück, das meine Mutter insgesamt als ausgezeichnet bewertete, das einzige Kleid, das ich komplett allein fertigen durfte. Meine Arbeit bestand nach wie vor in den einfachen Schneidertätigkeiten. In meiner freien Zeit begann ich deshalb wieder zu malen. Doch malte ich jetzt nicht mehr kindliche Gegenstände, sondern Kleider. Ich entwarf Kleider. Ich skizzierte Röcke, Roben und Kostüme. Ich fragte mich, warum die Mode so aussah, wie sie aussah, und erfuhr, dass die weiten, bauschigen, geschlitzten Ärmel auf die Tracht der Landsknechte zurückzuführen waren, die bei Kampf und Spiel auf Armfreiheit Wert legten. Irgendjemand hatte sich davon inspirieren lassen und dies auf andere Bereiche übertragen, wodurch eine Mode entstand, bei deren weiterer Entwicklung die Ärmel abknöpfbar und damit austauschbar wurden. Manche der vornehmen Kundinnen meiner Mutter besaßen mehr als zwei Dutzend Ärmelpaare und kombinierten sie hemmungslos mit den unterschiedlichsten Kleidern.
Die enge, in vielen Farben getragene Trikothose mochte ursprünglich den Gauklern und Akrobaten auf den Jahrmärkten abgeschaut worden sein. Das in unzähligen Formen vorkommende Barett war eine Erfindung der gebildeten Stände und des Adels, bevor es seinen Siegeszug auf den Köpfen der einfachen Leute begann. Die Zimarra, ein mantelähnliches Übergewand, das stets gefüttert und oftmals mit Pelz verbrämt war, mochte, ähnlich wie die Schlitzmode der Landsknechte, ihren Ursprung beim Militär gehabt haben, bevor der Mann auf der Straße sie trug.
Diese und andere Überlegungen brachten mich zu dem Schluss, dass nichts in der Mode neu, sondern alles schon einmal an anderer Stelle da gewesen ist. Man musste nur den richtigen Blick haben, um es zu erkennen.
Als ich wenig später ein paar alte Spielkarten in der Küche herumliegen sah, fiel mein Blick auf den Karobuben. Das, was er trug, gefiel mir. Warum sollte seine Kleidung mir nicht als Vorlage für einen Kostümentwurf dienen? Ich nahm meinen Rötelstift und fing an zu skizzieren.
Ich hatte das Prinzip der Kreativität verstanden.
Im folgenden Frühjahr, man schrieb anno 1568, und ich war gerade sechzehn Jahre alt geworden, wurde ich zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft krank. Ich bekam Schüttelfrost und Hitzeanfälle in willkürlicher Reihenfolge, fühlte mich schwach und hustete trocken. Ein Arzt untersuchte mich, indem er mir die Hand auf die Stirn legte und anschließend konstatierte, was meine Mutter und ich schon wussten: »Die junge Dame hat Fieber.«
»Welche Art von Fieber?« Meine Mutter wollte es genau wissen, denn der Arzt, ein gewisser Doktor Valerini, ließ sich seine Dienste gut bezahlen. Der Doktor zog die Brauen hoch. Er schien Nachfragen nicht gewohnt zu sein. »Nun, Signora, es gibt vielerlei Arten der febris. Es könnte sich um ein Zehrfieber handeln, vielleicht auch um ein Wechselfieber.« Seine Hand wanderte wieder auf meine Stirn. »Oder um ein Kopffieber. Gleichgültig, um welche Art es sich handelt, es zeigt in jedem Fall an, dass die Säfte des Körpers nicht im Einklang stehen. Wir müssen die eukrasie bei der jungen Dame wieder herstellen. Doch zuvor noch eine Frage, Signora: Leidet Eure Tochter an Suffukationen?«
»Wie bitte, Dottore?«
»Ach, das wisst Ihr vielleicht nicht: Suffukationen sind Erstickungsanfälle.«
»Nein, soviel ich weiß, hat sie nur diesen trockenen Husten.«
»Hm, hm, das dachte ich mir. Nun, eine Lungensucht können wir wohl trotzdem ausschließen, und gegen das Fieber verordne ich der jungen Dame camphora und senega. Um Eurer Frage zuvorzukommen, Signora: camphora ist Kampfer, eine herzstärkende Arznei, die als analepticum bewährt ist, äh, ein analepticum wirkt anregend auf Nerven und Atemwege, falls Ihr das auch noch wissen wollt. Senega wiederum nennt man eine segensreiche Wurzel von schleimlösender Wirkung. So werden wir der Krankheit gezielt an den Kragen gehen.«
Der Arzt griff in seine Tasche und holte neben den genannten Arzneien ein Zugpflaster hervor. »Dieses vesicatorium, welches ich oberhalb der Brust appliziere, wird ein Übriges tun. In zwei Tagen komme ich wieder, um zu sehen, ob es der jungen Dame bessergeht.«
»Gewiss, Dottore«, sagte meine Mutter und nahm seine Instruktionen, wann wie welches Medikament zu verabreichen sei, entgegen. Dann gab sie ihm sein Entgelt: fünf Paoli, was immerhin schon ein halber Scudo war. »Aber wenn es Euch recht ist, warte ich erst einmal ab. Sollte es nicht besser werden, kann ich immer noch nach Euch schicken lassen.«
»Wie Ihr wollt, Signora Castagnolo. Arrivederci.« Doktor Valerini schaute etwas irritiert, setzte sein Barett auf, ein mit Perlenschnüren und Agraffen verziertes Prachtstück, und verließ gemessenen Schrittes unser Haus.
Wie sich zeigte, war das von Doktor Valerini nicht näher diagnostizierte Fieber hartnäckig. Der Husten ließ dank der Medikamente etwas nach, aber die Hitzeanfälle blieben. Obwohl ich mich sehr schwach fühlte und mein Zustand dringend einer weiteren Behandlung bedurft hätte, war ich froh, dass meine Mutter beschloss, die kostspieligen Künste des Doktors nicht noch einmal in Anspruch zu nehmen. Der Mann war mir nicht sonderlich sympathisch, und die Art, wie er mein Feuermal taxierte, hatte mir auch nicht gefallen.
Zwei oder drei Tage später musste meine Mutter dringend in die Stadt, so dass ich mehrere Stunden allein war. Ich lag in meinem Bett und schaute an die Decke des Zimmers. Ein paar verblasste Fresken waren da zu sehen, die mehrere Szenen aus der Schöpfungsgeschichte darstellten. Ich sah Adam und Eva, die Schlange und den Apfel, und während ich emporblickte, bekam ich wieder einen der Fieberschübe, die mich in den vergangenen Tagen geplagt hatten. Ich schloss die Augen, weil ich hoffte, ich würde einschlafen und dem Anfall auf diese Weise entgehen können. Aber ich schlief nicht ein. Nach einiger Zeit öffnete ich die Augen wieder und sah zu meinem Erstaunen, dass in Adam und Eva Leben gekommen war. Sie bewegten sich. Auch die Schlange bewegte sich. Sie hielt in ihrem Maul den Apfel und bot ihn Eva an. Ich stutzte. Adam war es doch, der den Apfel der Versuchung nahm, und nicht Eva. Und Eva war es, die Adam den Apfel anbot, nicht die Schlange. Gottlob schien Adam das zu wissen, denn er interessierte sich überhaupt nicht für den Apfel, auch war er nicht mehr nackt, sondern trug statt des Feigenblattes das bunte Kostüm des Karobuben. Eva hingegen trug ein weites, geschupptes Kleid, dessen Einzelteile aus Feigenblättern bestanden. Ich wunderte mich. Und ich wunderte mich noch mehr, als die Schlange plötzlich verschwand und als Biene wiederkam. Die Biene summte immerfort, während sie mit großer Geschwindigkeit den Apfel umflog, als suche sie den Eingang zum Gehäuse. Das fand ich lustig, und ich musste lachen. Später hörte die Biene auf zu summen, weshalb ich für sie weitersummte, und als Adam erklärte, er wolle wieder nackt werden, wie Gott ihn erschaffen hätte, sagte ich ihm, dass er das Kostüm des Karobuben unbedingt anbehalten müsse, weil es so schön sei. Und ich zählte ihm jede Einzelheit des Kostüms auf, denn es war mir sehr wichtig, ihn zu überzeugen …
Ich weiß nicht, wie lange meine Mutter mich an jenem Tag allein ließ, in jedem Fall dunkelte es schon, als ich mit fieberheißer Stirn erwachte. Die Figuren in den Fresken über mir verharrten wieder steif und starr in ihrer ursprünglichen Position, und nichts deutete mehr darauf hin, dass Leben in ihnen gesteckt hatte.
Meine Mutter betrat den Raum, setzte sich auf mein Bett und ergriff meine Hand. »Ich bin schon einige Zeit zurück, meine Kleine«, sagte sie. »Du hast sehr viel geredet, unverständliches Zeug, das mich beunruhigt hat.«
»Ja, Mamma.«
»Bist du sicher, dass du nur geträumt hast? Bitte denke genau nach.«
Ich nickte schwach. »Ich habe die Biene gesehen, wie sie den Apfel im Paradies umkreiste.«
In die Augen meiner Mutter traten wieder jene Ängste und Zweifel, die ich schon kannte. »Die Biene?«
»Sie umkreiste den Apfel im Paradies, und sie summte so laut. Sie war verzweifelt, weil sie den Eingang zum Gehäuse des Apfels nicht finden konnte.«
Meine Mutter schluckte. »Ja, ja, natürlich, die Biene. Du musst ganz ruhig bleiben, meine Kleine, reg dich nicht auf, hörst du, stell dir etwas Schönes vor, die Engel im Himmel, wie sie singen, oder so etwas, und reg dich nicht auf.«
»Ich reg mich nicht auf. Es sah wirklich so aus, als wollte sie ins Gehäuse fliegen.«
»Gewiss, du siehst Dinge, die andere nicht sehen. Aber mit Gottes Hilfe werden wir das ändern.«
Ich wusste nicht, was meine Mutter damit meinte, aber ich war zu träge, um nachzufragen. Deshalb sagte ich nur: »Ich habe die Biene mit dem Apfel gesehen. Und Adam und Eva und die Schlange habe ich auch gesehen.«
»Sicher, sicher.«
»Alles war verkehrt. Die Schlange hatte den Apfel im Maul, und Adam trug das Kostüm des Karobuben und Eva ein Schuppenkleid aus Feigenblättern.«
Meine Mutter begann, mit zitternder Stimme zu beten.
»Aber ich habe gemerkt, dass es verkehrt war.«
»Ja, ja.« Meine Mutter hörte kaum noch zu. Ihre Lippen formten beschwörende Worte, und in diese Worte hinein mischten sich plötzlich andere, die von der Tür herkamen. Ihr Kopf fuhr herum. »Dem Allmächtigen sei Dank, ich dachte schon, Ihr kommt nicht mehr, Hochwürden!«
Pater Edoardo, seines Zeichens Seelsorger der Gemeinde San Salvatore, trat murmelnd näher. In nomine patri et filii et spiritus sancti, kam es monoton von seinen Lippen, während er ein silbernes Kruzifix zum Banne des Bösen hochhielt. Seine langsamen, konzentrierten Schritte erinnerten an die eines Wünschelrutengängers. »Jesus Christus, dessen Name gepriesen sei, dessen Name ich laut und vernehmlich ausspreche, dessen Name den Dämon aus dem Leibe treibe, hat mich an diesen Ort geführt, um …« Jäh hielt er inne. »Was ist das? Ich sehe die voglia di peccato im Gesicht Eurer Tochter, das Mal der Sünde! Davon war nicht die Rede, als Ihr mich rieft, Signora.«
Meine Mutter schlug schuldbewusst die Augen nieder.
Ich jedoch blickte den Pater an. Was ich sah, war ein stämmiger Mann mit grauem Bart und eng zusammenstehenden Augen, und dieser Mann hatte mein Feuermal soeben mit jenem Ausdruck bedacht, den auch die unselige Signora Vascellini damals benutzt hatte – voglia di peccato.
»Das Mal der Sünde macht die Sache nicht einfacher, Signora, und das wusstet Ihr auch. Nun, ich vergebe Euch. Der Allerhöchste hat mir auf Erden eine Aufgabe zugeteilt, und ich werde diese Aufgabe nicht von mir weisen. Ebenso, wie die heilige Mutter Kirche mich auf ihren Schild gehoben hat, um Teufelsaustreibungen mit Hilfe Jesu zu vollbringen, Missionen, die ich … äh, wie war noch der Name Eurer Tochter?«
»Carla, Hochwürden.«
»Carla, kannst du mich hören?«
Ich nickte und musste gleichzeitig husten.
Pater Edoardo ließ das Kruzifix los, das ihm an einer Kette um den Hals hing, und schlug das Kreuz. »Sie hat mich verstanden«, sagte er, zu meiner Mutter gewandt. »Das ist ein gutes Zeichen, ihre Seele ist nach wie vor in ihr, aber da ist noch etwas anderes in ihrem Leib, etwas, mit dem sie ringt. Etwas, das sie durch ihr Husten ausstoßen will. Es ist das unbekannte Böse. Es ist hier im Raum, ich spüre es. Es sind Partikel, Miasmen, unsichtbare Dünste, es sind die Ausscheidungen des Bösen, der sie verschlingen will.«
Meine Mutter stöhnte auf und fasste sich ans Herz.
»Seid stark, Signora, vertraut mir, vertraut einem Mann, der sich Gott mit ganzem Herzen verschrieben hat. Ich werde das Böse ansprechen und versuchen, seinen Namen herauszufinden, nachdem ich die vorgeschriebene Bedrohung ausgesprochen habe. So höre, Unhold der Finsternis: Wer immer du bist, der du von dieser armen Seele Besitz ergreifen willst, der starke Arm Jesu wird dich bezwingen, er wird dich zerstören, er wird dich vernichten! Er wird dir, so du der Teufel bist, die Hörner brechen, er wird dir, so du der Drache bist, das Feuer nehmen, er wird dir, so du die Hydra bist, Kopf um Kopf um Kopf abschlagen und jeden deiner Hälse einzeln ausbrennen. Er wird dich niedertreten in den Staub und wird dich selbst zu Staub machen. Wer bist du, dass du Jesus widerstehen willst? Nenne mir deinen Namen!«
Wieder musste ich husten. Was Pater Edoardo da zelebrierte, war mir in höchstem Maße unheimlich. Ich wollte, dass er ging, aber das konnte ich natürlich nicht sagen. Also flüsterte ich: »Es geht mir schon besser.«
Pater Edoardo nickte meiner Mutter zu: »Sie ist ein tapferes Mädchen, sie will das Böse durch den Mund ausstoßen. Der Dämon ist in ihr, so viel ist sicher, denn alle Dämonen verlassen den menschlichen Körper durch den Mund.«
»So ist Carlas Husten keine Krankheit?«
»Wenn Ihr es so bezeichnen wollt, ist es eine Krankheit. Aber in erster Linie ist es ein Zeichen ihres Kampfes gegen die Besessenheit. Doch mit Hilfe des Gottessohnes wird sie ihn gewinnen.«
»Grazie a Dio! Aber sie hat auch wieder so schrecklich gesummt. Ihr ganzer Kopf hat dabei gebebt.«
»Das alles sind Zeichen dämonischer Umtriebe in ihrem Fleisch. Lasst mich jetzt mit der Austreibung fortfahren.«
Und Pater Edoardo verstärkte seine Bemühungen. Er schlug abermals das Kreuz und rief mit volltönender Stimme: »Nenne deinen Namen, o Dämon! Ein Wurm in den mächtigen Händen des Herrn sollst du sein! Ungeziefer, Natterngezücht, animalisches Geschmeiß, so heiße ich dich! Nenne deinen Namen, sage mir, wer du bist, dass du diese arme Seele zerstören willst.«
Er hielt inne und starrte mich an, als erwarte er eine Äußerung von mir. Doch ich zitterte nur und brachte kein Wort hervor. Der Mann flößte mir große Angst ein.
»Wisse, Verfluchter der Finsternis, dieser Mensch ist ein getaufter Mensch! Er ist Jesu Christi gleichgestaltet, denn der Allerhöchste in seiner Gnade war bereit, mit diesem Menschen in die Gemeinschaft zu treten, wie es das Taufsiegel bekundet. Ja, dieser Mensch ist geprägt durch das unauslöschliche, geistliche Siegel, zum Zeichen, dass er Christus angehört. So ist es, und so wird es immer sein, bis zum Ende aller Tage …«
Er begann, mich mit seinem schlechten Atem anzublasen, was er mehrmals wiederholte und Übelkeit in mir auslöste. Danach schien er von allen guten Geistern verlassen, denn er spuckte wie ein Kutscher vor mir aus, wodurch ein Sprühnebel seines ekligen Speichels auf mich niedersank, und rief mich an: »Ex-animo … ex-animo … ex-animo!«
Ich verstand ihn nicht, ich wusste nicht, was er beabsichtigte, denn ich konnte damals noch nicht Latein, und ich ahnte auch nicht, dass er das Ausfahrwort gebraucht hatte, welches so viel wie den Atem nehmen oder erschrecken oder töten bedeutet. Ich heulte auf und zuckte am ganzen Körper, doch schon setzte er seinen beschwörenden Singsang fort: »Mit der Taufe hat Gott dem Menschen sein Angebot gemacht, und niemals nimmt er dieses Angebot zurück. Niemals kann das Böse zwischen ihm und einem getauften Menschen stehen. Die heimtückische Schlange, die da heißt Teufel und Satan, sie hebe sich hinweg von dieser armen Seele, denn sie ist ihr ärgerlich. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, und des Teufels ist, wer sich versündigt. Und so steht es geschrieben im vierten Kapitel bei Matthäus: Weiche von mir, Satan; weiche: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel; und siehe, da traten die Engel zu ihm und dieneten ihm. Ja, wahrhaftig, so steht es geschrieben …«
Pater Edoardo beschwor die Mächte Luzifers immerfort weiter, doch schien er mit dem Ergebnis seiner Anstrengungen nicht zufrieden, denn nach einiger Zeit unterbrach er seinen Redefluss und bat meine Mutter, die exorzistische Kraft seiner Worte zu verstärken, indem sie gleichzeitig ein Ave Maria sprach. Und meine Mutter, die bis zu diesem Zeitpunkt still vor sich hin geweint hatte, fiel auf die Knie, faltete die Hände und murmelte:
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus …
Und während sie betete, hatte Pater Edoardo unter seinen Utensilien ein thuribulum hervorgenommen und entzündet. Weißliche Wolken mit dem schweren Geruch nach Weihrauch entwickelten sich rasch und stiegen mir in die Nase. Ich fühlte Beklemmung und Erstickungsangst. Ich röchelte, hustete, schrie aus Leibeskräften.
»Ex-animo … ex-animo!«, schrie Pater Edoardo dagegen an. Wie aus weiter Ferne hörte ich ihn rufen, in seiner Stimme lag ein Ton des Triumphes, denn er glaubte sich wohl nahe am Ziel seiner Anstrengungen. »Ex-animo!« Er schwenkte das Rauchfass über meinem Gesicht, so dass der Qualm mir die Kehle zuschnürte.
Ich bäumte mich auf, rang nach Luft, jammerte, schluchzte. Wann hörte das Ganze endlich auf? »Mamma!«, keuchte ich. »Mamma, Hilfe!«
Doch weder meine Mutter noch Pater Edoardo beachteten mich, stattdessen vernahm ich, wie beide gleichzeitig unablässig beteten. Der Priester im Stehen, das thuribulum schwenkend: »Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua …«
Meine Mutter kniend, die Arme auf meinen Bettrand gestützt: »… Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes …«
»… Sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie: Es dimitte nobis debita nostra …«
Ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Ich vermute, irgendwann hatte mein Körper ein Einsehen mit mir und schenkte mir eine gnädige Ohnmacht.
Ich wachte auf und brauchte mehrere Augenblicke, um zu mir zu kommen. Das Höllenspektakel, das Pater Edoardo veranstaltet hatte, fiel mir ein, und der bloße Gedanke daran jagte mir erneute Schauer über den Rücken. Was war nur in den Mann gefahren, so unfassbare Dinge mit mir anzustellen? Ich hatte ihm doch nichts getan.
Er aber hatte gebetet und mich mit Rauch fast erstickt, er hatte Gottes Namen und den Namen Jesu ständig im Mund geführt, von Teufeln und Dämonen gesprochen, hatte geblasen und gespuckt und wirres Zeug geredet, als wäre er vom Satan besessen. Doch nun war er zum Glück fort. Ich war allein im Raum. Trotz meiner Schwäche richtete ich mich halb auf, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Es war helllichter Tag, vermutlich der Tag nach den gestrigen Schrecknissen. An den Schatten der Büsche sah ich, dass es Vormittag sein musste. Ich ließ mich zurücksinken und entdeckte dabei ein kleines Blatt Papier auf meiner Bettdecke.
Ich musste dringend zu einer Kundin, aber der Pater wird nach Dir sehen. Denke an nichts Böses, meine Kleine, denke an die singenden Engel.
Mamma
stand darauf. Im ersten Augenblick begriff ich nicht, was das bedeutete. Dann aber wurde mir siedendheiß klar, dass Pater Edoardo jederzeit erscheinen konnte. Das wollte ich nicht! Eine Begegnung mit ihm wollte ich unbedingt vermeiden. Ich nahm meine ganze Kraft zusammen, um aus dem Bett zu steigen. Doch es war schon zu spät.
»Nun, meine Tochter, wie geht es dir?«, ertönte eine Stimme von der Tür her. Der stämmige Gottesmann näherte sich, wobei er wieder das Kreuz schlug. Allerdings flüchtiger als am vorangegangenen Tag. »Die Teufelsaustreibung scheint bei dir mit Gottes Hilfe gelungen zu sein. Wenn es so ist, gib mir ein Zeichen.«