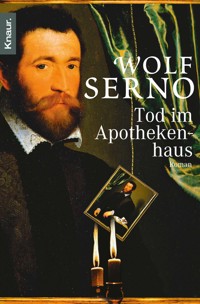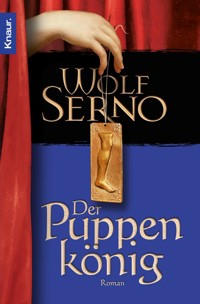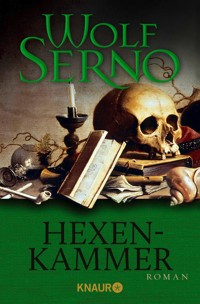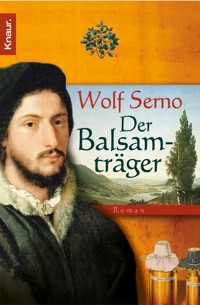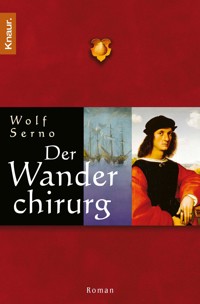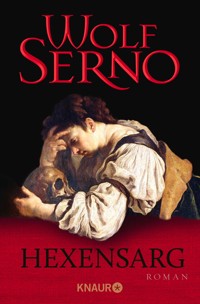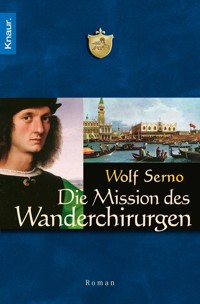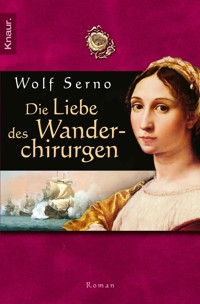9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geschichte einer Hamburger Arztfamilie
- Sprache: Deutsch
Liebe in unruhigen Zeiten.
Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts - Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben ...
Die Saga über eine Hamburger Arztfamilie, die auf wahren Begebenheiten beruht. Von Bestsellerautor Wolf Serno.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Wolf Serno
Wolf Serno war, bevor er begann, Romane zu schreiben, viele Jahre erfolgreich als Werbetexter und als Dozent tätig. Mit „Der Wanderchirurg“ gelang ihm ein internationaler Bestseller. Er lebt mit seiner Frau und zwei Hunden in Hamburg und Nordjütland.
Informationen zum Buch
Liebe in unruhigen Zeiten
Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben.
Die Saga über eine Hamburger Arztfamilie, die auf wahren Begebenheiten beruht. Von dem Bestsellerautor Wolf Serno.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Wolf Serno
Große Elbstraße 7
Das Schicksal einer Familie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Wolf Serno
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorbemerkung des Autors
Erster Teil: August bis Dezember 1892
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zweiter Teil: März 1895 bis Dezember 1896
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Dritter Teil: November 1897 bis Dezember 1899
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Die wichtigsten Personen der Handlung
Dank
Impressum
Stadt Hamburg in der Elbe Auen,
Wie bist du stattlich anzuschauen!
Mit deinen Türmen hoch und hehr
Hebst du dich schön und lieblich sehr!
Heil über dir, Heil über dir, Hammonia, Hammonia!
O wie so glücklich stehst du da! …*
* Erste Strophe der Hamburg-Hymne nach der Urfassung von Georg Nikolaus Bärmann. Albert Methfessel vertonte den Text. Die Hymne wurde erstmals im Jahre 1828 von der Hamburger Liedertafel gesungen.
Wie immer für mein Rudel: Micky, Olli und Magda
Und für Fiedler, Buschmann, Sumo und Eddi, die schon auf der anderen Seite der Straße gehen
Vorbemerkung des Autors
Im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert wurde in Hamburg noch überwiegend Plattdeutsch gesprochen. Arm und Reich, Alt und Jung, alles sprach Platt. Natürlich verständigte man sich in den besseren Kreisen auch auf Hochdeutsch – parlierte in der feinen Gesellschaft sogar französisch –, aber die Alltagssprache war Platt. Es hätte also nahegelegen, im vorliegenden Roman die Dialoge mundartlich abzuhandeln, doch das wäre für Sie und für mich zu mühsam gewesen. Wenn beipielsweise der Krankenwärter Puttfark sagt: »Glauben Sie mir, es ist ein wunderbares Gefühl, wenn jemand dieses Haus als geheilt verlässt«, hätte das auf Platt ungefähr so geklungen: »Glöven Se mi, dat is een wunnerbores Geföhl, wenn een düt Huus as kurert verlooten deit.«
Wo wir gerade im Krankenhaus sind: Im Neuen Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf gab es seinerzeit zwar einen Direktor – in unserem Fall Professor Theodor Rumpf –, aber keine Chefärzte. Sie führten den Titel Oberarzt. Außerdem gab es den Zweiten Chirurgischen Arzt, den Prosektor und sogenannte »Gehülfsärzte«. Aus Letzteren habe ich »Gehilfsärzte« gemacht.
Den Titel »Gehilfswärter« habe ich handlungsbedingt erfunden.
Ebenso wenig existierte die »II. Chirurgische Abteilung«, deren Leitung in diesem Roman Professor zur Haiden innehat. Es gab lediglich eine Chirurgische Abteilung, die im fraglichen Zeitraum von Professor Max Schede bzw. von Doktor Hermann Kümmell geführt wurde.
Ansonsten habe ich alles nach bestem Wissen und Gewissen behandelt – und mit der erlaubten dichterischen Freiheit.
Erster Teil August bis Dezember 1892
Kapitel 1
Nur wenige Stunden, bevor die Katastrophe ihren Lauf nahm, lähmte die Hitze alles Leben in der Stadt. Wie eine unsichtbare Glocke hing sie über den Straßen und Plätzen und trieb jedermann, der sich zu schnell bewegte, den Schweiß auf die Stirn. Sie ließ die Luft über den Pflastersteinen flirren, das Laub in den Bäumen erschlaffen und fauligen Gestank aus den Fleeten emporsteigen.
Niemand, auch nicht die Ältesten, konnte sich erinnern, jemals einen so heißen Tag im August erlebt zu haben. Die sonst so geschäftige Hafenstadt Hamburg stand still.
Am schlimmsten litten die Menschen in jenem Teil der Altstadt, der als Gängeviertel bekannt war – einem unübersichtlichen, lichtlosen Labyrinth aus unzähligen verwinkelten Pfaden und Gässchen. In der Niedernstraße jedoch, dort, wo das Gängeviertel am dunkelsten war, trotzten ein paar Kinder der sengenden Hitze. Fröhlich schreiend trieben sie einen eisernen Fassreifen mit Stockschlägen vor sich her. Der Reifen tanzte über die Steinplatten des Hinterhofs und geriet immer wieder gefährlich in die Nähe der Kellerfenster, doch jedesmal gelang es einem der Kinder, ihm rechtzeitig eine andere Richtung zu geben. Dann aber streifte der Reifen ein Geländer, geriet ins Trudeln und stieß gegen einen Jungen, der an einer Hauswand hockte.
Der Junge hieß Finn. Er wurde von den anderen Kindern »Vogelscheuche« gerufen, weil sein Hemd viele Flicken aufwies und die Hose ihm bei jedem Schritt um die Beine schlotterte. Finn war schon zwölf und damit älter als die anderen, aber er war nicht größer, was daran lag, dass er in den letzten Jahren kaum gewachsen war.
Finn hielt den Reifen fest.
Die anderen Kinder riefen: »Seuche, Seuche, Vogelscheuche! Rück den Reifen raus.«
Finn grinste. Er wusste, sie würden es nicht wagen, ihm ihr Spielzeug wegzunehmen. Er war zwar schwächer als sie, aber er hatte einen starken Vater. Einen sehr starken sogar. Und Vater musste jeden Augenblick zurückkommen. Eigentlich hätte er schon längst wieder da sein müssen. Vor einer halben Stunde hatte er über Kopfschmerzen geklagt und war gegangen, um in Gädgen’s Eck ein Bier zu trinken.
»Aber wirklich nur ein Bier, Hermann!«, hatte Mutter ihm nachgerufen. »Wir müssen sparen!«
Wo blieb Vater nur? Er gehörte nicht zu den Männern, die den halben Tag in der Kneipe hockten und sich über Gott und die Welt unterhielten. Er führte auch keine politischen Reden, wetterte nicht gegen kapitalistische Ausbeuter und kämpfte nicht für den Achtstundentag. Er war der Meinung, an Arbeit sei noch niemand gestorben, und fuhr sechs Tage in der Woche über die Norderelbe hinüber zum Kleinen Grasbrook, wo er die vom Flusswasser verschmutzten Siele reinigte. Vater war stolz auf das, was er tat, auch wenn sein Lohn kaum ausreichte, die Familie satt zu bekommen.
Wo blieb er nur?
»Seuche, Seuche, Vogelscheuche! Gib endlich den Reifen her, oder du kriegst was auf die Fresse!«
Finn fand, es sei klüger, sich von dem Reifen zu trennen. Unvermittelt gab er dem eisernen Ring einen Stoß, so dass er den fordernden Kinderhänden entwischte. Er rollte über den Hof, stieß gegen die Tür des allgemeinen Plumpsklosetts und fiel scheppernd um.
In diesem Augenblick passierte es.
Die Tür wurde aufgestoßen, und ein großer Mann taumelte heraus, die Hose hastig hochgezogen. Es war Finns Vater. Er war blaugrau im Gesicht und torkelte, als wäre er betrunken. Aber er konnte nicht betrunken sein, denn er kam nicht aus der Kneipe. Was war los mit ihm?
»Vater!« Finn rappelte sich auf und lief zu ihm hin.
»Finn.« Der Vater stützte sich schwer auf ihn. »Bring mich nach Haus. Muss mich hinlegen.«
»Mach ich! Was hast du bloß?«, fragte Finn ängstlich. So schwach hatte er seinen Vater noch nie gesehen. Dessen Beine zuckten so seltsam, und er zitterte am ganzen Körper. Finn legte sich Vaters Arm um die Schulter und machte einen Schritt. Es ging nicht. Der große Mann war zu schwer. Da fiel Finns Blick auf den eisernen Reifen. »Warte!« Er stellte ihn auf und drückte ihn in Vaters Hand. »Damit kannst du dich abstützen.«
»Danke, Junge.«
Finn drehte den anderen Kindern eine Nase. Sie würden sich ein neues Spielzeug suchen müssen. Mit schleppenden Schritten ging Vater zur Kellertreppe, deren fünf Stufen hinab zur winzigen Wohnung der Familie Flögl führte. Sie bestand aus zwei Räumen, die vollgestopft waren mit Bettgestellen und Strohsäcken, denn Finn hatte noch sieben Geschwister. Zwei Brüder und fünf Schwestern, alle jünger als er. Ein Regal mit Tellern und Tassen, ein Schrank mit Kleidern und ein halbblinder Spiegel – das machte schon fast die gesamte Einrichtung aus. Der einzige Schmuck im Raum bestand aus zwei fotografischen Aufnahmen an der Wand. Die eine zeigte den Kaiser in Feldherrnpose, die andere die Eheleute Flögl bei ihrer Hochzeit – steif und ernst und in Schwarzweiß. Am Handstein in der Ecke, neben Tisch und Herd, stand Mutter und riss die Augen auf. »Hermann, um Gottes willen, was ist mit dir?«
»Nichts.« Vater ließ sich kraftlos ins Ehebett fallen.
»Aber du hast doch was!«
»Nein. Ich fühl mich nur nicht.«
»Willst du ein Glas Wasser?«
»Nein.« Vater starrte gegen die Decke. Seine Augen waren eingesunken, seine Gesichtshaut war feucht. Die Familie umringte ihn ratlos.
Schließlich sagte Mutter: »Am besten lassen wir ihn erst mal in Ruhe.« Sie wollte zurück zum Handstein, um weiter zu spülen – und verharrte mitten in der Bewegung. Ein sehr vernehmliches Geräusch, das nichts Gutes ahnen ließ, hatte sie innehalten lassen. »Hermann, hast du etwa …?«
In Vaters Augen traten Tränen. Es waren Tränen der Scham.
Mutter schlug sich die Hand vor den Mund, doch sie fasste sich schnell. »So, Kinder, geht alle raus! Spielt im Hof und macht euch nicht schietig. Nur Finn bleibt hier.«
Als die Geschwister fort waren, schlug Mutter die Decke zurück und sah sich die Bescherung an. Vater hatte sich vollgemacht. Es stank entsetzlich. »Hol ein frisches Laken aus dem Schrank, Junge. Und bring den Eimer mit dem Spülwasser her. Und Kernseife.«
Finn gehorchte.
Mit vereinten Kräften wuchteten sie den schweren Mann auf die Seite, zogen ihm die Hose aus, entfernten das Betttuch und wuschen ihn sauber. Zuckend und wimmernd ließ er alles über sich ergehen. Finn beobachtete währenddessen die Mutter. Was mochte sie denken? War Vater ernstlich krank? »Ich glaube«, sagte sie laut, »wir sollten einen Doktor holen.«
Vater protestierte. »Für so was haben wir kein Geld.«
»Aber Hermann, meinst du nicht …?«
»Nein!«
Mutter fügte sich. Vater war krank, aber immer noch der Herr im Haus.
Lieber Himmel, dachte Finn, hoffentlich geht das gut.
* * *
Nur ein paar Gehminuten entfernt, in der Steinstraße, saß am selben Tag Doktor Johannes Dreyer vor einem Glas Bier. Er befand sich in einer Gaststätte, die sich ein wenig hochtrabend Ohlof’s Wirthschaft & Frühstücks-Lokal nannte, in Wahrheit aber eine billige Kneipe war. Gegen das Holsten-Export, das vor ihm im Glas schäumte, ließ sich nichts sagen, es kostete nur zehn Pfennig, und auch die Gemüsesuppe, die daneben in einer Terrine dampfte, war nicht schlecht, dennoch war seine Laune auf dem Nullpunkt. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte er seine Anstellung als Arzt verloren, aus Gründen, die er bis heute nicht begreifen konnte. Klar war nur eines: Es würde schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden, den Arztberuf weiter in Hamburg auszuüben.
Hannes, wie er von seinen wenigen Freunden gerufen wurde, schob den Suppenteller zur Seite, trank einen Schluck Bier und ließ den Blick schweifen. Es war nicht viel los in der Kneipe. Außer dem Tisch, an dem er saß, gab es noch drei weitere, von denen zwei unbesetzt waren. Am dritten Tisch saßen zwei Arbeiter mit Schirmmützen, die Pfeife rauchten und dicke Qualmwolken in die Luft pafften. Sie tranken trotz der Hitze Schnaps und schimpften über die steigenden Mieten. »Eine Schande ist es, dass man sein schwer verdientes Geld den Hauswirten in den Rachen werfen muss«, tönte der eine.
Der andere nickte schwer. »Blutsauger sind’s, verdammte Blutsauger.«
»Statt kleine Wohnungen in der Stadt zu bauen, bauen sie Paläste, wo die Mieten keiner bezahlen kann, und wenn sie Arbeiterwohnungen bauen, dann welche, die anderthalb Stunden vom Arbeitsplatz weg liegen, und man muss jeden Morgen mit der Pferdebahn fahren …«
Hannes hörte nur mit halbem Ohr hin. Er hatte andere Sorgen. Mutter Ohlof, die nach dem Tod ihres Mannes die Kneipe allein betrieb, machte sich im Hintergrund am Tresen zu schaffen. Sie wischte den Messingzapfhahn blank und fragte: »Schmeckt Ihnen meine Suppe nicht, Herr Doktor? Sie haben ja erst einen Teller gegessen.«
»Doch, doch. Sie ist sehr gut. Ich habe nur keinen rechten Appetit.«
»Das erzählen Sie mir seit Tagen.«
»Ach, wirklich?« Hannes musste zugeben, dass Mutter Ohlof recht hatte. Weil er so knapp bei Kasse war, hatte er nach einer billigen Unterkunft Ausschau gehalten und Kost und Logis bei ihr gefunden. Das lag jetzt über eine Woche zurück. Und seit über einer Woche forderte die freundliche Frau ihn auf, kräftiger zuzulangen.
»Wer nicht richtig isst, fällt vom Fleisch. Das müssten Sie als Arzt eigentlich wissen.«
»Natürlich.« Hannes seufzte. Die Frau meinte es nur gut, aber ihre Fürsorge ging ihm manchmal auf die Nerven. Gleich würde sie sich zu ihm an den Tisch setzen und ihm erzählen, dass auch ihr Mann ein schlechter Esser gewesen sei und er sie deshalb viel zu früh verlassen habe. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof liege er, und sie würde regelmäßig zu seinem Grab gehen, um mit ihm zu sprechen …
Zum Glück öffnete sich in diesem Moment die Tür. Ein Junge kam herein. Er war vielleicht zehn oder elf Jahre alt, trug ein geflicktes Hemd und eine Hose, die ihm um die Beine schlotterte. Er guckte sich um und entdeckte Hannes. »Sind Sie der Doktor?«, fragte er scheu.
»Der bin ich.« Hannes wunderte sich. »Woher kennst du mich?«
»Ich kenn Sie nicht. Aber ich weiß, dass Sie hier wohnen.«
»Aha.« Es hatte sich also herumgesprochen, dass sein Zuhause eine Kneipe war. Alle Welt schien mittlerweile zu wissen, dass es bergab mit ihm ging. Auch dieser schmächtige blonde Bengel.
»Wie heißt du, Junge?«
»Finn Flögl. Können Sie mal nach Vater sehen? Ihm geht’s nicht gut.«
Mir auch nicht, hätte Hannes am liebsten geantwortet und die Bitte des Jungen abgelehnt. Schließlich gab es Leute, die wegen des geringsten Zipperleins nach dem Arzt riefen und ihm die Zeit stahlen. Lag hier ein solcher Fall vor? Darauf durfte er sich nicht verlassen. Er war Arzt aus Berufung – und stolz darauf, trotz allem. »Was fehlt deinem Vater denn?«
»Er hat kalten Schweiß, sagt Mutter.«
»Kalter Schweiß, nicht mehr?«
»Doch, er zuckt auch immer so mit den Beinen.«
»Und weiter?«
»Na ja.« Der Junge fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Übergeben hat er sich. Und er hat dauernd Durchfall.«
»Erbrechen und Durchfall?« Die Sache schien ernster zu sein. »Warte hier. Ich hole meinen Arztkoffer.«
Kurz darauf waren sie auf dem Weg. »Wo wohnst du denn?«, fragte Hannes.
»Niedernstraße, Hof 22«, antwortete der Junge. »Nur durch den Kattrepel und dann links.«
Hannes war noch nie in dieser Gegend gewesen. Schmale Häuserschluchten, die mit jedem Schritt enger zu werden schienen, taten sich vor ihm auf. Leinen mit Wäsche spannten sich von Wand zu Wand. Fensterflügel mit zersprungenem Glas standen offen. Der Geruch nach Ruß, Kohl und Fäkalien lag in der Luft. »Ist es noch weit?«, fragte er.
»Nee, wir sind gleich da.«
Sie passierten einen tunnelartigen Durchgang und gelangten in einen Hinterhof. Hannes blinzelte. Hier war es noch schummriger als auf der Straße. Das Sonnenlicht gelangte nur bis hinunter zum zweiten Stock der Gebäude, darunter herrschte Zwielicht. Ein paar Kinder mit Rotznasen starrten ihn hinter einem Mauervorsprung an. Sie streckten dem Jungen an seiner Seite die Zunge raus. Gleich daneben hatte jemand ein Fenster geöffnet und Stiefel zum Lüften herausgestellt. Ein fragwürdiges Unterfangen, denn in unmittelbarer Nähe befand sich das Plumpsklosett: ein behelfsmäßiger Bau mit zwei Holztüren, eine links, eine rechts, dahinter je ein Balken mit Loch. Im Mauerwerk des Hauses gegenüber, gleich neben einem schiefen Regenrohr, hing eine einsame Laterne, wahrscheinlich die einzige Lichtquelle in der Nacht. »Hier ist es.« Der Junge wies auf eine Kellertreppe. »Da runter.«
Hannes klopfte und betrat ein Zimmer, in dem mehrere Betten standen. Im größten lag ein Mann, der mühsam atmete. Eine junge Frau mit verhärmten Zügen stand neben ihm. Sie trug ein Kittelkleid und deutete einen Knicks an. »Gott sei Dank, dass Sie da sind, Herr Doktor, es geht ihm ja so schlecht!«
»Äh, nun ja.« Hannes wusste nicht recht, was er sagen sollte. So viel Armut war ihm selten begegnet. Er blickte sich um. An der Wand des Zimmers standen sieben Kinder. Sie verharrten da wie die Orgelpfeifen und blickten ihn hohläugig an. Er räusperte sich. »Vielleicht ist es am besten, wenn die Kinder nicht dabei sind.«
»Ja, natürlich, Herr Doktor.« Die Frau schickte die Kleinen in den Nebenraum und wies dann auf den Jungen. »Kann Finn bleiben? Er ist mein Ältester.«
»Gewiss. Haben Sie eine Lampe oder ein paar Kerzen? Ich brauche Licht für die Untersuchung.«
»Kerzen hab ich, noch von Weihnachten.« Die Frau riss ein Streichholz an und entzündete zwei Talglichte. Sie stellte sie auf einen Stuhl neben dem Bett. Als sie sich hinunterbeugte, sah Hannes, wie der Kranke ihr etwas zuflüsterte. Er sprach sehr leise, trotzdem war er zu verstehen. Hermann Flögl sagte: »Schick den Kerl weg, der ist viel zu jung. Für Quacksalber haben wir kein Geld.«
Die Frau schüttelte den Kopf. Zu Hannes sagte sie: »Mehr Kerzen hab ich nicht.«
»Es ist schon gut.« Er trat an das Bett und griff zum Handgelenk des Kranken. Beiläufig sagte er: »Ich bin erst achtundzwanzig, Herr Flögl, aber ich habe zehn Semester Medizin in Heidelberg studiert und zwei Jahre lang am Neuen Allgemeinen Krankenhaus in Eppendorf gearbeitet. Das müsste eigentlich ausreichen, um feststellen zu können, dass Sie einen sehr schwachen Puls haben. Finden Sie nicht?«
Der Kranke drehte den Kopf zur Seite.
»Vertrauen Sie mir, sonst kann ich Ihnen nicht helfen. Strecken Sie die Zunge raus. Ja, so ist es gut. Danke.« Die Zunge roch schlecht und hatte einen weißlichen Belag.
Hannes betrachtete die Augen, sie waren eingesunken und rotgerändert. Er nahm ein hölzernes Instrument aus seinem Koffer und erklärte ruhig: »Dies ist ein Pinard-Rohr. Ich werde damit Ihre Lungen und Herzklappen abhören. Eigentlich müsste ich dazu eines der modernen Stethoskope benutzen, aber ich habe keins. Es wird auch so gehen.« Er redete absichtlich so ausführlich über das, was er tat, denn er hatte die Erfahrung gemacht, dass Patienten sehr viel einsichtiger waren, wenn sie in die Untersuchung einbezogen wurden.
So war es auch bei diesem Kranken. Hannes horchte ihn sorgfältig ab und sagte dann: »Lungen und Herztöne scheinen soweit in Ordnung. Wie steht es mit dem Stuhl?«
Kaum hatte er die Frage gestellt, legte die Frau einen Finger an die Lippen und nahm ihn zur Seite: »Es ist ihm ja so peinlich«, wisperte sie. »Er macht sich andauernd voll. Oben und unten, überall kommt es raus. Es ist schrecklich, ich hab schon gar keine frischen Bettlaken mehr.«
Hannes fragte ebenso leise: »Haben Sie von den Ausscheidungen etwas aufgehoben?«
»Nein.« Die Frau blickte verständnislos.
»Eine Stuhlprobe wäre hilfreich für die Diagnose. Nach dem, was ich sehe, höre und fühle, leidet ihr Mann an einer Influenza von Magen und Darm. Mehr lässt sich so nicht sagen. Auf jeden Fall muss er viel trinken, sonst trocknet der Körper zu sehr aus. Auch eine kräftigende Suppe wäre gut. Ach, übrigens, woher beziehen Sie Ihr Trinkwasser?«
Die Frau zuckte mit den Schultern. »Aus der Elbe, woher sonst? Das tun alle hier. Das Wasser vom Wasserträger ist doch viel zu teuer. Außerdem kommt der nur alle Jubeljahre. Ich …« Sie fuhr herum. Der Kranke hatte aufgestöhnt und sich mit einem Schwall erleichtert. »Mein Gott, Herr Doktor, schon wieder!« Sie schickte sich an, das Malheur zu beseitigen, aber Hannes hinderte sie daran.
»Augenblick, bitte«, sagte er. »Ich möchte mir das genau ansehen.« Er nahm eine Lupe zur Hand und betrachtete die dünnflüssigen Fäkalspuren. Sie erinnerten ihn im Aussehen an Reiswasser. Reiswasser? In Hannes keimte ein bestimmter Verdacht. Er vergegenwärtigte sich noch einmal die Symptome des Kranken. Da waren die eingesunkenen Augen, die blaugraue Haut, die Muskelzuckungen in den Waden, das Erbrechen, der Durchfall … und nun auch das Reiswasser, als letztes, entscheidendes Indiz. All das formte sich zu einer schrecklichen Gewissheit: Eine Katastrophe bahnte sich an.
»Er wird doch wieder gesund?«, fragte die Frau voller Angst.
»Das wollen wir hoffen«, antwortete Hannes und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Er wusste: Noch vor wenigen Jahrzehnten hatten die Ärzte bei einem Fall wie diesem gern den Aderlass vorgenommen. Doch inzwischen war man mehrheitlich der Meinung, dass der Blutverlust einen kranken Körper eher schwächte. Auch Calomel, ein Hornquecksilber vom Moschellandsberg, war gern appliziert worden, dazu wurde ein gewisses Quantum Opium verschrieben. Doch beides hatte Hannes nicht. Überdies glaubte er nicht an deren heilende Wirkung.
Er nahm ein Saugröhrchen mit Pipettierball aus seinem Koffer und zog damit eine kleine Menge der Ausscheidung auf. Gleich morgen würde er die Probe zum Krankenhaus bringen und sie mikroskopisch untersuchen lassen. Zwar war er dort unerwünscht, aber hier ging es um mehr als um seine Person: Es musste verifiziert werden, ob seine Schlussfolgerung richtig war.
Nachdem er die Probe verstaut hatte, sagte er zu der Frau: »Machen Sie sich nicht zu viele Gedanken. Geben Sie Ihrem Mann wie besprochen reichlich zu trinken. Aber bitte nicht aus der Elbe!«
Die Frau nickte beflissen. »Ich mach alles, was Sie sagen.«
Hannes wandte sich an Finn. »Und du hilfst deiner Mutter bei der Pflege. Bist ja fast schon ein Mann, nicht wahr?«
»Ja, bin ich.« Finn blickte stolz.
»Gut, für heute bleibt nichts mehr zu tun.« Er trat an das Bett des Patienten und nahm seine Hand. »Gute Besserung, Herr Flögl, ich gehe jetzt.«
»Danke, Herr Doktor«, sagte die Frau und fügte unsicher hinzu: »Wie viel …?«
Hannes winkte ab. »Darüber reden wir morgen. Ich will am Vormittag wieder nach Ihrem Mann sehen.«
Während er das sagte, bewegte sich der Kranke schwach. Er wollte noch etwas sagen. Die Frau legte das Ohr an seinen Mund. Er sprach abermals sehr leise, aber Hannes bekam es trotzdem mit. Der Kranke krächzte: »Sag ihm, er soll wegbleiben.«
Die Frau wollte widersprechen. »Aber …«
»Das ist mein letztes Wort.«
Hannes tat, als hätte er nichts gehört. Er nahm seinen Arztkoffer und ging. »Auf Wiedersehen, Frau Flögl.«
* * *
Am nächsten Morgen – man schrieb Montag, den fünfzehnten August 1892 – saß Hannes beim Frühstück in Mutter Ohlofs Kneipe, vor sich eine Tasse Kaffee und ein Butterbrot mit Marmelade. Doch es wollte ihm nicht schmecken. Der Gedanke an seinen gestrigen Patienten ließ ihn nicht los. Wie es dem Kranken wohl ging? Er war von kräftiger Statur, ein Bär von einem Mann. Gute Voraussetzungen für eine Genesung also, aber trotzdem …
Hannes erhob sich rasch. Eigentlich hatte er als Erstes nach Eppendorf zum Krankenhaus gehen wollen. Dort wirkte Doktor Ermann, der Leiter der Autopsie, der auch Laboruntersuchungen durchführte. Er sollte das Röhrchen mit der Probe erhalten. Die Ausscheidungen Flögls mussten bakteriologisch geprüft und die Keime in Kultur genommen werden, um einen endgültigen Befund zu erstellen und weitergehende Maßnahmen ergreifen zu können.
Doch nun entschied sich Hannes anders. Das Wohl des Patienten hatte Vorrang, und die Probe konnte auch am Nachmittag untersucht werden. Er lenkte seine Schritte wieder zur Niedernstraße, fand mit einiger Mühe den Hof und klopfte an die Tür der Flögls.
Er wartete einige Zeit. Als keine Antwort kam, trat er ein. Die Familie saß mit steinerner Miene um das Bett des Kranken. Hannes sah es mit einem Blick: Der Patient war gestorben.
Die Frau schluchzte auf. »Bis eben hat er noch gelebt, Herr Doktor, und nun ist er tot.«
»Das tut mir sehr leid.« Hannes meinte es aufrichtig. Er war noch nicht lange genug Arzt, um dem Tod mit Gleichmut zu begegnen, schon gar nicht, wenn es sich um einen seiner Patienten handelte. Er überlegte, ob es nicht besser gewesen wäre, den Mann ins Krankenhaus einweisen zu lassen, aber die Frage war müßig. Flögl hätte sein Einverständnis mit Sicherheit nicht gegeben.
Die Schultern der Frau zuckten. Dann begann sie, laut zu weinen. Finn hielt ihre Hand. Eine der Töchter versuchte, ihr mit einem zerknüllten Taschentuch die Tränen abzutupfen. Die anderen Kinder stierten vor sich hin.
Hannes kam sich sehr hilflos vor.
Langsam beruhigte die Frau sich wieder. »Es ist alles so furchtbar«, sagte sie mit stockender Stimme. »Was soll nur werden? Ich sitze hier mit acht Kindern in diesem winzigen Loch, die Enge, der Gestank, der ewige Lärm. Das bringt mich noch um.«
Hannes schwieg. Was sollte er auch sagen?
»Früher, da haben wir auf der Elbinsel Kehrwieder gewohnt, da hatten wir mehr Platz. Kennen Sie Kehrwieder?«
»Nein, tut mir leid.«
»Aber da mussten wir weg. Ist alles abgerissen worden für die neue Speicherstadt, die war ja wichtiger. Und nun ist Hermann auch noch tot, und ich sitz allein mit den Kindern in dieser schrecklichen Gegend. Wussten Sie, dass hier geklaut wird? Wie soll man seine Kinder erziehen, wenn überall geklaut wird.«
Hannes schwieg.
»Und dann die Dirnen, die sich nachts hier rumtreiben. Ein schlechteres Beispiel für meine Kleinen gibt’s wohl nicht.« Die Frau begann wieder, hemmungslos zu weinen.
Hannes räusperte sich. Er musste versuchen, die arme Frau auf andere Gedanken zu bringen. Doch was konnte er sagen? Vielleicht dies: »Ich glaube, Finn hat Rachitis.« Kaum waren die Worte heraus, hätte er sich ohrfeigen können.
Die Frau reagierte prompt: »Rachitis – ist das was Schlimmes?«
»Die englische Krankheit. Finn, komm mal zu mir.« Hannes ergriff die Handgelenke des Jungen und zeigte sie der Frau. »Sehen Sie die Verbreiterungen? Daran kann man das Leiden erkennen. Ebenso daran, dass Finn kleiner ist als seine Altersgenossen.«
Die Frau sagte nichts. Immerhin weinte sie nicht mehr.
Hannes wollte hinzufügen, dass Finn sehr schmächtig war und eine Hühnerbrust hatte, aber er unterließ es. Es wäre dem Jungen sicher peinlich gewesen. Deshalb fuhr er fort: »Finn, du musst mehr an die frische Luft. Spiel doch mal vor den Toren Hamburgs. Da, wo die Sonne scheint, im Zoologischen Garten oder auf der Gänseweide vor dem Dammtorbahnhof. Und dann solltest du mehr Fisch essen und viel Milch trinken.«
Finn nickte, doch seine Mutter lachte freudlos. »Woher nehmen und nicht stehlen, Herr Doktor! Finn muss arbeiten, es geht nicht anders, jetzt mehr denn je. Er arbeitet als Träger und Laufjunge in Köster’s Druckerei-Anstalt, jeden Tag mehrere Stunden nach der Schule. Der alte Köster ist ein Kapitalist und Leuteschinder, und Finn ist nicht der Einzige, den er ausbeutet.«
»Ist das Ihr Ernst?« Hannes konnte kaum glauben, was die Frau erzählte. Sicher, er hatte schon davon gehört, dass Kinder Geld hinzuverdienen mussten. Aber dass es unter solchen Umständen geschah … »Kinderarbeit ist doch verboten.«
Die Frau zuckte mit den Schultern.
»Nun ja.« Hannes besann sich auf das, was zu tun war. Er trat an den Leichnam heran und führte die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Feststellung des Exitus durch. »Ich muss den Tod des Patienten bestätigen, dazu brauche ich einige Informationen. Sagen Sie, was war Ihr Mann von Beruf?«
»Sielarbeiter. In den Kanälen drüben auf dem Kleinen Grasbrook.«
»Und wie alt wurde er?«
»Vierunddreißig.«
»Hatte er früher ernsthafte Krankheiten?«
»Nein, nie. Er war gesund wie ein Fisch im Wasser.« Wieder fing die Frau an zu schluchzen.
Hannes sprach schnell weiter: »Ich muss das alles aufschreiben. Haben Sie Feder, Tinte und Papier?«
Finn antwortete für seine Mutter: »Nee, haben wir nicht. Aber ich hab Schulhefte.«
»Ein leeres Blatt daraus wird reichen. Einen Totenschein habe ich sowieso nicht dabei.«
Gemeinsam rissen sie eine Seite aus einem alten Schreibheft, und Hannes setzte sich damit an den Tisch. Er nahm einen Kopierstift aus seinem Arztkoffer, leckte ihn an und hielt die bisherigen Auskünfte fest. Dann fügte er weitere Angaben wie Datum und Wohnort hinzu. Als er die Todesursache hinschrieb, fragte die Frau: »Woran ist mein Hermann denn nun gestorben?«
»Die Krankheit nannte man am Anfang des Jahrhunderts ›morgenländische Brechruhr‹«, antwortete Hannes.
»Ist das so was wie Durchfall?«
»Nun, in gewisser Weise, ja.«
»Komisch, das klingt so harmlos. Und trotzdem ist er daran gestorben.«
Hannes ließ sie in dem Glauben. Es würde nur schaden, ihr zu sagen, wie die Krankheit wirklich hieß. Er unterschrieb das Blatt Papier, faltete es zwei Mal und überreichte es der Frau. »Das müssen Sie beim zuständigen Standesamt abgeben, damit der offizielle Totenschein ausgestellt wird. Vielleicht kann man Ihnen dort auch in anderer Hinsicht weiterhelfen.«
»Danke, Herr Doktor.«
»Sie sagten gestern, das Trinkwasser vom Wasserträger sei sehr teuer. Sie würden deshalb Elbwasser nehmen. Bitte, kochen Sie es in Zukunft ab, bevor Sie es im Haushalt verwenden. Mindestens fünf Minuten lang. Versprechen Sie mir das?«
»Ja, Herr Doktor.« Die Frau zögerte. Dann nahm sie eine zerbeulte Dose mit der Aufschrift Kümmel aus dem Regal. Sie kramte darin und reichte Hannes ein paar Groschen. »Mehr hab ich leider nicht.«
»Lassen Sie, ich möchte kein Geld.« Hannes fand, das Leid der armen Frau war schon groß genug, da musste er ihr nicht noch die letzten Pfennige abnehmen. »Kaufen Sie davon lieber etwas Obst für die Kinder.«
»Wenn Sie meinen …« Die Frau hielt inne. »Warten Sie.« Sie ging zum Schrank, stellte sich auf die Zehenspitzen und holte zwei Gläser herunter. »Eingekochte Sülze«, erklärte sie. »Die müssen Sie aber nehmen.«
»Danke.« Hannes lächelte. »Sülze ist meine Lieblingsspeise.« Das stimmte zwar nicht, doch er wollte der Frau eine Freude machen. Er packte die Gläser in seinen Arztkoffer. »Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, Frau Flögl. Und viel Kraft.«
»Danke, Herr Doktor.« Der Frau kamen schon wieder die Tränen. »Es hilft ja nichts. Irgendwie muss es weitergehen.«
»Auf Wiedersehen. Wenn Sie oder eines Ihrer Kinder auch an … Brechdurchfall erkranken sollten, melden Sie es mir sofort. Ich logiere bei Mutter Ohlof in der Steinstraße.«
»Jawohl, Herr Doktor, adschüs.« Die Frau wischte sich die Hände am Kittel ab und gab Hannes die Hand. »Ach, Finn, trag dem Herrn Doktor doch die Tasche vor die Tür.«
Hannes wollte abwehren, aber Finn hatte den Arztkoffer bereits ergriffen.
Draußen auf dem Hof nahm Hannes Finn den Koffer wieder ab. Er schaute ihm ins blasse Gesicht und fragte sich, was wohl demnächst auf den Jungen zukommen würde. Armut, Hunger, Elend, soviel stand fest. Man musste kein Prophet sein, um das vorherzusehen. Aber vielleicht hatte das Schicksal mit ihm auch etwas Besseres vor. Das Leben ging manchmal seltsame Wege. »Mach’s gut, Junge. Du bist jetzt der Mann im Haus. Und denk daran: Wenn jemand von euch krank wird, gib mir sofort Bescheid.«
»Ja, Herr Doktor.«
Hannes klopfte Finn auf die Schulter und schritt über den Hof zu dem tunnelartigen Durchgang, der auf die Niedernstraße führte. Hinter dem Mauervorsprung hockten wieder die Kinder. Sie hatten die Köpfe durch einen Fassreifen gesteckt und riefen Finn etwas zu. Hannes verstand zuerst nicht, worum es ging, weil ihre Stimmen so unterschiedlich waren, aber dann bekam er es mit. Sie riefen lauthals einen Vers: »Seuche, Seuche, Vogelscheuche!«
Hannes lächelte schmerzlich. Armer Finn. Kinder konnten so grausam sein! Aber noch viel grausamer war die Wahrheit, die sie dem Jungen, ohne es zu wissen, zugerufen hatten. Zwar stand die bakteriologische Untersuchung der Probe beim Physikus Ermann noch aus, doch Hannes war überzeugt: Hermann Flögl war einer Seuche erlegen, die in Hamburg schon einmal, im Jahre 1831, verheerend gewütet hatte. Sie kam ursprünglich aus Indien, verbreitete sich rasend schnell und suchte Europa immer wieder in großen Wellen heim.
Es war die Asiatische Cholera.
Kapitel 2
Professor Carl-Heinrich zur Haiden rülpste dezent hinter der vorgehaltenen Hand, griff zur Serviette und tupfte sich den Mund ab. Er saß im Speisezimmer seines Privathauses an der Elbe und hatte soeben mit Frau und Sohn zu Abend gegessen. Eine Kraftbrühe mit Fleischklößchen hatte es gegeben, danach gebackenen Kabeljau mit Gemüse und Kartoffeln. Alles sehr schmackhaft und ausreichend. Zur Haiden war ein guter Esser, was man – zu seinem nicht geringen Kummer – auch seiner Figur ansah.
»Frieda!« Zur Haiden blickte sich nach der Dienstmagd um, die bei der Anrichte stand. »Geben Sie mir noch etwas von dem Wein.«
»Jawohl, Herr Professor.« Frieda schenkte von dem Riesling nach.
Zur Haiden trank einen Schluck. »Achten Sie darauf, dass er nicht zu warm wird. Ich mag keinen warmen Weißwein, das wissen Sie doch.«
»Jawohl, Herr Professor.« Frieda ging zur anderen Seite des Tisches, wo die Hausherrin saß, und fragte: »Brauchen Sie auch noch was, gnä’ Frau?«
Louise zur Haiden, die in der Leibesfülle ihrem Mann nur wenig nachstand, hatte nicht zugehört. Wie so häufig hatte sie aus dem Fenster gesehen und den regen Betrieb auf der Elbe verfolgt. Ein schönes Bild, besonders bei klarem Wetter. Der einzige Umstand, der ihre Freude hartnäckig trübte, war der Fischmarkt, der sich in unmittelbarer Nähe befand. Dort wurden sogar am Sonntag neben Aal, Stint und Hering auch gackernde Hühner, schnatternde Gänse, grunzende Ferkel, Obst, Gemüse und dergleichen mehr unter heftiger Lärmentfaltung feilgeboten, was nicht nur wenig romantisch war, sondern auch für unangenehme Gerüche sorgte, die bei ungünstigem Wind genau auf das Haus in der Großen Elbstraße 7 trafen. Die Versuche, ihren Gatten von der Notwendigkeit eines Umzugs zu überzeugen, zum Beispiel in eines der schönen Anwesen an der Außenalster, waren stets auf taube Ohren gestoßen. »Wir zur Haidens«, pflegte er zu antworten, »können unseren Stammbaum bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückverfolgen, als wir noch in der Lüneburger Heide saßen und unseren Broterwerb aus Fischteichen zogen, weshalb, wie du weißt, unser Hauswappen einen springenden Karpfen auf grünem Grund zeigt. Da kannst du nicht erwarten, dass ich meine Herkunft verleugne und mich von ein paar Fischhändlern mit ihren Schuppentieren vertreiben lasse.«
»Ob Sie noch was brauchen, gnä’ Frau.«
»Wie?« Louise schüttelte den Kopf. »Nein, Sie können abräumen. Es sei denn, Benno will noch etwas.«
»Wollen Sie noch was, junger Herr?«, fragte Frieda.
Benno grinste. Anders als seine Eltern war er hochaufgeschossen und von hagerer Gestalt. Er war neunzehn Jahre alt, hatte auf dem Christianeum das Abitur mit Ach und Krach bestanden und hielt nicht viel von Etikette. »Nein, Frieda, ich will nichts von Ihnen.«
Frieda errötete sanft und begann, die leergegessenen Teller auf ein Tablett zu stellen.
Benno stand auf, vergewisserte sich, dass seine Eltern ihn nicht beobachteten, und gab Frieda einen Klaps auf den Hintern. »Ich verdünnisiere mich mal.«
»Ja, ja.« Zur Haiden trank einen weiteren Schluck Riesling, setzte sich den Kneifer auf die Nase und schlug die Sonnabendausgabe der Hamburger Nachrichten auf. Er las das Blatt regelmäßig, nicht nur, weil er mit dem Herausgeber, Doktor Emil Hartmeyer, bekannt war, sondern auch, weil er es schätzte, dass die Nachrichten sich oftmals als Sprachrohr des vor gut zwei Jahren vom Kaiser fallengelassenen Reichskanzlers Bismarck verstanden. Da zur Haiden gleichzeitig ein strammer Monarchist war, geriet er bei der Lektüre immer wieder in einen Zwiespalt der Gefühle. Heute jedoch hatte er keinen Grund dazu. »Hast du das gelesen, Louise?«, fragte er entrüstet. »Hier steht ein Artikel über Deutsch-Südwest. Unsere braven Siedler werden dort zunehmend von den Negern überfallen. Ein Bild ist auch dabei. Hendrik Witbooi steht darunter. Das ist der Anführer der Horden. Der Kerl sieht aus wie eine schwarze Mumie mit Hut. Ich verstehe nicht, warum Leutnant Hugo von François mit seiner Truppe der Lage nicht endlich Herr wird. Seit drei Jahren ist er nun da unten, und die Aufstände sind immer noch nicht niedergeschlagen. Da müssen mal andere Saiten aufgezogen werden.«
»Wenn du meinst.« Louises Interesse lag weniger in der Politik. Ihre Aufmerksamkeit galt vielmehr dem häuslichen und repräsentativen Bereich. Sie hatte alle neunzehn Zimmer mit großer Liebe und Sorgfalt ausgestattet und dabei nicht auf die Mark sehen müssen, was sie dem Umstand verdankte, dass ihr Gatte aus wohlhabender Familie stammte. Die Einrichtung bestand im Wesentlichen aus Möbeln der Gründerzeit, darunter Kommoden und Schränke mit verspielten Ornamenten, Mahagonivitrinen, Armlehnstühle und brokatbezogene Ottomanen. Aber auch filigranere Stücke waren dabei, wie Blumenständer und Beistelltischchen im Lyra-Stil. Die größte Bewunderung der Gäste des Hauses galt jedesmal zwei hohen chinesischen Vasen, die links und rechts an der Eingangstür zum Salon standen und angeblich aus der Ming-Zeit stammten, vermutlich aber Nachbildungen waren. An den Wänden hingen hauptsächlich Bilder mit Jagdmotiven, ferner ein paar holländische Stillleben aus dem Goldenen Zeitalter und nicht zuletzt mehrere großformatige Seestücke. Letztere auf Wunsch des Hausherrn, der sich ansonsten wenig in die Gestaltung seines Heims einmischte.
Das war Louise nur recht. Sie glaubte, am besten zu wissen, was am meisten Eindruck machte, wenn die Damen ihres Zirkels – allesamt dem Bürgeradel zugehörig – auf eine Tasse Tee, ein Likörchen und etwas Gebäck vorbeischauten, um über die wichtigen und weniger wichtigen Ereignise in der Hamburger und Altonaer Gesellschaft zu tratschen – ein Anlass, den Louise gern dazu benutzte, um das eine oder andere französische Wort einzuflechten.
»Gnä’ Frau!«
Louise schreckte auf.
In der Tür stand Martha, die Köchin, und rang die Hände. »Frieda hat vergessen, den Nachtisch zu servieren – schon das zweite Mal in dieser Woche.« Marthas Blick streifte wütend die Dienstmagd, die im Begriff war, das Tablett aus dem Zimmer zu tragen. »Es gibt Birnenkompott.«
»Lassen Sie nur, Martha, wir sind satt«, sagte Louise. »Oder willst du noch etwas, Chéri?«
»Nein. Es ist gut, Martha.«
Martha zog beleidigt ab, gefolgt von Frieda.
Zur Haiden schlug eine neue Seite der Nachrichten auf und stutzte. »Schon über hundert Todesfälle und an die tausend Erkrankungen!«, rief er. »Das ist eine exponentielle Steigerung! Ermann hat doch schon vor drei oder vier Tagen Proben aus verschiedenen Stadtteilen erhalten. Und Kollege Rumpf hat mir erzählt, unter dem Mikroskop seien auffallend große Stäbchen entdeckt worden. Ich verstehe nicht, wieso Ermann so lange über seinen Petrischalen sitzt. Wieso braucht der so ewig, um ein paar Kulturen zu isolieren und den Erreger nachzuweisen? Was macht der Mann nur?«
Louise schaute aus dem Fenster. Der Schiffsverkehr auf der Elbe hatte nachgelassen. »Und du? Warum machst du das nicht, Chéri?«
»Meine Liebe, du scheinst zu vergessen, dass ich Leiter der II. Chirurgie im Krankenhaus bin, also Skalpellkünstler und kein Bakteriologe. Ich kenne mich mit Keimen nicht aus, sondern heile mit dem Messer.«
»Ja, ja, naturellement.«
»Man kann die Angelegenheit doch nicht unter den Teppich kehren! Aber genau das will der Senat, scheint mir. Man redet um den heißen Brei herum, quasselt von miasmatischen Absonderungen, von Dämpfen aus dem Erdinneren und von Giftwolken, die aus abschmelzenden Eisbergen steigen. Und warum? Ich sage es dir: Sobald das Wort Cholera erst offiziell gefallen ist, wäre die Katastrophe da. Der Hafen würde geschlossen werden, kein Schiff käme mehr herein, keines mehr hinaus, alles würde unter Quarantäne gestellt. Ein unvorstellbarer Schaden für die Pfeffersäcke dieser Stadt! Medizinalrat Kraus hat Rumpf in seiner Eigenschaft als Direktor des Krankenhauses beschworen, um Gottes willen jedes Aufsehen zu vermeiden. Man hätte es mit Einzelfällen zu tun. In jedem Sommer gäbe es schließlich Todesfälle mit ähnlichen Symptomen. Dass ich nicht lache!« Zur Haiden redete sich langsam in Rage, was bei ihm nicht selten vorkam. »Höchste Zeit, dass Fraenkel am Montag aus dem Urlaub zurückkommt.«
»Fraenkel?«
»Doktor Eugen Fraenkel, Pathologe, aber auch Bakteriologe. Wenn der sich die Proben vornimmt, geht das ruckzuck, das ist so sicher, wie Ebbe und Flut einander abwechseln. Der versteht wenigstens, die neue hervorragende Laboreinrichtung zu nutzen. Überhaupt muss man sagen, dass unser Institut in jeder Hinsicht das Nonplusultra ist. Kein großer, schwerer Krankenhausklotz, sondern fünfundfünfzig lichte Pavillons, jeder einzelne ausgerichtet nach der Sonneneinstrahlung, eingebettet in ein großes, parkähnliches Gelände …«
»Das hast du schon erzählt«, wagte Louise einzuwerfen.
»So, habe ich das?« Zur Haiden zündete sich eine Zigarre an, ein kleiner Luxus, den er sich nach jedem guten Abendessen gönnte. »Das macht nichts. Das kannst du dir gern noch einmal anhören. Wo war ich? Ach ja, bei den Pavillons. In ihnen finden sich umwälzende Erneuerungen, das kannst du mir glauben. Allein das Operationshaus hat zwei Säle mit riesigen Fensterscheiben und großen elektrischen Lampen mit zwölf Glühlichtern zu je zwölf Kerzen. Sogar einen Extraraum zum Lagern und Chloroformieren der Patienten gibt es. Jeder Saal besitzt voll ausgestattete Operationstische, von denen einer sogar beheizbar ist, sodann Waschtische, Waschschalen für die Schwämme, dazu einen Anwärmekasten. Die Instrumente werden in nicht weniger als vier großen Schränken verwahrt. Ihre Säuberung findet in modernsten Sterilisationsapparaten mit Hilfe strömenden Wasserdampfes statt und so weiter und so weiter. Ja, der gute Curschmann wusste schon genau, was er machte, damals, als er den gesamten Komplex plante.«
»Curschmann? Meinst du den, der nach Leipzig gegangen ist?«
»Ja, genau den.« Zur Haiden klaubte ein Fitzelchen Tabak aus seinem Schnauzbart und produzierte nacheinander drei kunstvolle Rauchringe.
»So ein netter, höflicher Mann, ein Kavalier alter Schule.«
»Jedenfalls war er bis vor vier Jahren ärztlicher Direktor der Hamburger Krankenhäuser. Er hat alles bis ins Kleinste durchdacht, bis hin zur Dampf- und Bratküche für das leibliche Wohl der Kranken. Ich sage dir, die Kraftbrühe und der Kabeljau von unserer Martha wären dort genauso gut gelungen … Herrgott, was ist denn nun schon wieder?«
In der Tür stand Frieda und blickte etwas ratlos. »Da ist ein Mann, Herr Professor. Er sagt, er hätte eine Nachricht für Sie.«
»Was, zu dieser Tageszeit? Was will er denn?«
»Das wollte er nicht sagen. Das wollte er nur Ihnen sagen. Soll ich ihn reinlassen?«
»In Gottes Namen, ja. Herein mit ihm.«
»’n Abend, Herr Professor, ’n Abend, Gnädigste«, sagte kurz darauf ein stämmiger Mann in Lederjoppe. Er verbeugte sich und drehte dabei seine Mütze in der Hand. Offensichtlich wusste er nicht, wie er anfangen sollte. »Trauschke, Max, wenn’s recht ist, ich bin Kutscher«, sagte er schließlich. »Ich fahr normalerweise die Damen vom Roquetteschen Lehrerinnenseminar in Lübeck.«
»Ja, und?«, fragte zur Haiden.
Louise ahnte nichts Gutes. »Qu’est-ce qui se passe? Ich meine, was gibt es, Trauschke?«
»Tja, ich soll schön von der Leiterin, von Fräulein Amélie Roquette, grüßen, und Ihre Tochter Viktoria wäre leider weg.«
»Vicki weg, was soll das heißen?«, fragte zur Haiden.
»Um Gottes willen, was ist passiert?« Louise fasste sich an den Busen. »So reden Sie doch, Trauschke!«
»Sie ist seit drei Tagen weg, soll ich ausrichten. Keiner weiß, wo sie ist. Die Polizei in Lübeck wurde bereits verständigt, aber die hat sie auch nicht gefunden.«
Zur Haiden brauchte einen Augenblick, um die ganze Tragweite dessen zu begreifen, was er soeben gehört hatte. Dann schwoll ihm eine Ader auf der Stirn. »Und wieso erfahren wir das erst jetzt?«
»Mein armes Kind!« Louise schluchzte auf.
»Fräulein Roquette wollte, äh, nicht die Pferde scheu machen, Herr Professor. Es passiert ja immer mal wieder, dass eine der jungen Damen stiften geht, aber sie sind immer wiedergekommen. Ihr Fräulein Tochter ist allerdings nicht wiedergekommen. Bis jetzt jedenfalls.«
»Aber warum?« Zur Haiden schüttelte den Kopf. »Warum hat sie das gemacht? Ich meine, sie hatte dort in Lübeck doch alles?«
»Ich weiß nicht, Herr Professor. Fräulein Amélie hat die Hoffnung gehabt, dass Ihre Tochter hier ist, aber wie es aussieht, ist sie’s nicht. Tut mir leid.« Trauschke zuckte hilflos mit den Schultern. »Sie sagte, es wäre schicklicher, wenn ich Ihnen die schlechte Nachricht persönlich bringe, besser als nur ein Brief.«
»Schon gut.« Trotz allem besann sich zur Haiden auf seine Pflichten als Hausherr. »Danke, Trauschke. Haben Sie eine Unterkunft für die Nacht? Ich nehme an, Sie wollen nicht im Dunkeln zurück nach Lübeck fahren.«
»Nein, Herr Professor, ich habe hier einen Bruder. Der wohnt am Schaartor beim Rödingsmarkt. Da kann ich schlafen.«
»Schön.« Zur Haiden kramte nach einer Münze und gab Trauschke eine Mark. Das war vielleicht etwas üppig, aber er hatte es nicht kleiner. »Danke für Ihre Mühe.«
Trauschke nahm das Geld, setzte die Mütze auf und verließ sichtlich erleichtert das Zimmer.
Louise weinte still vor sich hin. »Was soll nur werden?«, fragte sie nach einer Weile verzweifelt.
Zur Haiden fühlte sich nicht viel besser, aber als Mann durfte er keine Schwäche zeigen. Er räusperte sich. »Davon, dass wir hier Löcher in die Luft starren, kommt Vicki nicht zurück. Wir müssen etwas unternehmen.«
»Ja, doch was?«
Das wusste zur Haiden auch nicht. Er griff zur Klingel und läutete. Als Frieda erschien, sagte er: »Holen Sie Benno her. Stante pede!«
Als Benno die Neuigkeit erfahren hatte, verschlug es sogar seinem losen Mundwerk die Sprache. »Alle Wetter«, sagte er und ließ sich in einen Sessel fallen. »Das muss ich erst mal verdauen.« Er schenkte sich einen Kognak ein.
»Gib deiner Mutter und mir auch einen«, befahl zur Haiden.
Gemeinsam tranken sie.
»Und nun?«, fragte Louise, der die Tränen noch immer die Wangen herunterliefen.
»Wir müssen Kontakt nach Lübeck aufnehmen«, sagte zur Haiden. »Ich will wissen, was da los ist. Benno, du gibst ein Telegramm auf. Gleich morgen.«
»Morgen ist Sonntag. Da haben sämtliche Kaiserlichen Postämter geschlossen.«
»Verflixt und zugenäht! Dann eben übermorgen.«
»Ja, Vater. Aber was versprichst du dir von einem Telegramm? Die Antwort darauf wird nicht mehr erbringen, als dieser Kutscher uns schon gesagt hat.«
»Auch wieder wahr.« Zur Haiden trommelte mit den Fingern auf dem Tisch und überlegte. »Dann wirst du eben persönlich hinfahren und Nachforschungen anstellen. Stelle fest, ob morgen vom Bahnhof in der Spaldingstraße ein Zug nach Lübeck fährt. Ich würde es selbst machen, aber ich muss an jedem Tag in der nächsten Woche operieren. Gehe zu diesem Fräulein Amélie und quetsche es aus. Frage Vickis Mitstudentinnen, ob sie etwas wissen. Suche die zuständige Polizeiwache auf und erkundige dich, ob irgendwo eine Lei…« Er hielt inne und fuhr fort: »Ob irgendwo jemand aufgefunden wurde. Tu alles Erdenkliche und zeige mal, dass du zu etwas nütze bist. Versprichst du mir das?«
»Ja, Vater. Vielleicht aber taucht Vicki ja zwischenzeitlich wieder auf.«
»Oh, lieber Gott, das wollen wir hoffen.« Louise trocknete sich die Tränen. »Wie wäre das schön!«
»Ja, das wäre schön.« Zur Haiden seufzte. Er griff zur Zigarre und wollte einen tiefen Zug tun.
Doch die Zigarre war ausgegangen.
* * *
Hannes Dreyer, der junge Arzt, war mit sich im Reinen. Er hatte an diesem Montag einem älteren Kollegen namens Doktor Hugo Simon in Altona einen Besuch abgestattet, mit ihm einen Kaffee getrunken und über die besorgniserregenden Erkrankungsfälle gesprochen. Beide Mediziner verband, dass ihnen beruflich viel Unrecht widerfahren war: Simon hatte man nach einem Prozess, über den er nicht näher reden mochte, die Mitgliedschaft im Hamburger Ärztlichen Verein verwehrt, und Hannes war im Krankenhaus Eppendorf Knall und Fall entlassen worden. Simon hatte – genau wie Hannes – bereits vor einer Woche die Asiatische Cholera diagnostiziert. Der Name seines Patienten war Sahling gewesen. Sahling hatte in der Friedenstraße 28 gewohnt, er hatte ebenfalls auf dem Kleinen Grasbrook gearbeitet und dieselben Symptome wie Hermann Flögl aufgewiesen. Er war kurz nach Simons Besuch verschieden. »In Altona treten erheblich weniger Cholerafälle auf als in Hamburg«, hatte Simon gesagt. »Der Grund dürfte in der besseren Wasserqualität liegen, weil die Stadt eine Filteranlage hat.«
»Das glaube ich auch«, hatte Hannes geantwortet. »Die Hamburger hinken mit ihrem Filtrierwerk hinterher. Der Erreger schwimmt im Flusswasser, und ich fürchte, bei den derzeitigen Temperaturen fühlt er sich pudelwohl. Die Elbe soll 22 Grad haben.«
»Traurig nur, dass es noch immer Kollegen gibt, die nicht an die Existenz von Vibrio cholerae glauben. Leider gehören auch sehr prominente Kollegen unserer Zunft dazu. Doch lassen wir das. Ich will keine Namen nennen.«
»Hoffen wir, dass sie sich bald eines Besseren belehren lassen. Das gilt erst recht für den Senat und die Bürgerschaft. Die Herren müssen schleunigst wirksame Maßnahmen ergreifen. So geht es nicht weiter.«
»Da haben Sie recht, mein lieber Dreyer«, hatte Simon geantwortet und auf die Uhr geschaut. »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich muss unsere Unterhaltung beenden. Ein paar Hausbesuche wollen erledigt sein. Ich darf Ihnen jedoch noch Folgendes sagen: Auch die Amtsärzte in Altona sind sicher, dass es die Cholera ist. Wir stehen mit unserer Meinung also nicht allein da.«
»Das ist erfreulich«, hatte Hannes gesagt, »auch wenn die Begleitumstände äußerst unerquicklich sind. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben.«
»Gern geschehen.«
»Zum Glück ist es heute nicht mehr ganz so heiß. Ich werde die Gelegenheit nutzen und noch einen Spaziergang hinunter an die Elbe machen.«
»Tun Sie das, Herr Kollege.«
Sie hatten sich freundschaftlich verabschiedet, und Hannes war über die Lange Straße zum Pinnasberg geschlendert. Nun blieb er stehen und genoss den Ausblick. Im Osten lagen die Landungsbrücken, dahinter ragte das Wahrzeichen Hamburgs empor: der Michel mit seinem hölzernen Turm. Vor ihm wälzte sich träge die Elbe dahin. Kein Lüftchen regte sich. Auf der anderen Seite des Stroms, drüben auf Steinwerder, erklangen hell die Hammerschläge der Nieter von Blohm & Voss. Ein dreimastiger Frachtsegler schob sich in Hannes’ Blickfeld. Er glitt majestätisch flussabwärts, gezogen von zwei Schleppern mit qualmenden Schornsteinen. Ihm folgte langsam ein großer Dampfer: die hundertzehn Meter lange Suevia, auf deren Decks die Passagiere dichtgedrängt standen. Es waren Auswanderer, die nach New York wollten. Hannes fragte sich, wie viele von ihnen wohl den Erreger in sich trugen und die Seuche nach Amerika einschleppen würden. Der Dampfer verschwand und gab den Blick frei auf zwei Elbfischer, die ihre Netze ausgeworfen hatten. Sie würden ihren Fang wahrscheinlich noch heute am Fischmarkt anlanden, der westlich vom Pinnasberg lag.
Der Pinnasberg verdankte seinen Namen einem Wirtshaus, das vor über hundert Jahren auf diesem Hügel gestanden hatte. »Der neue Pinnas« hatte es geheißen und eine Pinasse im Schild geführt. Das Wirtshaus gab es schon lange nicht mehr, stattdessen stand dort heute eine Sitzbank. Eine junge Frau saß darauf und sah wie Hannes hinaus auf die Elbe. Sie trug eine weiße Rüschenbluse und einen blauen Rock in Turnürenform. Das dazugehörige Jäckchen hatte sie neben sich auf die Bank gelegt. Die Frau war schlank, vielleicht zwanzig Jahre alt, und ihr Gesicht war von ganz eigenem Reiz – mit schön geschwungenen Brauen und einem wohlgeformten Mund. Ein keckes Hütchen bedeckte ihre brünetten Locken.
Hannes wollte schon weitergehen, als ihm ein Bursche auffiel, der sich von hinten an die Bank heranschlich. Der Kerl sah ziemlich abgerissen aus, und betrunken war er obendrein, denn er schwankte wie ein Rohr im Winde. Das schien ihn aber nicht daran zu hindern, die Hand zielstrebig nach dem Jäckchen auszustrecken.
Ein Dieb!, schoss es Hannes durch den Kopf. Mit drei, vier schnellen Schritten war er heran und packte den Kerl beim Schlafittchen. »Das könnte dir so passen, hier lange Finger zu machen!«, rief er.
Der Kerl wehrte sich, aber Hannes hielt ihn eisern fest. »Ich werde dich dem nächsten Schutzmann übergeben, dann kannst du die Nacht in der Zelle schmoren.«
»Bitte nicht.« Der Mann gab seinen Widerstand auf. »Ich … ich wollte nichts stehlen, wollte nur, äh, dass die Jacke bei dem Wind nicht runterfällt.«
Hannes sagte grimmig: »Willst du mich für dumm verkaufen? Es ist heute ungefähr so windig, wie du nüchtern bist!«
»Hä?«
Die junge Frau lachte. Hannes sah, dass sie grüne Augen hatte.
»Lassen Sie ihn laufen«, sagte sie.
Hannes lockerte seinen Griff. »In Ordnung. Vorher soll er mir aber verraten, wieso er am helllichten Tag betrunken ist.«
»’s ist nur wegen der Cholera«, sagte der Kerl. »Ich hab ein paar Schnäpse gekippt, damit sie mich nicht erwischt. Hätte sonst auch nie die Jacke angefasst.«
Hannes ließ ihn los. Aufatmend lief der Mann davon.
»Das war sehr ritterlich von Ihnen«, sagte die junge Frau und schaute ihn direkt an. Was sie sah, war ein freundliches, jungenhaftes Gesicht mit rotblonder Mähne.
»Ach, nicht der Rede wert.« Hannes wusste nicht recht, wohin er blicken sollte. Immer wenn er einer hübschen Frau begegnete, wurde er verlegen.
Sie lächelte. »Ich würde mich gern erkenntlich zeigen.«
Hannes schluckte. Täuschte er sich, oder war das ein Zeichen, dass seine Gesellschaft ihr nicht unangenehm war? »Nun, äh, Sie könnten sich erkenntlich zeigen, indem Sie mir erlauben, Sie zu einer Limonade einzuladen.«
»Gern!« Als wäre es die selbstverständlichste Sache von der Welt, hakte sie sich bei ihm unter. »Wohin führen Sie mich?«
Diese Frage brachte Hannes ins Schwitzen. Er kannte die Ausflugslokale an der Elbe nur dem Namen nach und wollte keinen Fehler machen. Deshalb sagte er: »Wir könnten in den Alsterpavillon gehen. Es ist zwar ein ganzes Stück bis dahin, aber die Limonade soll gut sein.«
»Einverstanden.«
Eine Zeit lang gingen sie nebeneinander her. Hannes stellte fest, dass die Frau sich ohne Mühe seiner Schrittlänge anpasste. »Wir sind im Gleichschritt.« Sie lachte. »Wie beim Militär.«
»Stimmt.« Auch Hannes musste schmunzeln.
»Haben Sie gedient?«
»Nein. Ich bin kein großer Krieger.«
»Für den betrunkenen Kerl hat es aber gereicht. Wenn Sie kein Krieger sind, was sind Sie dann?«
»Ich bin Arzt.«
»Ein Doktor? Das ist lustig.«
Hannes runzelte die Stirn. »Was ist daran lustig?«
»Ach, nichts. Sehen Sie, gleich haben wir schon das Hafentor erreicht. Dann sind wir wieder in Hamburg.«
»Und Sie, mein Fräulein, was sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin ein unartiges Mädchen, das zurzeit kein Zuhause hat.«
»Kein Zuhause? So sehen Sie gar nicht aus.«
Daraufhin schwieg die junge Frau.
Wieder gingen sie eine Zeit lang nebeneinander her. Dann sagte Hannes: »Ich habe auch kein Zuhause.«
»Was, Sie auch nicht?«
»Nein, ich wohne seit einiger Zeit in Logis, genauer gesagt in einer Kneipe, die sich Ohlof’s Wirthschaft & Frühstücks-Lokal nennt. Die Gegend ist nicht besonders gut, aber die Preise sind niedrig.«
»Das heißt, Ihr Portemonnaie ist ziemlich leer?«
»Nun …« Die direkte Art der jungen Frau war Hannes peinlich. Andererseits gefiel ihm, dass sie aussprach, was sie dachte. »Um ehrlich zu sein, ja.«
»Dann gehen wir nicht in den Alsterpavillon. Da ist es viel zu teuer. Wir gehen in Ihre Kneipe.«
Hannes zögerte. »Ich weiß nicht, ob das für Sie der passende Ort wäre. Sie sind doch …«
»Unsinn!« Sie lachte erneut. »Ich war noch nie in einer billigen Kneipe. Gibt es da auch Limonade?«
Hannes musste grinsen. »Wohl eher nicht. Aber vielleicht kriege ich Mutter Ohlof dazu, uns eine Bowle zu machen.«
»Das wäre himmlisch! Ich bin nur Zichorienkaffee und Hagebuttentee gewöhnt.«
Das wunderte Hannes, aber er mochte nicht fragen, warum das so war. »Wir sind schon in der Steinstraße«, sagte er, »da vorne ist es.«
Hannes öffnete die quietschende Holztür, auf dem ein angerostetes Emailleschild mit dem Sinnspruch Trautes Heim, Glück allein! prangte. Erleichtert stellte er fest, dass von den vier Tischen nur einer besetzt war. Ein Arbeiter saß daran, der den Kopf auf die Arme gelegt hatte und vor sich hin döste. Der Tresen im Hintergrund des Schankraums war leer. »Mutter Ohlof, sind Sie da?«, rief Hannes.
Die Tür zu der winzigen Küche öffnete sich. Mutter Ohlof erschien. Als sie die junge Frau an Hannes’ Seite sah, machte sie ein verdutztes Gesicht.
»Mutter Ohlof, darf ich vorstellen, das ist …«, begann Hannes. Dann fiel ihm ein, dass er den Namen seiner Begleiterin nicht kannte.
»Lassen Sie mich raten: Ihre Gattin, Herr Doktor?« Mutter Ohlof fing an zu strahlen. »Das ist aber eine Überraschung!« Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und begrüßte die junge Frau. »Herzlich willkommen in Ohlof’s Wirthschaft & Frühstücks-Lokal!«
Hannes’ Begleiterin lächelte, machte jedoch keine Anstalten, das Missverständnis aufzuklären.
Mutter Ohlof drohte Hannes scherzhaft mit dem Finger. »Eigentlich müsste ich mit Ihnen Schlitten fahren, Herr Doktor, dass Sie mir Ihre hübsche Gattin so lange vorenthalten haben!«
»Nun, äh …«, sagte Hannes.
»Aber ich bin nicht nachtragend. Was darf ich Ihnen anbieten, Frau Doktor?«
»Mein Mann dachte, dass Sie vielleicht eine Bowle ansetzen könnten?«
»Eine Bowle?« Mutter Ohlof zog die Stirn kraus und kratzte sich die sorgfältig ondulierten Haare. »Da muss ich Sie enttäuschen … Aber warten Sie! Ich habe noch einige Flaschen Weißbier hinten stehen. Bruno, mein Seliger, war Brauergeselle in der Hauptstadt, müssen Sie wissen. Der mochte das Hamburger Bier nicht. Ich könnte etwas eingemachten Rhabarbersaft hineingeben. Die Berliner nehmen allerdings Waldmeister, aber wenn es Sie nicht stört …?«
»Nein, überhaupt nicht.« Die junge Frau lächelte. »Das ist ganz reizend von Ihnen, Frau Ohlof.«
»Sie können ruhig ›Mutter Ohlof‹ zu mir sagen. Das tun alle hier. So, und nun mache ich Ihnen ein Weißbier mit Schuss.«
Mutter Ohlof verschwand.
Hannes und die junge Frau standen da und sahen sich an. »So übel ist Ihr Zuhause gar nicht«, sagte sie und streckte die Hand aus. »Ich heiße übrigens Viktoria. Aber alle rufen mich Vicki.«
»Ich heiße Hannes.« Sie gaben sich die Hand. Weil die Situation so förmlich war, mussten sie beide lachen.
»Komm, wir setzen uns«, schlug Vicki vor.
Kurze Zeit später erschien Mutter Ohlof mit dem von ihr zusammengemischten Getränk. Vicki probierte, verzog das Gesicht und sagte: »Köstlich.«
»Ich habe leider keine Buletten dazu«, entschuldigte sich Mutter Ohlof. »Die Berliner sagen ja Buletten, obgleich die Dinger nichts anderes als Frikadellen sind. Gekocht habe ich heute leider auch nicht. Aber wenn die Frau Doktor mit ein paar Rollmöpsen und Soleiern vorliebnehmen würde …?«
»Natürlich«, sagte Vicki und angelte sich, ohne zu zögern, einen Rollmops aus dem Glas.
»Guten Appetit. Freut mich, wenn es Ihnen schmeckt.« Mutter Ohlof wandte sich ab, weil andere Gäste die Kneipe betreten hatten. »Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid.«
»Danke, das mache ich.«
Hannes trank einen Schluck und sagte: »So, und nun musst du mir erklären, warum du vorhin gelacht hast, als ich sagte, ich sei Arzt.«
»Ich komme aus einer Arztfamilie.«
»Ach so. Aber du sagtest doch, du hättest kein Zuhause?«
»Habe ich auch nicht.«
»Warum nicht?«
»Oh, das ist eine lange Geschichte.«
»Ich kann zuhören.«
»Also gut, es fängt damit an, dass meine Eltern aus ihrer Tochter eine staubtrockene Lehrerin machen wollten …«
Sie redeten den ganzen Abend bis in die Nacht hinein, und auch Hannes fand Gelegenheit, aus seinem Leben zu berichten. Dabei tranken sie mehrere Flaschen Berliner Bier mit Rhabarber-Schuss und wurden mit jedem Glas ein wenig lustiger. Dann jedoch, als das Gespräch für einen Augenblick versickerte, wurde Vicki plötzlich ernst. »Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon mein ganzes Leben«, sagte sie leise.
»So geht’s mir auch.«
Hannes nahm Vickis Hand – und ließ sie rasch wieder los, denn Mutter Ohlof erschien und scheuchte die letzten Gäste aus dem Schankraum. »Ich mache für heute den Laden dicht«, verkündete sie. »Es war ein langer Tag. Sie sollten auch schlafen gehen, Herr Doktor.«
»Äh, ja«, sagte Hannes.
»Gute Nacht, Frau Doktor. Brauchen Sie noch was?«
»Nein, vielen Dank«, sagte Vicki.
»Dann ist es gut.« Mutter Ohlof erlaubte sich ein Augenzwinkern. »Das Bett dürfte ja breit genug für zwei sein.«
Wenig später standen sie sich in der kleinen, von Hannes gemieteten Kammer gegenüber. Hannes räusperte sich. »Du bekommst natürlich das Bett.«
»Das ist nicht nötig.«
»Ich bestehe darauf. Wenn du möchtest, hänge ich eine Wolldecke quer durch den Raum, damit du dich ungestört entkleiden kannst.«
»Du bist ein echter Gentleman. Ich nehme dein Angebot an. Aber nur unter der Bedingung, dass wir dir ein bequemes Lager auf dem Fußboden herrichten.«
Sie suchten sämtliche Kissen und Handtücher zusammen und bauten daraus ein Bett, zogen ein Stück Leinen darüber und spannten danach gemeinsam die Wolldecke durch die Kammer. Dann schauten beide sich verlegen an. »Tja, schlafe gut, Vicki«, sagte Hannes.
»Du auch.«
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn rasch auf den Mund. »Bis morgen, Herr Doktor.«
Kapitel 3
Am dreiundzwanzigsten August, nur einen Tag, nachdem Hannes und Vicki sich zum ersten Mal begegnet waren, wurde der Hafen abgeriegelt. Das Dröhnen der Schiffshörner erstarb, die Kräne standen still, die Arbeit auf den Werften ruhte. Tagelang hatte der Senat sich mit der Beschlussfassung schwergetan, auch weil die einflussreiche Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft, kurz HAPAG, gedroht hatte, in diesem Fall ihren Firmensitz nach Bremen zu verlagern.
Doch dann endlich war die Entscheidung gefallen. Und nicht nur diese: Man hatte sich ebenfalls dazu durchgerungen, den Ausbruch der Cholera nach Berlin zu melden. Im Gegenzug war Professor Robert Koch, der berühmte Entdecker des Tuberkel-Bakteriums, nach Hamburg gekommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen.
Die ganze Stadt summte an diesem Tag wie ein Bienenkorb, überall standen die Menschen auf der Straße und sprachen über das Ereignis. Die Bedrohung durch die Seuche war für jedermann greifbar geworden. Und man hatte Angst. Keine zehn Jahre lag es zurück, dass der Typhus die Elbmetropole heimgesucht hatte. Tausende waren damals gestorben. Würden es diesmal genauso viele werden? Man munkelte bereits von Hunderten Toten. Jedes Pferdefuhrwerk, das sich als Krankenwagen seinen Weg durch die engen Gassen bahnte, wurde argwöhnisch betrachtet, und nicht selten lag tatsächlich ein Todkranker darin.
Auch durch die Steinstraße fuhr ein solches Gefährt. Es hielt vor dem Nebenhaus von Mutter Ohlofs Kneipe, zwei Träger