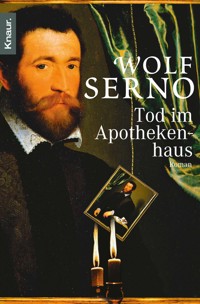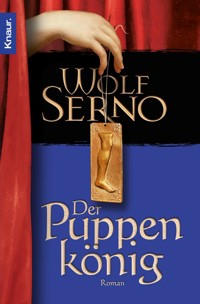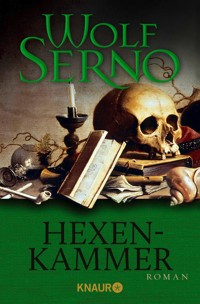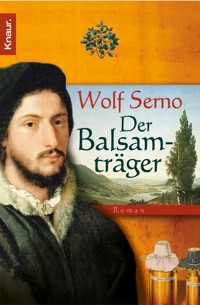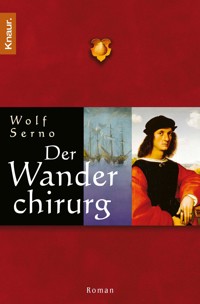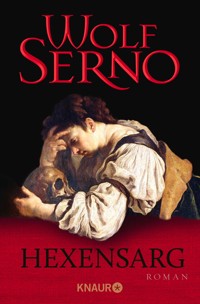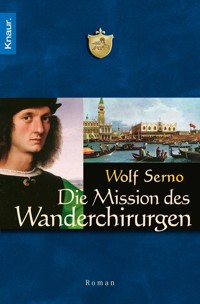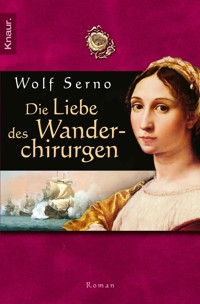Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wanderchirurgen-Serie
- Sprache: Deutsch
Die spannende Suche nach der großen Liebe im 16. Jahrhundert - der mitreißende zweite Band der Wanderchirurg-Reihe von Bestseller-Autor Wolf Serno! Vitus von Campodios könnte glücklich mit seinem Leben sein, denn endlich hat er in England seine Verwandten gefunden und das Geheimnis seiner Herkunft gelüftet. Doch dann fleht ihn sein sterbender Großonkel Lord Collincourt an, nach seiner Enkelin Arlette zu suchen, die er zusammen mit Vitus als Erbin eingesetzt hat. Von Liebe auf den ersten Blick getrieben, begibt sich der Wanderchirurg auf eine abenteuerliche Segelschiffreise voller ungeahnter Gefahren. Wird Vitus seine Angebetete finden und das Familiengeheimnis lüften können? Ein fesselnder historischer Roman über die Suche nach der wahren Liebe, der die Leser mit auf eine spannende Seefahrt ins 16. Jahrhundert nimmt. Der zweite Band der beliebten Wanderchirurg-Serie von Wolf Serno verspricht Nervenkitzel, Romantik und große Gefühle vor dem farbenprächtigen Panorama einer längst vergangenen Epoche.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolf Serno
Der Chirurg von Campodios
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vitus von Campodios könnte glücklich sein, denn endlich hat er in England seine Verwandten gefunden und kennt das Geheimnis seiner Herkunft. Doch dann fleht ihn sein Großonkel auf dem Totenbett an, nach seiner Enkelin Arlette zu suchen, die er zusammen mit Vitus als Erbin eingesetzt hat. Vitus liebt Arlette, seit er sie das erste Mal gesehen hat, und lässt sich nicht lange bitten. Er ahnt nicht, wie viele Klippen er umsegeln muss, bis er seine große Liebe endlich finden wird.
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Prolog
Der Examinator Banester
Der Stallbursche Keith
Die Wirtin Polyhymnia
Der Mönch Ambrosius
Der Geizhals Archibald Stout
Der Steuermann Ó Moghráin
Der Pirat John »Jawy« Cutter
Die »Dame« Phoebe
Der Überlebende Bantry
Die »Dame« Phyllis
Der Plankensäger Jaime
Der Schmied Haffissis
Die Orchideenhändlerin Francisca
Der Cimarron Okumba
Der Hermaphrodit Achille
Die Heilerin Marou
Der Sklavenhändler Sanceur
Der Matrose Hewitt
Der Schiffsarzt Doktor Hall
Der Kutscherjunge Pedro
Die Braut Arlette
Epilog
Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer,
so würde mich doch Deine Hand
daselbst führen und Deine Rechte mich halten.
Psalm 139, 9-10
Die Operationen und Behandlungen in diesem Buch spiegeln den wissenschaftlichen Stand des 16. Jahrhunderts wider. Zwar gab es schon damals Eingriffe, die sich im Prinzip bis in unsere Tage nicht verändert haben, und auch die Kräuter wirken heute nicht anders als vor über vierhundert Jahren, doch sei der geneigte Leser dringend vor Nachahmung und Anwendung gewarnt.
Für mein Rudel:
Micky, Fiedler, Sumo und Buschmann
Prolog
Nur die Augen verrieten, dass Leben in dem Mann steckte. Es waren dunkle Augen voller Glut und Hass, und sie gehörten zu einem Gesicht, das auf Wangen und Schläfen mit grellroten Winkeln bemalt war. Der Schädel des Mannes war kahl rasiert bis auf einen Kamm schwarzen Haars, der sich von der Stirn bis in den Nacken hinabzog. Sein Hals, die Oberarme und die Schenkel waren reich tatauiert. Über seinem Hinterkopf ragte steil eine einzelne Adlerfeder empor.
Der Mann war ein Algonkin. Und er war auf dem Kriegspfad.
Den ganzen Morgen schon hielt er sich in dem zähen Buschwerk verborgen, das nach Osten und Süden hin den Blick auf einige ausgedehnte Tabakfelder freigab. Nur wenige Male hatte er durch Handzeichen Kontakt zu seinen Stammesbrüdern aufgenommen, die am Westufer der Insel abwartend in ihren Birkenrindenkanus saßen – seetüchtigen Booten, mit denen sie vom Festland herübergepaddelt waren.
Doch die Zeit für den Angriff war noch nicht gekommen, obwohl die Sonne bereits im Zenit stand und Wolken von Stechmücken aus den Sümpfen aufgestiegen waren, um sich auf alles zu stürzen, was warm und voll Blut war.
Die scharfen Augen des Spähers verfolgten die mühsame Arbeit der schwarzen Sklaven, die mit hölzernen Hacken das Unkraut aus dem Boden schlugen, damit es den Tabakpflanzen nicht das Licht nahm. Eine junge Frau, weißhäutig und mit Haaren, die so rot waren wie das Kupfer, aus dem sein Halsanhänger bestand, beaufsichtigte sie. Die Rothaarige saß auf einem riesigen Tier, das die Weißen Pferd nannten. Der Späher hatte solche Tiere schon einige Male gesehen, und jedes Mal war er tief beeindruckt von ihrer Erscheinung gewesen. Ihnen wohnte ein mächtiger Zauber inne, der dafür sorgte, dass sie eins wurden mit dem Reiter, dessen Kraft und Schnelligkeit dadurch um ein Vielfaches anwuchs. Dazu kam, dass manche Reiter mit donnernden Feuerstöcken bewaffnet waren, die den Tod schon auf weiteste Entfernung bringen konnten. Einen solchen Stock hatte die Frau zwar nicht, aber Vorsicht war trotzdem geboten. Es würde besser sein zu warten, bis sie fortgeritten war. Oder bis Pferd und Reiterin sich wieder geteilt hatten.
Jetzt lachte sie, denn einer der Schwarzen zeigte ihr eine fingerlange grüne Raupe, die sich, von ihrer Fressarbeit aufgeschreckt, heftig hin- und herwand. Der Sklave lächelte scheu zurück, aber er vermied es, der Frau in die Augen zu sehen. Stattdessen warf er die Raupe in einen Sammelkorb und nahm eifrig seine Arbeit wieder auf.
Die Mundwinkel des Spähers zuckten verächtlich. Schwarze Feiglinge! Wagten es nicht, sich gegen den weißen Mann zu erheben, der sie zwang, den uppowoc anzubauen. Undenkbar für einen Algonkin-Krieger! Der Schamane seines Dorfes hatte die Zeichen für günstig befunden und ihm und seinen Brüdern einen Sieg prophezeit. Einen großen Sieg. Aber er hatte noch mehr gesehen. Er hatte gesehen, dass weiße Männer wieder über das Meer kommen würden. Irgendwann, in nicht allzu ferner Zeit. Viele weiße Männer und Frauen und Kinder. Zehnmal, ja zwanzigmal so viele, wie eine Hand Finger hatte. Doch einen tapferen Krieger durfte das nicht schrecken.
Unwillkürlich fasste der Späher an seinen Gürtel, in dem die Kriegskeule steckte. Der Gürtel war ein wampum, gefertigt aus weißen und violetten Meeresmuscheln, die ihm als Tausch- und Zahlungsmittel dienten. Die violetten hießen bei den Fremden Peak, die weißen Roanoke.
Wieder verfiel er in absolute Starre, doch innerlich tobte die Wut in ihm. Roanoke!, dachte er grimmig. So, wie die Eindringlinge die weißen Muscheln nannten, so nannten sie auch die Insel, die er mit seinen roten Brüdern noch an diesem Tag zurückerobern wollte:
Roanoke Island.
»Bei den verdammten zwölf Aposteln! Ich zieh dir eins mit der Peitsche über deinen verdammten Niggerrücken, wenn du den Blasebalg nicht schneller drückst! So wahr ich der Oberaufseher dieser verdammten Insel bin!«
»Ja, Massa Murphy.« Der Schwarze, der Inkpot gerufen wurde, nickte ängstlich. Er stand vor einem lodernden Feuer, das er an der Mündung des Doughs Creek entzündet hatte.
»Drücken, drücken, drücken! Die Glut muss weiß sein, sonst wird das Brenneisen nicht heiß genug und die verdammten Neunigger kriegen kein anständiges Brandzeichen! Hab’s dir schon hundertmal gesagt!« Murphy nahm seine Tonpfeife aus dem Mund und deutete damit auf die vor ihnen liegende Shallowbag Bay, in der kurz zuvor ein Sklavenfahrer Anker geworfen hatte.
Inkpot verstärkte seine Bemühungen. Er war ein hagerer Alter mit grauem Kraushaar und einem Rücken, den er sich auf den Feldern krumm geschuftet hatte. Langsam wurde die Glut heller und mit ihr das darinliegende Brenneisen. Es zeigte an seinem Ende die Buchstaben TC – TC wie Thomas Collincourt, dem Herrn der Insel und Besitzer der Tabakpflanzung.
»Dass ihr faules Niggerpack nur die Sprache der Peitsche versteht«, brummte Murphy. Er steckte die Pfeife wieder in den Mund und stieß dicke Qualmwolken aus. »Wenn’s darum geht, eure verdammten Weiber zu drücken, seid ihr doch auch nicht so zimperlich. Nur schade, dass so verdammt wenig dabei herauskommt!« Er lachte meckernd über seinen eigenen Witz. »Dabei wär’s Master Thomas verdammt recht, wenn eure Weiber häufiger werfen würden, er müsste dann nicht dauernd für teuren Nachschub sorgen.«
In der Tat war Thomas Collincourt schon mehrfach nach Habana gereist, um dort auf dem Sklavenmarkt neue Arbeitskräfte zu kaufen. Am Anfang hatte er es mit Indianern versucht, aber Sklaven aus Afrika waren williger und widerstandsfähiger. Dennoch: Die Hitze, das Fieber und die schmale, eintönige Kost ließen auch sie selten länger als ein paar Jahre überleben.
In diesem Jahr war Collincourt wieder auf Kuba gewesen und hatte dort acht neue Sklaven erworben. Sieben Männer und eine junge Frau. Die Frau hatte er zunächst nicht kaufen wollen, dann aber, angesichts ihrer straffen, vollen Brüste und der Tatsache, dass sie noch Jungfrau war, sich eines anderen besonnen. Anschließend war er umgehend nach Roanoke Island zurückgekehrt, jedoch nicht, ohne vorher dem Händler zur Auflage gemacht zu haben, ihm die Ware auf seine Insel nachzuschicken.
Der Segler in der Bucht, eine flachgehende Pinasse namens Santissima Trinidad, hatte unterdessen das mitgeschleppte Beiboot klargemacht, damit die neuen Sklaven an Land gerudert werden konnten. Murphy, der früher einmal zur See gefahren war, erkannte, dass die Matrosen mit den Riemen nicht sonderlich gut umzugehen wussten. Wasser spritzte auf. Im nahen Schilf flogen einige Enten protestierend davon. »Will zur Hölle verdammt sein, wenn’s nicht noch ’ne Weile dauert, bis die Teufelsbrut an Land ist«, knurrte er und wandte sich an einen zweiten Schwarzen, der eben einen Karren herangezogen hatte. »He, Chopper, hast du die verdammten Jochhölzer mit?«
»Ja, Massa. Chopper haben vier Jochhölzer mit, wie Massa gesagt.« Chopper nahm sich das lederne Zuggeschirr von den Schultern und begann abzuladen.
»Und die Querstangen für die Gabeln? Wie viele verdammte Querstangen hast du mit?«
»Acht, Massa. Wie Massa gesagt.«
»Hm.« Murphy war fürs Erste zufrieden, zumal Inkpot sich nicht hatte ablenken lassen und den Blasebalg weiter heftig drückte. Wenn die Neuen gebrannt wurden, würde es lustig brutzeln.
Dann, plötzlich, verzog der Aufseher voller Ekel die Nase. Der bis dahin ablandige Wind war umgesprungen und blies ihm einen bestialischen Gestank nach Urin, Schweiß und Kot ins Gesicht. Er kam von dem Boot, das sich jetzt zügig näherte. Murphy schluckte und würgte. »Ihr verdammten Sklavenfahrer!«, schrie er hinüber. »Schmeißt die Nigger ins Wasser, damit der verdammte Gestank aufhört!«
Der Bootssteurer lachte. Er hatte olivfarbene Haut und keine Zähne im Mund, obwohl er kaum dreißig Jahre zählte. »Seit wann bist du so zart besaitet, Murphy?«
»Ach, du bist’s, José! Hab dich nicht gleich erkannt.«
José, ein Halbblut, das Spanisch, Englisch und einige afrikanische Dialekte gleichermaßen beherrschte, gab den Matrosen einen Wink, woraufhin sie die Schwarzen, die bislang am Bootsboden gekauert hatten, kurzerhand über Bord warfen. Murphy schätzte, dass die Entfernung zum Strand nur noch dreißig oder vierzig Yards betrug, denn der größte der Schwarzen konnte bereits im Wasser stehen. Er war ein Mann von herkulischer Gestalt, mit ebenmäßigen Gesichtszügen und geschmeidigen Bewegungen. Er wirkte, ebenso wie seine Gefährten, keineswegs unterernährt. Der Sklavenhändler in Habana musste seine Ware tüchtig hochgepäppelt haben, nachdem sie die Überfahrt von Afrika überlebt hatte. Murphy sah es mit Befriedigung.
Einige der Schwarzen schluckten viel Wasser; sie heulten, japsten und jammerten zum Steinerweichen. Das Waten mit gefesselten Händen fiel ihnen schwer, doch sie kamen näher. Als die Wellen ihnen nur noch bis zur Hüfte gingen, griff Murphy zur Peitsche. »Halt, ihr schwarzen Teufel! Bevor ihr auch nur einen einzigen verdammten Schritt auf Roanoke Island setzt, will ich sicher sein, dass keiner mehr stinkt. Also, wascht euch gegenseitig ab!«
Die Schwarzen drängten sich zusammen und blickten ihn verständnislos an. Nur der Größte stand aufrecht da.
»Ihr sollt euch waschen, verdammte Höllenbrut!« Murphy ließ die Peitsche über den Köpfen knallen. Die Neuankömmlinge stammelten irgendein Kauderwelsch, gehorchten aber nicht.
»Ihr wollt nicht? Dann will ich euch das Tanzen lehren! Vielleicht werdet ihr dadurch sauber! Hüpft, ihr verdammten Heiden!« Jetzt machte Murphy ernst. Das lederne Ende mit den harten Knoten landete klatschend auf Nasen, Mündern und Wangen. Die Schwarzen schrien auf und duckten sich unter den Hieben. Nur der Größte stand weiter aufrecht da.
»Gib dir keine Mühe.« José sprang an Land, während sich der Steven des Beiboots knirschend in den Sand grub. »Sie verstehen dich nicht. Sie verstehen sich nicht einmal untereinander. Jedenfalls die meisten. Sie sind von ganz verschiedenen Stämmen: Temne, Kru, Ibo, Coramantier und Nupe. Der portugiesische Kapitän hat sie im Golf von Guinea auf einer Länge von über tausend Meilen zusammengekauft. Hier steht’s.«
Murphy guckte stirnrunzelnd auf das Dokument, das José ihm unter die Nase hielt. Alle Schwarzen waren darauf mit Namen und Herkunft vermerkt. »Hmja, wenn’s so ist.«
»Verlass dich drauf. Willst du den Empfang der Ware hier unten gegenzeichnen? Ich habe Feder und Tinte dabei.« José grinste zahnlos. Er machte sich einen Spaß daraus, die Frage zu stellen, denn er wusste genau, dass Murphy nicht einmal in der Lage war, seinen eigenen Namen zu schreiben. »Das Datum von heute habe ich schon eingetragen«, fuhr er fort und zeigte auf die Zeile:
21. Tag des Monats Juni, Anno Domini 1577
»Hm, hm. Wieso bist du eigentlich so verdammt spät dran mit den Niggern? Der Master ist schon seit einem Monat aus Habana zurück«, versuchte der Aufseher abzulenken.
José rollte das Dokument zusammen. »Als ob du das nicht genau wüsstest! Thomas Collincourt ist nicht der Einzige, der ungern mit stinkenden Sklaven zusammen reist. Schon gar nicht auf einer so langen Überfahrt wie dieser. Sind immerhin mehr als fünfhundert Meilen hier herauf, und in Florida gibt es ebenso Pflanzer, die ich beliefere. Da war ich natürlich zuerst.« Er drückte Murphy die Rolle in die Hand. »Zeig das Master Collincourt, dann wird er sehen, dass alles seine Richtigkeit hat.«
»Abmarsch! Und keine Sperenzchen!«, brüllte Murphy. Er saß auf dem Karren, vor den Chopper sich bereits gespannt hatte, und hielt eine Muskete in der Hand, die er unverwandt auf die Schwarzen richtete. Auch wenn diese Teufel seine Worte nicht verstanden – er wusste, die Drohung war eindeutig genug.
Vorhin, als das weiß glühende Brenneisen sich in ihre Schultern hinein gefressen hatte, war noch einmal ein großes Gezeter ausgebrochen. Inkpot hatte das Brenneisen geführt, und gezischt hatte es, wie wenn ein Kübel Wasser ins Feuer gekippt wird. Murphy hatte den Geruch nach verbrannter Haut genüsslich wahrgenommen, und während die Teufel schrien, war ihm ein Schauer den Rücken hinuntergelaufen. Fast hatte er es bedauert, dass Inkpot so schnell fertig geworden war.
Doch jetzt hatten die Gemüter sich wieder beruhigt. Die Schwarzen standen da wie gelähmt – einer hinter dem anderen. Den Schluss bildete der Riese. Chopper und Inkpot hatten jeweils zweien von ihnen die Jochhölzer angelegt: schwere Äste, die an beiden Enden gabelförmig auseinander liefen. Die Gabeln umschlossen den Hals und wurden am offenen Ende mit einer Querstange geschlossen. Okumba, so wurde der Riese gerufen, hatte das Jochholz zusammen mit der Frau. Sie war fast zwei Köpfe kleiner als er, was beim Anlegen einige Schwierigkeiten bereitet hatte. Murphy sah, dass sie Brüste wie Melonen hatte, voll und schwer, und er hätte gern mehr von ihrer Weiblichkeit erspäht, aber leider trug sie, wie auch die männlichen Sklaven, einen Lendenschurz.
»Abmarsch!«, brüllte Murphy noch einmal. Chopper legte sich ins Zeug, und der Karren kam rumpelnd ins Rollen. Der Weg führte sie in nordwestliche Richtung durch flaches Grasland. Der Boden war staubig, und Murphy sehnte sich nach einem anständigen Schluck Brandy. Die Schwarzen trotteten mit gesenkten Köpfen neben dem Wagen her. Nur der Riese Okumba ging hoch aufgerichtet und blickte sich aufmerksam um.
Du willst die Gegend studieren, Nigger!, fuhr es Murphy durch den Kopf. Schmiedest schon Pläne für deine Flucht, wie? Na warte, den Gedanken werde ich dir versalzen! Er griff zu seiner Peitsche, holte aus und landete einen klatschenden Hieb auf Okumbas Rücken. Zu seinem Ärger reagierte der Riese kaum.
Er murmelte irgendetwas, straffte sich und ging einfach weiter.
»Verdammter Hurensohn!« Murphy schlug erneut zu, diesmal kräftiger, doch der Schwarze tat, als wäre er Luft.
»Massa Murphy!« Der neben den Sklaven einhertrottende Inkpot meldete sich unterwürfig. »Wir gehen Weg vorbei an Hügel, oder?«
»Wie, was?« Der Aufseher blickte nach rechts vorn, wo inzwischen einige Landerhebungen aufgetaucht waren. »Natürlich, du schwarzes Scheusal, es gibt ja keinen anderen Weg nach Collincourt’s Tobacco Plantation, was fragst du so dämlich?«
»Ich nur wissen wollen.«
»Pah, du mit deinem Niggerhirn musst überhaupt nichts wissen«, blaffte Murphy, dessen eigene Geisteskraft nicht ausgereicht hatte, um zu erkennen, dass er nur abgelenkt werden sollte. »Chopper, beweg deinen verdammten Arsch, damit wir endlich ankommen. Ich verglühe hier oben!«
»Ja, Massa.« Chopper verfiel für wenige Augenblicke in eine Art Laufschritt, dann bremste er langsam wieder ab. Die Sklavenkolonne, die etwas zurückgeblieben war, konnte wieder aufschließen.
Nach anderthalb Meilen, die Hügel zur Rechten waren inzwischen passiert, hatten sie den oberen Teil des Eilands erreicht. Hier war der Boden fester als im Süden, wo große Sumpfflächen das Inselbild bestimmten. Vor ihnen lag das Hauptgebäude der Plantage, Collincourt House. Es hatte die Form eines Ls, wobei die längere Seite vielleicht zwanzig Schritt maß. Ursprünglich war es aus starken Bohlen errichtet worden, doch hatte der Zahn der Zeit tiefe Risse ins Holz gegraben. Der Türsturz war niedrig, und kurz darüber begann schon das Dach – stumpfwinklig in seiner Form, um den von See heranpeitschenden Hurrikans weniger Angriffsfläche zu bieten. Die Fenster waren schmal und mit Läden verrammelt.
In früherer Zeit mochte das Haus den Ausdruck »stattlich« verdient gehabt haben, doch jetzt war es nur noch alt und morsch und von ungepflegtem Äußeren.
Hinter der langen Seite des Ls befand sich, der Feuergefahr wegen, ein eigenes Holzhaus für die Küche. Daneben lagen die Wohnungen der Aufseher und einige große Schuppen. Sie dienten im Herbst dem Trocknen der Tabakblätter. Aus einem dieser Schuppen stürzte plötzlich ein halbwüchsiger Schwarzer heraus, verfolgt von einem rotblonden, vierschrötigen Mann. Der Mann stolperte fast über seine eigenen Füße. Offensichtlich hatte er schon zu dieser Tageszeit dem Alkohol zugesprochen. Er war nicht mehr jung, doch kräftig von Gestalt. Über seinem Leib spannte sich ein erdfarbenes Wollwams, dazu trug er halb lange Köperhosen und feine, lederne Stiefel. Es war ein Schuhwerk, das seiner Eitelkeit dienlich sein mochte, nicht aber der schnellen Fortbewegung. »Warte, Nichtsnutz, ich werde dich Mores lehren!«, rief er mit schwerer Zunge. »Hast sämtliches Holz für die Darren falsch zugeschnitten, ich …«
Thomas Collincourt verhielt mitten im Satz, denn die Schwarzen waren in sein Blickfeld gerückt. »Aaah, die neuen Nigger. Dachte schon, sie kämen überhaupt nicht mehr!«
Er schnaufte, wackelte mit dem Kopf, als könne er dadurch Ärger und Alkohol gleichermaßen abschütteln, und kam näher. Kurz vor Murphys Karren baute er sich auf, sichtlich um Haltung bemüht. »Stehen die Nigger gut im Saft, Murphy? Keine Krankheiten oder Verletzungen oder so was?« Gern hätte er auch gefragt, ob das Mädchen nach wie vor Jungfrau war, doch verbot sich dies natürlich von selbst.
»Soviel ich sehen konnte, ja, Sir.« Murphy sprang vom Karren. »Sind bereits alle gebrannt, die schwarzen Teufel, wie Ihr befohlen habt, Sir.«
»Gut, gut.« Der Plantagenbesitzer löste die Augen von der Gruppe. »Was habt Ihr da für ein Dokument, Murphy? Sind das die Eintragungen der Namen und der Stammesherkunft?«
Murphy konnte sich nicht mehr genau erinnern. »Die Rolle ist von José, Sir, damit, äh … alles seine Richtigkeit hat.«
Collincourt nahm Einsicht in das Dokument. »Scheint alles in Ordnung zu sein.« Er unterdrückte einen Rülpser und gab die Rolle an Murphy zurück. Wieder fiel sein Blick auf die Gruppe. Die junge Negerfrau mit den prachtvollen Brüsten war Coramantierin, sie war die Schwester von diesem Riesen, der Okumba hieß, und ihm fiel ein, dass er bei ihrem Kauf extra darauf geachtet hatte. Weil das die Sache vereinfachte …
»Die Niggermänner gehen heute nicht mehr aufs Feld, es würde nicht lohnen«, sagte er laut. »Bis sie eingewiesen sind, ist der Tag vorbei. Inkpot und Chopper, nehmt ihnen die Jochhölzer runter, danach ab mit ihnen in die Hütten.« Collincourt deutete in nördliche Richtung, wo in einiger Entfernung ein paar armselige Behausungen standen.
»Jawohl, Massa.«
Während die beiden Schwarzen sich beeilten, den Befehl ihres Herrn auszuführen, stand Collincourt leicht schwankend und sich den Hosenbund zurechtrückend da. In seinen rotgeränderten Augen glitzerte es. Endlich war es so weit. Alle Schwarzen konnten sich frei bewegen.
»Die Negerfrau bleibt hier. Sie hilft der alten Mary ab morgen in der Küche.« Er trat auf das Mädchen zu und ergriff es am Oberarm. »Komm mit, mein schwarzes Täubchen, der Massa will dir etwas zeigen.«
Doch kaum hatte Collincourt Okumbas Schwester angefasst, sprang dieser vor und versetzte dem Tabakpflanzer einen Faustschlag ins Gesicht. Collincourt taumelte zurück. Abermals schlug der Riese zu. Collincourt sank auf die Knie, was aussah, als wolle er in der Kirche beten. Stattdessen stieß er einen unartikulierten Laut aus und hielt sich schützend die Arme vors Gesicht. Der dritte Schlag jedoch blieb aus. Murphy hatte seine Muskete abgefeuert. Mit ohrenbetäubendem Knall strich das Geschoss dicht über Okumbas Kopf und bohrte sich in die Tür des Wohnhauses. Der Riese erstarrte zur Salzsäule. Ungläubig quollen seine Augen aus den Höhlen. Nie zuvor schien er Ähnliches erlebt zu haben.
»Verdammter Nigger, ich blas dir’s Hirn aus dem Kopf, wenn du überhaupt eins hast!« Murphy sprang auf den Schwarzen zu und fesselte ihn eigenhändig, dann half er Collincourt auf die Beine. »Seid Ihr unverletzt, Sir?«
»Ahem … ja.« Collincourts Stimme klang belegt. Er begann sich den Staub von der Hose zu klopfen, wobei er Okumba hasserfüllt musterte. »Murphy, Ihr sorgt dafür, dass dieser schwarze Satan morgen früh drei Dutzend Hiebe bekommt. Die Strafe soll vor den anderen Niggern vollzogen werden, noch bevor sie aufs Feld gehen. Ich will, dass er sich wünscht, er wäre nie geboren. Doch achtet darauf, dass er nicht krankgeschlagen wird. Er hat mich eine Stange Geld gekostet, und er soll arbeiten, bis ihm das Wasser in seiner Niggerfurche kocht!«
Abermals, diesmal unbehelligt, packte Collincourt die junge Frau am Arm und schob sie in Richtung seines Wohnhauses.
Okumbas Schwester zitterte am ganzen Körper.
»Ho, tobacco, ho!
Go, go, go!
Goin’ to, goin’ fro,
through a furrow
with a bow.
Ho, tobacco, ho!
Go, go, go!
Ho, tobacco, ho!
Go, go, go!
Goin’ zig, goin’ zag,
whip make crack
on my back.
Ho, tobacco, ho!
Go, go, go!«
Der schwermütige Singsang der Sklaven drang zu der rothaarigen Reiterin herüber, die abgesessen war und sich mit ihrem Pferd einem starken Pfahl näherte. An dem Pfahl hing in Mannshöhe der Magen einer Bisonkuh. Er diente den Schwarzen als Wasserbehälter.
»Darf ich meinem Braunen ein wenig von eurem Wasser geben?«, rief die Frau ihnen freundlich zu.
Ein paar der Sklaven hoben die Köpfe. Sie standen, einer hinter dem anderen, tief gebückt in den Furchen des Felds, wo sie in Dreiergruppen arbeiteten. Jeder hatte seine spezielle Aufgabe: Der erste hackte das Unkraut fort, damit die Tabakpflanzen Licht und Luft bekamen, der zweite pflückte die Spitzen ab, damit sie keine Blüten trieben, und der dritte sammelte Raupen, Käfer und sonstige Schädlinge von den Blättern.
»Oh ja, Ladymissu Arlette!« Ein dürrer Schwarzer mit sehnigen Armen richtete sich auf und stapfte herbei. »Brauchen Wasser nicht mehr, ist bald Ende Arbeit diesen Tag, Mbamo tut Rücken weh, merken daran!« Der Dürre deutete auf seine Hinterseite und grinste. »Ich helfen Ladymissu.«
Arlette lächelte und beobachtete Mbamo, wie er vorsichtig den Kuhmagen herunter nahm und seinen Inhalt in einen bereitstehenden Holzeimer goss. Der Mann nannte sie hartnäckig »Ladymissu«, seit sich herumgesprochen hatte, dass sie die Enkelin eines echten englischen Lords war. Dabei sah sie alles andere als ladylike aus: Statt eines Kleids nach der neuesten Londoner Mode trug sie eine lederne Reiterkluft, die ihren Körper vor Dornen und Buschwerk schützte. Statt eines Spitzenkragens und juwelenbesetzter Ketten trug sie ein Schweißtuch um den Hals. Und statt eines züchtigen Damensattels bediente sie sich eines Männersattels, der sie zwang, beim Reiten die Beine weit zu grätschen. Nicht, dass ihr das besonders viel ausgemacht hätte – doch sie war froh, dass niemand aus dem sittsamen alten England ihr dabei zusah.
Das einzig Weibliche an ihr war der große, mit grünen Bändern geschmückte Hut, der mit seiner breiten Krempe vor der Sonneneinstrahlung schützte. Als Rothaarige hatte sie eine besonders zarte weiße Haut, und sie erinnerte sich noch gern an die vielen Komplimente, die man ihr wegen ihres guten Aussehens gemacht hatte.
Das alles lag kaum ein Jahr zurück.
Vieles war seitdem passiert, und das wenigste davon hatte ihr gefallen. So schön Roanoke Island landschaftlich auch war – das Leben hier war unerträglich. Die Hitze war mörderisch, die Mücken allgegenwärtig, die Fiebergefahr hoch, die Arbeit eintönig, die Abende immer gleich. Wer sich nach Abwechslung wie Musik, Tanz oder Konversation sehnte, wurde bitter enttäuscht. All das gab es auf Roanoke nicht.
Und dann war da noch Thomas Collincourt, der ewig unzufriedene Trinker, der zu allem Unglück ein entfernter Onkel von ihr war. Dass in seinen Adern ebenfalls adliges Blut floss, konnte sich niemand, der ihn sah, auch nur im entferntesten vorstellen.
Als kleines Mädchen hatte sie immer davon geträumt, eines Tages der Enge des englischen Landlebens zu entfliehen und zu Thomas in die Neue Welt zu segeln. Sie hatte von Abenteuern geschwärmt und von einem Märchenprinzen, der hier um ihre Hand anhalten würde.
Doch es war anders gekommen.
Zwar hatte sie auf der Überfahrt einen jungen Mann kennen gelernt, der sich Vitus nannte und in den sie sich Hals über Kopf auf das heftigste verliebt hatte, aber dieser Vitus war ein Hochstapler und ein Dieb gewesen. Sie hatte ihn auf frischer Tat in ihrer Schiffskabine ertappt – mit der Hand in ihrer Kleidertruhe. Damit nicht genug, hatte er noch ernsthaft behauptet, er sei ein gebürtiger Collincourt! Sie hatte ihn hinausgeworfen und anschließend wie ein Schlosshund geheult. Später, viel später, waren ihr Zweifel gekommen, und sie hatte sich dabei ertappt, wie sie sich ein ums andere Mal nach ihm sehnte … Doch da war sie schon lange auf Roanoke, und niemand konnte die Zeit zurückdrehen.
Ihre Gedanken kehrten zu Thomas Collincourt zurück. Sie wusste, er war alles andere als ein erfolgreicher Pflanzer, und nur den regelmäßigen Zuwendungen ihres Großvaters hatte er es zu verdanken, dass er sich gerade so über Wasser halten konnte.
An den wenigen Abenden, da Thomas nicht betrunken war, hatte er ihr erzählt, wie damals, vor über fünfundzwanzig Jahren, alles begonnen hatte: Er war mit großen Erwartungen und einer stattlichen Menge Geldes in die Neue Welt gereist. Von Anfang an hatte er eine Insel sein Eigen nennen wollen, denn der Gedanke, Nachbarn wie in England zu haben, war ihm ein Gräuel gewesen. So hatte er sich mit Aufsehern und Arbeitern auf Roanoke niedergelassen und zunächst sein Glück mit dem Anbau von Tabak versucht. Doch seine Unerfahrenheit hatte sich alsbald gerächt. Nach mehreren Missernten hatte er seine Bemühungen eingestellt. Zuckerrohr schien Erfolg versprechender zu sein. Er hatte weite Flächen urbar machen lassen und Jahr um Jahr auf den großen Durchbruch gehofft. Auch dieser Versuch war letztendlich fehlgeschlagen, denn auf dem Land schien kein Segen zu liegen. Fieberseuchen und Indianerüberfälle hatten ein Übriges getan. Aber Thomas hatte nicht aufgegeben. Seit zwei Jahren galten seine Bemühungen wieder dem Kultivieren ausgedehnter Tabakfelder, und er hoffte, seine Ware im nächsten Jahr erstmals verkaufen zu können. Zunächst im karibischen Raum, später vielleicht sogar nach England.
Das Pferd hatte unterdessen gesoffen. Es nahm den Kopf aus dem Eimer und schüttelte ihn schnaubend. Ein paar kräftige Wasserspritzer trafen Mbamo ins Gesicht. Der Schwarze riss den Arm hoch und verzog dabei vor Schmerzen das Gesicht.
»Ist etwas mit deinem Arm, Mbamo?« Arlette war die Reaktion nicht entgangen.
Der Sklave setzte ein gleichmütiges Gesicht auf. »Nichts, Ladymissu. Ich nur erschreckt.«
»Unsinn, du hast doch da was. Lass mal sehen.« Die Frau nahm den Arm und untersuchte ihn. Dann sah sie die Ursache: Halb in der Achsel saß eine schwärende Wunde. Die violetten Ränder waren aufgequollen, winzige Fliegen saßen darauf. »Wie ist das passiert?«
»Nicht schlimm, nicht schlimm. Wachsen zu von selbst.«
Arlette bog vorsichtig die Wunde auseinander, um Art und Ausmaß der Verletzung besser einschätzen zu können. Der Schwarze zog vor Schmerz die Luft durch die Zähne. »Es sieht aus, als wäre die Wunde durch eine Hacke hervorgerufen worden. Dein Vordermann könnte sie nach hinten durchgeschwungen und dich getroffen haben. War es so, Mbamo?«
»Ja, Ladymissu. Ich zweiter Mann in Reihe. Ich hinter Bongo. Aber Bongo keine Schuld. War Unfall.« Mbamo wurde nervös. »Bongo keine Schuld.« Er wusste, dass die Arbeitskraft eines Sklaven von alles überragender Wichtigkeit war. Wer sie schwächte, ob bei sich selbst oder bei anderen, lief Gefahr, sich ein Dutzend Peitschenhiebe einzuhandeln.
»Ich glaube dir ja. Aber warum, um Jesu Christi willen, bist du nicht früher zu mir gekommen?« Ohne Mbamos Antwort abzuwarten, nahm sie aus der Satteltasche ihres Braunen etwas Verbandszeug. Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, derlei mit sich zu führen, denn es kam bei der Feldarbeit immer wieder zu Verletzungen.
Während sie die Wunde schnell und geschickt säuberte, wanderten ihre Gedanken abermals zurück zu dem Mann, der sich Vitus nannte und ein Collincourt sein wollte. Er hatte sich, das musste sie einräumen, damals nach dem Seegefecht gegen die Spanier prachtvoll verhalten. Stunde um Stunde hatte er geschuftet, um die zahllosen Verwundeten zu versorgen, und nicht wenige von ihnen verdankten ihm ihr Leben. Er war, so seine Behauptung, ein Cirurgicus. Und sie, Arlette Collincourt, hatte ihm gern bei seiner Arbeit geholfen …
Sie verscheuchte die müßigen Gedanken, nahm eine zinkhaltige Salbe zur Hand und bestrich damit die Wunde. Dann legte sie eine Kompresse an, die sie mit einigen Leinenstreifen fixierte. »Fertig.«
Mbamo reagierte nicht.
»Hallo, Mbamo, träumst du?«
»Mbamo traurig. Alles falsch sein. Sowieso.«
»Wie? Was soll falsch sein?« Sie blickte ihn forschend an. Die Stimmungen der Schwarzen, die sich häufig von Augenblick zu Augenblick wandelten, würden ihr ein ewiges Rätsel bleiben.
»Egal, Ladymissu. Ladymissu freundlich. Egal.«
»Jetzt aber heraus mit der Sprache!« Sie schüttelte ihn sanft, damit er zu sich kam.
Mbamo zögerte. Schließlich sprach er: »Mbamo denken, Tabak nix gut schmecken. Letzte Jahr genauso. Herbst kommen Ernte. Viel Arbeit. Tabak darren. Fässer packen. Viel Arbeit. Gut Arbeit. Nix Verschnitt, nix Steine, nix Feuchtigkeit. Aber Tabak nix schmecken. Massa nehmen Kot, düngen Feld. Deshalb so.«
Arlette staunte. »Willst du damit sagen, dass Felder, die mit, äh … Kot gedüngt werden, schlecht schmeckenden Tabak hervorbringen?«
»Kot schlecht! Immer schlecht. Nix gut düngen. Ich wissen!« Mbamo nickte heftig.
»Nun, ich erinnere mich, dass im Frühjahr damit gedüngt worden ist.« Ihr Blick wanderte über die Felder, die sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnten. Der Aufseher Murphy, fiel ihr ein, hatte einmal gesagt, die Größe der Felder allein mache noch keine gute Tabakplantage aus. Ebenso wichtig sei die Möglichkeit, regelmäßig neue Felder anlegen zu können. Allerdings seien dazu riesige Flächen nötig. Genau da schien der Hase im Pfeffer zu liegen: Die Anbaufläche auf Roanoke war nur allzu begrenzt. Statt neuen, nicht ausgelaugten Boden nutzen zu können, musste Thomas den alten düngen – mit Kot.
Sollten seine Bemühungen damit endgültig gescheitert sein? Musste ihr Großvater die hohen Summen, mit denen er wieder und wieder die Plantage unterstützt hatte, in den Wind schreiben?
Sie seufzte innerlich. Wenn hier alles zu Ende ging, würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als nach England zurückzukehren, dorthin, wo der alte Lord seinen Familiensitz hatte – nach Greenvale Castle. Er würde wissen wollen, warum sie ihm die ganzen Monate kein Wort geschrieben hatte. Und es würde nicht leicht werden, ihm zu erklären, dass sie sich zu sehr geschämt hatte. Weil sie damals einfach fortgegangen war, ohne ihm die Gründe zu nennen. Und weil alles, was überhaupt schief laufen konnte, auch schief gelaufen war. Sie hatte einen großen Fehler gemacht, und sie durfte nicht auf sein Verständnis hoffen.
Sie machte sich daran, das Verbandszeug und die Salbe in der Satteltasche zu verstauen. »Ich sehe mir die Wunde morgen Vormittag noch einmal an. Wenn sie dann nicht besser geworden ist, musst du ein, zwei Tage mit der Arbeit aussetzen.«
»Ladymissu, oh Ladymissu!« Die Stimme von Mbamo klang aufs höchste erschreckt.
»Nanu, was ist daran so schlimm?« Arlette sah auf und erkannte, dass Mbamos Ausruf nicht ihrem letzten Satz gegolten hatte. Er starrte voller Angst nach Norden, wo das dichte Buschwerk den Blick zur Küste verwehrte.
Davor stand ein Indianer.
Arlette stockte der Atem. Noch nie hatte sie einen Wilden leibhaftig zu Gesicht bekommen. Dieser da sah zum Fürchten aus. Er war grell bemalt und bis an die Zähne bewaffnet. Den Flachbogen trug er quer über der Schulter, den Speer hatte er in der Hand, in seinem Gürtel steckte eine Kriegskeule mit messerscharfer Steinklinge. Unwillkürlich ergriff sie Mbamos Hand. »Es ist nur ein einzelner«, versuchte sie sich und den Schwarzen zu beruhigen.
Zwei weitere Indianer traten aus dem Buschwerk hervor.
Arlette spürte, wie auch in ihr die Angst emporkroch. Dann sah sie gleich mehrere Wilde hinter einer Bodenwelle auftauchen. Der Abstand zwischen ihnen und ihr betrug höchstens dreihundert Schritte. Da! Von Westen her kamen weitere Wilde. Und dort! Noch mehr! Wie viele mochten es schon sein? Fünf Dutzend? Sechs Dutzend? Sie hatten einen weiten Halbkreis gebildet und umschlossen die gesamte Stirnseite des Tabakfelds.
Auch die anderen Sklaven hatten die Gefahr bemerkt. Unter großem Geschrei ließen sie alles stehen und liegen und kamen herbeigestürzt, um bei Arlette Schutz zu finden.
Bleib ruhig!, ermahnte sie sich. Gib den Schwarzen ein gutes Beispiel! Ihre Hand tastete zum Gürtel, in dem eine Radschlosspistole steckte. Thomas hatte sie ihr einst gegeben und sie dabei ermahnt, die Waffe stets geladen und gespannt mit sich zu führen. Umständlich hatte er von Federn, Zähnen, Zündkraut und Pyrit geredet, und sie hatte kein Wort verstanden, nur dass sie zum Schießen dreierlei tun musste: den Deckel der Pfanne entfernen, den Hahn absenken und den Abzughebel betätigen. Dann passierte alles gedankenschnell – und dennoch nützte es ihr hier, im Angesicht der zahlreichen Feinde, überhaupt nichts.
Jetzt hob der erste Indianer die Arme und stieß einen lang gezogenen, gutturalen Schrei aus. Das schien das Angriffssignal zu sein. Wie ein Mann liefen alle Krieger auf sie zu.
Arlettes Gedanken rasten. Was konnte sie tun? Sollte sie kämpfen? Zusammen mit den Schwarzen? Nein, die Überlegung war lächerlich. Also Flucht? Ja, aber wohin? Die einzige freie Seite ging nach Süden, ja, nach Süden mussten sie fliehen! Dort befanden sich auch die Hütten der Schwarzen und, noch weiter entfernt, Thomas’ Wohnhaus. »Höre, Mbamo! Du und deine Leute, ihr lauft so schnell ihr könnt zu euren Behausungen. Ich glaube nicht, dass die Wilden es auf euch abgesehen haben, aber verrammelt auf jeden Fall die Türen! Und haltet eure schweren Hacken bereit. Gott sei mit euch!«
»Ja, Ladymissu, ja!« Mbamos Stimme war heiser vor Furcht.
»Ich reite zum Wohnhaus und alarmiere Master Thomas und die anderen. Der Allmächtige gebe, dass wir alle am Leben bleiben!«
Mit katzenhafter Kraft schwang sie sich in den Sattel und galoppierte davon.
Als nach kurzem, scharfem Ritt das Anwesen von Thomas Collincourt in ihr Blickfeld rückte, bot sich Arlette ein Bild voller Frieden. Nur ein Ziegenbock, der in der Nähe des Küchenschuppens angepflockt war, meckerte ein paar Mal. Keine Menschenseele war zu sehen. Doch da: Ein ihr unbekannter Schwarzer eilte über den Hof und schlüpfte durch die niedrige Haustür ins Innere des Gebäudes. Der Schwarze war von riesiger Gestalt, und als er verschwand, blitzte etwas in seiner Hand auf.
Seltsam!, schoss es ihr durch den Kopf, was hat der Kerl dort zu suchen? Doch sie war viel zu aufgeregt, als dass sie lange darüber hätte nachdenken können.
Kurz darauf stand sie selber vor dem Haus. Schon wollte sie die Tür aufstoßen, da meckerte der Ziegenbock erneut. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Was zögerst du?, fragte sie sich. Warum schreist du nicht um Hilfe? Stattdessen machte sie ihre Pistole schussbereit.
Sie holte tief Luft und öffnete die Tür. Drinnen im großen Raum, der dem Hausherrn als Wohn- und Schlafzimmer diente, war es sehr dunkel. Arlette blinzelte, während sie den schweren Eisenriegel vorschob. Thomas hatte wieder einmal die Fensterläden fest verschließen lassen, damit die Gluthitze keinen Einlass fand. Aber wo war Thomas? Er musste im Haus sein; es gab keine andere vernünftige Erklärung. Abermals blinzelte Arlette und blickte suchend in die Runde.
Dann sah sie ihn.
Er lag bäuchlings auf seinem großen Bett an der gegenüberliegenden Wand. Er war nackt, und sein Rücken war rot von Blut. So rot wie das Messer, das der riesige Schwarze über ihm in der Hand hielt.
Arlette schrie auf.
Der Schwarze rief irgendetwas, das sie nicht verstand, und sprang zur Seite.
Beide musterten einander.
»Indianer«, sagte Arlette endlich und war sich augenblicklich der Unsinnigkeit dieser Warnung bewusst. Ihre Hand hob die Radschlosspistole. Der kalte Griff der Waffe hatte etwas Beruhigendes. Sie richtete den Lauf auf den Riesen. »Warum hast du den Massa umgebracht?«, fragte sie mit einer Stimme, die sie selbst nicht kannte. »Ich werde dich töten.«
Im Gesicht des Schwarzen, dessen Ausdruck eben noch wild entschlossen gewesen war, ging eine Verwandlung vor sich. Seine Augen quollen aus den Höhlen, und hastig trat er einen Schritt zurück.
»Ich werde dich töten«, wiederholte Arlette und spürte, dass sie niemals dazu in der Lage sein würde.
Der Riese wich einen weiteren Schritt zurück. Ohne recht zu wissen, was sie tun sollte, ging sie vor und trat auf der anderen Seite neben das Bett.
Plötzlich vernahm sie ein Schluchzen, das von unten zu ihr hinaufdrang und deshalb keineswegs von dem Schwarzen stammen konnte. Sie senkte den Blick und entdeckte ein Bein: das schwarze Bein einer Negerin, die begraben unter Thomas’ schwerem Leib lag. Wieder das Schluchzen. Es war jenes Geräusch, das tagtäglich tausendfach auf dieser Welt zu hören ist und das jede Frau instinktiv erkennt: das Schluchzen einer vergewaltigten Frau.
Arlette war versucht, der Schwarzen zu helfen, aber sie wusste nicht, wie. Wenn sie die Leiche von der Frau heben wollte, würde sie dazu beide Hände brauchen, was bedeutete, dass sie die Pistole aus der Hand legen musste. Das kam auf keinen Fall in Frage. Unschlüssig verharrte sie.
Nachdem eine kleine Ewigkeit vergangen war, schien sich der Schwarze sicherer zu fühlen. Er trat einen Schritt heran und stieß abermals unverständliches Zeug aus.
»Bleib, wo du bist.« Arlette richtete ihre Waffe auf seinen Kopf. Der Riese sprang zurück.
»Ich beginne zu begreifen, warum du den Massa getötet hast. Wahrscheinlich ist die Schwarze deine Frau oder Freundin. Trotzdem wird man dich für diese Tat hängen.« Arlette wusste jetzt, was sie wollte. Sie bewegte sich rückwärts gehend zur Tür, wobei sie den Riesen nicht aus den Augen ließ. »Aber die Frau tut mir von Herzen Leid. Los, nimm den Massa von ihrem Körper herunter.«
Erst nachdem sie mehrmals eine erklärende Handbewegung gemacht hatte, nickte der Riese verstehend. Er packte Thomas bei den Schultern und drehte ihn um. Der willenlose Leib entglitt seinem Griff und sackte vom Bett. Arlette sah, dass Thomas’ Penis noch immer halb aufgerichtet war. Ekel erfasste sie. Fort, nur fort von dieser Stätte des Grauens! Rasch wandte sie sich um – und zuckte am ganzen Körper zusammen.
Vor ihren Augen, krachend und alles zersplitternd, fraßen sich Kriegskeulen durch die Tür.
Der Examinator Banester
»Donnerwetter, schon so spät? Nun, ich muss gestehen, dass ich mich eines kleinen Hungergefühls nicht ganz erwehren kann.«
Harvey Blossom war ein kleiner Mann mit einer Gesichtshaut, der man ansah, dass sie nicht häufig mit dem Tageslicht in Berührung kam. Seine Hände, mit denen er gestenreich zu reden pflegte, waren knochig, sein Gesicht faltig und sein Kopf nahezu kahl. Er zählte dreiundvierzig Jahre, und einen Großteil dieser Jahre hatte er als Hausdiener des Sehr Ehrenwerten John Banester verbracht – seines Zeichens Lizentiat von Oxford, Professor in London und Cirurgicus Ihrer Majestät Königin Elisabeth I. von England.
An diesem trüben Morgen, da wieder einmal Nebel die Ufer der Themse einhüllte, näherte sich Harvey vorsichtig der Tür zum Allerheiligsten seines Herrn. Er wusste, dass Banester zu unwirschem Gebaren neigte, wenn er in seinem Arbeitsraum gestört wurde, dies umso mehr, wenn er unpässlich war.
Der Diener klopfte und trat, ohne eine Antwort abzuwarten, ein. »Sir, ich darf Euch melden …«, hob er an und brach augenblicklich wieder ab. Zu ungewöhnlich war der Anblick, der sich seinen Augen bot. In der Mitte des Raums, einem Felsblock gleich, saß Banester unter einem riesigen, ihn zur Gänze bedeckenden Tuch. Seine sich abzeichnenden Ellenbogen standen weit gespreizt auf dem Arbeitstisch vor ihm. Keine Bewegung verriet, ob Leben in dem Felsblock wohnte, doch einige mühsam schniefende Laute, die unter dem Tuch hervorklangen, sprachen dafür.
»Was gibt’s, Harvey?«, krächzte eine Stimme, die klang, als würde ihrem Besitzer die Nase zugepresst. Banester schlug das Tuch zurück. Wabernde, aus einer Schüssel aufsteigende Inhalationsdämpfe wurden sichtbar. Sie umspielten ein verquollenes Gesicht, das an das Aussehen eines Ochsenfrosches erinnerte. Kein Zweifel: Der Professor war schwer erkältet.
»Sir, ich darf Euch melden, dass der Prüfling soeben eingetroffen ist. Er befindet sich bereits im Examiniersaal, wo auch die Herren des Collegium medicum schon auf Euch warten.« Der Diener deutete vage hinter sich, um anschließend mit einer dramatischen Geste fortzufahren: »Oh, Sir, bei meiner armen Seele! Wenn ich auch nur geahnt hätte, wie schlecht Euer Befinden heute Morgen ist, hätte ich …«
»Schon gut, lass die Faxen.« Banester stand auf, wickelte sich mit einiger Anstrengung aus dem Tuch und schritt zur Tür. Er war, wenn nicht gerade eine Erkältung sein Gemüt belastete, ein Mann von freundlicher Wesensart. Er hatte einen klaren Verstand und kleine, scharf beobachtende Augen, in denen dann und wann ein guter Schuss Humor aufblitzte. Banester war erst Ende dreißig und hatte trotz seiner verhältnismäßig jungen Jahre schon eine Reihe beachtlicher Erfolge auf dem Gebiet der Cirurgia erzielt. Unter anderem als Dreiundzwanzigjähriger, als er in der englischen Flotte beim Angriff auf Le Havre diente.
In London, diesem Pfuhl der Klatschmäuler und Alleswisser, waren seine Taten seit Jahren in aller Munde, nicht nur bei der Admiralität und im Navy Office, sondern auch im St. Bartholomew’s Hospital und anderen Krankenhäusern – eine Reputation, die letztlich sogar die Königin veranlasst hatte, sich seiner Künste zu versichern.
»Mein Befinden ist in der Tat schlecht, Harvey. Wir schreiben heute den 7. Oktober, und nicht weniger als 1577 Jahre sind seit unseres Heilands Geburt vergangen, doch noch immer hat es die medizinische Wissenschaft nicht verstanden, ein Mittel gegen etwas so Lächerliches wie den Schnupfen zu finden. Dennoch: Eine Absage des Prüfungstermins kommt nicht in Frage, zumal, wie du sagst, Clowes und Woodhall schon eingetroffen sind. Können’s wohl kaum abwarten, die beiden, unsere Aspiranten zu zwiebeln.«
Banester hielt inne, um den ordnungsgemäßen Sitz seiner Kleidung zu überprüfen. Er war nicht eitel, doch legte er Wert auf ein gepflegtes Äußeres. An diesem Tag trug er, einer alten Gewohnheit zufolge, bauschige englische Seemannshosen, die kurz unter dem Knie endeten, dazu ein Hemd mit Spitzenkragen, Weste, Wams und Schnallenschuhe – alles gut sitzend und aus feinsten Materialien zugeschnitten. Und alles, bis auf das weiße Hemd mit Kragen, in glänzendem Schwarz.
Harveys Hände hoben sich, als wollten sie wogende Wellen glätten. »Oh, Sir, mit Verlaub: Wie ich bereits sagte, haben wir es heute Morgen nur mit einem einzigen Examinanden zu tun, sein Name ist, äh … Vitus, glaube ich. Den Nachnamen habe ich vergessen.«
»Richtig, jetzt fällt’s mir wieder ein. Vitus von Campo … Camposowieso. Ich kann mir den Namen nicht merken. Der verdammte Katarrh raubt mir noch den Verstand.« Neben seiner unzweifelhaften Tüchtigkeit hatte der Professor eine weitere lobenswerte Eigenschaft: Er konnte Fehler und Schwächen eingestehen.
Er wandte sich um und schritt zu seinem Arbeitstisch zurück, auf dem neben der Inhalationsschüssel und Stapeln von Papieren ein in kunstvollen Frakturlettern abgefasster Brief lag. Das Schreiben war neun Wochen alt, es datierte vom 2. August, und sein Absender war ein Zisterzienserpater namens Thomas. Banester ergriff den Brief und überflog noch einmal seinen Inhalt. Nach mehreren Seiten, in denen der Absender, der ebenfalls Arzt war, ihn seiner Hochachtung versicherte, sowie ausführlichen Erläuterungen über das Kloster Campodios, welches sich im Nordspanischen befand, war Pater Thomas endlich auf das zu sprechen gekommen, um dessentwillen er den Brief offenbar geschrieben hatte:
… Ich erlaube mir, Sehr Ehrenwerter Professor, Euer Augenmerk auf einen jungen Mann zu lenken, den ich persönlich in der ärztlichen Kunst unterrichtet habe:
Vitus, so sein Name, wurde auf Campodios seit frühester Jugend in den Artes liberales unterwiesen, wobei er sich ein ums andere Mal auszuzeichnen wusste. Seine besondere Passion jedoch gilt einem Fach, welches gemeinhin nicht den Artes liberales zugeordnet wird: Es ist die Cirurgia. Hier war er mein vorzüglichster Schüler, der zu den größten Hoffnungen Anlass gab.
Doch hat es dem Allmächtigen in seinem unergründlichen Ratschluss gefallen, den Jüngling nach Abschluss des Studiums zweifeln zu lassen, was unter anderem dazu führte, dass er die Ordensgelübde nicht ablegte und stattdessen in die Welt hinauszog. Dieses trug sich im Jahre 1576 zu, und seitdem ist von ihm nur selten Kunde nach Campodios gedrungen. Dennoch weiß ich, dass er so bald nicht wieder in den Schoß der Kirche zurückkehren wird, vielmehr sich sehnlichst wünscht, auch von weltlicher Seite den Grad seiner ärztlichen Kunst bestätigen zu lassen. Dies am liebsten als Schiffschirurg …
Banester ließ den Brief sinken und zog vernehmlich die Nase hoch. Was glaubt das Jüngelchen eigentlich, wie es auf einem englischen Schiff zugeht?, dachte er grimmig. Besonders, wenn es eine Schlacht zu schlagen gilt? Da fließen Blut, Schweiß und Tränen! Da wird geschrien, gelitten und gestorben! Und der Schiffschirurg ist immer mittendrin. Er schient, renkt, kautert und amputiert! Alles Tätigkeiten, die ein bisschen anders sind, als den Furunkel an einem Mönchshintern aufzustechen!
Sein Sinn für Gerechtigkeit meldete sich und sagte ihm, dass es einem Gentleman nicht gut anstand, den Stab über einen Prüfling zu brechen, nur weil er aller Wahrscheinlichkeit nach ein verweichlichter Klosterjüngling war. Der Bursche hatte sich ordnungsgemäß zum Examen angemeldet, und eine Ausbildung hatte er auch, denn an den Worten seines Fürsprechers war nicht zu zweifeln. Im Übrigen konnte er, Banester, froh sein, dass es überhaupt Männer gab, die sich einem Examen zum Schiffschirurgen stellten. Noch immer konnte sich jeder hergelaufene Knochenflicker ungestraft Wundchirurg nennen, was dazu führte, dass nach wie vor mit der Gesundheit der englischen Seefahrer Schindluder getrieben wurde.
Ein anerkannter Abschluss musste endlich her, doch sein Ruf nach offiziellem Studium und Examen war zwar gehört worden, aber, wie überall auf der Welt, im zähen Mahlstrom der Behörden untergegangen. Nicht einmal die Tatsache, dass Ihre Majestät seinen Forderungen wohlwollend gegenüberstand, hatte daran etwas ändern können.
Also hatte er selbst die Initiative ergriffen und zusammen mit Clowes und Woodhall ein Collegium medicum gegründet, das regelmäßig Prüfungen durchführte. Sie nannten das Ganze Einschiffungsexamen – eine Prozedur, die in den weitläufigen Räumen von Banesters Haus stattfand und, dank des hervorragenden Leumunds der drei Examinatoren, zumindest halboffiziellen Charakter erlangt hatte. Dass ihr Bemühen sich mittlerweile bis nach Spanien herumgesprochen hatte, gab Banester neuen Schwung.
»Wirst du ein paar Kerle von den Kais auftreiben können, Harvey?«, fragte er und begab sich erneut zur Tür. »Du weißt schon, wozu wir sie brauchen.«
»Aber natürlich, Sir, das wird mir gelingen!« Der Diener klatschte theatralisch in die Hände. »Ich werde sie über Mittag beschaffen. Falls Ihr sie erst später am Nachmittag braucht, sperre ich sie solange in die Abstellkammer!«
»Schön, heute Vormittag magst du der Prüfung folgen. Aber stumm wie ein Fisch, wenn ich bitten darf. Und wehe, du machst Faxen!«
»Guten Morgen, Gentlemen!« Banester betrat, Harvey im Gefolge, gemessenen Schrittes den Examiniersaal, einen schmucklosen Raum, der fünfundzwanzig mal dreißig Fuß im Geviert maß und auf der Südseite drei hohe, zur Themse hinausgehende Fenster aufwies. An der hinteren Wand standen zwei lange Bänke, auf die man Gegenstände von unterschiedlichster Größe und Beschaffenheit gelegt hatte. Die Gegenstände waren nicht genau zu erkennen, denn große Stoffbahnen deckten sie ab.
Der Hausherr nickte den Anwesenden zu. Wie angekündigt saßen da bereits Clowes und Woodhall, seine beiden Co-Examinatoren. Sie wirkten noch etwas schläfrig zu dieser Stunde und nickten deshalb nur kurz zurück. Man kannte sich. Einige Schritte entfernt saß der Prüfling Vitus von Campodios.
Der Mann, das fiel sofort ins Auge, entsprach in seinem Äußeren keineswegs dem Vorstellungsbild eines Klosterbruders. Banester, der schwammige Gesichtszüge und einen von reichlicher Speise gerundeten Leib erwartet hatte, runzelte überrascht die Stirn. Der Bursche war von fester Statur mit gut proportionierten Gliedmaßen. Er hatte blonde Locken, eine gerade Nase und einen ausdrucksstarken Mund. In der Mitte des Kinns saß ein Grübchen, das gewissermaßen den Abschlusspunkt unter den klaren Gesichtslinien bildete.
Auch seine Kleidung durfte als bemerkenswert bezeichnet werden. Zwar fiel sie nicht aus dem Rahmen, denn eine gepolsterte Oberschenkelhose und ein gut sitzendes ausgestopftes Wams waren auf Londons Straßen nichts Ungewöhnliches, doch war sie aus kostbaren Tuchen hergestellt. Banester hatte ein Auge für so etwas.
Zu seiner Verwunderung wurde sein Blick ganz offen erwidert. Im Gegensatz zu den meisten Prüflingen, die ängstlich und aufgeregt waren und den direkten Blickkontakt mieden, musterte dieser Examinand ihn genauso sorgfältig. Wobei weder Anmaßung noch fehlender Takt in seinen grauen Augen lag, lediglich eine gute Portion Neugier.
Banester fühlte sich bemüßigt, etwas zu sagen. »Nun, Sir«, sprach er mit voller Nase, »ich nehme an, Ihr seid Vitus von Campodios.«
»So ist es, Professor. Ich freue mich, Eure Bekanntschaft zu machen.« Der Mann sprang auf und verbeugte sich höflich. »Den beiden anderen Herren habe ich mich bereits vorgestellt.«
»Sehr schön. Ihr habt Euch also entschlossen, vor diesem Prüfungsausschuss das Einschiffungsexamen abzulegen – warum?« Banester nahm ächzend zwischen Clowes und Woodhall Platz. Ein schwerer Eichentisch, auf dem ein Totenschädel mit kreisrunden Trepanationslöchern lag, trennte ihn jetzt von dem Examinanden.
»Nun, wenn Ihr gestattet, Professor, hole ich dazu etwas aus: Noch vor gar nicht langer Zeit, innerhalb der Klostermauern, galt meine ärztliche Kunst ganz selbstverständlich als gutes, gottgefälliges Werk – heute jedoch, außerhalb der Mauern, wird sie häufig schief angesehen. Man misstraut meiner Arbeit, ja, man beschimpft mich mitunter sogar. Warum ist das so? habe ich mich immer wieder gefragt und endlich die Ursache erkannt: Mir fehlt ein Titel, Sir, denn ohne Titel gilt niemand etwas in diesem Land. Einen Medicus, als welchen ich mich dem Wissen nach verstehe, darf ich mich nicht nennen, und alle anderen Titel kommen für mich nicht in Frage, denn als Bader, Feldscher, Schneidarzt, Bruchschneider, Wundstecher, Zahnbrecher oder sonst wie kann sich jedermann bezeichnen, ohne eine Ausbildung nachweisen zu müssen. Etwas Schriftliches in der Hand zu haben, das ist es, worauf es meiner Meinung nach ankommt.«
»Sehr wahr«, meldete sich William Clowes zu Wort. Er war ein kleiner, unscheinbarer Mann mit Halbglatze und schmalen Schultern. Dass er einer der besten Militärchirurgen und Anatomen Englands war, sah ihm niemand auf den ersten Blick an. »Doch wenn Ihr Euch als Medicus versteht, solltet Ihr wissen, dass die Kunst eines solchen mehr darin zu sehen ist, den menschlichen Corpus in seiner Gesamtheit zu erkennen: das Funktionieren der Organe beispielsweise, ihre Verflechtung miteinander und ihr Zusammenwirken mit den Adersträngen, der Muskulatur, den Nerven et cetera, et cetera – der Cirurgicus indessen ist eher für das Grobe, das Äußere zuständig. Bei ihm fallen Dinge wie Diagnose, Therapie und Indikation kaum ins Gewicht, von den Geheimnissen der Vier-Säfte-Lehre oder der Harnschau gar nicht zu reden … Nun, all das sind Gründe, warum ein Medicus an der Universität aus der Anatomie des Galenos zwar liest, aber keinesfalls die entsprechenden Schnitte am Körper des Leichnams vornimmt. Diese Arbeit überlässt er seinem Gehilfen, dem Prosektor. Oder dem Cirurgicus.«
»Das ist mir bekannt, Sir«, antwortete der Examinand respektvoll. »Ich darf wohl behaupten, dass ich in Theorie und Praxis gleichermaßen bewandert bin. Mein Herz jedoch schlägt für die Praxis. Ich operiere lieber eine Hasenscharte, als dass ich eine lange Vorlesung halte, doch gebe ich zu: Beides hat seine Berechtigung.«
»Wenn ich Euch recht verstehe«, bemerkte nun Woodhall scheinbar nebenbei, »habt Ihr das Wissen eines Medicus, wollt aber lieber mit Blut und Eisen arbeiten. Heißt das nicht Perlen vor die Säue werfen?«
Das war eine kleine, wohl überlegte Provokation.
Sie war Teil des Examens und typisch für Woodhall. Dem sechs Fuß langen, mit seinen hängenden Armen an eine Trauerweide erinnernden Arzt machte es diebische Freude, derartige Pfeile abzuschießen. Doch hatte das Ganze auch einen konkreten Hintergrund, denn die Gentlemen wollten wissen, wie leicht ihre Prüflinge aus der Fassung zu bringen waren. Brausten sie auf oder wurden sie gar laut, war das kein gutes Zeichen, sondern ein Indiz dafür, dass sie sich auch bei anderer Gelegenheit nicht unter Kontrolle haben würden – zum Beispiel bei einem chirurgischen Eingriff. Man durfte gespannt sein, wie dieser Vitus von Campodios reagieren würde. Banester und Clowes beugten sich neugierig vor.
»Keineswegs, Sir.« Die grauen Augen des Examinanden blitzten, während sein Mund lächelte. »Wie ich bereits sagte, ist mir das Praktizieren lieber als das Theoretisieren. Wobei ich der Meinung bin, dass ohne Theorie keine praktische Arbeit möglich ist – und umgekehrt. Beides ist gleich wichtig einzuschätzen. Wenn also der Medicus seinen Prosektor ob dessen Arbeit geringer achtet, ist er in meinen Augen selber gering zu achten. Oder, um es mit dem großen Doctorus Paracelsus zu sagen: ›Wo er nit ein Chirurgus darzu ist, so steht er do wie ein Ölgöz, der nichts ist als ein gemalter Aff.‹«
»Hört, hört!«, entfuhr es Banester. Der Prüfling hatte nicht nur den Pfeil abgewehrt, sondern es gleichzeitig verstanden, einen eigenen in Richtung Woodhall abzuschießen. Gerade so, als hätte er geahnt, dass der lange, dürre Mann derjenige unter ihnen war, der sich am ehesten etwas auf seinen Status einbildete.
»Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich ein examinierter Schiffschirurg werden möchte«, fuhr der blonde Mann freundlich fort, »es ist der Wunsch meines Großonkels, denn wir kommen aus einer Seefahrerfamilie.«
»Und wie heißt Euer Großonkel, wenn man fragen darf?«
Woodhalls Stimme klang säuerlich; er hatte sich noch nicht von dem Treffer erholt.
»Lord Collincourt, Sir. Wir leben zusammen auf Greenvale Castle, einem kleinen Schloss an der Kanalküste.«
»Lord Collincourt? Das ist nicht Euer Ernst!«, platzte Clowes heraus. »Seine Lordschaft habe ich persönlich vor ein paar Jahren von den Qualen eines ulcus befreit … äh, nebenbei, Herr Prüfling: Ihr wisst doch, was ein ulcus ist?«
»Ja, Sir, ein Magengeschwür.«
»Wenn der Herr Prüfling mit Lord Collincourt verwandt ist, wird er wahrscheinlich ebenfalls Collincourt heißen – und nicht ›von Campodios‹. Sehe ich das richtig?« Woodhall blickte fragend in die Runde. Man hörte ihm an, dass er langsam wieder Oberwasser bekam. Dann wandte er sich direkt an den Examinanden: »Warum habt Ihr Euch für diese Prüfung unter dem Namen Vitus von Campodios angemeldet, wenn Ihr in Wahrheit anders heißt?«
»Nun, Sir«, der Prüfling zögerte kurz, »wie Ihr wisst, wuchs ich im Kloster Campodios auf. Ich war als Findelkind anno 1556 von dem alten Abt Hardinus, dessen Seele der Allmächtige gnädig sein möge, vor dem Haupttor gefunden worden. So wuchs ich unter Mönchen auf, betete, lernte, studierte viel, und die Kirche war Vater und Mutter zugleich für mich. Doch als ich zwanzig Jahre zählte und immer sicherer wurde, dass ich kein Mönch werden wollte, machte ich mich auf, meine Herkunft zu ergründen. Auf einer langen, gefahrvollen Reise, deren Einzelheiten zu erzählen hier zu weit führen würde, fand ich heraus, dass ich ein Collincourt bin. Es muss so sein. Denn alles, was dafür spricht, habe ich Punkt für Punkt zusammengetragen. Und dennoch fehlt mir das letzte Beweisstück in der Kette, eine Winzigkeit, die weder mich noch Seine Lordschaft stört, aber letztlich der Grund dafür ist, warum ich nicht offiziell den Namen Collincourt führe.«
»Und was ist das für eine Winzigkeit?«, bohrte Woodhall nach, doch Banester, der endlich mit der Prüfung beginnen wollte, unterbrach:
»Lasst es gut sein, Woodhall. Wir wollen nicht die Namen dieses jungen Mannes erforschen, sondern sein medizinisches Wissen. Er heißt Vitus von Campodios, so viel ist sicher, schließlich habe ich den Brief von diesem Pater Thomas aus dem Kloster. Alles andere soll uns hier nicht interessieren. Fangen wir an.«
Banester schnaufte, zog ein großes Schnupftuch hervor und schnäuzte sich geräuschvoll. Dann, das Tuch wieder wegsteckend, hob er an: »Nun, Vitus von Campodios, lasst mich Euch zunächst erklären, wie das Ganze abläuft. Wir werden Euch viele Fragen stellen: Fragen zur Medizin im Allgemeinen und zur Cirurgia und ihren Instrumenten im Besonderen, ferner zum menschlichen Körper und seinen Funktionen und nicht zuletzt zur Kräuterheilkunde und ihrer praktischen Anwendung. Doch wird das Collegium seine Fragen nicht immer in Komplexen stellen, sondern mitunter auch bunt durcheinander, ganz wie es ihm beliebt. So wollen wir gleichzeitig Eure Geistesgegenwart prüfen – eine Eigenschaft, die dem Schiffschirurgen in vielerlei Hinsicht zugute kommt. Wohlan, zu Beginn eine aktuelle Frage: Sicher habt Ihr gehört, dass der Morbus gallicus, jene Plage aus Neu-Spanien, die auch als Lues oder Syphilis bekannt ist, immer weiter um sich greift. Was wisst Ihr über sie, und wie bekämpft Ihr sie?«
Der Prüfling schien etwas überrumpelt, fing sich aber rasch. »Nun, Professor, die Syphilis ist eine tückische Krankheit, die den Patienten über viele Jahre hinweg quälen kann. Man sagt, sie werde durch die, äh … Fleischeslust übertragen und begänne sich zuerst in Form eines scharfrandigen dunkelroten, feuchten Geschwürs am Geschlechtsteil zu zeigen, doch sind diese Erkenntnisse keineswegs unumstritten. Fest steht, dass der Morbus gallicus nach mehreren Jahren zu nässenden, juckenden Pusteln am ganzen Körper führt und später zu Verblödung, Lähmung und Tod.«
»Gut.« Banester klang knapp. »Soweit zu den Symptomen. Nun zur Therapie: Welche Maßnahmen könnt Ihr ergreifen, um das Leben des Patienten zu retten?«
»Nur wenige, und diese wenigen helfen kaum, denn die Syphilis ist praktisch unheilbar. Und wenn sie von Fall zu Fall doch kuriert werden kann, dann nur unter Inkaufnahme anderer Krankheiten. In concreto: Ich verordne Quecksilberschmierungen. Dabei wird der Patient am ganzen Körper mit Quecksilbersalbe eingerieben, eine Prozedur, die über kurz dazu führt, dass schwärende Wunden in Rachen und Gaumen entstehen, zudem bilden sich Geschwüre an den Lippen, und die Zähne fallen sämtlich aus. Von den wenigen Patienten, die auf diese Weise geheilt werden, stirbt jeder vorher tausend Tode.«
Woodhall mischte sich ein: »Wie viele Syphiliskranke habt Ihr schon behandelt, Herr Prüfling?«
»Keinen, Sir.«
»Keinen?« Woodhall schnaubte misstrauisch. »Und woher habt Ihr dann Euer Wissen?«
»Aus einem Werk namens De morbis hominorum et gradibus ad sanationem. Es ist ein Buch, das die wichtigsten Erkenntnisse aller großen Ärzte der Vergangenheit und der Gegenwart zusammenfasst. Pater Thomas ist der Herausgeber, doch muss ich hinzufügen, dass er selbst ebenfalls eine Reihe hervorragender Heilvorschläge beigesteuert hat. Im Falle der Syphilis sind es Abkochungen vom Guajakholz sowie die Verordnung der Salsarparriwurzel.«
»Ein interessanter Therapieansatz«, nickte Clowes beifällig. »Es wäre reizvoll, sich mit dem Pater darüber auszutauschen. Doch zurück zu Euch. Ihr habt die Quecksilberkur trefflich beschrieben. Dem, so denke ich, ist nichts hinzuzufügen. Lasst uns deshalb zu etwas kommen, bei dem wir Ärzte mehr ausrichten können.« Er wandte sich um und blickte auf die Wand in seinem Rücken. »Seht Ihr diese große Bildtafel, Herr Prüfling?«
»Jawohl, Sir.«
»Dann sagt mir, worum es sich dabei handelt.«
»Gern, Sir. Die Tafel zeigt einen so genannten Wundenmann – eine Figur zur Demonstration verschiedener durch Waffengewalt verursachter Verletzungen.«
»Richtig erkannt. Es ist eine Abbildung, die der berühmte Anatom und Cirurgicus Hanns von Gersdorff für sein Werk Feldtbuch der Wundartzney anfertigen ließ. Ein Werk von anno 1517, sehr beachtlich, auch wenn es seinerzeit nur auf Deutsch erschien.« Clowes erhob sich und trat an die Bildtafel heran. Sie zeigte die Strichzeichnung eines Mannes, der nackt bis auf einen kleinen Schurz dastand. In seinen Gliedmaßen steckten die unterschiedlichsten Waffen. »Ich weise auf die Verletzung hin, und Ihr, Vitus von Campodios, sagt mir, ob sie, normalen Heilverlauf vorausgesetzt, curabilis oder incurabilis ist. Ich nehme an, Ihr wisst, was diese Ausdrücke bedeuten?«
»Selbstverständlich, Sir. Zu den Fächern, die jeder Klosterschüler erlernen muss, gehört auch die lateinische Sprache. Curabilis bedeutet heilbar, incurabilis unheilbar.«
»Hm. Nun gut.« Clowes wurde sich bewusst, wie überflüssig seine Frage gewesen war. Dennoch: Es gab viele Examinanden, die ihren Caesar nicht gelesen hatten und sich in der Sprache der Wissenschaft nicht ausdrücken konnten. Dass manche trotzdem das Examen bestanden hatten, stand auf einem anderen Blatt. Clowes wies auf den Oberschenkel des Wundenmannes, in dem ein Pfeil mit eiserner Spitze steckte.
»Was haltet Ihr von dieser Verletzung, Herr Prüfling?«
»Curabilis. Rechtzeitige und fachmännische Behandlung vorausgesetzt, um dem Gangrän vorzubeugen.«
»Recte!« Clowes registrierte zufrieden, dass der Examinand die Hauptgefahr bei dieser Art Verletzung, den Wundbrand, unaufgefordert erwähnt hatte. »Und was sagt Ihr zu diesem Oberarm, der von einer Keule getroffen wird?«
»Curabilis. Stumpfe Schlagwaffen erzeugen meistens einfache Frakturen. Der Oberarmknochen dürfte sauber zusammenheilen, vorausgesetzt, eine ordentliche Bruchlade kommt zur Anwendung.«
»Ihr könnt mit einer Bruchlade umgehen?«
»Jawohl, Sir.«
»Was unternehmt Ihr, wenn Ihr nur eine Lade habt, aber zwei Brüche versorgen müsst?«
»Ich gehe nacheinander vor. Erst versorge ich den leichteren Bruch, ziehe mit der Lade die Knochen wieder in ihre Position, schiene sie und lege einen festen Verband an. Dann setze ich die Lade beim zweiten Bruch ein.«
»Warum kümmert Ihr Euch zuerst um die leichtere Fraktur? Wäre es umgekehrt nicht besser?«
»Pragmatische Gründe, Sir. Bei einem schweren Bruch kann das Armstrecken und Einpassen der Knochen langwierig sein. Kümmere ich mich aber zunächst um den leichteren Bruch, habe ich die erste Behandlung schon geschafft. Außerdem mag sich der Verletzte mit dem schwereren Bruch dadurch ermutigt fühlen.«
»Hm. Zurück zum Wundenmann: Dieser Dolch steckt tief in seiner Brust, was sagt Ihr dazu?«
Der Prüfling zögerte. »Wenn Ihr gestattet, schaue ich mir die Abbildung aus der Nähe an.« Er trat an die Tafel und studierte eingehend den Sitz der Wunde. »Incurabilis. Der Dolch sitzt so, dass die Lunge mit Sicherheit getroffen ist. Wahrscheinlich auch die eine oder andere Ader. Der Verletzte verblutet innerlich, oder aber er erstickt.«
»Dieser Armbrustpfeil im Hals?«
»Nun, der Pfeil steckt etwas seitlich. Vielleicht curabilis, sofern nicht der Kehlkopf oder Hauptadern getroffen sind. Da dies aber selten der Fall ist, wohl incurabilis.«
»Die durch den Morgenstern eingedrückten Rippen?« Clowes fragte jetzt immer schneller.
»Curabilis. Ein Streckverband und einige Wochen Ruhe genügen in der Regel.«
»Das Handgelenk, das von diesem Schlachtmesser nahezu durchtrennt wurde?«
»Die Hand ist nicht zu retten, wohl aber der Mann. Deshalb: curabilis.«
»Was tut Ihr im Einzelnen?«
»Ich trenne mit dem Skalpell die Hand ganz ab, dabei lasse ich …«
»Halt! Habt Ihr nicht etwas vergessen?«