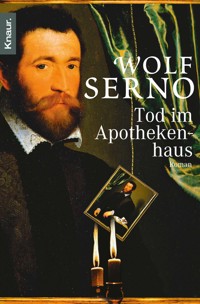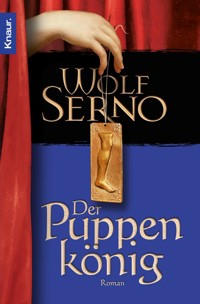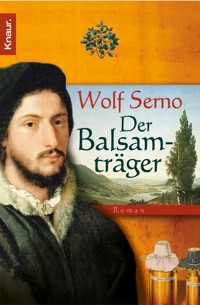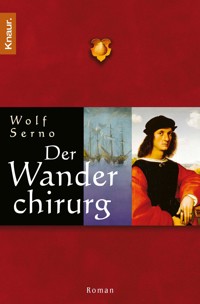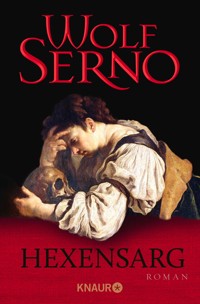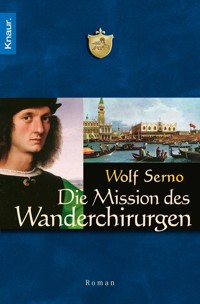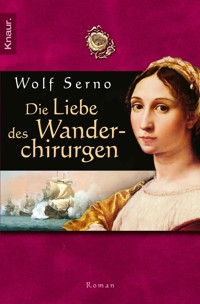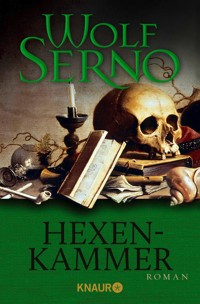
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lapidius-Serie
- Sprache: Deutsch
Hexenjagd im HarzKirchrode im Harz im Jahre 1547: Die Kräuterhändlerin Freyja steht unter einem schrecklichen Verdacht. Sie ist der Hexerei angeklagt. Dem zudem schwer kranken Mädchen kann nur einer helfen: der Alchemist Lapidius, der sie bei sich aufnimmt, um eine neue Heilmethode an ihr auszuprobieren. Er hat nicht viel Zeit, die Unschuld seines Schützlings zu beweisen ... Hexenkammer von Wolf Serno im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Wolf Serno
Hexenkammer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Prolog
Der Tag davor
Erster Behandlungstag
Zweiter Behandlungstag
Dritter Behandlungstag
Vierter Behandlungstag
Fünfter Behandlungstag
Sechster Behandlungstag
Siebter Behandlungstag
Achter Behandlungstag
Neunter Behandlungstag
Zehnter Behandlungstag
Elfter Behandlungstag
Zwölfter Behandlungstag
Dreizehnter Behandlungstag
Vierzehnter Behandlungstag
Fünfzehnter Behandlungstag
Sechzehnter Behandlungstag
Siebzehnter Behandlungstag
Achtzehnter Behandlungstag
Neunzehnter Behandlungstag
Zwanzigster Behandlungstag
Epilog
Wehe denen, die Böses gutund Gutes böse heißen,die aus Finsternis Lichtund aus Licht Finsternis machen …
Jesaja 5, 20
»Du verbrennst das Geblut.«»Ich lesche aus die Brunst der Unkeuschheit.«»Du bringst Schmerzen.«»Ich treib aus Unreinigkeit …«
Ulrich von Huttenim Zwiegespräch mit seiner Syphilis
Für mein Rudel:Micky, Fiedler († 16), Sumo, Buschmann und Eddi, den Dänen
Prolog
Das Blut spritzte, als der Erste Sohn des Teufels dem Zweiten Sohn des Teufels das Messer in den Arm stieß.
Der Dritte Sohn des Teufels lächelte mit starrem Blick. Auch sein Blut würde gleich fließen. Es würde in den eisernen Topf zu ihren Füßen rinnen und sich mit dem seiner beiden Brüder verbinden. Doch sie würden es noch nicht trinken.
Erst musste dem Ritual Genüge getan werden. Luzifer musste gnädig gestimmt sein, wollte man in den Bereich der höchsten Lüste vorstoßen.
Der entrückte Zustand, in dem sich der Dritte Sohn des Teufels befand, ließ ihn kaum den Schmerz spüren, als das Messer auch in seinen Arm drang. Wieder musste er lächeln. Es war lustig, wie das Blut spritzte. Und es würde schmecken. Denn es würde noch ein viertes Blut dazukommen. Bald, sehr bald.
Der Erste Sohn des Teufels nahm eine der Fackeln von der Wand und hielt sie hoch über sich. »Luzifer!«, rief er mit lauter Stimme, »Deine Söhne sind hier, um Dir zu huldigen!« Dann ließ er die Fackel kreisen und begann mit abgehackten Bewegungen um das Feuer zu tanzen.
Der Zweite und der Dritte Sohn des Teufels taten es ihm nach, denn die besondere Verbindung, die zwischen ihnen und dem Ersten Sohn des Teufels bestand, verlangte es so.
Ein schwerer Singsang, immer lauter werdend, drang aus den Kehlen der drei. Ihre Körper wurden schneller, ihre Masken bewegten sich im Takte des Singsangs. Die Melodie wurde rhythmischer. Die Körper passten sich ihr an. Schweiß lief den dreien in Bächen über die Haut. Schwerer Geruch nach Weihrauch lag in der Luft. Endlich, mit einem gutturalen Schrei, beendete der Erste Sohn des Teufels den Gesang, fiel erschöpft zu Boden und betete inbrünstig:
»Luzifer, Du Herrlicher!
Einzig bist Du, einzig warst Du,
einzig wirst Du immer sein!
Deine Kraft und Männlichkeit
komme über uns,
auf dass wir Dich
wie unser eigenes Leben lieben!
Auf ewig!«
»Auf ewig!«, riefen auch der Zweite und der Dritte Sohn des Teufels.
Nun würde bald das vierte Blut sich mit dem ihren vereinen.
Der Zweite und der Dritte Sohn des Teufels lächelten jetzt mit leuchtenden Augen. Denn das, was vorher käme, schmeckte ihnen noch besser als Blut. Sie würden eine Frau schmecken. Sie würden ihre Kraft in sie versenken.
Und Luzifer würde es gutheißen.
Der Erste Sohn des Teufels erhob sich und verließ den Ort ihrer Zeremonie. Er ging voran, den eisernen Topf in Brusthöhe vor sich haltend. »Sei bereit! Luzifer will seinen Tribut!«, rief er mit schallender Stimme. »Sei bereit, uns zu empfangen.«
Doch dort, wo vorhin noch eine Frau gelegen hatte, war nur noch leerer Stein. Luzifers Opfer war fort.
Die Freude des Zweiten und des Dritten Sohns des Teufels hielt unverändert an. Sie verstanden das Geschehene nicht.
Der Erste Sohn des Teufels war der Einzige, der die ganze Tragweite dieses Ereignisses ermessen konnte. Hastig setzte er den Topf mit dem Blut ab und riss sich die Maske herunter. Sein Gesicht verzerrte sich vor Wut.
»Dafür muss sie brennen!«, zischte er.
Der Tag davor
Der Mann, der sich Lapidius nannte, stand in seinem Laboratorium und schob zwei Buchenscheite in einen bauchigen Ofen aus roten Ziegeln. »Das Feuer im Athanor muss ununterbrochen brennen«, murmelte er, »ununterbrochen, denn je mehr es dem ewigen Feuer gleichkommt, desto besser gelingt das Werk.« Aufmerksam beobachtete er, wie die Flammen sich augenblicklich in das abgelagerte Holz fraßen.
Als er sicher war, dass die Scheite gut durchglühen würden, ging er die drei Schritte hinüber zu seinem Experimentiertisch, dessen Oberfläche gänzlich mit gläsernen Tiegeln und Kolben bedeckt war. Er zog ein papierenes Büchlein heran, schlug es auf und beugte sich über seine Aufzeichnungen. Es waren Angaben zu seiner jüngsten Versuchsreihe, die er am Tag zuvor festgehalten hatte: Angaben über Stoffe, Flüssigkeitsmengen, Temperaturen, Verfärbungen und zeitliche Abfolgen. Er musste die Augen zusammenkneifen, um die Eintragungen besser entziffern zu können. Geraume Zeit las er. Das, was er gestern geschafft hatte, machte Sinn. Die einzelnen Schritte waren logisch, die Erkenntnisse richtig. Ein Gefühl der Zufriedenheit durchströmte ihn. Trotzdem würde es noch eine Weile dauern, bis er am Ziel war. Geduld und Scharfsinn, das war es, worauf es in der Alchemie ankam.
Er blickte auf und blinzelte. Seine Augen wurden schwächer. Das war eine bedauerliche Tatsache. Er war beinahe vierzig, und mit jedem Jahr, das er älter wurde, ließ seine Sehkraft nach. Jedenfalls auf kurze Entfernungen. Er seufzte, griff zu einem schön gearbeiteten Federmesser und spitzte einen Gänsekiel an. Dann, nachdem er ihn in ein bereitstehendes Tintenfass getaucht hatte, schrieb er mit akkurater Schrift auf eine neue Seite:
Pagina 19
noch: Die Amalgamation zum Zwecke der Gewinnung
von Gold und Silber mittels Quecksilber.
Variatio VII, Montag, 11. Aprilis AD 1547
Abermals kniff er die Augen zusammen. Wenn das so weiterging, brauchte er bald eine Sehhilfe. Er tauchte die Feder erneut ein, als unvermutet heftig an die Tür geklopft wurde. »Was gibts?«, rief er, nicht eben verbindlich. Gewöhnlich war er ein Mann von freundlichem Wesen, doch konnte er es nicht ausstehen, wenn man ihn während der Arbeit unterbrach.
Die Tür wurde aufgestoßen. Marthe, seine Magd, stand da. Sie war ein strammes Weibsbild von siebenundzwanzig Jahren, mit roten Backen, blauen Augen und lockerem Mundwerk. »Herr, ich weiß, dass Ihrs nich gern habt, wennich stör, abers geht nu mal nich anners. Der Büttel is draußen, un es wär sehr dringend!«
»Ja, und?« Lapidius streute Löschsand auf seine Zeilen.
»Inner Folterkammer is ne junge Frau, die hamse gepiesackt, un nu isse ohnmächtich, un es kann nich weitergehn.«
Lapidius beabsichtigte nicht, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. »Dass hier in Kirchrode gefoltert wird, ist schlimm genug. Du weißt, dass ich derlei Methoden keinesfalls billige. Aber ich habe nichts damit zu schaffen. Dafür ist der Stadtmedicus zuständig. Er ist approbiert, im Gegensatz zu mir.« Lapidius wollte sich wieder über sein Versuchsprotokoll beugen, doch Marthe ließ nicht locker:
»Der Büttel sacht, der Medicus is krank.«
»Nun gut, dann ist da immer noch der Bader. Möge er der Frau helfen.«
»Der Büttel sacht, der Bader hatn Arm inner Schlinge. Seit gestern. Der kann auch nich. Deswegen, sacht er, isser ja hier.«
Lapidius runzelte die Stirn und fügte sich in sein Schicksal. Es sollte wohl nicht sein, dass er an diesem Vormittag zum besinnlichen Experimentieren kam. »Die Ohnmächtige befindet sich in der Folterkammer, sagtest du?«
»Ja, unten im Keller vom Rathaus, un Ihr möchtet ganz schnell kommen.«
»Gut.« Jetzt, wo Lapidius sich gedanklich von seiner Arbeit getrennt hatte, handelte er rasch. Er richtete seinen hageren Körper zu voller Höhe auf und befahl: »Sage dem Büttel, er soll vorauslaufen. Ich komme gleich nach.«
»Ja, Herr, ja. Ogottogott, is dasne Aufregung!« Marthe drehte sich so schwungvoll in der Tür um, dass ihre gestärkte weiße Haube einen Knick bekam.
Lapidius überlegte kurz. Er war kein Arzt, hatte somit auch keine Instrumente oder Medikamente, die er mit sich führen konnte. Er hatte nur sein Wissen über einige Therapien, die er früher einmal kennen gelernt hatte. Schließlich griff er zu einem irdenen Tiegel und mischte darin Sal ammoniacum und gelöschten Kalk, tat noch ein paar Tropfen vom ätherischen Öl des Lavendels hinzu und verließ mit großen Schritten sein Laboratorium.
Richter Reinhardt Meckel trommelte ungeduldig mit den Fingern auf die große Tischplatte. Er saß mit sechs Schöffen tief unten in den Gewölben des Rathauses und war alles andere als guter Laune. Der Grund dafür war die blonde junge Frau, die vor ihm über den Daumenschrauben zusammengebrochen war. Freyja Säckler hieß sie. Und sie war eine Hexe. Doch das zuzugeben, hatte sie sich hartnäckig geweigert. Es war ihm nichts anderes übrig geblieben, als sie, nach Einverständnis durch den Rat der Stadt, foltern zu lassen.
Meckels Finger schlugen einen Wirbel. Er hoffte, dass die Delinquentin nicht starb. Das würde noch mehr Schreiberei und Fragerei nach sich ziehen als das bloße Tortieren. Und er hoffte, dass der neue Bürger der Stadt, von dem es hieß, er sei unter anderem in der Medizin bewandert, endlich einträfe.
Wie um seine trüben Gedanken zu vertreiben, öffnete sich in diesem Augenblick die schwere Eichentür, und ein hagerer, groß gewachsener Mann trat über die Schwelle. Meckel taxierte ihn. Er wusste, dass der Neuankömmling von Stand war, gebildet, studiert und der Wissenschaft verschrieben. Dazu durchaus vermögend. Das hatte ihm Bürgermeister Stalmann bei einer der letzten Ratssitzungen anvertraut. Der Mann lebte als freier Bürger seit ungefähr einem halben Jahr in Kirchrode, genauer gesagt, in der Böttgergasse, daselbst in einem schmucken dreistöckigen Fachwerkhaus, das er gleich nach seiner Ankunft erworben hatte.
Meckel wunderte sich. Der Mann war wohlsituiert, doch sein schwarzer Mantel hatte schon bessere Tage gesehen. Dasselbe galt für die Samtkappe auf dem Kopf, die Hosen, die Schuhe und das spitzenbesetzte Leinenhemd. Es mochte hier sein wie bei manchem Gelehrten, dem seine Forschungen wichtiger waren als sein Äußeres. Meckel sah noch näher hin. Der Mann war bartlos, mit schmalem Gesicht und ernsten Augen über einer kräftigen Nase. Ein paar Fältchen um die Augenwinkel verrieten, dass er auch zu lachen verstand. Sein Alter mochte vierzig Jahre betragen, vielleicht ein wenig mehr. Irgendetwas in diesem Gesicht war ungewöhnlich. Meckel schlug einen weiteren Wirbel, dann wusste er es: Der Mann war überhaupt nicht behaart; er hatte weder Bart noch Augenbrauen noch Wimpern. »Ich danke Euch, dass Ihr so schnell gekommen seid«, hob er an, »Euer Name ist …«
»Lapidius, Herr Richter. Ludolf Lapidius.«
Meckel zögerte. »Um es freiheraus zu sagen: Ich weiß nicht, wie ich Euch anreden soll. Mir ist zwar bekannt, dass Ihr ein Gelehrter seid, aber ich kenne nicht Euren Titel.«
Über Lapidius’ Gesicht huschte ein Lächeln. »Nun, Herr Richter, ich bin einfach ein Neugieriger. Jemand, der den Dingen gern auf den Grund geht. Manche würden mich als Alchemisten bezeichnen, ich hingegen sehe mich eher als Universalgelehrten. Doch sei es, wie es sei: Ich habe den akademischen Grad eines Magisters erworben.«
»Gut, Herr Magister«, nickte Meckel. Das Trommeln seiner Finger erstarb. »Und in Eurer Eigenschaft als Universalgelehrter habt Ihr auch die Medizin studiert, nicht wahr?«
»Ganz recht.«
»Schön. Das sicherzustellen lag mir am Herzen. Würdet Ihr Euch nun um diese als Hexe angeklagte junge Frau kümmern?«
»Gern.« Lapidius war schon zu der Ohnmächtigen hingetreten. Man hatte die Daumenschrauben in der Zwischenzeit gelöst. Er sah die blutenden, zerquetschten Nägel und unterdrückte einen Anfall von Übelkeit. Es war nicht so, dass er kein Blut sehen konnte, im Gegenteil, er hatte in seinem Leben schon manche Verletzung behandelt, darunter sogar weit schlimmere, aber an Wunden, die unter Folterqualen entstanden waren, würde er sich sein Lebtag nicht gewöhnen. Er nahm das Handgelenk und prüfte den Puls. Er war deutlich, aber schwach. Dann zog er der jungen Frau ein Augenlid hoch. Die verdrehte Pupille zeigte, dass sie sich noch in tiefer Bewusstlosigkeit befand. Lapidius nahm den mitgebrachten Tiegel und hielt ihr den Inhalt unter die Nase. Nichts geschah. Lapidius versuchte es erneut, doch die Ohnmacht schien so tief zu sein, dass selbst der scharf-würzige Geruch des Salzes sie nicht zu beenden vermochte. Er blickte sich um. »Ich brauche einen Schemel. Wenn einer der Herren die Freundlichkeit hätte …«
Während das Gewünschte herbeigeschafft wurde, hatte Lapidius Muße, der Frau ins bleiche Gesicht zu sehen. Überrascht stellte er fest, dass sie von außergewöhnlicher Schönheit war, mit einem vollen, ausdrucksstarken Mund, einer kleinen, geraden Nase, ebenmäßigen Zügen. Dazu kam das lange, zu dicken Zöpfen geflochtene blonde Haar. Keine zwanzig Jahre zählte sie, da war er sicher. Das Einzige, was den Gesamteindruck störte, war hier und da eine schorfige Pustel auf ihrer makellosen Haut.
Lapidius besann sich wieder auf seine Aufgabe und ordnete an, die Ohnmächtige auf den Rücken zu drehen und ihre Unterschenkel auf die Sitzfläche des Schemels zu heben. Er hoffte, dass dadurch das Blut in ihren Kopf zurückfließen würde.
Doch auch diese Maßnahme zeitigte keinen Erfolg. Lapidius widerstrebte es, aber er sah keine andere Möglichkeit mehr. Er ließ einen Eimer Wasser kommen und schüttete ihn der Frau ins Gesicht. Das half endlich. Freyja Säckler kam zu sich. Sie prustete, nieste und schüttelte den Kopf. Dann schien der Schmerz wieder über sie herzufallen, denn sie stöhnte auf und vergrub die Hände in den Achseln. Ein grimmiger Gesichtsausdruck trat auf ihre schönen Züge.
Meckel ergriff das Wort: »Ich bin Euch sehr zu Dank verpflichtet, verehrter Magister«, sagte er. »Darf ich Euch bitten, der weiteren Tortur beizusitzen, nur für den Fall, dass sich ein derartiges Missgeschick wiederholt?«
Lapidius nickte, obwohl er keinerlei Wert darauf legte, die Peinigung mitzuverfolgen. Er setzte sich auf den Stuhl, der zur Behandlung gedient hatte.
Meckel befahl dem Folterknecht: »Gunthart, hilf der Angeklagten auf. Gut so. Nun, Freyja Säckler, ich hoffe, du ersparst dir und uns weitere Anstrengungen. Gestehe, dass du eine Malefizperson bist. Bekenne dich zu Luzifer, mit dem du im Bunde bist, gemäß den vorliegenden Zeugenaussagen, und vor allem: schwöre ab, damit du, so du brennen wirst, nicht im ewigen Fegefeuer endest.«
Bei den letzten Worten glaubte Lapidius einen lüsternen Glanz in den Augen des Richters erkannt zu haben, und er fragte sich, ob dem wirklich so war. Doch bevor er sich näher mit dem Gedanken beschäftigen konnte, antwortete die Angeklagte:
»Nichts werd ich. So wahr ich hier steh. Und so wahr ich keine Hexe bin!«
Meckels Finger schlugen erneut einen Trommelwirbel. »Das hatten wir doch alles schon, Freyja Säckler!« Sein Ton klang plötzlich gereizt. »Du bist eine Hexe. Es gibt Zeugenaussagen dafür. Gestehe und mach dieser Posse ein Ende! Ich sage dir, und ich sage es zum letzten Mal: Das Gericht kann auch anders. Die Daumenschrauben waren erst der Anfang. Glaube mir: Die Schmerzen der Schrauben werden dir gegen die des Stachelstuhls und des Streckbetts vorkommen wie Liebkosungen.«
»Ich bin keine Hexe!«
»Das sagen alle, aber bisher hat sich noch jede unter der Folter dazu bekannt.«
»Ich bin keine Hexe! Ich bin keine Hexe! Ich bin keine Hexe! Geht das nicht in Euren Kopf rein, verdammt noch mal?« Trotzig schob die Säckler das Kinn vor.
Für einen Augenblick war Meckel fassungslos. Dann schoss er von seinem Sitz hoch. »Sie hat die Würde des Gerichts missachtet!«, schrie er. »Und sie hat geflucht! Die Herren Schöffen haben es gehört! Sie hat gotteslästerlich geflucht!«
Die Schöffen, eine Auswahl ebenso unbescholtener wie selbstgerechter Kirchroder Bürger, blickten empört. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten, während Meckels Hand übergangslos auf den Schreiber zielte, ein dünnes Männchen, das etwas abseits an einem Pult saß. »Habt Ihr das mitgeschrieben, Herr Protokollführer? Ja? Gut! Alles, was die Angeklagte äußert, muss genauestens festgehalten werden, alles, was sie als Hexe ausweist, alles, einfach alles!«
Lapidius wollte sich einmischen, aber schon schrie der Richter weiter: »Freyja Säckler, wir sind nicht gewillt, deine Widerborstigkeit länger hinzunehmen! Unsere Geduld ist erschöpft! Jetzt werden andere Saiten aufgezogen! Gunthart, reiß der Angeklagten die Kleider herunter! Ein Hexenmal auf ihrem Körper wird sie als Dämonin entlarven.«
Jetzt konnte Lapidius nicht länger an sich halten: »Verzeiht, verehrter Richter«, sagte er, so ruhig er konnte, »haltet Ihr es wahrhaftig für notwendig, die Angeklagte zu entkleiden? Fluchen macht eine Frau nicht gleich zur Hexe. Und ein Stigma maleficarum kann auch ein harmloser Leberfleck sein.«
Lapidius’ besonnene Art verfehlte ihre Wirkung nicht. Meckel rang um Haltung. »Bei Gott, Herr Magister«, sagte er mühsam, »ich habe Euch nicht gebeten, hier zu bleiben, damit Ihr das Prozedere stört – Gunthart, tue, wie dir befohlen wurde! –, dennoch will ich Euch antworten. Wisset also, dass nach dem Hexenhammer die Hexe eine ›in der Ketzerei der Hexen Ertappte‹ ist, welches sich auf dreierlei Arten deutlich macht: erstens durch das Indizium der Tat, das heißt, wenn die Betroffene öffentlich Ketzerei gelehrt hat, etwa durch Drohungen wie: ›Du wirst niemals gesunde Tage mehr haben!‹ Eine solche Drohung hat die Säckler nachweislich ausgestoßen. Zweitens durch gesetzmäßige Beweise der Zeugen, die in diesem Falle angaben, dass ein von der Säckler berührter Axtstiel augenblicklich zu bluten begann. Und drittens durch das eigene Geständnis. Und eben dieses will ich hier und heute durch die Peinliche Befragung herbeiführen.«
Lapidius zog es vor, nicht auf die Ausführungen des Richters einzugehen. Statt zu antworten, trat er auf die mittlerweile Entkleidete zu. Gunthart stand hinter ihr, die groben Hände wie Schraubstockbacken in ihre Schultern gekrallt. Hilflos wie am Pranger stand die Säckler da – die Augen geschlossen, der schöne Mund nur ein Strich.
»Lass sie los, Gunthart.« Lapidius hatte auch am Körper kleine, pustelähnliche Erhöhungen erspäht. Er zwang sich, nicht auf die wohl gerundeten Brüste zu blicken, und nahm den Ausschlag in Augenschein. Dann betastete er die schorfig-nässenden Punkte, zog sie mit den Daumen auseinander, beroch sie, überprüfte das austretende Secretum und wiederholte anschließend das Ganze noch einmal. Und je länger seine Untersuchung andauerte, desto mehr wurde sein Verdacht zur schrecklichen Gewissheit.
»Ich muss Euch allein sprechen, Herr Richter«, sagte er endlich. »Bitte habt die Liebenswürdigkeit und schickt Gunthart und den Herrn Protokollführer hinaus. Ebenso die Herren Schöffen.«
Meckel schnappte nach Luft. »Das ist … unmöglich.«
»Glaubt mir, es muss sein. Wäre es nicht so, würde ich Euch nicht bitten.« Lapidius’ Ton ließ keinen Widerspruch zu.
»Nun denn, in Gottes Namen. Aber nur kurz.« Mit einer herrischen Bewegung winkte Meckel die Anwesenden hinaus. »Erst stört Ihr das Procedere, Magister Lapidius, dann besteht Ihr darauf, dass die Peinliche Befragung unterbrochen wird. Ich hoffe, Ihr habt einen triftigen Grund dafür. Einen sehr triftigen.«
»Den habe ich.«
»Und?«
»Herr Richter, ich muss Euch leider mitteilen, dass die Angeklagte Freyja Säckler von der Gallischen Krankheit befallen ist.«
Meckel fiel die Kinnlade herab. »Das ist doch … das ist … nein! Sagt, dass das nicht stimmt.«
»Doch, es ist leider so.«
Meckel überlegte fieberhaft. »Seid Ihr ganz sicher, dass es nicht nur eine einfache Krätze ist?«
»Leider ja. Ich kenne mich diesbetreffend aus. Das Krankheitsbild spricht eine eindeutige Sprache.«
Meckel schwieg erschüttert. Das von Lapidius konstatierte Leiden hatte in den letzten Jahrzehnten überfallartig ganz Europa heimgesucht. Es war, ähnlich wie die Pest, eine Geißel Gottes und hatte viele Namen: Scabies grossa, Mal franzoso, Lues oder auch Pöse Platern, Lustseuche und Geschlechtspest.
Lapidius fuhr fort: »Ihr wisst, dass die Gallische Krankheit, neuerdings mehr und mehr Syphilis genannt, dem Gesetz nach behandelt werden muss?«
»Ich weiß, ich weiß.« Meckels Gedanken überschlugen sich. Syphiliskranke verbannte man entweder vor die Stadttore oder steckte sie ins Franzosenhaus, eine Stätte, in der, ähnlich wie in Leprahäusern, die Kranken behandelt wurden – wobei die Therapie sich meistens darin erschöpfte, den Insassen in weitem Abstand einen Essnapf hinzustellen. Eine solche Isolierung der Säckler kam nicht in Frage, schon deshalb nicht, weil es in Kirchrode kein Franzosenhaus gab. Eine Verbannung der Kranken schied ebenso aus, schließlich war sie als Hexe angeklagt.
Lapidius unterbrach Meckels Überlegungen. »Ich schlage vor, die Kranke nicht weiter zu tortieren«, sagte er.
»Kommt nicht in Frage!« Meckel wusste zwar nicht, was mit der Kranken geschehen sollte, aber er war ganz sicher, dass die Peinliche Befragung abgeschlossen werden musste. Und zwar mit einem Geständnis.
»Verzeiht, dass ich Euch widerspreche«, sagte Lapidius und blickte Meckel direkt in die Augen. »Ihr habt vorhin den Hexenhammer erwähnt, jenes Werk, das die Kirche verfassen ließ, um festzuschreiben, wie Hexenprozesse ablaufen müssen. Ich darf Euch mit dem gebotenen Respekt darauf hinweisen, dass Ihr kein Gottesmann seid. Soweit mir bekannt ist, seid Ihr Richter und außerdem Rat der Stadt Kirchrode. Somit seid Ihr, wie alle weltlichen Juristen, der Constitutio Criminalis Carolina verpflichtet, also der Gerichtsordnung, die Kaiser Karl V. anno 1532 erließ.«
»Es liegt im Ermessen des Richters, welches Werk er zu Rate zieht. Es kann dieses sein oder auch jenes. Häufig sind es sogar beide, was nicht verwundert, denn es gibt in der Rechtsauffassung viele Parallelen«, entgegnete Meckel steif.
»Da bin ich ganz Eurer Meinung. Nach der Carolina allerdings muss eine Schuld bewiesen sein, bevor gefoltert werden darf. Wurde der blutende Axtstiel dem Gericht zur Ansicht vorgeführt?«
Der Richter schürzte die Lippen. »Nein, das wurde er nicht. Aber es gibt Zeugenaussagen, nach denen die halbe Stadt von der Säckler verhext wurde. Sie hat Vieh mit Krankheit geschlagen, Missgeburten herbeigezaubert, Kinderfinger zu Salbe eingekocht und mit dem Teufel mehrfach Unzucht getrieben.«
»Großer Gott!« Lapidius musste an sich halten. Fast hätte er hinzugefügt: »Und das glaubt Ihr?« Stattdessen sagte er: »Wer um alles in der Welt hat diese angeblichen Taten bezeugt?«
»Es sind die Bergmannsfrau Auguste Koechlin und die Witwe Maria Drusweiler. Unbescholtene Bürgerinnen, denen keiner etwas nachsagen kann.«
»Sie sind die einzigen Zeuginnen?«
»Ja, warum fragt Ihr?« Meckel spürte Ärger in sich hochwallen.
»Nun, wenn die Säckler die halbe Stadt verhext hat, müsste es doch viel mehr Zeugen geben.«
Dem Richter fiel darauf nichts ein. Er hätte es niemals zugestanden, aber Lapidius hatte es fertig gebracht, einen leisen Zweifel in ihm zu säen.
Als hätte er seine Gedanken erraten, sagte Lapidius: »Ihr wisst sicher, dass ein Richter, sofern er nur die geringsten Zweifel hat, verpflichtet ist, bei anderen Gerichtshöfen oder juristischen Fakultäten Rat einzuholen.«
Meckel wollte aufbegehren, doch Lapidius sprach rasch weiter: »In der Halsgerichtsordnung von Kaiser Karl heißt es wie folgt:
Item wo unser Amptlewt Lastner Richter oder Schoepffen in verstandt dieser unser ordnung zweyffenlich wurden soellen sie bey unsern Reten erclerung suchen …«
Meckel holte tief Luft. Er fragte sich, woher dieser Lapidius seine fundierten Rechtskenntnisse besaß, machte sich dann klar, dass er einen überaus gebildeten Mann vor sich hatte, und antwortete schließlich: »Nun ja, das stimmt. Aber es dürfte mindestens drei Wochen dauern, bevor ich auf eine juristische Stellungnahme der hohen Herren aus Goslar hoffen darf.«
»Das trifft sich gut. Eine Syphilisbehandlung im vorliegenden Stadium dauert ähnlich lange, nämlich zwanzig Tage.«
»Wie meint Ihr das?« Meckel verstand nicht.
»Ich meine, dass ich bereit bin, die Kranke zu kurieren, während Ihr auf Antwort aus Goslar wartet. Doch muss ich wohl besser sagen: Ich mache den Versuch, denn die Mortalität bei der Behandlung ist hoch. In jedem Fall würde ich die Säckler bei mir aufnehmen und dafür sorgen, dass niemand sich die Seuche bei ihr holen kann. Ihr wisst sicher, dass die Syphilis äußerst kontagiös ist?«
»Gewiss, gewiss. Ihr seid … äh … ungewöhnlich hilfsbereit.«
»Ich habe meine Gründe.«
»Natürlich.« Meckel konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, welche Gründe das sein mochten, doch focht ihn das nicht weiter an. Stattdessen wog er rasch das Für und Wider des Angebots ab. Wenn die Angeklagte bei Lapidius untergebracht war, so trug dieser auch die Verantwortung für sie, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: dafür, dass sie nicht floh, dafür, dass sie niemanden ansteckte, dafür, dass sie keine Hexereien betrieb, und dafür, dass sie wieder gesund und verhandlungsfähig wurde. In welche Richtung Meckel auch dachte, es ergaben sich für ihn nur Vorteile. Und für den Fall, dass etwas passierte: nur Nachteile für Lapidius. Was blieb, war lediglich der Umstand, dass er die zum Prozess gehörende Folter vorschriftswidrig abbrechen musste. Aber das würde er seinen Ratskollegen bei nächster Gelegenheit erklären können. Und zudem: Aufgeschoben war nicht aufgehoben. »Vorausgesetzt, ich würde Eurem Vorschlag zustimmen, Magister: Kann ich auf Eure Diskretion zählen? Es wäre fatal, wenn sich herumspräche, dass die Franzosenkrankheit in der Stadt ist.«
»Ihr habt mein Wort, Herr Richter.«
»Dann bin ich einverstanden. Bitte gebt mir Bescheid, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, damit der weitere Prozessverlauf festgelegt werden kann.«
»Das werde ich.«
Sie gaben sich die Hand, und kaum war dies geschehen, verließ Meckel schnellen Schrittes den Raum. Eine gewisse Verlegenheit bemächtigte sich Lapidius’, denn ihm wurde bewusst, dass er mit der nackten Frau nun allein war. Hastig drehte er sich zur Wand. »Bitte, zieh dich wieder an.«
Sie gab keine Antwort, aber er hörte Stoff rascheln. Als er glaubte, sie müsse fertig sein, wandte er sich um und stellte erleichtert fest, dass sie wieder ihren zerschlissenen Rock, das billige Kamisol und die abgewetzte Knopfjacke trug. Er trat auf sie zu und wollte nach ihren tortierten Daumen sehen, doch sie zog die Hände fort. Er zuckte mit den Schultern. »Wie du willst, dann werde ich mir die Verletzungen eben später ansehen. Komm jetzt, ich stütze dich.«
»Ich kann allein gehen!«
Ihre Augen sprühten. Die Farbe erinnerte Lapidius an das Blaugrün von Kupfervitriol. »Ich meinte es nur gut. Mach mir keine Schwierigkeiten. Mein Haus steht ganz in der Nähe.«
Sie lachte. Es war ein kurzes, verächtliches Lachen. »Keine Sorge. Ich tät mit jedem fortlaufen, nur damit ich wegkomm aus diesem Loch.«
»Gut, dann gehe ich vor.«
Er schritt zur Tür, und zu seinem nicht geringen Erstaunen folgte sie ihm auf dem Fuße.
Kirchrode im Oberharz war eine Stadt mit annähernd tausend Einwohnern, darunter Kaufleute, Handwerker und Tagelöhner; die Hauptmasse jedoch bildeten die Bergleute. Ihnen und der durch den Landesherrn erteilten Bergfreiheit verdankte die Stadt ihren Wohlstand. Die Bergfreiheit garantierte vielerlei Privilegien: So waren die Bürger von Steuer und Kriegsdienst befreit, durften Räte und Richter frei wählen, das Markt-, Brau- und Schankrecht ausüben, Bau- und Brennholz in den umliegenden Wäldern schlagen und mancherlei andere Gerechtsamen nutzen. Lediglich ein Förderzins in Höhe des Zehnten musste regelmäßig entrichtet werden.
Dass Kirchrode blühte, war am deutlichsten an den zahlreichen prächtigen Fachwerkhäusern abzulesen, die im Stadtkern lagen. Hier, am Gemswieser Markt, standen die schönsten Bauten, liebevoll errichtet, mit reichem Schnitzwerk an Säulen, Knaggen und Balkenköpfen. Der Stolz Kirchrodes aber war das Rathaus, ein gotischer Steinbau, dessen Hauptflügel sich zum Marktplatz hin öffnete. Aus eben diesem trat Lapidius nun hervor, Freyja Säckler hinter sich. »Wir überqueren den Markt, biegen auf der anderen Seite in den Kreuzhof ein und kurz darauf in die Böttgergasse. Dann ist es nicht mehr weit«, erklärte er.
Sie gab keine Antwort, schloss aber zu ihm auf, so dass sie nun an seiner Seite ging. Ohne auf seine Umgebung zu achten, steuerte er vorbei an Ständen, Buden und Karren. Obwohl es zu dieser Jahreszeit noch keine Feldfrüchte gab, kein Obst und auch kein Gemüse, herrschte allerorten hohe Geschäftigkeit. Kurz bevor der Kreuzhof sich vor ihnen auftat, geschah das, was Lapidius befürchtet hatte. Eine der Marktfrauen hatte die Säckler erkannt und schrie:
»He, Leute, seht mal, wer da geht – die Hexe!«
»Die Hexe? Welche Hexe?«
»Freyja Säckler!«
»Wo? Wo geht sie? Sag doch, wo sie geht!«
»Da ist sie doch! Seid ihr blind? Da, da!«
»Ich denk, die ist unter die Folter?«
Solche und ähnliche Rufe erschollen augenblicklich von allen Seiten. Nur fort!, dachte Lapidius, fasste seine Begleiterin am Handgelenk und zerrte sie unsanft zwischen den Neugierigen hindurch, rempelte gegen ein paar Schultern, trat auf verschiedene Füße und landete endlich im Kreuzhof, wo er aufatmend verschnaufte. Doch die Kunde von der frei herumlaufenden Hexe eilte ihnen voraus, Mütter nahmen ihre Kinder beiseite, alte Frauen starrten sie an, und links und rechts vor ihnen öffneten sich Fenster.
Lapidius machte, dass er weiterkam. Fort, nur fort von diesen lüsternen Gaffern! Endlich war die Böttgergasse erreicht. Bis hierher schien die Neuigkeit sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Sein Puls raste. Er war es nicht gewohnt, derart zu rennen. Freyja Säckler hingegen schien der Lauf nicht viel ausgemacht zu haben. Ihr Atem ging kaum schneller. »Hier wohne ich«, stieß Lapidius hervor.
Ihr Blick wanderte über das Haus. Es war ein dreistöckiges, gepflegtes Fachwerkgebäude, dessen Oberstock und Dachgeschoss je anderthalb Fuß vorkragten, um auf diese Weise die Bodenfläche zu vergrößern. »Ihr müsst stinkreich sein.«
Eine Stimme aus dem Nachbarhaus brüllte: »Stinkreich, harhar, stinkreich, stinkreich … das is lustich!« Sie gehörte einem Kerl, der sich weit aus dem Fenster lehnte. Er hatte ein einfältiges Gesicht und war so ungeschlacht, dass er den Rahmen zu sprengen drohte. Sein Name war Gorm. Er arbeitete als Hilfsmann bei Schlossermeister Tauflieb. »Stinkreich, harhar, stink …«, wollte er wiederholen, aber sein Blick hatte Freyja Säckler jetzt vollends erfasst. Sein Mund klappte zu, sein Gesicht nahm einen ungläubigen Ausdruck an. Lapidius vermutete, dass er von der Schönheit Freyja Säcklers geblendet war. Eine andere Stimme, barsch und befehlsgewohnt, ertönte von drinnen:
»Zurück an die Arbeit, Faulpelz! Aber ein bisschen plötzlich!« Sie gehörte Tauflieb.
»Lass uns hineingehen«, sagte Lapidius. Sein Atem hatte sich einigermaßen beruhigt.
Lapidius saß in seinem Laboratorium und war der Verzweiflung nahe. Auf dem großen Experimentiertisch, dessen eine Ecke er frei geräumt hatte, stand noch immer das Essen für die Säckler. Unberührt seit Stunden. »Du musst etwas zu dir nehmen«, sagte er zum hundertsten Mal.
Und zum hundertsten Mal antwortete ihm nur ein verstockter Blick.
Wieder und wieder hatte er auf sie eingeredet, doch es war ihm nicht gelungen, die Mauer ihres Schweigens zu durchbrechen. Dabei hatte er es behutsam angestellt, hatte zunächst nach ihrem Elternhaus gefragt, danach, wo sie herkäme, wie alt sie sei. Hatte sich erkundigt, ob sie Geschwister habe, ob Verwandte in der Nähe wohnten und so weiter. Sie hatte starrköpfig geschwiegen. Nur ein, zwei Male hatte sie ihm entgegengeschleudert:
»Was gehts Euch an, lasst mich in Ruh!«
Er war hinausgegangen, hatte Marthe gefragt, wie er ihr Vertrauen gewinnen konnte, doch die hatte nur mit den Schultern gezuckt. Ratlos war er ins Laboratorium zurückgekehrt und hatte weiter auf sie eingeredet. Ohne Erfolg.
»Du musst etwas zu dir nehmen!«
»Esst doch selbst.«
»Niemandem nützt es, wenn du verhungerst.«
»Pah! Was tut Ihr so barmherzig? Wollt mich einwickeln, was? Aber nicht mit mir!«
Lapidius schöpfte Hoffnung. Freyja Säckler hatte ihn etwas gefragt. Das war immerhin ein Anfang. Vielleicht konnte er sie doch von der Wichtigkeit der Nahrungsaufnahme überzeugen. »Sagen wir, ich gehöre zu den Menschen, denen es Freude macht, zu helfen.«
»Pah!« Freyja Säckler verdrehte die schönen Augen. »So jemand ist mir mein Lebtag nicht über den Weg gelaufen. Sagt endlich, was Ihr wollt.«
»Ich will dir wirklich nur helfen, mehr nicht.«
Freyja Säckler schwieg erneut.
Lapidius schob Wurst und Brot beiseite. Mit der Frau war einfach nicht zu reden. Das Einzige, was sie widerstrebend zugelassen hatte, war die Behandlung ihrer gequetschten Daumennägel gewesen. Er hatte sie verbunden und insgeheim gestaunt, wie tapfer sie die Schmerzen ertrug. Kein Wort war über ihre Lippen gekommen. Genau wie jetzt. Nun gut, es sollte eben nicht sein. »Marthe!«, rief er, »Marthe!«
Die Magd kam aus der Küche. »Wassis, Herr?«
»Trag das Essen fort.«
»Was denn? Die feine Dame hat noch immer nix gegessen?« Marthes Vollmondgesicht lief rot an. Sie stemmte die Fäuste in die Hüften. »Jetzt reichts aber! Ne Schande isses, wasde dir mitm Herrn erlaubst. Lang zu, ich sachs nur dies eine Mal! Wennnich, verpass ich dir ne Maulschelle, diede dein Lebtach nich vergessen tust!«
Und das Wunder geschah. Zu Lapidius’ grenzenlosem Erstaunen gehorchte die Säckler. Sie ergriff das Brot und biss hinein. Es schien ihr zu schmecken. Schon nahm sie den nächsten Bissen, kaute ihn kaum durch, schluckte ihn hinunter, kaute weiter, schluckte, hieb die Zähne in die Wurst und schloss die Augen, während sie Bissen um Bissen vertilgte.
Marthe grinste zufrieden. Wie alle mütterlichen Frauen freute es sie, wenn jemand herzhaft zu essen verstand. Speise und Trank waren der Mittelpunkt ihres Lebens. »Na also. Ich hol nochn Becher Ziegenmilch zum Nachspülen.«
Lapidius erkannte, dass seine Sprache die falsche gewesen war. Freyja Säckler war eine Frau, die auf Freundlichkeit misstrauisch und schroff reagierte. Wahrscheinlich, weil sie schlechte Erfahrungen im Leben gemacht hatte. Er beschloss, sich das zu merken und fortan kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. »Hör mal«, sagte er, »mit deiner Krankheit ist nicht zu spaßen. Sie ist so schwer, dass du alle Kräfte brauchen wirst, sie zu besiegen. Deshalb ist es gut, wenn du jetzt isst. Ab morgen bekommst du keine feste Nahrung mehr.«
Sie unterbrach ihr Kauen und Schlucken. Und sagte nichts.
Lapidius sprach weiter: »Wenn deine Krankheit unbehandelt bleibt, wirst du sterben. Das solltest du wissen. Sei also froh, dass ich mich um dich kümmere.«
»Die Wurst ist gut«, sagte sie.
Lapidius nickte und sah hinüber zu Marthe, die mit der Ziegenmilch hereinkam. Das, was er jetzt zu sagen hatte, war nicht für ihre Ohren bestimmt. »Marthe, stell den Becher ab und lass uns allein.«
Die Magd blickte entrüstet.
»Los, los.«
Als Marthe draußen war, fuhr Lapidius fort: »Dass deine Krankheit Syphilis geheißen wird, hast du vielleicht in der Folterkammer mitgehört. Nach dem, was die Medizin weiß, wird sie grundsätzlich durch, äh … die Fleischeslust übertragen. Mit wem hattest du in letzter Zeit Verkehr? Ich muss das wissen, denn einer deiner Liebhaber hat dich womöglich angesteckt. Genau so, wie du danach andere angesteckt hast, wenn du mit ihnen Verkehr hattest. Es ist wichtig, alle Personen zu kennen, sonst ist die Seuche nicht einzudämmen. Also: Mit wem hattest du in der letzten Zeit Verkehr?«
»Verkehr? Ihr meint, bei wem ich gelegen hab?« Freyja Säckler nahm einen Schluck Ziegenmilch.
»Ja, so kann man es auch sagen.«
»Bei wem soll eine, die übers Land zieht, schon liegen. Ab und zu geh ich mit einem ins Heu, aber die wenigsten stellen sich vor. Ich halt nicht viel von Männern.«
»Du ziehst über Land?«
»Mit dem Kräuterwagen. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt.« Sie nahm einen weiteren Schluck.
»Das ist interessant. Wir müssen später einmal darüber reden. Hattest du mit einem Mann aus Kirchrode Verkehr?«
»Weiß nicht.«
»Aber das musst du doch wissen!«
»Nein.«
Lapidius atmete tief durch. Er merkte, dass er für heute nicht mehr weiterkam. »Schön. Es mag genug sein. Morgen beginnt die Behandlung der Syphilis. Sie erfolgt in der Hitzkammer. Die einzelnen Schritte erkläre ich dir dann. Marthe wird dir für die Nacht eine Bettstatt zuweisen. Geh nun zu ihr in die Küche.«
»Danke für das Essen.«
»Schon recht. Gute Nacht.«
Freyja Säckler stand auf und verschwand. Die Tür zur Küche schlug zu. Lapidius seufzte erleichtert. Seine Gedanken begannen abzuwandern und sich mit dem morgigen Versuch, dessen Anordnung er noch einmal überprüfen wollte, zu beschäftigen. Da öffnete die Tür sich wieder. Die Säckler war noch einmal zurückgekommen. »Ich weiß es wirklich nicht«, sagte sie.
Lapidius runzelte die Stirn. »Was weißt du wirklich nicht?«
»Ob ich mit einem aus Kirchrode was hatte.«
Erster Behandlungstag
Lapidius hatte sein Haus ausschließlich nach praktischen Erwägungen eingerichtet. Deshalb befand sich sein Laboratorium im Erdgeschoss – in dem großen Raum mit den hellen Fenstern, der am meisten Platz bot. Hier forschte Lapidius. Hier ging er in seiner Arbeit auf. Hier war das Zentrum seines Lebens. Auch sein Bett stand hier, denn oftmals hatte er mitten in der Nacht einen Einfall, dessen Überprüfung nicht den geringsten Aufschub duldete.
Hinter dem Labor, zum Hof hinaus, begann Marthes Reich. Da lagen Küche und Vorratsräume, ebenso wie ihre Kammer. Im Oberstock befanden sich weitere Räume, in denen einige schwere Möbel verwahrt wurden. Es handelte sich um Erbstücke, die Lapidius in Erinnerung an sein Elternhaus aufhob. Das Dachgeschoss schließlich war ein Ort, den er nur einmal betreten hatte. Altes Gerümpel vom ehemaligen Besitzer hatte er dort vorgefunden, kreuz und quer herumliegend, voller Staub und Spinnweben. Ein Anblick, den er nur schwerlich ertrug. Er hatte Marthe gebeten, Ordnung zu schaffen, sich umgedreht und gemacht, dass er die Stiegen wieder hinunterkam. Hinunter in sein Labor, wo alles seinen Platz hatte.
Hier saß er jetzt zu früher Stunde, das Büchlein mit seinen Versuchsaufzeichnungen in der Hand. Es zeigte ihm nur allzu deutlich, dass er am gestrigen Tage nichts geschafft hatte. Der Grund hieß Freyja Säckler. Die junge Frau, die Syphilis hatte und der geholfen werden musste. Das gebot die Menschlichkeit. Trotzdem hoffte er, heute die Versuchsvariation VII in Angriff nehmen zu können. Er beschloss, kein Papier zu verschwenden und die Eintragung Montag, 11. einfach in Dienstag, 12. abzuändern, als plötzlich die Tür zur Küche aufgestoßen wurde und Freyja Säckler erschien. Lapidius seufzte unhörbar. Er hatte nicht so zeitig mit ihr gerechnet. »Guten Morgen. Du bist früh auf«, begrüßte er sie.
Statt einer Antwort biss sie in ein Stück weißes Brot, das vor Honig troff. Ihr Blick ruhte auf seinen Apparaturen, in denen sich das erste Tageslicht spiegelte.
Lapidius unterdrückte die Bemerkung, dass heute der erste Behandlungstag sei und sie deshalb keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen dürfe. Wenn alles so kam, wie er es voraussah, würde es schwer genug für sie werden.
Marthe tauchte hinter der Frau auf, einen Topf Grießbrei in der Hand. »Habse geweckt, Herr, damitse was zu beißen kriegt. Sieht ja zu käsich aus, die Freyja. Nachher sollse nochne Runde schlafen, habich gesacht. Is Euch doch recht, Herr, oder?«
»Ja, äh … natürlich. Die Behandlung kann durchaus etwas später beginnen.«
»Komisch, das mitter Behandlung. Wozu solldie überhaupt gut sein? Wassis das fürne Todeskrankheit? Freyja wills nich sagen. Naja, mir isses egal.« Marthes Blick verriet, dass dem keineswegs so war. »Wollt Ihr auch was?«
»Bitte?«
»Wollt Ihr auch Grießbrei? Er is lecker. Isn Rezept von meiner Mutter.«
»Nein, ich habe schon etwas gegessen.«
Marthe verschwand.
»Die sehen hübsch aus.« Freyja deutete mit dem Brot auf die Apparaturen. »Wie Tiere aus Glas.«
»Du bist eine gute Beobachterin.« Lapidius war angenehm überrascht. »In der Tat tun sie das, denn die Form der alchemistischen Geräte orientiert sich an der Natur. Man unterscheidet Bär, Schildkröte, Wildgans und andere. Dieser Kolben da mit den vielen Abzweigungen wird Hydra genannt.«
Sie antwortete nicht, doch ihre Augen ruhten unverwandt auf den seltsamen Glasformen.
»Das Figierglas dort wird auch als Strauß bezeichnet, wegen seines langen Halses.«
»Strauß? Ist das auch ein Tier?«
»Ja. Es lebt in Afrika, jenseits der Barbareskenküste. Der Strauß ist wichtig bei der Bereitung des Steins der Weisen. Die letzten Schritte dieses Vorgangs, so die Lehre, müssen im zugeschmolzenen Figierglas erfolgen.« Lapidius, bei einem seiner Lieblingsthemen angelangt, entging, dass die Frau seinen Ausführungen nicht folgen konnte.
»Und das da?«, fragte sie.
»Das ist ein Alambic. Alambic ist arabisch und bedeutet Destillationskolben. Dieser ist doppelschnablig und besonders groß, weshalb er in einem eisernen Dreibein ruht.«
»Aha. Na, ich leg mich dann noch mal aufs Ohr.« Ihr Interesse an seiner Arbeit war erloschen. Ihr Brot war aufgegessen, und sie verließ den Raum.
»Ja, mach das.«
Lapidius bedauerte es ein wenig, dass sie so abrupt ging.
Erst am frühen Nachmittag kam sie wieder. Lapidius, der die Zeit eigentlich hatte nutzen wollen, um an seiner Variatio VII zu arbeiten, war eingefallen, dass zur Syphilisbehandlung ein Quecksilber-Unguentum vonnöten war. Da der Apotheker ein solches Präparat nicht bereithielt, hatte er sich selbst an die Herstellung der Salbe machen müssen. Er hatte rotes iodiertes Quecksilberpulver genommen und eine gute Menge gewärmtes Äthanol dazugegeben, damit eine breiige Masse entstehen konnte. Anschließend hatte er diese mit einer gehörigen Portion Wollfett vom Schaf vermischt und das Ganze noch einmal kräftig durchgeknetet. Das so entstandene Unguentum war von zufrieden stellender Geschmeidigkeit, auch wenn der Geruch zu wünschen übrig ließ.
»Gut, dass du kommst«, sagte Lapidius. Er wies auf die rötliche Masse. »Da kann ich dir gleich zeigen, womit die Schmierbehandlung durchgeführt wird.«
Sie trat heran, steckte den Finger in die Salbe und hielt ihn an die Nase. »Das riecht nach Stall.«
»Das Fett der Schafwolle gibt der Salbe den Halt.«
»Und damit soll die, äh … Syphilis weggehen?«
»Nein, das besorgt das Hydrargyrium, ich meine, das Quecksilber.« Lapidius unterdrückte den Zusatz: »So Gott will.« Stattdessen sagte er: »Es sorgt dafür, dass die kranken Säfte der Syphilis ausgeschwitzt werden können.«
»Wie lange dauert das?«, fragte sie.
»Streif den Finger am Behälter ab. Du kommst mit dem Quecksilber noch früh genug in Berührung.«
»Wie lange dauert die Kur? Ihr wollts mir wohl nicht sagen?«
»Hast du das in der Folterkammer nicht mitbekommen? Zwanzig Tage.«
»Zwanzig Tage?«
»Ganz recht.« Lapidius fiel ein, dass man am besten daran tat, mit Freyja Säckler ein klares Wort zu reden. »Du wirst zwanzig Tage in der Hitzkammer verbringen und dabei ununterbrochen schwitzen. Wie ein Ochse im Joch.«
»Jesus Christus!« Zum ersten Mal sah Lapidius die junge Frau außer Fassung. »Zwanzig Tage lang schwitzen?«
»In der Hitzkammer.«
So plötzlich Freyja Säcklers Ausbruch gekommen war, so schnell hatte sie sich wieder in der Gewalt. Trotzig reckte sie das Kinn vor. »Pah! Das schreckt mich nicht. Zwanzig Tage in dieser Hitzkammer sind allemal besser als zwanzig Tage im Kerker.«
Lapidius schwieg. Er war da keineswegs sicher.
»Wo ist die Kammer überhaupt? Wie groß ist sie? Was steht drin?«
»Die Hitzkammer befindet sich im Oberstock meines Hauses. Sie enthält keine Gegenstände, dafür ist sie zu klein. Sie ist so klein, dass du in ihr nur liegen kannst.«
»Jesus Christus! Da ist mir doch der Kerker lieber!«
»Du hast nicht die Wahl zwischen Hitzkammer und Kerker. Du hast nur die Wahl zwischen Hitzkammer und Tod.« Lapidius’ Stimme klang kälter, als er eigentlich wollte.
Sie presste den Mund zusammen und starrte auf ihre verbundenen Daumen. »So schlimm wirds schon nicht sein.«
»Doch. Es hat keinen Zweck, dir etwas vorzumachen. Die Syphilis ist tückisch wie ein angeschossener Keiler. Niemand kennt sie genau, denn sie tritt erst seit wenigen Jahrzehnten auf. Es heißt, am Anfang wären die Kranken ihr schon nach wenigen Monaten erlegen – sabbernd, gelähmt, in geistiger Umnachtung. Es heißt aber auch, dass sie sich gewandelt habe und dass sie zunehmend Freude daran fände, ihre Opfer langsam zu zerstören. Jahrzehnte könnten darüber vergehen, immer jedoch sei sie es, die am Ende obsiegt. Allerdings ist das, wie ich hinzufügen will, nur dann der Fall, wenn man sich ihr kampflos ergibt. Wirst du kämpfen?«
Freyja löste den Blick von ihren Daumen und sah Lapidius mit ihren blaugrünen Augen an.
»Wirst du kämpfen?«
»Ja«, sagte sie nach einer Weile, die Lapidius wie eine Ewigkeit vorkam. »Ja, ich komm wohl nicht drum rum. Ich häng am Leben.«
»Das höre ich gern. Siehst du den Ofen dort an der Wand?«
»Den roten?«
»Ja. Das ist ein Athanor, die Wärmequelle des Alchemisten. Darin brennt das immer währende Feuer, das die Hitze für deine Behandlung liefern wird.« Er schritt zum Ofen hinüber und deutete nach oben. »Über dem Athanor führt der Kaminschacht zum Schornstein hinauf. Die heiße Luft zieht direkt an der Hitzkammer vorbei. So wirst du, in der Kammer liegend, stark und stetig schwitzen können.«
Freyja musterte ihn aufmerksam.
»Vielleicht fürchtest du jetzt, dass dir die Zeit lang werden wird, aber sieh her. Diese Maueröffnung neben meinem Bett ist der Zugang zu einem toten Schacht. Er führt ebenfalls nach oben. Das Praktische ist: In der Hitzkammer befindet sich ein ähnliches Loch. Man muss nur in eine der Öffnungen hineinsprechen, um sich zu verständigen.«
»Zeigt mir die Kammer.«
Lapidius stieg vor ihr die knarrende Treppe empor. Fahles Licht fiel in den Oberstock und ließ mehrere abzweigende Türen erkennen. Die kleinste glich eher einer Holzklappe; sie maß nur drei Fuß in der Höhe und besaß seitliche Scharniere. Mit einiger Mühe zerrte Lapidius sie auf. Spinnweben wurden sichtbar und, im Halbdunkel dahinter, schräg nach oben laufende Dachsparren. Stickig-warme Luft schlug ihnen entgegen. »Ich verfüge leider nicht über eine Hitzkammer, wie die Medizin sie vorschreibt. Schließlich bin ich weder Arzt noch Bader. Aber ich denke, es wird auch hierin gehen.«
»Das ist ja nur eine Abseite!«
»Ja. Der einzige Ort im Haus, der sich als Hitzkammer eignet.«
»Da kann ich ja nicht mal drin sitzen! Nur liegen wie … wie … in einem Sarg!«
»Ich weiß.« Lapidius war bemüht, unbeteiligt zu klingen. »Eine sitzende Position ist für die Behandlung der Syphilis auch nicht erforderlich. Du wirst quer hinter der Tür liegen, auf einer Strohmatratze, und du wirst während der gesamten Kur nackt sein. Die Einschmierungen und Behandlungsschritte wird Marthe nach meinen Anweisungen vornehmen. Sie wird dich auch mit Flüssigkeit versorgen, allerdings in Maßen, damit du nicht deine Notdurft verrichten musst. Sollte das doch einmal der Fall sein, kannst du sie oder mich durch den Sprechschacht erreichen.« Er deutete auf ein Loch in der Innenwand der Abseite. »Hier hinein musst du sprechen. Außerdem werde ich eine Öffnung in die Tür schneiden lassen, damit du tagsüber etwas Licht hast. Es wird gut sein, wenn du die meiste Zeit schläfst.«
Freyja Säckler schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich will nicht sterben, Gott ist mein Zeuge! Aber ob ich das schaff, weiß ich nicht …«
»Du musst. Was sind drei Wochen gegen ein ganzes Leben, das du damit erretten kannst!«
Die Frau antwortete nicht und blickte in die Hitzkammer hinein. »Da sind Spinnen«, sagte sie, »und wenn Spinnen da sind, gehts nicht. Ich ekle mich vor ihnen. Wenn ich mir vorstell, ich schlaf, und eine lässt sich auf meinen Kopf runter.«
»Ich werde dafür sorgen, dass Marthe sie täglich entfernt. Glaub mir, wenn die Behandlung erst einmal begonnen hat, werden Spinnen deine geringste Sorge sein. Bedenke im Übrigen: Während du die Syphilis auskurierst, kann ich den Anschuldigungen gegen dich nachgehen und versuchen, sie zu entkräften. Mit ein wenig Glück hat sich am Ende alles aufgeklärt, und du kannst als freie Frau die Stadt verlassen.«
»Glück?« Freyjas blaugrüne Augen musterten Lapidius. »Ich hab noch nie im Leben Glück gehabt.«
Am Abend hatte Marthe den Körper der Säckler zunächst mit einem schwefelhaltigen Präparat gegen die Pusteln behandelt und anschließend über und über mit Quecksilbersalbe eingeschmiert. Nur zögernd, so Marthes Bericht, war die Patientin daraufhin in die Hitzkammer gekrochen, hatte sich aber wortlos niedergelegt. Danach hatte die Magd sich die Hände gründlich am Hofbrunnen gewaschen.
»Schläft sie schon?«, fragte Lapidius, als Marthe sein Laboratorium betrat.
»Nee, Herr, sie hat Durst, sachtse, aber ich wusst nich, ob ich ihr was geben darf.«
»Das hast du ganz richtig gemacht«, lobte Lapidius. »Wenn du nicht noch anderweitige Arbeit hast, kannst du jetzt schlafen gehen.«
»Danke, Herr. Gute Nacht, Herr.«
»Gute Nacht.« Lapidius spürte ein Gefühl der Erleichterung. Der erste Schritt war getan. Freyja Säckler war freiwillig in die Hitzkammer gestiegen. Aber er wusste aus Erfahrung: Über kurz oder lang würde sie ihr Gefängnis verlassen wollen, und das musste verhindert werden. In ihrem eigenen Interesse. Rasch griff er zu einem Becher und mischte darin einen kräftigen Schlaftrunk an. Dann, ein Talglicht in der einen, den Becher in der anderen Hand, kletterte er die Treppe zum Oberstock hinauf. »Ich bins, Lapidius!«, rief er. »Ich habe noch etwas für dich.«
Mit einem heftigen Ruck wurde die Türklappe von innen zugezogen.
»So kann ich es dir nicht geben.«
»Ich bin nackt, und ich stink am ganzen Körper nach der Salbe.« Die Klappe öffnete sich einen Spaltbreit. »Was habt Ihr denn für mich?«
»Einen Schlaftrunk. Hier.« Er gab den Becher in die herausgestreckte Hand.
»Danke. Schlaf ist immer gut.«
»Ja, das stimmt«, sagte Lapidius, »sehr gut sogar.«
Zweiter Behandlungstag
Lapidius hatte die Nacht über kaum ein Auge zugetan. Immer wieder waren seine Gedanken zu Freyja Säckler gewandert. Und nicht wenige Male war er versucht gewesen, durch den Sprechschacht das Wort an sie zu richten. Doch er hatte es unterlassen. Freyja schlief tief und fest, das wusste er; schließlich hatte er ihr am gestrigen Abend eigenhändig ein Tranquilium verabreicht.
Er stand rasch auf, reinigte sich am Waschgeschirr und kleidete sich an. Dann steckte er den Kopf durch die Küchentür. Marthe hantierte bereits geschäftig mit Töpfen und Pfannen. Sie pflegte, mit seinem Einverständnis, stets für drei zu kochen, um am Nachmittag ihrer alten Mutter etwas vorbeibringen zu können. »Marthe, ich gehe mal rasch hinüber zu Tauflieb.«
»Was? Wie?«, schreckte die Magd auf. »Oh, Herr, hab Euch gar nich gehört. Guten Morgen. Was sachtet Ihr?«
»Ich gehe mal rasch zu Meister Tauflieb.«
»Ja, so. Gut. Un wassis mit Essen?«
»Ich habe jetzt keinen Hunger, und bis Mittag bin ich lange zurück.«
Marthe begann Bohnen in einen Napf zu schnippeln. »Sollich für vier kochen? Weil Freyja doch da is …«
»Nein, die Patientin bekommt für die Zeit der Behandlung ausschließlich Flüssigkeit. Die kann sie zusammen mit den kranken Säften ausschwitzen.«
»Gar nix Festes? Kein Braten, kein Käse, kein Gemüse nich? Dassis aber ne komische Krankheit, wo man nich richtich zu beißen kriegt, um aufe Beine zu kommen, un ich will auch nich weiter drüber reden, wie ichs versprochen hab, aber komisch isses doch.«
»Die Ärzte sehen eine solche Behandlung vor. Im Übrigen hinterlässt feste Nahrung nur feste … äh … Ausscheidungen, die du dann fortmachen müsstest. Du darfst Freyja täglich eine kräftige Brühe geben, mehr jedoch nicht.«
»Is recht, Herr, wenn Ihrs sacht.«
Lapidius öffnete die Haustür und rümpfte die Nase. Er war sehr geruchsempfindlich, weshalb er mehr als andere darunter litt, dass die Bürger Kirchrodes ihren Abfall einfach auf die Straße kippten. Er hatte Marthe angewiesen, den eigenen Unrat in einem Bottich zu sammeln und alle zwei Tage fortzukarren, ebenso wie sie täglich vor dem Haus zu kehren hatte, aber diese Maßnahmen waren nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Lapidius atmete aus und stelzte an Speiseresten, Hühnerknochen und Urinlachen vorbei zur Schlosserei hinüber. Er klopfte kräftig, um sich gegen die Hammerschläge, die drinnen ertönten, Gehör zu verschaffen. Als ihn niemand hereinbat, stieß er die Tür auf und betrat die Werkstatt. Der Lärm wurde von Gorm verursacht, der sich über einen Schraubstock beugte und Blech umbördelte. Neben ihm stand der Meister, mit Argusaugen die Tätigkeit seines Hilfsmannes überwachend. »Guten Morgen, Meister Tauflieb«, grüßte Lapidius höflich.
»Morgen.« Tauflieb gehörte nicht zu den Freundlichen im Lande. Er sah kaum auf und schnauzte stattdessen Gorm an: »Pass auf, dass die Kante gerade wird!«
»Meister Tauflieb, ich wollte Euch bitten, heute Vormittag an einer meiner Türen ein Schloss anzubringen.«
Tauflieb grunzte.
»Sie befindet sich im Oberstock und ist eher eine Klappe. Sie führt zu einer Abseite, die …«
»Ich habe keine Zeit.«
Wortlos legte Lapidius einen Taler auf die Werkbank.
»Hm, vielleicht kann ich es doch einrichten.« Taufliebs Blick wanderte von der Münze hinauf in Lapidius’ Gesicht. Er hatte eng zusammenstehende Augen, dunkel, forschend, humorlos. »Euch muss eine Menge an dieser Arbeit liegen, da sie Euch so viel wert ist.«
»Ganz recht.« Lapidius schluckte. Er hatte geahnt, dass die Unterredung mit Tauflieb nicht erfreulich sein würde. Der Meister war wenig beliebt in Kirchrode. Er galt als verschlossen und misstrauisch. Nur der Tatsache, dass sein handwerkliches Geschick über jeden Zweifel erhaben war, verdankte er sein Auskommen. »Bevor Ihr mich unterbrochen habt, wollte ich sagen, dass die Klappe zu einer Abseite führt, in der eine Frau liegt. Sie schläft dort und schwitzt ihre Krankheit aus. Ich sage das nur, damit Ihr Euch nachher nicht wundert.«
»Eine Frau in einer Abseite? In Eurem Haus?« Tauflieb runzelte die Stirn.
»Ja, es klingt merkwürdig. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Nur so viel: Ich handele im Auftrag der Stadt. Das muss Euch genügen. Ich darf Euch bitten, strengstes Stillschweigen zu bewahren, in Eurem eigenen Interesse.«
Tauflieb murmelte irgendetwas, dann kam ihm eine Erleuchtung. »Ist das die blonde Hexe, die mir den Gorm vorgestern von der Arbeit abgehalten hat?«
Der Hilfsmann grinste einfältig, als sein Name fiel.
»Es ist eine kranke junge Frau, die vor sich selbst geschützt werden muss. Deshalb das Schloss. Wenn Ihr es einbaut, seid so freundlich und schneidet außerdem ein Loch in die Türklappe. Ob rund oder eckig, ist mir egal.«
»Das ist Tischlerarbeit«, wehrte der Meister ab. »Ich komme in Teufels Küche, wenn ich anderen ins Handwerk pfusche.«
»Tut es trotzdem. Mir liegt daran, dass möglichst wenige um die Kranke in der Abseite wissen.« Lapidius schob einen weiteren Taler auf die Werkbank.
Tauflieb zögerte. Dann steckte er auch diesen ein.
Lapidius lächelte. »Ich freue mich, Meister, dass wir einander verstehen. Ich verspreche Euch, das bleibt unter uns; ebenso wie Ihr mir versprecht, nicht über die Kranke in der Abseite zu reden.«
Tauflieb spitzte die Lippen. »Alle Achtung, Ihr seid ein raffinierter Kopf, wenn die Bemerkung gestattet ist. Es sei, wie Ihr sagt.«
»Und was ist mit Gorm? Wird auch er den Mund halten?«
»Für Gorm lege ich meine Hand ins Feuer. Der hält dicht. Wie heißt es so schön? Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.«
»Dann sehe ich Euch später.«
Als Lapidius wieder auf die Böttgergasse hinaustrat, hatte ein frischer Wind eingesetzt. Er wehte von den Bergen herab und vertrieb die üblen Gerüche zwischen den Häusern. Ein Hauch von Frühling lag in der Luft. Lapidius ertappte sich dabei, Lust auf einen kleinen Spaziergang zu verspüren, was aber selbstverständlich nicht in Frage kam. Seine Arbeit im Laboratorium ging vor. Andererseits, wenn er den Gang nun mit etwas Nützlichem verbinden konnte? Zum Beispiel, indem er die beiden Zeuginnen aufsuchte, die Freyja belastet hatten? Wie waren noch ihre Namen? Richtig: Auguste Koechlin hieß die eine, Drusweiler die andere. Maria Drusweiler, wenn er sich recht erinnerte. Beide hatten mit ihren Aussagen dafür gesorgt, dass die Säckler gefoltert worden war. Wobei man von Aussagen kaum sprechen konnte, eher von schweren Anschuldigungen. Sie hätte Kinderfinger zu Salbe eingekocht, hatte es geheißen, und einen Axtstiel zum Bluten gebracht.
Lapidius, ein Mann der Wissenschaft, glaubte nicht an solchen Hokuspokus, auch wenn keinesfalls auszuschließen war, dass es Geister und Dämonen gab. Aber Freyja Säckler eine Hexe? Unsinn. Ein Gespräch mit den beiden angeblich so unbescholtenen Frauen würde Aufklärung bringen. Auch darüber, warum sie solche Ungeheuerlichkeiten behaupteten.
Allerdings hatte er keine Ahnung, wo die beiden wohnten. Was also tun? Plötzlich fiel ihm ein, dass ihm im Gegensatz dazu das Haus des Stadtmedicus durchaus bekannt war. Es lag in einer Seitengasse hinter dem Kornmarkt. Spontan beschloss er, nach dem erkrankten Mann zu sehen. Lapidius kannte ihn zwar nur dem Namen nach – Johannes Gesseler hieß er –, aber immerhin bestand eine Verbindung zwischen ihnen, da Lapidius ihn in der Folterkammer vertreten hatte.
»Wohlan denn«, murmelte er, »ich werde dem Herrn meine Aufwartung machen.«
Johannes Gesseler war ein Doctorus medicinae, wie seine Approbation verriet. Sie hing über seinem Bett, gold gerahmt und unübersehbar. Und sie war beileibe nicht das einzig Spektakuläre im Schlafraum des Stadtmedicus, denn daneben erkannte Lapidius die Abbildung eines nackten männlichen Körpers aus der Fabrica von Vesalius, bemerkenswerterweise mit geröteltem Genitalbereich. Dazu, auf Borden stehend, einige Marmorexponate von Geschlechtsteilen sowie mehrere Glashäfen mit menschlichen Organen in Spiritus, ferner präparierte Testikel, Skrota und Penisse. Alles wirkte mehr oder weniger eingestaubt und verriet, dass hier die sorgende Hand einer Frau fehlte.
Gesseler wirkte weit weniger auffällig. Er lag im Bett, klein und unscheinbar, fast etwas Rührendes ausstrahlend. Sein Gesicht war faltig, sein Alter schwer zu schätzen; vielleicht zählte er fünfzig Jahre. Der Gott Adonis, dachte Lapidius unwillkürlich, hat es nicht gut mit diesem Mann gemeint. Laut sagte er: »Gestattet, dass ich mich vorstelle: Lapidius ist mein Name. Ich hatte die Ehre, Euch in der Folterkammer zu vertreten.«
»Ich hörte davon, Magister.« Gesseler hatte eine überraschend angenehme Stimme. »Ich bin Euch sehr verbunden.«
»Ich hoffe, es geht Euch besser? Es hat den Anschein, dass niemand sich um Euer Wohlergehen kümmert.«
»Ich bin ein Eigenbrötler.« Ein Lächeln huschte über die Falten in Gesselers Gesicht. »Aber danke für die Nachfrage, ja, es geht mir ein wenig besser.«
Lapidius fiel auf, dass der Medicus ungewöhnlich langsam sprach, so, als wolle er jedem Wort eine besondere Bedeutung beimessen. Seine Augen unterstrichen seine Worte. Es waren Augen voller Leben.
Als hätte Gesseler Lapidius’ Gedanken erraten, fuhr er fort: »Die Augen sind der Teil meines Körpers, der noch am besten funktioniert. Mit den anderen Partien ist es nicht weit her, wie meine Fallsucht beweist. Sie zwang mich wieder einmal nieder, just zu dem Zeitpunkt, als ich gebraucht wurde.«
»Ich habe schon viel von dieser Krankheit gehört«, sagte Lapidius. »Wie äußert sie sich bei Euch?«
Gesseler winkte ab. »Wie bei jedem anderen Fallsüchtigen auch. Als Arzt mache ich da keine Ausnahme. Erbrechen, Krämpfe, Bewusstlosigkeit. Wenn ich es überstanden habe, manchmal erst nach Stunden, fühle ich mich unendlich matt und reizbar. Am liebsten bleibe ich dann für ein paar Tage im Bett.«
»Ich verstehe. Welche Medikamente verordnet Ihr Euch?«
»Keine.« Der Stadtmedicus winkte abermals ab. »Denn nichts kann mir helfen.«
»Nanu? Ihr nehmt auch keine Brompräparate?«
»Nichts. Gar nichts.«
Lapidius lachte. »Ein Beißholz aber werdet Ihr doch haben, um es bei einem Anfall zwischen die Zähne zu schieben?«
Gesseler versuchte einen Scherz: »Ich verbeiße mich lieber in meine Forschungen, denen ich jede freie Stunde widme. Ich will Hippokrates’ These endgültig widerlegen, welche besagt, dass der männliche Same von den Rückenwirbeln in die Nieren strömt und von dort in die Hoden. Ein Irrweg, im wahrsten Sinne des Wortes.«
»Aha, nun ja.« Lapidius’ Interesse für derlei Fragen war begrenzt. Es gab zwar Überschneidungen zwischen der Medizin und der Alchemie, und soweit sie seine Arbeit betrafen, hatte er sich mit ihnen beschäftigt, aber alles, was darüber hinausging, kümmerte ihn wenig. Er wechselte das Thema. »Seid Ihr sicher, dass Ihr keine Hilfe braucht? Ich könnte Euch meine Magd vorbeischicken.«
Der Medicus schüttelte den Kopf. »Nein, nein, macht Euch keine Sorgen um einen alten Mann. Ruhe ist alles, was ich brauche. Ruhe …« Er schloss die Augen und drehte den Kopf leicht zur Seite.
Lapidius verstand. »Dann will ich Euch nicht länger stören, ich wünsche Euch gute Besserung«, sagte er und schlüpfte rasch aus der Krankenstube.
Als er sich geraume Zeit später seinem Haus näherte, hörte er schon von weitem laute Schreie aus dem Oberstock. Was war da los? Er unterschied männliche und weibliche Stimmen, konnte aber nichts verstehen. Voll dunkler Vorahnungen hastete er durch die Tür und die Treppe hinauf. Das Erste, was er sah, war Gorms breiter Rücken. Er drängte ihn beiseite und erblickte Tauflieb und Marthe und – Freyja. Sie stand neben der Abseite, ihre Blöße mit einem Stück Sack bedeckend, und rief aufs Höchste erregt: »Ich lass mich nicht wegschließen wie ein Hund! Dass ihrs nur wisst! Ich will meine Kleider, meine Kleider will ich! Sofort!«
Marthe hing an ihr wie eine Klette. »Nu beruhich dich doch, Kindchen, beruhich dich! Wenns der Herr gesacht hat, hats gewisslich seine Richtigkeit mitm Schloss.«
»Das ist mir gleich! Verschwindet! Alle! Sofort! Ohhh …« Freyja hatte Lapidius bemerkt.
Marthe seufzte: »Der Herr is da. Gott sei gelobt un gepriesen!«
Tauflieb ging in die Hocke, um eine letzte Schraube festzuziehen. »Die Frau spielt verrückt«, knurrte er. »Wir haben nur unsere Arbeit gemacht, mehr nicht. Zuerst haben wir sie gar nicht bemerkt in ihrer Hexenkammer, so dunkel wies da drinnen ist, stimmts, Gorm?«
Der Hilfsmann schien die Worte seines Meisters nicht gehört zu haben, denn er starrte wie gebannt auf die kaum verhüllte Frau.
»Stimmts, Gorm?«
»Ja, jahaaa.« Gorm konnte den Blick nicht von Freyja lösen.
Tauflieb fuhr fort: »Auf einmal schießt dieses Weib hervor, rennt uns über den Haufen und schreit wie am Spieß. Na, mir kanns egal sein, die Arbeit ist getan. Auch das Loch haben wir in die Klappe geschnitten.«
Lapidius biss sich auf die Lippen. Die Situation, die er unbedingt hatte vermeiden wollen, war eingetreten. Die Wirkung seines Tranquiliums hatte vorzeitig nachgelassen, und Freyja war wach geworden. Doch daran ließ sich nun nichts mehr ändern. »Ich danke Euch, Meister Tauflieb«, sagte er. »Bitte lasst uns allein.«
»Das müsst Ihr mir nicht zweimal sagen«, knurrte Tauflieb, »hier, nehmt den Schlüssel zum Schloss. Komm schon, Gorm.«
Lapidius wandte sich an Marthe. »Du hast sicher Arbeit unten in der Küche.«
Die Magd verschwand ebenfalls, wenn auch widerstrebend.
Jetzt erst hatte Lapidius Zeit, Freyja richtig in die Augen zu sehen. Wut stand darin. Wut und Empörung. Und eine Portion Verzweiflung. »Ich hatte gehofft, du würdest länger schlafen«, sagte er betont ruhig. »Dann hätte ich dir alles erklären können.«
»Pah! Ich lass mich nicht wegschließen wie ein Hund!«
»Es ist nur zu deinem Besten, bitte, glaub mir.«
»Pah!«
»Setz dich da auf die Truhe und hör mir zu. Ich habe dir schon gesagt, dass die Kur außerordentlich unangenehm ist. Du wirst nicht nur schwitzen, dir werden auch sämtliche Knochen im Leibe wehtun. Manches Mal wirst du glauben, es nicht mehr aushalten zu können, und nur noch einen Gedanken haben: hinaus aus der Hitzkammer! Hinaus, hinaus! Aber glaube mir: Es wäre das Falscheste, was du machen kannst. Einmal begonnen, musst du die Kur um alles in der Welt durchstehen, denn bei einem Abbruch wäre alles umsonst gewesen.«