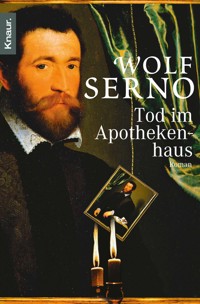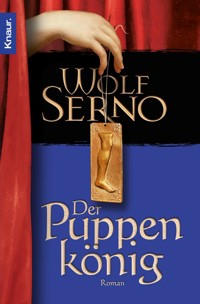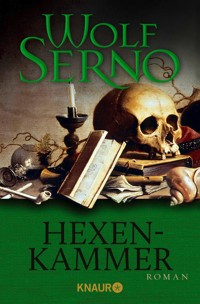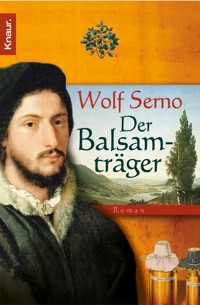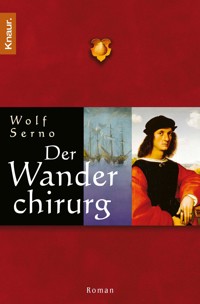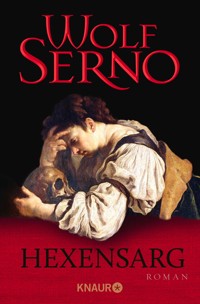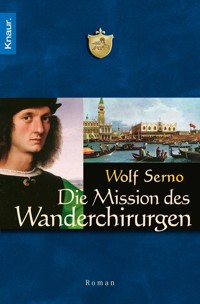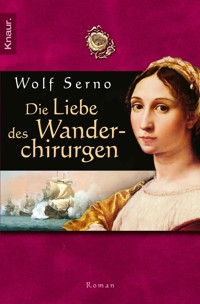6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein farbenprächtiger, bildgewaltiger historischer Roman von Wolf Serno, des Bestseller-Autors von u.a. "Der Wanderchirurg", "Der Balsamträger" und "Der Medicus von Heidelberg" »Manchmal, o Herr, ist es wirklich nicht leicht, Dein Diener zu sein.« 1576 ist Bologna eine wilde, überschäumende Stadt, von prunkvollen Palästen ebenso geprägt wie von Abertausenden von Bettlern. Mittendrin: Pater Matteo, der, so gut es eben geht, den Willen Gottes zu erfüllen versucht. Als Beichtvater werden ihm alle möglichen Sünden anvertraut – auch diejenigen, die als die sieben Todsünden bekannt sind. In sieben Episoden reihen sie sich aneinander, bevölkert von Adligen und Gauklerinnen, Kastratensänger, Dieben, Medici und Pestkranken, und zeichnen das farbenprächtige Bild einer Zeit des Umbruchs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolf Serno
Die sieben Todsünden
Gebeichtet zu Bologna1576 Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Manchmal, o Herr, ist es wirklich nicht leicht, Dein Diener zu sein.«
1576 ist Bologna eine wilde, überschäumende Stadt, von prunkvollen Palästen ebenso geprägt wie von Abertausenden von Bettlern. Mittendrin: Pater Matteo, der, so gut es eben geht, den Willen Gottes zu erfüllen versucht. Als Beichtvater werden ihm alle möglichen Sünden anvertraut – auch diejenigen, die als die sieben Todsünden bekannt sind. In sieben Episoden reihen sie sich aneinander, bevölkert von Adligen und Gauklern, Kastratensängern, Dieben, Medici und Pestkranken, und zeichnen das farbenprächtige Bild einer Zeit des Umbruchs.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Hinweis
Eine Vorbemerkung zum Ort der Handlung
Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge der Beichten
Die erste der sieben Todsünden: Hochmut
Die zweite der sieben Todsünden: Geiz
Die dritte der sieben Todsünden: Wollust
Die vierte der sieben Todsünden: Zorn
Die fünfte der sieben Todsünden: Völlerei
Die sechste der sieben Todsünden: Neid
Die siebte der sieben Todsünden: Faulheit
Dank
Wie immer für mein Rudel:
Micky, Olli und Magda
Nicht zu vergessen:
Fiedler, Buschmann, Sumo und Eddi,
die schon auf der anderen Seite
der Straße gehen.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
wer Sünde thut,
der ist der Sünde Knecht.
Evangelium Johannis, 8, 34
Die religiösen Zitate des Romans
stammen überwiegend aus:
Die Bibel
Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments
Siebenundzwanzigster Abdruck
Gedruckt und verlegt von B. G. Teubner in Leipzig, 1877
Eine Vorbemerkung zum Ort der Handlung
Bologna ist eine Stadt mit bewegter Vergangenheit. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins Mittelalter, als sie eine unabhängige Kommune war, und weiter bis in die Zeit des Römischen Reiches, als sie eine Kolonie war und Bononia hieß. Noch früher lebten hier die Etrusker, die sie Felsina nannten, und das italische Volk der Umbrier. Davor die prähistorischen Steinzeitmenschen.
Gelegen in einer fruchtbaren Ebene am Fuße der Appeninen, war die Stadt seit jeher ein bevorzugter Lebensraum, ein pulsierender Handelsplatz und ein Knotenpunkt der Verkehrswege.
Ihre ursprüngliche Ausdehnung kann noch heute an den Überresten zweier Stadtmauern abgelesen werden. Der äußere Wall und die zwölf Tore bestanden vermutlich noch im Jahre 1576, zu einer Zeit also, in der die Handlung dieses Romans spielt. Sämtliche Hauptstraßen führten – gleich den Speichen eines unregelmäßigen Rades – ins Zentrum auf einen weitläufigen Zentralplatz: die Piazza Maggiore.
Damals wie heute wird die Piazza Maggiore beherrscht von der gewaltigen Basilika San Petronio, die nach dem Schutzheiligen der Stadt benannt ist. Ihre mächtigen Mauern überschatteten den angrenzenden Palazzo dei Notai, den Palast der Notare, in dem auch die Geldwechsler ihre Räume hatten. Gegenüber befand sich der Palazzo del Podestà, in dem die Ältesten residierten. An der dritten Seite der Piazza stand das beeindruckende, einer Festung gleichende Rathaus: der Palazzo Pubblico. Er war der offizielle Wohnsitz des vom Papst ernannten Legaten, der in allen Belangen das letzte Wort hatte. Er stand noch über der Regierung, die sich aus dem obersten Beamten, Gonfalonier genannt, sowie acht Konsuln und dem Senat zusammensetzte.
Auf dem Monte della Guardia, einem sich nach Südwesten erstreckenden Hügel, überragte das Kloster der Madonna di San Luca die Ebene. Es war eines von nicht weniger als sechsundneunzig Klöstern im Stadtgebiet.
Von den hoch aufragenden Wohntürmen, den sogenannten Geschlechtertürmen, die in früheren Zeiten durch wohlhabende Familien zum Schutz vor Angriffen errichtet worden waren, standen im späten sechzehnten Jahrhundert nur noch wenige, darunter die beiden berühmten, heute noch erhaltenen Türme Asinella und Garisenda.
Sie waren – wie nahezu alle Gebäude der Stadt – in Ermangelung von Marmor aus Ziegeln errichtet. Die Häuser schmiegten sich eng aneinander in Blocks, direkt an der Straße und direkt über den langen Arkaden, die noch immer typisch für Bologna sind. Von ihnen sagte man, sie seien angelegt zum Schutz vor Regen und Schnee – unter anderem für die vielen Studenten der Universität, die sich tags und nachts auf den Straßen herumtrieben oder bei feierlichen Anlässen in prächtigen Prozessionen mit ihren Professoren einherschritten.
Überhaupt spielte die äußere Erscheinung eine entscheidende Rolle. Strenge Regeln bestimmten die Etikette. Luxus und Zurschaustellung der Kleidung waren extrem. Kostbare Seiden und Brokate, goldene Ketten, Ringe und Knöpfe, Perlen und Juwelen waren in Mode, der Gebrauch von Puder und Parfum war gang und gäbe, das Färben der Haare sehr beliebt.
Daneben traten Aberglaube und Hexenwahn in hohem Maße zutage. Der Glaube an Astrologie, an die verborgene Kraft von Edelsteinen und der mystische Einfluss von Worten und Zahlen waren weit verbreitet und beherrschten in nicht geringem Maße die Gedanken und das Schrifttum der Zeit.
Doch neben Glitzerwelt und Luxus zeichneten sich mehr und mehr Zerfallserscheinungen ab. Die Gesetzlosigkeit nahm zu. Posten und andere Ämter wurden an den Meistbietenden verschachert oder einem Verwandten zugeschanzt. Brutale Fehden zwischen einflussreichen Familien waren üblich. In den letzten Jahren unter Gregor XIII. (1502–1585) stieg die Zahl der Verbrechen ins kaum Erträgliche und behinderte den für die Stadt so notwendigen Handel beträchtlich.
Es waren die Armen und die Bettler, die Diener und die Tagelöhner, die am meisten unter den Gewalttaten litten. Hohe Steuern durch Adel und Kirche trugen zur Armut der Menschen bei. Kaminsteuern wurden oft mehrmals im Jahr erhoben, Salzsteuern ständig erhöht. Jede Ware, die in die Stadt kam, wurde ohne Ausnahme mit Abgaben belegt. Gegen Ende des Jahrhunderts drohte eine Hungersnot, und zehntausend Bettler hielten täglich die Hand auf.
So war die Situation, als sich gegen all den Protz und Prunk, gegen Armut und Not ein einzelner Priester stemmte. Sein Name war Pater Matteo, und er war Seelsorger einer kleinen Kirche namens Chiesa di San Simeone. Er setzte seine bescheidenen Kräfte dazu ein, den Menschen Hilfe zu bringen und Trost zu spenden – manchmal, wie er glaubte, mehr schlecht als recht, manchmal vielleicht ein wenig erfolgreicher. Aber immer im Namen des Herrn.
Beides, die kleine Kirche und Pater Matteo, hat es nie gegeben. Und doch können wir ihnen auch heute noch überall begegnen …
Die wichtigsten Personen in der Reihenfolge der Beichten
Pater Matteo – ein Priester, dem nichts Menschliches fremd ist, weil er nicht immer Priester war. Beichtvater und Seelsorger der Chiesa di San Simeone
Dovizio – Matteos »Küster, Koch und Kantor«. Brummig, aber treu
Gioacchino Pepoli – sein Hochmut wird nur von seiner Feigheit übertroffen. Beichtet deshalb die Sünden eines »Freundes«
Pamfalon – Patron der Gauklertruppe Le Giocolieri. Tritt als Ansager und Pulcinell auf
Lavinia – Pamfalons Tochter. Besitzt die seltsame Gabe, Zuschauer in Schlaf zu versetzen. Begeht Selbstmord aus Rache
Leonello und Leonardo – Zwillinge, Söhne von Pamfalon
Conor – ein gewitzter Bettler, stadtbekannt wegen eines klugen Raben, der auf den Namen Massimo hört
Doktor Marcello Galbaio – ein junger Arzt aus Berufung. Wohnt in einem Kuriositäten-Kabinett. Beichtet in einer katholischen Kirche, obwohl er Protestant ist
Umberto Fanti – der größte Geizhals Bolognas. Stirbt lieber, als auch nur einen einzigen Baiocco für Medikamente auszugeben
Die Witwe Memmo – eine Nachbarin, deren Hilfsbereitschaft den Geizhals Fanti nicht vor dem Tod bewahren kann
Alberto Dominelli – handelt mit lebensechten Miniaturnachbildungen, unter dem Leitsatz Corpus in perfectio natura
Violino – ein Jüngling, der wegen seiner engelsgleichen Stimme kastriert wird. Findet Zuflucht bei Pater Matteo
Marino – ein Bettler, der bis zu seinem Tod als allacrimanto, als Dauerweiner, arbeitet. Violinos Vater
Doktor Giorgio Fausto – ein teuflischer Alchemist mit pädophilen Neigungen. Will die Transmutation im Menschen nachweisen
Domenico Selvo – ein schwerreicher Seidenraupenzüchter. Sorgt dafür, dass Violino gegen seinen Willen kastriert wird
Bella – Selvos Töchterchen. Freundin Violinos
Pipo – ein Dieb und Frauenheld. Treibt Selvo durch einen wollüstigen Akt vor aller Augen in den Ruin
Meister Bruno – repariert den Beichtstuhl von San Simeone und baut das Gerüst für die Restauration der Fresken
Doktor Flabanico – soll Pater Matteos Knie heilen und nimmt stattdessen eine Aussatzschau an ihm vor
Nausica – eine junge Frau, die vergewaltigt wird und fast an der Abtreibung stirbt. Findet ein Zuhause bei Pater Matteo
Morna – eine alte Wehmutter, die nicht viel Worte macht und hilft
Sberleffo – ein Bettler und Grimassenschneider. Bringt die Menschen zum Lachen, indem er seine Nase in den Mund nimmt
Doktor Gaspare Tagliacozzi – ein Arzt, der zweifelhafte Heilmethoden anwendet. Behandelt Pater Matteos Knie mit warmem Schafsgedärm und zieht sich dessen Zorn zu
Gorgo – ein eingeschleppter Pestkranker aus Venedig. Stirbt trotz Pater Matteos aufopferungsvoller Pflege
Tullio Tegalliano – erscheint während des Karnevals als Satyr mit Phalli und Vulven auf der Brust. Geliebter von Giulia Anafesto
Giulia Anafesto – tritt während des Karnevals als verführerische Elfe auf. Geliebte des Satyrs
Anafesto – ein reicher Kunsthändler. Vater Giulias. Mitverursacher des guerra balconale, einer maßlosen Völlerei während der Karnevalstage
Riccardo Contarini – Sohn eines Weinhändlers. Geht aus Neid über Leichen und bereut seine Todsünde trotz allen Zuredens bis zuletzt nicht
Diotato Grimani – Freund und späterer Feind Riccardo Contarinis. Wird von diesem aus niederen Neidgefühlen ermordet
Meister Bonucci – Schirmmacher und Nausicas Vater. Verstößt seine vergewaltigte Tochter aus Angst vor dem Gerede der Nachbarn. Zeigt späte Reue und Einsicht
Filippo – Sohn eines Olivenbauern. Dieb und Faulpelz. Wettet, einem Mauerblümchen die Jungfernschaft stehlen zu können, ohne dass diese es bemerkt
Madalena Colberti – das Mauerblümchen. Ein hässliches Entlein, aus dem später ein Schwan wird. Verliebt sich in Filippo. Und umgekehrt
Gustavo – ein Dieb und Kumpan von Pipo. Will Filippo töten, weil er sich um die Wettsumme betrogen fühlt
Die erste der sieben Todsünden: Hochmut
superbia
Es war an einem der ersten Tage des Jahres 1576, als Pater Matteo wieder einmal Gelegenheit fand, Zwiesprache mit seinem Schöpfer zu halten. Er pflegte dies in der Sakristei seiner Kirche, der Chiesa di San Simeone, zu tun, wo er niederkniete und den Blick auf das kleine Kruzifix an der Wand richtete. »Herr«, sagte er, »es liegt geraume Weile zurück, dass ich um Deinen Rat und Deine Stärke gebeten habe. In der Zwischenzeit ist vieles geschehen, zu vieles, wenn Du mich fragst. Doch lass mich der Reihe nach berichten. Ich …«
In diesem Augenblick drang ein gewaltiges Poltern an sein Ohr, es schien aus dem Kirchenschiff zu kommen. Was ging da vor? Matteo erhob sich mühsam. Seit einigen Wochen plagten ihn Knieprobleme, was angesichts seines Alters – er zählte dreiundfünfzig Jahre – und der harten, kalten Steinfliesen in der Sakristei kein Wunder war. Er öffnete die Tür und sah an der gegenüberliegenden Wand vier Männer, die ein hölzernes Ungetüm heranschleppten. Es war der reparierte Beichtstuhl. Sie setzten ihn ächzend ab, hoben ihn wieder an und setzten ihn abermals ab. Offenbar wussten sie nicht, wo sein angestammter Platz war. Sie schnauften und schwitzten, und als einer der Träger den Pater entdeckte, rief er: »Buon giorno, Hochwürden, wir sollen uns bei Dovizio, dem Küster, melden!«
Matteo, ein Mann, dem das Leben schon manche Falte ins Gesicht geschnitzt hatte, war noch immer ungehalten über die Unterbrechung. »Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich fürchte, ihr müsst mit mir vorliebnehmen.«
Der Träger lachte verlegen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wir wollten Euch nicht stören, Hochwürden.«
»Nun ja.« Matteo musste zugeben, dass der Beichtstuhl von San Simeone in der Tat ziemlich schwer war, ein Möbel aus massivem Eichenholz, geschlossen, zweigeteilt und hoch wie ein Schrank. Niemand, auch nicht der stärkste Mann, vermochte ihn geräuschlos zu transportieren. »Wo habt ihr denn euren Meister gelassen?«, fragte er versöhnlich.
»Meister Bruno ist in der Werkstatt, Hochwürden. Wir sollen auch recht schön grüßen.«
»Danke, eigentlich hatte ich erwartet, dass er mir das Ergebnis seiner Reparaturarbeit persönlich zeigt. Aber es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Der Platz des Beichtstuhls ist übrigens auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchenschiffs, ihr müsst euch also noch einmal bemühen.«
Die Träger unterdrückten eine Verwünschung und hoben das schwere Gebilde erneut an. Mit roten Gesichtern und geschwollenen Adern bugsierten sie es um die Bankreihen herum, setzten es ab und wollten sich aufatmend davonmachen, doch Matteo hielt sie auf. »Einen Augenblick noch. Ich muss etwas überprüfen.«
»Ja, Hochwürden.«
Matteo betrachtete das Dach des Beichtstuhls und die dort inmitten von Rosenreliefs hineingeschnittenen Buchstaben. Es waren acht Versalien, die zusammen das Wort Ignoscam ergaben. Er prüfte jeden Buchstaben genau, denn Meister Bruno war des Lateinischen nicht mächtig und hätte leicht einen Fehler machen können.
»Es ist alles richtig«, stellte Matteo erleichtert fest. »Bestellt eurem Meister meinen Dank.«
»Wird gemacht, Hochwürden.«
Die Träger bekreuzigten sich und strebten dem Ausgang zu, doch Matteo war noch etwas eingefallen: »Und richtet ihm aus, er möge bei der Berechnung seiner Kosten nicht vergessen, dass dieses Gotteshaus zu den ärmsten der Gemeinde San Salvatore gehört.«
»Ja, Hochwürden.«
Sie verschwanden endgültig, und Matteo war wieder allein in seiner Kirche. Allein mit dem Beichtstuhl. Er strich mit der Hand über das grob gemaserte, vom Zahn der Zeit dunkel gefärbte Holz. Es fühlte sich warm und vertraut an. Und es roch schwach nach Weihrauch. Eine Eigenschaft, die von den zahllosen Messen herrührte, bei denen Dovizio das Thuribulum schwenkte, um den Altar, das Altarkreuz und die Reliquien zu beräuchern, während Matteo im vollen liturgischen Ornat das Kirchenschiff betrat, um den Gottesdienst zu beginnen.
Er schloss die Augen, genoss für einen Moment den Duft des Holzes und nahm wie von selbst seinen Platz im Beichtstuhl ein, den Platz des Zuhörens, des Verstehens und – sofern der Sünder Reue zeigte – den Platz des Vergebens. Er betrachtete das Gitterfenster mit dem rautenförmigen Muster, das Priester und Beichtenden trennte, und zog den Vorhang zu. Nun drang das Licht nur noch gedämpft zu ihm herein, während er selbst vollständig im Dunkeln saß. Oftmals hatte er darüber nachgedacht, warum der Priester in jedem Fall unsichtbar bleiben musste, warum die Beichte stets im Flüsterton stattfand, warum das Bußgespräch so ehernen Regeln unterworfen war. Wäre es der Sache des Herrn nicht manchmal dienlicher, fragte er sich, wenn ein strenges Wort von einer strengen Miene, ein aufmunterndes Wort von einer aufmunternden Miene begleitet würde? Indes, das zu beurteilen durfte er sich nicht anmaßen. Das Sakrament der Beichte war ein jahrhundertealtes Ritual und hatte sich vieltausendmal bewährt …
»Hochwürden?«
Matteo schreckte aus seinen Gedanken auf. Hinter dem Vorhang erkannte er im matten Licht einen Kopf. »Ja, ich bin hier«, antwortete er leise.
»Ich möchte beichten.«
Matteo seufzte unhörbar. Auf das geliebte Zwiegespräch mit seinem Schöpfer würde er zunächst wohl verzichten müssen.
Andererseits hatte jeder Gläubige das Recht und die Pflicht zu beichten, mehrmals im Jahr, je nachdem, wie viel Schuld er auf sich geladen hatte. Wer krank war, auf Reisen war oder andere triftige Gründe anführen konnte, dem Bußsakrament fernzubleiben, sollte versuchen, wenigstens ein Mal pro Jahr die Confessio abzulegen, und das möglichst am Osterfest. Bis zum Auferstehungstag Christi war es in diesem Jahr noch geraume Weile hin, aber vielleicht war die Schuld des Sünders besonders groß.
»Ich werde Euch die Beichte abnehmen«, sagte Matteo und wartete auf die Anfangsformel der Beichte, die von der anderen Seite kommen musste.
Als es still blieb, räusperte Matteo sich. »Es ist wohl einige Zeit her, dass Ihr Eure Vergehen vor Gott dem Herrn bekannt habt?«
»Warum, Hochwürden?«
»Weil Ihr, wie es scheint, die Anfangsformel der Beichte vergessen habt. Schlagt das Kreuz, dann will ich sie für Euch sprechen.«
»Gut, ich habe es geschlagen.«
»In nomine patri et filii et spriritus sancti. Amen. Merkt Euch den Satz für das nächste Mal.«
»Wie Ihr meint, Hochwürden.«
»Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und Seiner Barmherzigkeit«, sprach Matteo den Anschlusstext und fuhr fort: »Nun sagt mir, was Euch bedrückt.«
»Ich habe gesündigt.«
»Etwas genauer müsst Ihr schon werden.«
»Verzeiht, Hochwürden, kann ich sicher sein, dass kein Sterbenswort aus diesem Kasten an die Öffentlichkeit dringt?«
Matteo verspürte Unmut. »Alles, was Ihr sagt, sagt Ihr sub rosa, also unter der Rose. Die geschnitzte Rose schmückt diesen ›Kasten‹, wie Ihr ihn nennt, in üppiger Pracht, sie ist das Zeichen der Verschwiegenheit. Seid versichert, ich werde das Beichtgeheimnis in jedem Fall wahren.«
»Nun gut, meine Sünde besteht darin, einen, äh, Freund nicht von seiner Sünde abgehalten zu haben.«
»Das ist eine eher ungewöhnliche Verfehlung.«
»Ich fürchte, dafür wiegt die Schuld meines Freundes umso schwerer.«
»Wollt Ihr mir seinen Namen nennen?«
»Auf keinen Fall.«
»Schon gut, es war nur eine Frage.«
»Mein Freund wäre gewiss nicht damit einverstanden, wenn sein Name …«
»Seine Anonymität wird, wenn er es wünscht, selbstverständlich respektiert. Wollt Ihr mir wenigstens sein Alter verraten?«
»Mein Freund ist einundzwanzig.«
»Schön, und wie steht es mit Eurem Alter?«
»Ist das wichtig, Hochwürden?«
»In der Tat.« Matteo bezwang seine aufkommende Ungeduld und sprach ruhig weiter. »Weil eine Sünde bei einem achtzehnjährigen Heißsporn anders zu bewerten ist als bei einem vierzigjährigen Mann.«
»Das leuchtet ein. Ich bin, äh, auch einundzwanzig.«
»Also noch ein junger Mann. Und nun erzählt mir, was Euch und Euren Freund bedrückt. Zuvor aber noch eine Frage: Wäre es nicht besser, wenn er ebenfalls zur Beichte käme?«
»Zweifellos, Hochwürden.«
»Und warum tut er es nicht?«
»Ich hoffe, er tut es.«
Matteo gewann allmählich den Eindruck, dass sein Gegenüber ihm die Zeit stehlen wollte. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Vergehen, das ihm gleich zu Ohren kommen würde, nur um eine Belanglosigkeit, vielleicht war das Ganze sogar nur ein Studentenstreich, bei dem es darum ging, einen Priester an der Nase herumzuführen. Bologna, die altehrwürdige Universitätsstadt, in der seine Kirche stand, wurde zwar allgemein la dotta, »die Gelehrte«, genannt, man hätte sie aber genauso gut la irriverenta, die »Respektlose«, oder l’atea, »die Gottlose«, rufen können. »Ich denke, wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Also bitte, beginnt.«
»Jawohl, Hochwürden. Ich muss vorausschicken, dass es sich bei meinem Freund um den Sohn eines der reichsten Männer der Stadt handelt. Der Vater ist Seidenkaufmann.«
»Seidenkaufmann?«
»Ja, er besitzt ein prächtiges Anwesen in der Via … aber der genaue Wohnort tut nichts zur Sache. Jedenfalls liegt das Anwesen in der Gemeinde San Mamolo.«
»Fahrt fort.« Matteo wusste, dass in der Gemeinde San Mamolo tatsächlich eine Reihe gut betuchter Seidenkaufleute lebte. Vielleicht, überlegte er, handelt es sich doch nicht um einen Studentenstreich. Immerhin wird Bologna auch die Stadt der Seidenweberei genannt.
»Der Vater meines Freundes gab eines Tages ein großes Fest in seinem Haus. Er hatte es von langer Hand vorbereiten lassen, denn das Ereignis sollte alles in den Schatten stellen, was die Gemeinde je gesehen hatte. Wem die Ehre zuteilwurde, eine Einladung zu erhalten, nahm dies zum Anlass, seine schönsten Gewänder hervorzuholen. Seide, Atlas und Brokat, schillerndes Organza, feinstes Tuch und edelster Schmuck bestimmten das Bild, als die Gäste zur genannten Stunde eintrafen. Überall blitzten goldene Ketten und Juwelen auf, erlesene Aromen von Duftkugeln durchzogen die Räume. Man lachte und plauderte, übergab der Dienerschaft beim Hereinkommen die pelzverbrämten Übermäntel, und der Vater meines Freundes begrüßte jeden Gast persönlich. Nicht nur, weil dies die Höflichkeit gebot, sondern auch, weil viele der Geladenen zu den Honoratioren der Stadt gehörten, die ihm bei seinen vielfältigen Geschäften von Nutzen sein konnten. Zu alledem spielten die besten Musikanten auf. Der Klang von Schalmeien, Flöten und Fideln füllte die Räume, Trommel und Triangel gaben den Takt dazu an.«
An dieser Stelle räusperte sich Matteo und sagte: »Es mag ein Merkmal unserer Zeit sein, dass manch einem die Zurschaustellung von Prunk und Pracht fast wichtiger erscheint als die Luft zum Atmen. Aber allein darin kann ich noch keine schwerwiegende Sünde erkennen. Im Übrigen: Welche Rolle spielte Euer Freund bei der Feier? Bisher habt Ihr ihn mit keiner Silbe erwähnt.«
»Mein Freund, Hochwürden, war an der Seite seines Vaters. Er war zum Nachfolger des Handelshauses bestimmt und sollte bei dieser Gelegenheit in die Gesellschaft eingeführt werden.«
»Ihr sprecht stets nur von dem Vater. Wo war die Mutter bei diesem Fest?«
»Der Vater ist Witwer. Seine Frau starb vor einigen Jahren an Bluthusten. Doch lasst mich weitererzählen: Nach der Begrüßung führte der Vater seine Gäste zu dem großen Festsaal, in dem getafelt werden sollte. Auf den Tischen bog sich alles, was Küche und Keller hergegeben hatten: erlesenste Speisen von Rind, Lamm und Wildschwein, dazu Braten und Pasteten, Würste und Schinken – Fleisch, so weit das Auge reichte, eine Orgie aus Fleisch, der die Vielfalt des Geflügels in nichts nachstand. Der Gaumen des Feinschmeckers konnte wählen zwischen Fasan und Wachtel, Kapaun, Schwan und sogar Pfau. Fische und Suppen hingegen gab es nicht, denn der Vater war der Meinung, derlei fade Kost sei der Fastenzeit vorbehalten. Stattdessen lockten die verschiedensten kandierten Früchte und feinstes Zuckerwerk – Stück für Stück so delikat angerichtet, dass den Gästen das Wasser im Munde zusammenlief.«
Matteo erging es in diesem Augenblick ähnlich, denn das Einzige, was er bisher zu sich genommen hatte, war ein Becher Brühe am Morgen – der Rest einer Gemüsemahlzeit, die Dovizio für sie beide am Tage zuvor aufs Feuer gesetzt hatte. Der Küster war kein guter Koch und würde es niemals werden, doch Matteo war froh, dass er überhaupt jemanden hatte, der in dem kleinen Wohnhaus neben San Simeone die Küchenarbeit für ihn erledigte. Laut sagte er: »Eure Schilderung lässt an Genauigkeit nichts zu wünschen übrig. Allerdings habt Ihr mir noch nicht verraten, welche Rolle Ihr bei der Feier gespielt habt. Wart Ihr selbst anwesend?«
»Nein, Hochwürden. Es ist so, dass mein Freund mir die gesamte Geschichte bis ins Kleinste berichtet hat, vielleicht, weil es ihm half, die große Schuld, die er auf sich lud, besser zu ertragen.«
»Ich verstehe.« Matteo sah ein, dass er sich noch gedulden musste.
»Nachdem die Gäste den Speisen kräftig zugesprochen hatten und die Diener nicht müde geworden waren, roten Lambrusco aus gläsernen Karaffen nachzuschenken, lockerte sich die Stimmung mehr und mehr auf. Das Geschehen verlagerte sich in die große Säulenhalle, die zum Garten hin offen ist. Die Dämmerung setzte ein. Fackeln und Lampions verbreiteten Licht, Kohlebecken spendeten angenehme Wärme. Die Musikanten folgten den Gästen und setzten ihre Darbietung auf einer Bühne in der Halle fort. Die Melodie einer langsamen Pavane erklang, als Aufforderung, den Abend mit einem Schreittanz zu eröffnen.
Doch bevor die ersten Schritte gesetzt wurden, ergriff der Vater das Wort. Er nutzte die Gelegenheit, um seine Gäste noch einmal in aller Form zu begrüßen und sie mit einem eigens zu diesem Zweck verfassten Poem zu erfreuen. Das Gedicht war einfach, kam ohne rhetorische Effekte und ohne geschwollene Worte aus und erhielt deshalb großen Beifall. Der Vater bedankte sich mit einer kleinen Verbeugung. Er wusste: Das Schreiben von Versen machte Eindruck. Es war in der feinen Gesellschaft Bolognas ebenso in Mode wie das Tragen von bunten Baretten oder tief geschlitzten Ärmeln.
Nachdem der Applaus verklungen war, forderte der Vater eine alte Freundin zur Pavane auf, um den Anfang zu machen. Obwohl der Wein ihm schon zu Kopf gestiegen war, gelang es ihm, die Schrittkombinationen nach links und rechts mit der gebotenen Würde auszuführen, und alsbald taten es ihm mein Freund und die anderen Herren mit ihren Damen nach. Anschließend erklang eine Gaillarde, ein Springtanz, der Kraft und Ausdauer erforderte, weshalb mehrere ältere Paare die Tanzfläche verließen.
So reihte sich Tanz an Tanz, und mancher Gast dachte bereits an den Aufbruch, als der eigentliche Höhepunkt des Abends nahte. Er kündigte sich an mit einem machtvollen Anschwellen der Musik, die lauter und immer lauter wurde, um dann ganz plötzlich auszusetzen. In der entstehenden Stille trat ein zierlicher Mann auf die Tanzfläche. Er trug ein Kostüm wie ein neapolitanischer Pulcinell, hatte eine Zipfelmütze auf dem Kopf und ein sackartiges, knöchellanges Hemd über dem Leib. Das Hemd bestand lediglich aus braunen und roten Flicken – ein Aufzug, der im Vergleich zu den kostbaren Gewändern der Gäste lächerlich wirkte und deshalb umgehend für Heiterkeit sorgte.
Der zierliche Mann schien das Lachen kaum zu hören. ›Mein Name ist Pamfalon‹, sagte er mit großem Ernst, ›ich bin Patron einer Gauklertruppe, die sich schlicht Le Giocolieri nennt. Wir haben an diesem Abend die Ehre, Euch mit unseren Künsten zu erfreuen.‹ Während er das sagte, war er wie zufällig an einigen der Umstehenden vorbeigegangen, machte halt und fragte: ›Vermisst Ihr nichts?‹
Die Gäste schauten sich an und schüttelten die Köpfe.
Pamfalon griff in eine seiner tiefen Taschen. ›Dann fehlt Euch dieses sicher auch nicht.‹ Seine Hand tauchte auf und präsentierte im Licht der Lampions einige Broschen und Fibeln. Erstaunte Rufe der Besitzer, die erst jetzt ihr Eigentum vermissten, waren die Antwort.
›Ihr sollt alles, was Euch gehört, zurückbekommen‹, versicherte Pamfalon und steckte die Gegenstände in seine Tasche zurück. Dann nickte er einer jungen Frau zu. ›Eine der Broschen gehört Euch. Holt sie Euch heraus.‹
Als die junge Frau ihn unsicher ansah, gestattete er sich ein Lächeln. ›Oder fürchtet Ihr Euch vor einem alten Mann?‹
Die Frau kicherte verlegen, doch dann griff sie zu und machte ein verdutztes Gesicht.
Pamfalon fragte: ›Findet Ihr nichts?‹
›Nein, eben war die Brosche doch noch …?‹
Daraufhin bat Pamfalon einen stattlichen Herrn, sein Eigentum zurückzunehmen, und auch dieser fand nichts in der Tasche.
So ging es weiter, sehr zum Erstaunen aller Gäste, die mittlerweile einen Halbkreis um Pamfalon gebildet hatten. Der zierliche Mann trat einige Schritte zurück, damit jeder ihn gut sehen konnte, und sagte: ›Vielleicht ist es kein Zufall, dass meine Tasche leer war. Ich bitte diejenigen, die etwas vermissen, ihre Kleidung zu überprüfen.‹
Die Gäste taten, wie ihnen geheißen, und zur Verblüffung aller befand sich jedes der verschwundenen Schmuckstücke wieder an seinem ursprünglichen Platz.
›Das ging nicht mit rechten Dingen zu!‹‚ rief einer. ›Wie habt Ihr das nur fertiggebracht?‹
Pamfalon streckte ihm seine Hände entgegen. ›Damit, Messer, mit nichts anderem. Seid versichert, es war keine Zauberei im Spiel. Die Kunst, Gegenstände verschwinden und wieder auftauchen zu lassen, verlangt nur etwas Geschicklichkeit und Ablenkung, nicht mehr.‹
Auch wenn es über das Vorstellungsvermögen der Gäste hinausging, glaubten sie dem zierlichen Mann, und dieser schien erleichtert …«
Hier unterbrach Matteo die ungewöhnliche Beichte und sagte: »Der Gaukler-Patron kann von Glück sagen. Nicht jedes Mal lässt sich ein Verdacht so leicht ausräumen.« Er dachte an eine Hexenverbrennung, die noch keine fünf Jahre zurücklag. In Rom war es gewesen, wo eine Frau auf dem Scheiterhaufen qualvoll starb. Er wusste nicht, was man ihr vorgeworfen hatte, außer, dass sie rothaarig war, er wusste nur, dass der Ankläger Girolamo Menghi hieß, ein Franziskaner-Minorit und ein großer Glaubenseiferer obendrein, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jegliche Art von Besessenheit und Zauberei zu verfolgen. Menghi war im Klerus durchaus nicht unumstritten, und auch Matteo gehörte zu den Zweiflern, die mehr Besonnenheit und weniger Blindgläubigkeit anmahnten. Nicht zuletzt, weil vielerorts Aberglaube und Astrologie, dazu der Einfluss von mystischen Worten und Zahlen sowie das Bekenntnis zu der verborgenen Kraft von Edelsteinen zusehends um sich griffen. »Nun fahrt fort.«
»Jawohl, Hochwürden. Ich sagte, Pamfalon, der Gaukler-Patron, sei erleichtert gewesen, als er sah, dass man seine Darbietung nicht für Zauberei hielt. Er setzte sein Programm fort, wobei er es sich nicht nehmen ließ, einige Male zu erklären, welche Täuschung sich hinter dem Kunststück verbarg. Auch bei dem Trick mit dem Seidentuch verfuhr er so. Er bat einen der anwesenden Gäste zu sich und hieß ihn, sich auf einen bereitgestellten Stuhl zu setzen. Dann verwickelte er den Mann in ein Gespräch und begann, ein rotes Seidentuch in sein linkes Ohr zu stopfen. Die Gäste lachten und fragten sich, was als Nächstes geschehen würde. Sie sollten nicht lange warten müssen. Pamfalon wanderte um den Mann herum und zog zur Verblüffung aller das Tuch aus dem anderen Ohr heraus.
›Das ging nicht mit rechten Dingen zu!‹, rief wieder einer. Doch Pamfalon erklärte, er habe – unter aller Augen, doch unbemerkt – zuvor ein gleiches Tuch in das andere Ohr gestopft. Zum Beweis zog er das erste Tuch aus dem linken Ohr heraus. ›Seht Ihr, edle Herrschaften, zur Täuschung bedarf es nur einiger Geschicklichkeit und Ablenkung.‹ Er hielt inne und fuhr fort: ›Und in diesem Fall zweier gleicher Tücher.‹
Die Gäste klatschten.
Pamfalon bedankte sich bei dem Mann und entließ ihn. ›Bei der folgenden Darbietung werden jedoch weder Ablenkung noch Geschicklichkeit zum Einsatz kommen‹, kündigte er an, woraufhin einige der Gaukler eine schwere Truhe auf die Tanzfläche trugen. Ein Jüngling, keine sechzehn Jahre alt, folgte der Truhe und verbeugte sich in alle Richtungen.
›Das ist mein Sohn Leonello‹, stellte Pamfalon ihn vor. ›Bitte achtet genau darauf, was er tut.‹
Leonello hob den Deckel an und kletterte in das Behältnis, bis er vollständig verschwunden war. Nur sein Arm reckte sich noch einmal nach oben und schloss den Deckel. Pamfalon verriegelte die Truhe. Darüber hinaus bat er zur allgemeinen Erheiterung zwei gewichtige Gäste, sich auf den Deckel zu setzen, um auf jeden Fall zu verhindern, dass Leonello aus seinem Gefängnis ausbrechen könne.
Dann geschah erst einmal nichts.
Alle starrten auf die Truhe. Die beiden gewichtigen Herren. Die Gäste. Der Vater. Und mein Freund. Sie warteten, dass etwas geschehe, doch es geschah nichts – nur Pamfalon lächelte fein. Als die Spannung schließlich in Unruhe umzuschlagen drohte, sagte er: ›Edle Herrschaften: Niemand wird es mir glauben, aber mein Sohn war die ganze Zeit nicht eingeschlossen. Er war die ganze Zeit unter Euch!‹
Kaum hatte er das gesagt, trat Leonello aus der Mitte der Gäste heraus, ging zu seinem Vater und verbeugte sich nach allen Seiten.
Ungläubiges Staunen schlug ihm entgegen.
›Schaut ihn Euch genau an‹, befahl Pamfalon. ›Er ist es.‹
Das taten die Gäste. Und sie mussten erkennen, dass es sich um keinen anderen als Leonello handelte.
›Das ging nicht mit rechten Dingen zu!‹, rief zum dritten Mal einer.
›Doch, das tat es‹, widersprach Pamfalon. ›Lasst es mich Euch beweisen.‹ Er trat an die Truhe heran, entriegelte das Schloss und hob den Deckel.
Alle hielten den Atem an.
Aus der Truhe stieg Leonello. Oder besser: ein Jüngling, der ihm aufs Haar glich.
Pamfalon wies mit der Hand auf beide. »Darf ich vorstellen, edle Herrschaften: meine Söhne Leonello und Leonardo. Sie sind Zwillinge, die niemand auseinanderzuhalten vermag – und sie sind der Beweis dafür, dass soeben alles mit rechten Dingen zuging.‹
Erneut brandete Beifall auf.
Als er verebbte‚ setzte die Musik wieder ein. Fidel, Trommel und Schellenring spielten eine schnelle Moriskenmelodie, eine Weise, die sich bei Hofe und Adel zunehmender Beliebtheit erfreute, da der dazugehörende Tanz von Kraft und körperlicher Gewandtheit geprägt war. Doch wer sollte ihn ausführen?
Ein dritter Jüngling erschien, noch knabenhafter in seiner Erscheinung als Leonello und Leonardo, doch ungleich auffälliger gekleidet. Er trug ein mit Adlerfedern geschmücktes Barett, ein salamandergrünes Wams, eine resedafarbene Puffhose und storchenrote Beinlinge.
›Meine Tochter Lavinia!‹, rief Pamfalon nicht ohne Stolz.
›Eure Tochter?‹, kam es ungläubig zurück.
Pamfalon lachte zum ersten Mal an diesem Abend. ›So ist es, edle Herrschaften. Denn unter buntem Tuch lässt sich vieles verbergen: Armut oder Reichtum, Alter oder Jugend, Mann oder Frau. Lavinia jedenfalls ist eine Frau. Sie wird tanzen für Euch, und sie wird Euch‹ – er machte eine bedeutungsvolle Pause – ›ganz sicher in ihren Bann schlagen.‹
Sowie seine letzten Worte verklungen waren, riss Lavinia sich das Barett vom Kopf, und schwarze, lockige Haare quollen hervor.
Ein Raunen ging durch die Gäste. Die Musik wurde lauter und schneller. Lavinia begann zu tanzen. Sie wiegte sich im Rhythmus der Melodie, flocht eine erste Körperdrehung in ihre Darbietung ein. Es folgte einer der für den Moriskentanz charakteristischen Sprünge, dann ein zweiter, ein dritter, wobei sie Hände und Finger auf seltsame Art kreisen ließ. Tiefe, nie gehörte Laute entrangen sich ihrer Kehle. Sie wirkte wie ein schönes Tier, wie eine Katze, mal schien sie sich an die Gäste heranzupirschen, mal schien sie auf der Flucht zu sein. Doch ständig blieb sie in Bewegung, ihr Körper spannte und entspannte sich mit akrobatischer Fertigkeit, ihre Füße berührten den Boden kaum. Dann, mit einem gewaltigen Sprung, landete sie wieder in der Mitte der Tanzfläche, wo weitere Gaukler erschienen waren, um gemeinsam mit ihr weiterzutanzen.
Alsbald folgten einige der Gäste dem Beispiel. Die mutigsten und jüngsten waren es, und auch mein Freund war unter ihnen. Er und Lavinia fanden sich im Spiel der gemeinsamen Bewegungen, sie tanzten umeinander herum, aufeinander zu und voneinander fort, ergänzten sich auf ideale Weise, und wenn Lavinias Schritte zuvor denen einer jagenden Katze geglichen hatten, so schien sie jetzt selbst die Gejagte zu sein. Denn immer näher kam mein Freund ihr, immer stärker schien er sie zu bedrängen – bis sie sich abermals mit einem gewaltigen Sprung von ihm löste und einen Arm hochriss, um der Musik Einhalt zu gebieten.
Die Melodie brach ab. Die Tänzer hielten atemlos inne und verließen die Tanzfläche. Gleiches taten die Gaukler. Nur Lavinia und mein Freund blieben. Sie sahen sich schweigend an, und sie spürten, dass der Tanz ein Band um sie geknüpft hatte. Pamfalon, der sich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten hatte, trat hinzu und wandte sich an die Gäste: ›Edle Herrschaften, der Moriskentanz soll nur der Auftakt zu einer weit ungewöhnlicheren Darbietung gewesen sein, denn meine Tochter Lavinia beherrscht eine Kunst, die ihresgleichen sucht. Zur Ausübung dieser Kunst bedarf es äußerster Ruhe – und eines Freiwilligen. Wer von Euch traut es sich zu, ihr zu assistieren?‹
›Ich!‹, rief mein Freund, bevor ihm ein anderer zuvorkommen konnte. ›Ich traue mir das zu.‹
Einen Herzschlag lang sah es so aus, als sei es Pamfalon nicht recht, dass mein Freund die Aufgabe übernahm, doch der Augenblick ging vorüber, und der Gaukler-Patron sagte: ›Wohlan, Lavinia, beginne rasch, denn ich glaube, dass dein Assistent bereits sehr müde ist.‹
Die Gäste lachten, da mein Freund alles andere als müde wirkte. Er hatte vielmehr nur Augen für Lavinia. Diese schien es nicht zu bemerken. Sie hob abermals einen Arm, und sofort kehrte Ruhe ein. ›Ich glaube, mein Vater hat recht‹, sagte sie mit dunkler, eindringlicher Stimme, einer Stimme, die in seltsamem Gegensatz zu ihrem schlanken Körper stand. ›Ihr seid müde.‹
Mein Freund lachte. Doch dann begegnete er Lavinias Augen, und sein Lachen erstarb. Er wusste nicht, warum, aber irgendetwas war in ihrem Blick, das ihn fesselte. Waren es zuvor ihr Tanz und ihre Ausstrahlung gewesen, die ihn in ihren Bann gezogen hatten, so waren es jetzt die Augen. Es waren bernsteinfarbene Augen, Augen von tiefer Unergründlichkeit, Augen, durch die sie zu sprechen schien.
›Ihr seid müde‹, wiederholten die Augen, ›sehr müde, es wäre besser, wenn Ihr Euch schlafen legtet.‹
Während dieser Worte hatten mehrere Gaukler ein Bett mit Decken und Daunenkissen herbeigetragen und stellten es neben Lavinia ab. Mein Freund bemerkte es nicht. Alle seine Sinne konzentrierten sich auf die Augen vor ihm.
›Wollt Ihr Euch schlafen legen?‹, fragten die Augen.
Mein Freund nickte.
›Das ist gut, denn es ist kalt. Sehr, sehr kalt. Es war lange nicht so kalt wie heute. Friert Euch?‹«
»Verzeiht, wenn ich Euch abermals unterbreche«, sagte Matteo, dem die Kälte selbst in die Glieder kroch. Man schrieb Anfang Januar, und in seiner Kirche herrschten eisige Temperaturen. San Simeone war schon immer ein armes Gotteshaus gewesen, in dem an allem gespart werden musste, selbst am Holz zum Heizen. Anders als in San Rocco, einer prächtigen Basilika, die nur wenige hundert Schritte entfernt lag. Dort waltete Pater Edoardo seines Amtes und las alljährlich die Messe anlässlich der Prozession der Seidenweber, eines farbenprächtigen Umzuges, der durch das gesamte Viertel führte und erst vor dem mit Blattgold und Juwelen geschmückten Altar endete. Der heilige Rocco war der Schutzpatron der Seidenweber, und diese ließen es sich nicht nehmen, ihm für seine Hilfe zu danken, indem sie seiner Kirche großzügige Geschenke machten. Doch Matteo wollte nicht undankbar sein. Er war ein Spätberufener, der viele Jahre als Medicus gearbeitet hatte, bevor ein einschneidendes Erlebnis ihn dazu bewog, sein Leben dem Dienst an Gott zu widmen, und er war froh, in San Simeone sein eigenes, bescheidenes Reich gefunden zu haben. Wenn es doch bloß nicht so bitterkalt wäre! »Braucht Ihr für Euren Bericht noch lange?«, fragte er.
»Ich fürchte, es dauert noch ein wenig, Hochwürden.«
Matteo zog die Kutte enger um den Leib. »Nun ja, nirgendwo steht geschrieben, dass eine Beichte kurz sein muss. Allerdings ist mir bisher nicht klar geworden, welcher Sünde Ihr Euch schuldig gemacht habt. Fahrt fort.«
»Danke, Hochwürden. Lavinia fragte also meinen Freund, ob ihn friere, woraufhin dieser nickte.
›Das ist kein Wunder‹, sagte sie, ›denn Ihr seid völlig unbekleidet. Seht nur an Euch herunter, Ihr habt überhaupt nichts an. Habt Ihr etwas an?‹
Mein Freund schüttelte den Kopf.
Einige der Gäste lachten, doch Lavinia hob den Arm und gebot Ruhe. ›Ihr müsst zu Bett, denn Ihr seid nackt und müde. Und Euch ist kalt. So kalt, dass Ihr mit den Zähnen klappert.‹
Mein Freund nickte und klapperte mit den Zähnen.
›Nun legt Euch hin. Und deckt Euch sorgfältig zu, denn es ist kalt. Und wenn Ihr Euch zugedeckt habt, werdet Ihr schlafen. Ihr werdet tief schlafen, ganz tief, und alles, was um Euch herum geschieht, werdet Ihr nicht erkennen. Es wird sein wie ein Traum. Und wenn ich mit den Fingern schnippe, werdet Ihr wach werden und Euch an nichts erinnern.‹
Mein Freund ging zum Bett und legte sich hinein. Seine Bewegungen glichen denen einer Maschine, sein Gesichtsausdruck war leer. Die Gäste starrten ihn an. Sie sahen, wie er die Augen schloss und sofort einschlief.
›Das ist vorher abgesprochen!‹, platzte einer der Gäste heraus. ›Ich wette, der Junge schläft nicht. Der tut nur so.‹
›Richtig, das Ganze ist ein abgekartetes Spiel‹, bekräftigte ein Zweiter.
Und ein Dritter meinte: ›Selbst wenn es kein Spiel sein sollte, bei mir würde der Blick nicht wirken.‹
Pamfalon, der auf den letzten Rufer aufmerksam geworden war, wandte sich höflich an ihn: ›Wenn Ihr einverstanden seid, Messer, nimmt Lavinia Euch beim Wort. Kommt auf die Tanzfläche und schaut ihr in die Augen.‹
Die Aufforderung kam dem Mann – es handelte sich um jenen, dem Pamfalon das Tuch aus dem Ohr gezogen hatte – jedoch zu plötzlich. Der Mut verließ ihn. Er murmelte irgendetwas und tauchte in der Menge der Gäste unter.
Dafür meldete sich ein anderer. Ein munterer Vierziger, der als gargiolaro zu Geld gekommen war. ›Wir Seilmacher sehen immer gern einer schönen Frau in die Augen!‹, rief er laut und hatte die Lacher auf seiner Seite.
Doch als er Lavinia gegenüberstand, verstummte er.
›Ein Seilmacher seid Ihr also‹, sagten Lavinias Augen. ›Das ist ein schöner Beruf. Ich sehe, wie Ihr in Eurer Werkstatt steht und die Fäden mit der Seilerkurbel zusammendreht. Seht Ihr Euch auch? Ihr steht an der Seilerkurbel und stellt ein kräftiges Tau her. Seht Ihr Euch?‹
Der gargiolaro nickte.
›Dann dreht nur weiter an der Kurbel.‹
Der Mann begann, ein unsichtbares Rad zu drehen.
›Ihr werdet so lange die Kurbel betätigen, bis ich mit dem Finger schnippe. Dann werdet Ihr aufhören und Euch an nichts erinnern. Habt Ihr das verstanden?‹
Der gargiolaro nickte, während seine Hand unablässig das unsichtbare Rad drehte.
Auf den Gesichtern der Gäste spiegelte sich eine Mischung aus Ungläubigkeit und Belustigung wider. Doch Lavinia hatte schon weitere Gäste zu sich gebeten. Während der gargiolaro fortfuhr, sein Rad zu drehen, und mein Freund im Bett tief zu schlafen schien, sorgte sie dafür, dass ein alter Mann, der unter ständiger Heiserkeit litt, ein fröhliches Karnevalslied anstimmte, weil er glaubte, die Zeit der Masken und der Tänze sei gekommen.
Es folgten zwei Frauen, die allgemein als spinnefeind bekannt sind. Nachdem Lavinias Augen zu ihnen gesprochen hatten, umarmten sie sich, herzten einander und küssten sich auf die Wangen.
Danach kam ein eher billig gekleideter Mann, Umberto Fanti mit Namen, der als einer der geizigsten Kaufleute Bolognas gilt. Seine Hand, die sonst jeden Baiocco zwei Mal umdreht, bevor sie ihn ein Mal ausgibt, verteilte großzügig Scudi, die hundert Mal wertvoller waren. Die Gäste wussten kaum, wie ihnen geschah.
So ging es weiter. Immer wieder bewirkte die Kraft von Lavinias Augen eine seltsame Entrückung, und immer wieder, wenn sie mit dem Finger schnippte, schien es, als würden die Menschen aus einer anderen Welt erwachen. Niemand konnte sich an das erinnern, was in der Zwischenzeit geschehen war, nicht der gargiolaro, der verwundert auf seine Hände starrte, nicht der alte Herr, der wieder heiser war, nicht die beiden Frauen, die sich spinnefeind wie eh und je waren, und auch nicht der geizige Umberto Fanti.
Zuletzt ging Lavinia abermals zur Mitte der Tanzfläche, wo das Bett stand, in dem mein Freund schlief. Sie weckte ihn, und er stand auf. ›Wisst Ihr, warum Ihr Euch in dieses Bett gelegt habt?‹, fragte sie.
Mein Freund verneinte.
›Wisst Ihr, dass Euch sehr kalt war?‹
›Nein.‹
Dann wisst Ihr auch nicht, dass Ihr sicher wart, völlig nackt zu sein.‹
Mein Freund schaute erschreckt an sich herab. Als er sah, dass er vollständig angekleidet war, wirkte er erleichtert.
Die Gäste schmunzelten, doch manche unter ihnen begannen wieder zu zweifeln. War das alles wirklich keine Zauberei, keine geheime Magie?
Als hätte Pamfalon ihre Gedanken erraten, ergriff er rasch das Wort und rief: ›Edle Herrschaften, wie Ihr Euch sicher erinnert, sagte ich, dass hinter den Kunststücken des heutigen Abends nichts anderes als Geschicklichkeit und Ablenkung stehen. Genauso verhält es sich auch mit Lavinias Darbietung.‹
›Nun gut, das mag sein‹, rief einer der Herren und schwenkte ein Glas Wein dabei, ›aber Ihr habt uns bisher jedes Mal erklärt, welcher Trick sich hinter dem Kunststück verbirgt. Was ist das Geheimnis von Lavinias Augen?‹
Pamfalon antwortete: ›Messer, bitte glaubt mir, es gibt für alles eine Erklärung, auch für dieses Geheimnis. Aber erlaubt, dass ich es nicht lüfte. Es muss Dinge geben, die nur wir Gaukler kennen, denn wenn es nicht so wäre‹ – er lächelte schief –, ›wie sollten wir dann noch Zuschauer finden.‹
›Richtig‹, rief der Vater, der sich auf seine Pflichten als Gastgeber besann, ›ein Geheimnis, das keines mehr ist, hat seinen Wert verloren. Wir wollen in den Festsaal zurückgehen und weiterfeiern.‹«
»Halt«, gebot Matteo leise, aber energisch an dieser Stelle, »ich habe Euch bisher sehr gut zugehört, und abgesehen davon, dass die Gäste des Abends sich zweifelsohne der Völlerei schuldig gemacht haben, kann ich noch immer nicht erkennen, was Eure Schuld in diesem Zusammenhang ausmachen soll. Wenn ich Euch richtig verstanden habe, seid Ihr ein Freund des Sohnes und wart an jenem Abend gar nicht dabei.«
»So ist es, Hochwürden«, kam die Antwort von der anderen Seite des Beichtstuhls. »Wartet noch ein wenig, dann werdet Ihr es erfahren.«
»Nun gut, ich höre.«
»Im Festsaal feierten, schmausten und tranken die Gäste noch bis spät in die Nacht, und der Vater bemühte sich, die wichtigsten Besucher von den Vorzügen seines Sohnes zu überzeugen. Er sprach von seinem wachen Verstand, seiner umfassenden Bildung, seinen angenehmen Umgangsformen und wurde nicht müde, ihn als seinen Nachfolger in den höchsten Tönen zu loben. Doch seine Versuche waren wenig erfolgreich, denn mein Freund wirkte die ganze Zeit mehr oder weniger abwesend. Er machte den Eindruck, als befände er sich nicht im Festsaal, sondern irgendwo an einem entfernten Ort. In einem unbeobachteten Augenblick verließ er tatsächlich den Saal und strebte in die Säulenhalle, in der zuvor die Gaukler aufgetreten waren. Er hegte die Hoffnung, Lavinia zu treffen. Wer ihn gefragt hätte, warum er so erpicht darauf war, noch einmal die Tochter des Gauklers zu sehen, dem wäre er die Antwort schuldig geblieben. Er wusste es nicht. Er fühlte sich nur magisch von ihr angezogen.
In der Säulenhalle stellte sich heraus, dass Pamfalon und seine Truppe das Haus bereits verlassen hatten. Mein Freund fragte die Bediensteten, wohin die Spielleute verschwunden seien, doch niemand konnte ihm Auskunft geben. Da machte er sich auf die Suche. Er nahm eine Laterne und ging mit ihr die Straßen rund um das Anwesen seines Vaters ab. Es war schon tief in der Nacht, kaum jemand war im Viertel noch auf den Beinen, und die wenigen Menschen, denen er begegnete, konnten ihm ebenfalls nichts zum Verbleib der Gaukler sagen.
Sie waren wie vom Erdboden verschwunden.
Als er unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehrte, war der Vater noch auf und machte ihm heftige Vorwürfe. Er klagte, mein Freund habe ihn durch sein Verhalten bloßgestellt, ja, sogar lächerlich gemacht. Wie wolle er jemals in seine Fußstapfen treten, wenn er nicht einmal in der Lage sei, den Gästen Rede und Antwort zu stehen, sondern stattdessen einfach fortlaufe?
Mein Freund sagte dazu nichts. Er bat, auf sein Zimmer gehen zu dürfen, er sei müde.
Am anderen Tag machte er sich erneut auf die Suche nach den Gauklern. Er forschte den ganzen Vormittag nach ihnen, fragte Gott und die Welt, bis ihm schließlich Conor, ein Bettler, der auf der Piazza Maggiore um Almosen bittet, gegen ein paar Baiocchi weiterhalf. Conor sagte, Pamfalon sei mit seiner Truppe auf dem Weg nach dem Dörfchen Bentivoglio, dort wolle man im Schutz des Kastells ein Lager aufschlagen und in den nächsten Tagen einige Vorstellungen geben.
Mein Freund bedankte sich und eilte nach Hause, wo er ein Pferd bestieg, um die Stadt zu verlassen und auf der Via Ferrarese nach Norden zu reiten. Nach gut zwei Stunden erreichte er Bentivoglio. Pamfalon und die Seinen waren kurz zuvor eingetroffen. Fünf einfache Wohnwagen hatte man zu einem Kreis aufgestellt. In der Mitte des Kreises legte Pamfalon mit seinen Gauklern letzte Hand an den Aufbau des Zuschauerzeltes. Als er meinen Freund sah, hob er überrascht die Augenbrauen. ›Messer, Ihr hier? Was ist der Grund für Euer Erscheinen?‹
Mein Freund hatte während des gesamten Ritts darüber nachgedacht, welch einleuchtende Erklärung er dafür geben könne, doch ihm war nichts Gescheites eingefallen. Deshalb sagte er: ›Ich bin auf dem Weg nach Ferrara. Es ist reiner Zufall, dass ich dir und deinen Giocolieri begegne. Doch da wir uns schon getroffen haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen und dich bitten, mir etwas zu verkaufen.‹
›Was könnte ich Euch schon verkaufen?‹
›Das rote Tuch, das du einem der Gäste meines Vaters durch den Kopf gezogen hast.‹
Pamfalon lächelte flüchtig. ›Ihr wisst, dass dies so nicht geschah. Es bedurfte vielmehr zweier Tücher, um den Schein zu erwecken. Doch es wird mir eine Ehre sein, Euch beide Tücher zu überlassen – selbstverständlich als Geschenk. Geht nur hinein ins Zelt. Dort werdet Ihr Lavinia antreffen, die ein paar Sitzbänke aufstellt für die Zuschauer, die wir heute Abend erwarten. Lavinia hat die Tücher.‹
Mit klopfendem Herzen betrat mein Freund das Zelt. Nachdem er sich umgesehen hatte, entdeckte er Lavinia. Sie trug eine Männerhose aus einfachem Blautuch und ein Leinenhemd, das ihre Fraulichkeit kaum verhüllte. Über sein Erscheinen schien sie sich nicht zu wundern. ›Ich ahnte, dass Ihr kommen würdet‹, sagte sie mit ihrer dunklen Stimme. ›Was kann ich für Euch tun?‹
›Ich sprach draußen mit deinem Vater über die beiden roten Tücher. Er möchte, dass du sie mir schenkst.‹
›So, möchte er das?‹ Lavinia kräuselte die Stirn. Dann griff sie in die Taschen ihrer Hose und zog beide Hände, zu Fäusten geballt, wieder heraus. ›Ratet, wo sie sind.‹
›Beim Raten habe ich nie Glück.‹ Mein Freund deutete auf die linke Faust.
›Falsch.‹ Lavinia öffnete die Hand. Sie enthielt nichts.
›Ich wusste es. Nun gut, dann eben die andere.‹
›Meint Ihr?‹ Spott blitzte in ihren Augen auf. Sie öffnete die rechte Faust. Auch sie war leer.
›Du willst mich foppen! Du hattest gar keine Tücher in den Taschen.‹
›So? Und was ist das?‹ Wie aus dem Nichts hielt sie in jeder Hand ein Tuch.
Mein Freund staunte. ›Wie hast du das gemacht?‹
Lavinia lächelte. ›Mit Geschicklichkeit und Ablenkung.‹
›Das möchte ich auch können! Würdest du es mir beibringen?‹
›Nein.‹
›Bitte! Was nützt mir ein Geschenk, wenn ich damit nichts anfangen kann.‹
Lavinia zögerte. ›Der Trick verlangt sehr viel Übung.‹
›Ich habe Zeit.‹
›Müsst Ihr nicht nach Hause zu Eurem Vater?‹
›Nein, er hat mich beauftragt, in Geschäften nach Ferrara zu reisen, und erwartet mich nicht vor zwei Wochen zurück.‹
›In zwei Wochen kann sehr viel geschehen.‹
›Wie meinst du das?‹
›Ach, nichts. Wollt Ihr mir beim Aufbauen der Sitzbänke helfen? Sie sind ziemlich schwer.‹
›Gern.‹
Gemeinsam stellten sie die Bänke auf. Als sämtliche Sitze in Reih und Glied standen, fragte mein Freund: ›Wo sind eigentlich deine Brüder, ich habe sie draußen nicht gesehen?‹
›Sie sind unterwegs und werben für unsere Darbietung heute Abend. Sie jonglieren ein wenig mit Bällen und gehen auf den Händen, um die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner zu erwecken. Aber ob es ihnen gelingt, sie zu uns zu locken, kann man nie genau wissen. Das Leben eines Gauklers ist hart. Einerseits ist es ein freies, unbeschwertes Dasein, andererseits stehen wir stets mit einem Bein im Gefängnis, weil man uns der Zauberei oder des Diebstahls verdächtigt. Wir sind nicht von Stand, wie Ihr es seid, Messer, man wirft uns mit Bettlern, Langfingern und Tagelöhnern in einen Topf. Wollt Ihr noch immer, dass ich Euch den Trick mit den roten Tüchern beibringe?‹
›Ja‹, antwortete mein Freund. ›Ja, das will ich.‹ Er griff nach ihrer Hand, um seine Absicht zu bekräftigen, doch sie entzog sie ihm. ›Lasst das.‹
Er sah sie an. Ihre bernsteinfarbenen Augen schienen das ganze Gesicht zu beherrschen. Es war ein schmales Gesicht mit ausdrucksstarkem Mund, der den Eigenwillen seiner Besitzerin erahnen ließ. ›Du bist schön.‹
›Spart Euch die Schmeicheleien. Ich weiß, was junge Herren damit bezwecken. Wollt Ihr nun den Trick erlernen oder nicht?‹
›Gewiss, gewiss.‹
›Dann schaut Euch die Tücher genau an. Sie sind mindestens fünf Ellen lang und wirken viel größer, als sie sind. Doch weil sie aus feinster Seide hergestellt wurden, lassen sie sich so stark zusammenknüllen, dass sie in die Schale einer Haselnuss passen.‹
›Mit einem normalen Tuch wäre der Trick also nicht möglich?‹
›Auf keinen Fall. Nur weil die Tücher sich so stark zusammendrücken lassen, können sie in einem Ohr verschwinden oder‹ – Lavinia machte zwei geschmeidige Handbewegungen – ›im Ärmel eines Hemdes.‹ In der Tat waren während ihrer letzten Worte beide Tücher schlagartig unsichtbar geworden.
›Das musst du mir noch einmal zeigen, aber langsam.‹
Sie tat es.
›Ich staune. Darf ich es auch mal versuchen?‹ Mein Freund probierte es und scheiterte kläglich.
Lavinia lachte. Es war das erste Mal, dass er sie lachen sah. Aller Ernst war aus ihrem Gesicht gewichen und hatte einem strahlenden Leuchten Platz gemacht.
›Lass es mich gleich noch einmal versuchen.‹ Obwohl er sicher war, den Trick dieses Mal besser ausführen zu können, stellte er sich linkisch an, denn er hoffte, sie würde wieder so lachen.
Doch sie tat ihm den Gefallen nicht.
›Ihr müsst fleißig üben, sonst werdet Ihr niemals Erfolg haben‹, sagte sie stattdessen. ›Und wenn Ihr den Bewegungsablauf beherrscht, seid Ihr noch immer nicht am Ziel, denn die Zuschauer sind flinker mit den Augen, als man glaubt. Es gilt, sie abzulenken. Das kann durch eine Geste sein, ein Wort oder ein Geräusch. Es kommt auf die Situation an. Sie zu erkennen und das Richtige zu tun, ist die eigentliche Kunst.‹
›Glaubst du, ich werde sie erlernen können?‹
Lavinia schaute ihn an. ›Ich glaube nicht. Vielleicht würde es Euch gelingen, aber Ihr wollt es nicht wirklich.‹
›O doch! Bedenke, ich habe zwei Wochen Zeit, um mit dir zu üben.‹
›Ich weiß. Wenn Ihr bei uns bleiben wollt, müsst Ihr meinen Vater um Erlaubnis fragen. Er ist der Patron. Und fragt ihn auch, ob Ihr Euer Pferd zu unseren Eseln stellen dürft, es muss schließlich irgendwo bleiben.‹
›Danke, Lavinia.‹
›Und nun geht, ich muss mich um das Abendessen kümmern.‹
Mein Freund verließ das Zelt und suchte Pamfalon. Er fand den alten Mann im größten der Wohnwagen, wo er an einem Tisch saß und einen Apfel schälte.
Mein Freund fragte, ob er ein paar Tage bei den Giocolieri bleiben dürfe. Er würde gern die Tricks mit den Seidentüchern erlernen.
Pamfalon sah ihn an. ›Eure Bitte ist ungewöhnlich, Messer, sehr ungewöhnlich sogar.‹
›Ich meine es ernst.‹
Pamfalon steckte sich ein Stück Apfel in den Mund. ›Wenn ich Euch die Erlaubnis erteile, werdet Ihr früher oder später merken, dass ich immer zu sagen pflege, was ich denke. Und ich denke, es sind weniger die roten Seidentücher, die es Euch angetan haben, als vielmehr meine Tochter.‹
Mein Freund wollte protestieren, aber Pamfalon winkte ab. ›Erspart Euch die Mühe. Wie gesagt, ich spreche aus, was ich denke. Wisset, Lavinia kann machen, was sie will. Sie ist alt genug. Sieben Jahre liegt es zurück, dass ihre Mutter starb. Sie war die Seele der Giocolieri. Bevor sie die Augen schloss, habe ich ihr eines schwören müssen: niemals zuzulassen, dass Lavinia auch nur ein Haar gekrümmt wird.‹
›Ich würde mir lieber die Hand abhacken lassen, als Lavinia Schmerz zuzufügen.‹
Pamfalon richtete die Spitze des Schälmessers auf meinen Freund. ›Könnt Ihr das bei Gott dem Allmächtigen beschwören?‹
›Das kann ich.‹
›Gut, ich will Euch glauben. Doch solltet Ihr Euer Versprechen nicht einhalten, werde ich Euch mit diesem Messer töten.‹
›Das schreckt mich nicht.‹
Pamfalon musterte meinen Freund lange. Dann sagte er: ›Ich glaube nicht, dass du weißt, auf was du dich einlässt. Doch sei willkommen. Da du bei den täglichen Darbietungen nicht von Nutzen sein kannst, wirst du beim Auf- und Abbauen der Gerätschaften helfen, Wasser holen, Lasten tragen und all jene Dinge erledigen, die von den feinen Leuten als niedere Arbeiten bezeichnet werden. Ist das klar?‹
›Jawohl.‹
›Es heißt: Jawohl, Patron.‹
›Jawohl, Patron.‹
›Schön. Nur eines wirst du nicht: in meinem und Lavinias Wohnwagen schlafen. Such dir einen anderen Platz. Am Fuß der östlichen Kastellmauer gibt es einen Ziegenverschlag. Wird dir das genügen?‹
›Jawohl, äh, Patron. Darf ich mein Pferd zu euren Eseln stellen?‹
›Das darfst du. Und wenn du schon einmal da bist, kannst du auch gleich die Tiere füttern.‹
Mein Freund brachte sein Pferd zum Pferch der Esel, hängte den Tieren Futtersäcke um und füllte den Trog mit frischem Wasser. Es war eine Arbeit, die ihm leicht von der Hand ging, denn als Kind hatte er viel Zeit in den Stallungen seines Vaters verbracht. Anschließend legte er die wenigen Schritte zum Kastell zurück. Der Zahn der Jahrhunderte hatte an den Mauern des alten Bauwerks genagt, doch immer noch stand es trutzig in der Landschaft. Wie beschrieben, befand sich an der östlichen Mauer ein Ziegenverschlag. Als mein Freund sich bückte, um hineinzugelangen, verzog er unwillkürlich das Gesicht, die gehörnten Bewohner hatten einen strengen Geruch hinterlassen. Er sah sich um. In einer der Ecken stand ein Reisigbesen. Er nahm ihn und kehrte damit notdürftig den Boden. Dann setzte er sich auf die nackte Erde.
Es dauerte nicht lange, da wurde ihm kalt, und die Gedanken begannen, in seinem Kopf zu kreisen. Nie zuvor war er allein fort gewesen. Immer hatte der Vater ihn begleitet. Was würde der Vater unternehmen, wenn er seine Abwesenheit bemerkte?
Er musste eingeschlafen sein, denn irgendwann wurde er durch lautes Lachen und Rufen wach. Draußen war es bereits dunkel. Woher kamen die Geräusche? Er verließ den Verschlag und erkannte, dass im Zelt eine Vorstellung lief. Schwacher Lichtschein drang durch die Planen nach außen. Er lief hinüber und stellte sich in den Eingang. Ein Dutzend Dörfler saß auf den Bänken und starrte auf eine Truhe in der Mitte. Zwei kräftige Zuschauer hatten auf ihr Platz genommen, und Pamfalon rief: ›Hört zu, Leute: Niemand wird es mir glauben, aber mein Sohn war die ganze Zeit nicht eingeschlossen. Er war die ganze Zeit unter euch!‹
In diesem Augenblick murmelte jemand eine Entschuldigung, damit mein Freund ihn vorbeiließe. Es war Leonardo. Der zweite Zwilling strebte zur Mitte des Zeltes, stellte sich dort neben Pamfalon hin und verbeugte sich nach allen Seiten.
Ein Raunen ging durch die Dörfler. Jemand rief: ›Das ist Zauberei!‹
›Nein, das ist es nicht‹, widersprach Pamfalon. ›Lasst es mich euch beweisen.‹ Er entriegelte das Schloss und hob den Deckel. Aus der Truhe stieg Leonello.
Die Dörfler klatschten. Zuerst zaghaft, dann stärker.
Mein Freund musste lächeln. Die Darbietung kannte er bereits. Er wandte sich ab und ging zurück zum Ziegenverschlag, wo er sich fröstelnd auf den Boden setzte. Was will ich eigentlich hier?, fragte er sich. Es stinkt, es ist feucht, mein Magen knurrt, und dunkel ist es obendrein. Ich könnte jetzt zu Hause im Warmen sitzen, und die Diener würden mir zu essen und zu trinken bringen.
Ein Geräusch unterbrach seine Gedanken. Schritte näherten sich, eine Laterne verbreitete schwankendes Licht. ›Ich habe von Vater gehört, du darfst bleiben‹, sagte Lavinia mit ihrer dunklen Stimme.
Lavinia! Sein Herz tat einen Sprung.
›Ich habe dir einen Strohsack mitgebracht und etwas zu essen.‹ Sie breitete die Unterlage auf dem Boden aus und legte einen halben Laib Brot darauf. ›Die Laterne lasse ich dir auch da.‹
›Bleib‹, bat er. ›Geh nicht gleich wieder.‹
›Warum sollte ich bleiben?‹, fragte sie.
›Weil … weil ich mich mit dir unterhalten möchte.‹
›Unterhalten?‹ Sie kräuselte die Stirn. ›Worüber? Es ist schon sehr spät.‹
›Ich weiß‹, sagte er, ›bleib trotzdem. Komm, setz dich zu mir auf den Strohsack.‹
Widerstrebend setzte sich Lavinia neben ihn. Sie blickte ihn an, ruhig und ernst.
›Und nun?‹, fragte sie.
›Nun, äh, könntest du mir erzählen, wie du es anstellst, Menschen in Schlaf zu versetzen. Ich weiß, dein Vater macht darum ein Geheimnis, das er nicht lüften will. Er sagte aber auch, es gäbe für alles eine Erklärung. Bitte sag mir: Warum kannst du etwas, das andere nicht können?‹
Lavinia zuckte mit den Schultern. ›Warum fliegen Vögel, warum hüpfen Frösche, warum springen Böcke? Es ist nun einmal so.‹
›Aber etwas muss doch in dir vorgehen, ich meine, es ist doch eine Kraft, mit der du das Verhalten der Menschen beeinflussen kannst?‹
›Ich weiß es nicht. Ich habe nie darüber nachgedacht. Es ist ganz einfach so, dass ich will, dass der andere in Schlaf fällt, und tut, was ich ihm sage.‹
›Es ist also Willensstärke, die das bewirkt?‹
Lavinia zögerte. ›Ja, es hängt mit meinem Willen zusammen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich muss jetzt gehen.‹ Sie erhob sich mit einer anmutigen Bewegung und blieb noch einmal stehen. ›Hier stinkt es. Morgen musst du gründlich sauber machen und lüften. Gute Nacht.‹
›Gute Nacht, Lavinia.‹
Sie verließ ihn, und er blieb allein zurück. Hungrig biss er in das Brot. Es war billiges Brot, gebacken mit minderwertigem Erbsen- und Bohnenmehl, nicht duftend und weiß, wie er es kannte. Gern hätte er einen Schluck Wein getrunken, um es hinunterzuspülen, aber er hatte nicht einmal Wasser.
Nachdem er gegessen hatte, deckte er sich mit seinem Übermantel zu und löschte die Talgkerze in der Laterne. Noch einmal zogen die Bilder des Tages an ihm vorüber. Sein letzter Gedanke galt dem Vater, mit dem ihn so wenig verband. Der Vater war ein geltungssüchtiger Mann, der von allem nie genug bekommen konnte: von Geld, Ruhm und wichtigen Ämtern. Dazu setzte er sämtliche Hebel in Bewegung – und überließ nichts dem Zufall. Selbst das kleine Poem, für das er von seinen Gästen so viel Beifall erhalten hatte, stammte in Wahrheit nicht aus seiner Feder. Mein Freund hatte es verfasst. Mein Freund, der am gleichen Abend in die Gesellschaft hatte eingeführt werden sollen und der nichts so sehr verabscheute wie leeres Geschwätz und nichtssagende Floskeln. Vielleicht, dachte er beim Einschlafen, sollte ich auch für Lavinia ein kleines Gedicht machen …
Sein Schlaf war unruhig, die Geräusche der Nacht waren fremd und ungewohnt. Immer wieder wachte er auf. Als der Morgen kam, fühlte er sich wie gerädert. Aber darauf nahm von den Giocolieri niemand Rücksicht. Immerhin baten sie ihn an das gemeinsame Feuer, über dem ein Kessel mit gewürztem Haferbrei hing. Gegessen wurde aus einer großen Schüssel, in die jeder seinen Löffel tauchte. Mein Freund hatte keinen Löffel, doch Lavinia gab ihm einen. Er bedankte sich bei ihr und suchte den Blick ihrer bernsteinfarbenen Augen. Es gelang ihm nicht.
Nach der Mahlzeit sagte Pamfalon zu ihm: ›Wenn du einer von uns sein willst, musst du dich von deinen feinen Kleidern trennen. Lass dir von den Zwillingen ein paar alte Sachen geben. Sie müssten dir passen, denn die Jungen sind fast so groß wie du. Danach gehst du mit ihnen zum Schmied in Bentivoglio. Er soll sich drei unserer Wagenräder ansehen. Die Eisenringe an den Naben sind durchgerostet. Sie müssen erneuert werden.‹
›Jawohl, Patron.‹
Wenig später war er mit den Zwillingen unterwegs. Jeder von ihnen hatte eines der schweren Räder geschultert. Obwohl der Weg zum Schmied kaum eine Meile lang war, fiel ihm nach kurzer Zeit das Ausschreiten schwer. Den Zwillingen jedoch schien die Last nichts auszumachen, sie unterhielten sich lebhaft über die Vorstellung am gestrigen Abend und waren sich einig, dass sie beim nächsten Auftritt wechseln wollten: Dann sollte es Leonardo sein, der in die Truhe stieg. Überhaupt sei Abwechslung wichtig und jemand, der sein ganzes Leben an ein und demselben Fleck verbrächte, von Herzen zu bedauern. Ob mein Freund nicht auch dieser Meinung sei?