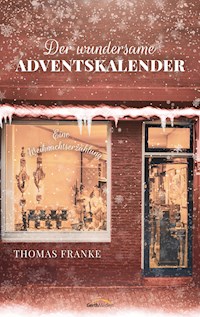
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann hastet am Abend des 24. Dezembers durch die Straßen. Die viel zu spät bestellten Geschenke sind nicht rechtzeitig angekommen. Kein Wunder, dass Martin Harnack deswegen zu Hause Ärger hat. Denn für seine Frau ist das verpatzte Weihnachtsfest ein Symbol für den geringen Stellenwert der Familie in Martins Leben. Nun versucht er zu retten, was zu retten ist. Ein einziger verkramter alter Laden hat noch geöffnet. Dort erhält er ein seltsames Geschenk. Es ist ein mechanischer Adventskalender, der Martin an den Morgen des 1. Dezembers zurückversetzt und noch so manch weitere Überraschung bereithält ... Eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte darüber, was im Leben wirklich von Bedeutung ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den AutorThomas Franke ist Sozialpädagoge und bei einem Träger für Menschen mit Behinderung tätig. Als leidenschaftlicher Geschichtenschreiber ist er nebenberuflich Autor von Büchern. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Mehr über den Autor: www.thomasfranke.net
Danksagung
Anne, Matthes und Malte – ihr seid die besten. Es ist ein großartiges Geschenk, mit euch das Leben zu teilen!
Danke, Tina, dass du auch für dieses Buch deine Freizeit geopfert hast. Du bist und bleibst meine Lieblingskollegin.
Liebe Ma, vielen Dank, dass du dich mit Hingabe um die systematische Ausrottung meiner orthografischen Mängel gekümmert hast.
Vielen, vielen Dank, Reiner, für deine treue Unterstützung und deine Anteilnahme.
Liebe Verena, vor ungefähr zehn Jahren haben wir zusammen unser erstes Buchprojekt verwirklicht. Es wurde wirklich Zeit für das nächste Projekt. Es war ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten.
Inhalt
Zu spät
Erwachen
Der Konkurrent
Abenteuerland
Gesehen, aber nicht wahrgenommen
Nikolausgeschenke
Babysitting
Ein langer Abend und drei Taschentücher
Treibsand
Licht in der Dunkelheit
Der Weihnachtsschock
Update mit Chicken Nuggets
Der Feind auf dem Silbertablett
Ein anstrengendes Versprechen
Ein Wunder
Sekt in der Schlangengrube
Eisregen und Picknickdecke
Die dritte Fahrstunde
Weihnachten
Zu spät
Ich lief durch die menschenleeren Straßen. Kalter Nebel umwallte mich und meine Füße hämmerten rhythmisch auf das Straßenpflaster. Split knirschte unter meinen Sohlen. Schneller!, feuerte mich eine panische Stimme in meinem Inneren an.
Ein Pärchen ging über die Straße. Die Frau hielt sich ihren voluminösen Bauch, es wirkte, als ob sie Schmerzen hätte. Der Mann stützte sie. Ich sah den beiden hinterher und zuckte erschrocken zusammen, als ich einen aufheulenden Motor hörte.
Wie aus dem Nichts schoss ein massiger SUV aus einer Einfahrt hervor. Reifen quietschten ohrenbetäubend und ich hechtete instinktiv zur Seite auf den Radweg. Schmutziger Schneematsch spritzte auf und durchnässte meine Hose. Nur mühsam und wild mit den Armen rudernd gelang es mir, das Gleichgewicht zu halten. Während ich schlitternd auf den Gehweg zurückhastete, hörte ich hinter mir ein wütendes: „Bist du irre, Mann?“
Ich warf einen Blick über die Schulter und sah, wie der Fahrer des Wagens mir mit einer knappen Geste stark eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit bescheinigte. Er trug Anzug und Krawatte, die elegant gekleidete Frau neben ihm schüttelte den Kopf und warf mir einen entrüsteten Blick zu. „Vollidiot“, murmelte der Fahrer, ehe er eine Zigarettenkippe aus dem halb geöffneten Fenster schnippte und davonbrauste. Ich hatte keine Energie mehr, um mich darüber aufzuregen. Stumm wandte ich mich ab und rannte weiter.
Es war der 24. Dezember, 22.35 Uhr. Die kalte Luft schmerzte in meiner Lunge, und ich hatte den Geschmack von Eisen auf der Zunge. Mein Herz pochte so heftig, dass ich das Gefühl hatte, meine Rippen würden gleich zerbersten.
Entschlossen hielt ich den Blick fest auf das schummrige Licht hinter den schmierigen Schaufensterscheiben gerichtet. Das schwache gelbliche Schimmern war mein Leuchtfeuer in der Nacht.
Ich habe da ein Licht gesehen. Vielleicht haben Sie Glück. Das waren die Worte der Frau gewesen, wobei sie sich offensichtlich nicht entscheiden konnte, ob sie mitleidig oder vorwurfsvoll klingen sollten.
Ich war nun so nahe herangekommen, dass ich die Waren hinter der Schaufensterscheibe erkennen konnte: ein altes Akkordeon, pastellfarben bemaltes Porzellan, Ölbilder, Bücher. Es war furchtbar – aber gar nichts wäre noch furchtbarer gewesen.
Ich überquerte die Straße, taumelte über die Gehwegplatten und stieß die Tür auf. Eine Ladenglocke bimmelte. Gott sei Dank! Der Laden hatte noch geöffnet.
Die Tür fiel hinter mir ins Schloss. Ich hielt inne, stützte die Hände auf die Knie und rang nach Atem. Als das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen, nachließ, richtete ich mich ächzend auf. „Hallo?“, keuchte ich.
Alte Dielen knarrten leise. Ein bärtiges Gesicht lugte hinter einem Regal mit Standuhren hervor, es wirkte irgendwie alterslos. Der Mann hätte Anfang dreißig oder auch Ende fünfzig sein können.
„Guten Abend“, begrüßte er mich.
„Geschenke …“, stieß ich atemlos hervor. „Ich brauche … Geschenke.“
Der Mann trat hinter dem Regal hervor. Er war groß gewachsen und ziemlich hager. „Wir haben den 24. Dezember“, sagte er bedächtig. Er warf einen kurzen Blick auf seine Wecker-Armada. „Und es ist 22 Uhr 37.“
„Ob Sie’s glauben … oder nicht“, schnaufte ich. „Dessen bin ich mir bewusst.“
Der Bärtige schwieg, und in mir reifte die Erkenntnis, dass es klug sein könnte, meine letzte Rettung etwas zuvorkommender zu behandeln. „Tut mir leid“ – ich versuchte, ein Lächeln auf meine Lippen zu quetschen. „Ich hatte einen sehr unerfreulichen Tag. Und ich wäre Ihnen außerordentlich dankbar, wenn Sie mein Familienleben retten könnten.“
„So schlimm?“, fragte der Bärtige.
Ich schüttelte den Kopf. „Schlimmer!“
„Ich verstehe.“ Er nickte bedächtig. „Was genau brauchen Sie?“
Ich holte tief Atem. „Für meine Frau brauche ich irgendetwas Hübsches, das sie sich ins Regal stellen kann. Sie mag alte Dinge. Für sie etwas zu finden, dürfte am leichtesten sein. Anton, mein Ältester, ist 18. Es wäre schön, wenn Sie etwas hätten, das ihn wenigstens mal für fünf Minuten vom Bildschirm weglockt. Vielleicht ein spannendes Buch? Meine Tochter Leonie ist 15 und unerträglich pubertär. Ich habe keine Ahnung, was sie mag. Zumindest scheint sie ihr Gesicht nicht zu mögen, da sie es jeden Morgen hinter einer dicken Schicht Make-up verbirgt. Vielleicht haben Sie einige historische Schminkutensilien im Angebot. Und für Ben, den Achtjährigen, bräuchte ich irgendetwas, womit er sich endlich mal alleine beschäftigt – einen Experimentierkasten oder etwas Ähnliches.
Der Mann verzog keine Miene. „Das ist alles?“, fragte er.
Ein irres Grinsen huschte über mein Gesicht. Nein, dachte ich, da gäbe es noch einiges: zum Beispiel ein Geschenk, das mir diesen arroganten Besserwisser Dr. Wegner vom Leib hält; etwas, das meine hübsche Assistentin Anna dazu bringt, mich anzulächeln – und ein weiteres Präsent, das dafür sorgt, dass die Reinigungskraft im Institut endlich ein Mindestmaß an Höflichkeit an den Tag legt …
Natürlich erwähnte ich nichts dergleichen. Stattdessen sagte ich: „Also, ich finde das schon herausfordernd genug.“
Der Bärtige lächelte. Seine Augen funkelten, und er rieb sich vergnügt die Hände. „Ich glaube, ich kann Ihnen weiterhelfen.“
„Tatsächlich?“ Verblüfft starrte ich ihn an.
„Folgen Sie mir?“
Da er sich nicht von der Stelle bewegte, blinzelte ich ihn wie ein kurzsichtiges Meerschweinchen an.
„Würden Sie mir bitte folgen?“, hakte er freundlich nach.
„Äh, klar, natürlich. Gehen Sie einfach voraus.“
„Hier entlang.“ Er wandte sich um und schlängelte sich geschickt durch die Regalreihen. Ich quetschte mich deutlich weniger elegant durch den engen Gang und hinterließ schmutzige Fußabdrücke auf dem Dielenboden.
Nachdem wir zwei Räume mit tausenden von Büchern, uralten Lampen, mechanischen Geräten und ausgestopften Tieren durchquert hatten, gelangten wir durch eine winzige Tür auf eine schmale Treppe, die steil nach oben führte.
„Einen Moment.“ Der Mann entzündete eine Petroleumlampe. „Es wäre nicht klug, diesen Weg ohne Licht zu beschreiten.“ Die Lampe emporhaltend, stieg er die Stufen nach oben.
Ich folgte ihm. Die Treppe war erstaunlich lang, und ich geriet wieder außer Atem. „Dass Ihr Laden so groß ist, hätte ich nicht gedacht“, bemerkte ich schnaufend.
„Das liegt daran, dass Sie ihn nicht mehr von außen betrachten“, erwiderte der Bärtige.
„Aha“, brummte ich verständnislos.
„Wie viele Dinge und wie alle Menschen ist er innen größer als außen.“
„Das ist … äh … erstaunlich“, brummte ich.
Über das Quietschen der uralten Stufen hinweg hörte ich den Mann leise lachen. Aber es klang eher freundlich als spöttisch, und so nahm ich es ihm nicht übel.
Der Bärtige öffnete eine Bodenklappe, und wir betraten einen staubigen Dachboden. Zu meiner großen Überraschung war der Raum fast vollständig leer. Einzig ein Tisch stand unter dem schmalen Dachfenster, durch das der Mond hereinlinste. Auf dem Tisch befand sich irgendetwas Kastenähnliches, das mit einem Tuch bedeckt war. „Hier …“, der Bärtige trat vor und zog schwungvoll das Tuch beiseite, „… habe ich genau das, was Sie brauchen.“
Eine Staubwolke wirbelte empor und senkte sich dann langsam auf ein seltsames blechernes – Dings. Es sah ein bisschen aus wie eine uralte Registrierkasse. Das dicke Blech war grün lackiert und mit merkwürdigen Mustern verziert. Hinter einer kleinen Glasscheibe erkannte ich undeutlich den Buchstaben „O“, der vielleicht auch eine Null war. An der rechten Seite befand sich eine Kurbel mit abgewetztem Griff.
„Äh …“, fasste ich meine Verwirrung wortkarg zusammen.
„Es ist ein mechanischer Adventskalender“, erklärte der Mann.
„Toll“, murmelte ich.
Mit geradezu kindlicher Begeisterung strahlte mich der bärtige Antiquitätenhändler an.
Ich räusperte mich. „Ich bin mir sicher, dieses … äh … Gerät ist etwas ganz Besonderes. Aber für einen Adventskalender ist es leider ein bisschen spät, finden Sie nicht? Heute ist Heiligabend, und ich bin hier, weil ich dringend Geschenke für meine Familie brauche.“
Das Lächeln des Mannes wurde sanfter. „Ich habe Ihnen genau zugehört. Ich weiß, was Sie brauchen. Vertrauen Sie mir.“
Ich starrte den hageren Mann an. Etwas sagte mir, dass er weder Scherze mit mir trieb noch den Verstand verloren hatte. Andererseits war diese ganze Geschichte vollkommen absurd. Ein Adventskalender würde mir nicht weiterhelfen! „Nehmen Sie es mir nicht übel, aber das ist nicht das, was ich gesucht habe. Vielen Dank für Ihre Mühen, ich muss jetzt gehen.“ Ich lächelte ihm kurz zu und wollte mich abwenden.
„Sie müssen nur die Kurbel drehen.“
„Was?“
„Sehen Sie, es ist gar nicht schwer.“ Er drehte die Kurbel. Das Gerät ratterte, eine mechanische Glocke erklang, und die Null wurde durch eine Eins ersetzt.
Halb genervt, halb fasziniert nickte ich. „Also gut.“ Ich packte die Kurbel. Der Griff war alt, der Lack fast verschwunden, abgerieben von vielen Händen. Beim Berühren des Metalls durchfuhr mich ein leichtes Kribbeln, das ich nicht einordnen konnte. Dann drehte ich kurz entschlossen die Kurbel.
Sanfte Dämmerung umgab mich, es war warm und weich. Von irgendwo drang leise Musik an meine Ohren.
Erwachen
Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away …“
„Wie, was?“ Meine Stimme wurde von einem weichen Kissen gedämpft. Ein Schatten bewegte sich. Die Musik verstummte und ich blinzelte in die Dämmerung. „Wo bin ich?“, kam es murmelnd über meine Lippen.
„Also, ich weiß ja, dass du kein Frühaufsteher bist, Schatz. Aber jetzt übertreibst du!“
Ich blinzelte, sah die Uhr auf meinem Nachttisch und die verstaubte Bibel daneben. Dann drehte ich meinen Kopf der Stimme entgegen. Swenja stand in ihrem uralten, ehemals roten Morgenmantel neben dem Bett und hielt die Hände in die Hüften gestemmt.
„Ich … bin zu Hause?“, stammelte ich.
Swenja runzelte die Stirn. „Hast du etwas anderes erwartet? Das würde ich etwas irritierend finden.“
„Äh … nein, natürlich nicht!“
„Da bin ich ja beruhigt.“ Sie wandte sich ab und begann, sich die Haare trocken zu rubbeln. Ich starrte auf ihren Rücken. Wie kann das sein? Habe ich einen Blackout? Warum ist sie so entspannt? Ich hab’s doch eindeutig vermasselt!
Swenja schaltete das Licht ein und föhnte sich vor dem Schlafzimmerspiegel die Haare, ganz so, als sei nichts geschehen. Ich konnte es nicht fassen. Gestern Abend hatten wir einen furchtbaren Streit gehabt. Ich hatte eine Menge Stress mit meinem Forschungsprojekt, und im Kollegium krachte es. Kurz: Ich war die ganze Zeit so beschäftigt gewesen, dass ich erst in allerletzter Sekunde an die Geschenke für meine Familie gedacht hatte. Am Heiligabend um 21.48 Uhr hatte ich dann eingesehen, dass der Onlinehändler bei seinem vollmundigen Versprechen: „Wir liefern über Nacht“, vergessen hatte, ein „manchmal“ hinzuzufügen. Swenja hatte eine Riesenszene gemacht. Auf einmal hatte sie unsere Ehe infrage gestellt – und das auch noch vor den Kindern. Ehrlich gesagt hatte ich nicht verstanden, warum sie plötzlich dermaßen ausrastete. Ging es zu Weihnachten nicht um viel mehr als um Geschenke?
Es hatte sich als keine gute Idee erwiesen, diese Gedanken laut zu äußern.
Swenja hatte einen unartikulierten Schrei ausgestoßen, nach meiner Weihnachtsmarkt-Schneekugel gegriffen, die ich im Alter von neun Jahren erstanden hatte, und sie ins Bücherregal geschleudert, wo sie über der Gesamtausgabe der Wuppertaler Studienbibel zerschellt war, die meine Eltern mir zum Geburtstag geschenkt hatten. Anton war daraufhin schweigend in seinem Zimmer verschwunden, Leonie hatte mir Blicke zugeworfen, die einen Stahlbetonpfeiler zum Bersten gebracht hätten, und Ben hatte angefangen zu schluchzen. Das war der Moment gewesen, in dem ich fluchtartig das Haus verlassen hatte, um zu retten, was zu retten war.
„An deiner Stelle würde ich mich jetzt beeilen“, unterbrach Swenja meine Erinnerungen. „Du weißt, was passiert, wenn du nicht rechtzeitig ins Bad kommst.“
Mein Blick wanderte zum Radiowecker: Es war 6 Uhr 58. Darunter stand das Datum des heutigen Tages – ich traute meinen Augen nicht. „Swenja, ist mit dem Wecker alles in Ordnung?“, fragte ich hastig.
„Ja, natürlich, warum denn nicht?“
„Also ist heute wirklich der erste Dezember?“, hakte ich vorsichtig nach.
„Natürlich! Also heute bist du wirklich vollkommen verpeilt.“
Es war nur ein Traum! Ein hysterisches Lachen brach aus mir hervor. „Es war nur ein Traum!“ Und noch während ich dies sagte, verblassten die Bilder, die gerade noch so deutlich vor meinem inneren Auge gestanden hatten.
Swenja wandte sich um, in ihren Augen spiegelte sich eine Mischung aus Ärger und Sorge. „Was ist denn los mit dir?“, fragte sie.
„Nichts!“ Ich sprang auf. „Ich hatte einen ziemlich schrägen Albtraum, aber jetzt ist alles in Ordnung. Es sind noch 24 Tage bis Weihnachten?“
„Ja, wie an jedem ersten Dezember.“ Kopfschüttelnd wandte sie sich ab.
Ich machte mich auf dem Weg ins Bad, das jedoch abgeschlossen war. „Hey!“, rief ich.
„Besetzt!“, ertönte die genervte Stimme meiner Tochter.
In diesem Moment wurde mir klar: Ich hatte das schmale Zeitfenster verpasst, in dem es möglich war, die sanitären Anlagen des Hauses zu nutzen und noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen.
Ich klopfte gegen die Tür: „Beeil dich!“
„Mann, Papa, nerv nicht! Ich muss meine Haare machen.“
„Du musst deine Haare nicht machen, die wachsen von alleine.“
„So witzig“, ätzte es durch die Badezimmertür.
Swenja kam aus dem Schlafzimmer und schlüpfte in eine warme Strickjacke. „Ich hab dich gewarnt! Denkst du daran, Ben zu wecken?“
„Wieso ich?“
„Wir haben das doch gestern besprochen, Martin. Ich hab Frühdienst.“
„Aber …“
„Die Frühstücksbox ist im Kühlschrank. Denk daran, dass er die Sportsachen mitnehmen muss.“
„Sportsachen?“
„Ja, und seine Trinkflasche. Bleibt es dabei, dass du mich heute Abend vom Elternabend abholst?“
„Äh … klar.“
„Danke. Tschüss, bis später!“ Sie hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Ich roch das vertraute Parfüm und das Pfefferminz der Zahnpasta. Wenige Sekunden später fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
Ich fühlte mich mit einem Mal allein gelassen, und ich trug noch immer meinen Pyjama. Seufzend quetschte ich mich in unser winziges Gästebad und unterzog mich notdürftig einer Katzenwäsche.
Als ich mich eine Viertelstunde später fertig angezogen an den Frühstückstisch setzte, war Anton gerade dabei, seine Cornflakes zu verschlingen, ohne seinen Blick ein einziges Mal vom Handy-Display zu nehmen. Ben saß mit halb geschlossenen Augen da, gähnte alle paar Sekunden und rührte meditativ in seinem Kakao. Leonie war noch im Bad.
„Dann fangen wir eben ohne sie an.“ Ich senkte den Kopf und sprach ein Tischgebet.
„Amen“, gähnte Ben. Auf seiner Stirn prangte ein brauner Fleck.
„Ben, wisch dir den Kakao aus dem Gesicht und schmier deinen Toast. Anton, kannst du nicht mal für ein paar Minuten dein Handy beiseitelegen? Das ist so was von asozial.“
Ich griff nach dem Losungsbüchlein. Zum Frühstück las ich immer die Bibelverse, die von der Herrnhuter Brüdergemeine für jeden Tag des Jahres ausgelost worden waren. Das war Tradition bei uns. Schon meine Eltern hatten das so gehandhabt. Allerdings legte ich das Buch gleich wieder beiseite, als der Klang von Harfen an mein Ohr drang. Diesen Rufton hatte ich für Anna reserviert. Hastig zog ich mein Smartphone aus der Tasche. Hoffentlich gute Nachrichten.
Muss zum Arzt, komme heute leider später. Tut mir leid.
Ich seufzte und sandte ihr eine kurze Antwort.
Gute Besserung. Bis später.
„Asozial, ja?“, schnaufte Anton.
„Das war dienstlich“, verteidigte ich mich.
„Schon klar.“
In diesem Moment kam Leonie aus dem Badezimmer. „Ich seh’ so scheiße aus.“
Anton warf seiner Schwester einen prüfenden Blick zu. „Aber nur ein bisschen“, antwortete er lakonisch.
Leonie ließ sich auf ihren Stuhl fallen. Es schien, als würde sie die Einschätzung ihres älteren Bruders nicht sonderlich aufmuntern.
„Leonie, achte bitte auf deine Ausdrucksweise“, mahnte ich. „Und du, Anton, kannst du nicht einfach mal nett sein?“
Anton zuckte mit den Achseln, während Ben seine größere Schwester kritisch beäugte: „Dein Pullover ist zu kurz.“
„Das ist ein Top, du Genie“, knurrte Leonie.
„Leonie, jetzt mal im Ernst: Willst du wirklich so zur Schule gehen?“ Ich betrachtete zweifelnd ihre für die Jahreszeit doch recht knappe Bekleidung.
„Warum müsst ihr eigentlich alle auf mir herumhacken?“ Leonie sprang wütend auf.
„Niemand hackt auf dir herum. Und nun setz dich wieder, du musst etwas frühstücken.“
„Ich hab keinen Hunger!“, blaffte sie und stapfte davon.
Anton kratzte die Reste aus seiner Müslischale und verließ danach wortlos den Raum.
„Räum dein Geschirr weg!“, rief ich ihm nach und hörte im selben Moment, wie sich die Tür seines Zimmers schloss.
Ich atmete tief ein und aus. Als ich an meinem Kaffee nippte, stellte ich fest, dass er inzwischen kalt geworden war.
Ich liebte meine Familie. Tief in meinem Herzen gab es einen Ort, an dem ich sie vorbehaltlos und ohne jeden Zweifel liebte. Aber ich musste zugeben: An diesem düsteren Dezembermorgen war dieser Ort etwas schwer zugänglich.
„Papa“, nuschelte Ben, nachdem er zum ersten Mal von seinem Toast abgebissen hatte. Offenbar hatte er mittlerweile registriert, dass wir uns am Frühstückstisch befanden. „Max sagt, dass Iron Man der stärkste Avenger ist. Aber ich finde, das stimmt nicht. Er hat ja selber gar keine Superkräfte, das ist alles nur Technik. In Wirklichkeit ist Captain Amerika der Stärkste. Aber am liebsten mag ich Ant Man. Das wäre doch voll cool, wenn man so klein wie eine Ameise werden könnte …“
Eine Harfe erklang. Ich griff zum Smartphone.
Es gibt ein Problem. Gerade habe ich erfahren, dass noch jemand Mittel aus dem Publikationsfond beantragt hat. Nun könnte es eng werden.
Ich spürte, wie mein Herz schneller zu schlagen begann. Das alles kam mir so bekannt vor. Hatte ich womöglich so etwas wie eine prophetische Gabe entwickelt? Aber das hieß nicht, dass es so etwas nicht wirklich geben konnte. Oder hing dieses Gefühl irgendwie mit meinem Traum zusammen? Je mehr ich allerdings versuchte, mich zu erinnern, desto blasser wurden die Bilder. Ich schüttelte den Kopf, um meine Verwirrung abzuschütteln.
Seit drei Jahren saß ich an diesem Buchprojekt. Eine erfolgreiche Publikation war meine letzte Chance, doch noch einmal Fuß an einer renommierten Universität zu fassen. Noch war es nicht zu spät. Ich musste handeln, und zwar schnell. Wie kann das sein?, tippte ich. Es war doch alles vereinbart.
Nicht ganz, schrieb Anna zurück. Prof. Jaspers sagte lediglich:Es sähe sehr gut aus, weil die Bewerbungen im Regelfall sehr früh einträfen, aber das Zeitfenster für die Abgabe war offiziell bis gestern geöffnet.
Und irgendjemand hatte es genutzt. Wütend presste ich die Lippen zusammen. Lass mich raten – es war Dr. Carsten Wegner, der in letzter Sekunde einen Antrag eingereicht hat. Habe ich Recht?
Mein Handy summte wieder. Jaspers hat keine Namen genannt, las ich.
Wer soll es denn sonst gewesen sein?, schrieb ich zurück. Du musst mit Jaspers sprechen. Niemand hat so einen guten Draht zu dem Alten wie du. Ich muss wissen, wie meine Chancen stehen!
Keine Antwort.
Irritiert starrte ich auf mein Smartphone. Ben plapperte irgendetwas. Ich hörte nicht zu. Dann meldete mein Handy den Eingang einer weiteren Kurznachricht:
Martin, ich sitze gerade im Wartezimmer.
Oh, entschuldige, tippte ich schnell. Gute Besserung und bis später.
Seufzend steckte ich das Smartphone in die Hosentasche.
„Papa!“ Ben sah mich vorwurfsvoll an.
„Was ist denn?“
„Wenn ich nicht punkt 8 Uhr in der Klasse sitze, schimpft Frau Schlimper!“
Ich sah auf die Uhr: 7.54 Uhr. „Verflixt!“ Ich sprang auf. „Wir müssen los. Schnapp dir deine Schultasche!“ Ich hastete zur Treppe und brüllte die Treppe hinauf: „Leonie!“
„Die hat zur zweiten!“, klärte mich Ben auf.
Wir hetzten aus dem Haus und ich raste in halsbrecherischem Tempo durch die schmalen Seitenstraßen.
Ben nutzte die Fahrt, um mich über seine Zukunftsvisionen auf dem Laufenden zu halten. „Wenn ich groß bin, erfinde ich einen Schrumpfomator. Das ist eine Verkleinerungsmaschine, mit der man Menschen und Sachen, zum Beispiel ein Auto oder ein Schiff, eine Million Mal kleiner machen kann …“
Ich warf ihm einen Seitenblick zu. „Du hast Kakao an der Stirn.“
Ben wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Jetzt hatte er Kakao auf seinem Sweatshirt-Ärmel und auf der Stirn. „… dann könnte ich mich selber schrumpfen und mein Forschungslabor auch“, nahm er seinen Gedankenfaden wieder auf. „Und dann könnte ich alle Sachen genau erforschen. Ich würde zum Beispiel beobachten, wie die Ameisen die Blattläuse melken, obwohl sie gar keine Hände haben.“
Ich bremste scharf. Beinahe hätte ich eine junge Radfahrerin auf der Kühlerhaube mitgenommen. Ich duckte mich unter ihren wütenden Blicken hinweg und brauste weiter. In solchen Momenten war ich froh, dass die meisten Menschen keine Ahnung hatten, was der Fisch auf dem Heck unseres Wagens eigentlich bedeutete.
Ben hatte den Beinahe-Unfall souverän weggesteckt und erklärte mir: „Außerdem könnte ich mit meinem Spezialkletterjeep in einen Elefantenrüssel hineinfahren. Dann könnte ich herausfinden, ob die Popel von einem Elefanten wirklich länger sind als die von Menschen oder eher dicker.“
Aus den Augenwinkeln entdeckte ich einen freien Parkplatz. Ich gab Gas, doch eine Mutter mit schwedischem SUV war schneller. Zähneknirschend stellte ich mich in eine Ausfahrt. „Wir sind da!“
„Vielleicht sind Elefantenpopel auch überhaupt nicht größer als die von Menschen“, sinnierte mein Sohn. „Nur weil die Nase größer ist, heißt das ja nicht …“
„Ben, steig aus!“, herrschte ich ihn an.
Er zuckte zusammen: „Mann, Papa, jetzt hast du mich voll erschreckt!“
„Jetzt reicht’s aber. Raus mit dir! Du kommst zu spät!“
Ben verzog das Gesicht und kletterte hastig aus dem Wagen.
Ich wusste, dass ich ihm Angst eingejagt hatte. Aber eine Entschuldigung wollte mir nicht über die Lippen kommen. Ich lächelte verkniffen und wuschelte ihm kurz durch die Haare. „Ab mit dir!“
Er warf mir einen traurigen Blick zu. Erneut überkam mich eine Art Déjà-vu, aber ich verdrängte das Gefühl.
Als ich mich aus dem Gewirr enger Straßen geschlängelt hatte und endlich die Auffahrt zur Autobahn hinaufbrauste, fiel mir ein, dass Bens Sporttasche noch immer zu Hause im Flur stand.
Der Konkurrent
Ich war spät dran und beschloss, dass man für den Grundschulsport keine besondere Kleidung benötigte. Ben konnte auch in Jeans und T-Shirt in der Sporthalle herumhüpfen. Außerdem, so beruhigte ich mein aufkeimendes schlechtes Gewissen, musste er lernen, auf seine Sachen selbst zu achten.
Ich brauste in überhöhtem Tempo auf den Institutsparkplatz. In zwei Minuten würde meine Vorlesung beginnen. Daher war es mir nur ein bisschen peinlich, als ich mit quietschenden Reifen in der Parkbucht zum Stehen kam. Hastig eilte ich die Treppen hinauf in mein Büro und zuckte erschrocken zusammen, als ich feststellte, dass ich nicht alleine war. Ein Mann in blauem Kittel hatte mir den Rücken zugewandt und leerte meinen Papierkorb in einen großen Müllsack. Es war unsere Reinigungskraft. Ein bisschen spät dran, ging es mir durch den Kopf. Laut sagte ich: „Guten Morgen.“
Der Mann antwortete nicht, er wandte sich nicht einmal um. Stattdessen ging er einfach in den Nebenraum und knallte die Tür hinter sich zu.
Kopfschüttelnd sah ich ihm hinterher. Es war nicht das erste Mal, dass mich der Typ einfach ignorierte. Vielleicht sollte ich noch mal mit Jaspers sprechen. Diese Reinigungsfirma hatte bestimmt höflichere Mitarbeiter, die hier putzen könnten.
Eilig zog ich meine Unterlagen und den Laptop für die Präsentation aus der Schublade und trat hinaus auf den Flur.
Ich erkannte ihn schon an den Schritten, bevor ich ihn sah. Bei Dr. Carsten Wegner klangen selbst die Schuhsohlen arrogant. Als er um die Ecke bog, spiegelte sich das Licht der Neonlampen auf seiner Stirn, die dank frühzeitigem Haarausfall von der Nasenwurzel bis zum Nacken reichte. Seine wulstigen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, dem auch der kleinste Hauch von Freundlichkeit abhandengekommen war. „Guten Morgen, Kollege. Spät dran, was?“
Ich spürte, wie meine Kiefermuskeln sich verkrampften – wahrscheinlich eine Art Reflex. Es war daher anatomisch durchaus bemerkenswert, dass es mir dennoch gelang, zurückzulächeln. „Guten Morgen! Mit dem Spät-dran-Sein kennen Sie sich ja bestens aus.“
Wir maßen einander mit Blicken, und für einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, Unsicherheit in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Wusste er etwa nicht, worauf ich anspielte?
Im nächsten Augenblick wirkte er so überheblich wie immer, und ich ging wortlos an ihm vorbei in den Seminarraum. Meine Studenten registrierten mich kaum. Wie immer begann ich meine Vorlesung daher im Flüsterton, bis auch der letzte vertratschte Teilnehmer verstummte.
Routiniert spulte ich mein Programm ab und machte zehn Minuten früher Schluss. Die meisten Studierenden verziehen langweilige Vorlesungen, wenn sie dafür etwas kürzer waren.
Als ich zurück in mein Büro kam, saß Anna schon an ihrem Schreibtisch. Sie hatte ihre langen, schlanken Beine übereinandergeschlagen und studierte sorgfältig ein Manuskript.
„Guten Morgen, Anna“, sagte ich.
Sie blickte auf und klemmte sich in einer unbewussten Geste eine Strähne ihres Haars hinter das Ohr. Ihrem dunklen Teint und ihren rabenschwarzen Haaren sah man an, dass ihr Vater Spanier war.
„Guten Morgen, Martin“, gab sie zurück.
„Wie geht’s?“
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Ich bin hier.“
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























