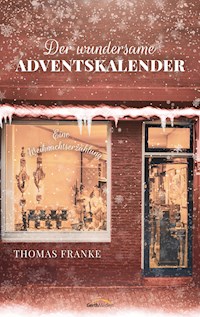Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Hilfe! Der verrückte Biber ist wieder da! Rudert schneller, Jungs! Rudert um euer Leben!" Verdutzt blickte Bert der Biber den fliehenden Ameisen hinterher. Dabei hatte er doch eigentlich eine Superidee gehabt: Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Aber ganz offensichtlich hatte er eine Kleinigkeit übersehen ... Diese und 17 weitere tierische Kurzgeschichten vermitteln auf humorvolle Weise biblische Wahrheiten und laden dazu ein, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Dieses Buch enthält die besten Episoden aus "Warum es besser war, dass Pogo nicht fliegen konnte" und "Mike Mampf und die mongolischen Rennmäuse". Ideal für Kinder ab 6 Jahren. Mit zahlreichen Illustrationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Thomas Franke ist Sozialpädagoge und bei einem Träger für Menschen mit Behinderung tätig. Als leidenschaftlicher Geschichtenschreiber ist er nebenberuflich Autor von Büchern. Die Geschichten entstanden unter anderem im Rahmen seiner Mitarbeit in einer Kinderklettergruppe. Er lebt mit seiner Familie in Berlin. www.thomasfranke.net
Inhalt
Charlie und der Hirte
Konrad und das Nadelöhr
Phillip Fusselbirne und der Marathon der Weberknechte
Fiona, Elvis und die Lemminge
Enno und der lebensgefährliche Lebensrettungsplan
Warum es besser war, dass Pogo nicht fliegen konnte
Onkel Benedikts Vermächtnis
Harald, das Moor und der falsche Moment für Plaudereien
Lars und die Legende vom Meer
Maik Mampf und die mongolischen Rennmäuse
Mission Opossum – ein neuer Auftrag für Superbert
Wie Kuni das Unmögliche tat
Hans und der Sturz in den Abgrund
Der Zirkusdirektor und die affige Abstimmung
Leon Teil 1 – Nur der Löwe ist der Löwe
Leon Teil 2 – Die Königskinder und der fiese Popo
Leon Teil 3 – Riesendurst statt Zebrawurst
Spucke und die Friedenstaube
Charlie und der Hirte
Charlie das Schaf war sauer, stinksauer. Immer machten ihm die anderen Vorschriften: „Du darfst dies nicht, du darfst das nicht“; „Der Hirte hat aber gesagt …“ und so weiter und so weiter.
Allmählich hatte er die Nase gründlich voll. Am schlimmsten war Meckerminni, die alte Petze. Aber die anderen 98 waren auch nicht viel besser.
Charlie gehörte nämlich einem Hirten, der genau hundert Schafe hatte. Eigentlich ging es Charlie gar nicht so schlecht in seiner Herde, aber darüber wollte er jetzt überhaupt nicht nachdenken. Er war nämlich sauer, stinksauer. Er hatte sich ganz furchtbar mit den anderen gestritten. Zwar konnte er sich nicht mehr so recht erinnern, worum es in diesem Streit eigentlich gegangen war, aber er wusste noch ganz genau, dass er recht gehabt hatte!
Er sonderte sich von den anderen ab und schlich an den Rändern der Weide entlang. Und schließlich entdeckte er etwas Interessantes. War da nicht ein Loch im Zaun? Neugierig trabte er näher. Tatsache, ein dickes, fettes, genau charlieschafgroßes Loch. Wenn das kein Wink des Schicksals war?!
Du darfst da nicht durch, würde Meckerminni jetzt garantiert sagen. Das hat der Hirte verboten.
Pah, dachte er sich. Wenn das dem Hirten wirklich so wichtig wäre, hätte er kein Loch im Zaun gelassen. Vorsichtig sah er sich um. Niemand schaute zu ihm herüber und – schwupp – schon war er durch das Loch geschlüpft. Er brauchte gar nicht weit zu gehen, da bekam er vor Staunen Augen, so groß wie Frühstücksteller. Unglaublich – ein riesiger Gemüsegarten voll mit den leckersten und saftigsten grünen Blättern! Sofort machte sich Charlie an die Arbeit und schlug sich den Bauch voll, bis ihm der Spinat fast aus den Ohren wieder rauskroch und der Sellerie ihm beinahe aus der Nase guckte.
Plötzlich schreckte ihn ein schriller Schrei aus seiner Schlemmerei. „Charlie! Was tust du da?“
O nein!, durchzuckte es Charlie.
„Das sag ich dem Hirten!“, fauchte Meckerminni und im nächsten Moment galoppierte sie schon laut blökend auf die Weide zurück.
„So ein Mist“, schimpfte Charlie. Er verließ den Spinat und schlug sich an den Kohlköpfen vorbei, quer durch den Salat. Nix wie weg, dachte er und rannte, so schnell es seine kurzen Beine und sein vollgefressener Bauch zuließen, davon.
Charlie rannte und rannte, und als er schließlich nicht mehr konnte und mit Seitenstichen und hechelnder Zunge stehen blieb, wusste er nicht mehr, wo er war. Alles sah so fremd aus. Die grünen Wiesen waren verschwunden, stattdessen ragten hohe, kahle Felswände um ihn herum in den Himmel auf und unter seinen Hufen knirschte Geröll. Es sah ein bisschen unheimlich aus.
Vorsichtig lief er weiter. Was sollte er jetzt tun? Umkehren? Er dachte an die keifende Meckerminni, an die vorwurfsvollen Blicke all der anderen Schafe und an den Hirten, der garantiert supersauer war, weil Charlie den Garten verwüstet hatte. Nein, nein, da war es hier doch allemal besser – ein bisschen kahl vielleicht, aber wenigstens ließ man ihn in Ruhe.
Und so stapfte Charlie weiter. Als es anfing zu dämmern, fühlte er sich auf einmal furchtbar einsam. Um sich Mut zu machen, versuchte er, ein Lied zu pfeifen, aber es wollte ihm nicht recht gelingen. Charlie war nicht der Musikalischste und seine aufkeimende Furcht machte es nicht besser. Sein Pfeifen hörte sich in etwa an wie ein pupsender Ochsenfrosch, der in einen Teller mit Bohnensuppe gefallen ist. Also ließ er das mit dem Pfeifen lieber bleiben. Stattdessen begann er, sich große Sorgen zu machen. Wo sollte er nur hin?!
Schließlich wurde es immer dunkler und Charlie konnte kaum noch den Huf vor Augen sehen. Er kroch in einen dunklen Spalt und legte sich auf den kalten Boden. Der Felsspalt war recht tief und glich einer Höhle. Wenigstens bin ich hier einigermaßen sicher, dachte Charlie.
Aber das war, bevor er die Wölfe zum ersten Mal hörte!
Der Schreck fuhr Charlie durch alle Glieder, als er das hungrige Heulen vernahm, mit dem der Leitwolf sein Rudel zur Jagd rief. O nein!, war alles, was Charlie denken konnte, und dann kauerte er sich zusammen und kniff die Augen zu.
Das nächste Heulen klang schon näher. Geröll polterte irgendwo in dem schmalen Tal. Wieder ein Heulen. Charlie öffnete die Augen nur ein winziges bisschen. Inzwischen war der Mond aufgegangen und tauchte die trostlose Welt vor seinem Versteck in düsteres Licht. Nicht weit entfernt glaubte Charlie, dunkle Schatten durch die Nacht huschen zu sehen. Sofort schloss er die Augen wieder. „Ich Idiot! Ich Volltrottel! Ich Riesenhornochse!“, murmelte er lautlos vor sich hin. „Wäre ich doch nie abgehauen.“
Plötzlich ertönte ein tiefes, grausames Knurren ganz dicht bei ihm. Charlie erstarrte und versuchte, sich so klein wie möglich zu machen. Kurz hörte es sich so an, als würden Pfoten schnell davonlaufen, doch dann knirschte Geröll, direkt vor dem Felsspalt. Charlie rechnete jeden Augenblick damit, den stinkenden Atem eines Wolfrachens zu riechen und scharfe Reißzähne in seinem Nacken zu spüren.
Etwas Riesiges beugte sich über ihn.
„Da bist du ja, Charlie. Ich habe dich überall gesucht.“
Vor Erleichterung quiekte Charlie wie ein neugeborenes Ferkel.
„Der Hirte! Es ist tatsächlich der Hirte, er hat nach mir gesucht. Ich bin gerettet!“, blökte er erleichtert.Charlie konnte sein Glück kaum fassen.
Sanft wurde er von starken Armen emporgehoben. Von hier oben sah die Welt ganz anders aus. Die Wölfe hatten sich irgendwo in die Nacht verzogen, ihr Heulen klang nun gar nicht mehr so grausam, sondern eher ein bisschen beleidigt.
Er mag mich. Der Hirte mag mich, trotz allem!, dachte Charlie und staunte, während er es gleichzeitig genoss, dass dieser ihn hinter dem Ohr kraulte. Ganz gemütlich wanderte der Hirte mit ihm den weiten Weg zurück.
Und Charlie? Charlie fühlte sich in dieser Nacht wie das wichtigste, ja, wie das einzige Schaf auf der ganzen Welt.
Und wisst ihr was? Er hatte sogar fast recht damit.
Jesus erzählte einmal folgendes Gleichnis:
„Stellt euch einen Mann vor, der hundert Schafe hat. Was macht er wohl, wenn eins davon wegläuft? Ich will es euch verraten: Er lässt die neunundneunzig anderen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen. Und wenn er es endlich gefunden hat, dann freut er sich über dieses eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verlaufen haben. Dem Hirten ist jedes einzelne seiner Schafe superwichtig. Und genauso ist für Gott jeder einzelne Mensch superwichtig. Er sorgt sich um uns wie ein liebevoller Vater. Und deshalb will er nicht, dass auch nur einer, und sei es auch der Kleinste und Unscheinbarste, verloren geht.“
Nach Matthäus 18,12-14
Konrad und das Nadelöhr
Konrad war stolze zwei Meter fünfundvierzig groß. Er trug stets eine riesige, blau-gold verzierte Damastdecke und konnte mühelos die allerschwersten Lasten schleppen. Vierhundert Kilo waren überhaupt kein Problem, und dies tagelang und bei Affenhitze. Dabei geriet er nicht einmal ins Schwitzen. Außerdem war er superschnell. Einmal hatte er sogar den Araberhengst eines Kalifen in einem Rennen geschlagen. Konrad hatte seidiges, goldbraunes Haar und einen prächtigen, schwarzbraunen Kinnbart. Überdies hatte er auch noch eine besondere Begabung im Weitspucken. Er konnte zielgenau 15 Meter weit direkt in das Ohr eines Kameltreibers spucken. Und wenn dieser sich dann wutschäumend nach dem schleimigen Angreifer umsah, blickte Konrad so unschuldig drein wie ein Lämmlein, das gerade sein erstes Gänseblümchen verzehrt.
Um es klar zu sagen: Konrad war das größte und schönste Kamel im Umkreis von 200 Meilen, und das wusste er sehr genau.
Konrad blickte immer ein wenig hochmütig auf die Kamelkollegen seiner Karawane herab. Für die Maultiere hatte er nur ein mitleidiges Lächeln übrig und die Lastesel beachtete er gar nicht erst. Sie waren für ihn nicht mehr als struppige Staubwedel mit Ohren.
Der mickrigste dieser wandelnden Staubwedel war ein besonders erbarmungswürdiges Geschöpf. Elimar der Esel war so winzig, dass die anderen Tiere lästerten, er sei wohl ein Kaninchen, dem man die Beine lang gezogen habe. Sein struppiges Fell war voller Flöhe, und er roch wie ein Iltis, der ein Stinktier beeindrucken will.
Elimar hatte furchtbare Angst vor Wasser. Lieber trank er die alte, abgestandene Brühe aus einem Eimer, als dass er sich einer Oase dichter als zwanzig Schritte näherte. Schon wenn ein paar Spritzer sein Fell benetzten, quiekte er wie ein Schwein, dem ein Metzger zuzwinkert. Das lag daran, dass sein erster Besitzer versucht hatte, Elimar zu ertränken, als er erkannt hatte, was für ein nutzloser Winzling der kleine Esel war. Glücklicherweise war damals gerade Trockenzeit und somit nicht genug Wasser in der Oase. Elimar kam mit dem Leben davon. Allerdings verlor er dabei seine Vorderzähne. Seitdem lispelte er.
Eines Tages nun geschah es, dass Elimar mit seiner Karawane direkt neben Konrad dahinzog. Das heißt: Konrad zog dahin – mit langen, eleganten Schritten. Elimar hingegen versuchte hoppelnd und mit heraushängender Zunge, Schritt zu halten. Der kleine Esel hatte auf seinem Rücken ein winziges Körbchen mit Dung, welcher den Beduinen als Brennmaterial diente. Konrad hingegen trug eine Last, die mindestens fünfmal so schwer war wie der ganze Elimar samt seinem Körbchen: schwarzes Ebenholz und feinste Seide aus dem Morgenland – sehr selten und sehr, sehr kostbar. Das würdige Kamel achtete nicht weiter auf den winzigen, struppigen Esel, und Elimar traute sich nicht, etwas zu sagen.
Die Karawane war ein bisschen spät dran und die Tiere wurden immer unruhiger. Plötzlich ließ ein Schrei die ganze Kolonne erschrocken zusammenfahren. „Ein Sandsturm! Ein Sandsturm kommt auf.“
„Au Backe, fo ein Mift“, lispelte Elimar.
Konrad behielt die Ruhe. Rasch erstieg er einen kleinen Sandhügel und sah, wie erwartet, die Stadt nur ein paar Meilen entfernt in der Abenddämmerung vor sich liegen. „Okay, Jungs“, rief er den anderen Kamelen zu, „jetzt ganz ruhig bleiben! Es war ein harter Tag, aber wir schaffen das. Im Laufschritt brauchen wir nicht mehr als 15 Minuten. Ich gebe das Tempo vor. Und ich verspreche euch, wer bei mir bleibt, schlürft nachher einen Wassermelonenshake in Josefs Restaurant, ohne dass ihm der Sand zwischen den Zähnen knirscht. Mir nach!“
Die ganze Kolonne fasste neuen Mut und im Laufschritt folgte sie dem vorauseilenden Konrad. Elimar versuchte, das Tempo zu halten. Sein Atem keuchte und sein Herz flatterte wie ein Schmetterling. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass er immer weiter zurückfiel.
Plötzlich blieb Konrad stehen, sodass auch die anderen mit qualmenden Hufen über den Sand schlitterten. Mit hechelnder Zunge stieß als Letzter auch Elimar dazu.
„Diese elenden Weicheier“, knurrte Konrad. „Seht euch das an. Sie schließen die großen Tore.“
„Sie haben Angst vor dem Sandsturm“, sagte Dorothee das Dromedar mit großen Augen.
„Sieht so aus“, erwiderte Konrad. Dann erhob er die Stimme und wandte sich an die erschrocken dastehende Karawane. „Planänderung, Leute. Wir müssen weiter nach Osten. Dort gibt es, soweit ich weiß, noch ein kleines Nebentor. Das ist fast immer offen. Jetzt könnt ihr zeigen, was in euch steckt. Beeilt euch. Wir müssen die Ladung retten.“
Elimar der Esel wollte etwas sagen. „Äh hallo … Chef! Ef… gibt da noch ein Problem …“
Weiter kam er nicht, denn Konrad startete durch und hinterließ eine mächtige Staubwolke.
Nachdem er seinen Hustenanfall überwunden hatte, versuchte der kleine Esel verzweifelt mitzuhalten. Hinter sich konnte er schon das drohende Brausen des Sturmes vernehmen. Elimar glaubte, gleich ohnmächtig werden zu müssen, so anstrengend war das Laufen. Doch er gab nicht auf. Und das lag nicht nur an dem drohenden Sandsturm. Im Gegensatz zu Konrad war Elimar nämlich schon einmal durch das kleine Nebentor gegangen, und er wusste, warum es Das Nadelöhr1 hieß.
Und dann blieb die Karawane tatsächlich noch einmal stehen. Nur fünfzig Meter von der Mauer entfernt. Elimar hätte vor Freude gerne einen Luftsprung gemacht, wenn seine Beine nicht so schrecklich gezittert hätten.
„Da vorne ist es“, hörte er Konrad sagen, der kein bisschen außer Atem klang. „Auf zum Schlussspurt, bevor die Jungs das Tor auch noch schließen.“
Elimar quetschte sich zwischen den Beinen der anderen Tiere hindurch. „Halt“, krächzte er völlig erschöpft, „Ftop, einen … Moment … noch.“
Ärgerlich drehte sich Konrad um. Zuerst sah er gar nicht, wer dort rief, bis er seinen Blick zu Boden senkte. „Was willst du denn?“, fragte Konrad naserümpfend.
„Daf Tor …“, keuchte Elimar atemlos.
„Natürlich ist da das Tor, du Trottel“, zischte Konrad. „Deswegen habe ich euch doch hierhergeführt. Und nun zur Seite, du stinkst nämlich ganz erbärmlich. Ich will nicht, dass alle in Ohnmacht fallen, bevor wir die Stadt erreichen.“
„Nein, du verftehft nicht“, sagte Elimar verzweifelt. „… du mufft vorfichtig fein. Daf Tor ift nämlich fehr kl…“
„Hör auf, hier rumzuwinseln“, unterbrach ihn Konrad wütend. „Ich habe euch hierhergeführt. Ich weiß, was ich tue!“
„Aber …“
„Klappe halten“, zischte Konrad und dann rief er den anderen zu: „Auf geht’s!“ Konrad sprintete los, dass die Barthaare wehten und die Ladung auf seinem Rücken sich bedrohlich nach hinten neigte. Er grinste, als er bemerkte, dass er die anderen weit hinter sich ließ. Rasch kam die rettende Öffnung näher. In Gedanken machte er es sich schon in Josefs Bar gemütlich. Dann hatte er die Stadt erreicht. Doch statt elegant durch das Tor zu preschen, blieb er plötzlich stecken wie ein Korken im Flaschenhals. Sein Schwung war dabei so groß, dass ihm die Augäpfel wie Riesenpilze aus den Höhlen glubschten und seine Zunge durch die Zähne hindurch um seine Nase schlabberte.
Dann wurde er wie von einem Gummi zurückgeschleudert, ditschte ein paar Mal mit dem Hintern auf den harten Wüstenboden und kam in einer riesigen Staubwolke zum Liegen. Doch anstelle des Staubs sah Konrad Sternchen – eine ganze Galaxie voll.
Als er wieder zu sich kam, waren die anderen Tiere aus der Karawane verschwunden. Sie hatten es irgendwie geschafft, sich durch das Tor in Sicherheit zu bringen. Der Sturm war inzwischen ganz dicht und Sand bedeckte die dicken Packen von Ladung, die rechts und links von Konrad auf dem Boden lagen. Konrad war zu benommen, um sie zu bemerken. Verwirrt schüttelte er den Kopf und versuchte aufzustehen.
„Haft du dir wehgetan?“, drang eine mitfühlende Stimme an sein Ohr.
Wenn schon nicht durch das Lispeln, so konnte Konrad spätestens durch den penetranten Geruch erahnen, wer dort zu ihm sprach. „Was machst du denn noch hier?“, fragte Konrad und erhob sich stöhnend.
„Ich dachte, du könnteft vielleicht ein wenig Hilfe gebrauchen“, erwiderte Elimar.
„Hilfe? Von dir?“, fragte Konrad, während er schwankend auf die Beine kam. Langsam wankte er auf das Tor zu.
„Du muft Ballaft abwerfen“, sagte Elimar eindringlich und hoppelte neben ihm her. „Fo pafft du nich durch.“
„Ich bin ein Kamel, was bildest du dir ein?“, fragte Konrad würdevoll. „Ich bin sogar das beste Lastkamel im Umkreis von 200 Meilen. Ich trage keinen Ballast. Ich trage die wertvollsten Güter der gesamten Karawane. Mit dem Preis für meinen Ballast könntest du dieses Stadttor da komplett vergolden lassen.“
„Ift ja fön und gut“, erwiderte der kleine Esel ungeduldig. „Aber der Fandfturm ift gleich hier, und wenn du daf Feug nicht fleunigft lofwirft, bleibt von dir nicht mehr übrig alf ein paniertef Kamelfnitfel.“
Konrad warf einen nervösen Blick nach hinten. Der kleine Stinker hatte leider recht. Der Sturm war gewaltig und schon so dicht, dass er sich wie eine düstere Wand vor ihnen auftürmte. Es wurde wirklich Zeit, dass sie in die Stadt kamen. Mit einem ärgerlichen Knurren ging Konrad in die Knie und versuchte, sich robbend durch das Tor zu bewegen.
Es half nichts; er blieb stecken. Und hätte der kleine Esel nicht an seinem Schwanz gezogen, wäre er auch gar nicht wieder rausgekommen.
„Beim Eiterpickel meines Urgroßvaters, so ein Mist!“, schimpfte Konrad. Er warf einen Blick auf den kleinen Esel, der treuherzig zu ihm aufblickte. Dann knurrte er: „Hilf mir mal, das oberste Bündel abzuschnüren.“
Das große Kamel kniete nieder, und der kleine Esel zerrte mit seinen verbliebenen Zähnen eifrig an dem Packen, bis die wertvolle Seide schließlich in den Staub fiel.
Konrad zuckte beinahe schmerzhaft zusammen, als Elimar den Stoff achtlos mit den Hufen beiseiteschob und meinte: „Ich fürchte, daf wird nicht reichen.“
„Unsinn“, knurrte Konrad und kroch auf das Nadelöhr zu. „Mist“, fluchte er wenig später. Das Paket war immer noch zu groß.
Noch zweimal musste Elimar das Paket verkleinern, bevor Konrad endlich einsah, dass seine wertvolle Last nicht zu retten war. Inzwischen heulte ihnen der Wind ordentlich um die Ohren und der Sand peitschte ihnen ins Gesicht. Konrad machte sich so klein wie möglich und quetschte sich durch das Nadelöhr. Elimar schob und drückte aus Leibeskräften.
Und dann endlich mit einem lauten RATSCH riss auch noch die kostbare goldblaue Damastdecke von Konrads Höcker, und er selbst flutschte nackt und ramponiert durch das winzige Tor. Stolpernd und hustend folgte ihm Elimar. Rasch brachten sich die beiden in einer engen Gasse in Sicherheit. Dann hörten sie, wie auch das Nadelöhr als letztes Tor geschlossen wurde.
Schweigend blieben die beiden stehen, während sie hin und wieder Sand ausspuckten. Dann kniete Konrad nieder, bis er sich auf Augenhöhe mit dem kleinen Esel befand. „Ich … war … ein Riesenidiot“, sagte er stockend. „Und du … du bist ein echter Held, kleiner Esel. Wenn ich irgendetwas tun kann, um das wiedergutzumachen, sag es mir.“
„Och, na ja“, druckste Elimar ein wenig verlegen herum. Solches Lob war er nicht gewohnt. „Alfo, wenn du mir einen Gefallen tun willft … Ich habe noch nie einen Waffermelonenfake getrunken.“
„Dann wird es Zeit, dass wir das ändern“, sagte Konrad ernst und zwinkerte Elimar zu.
Sie waren mit Abstand das seltsamste Paar, das sich an diesem Abend in Josefs Restaurant einfand. Es wurde viel getuschelt und hämisch gegrinst. Doch zum ersten Mal in seinem Leben war es Konrad egal, was die anderen von ihm dachten, denn heute hatte er erfahren, was wirklich wichtig ist.
1 Ein Nadelöhr ist das winzige Loch in einer Nähnadel, durch das man den Faden zieht, mit dem man nähen möchte.
Einmal war Jesus ziemlich traurig,
weil ein reicher Mann, der eigentlich ein netter Kerl war, nicht verstehen wollte, dass ihn sein ganzer Reichtum von viel Wichtigerem abhielt. Da sagte Jesus zu seinen Freunden: „Ein Reicher hat es echt schwer, in die neue Welt Gottes zu kommen. Das liegt daran, dass sich bei ihm alles um die falschen Sachen dreht. Eher noch quetscht sich ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher kapiert, worauf es wirklich ankommt.“
Nach Matthäus 19,24
Phillip Fusselbirne und der Marathon der Weberknechte
Die beiden Weberknechte Phillip Fusselbirne und Steffi Stinkesocke spazierten gerade die Amöbenpromenade entlang, als sie auf einmal eine große Ansammlung von anderen Weberknechten entdeckten, die aufgeregt miteinander tuschelten.
„Alle mal herhören! Alle mal herhören!“, rief jemand laut. Es war Alois Altölkanister. Mit seinen langen, dürren Beinen erklomm er einen verbeulten Fingerhut, sodass er von allen gut zu sehen war.
An dieser Stelle sollte ich besser noch eine Anmerkung machen: Vielleicht wundert ihr euch über die merkwürdigen Namen der Weberknechte, aber bei denen ist es so üblich, dass sie nach dem Ort benannt werden, an dem sie geboren wurden. Bei Alois war es der erwähnte Altölkanister, Steffi erblickte das Licht der Welt in der alten Socke eines achtjährigen Jungen – der sich ungern duschte –, und Phillips Geburtsort war die Perücke einer aussortierten Schaufensterpuppe.
„Alle mal herhören!“, rief Alois noch einmal und winkte mit einem seiner langen Beine. „In genau vier Wochen startet der große Weberknechtmarathon quer durch den Hoppelgarten bis zum olympischen Spinnentierstadion.“
„Typisch Alois“, murmelte Phillip Fusselbirne Steffi Stinkesocke zu. „Immer muss sich Herr Altölkanister wichtigmachen.“
„Psst“, zischte Steffi. „Es geht noch weiter.“
„Der Sieger erhält als besonderen Preis eine unverdaute Fruchtfliege wöchentlich bis an sein Lebensende.“
„Hey!“ Steffi knuffte Phillip mit ihrem Lieblingsvorderbein in den Bauch. „Das hört sich doch interessant an, oder?“