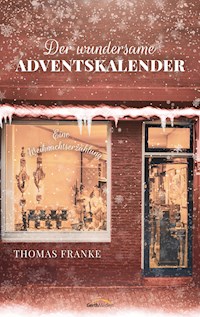Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der junge Extremsportler Raven Adam kann nicht glauben, dass der plötzliche Tod seines Bruders ein Unfall war. Als er beginnt, Nachforschungen anzustellen, erreicht ihn der verzweifelte Hilferuf von Mirja Roth. Sie absolviert ein Praktikum in einer Dschungelklinik am Amazonas und macht dort erschreckende Beobachtungen: Menschen verlieren ihre Erinnerung oder verschwinden spurlos. Schnell erkennt Mirja, dass sie nicht zufällig in dieser Klinik gelandet ist. Ihr Leben ist in großer Gefahr. Bald darauf muss Raven feststellen, dass auch der Tod seines Bruders eng mit diesen Ereignissen verwoben ist ... Ein atemberaubender Thriller über die uralte Angst des Menschen vor dem Tod und die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten moderner Hirnforschung, aber auch über Hoffnung, die selbst in die dunkelsten Abgründe scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor
Thomas Franke ist Sozialpädagoge und bei einem Träger für Menschen mit Behinderung tätig. Als leidenschaftlicher Geschichtenschreiber ist er nebenberuflich Autor von Büchern. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.
Mehr über den Autor: www.thomasfranke.net
Für Anne.Es ist ein unverdientes Glück, dass du dieses Leben mit mir teilst.Ich liebe dich.
Kapitel 1
Berlin, Februar 2016
Omega schnupperte nervös. Die sterile Luft ermöglichte ihr keine Orientierung. Seine dunklen Knopfaugen glänzten im Licht der Halogenleuchten, die Schnurrhaare zitterten.
Konzentriert beobachtete Dr. Philip Morgenthau abwechselnd die Bewegungen des Tieres und die Monitore, die über der komplexen Versuchsanordnung aus Plexiglas angebracht waren. Die Grafik zeigte rege Aktivität im Hippocampus an. Die feuernden Synapsen bildeten ein komplexes orangefarbenes Muster. Nach kurzem Zögern wandte sich Omega nach links. Die blassrosa Pfoten glitten den abschüssigen Gang hinab. Der Pulsschlag erhöhte sich. Das Tier überwand seine instinktive Abneigung gegen die glatte, stark geneigte Oberfläche. Das war gut!
Das Tier fixierte das zweite Symbol von links, ein gleichschenkliges Dreieck. Die empfindsame Schnauze drückte gegen die Klappe. Omega musste 85 Prozent der ihm zur Verfügung stehenden Kraft nutzen, um den Mechanismus zu betätigen. Dann öffnete sich die Klappe, und das Tier huschte weiter. Die Elektroden auf seiner Schädeldecke klackten leise gegen Kunststoffwände.
Dr. Philip Morgenthau setzte sich auf. So weit waren bislang nur drei Tiere gekommen.
Das Smartphone in seiner Brusttasche klingelte. Er ignorierte es.
Omega hatte nun eine rautenförmige Plattform erreicht, von der aus sechs schmale Tunnel abgingen, die sich lediglich durch die Stärke des jeweiligen Luftzugs voneinander unterschieden. Ohne zu zögern, wählte das Tier den Gang, dessen Luft ihm mit Windstärke 5 entgegenblies. Bis zu dieser Stelle war bislang nur 22 β vorgedrungen, und sie hatte annähernd eine Minute gebraucht, um sich zu entscheiden. Einige Punkte im orangefarbenen Flimmern des Hippocampus leuchteten jetzt in dunklem Rot.
Dr. Morgenthau machte hastig eine digitale Kopie des Scans und legte sie im Rechner über die Originalaufnahme. Der Sitz der Ortszellen war zu 92 Prozent identisch.
Erneut meldete sich sein Handy. Er schaltete den Ton ab.
Die weiße Ratte folgte dem bogenförmigen Gang. Das Muster der roten Punkte veränderte sich.
Sie weiß es!, schoss es Morgenthau durch den Kopf. Seine Hände zitterten, als er sie an seiner Hose abwischte.
Nun gabelte sich der Plexiglastunnel innerhalb von kurzen Abständen sechsmal. Omega zögerte lediglich beim zweiten Abzweig etwa drei Sekunden lang. Es war fantastisch! Charly hatte einen ganzen Monat benötigt, um den richtigen Weg zu erlernen!
Dr. Morgenthaus Handy gab ein kurzes Brummen von sich, als es eine Kurznachricht empfing.
Das Tier erreichte eine Plattform, auf der ein kleines Schälchen mit Roggenkörnern stand. Die Schnurrhaare der Ratte zitterten. Dem überwältigend köstlichen Geruch war ein hauchfeiner Duft von etwas Fremdartigem beigemischt. Normalerweise hätte sich das Tier davon nicht abhalten lassen, doch Omega rührte das Schälchen nicht an. Sie wäre an dem vergifteten Futter zwar nicht gestorben, aber es wäre eine sehr schmerzvolle Erfahrung für sie geworden.
Dr. Morgenthau zog das Handy aus der Tasche. „Ruf mich an!“, stand auf dem Display. Die Augen des Wissenschaftlers richteten sich wieder auf die weiße Ratte.
Die Krallen des Tieres kratzten über den glatten Boden, als es eilig um eine Kurve bog und sich für die mittlere der drei Klappen entschied, die nun vor ihr auftauchten.
Dr. Morgenthau seufzte tief, als der kleine Nager sein Ziel erreichte. Mit scharfen Zähnen zerriss Omega die Plastikfolie und machte sich dann über eine Mischung frischer Körner her.
Mit der linken Hand betätigte der Wissenschaftler die Rückruftaste seines Handys, während er mit der rechten die Klappe öffnete und die weiße Ratte sanft emporhob.
„Willkommen zurück“, flüsterte er.
Das Freizeichen ertönte zweimal. Dann nahm der Angerufene ab. „Wo steckst du denn, Philip?“
„Wir haben einen Erfolg, Michael!“, unterbrach ihn Dr. Morgenthau. „Und zwar einen grandiosen Erfolg! Die Verhaltensübereinstimmung liegt bei 100 Prozent!“
„Philip – “
„100 Prozent beim ersten Versuch! Ist dir klar, was das bedeutet?!“
„Philip“, wiederholte Dr. Michael Krüger leise. „Die Klinik hat sich gemeldet. Erika …“, er räusperte sich, „… sie hatte in der Nacht eine Lungenembolie.“
„Und warum melden die sich erst jetzt?!“ Unwillkürlich presste Dr. Morgenthau die Finger der rechten Hand fester zusammen. Die Ratte fiepte leise. „Ich fahre sofort in die Klinik und werde mir die Kollegen zur Brust nehmen!“
„Philip, die Kollegen haben sehr schnell reagiert, als die Geräte Alarm gaben. Sie haben auch versucht, dich zu erreichen, aber – “
„Schon gut. Ich war im UG3, dort ist der Empfang zuweilen miserabel. Wie geht es Erika? Auf welchem Zimmer liegt sie?“
„Es tut mir so leid, Philip. Sie hat es nicht geschafft!“
„Was?“
„Erika ist tot, Philip. Sie ist vor zehn Minuten im Operationssaal verstorben.“
Dr. Morgenthau schwieg.
„Philip?“
Ein leises, kaum hörbares Knacken erklang, als das Genick der weißen Ratte brach.
Kapitel 2
Berlin, Mai 2024
Es ist nicht deine Schuld! Tausendmal hatte er diese Worte schon gehört. Sie plätscherten über seine Seele wie Wasser über Felsen.
„Es ist nicht deine Schuld“, sagte seine Mutter leise und schaute mit leeren Augen an ihm vorbei.
„Nicht schuldig“, sagte der Richter und fügte hinzu: „Aus Mangel an Beweisen.“
„Du hättest nichts tun können“, sagten seine Freunde, aber sie wichen seinem Blick aus.
„Sie dürfen sich nicht die Schuld daran geben“, sagte sein Therapeut und verschrieb ihm weitere Medikamente.
Du bist nicht schuld!, sagte er sich selbst. Aber er glaubte sich nicht.
Wenn er sich doch nur erinnern könnte.
Die alte Villa prahlte mit ihrer stuckverzierten Fassade, die in der grellen Mittagssonne glänzte. Aber im Garten wuchs Unkraut zwischen den Rosen, und niemand kümmerte sich um den verblühten Rhododendron. Raven drückte den Messingknopf neben dem Klingelschild.
Es dauerte lange, bis eine heisere Stimme fragte: „Ja?“
„Ich bin’s … Raven.“
Schnaufendes Atmen war zu hören. „Wer?“
„Raven Adam, der Pflegehelfer.“
„Kenn ich nicht.“
„Natürlich kennen Sie mich. Wir haben gestern zusammen Dame gespielt, und Sie haben mich haushoch geschlagen.“
Schweigen.
„Frau Schubert?“, fragte Raven.
„Kenn ich nicht.“
„Ich spreche von Ihnen.“ Schmunzelnd schüttelte Raven den Kopf. „Sie sind Frau Schubert!“ Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet dieser Job ihm sein Lächeln zurückgeben würde?
Einige Atemzüge waren zu vernehmen, dann erklang ein ärgerliches „Was wollen Sie?!“.
Raven hatte einen Schlüssel, aber wenn irgend möglich vermied er es, ihn zu benutzen. Als er damit das erste Mal Frau Schuberts Wohnung betreten hatte, hatte sie beinahe einen Kreislaufzusammenbruch erlitten. Das zweite Mal hatte sie versucht, ihm mit einem eisernen Schürhaken den Schädel zu spalten.
„Frau Schubert, ich bin’s, Raven. Der junge Mann, der Ihre Blumen gießt.“
„Und warum kommen Sie erst jetzt?“ Das Summen des Türöffners erklang, und Raven trat ein. Der alte Sisalläufer knarzte unter seinen Füßen. Er beeilte sich, denn es war durchaus vorgekommen, dass sie ihn schon wieder vergessen hatte, wenn er bei ihrer Wohnungstür anlangte. Doch dieses Mal hätte er sich keine Sorgen zu machen brauchen. Die Tür stand offen, und ein faltiges Lächeln begrüßte ihn.
„Wollen Sie Kaffee?“
„Gern“, sagte Raven, denn er wusste, dass er ihr damit eine Freude machte.
„Ich habe echten Bohnenkaffee im Haus“, verkündete die alte Dame in verschwörerischem Tonfall. Dann schlurfte sie in die Küche. Mit ihren über 90 Jahren war sie körperlich noch beeindruckend rüstig. Nur ihr Geist hatte sich im Labyrinth ihrer Erinnerungen hoffnungslos verirrt. Sie ignorierte den chromglänzenden Kaffeeautomaten, der sicherlich mehr gekostet hatte, als Raven in einem Monat verdiente, und stellte einen verbeulten Teekessel auf den Herd. Dann starrte sie nachdenklich an ihm vorbei.
„Sie wollten sicherlich den Kaffee holen“, sprang er ihr bei.
Frau Schubert nickte und wandte sich ab.
Rasch füllte Raven den Wasserkocher und schaltete ihn an. Der Herd war schon vor einiger Zeit abgestellt worden. Es war einfach zu gefährlich. Manchmal kam Raven sich schäbig vor, dass er die Illusion der Selbstständigkeit aufrechterhielt, obwohl die alte Dame in Wahrheit in allen alltäglichen Dingen auf Hilfe angewiesen war. Aber dann sah er sie lächeln, und sein schlechtes Gewissen verging wieder.
Frau Schubert stellte eine Blechbüchse mit Kaffee und zwei Tassen auf den Tisch. „Aus irgendeinem Grund habe ich keine Filter mehr im Haus. Dann müssen wir ihn eben türkisch trinken.“ Sie füllte mit zitternden Händen Kaffee in die Becher. „Das schmeckt ohnehin besser.“ Sie setzte sich. „Nehmen Sie Platz.“ Sie betrachtete ihn unter hochgezogenen Brauen. „Wo ist eigentlich Ihre Uniform?“
„Ich bin der Pflegehelfer, Frau Schubert. Ihre Freundin Eleonore von Hovhede hat mich angestellt – “
„Schade, Sie sahen so schnieke aus in Ihrer Portiersuniform.“
Raven lächelte. Wer wusste schon, mit wem sie ihn gerade verwechselte.
Als das Wasser kochte, goss Raven den Kaffee auf. Unauffällig öffnete er den Kühlschrank und ergänzte in Gedanken seine Einkaufsliste.
Frau Schubert hatte Glück: Sie war wohlhabend, hatte keine Erben und eine gute Freundin, die alles dafür tat, dass sie ihren Lebensabend in der vertrauten Umgebung verbringen konnte. Die Pflegerin von der Sozialstation kam dreimal am Tag für Körperpflege und Medikamente vorbei. Raven war das Bonusprogramm. Er nahm ein angebissenes Stück Brot aus der Spüle und warf es in den Mülleimer. Als er sich umdrehte, hatte die alte Frau die Tasse Kaffee in der Hand.
„Nicht, Frau Schubert, der ist noch viel zu heiß!“
Sie trank einen Schluck und lächelte ihn kokett an. „Ach, Anton, du bist ein Spielverderber.“ Schwarze Krümel saßen in ihren Zahnlücken. Es war ein grotesker Anblick. Und dennoch wurde Raven in diesem Moment wieder bewusst, dass Frau Schubert früher einmal sehr hübsch gewesen war. Er hatte alte Fotos gesehen. Sie selbst fühlte sich in diesem Moment wieder jung und flirtete mit dem jungen Portier Anton, den sie in ihrer Jugend offenbar sehr attraktiv gefunden hatte.
Raven setzte sich wieder und schob ihre Tasse mit dem heißen Kaffee ein Stück zur Seite. „Was möchten Sie denn zum Frühstück essen, Frau Schubert?“
„Weißt du, dass deine Augen ein ganz besonders dunkles Blau haben?“
„Ich mache Ihnen ein Honigbrot, Frau Schubert, und diesmal essen Sie wenigstens die Hälfte, in Ordnung?“
„Honig …“, wiederholte die alte Frau, und es klang, als teste sie den Geschmack dieses Wortes.
Das Frühstück nahm über eine Dreiviertelstunde in Anspruch. Immer wieder vergaß die alte Dame sogar das Kauen und starrte mit leerem Blick an die Küchenwand. Schließlich murmelte sie: „Der Anton ist tot. Er ist gefallen, sagen sie. Aber ich glaube, er ist erfroren, im russischen Winter. Er fror doch so leicht.“ Sie schob den Teller beiseite.
„Kommen Sie, wir gehen ein bisschen auf den Balkon. Dann können Sie mich beaufsichtigen, während ich mich um Ihre Blumen kümmere.“
Erst reagierte sie nicht, dann schrie sie ihn an. Er solle sie in Ruhe lassen. Schließlich bot sie ihm mit gezierter Bewegung ihren Arm. Ihre Finger waren kalt und ihre Haut so dünn wie Pergament. Raven öffnete die Balkontür und führte die alte Dame zu einem gepolsterten Liegestuhl. Frau Schubert setzte sich.
„Blühen die Petunien nicht herrlich?“
„Ganz wunderbar“, erwiderte Raven. Er hatte keine Ahnung von Blumen.
Nachdem er die Gießkanne mit Wasser gefüllt hatte, goss er die Balkonkästen. Dabei starrte er auf die terrakottafarbenen Plastikbehälter und versuchte, so viel Abstand wie möglich zum Geländer zu halten. Diesen Teil seines Jobs hasste er. Aber die alte Dame liebte nun einmal ihren Balkon, und sie war stets entspannter, wenn sie hier saß.
„Sie müssen die verwelkten Blätter entfernen“, wies sie ihn an.
Raven schluckte. Sie wird es gleich wieder vergessen, dachte er. Die Erkenntnis seiner eigenen Feigheit versetzte ihm einen Stich. Du bist so erbärmlich! Soll diese Angst dein gesamtes Leben bestimmen? Willst du immer auf der Flucht sein wie ein verängstigtes Kaninchen?!
Er machte einen Schritt auf die Balkonbrüstung zu, dann noch einen. Unwillkürlich huschte sein Blick zur nahe gelegenen Dachterrasse des Nachbarhauses. Eigentlich wäre es ganz einfach: per Cat Balance über das Geländer, Tic-Tac an der Mauerseite und dann oben von der Mauerkrone ein Two Foot Precision über den Hof auf den Balkon der alten Dame, den Schwung mit einer einfachen Rolle auffangen und weiter. Ganz einfach …
Eine vertrocknete Blüte hing über die rostige Brüstung. Raven beugte sich vor. Der Hof lag direkt unter ihm, Pflastersteine … Helles Grau und Anthrazit bildeten ein wellenförmiges Muster. Sein Herz begann, schneller zu schlagen. Es sind doch nur sechs oder sieben Meter. Er versuchte, gegen die aufkeimende Panik anzukämpfen. Du hast schon in zehnfacher, ja, hundertfacher Höhe gestanden. Sein Atem ging hektisch und flach. Das Muster der Granitsteine im Hof begann, sich zu bewegen. Es verschwamm zu einem Strudel, der sich immer schneller zu drehen begann.
Erinnerungsfetzen schossen ihm durch den Kopf:
Sie standen auf dem obersten Parkdeck, es war windig, doch für Ende September war die Luft noch ganz warm. Raven hielt die Kamera. „Du wirst berühmt werden!“, hörte er seine eigene Stimme.
Julian grinste. Es war das typische jungenhafte Grinsen seines Bruders – die Frauen liebten ihn dafür. Doch diesmal lag in seinen Augen ein Schatten. Irgendetwas stimmte nicht … Julian stand auf der Parkdeckumrandung …
Und dann kam das Nichts: ein heller Blitz … weißes Rauschen und das Trommeln seines eigenen Herzschlags.
Weit unter ihm lag Julians Gestalt. Das Pflaster färbte sich rot.
Etwas Hartes drückte gegen Ravens Nacken. Ein Schrei gellte in seinem Inneren wider. Er wusste nicht, ob er geschrien hatte oder Julian – oder war da noch jemand anderes gewesen?
Dann ein Plätschern. Vor seinem inneren Auge sah er Ströme von Blut auf helles Pflaster rinnen. Er schüttelte den Kopf, um die ungebetenen Gedanken zu vertreiben, und fand sich auf dem Boden des Balkons wieder. Es war die Halterung eines Balkonkastens, die schmerzhaft gegen seinen Nacken drückte.
Frau Schubert hockte auf ihrem Stuhl. Ihr Blick war leer. Auf dem Boden breitete sich eine Urinlache aus.
„Warten Sie“, sagte Raven. „Ich helfe Ihnen.“
Die alte Dame ließ sich widerstandslos hineinführen. Erst im Wohnzimmer riss sie sich wütend von ihm los. „Lass mich! Was fällt dir ein?“
„Frau Schubert, ich bin’s“, sagte Raven beschwichtigend.
„Verlassen Sie mein Haus oder ich rufe die Polizei!“
„In Ordnung, ich gehe. Aber erst ziehen wir Ihnen saubere Sachen an, und dann müssen Sie mir noch sagen, was ich für Sie einkaufen soll.“
Frau Schubert starrte ihn an.
„Ein Pfund Butter und das Schwarzwälder Graubrot vom Bäcker habe ich bereits aufgeschrieben – “ Die Klänge von When September Ends ließen ihn innehalten. Hastig zog Raven sein Smartphone aus der Hosentasche.
Frau Schuberts Augen verengten sich.
„Hallo, Mama, jetzt ist wirklich ein ganz schlechter Zeitpunkt – “
„Vor einigen Tagen ist ein Paket gekommen“, unterbrach ihn die tonlose Stimme seiner Mutter.
Frau Schubert drehte sich abrupt um und eilte aus dem Zimmer.
„Mama – “
„Es kommt von der Staatsanwaltschaft. Sie schicken uns die freigegebenen Gegenstände aus der Asservatenkammer. Ich … will das hier nicht …“
Julians Sachen!, fuhr es Raven durch den Kopf. Das Video!
Aus dem Flur erklang ein Klirren.
Raven trat rasch durch die Tür. Der lang gezogene Gang erstreckte sich düster vor ihm.
„Ich hol die Sachen später ab“, sagte er. „In zwei Stunden bin ich da.“
Wortlos legte seine Mutter auf.
Raven betrat den dunklen Flur. Die alte Frau stand reglos vor einem umgestürzten Tischchen. Die Vase, die darauf gestanden hatte, war zerbrochen. Blumen lagen auf dem Boden, und Wasser tränkte den alten Perserteppich.
Sanft legte Raven eine Hand auf die Schulter der alten Dame.
„Der Mann …“, flüsterte sie leise.
„Kommen Sie, Frau Schubert.“
Die alte Dame stand stocksteif da. Plötzlich schoss ihre Hand vor und umklammerte seinen Arm. Ihre Finger waren eiskalt. „Er ist immer in der Nähe!“
„Frau Schubert, hier ist niemand außer uns. Kommen Sie!“
Raven wollte sie zurück ins Wohnzimmer führen, doch die alte Frau widersetzte sich seinem sanften Druck. „Der Mann mit dem Bart, er sieht uns!“
Etwas an ihrer Stimme ließ Raven frösteln. Obwohl die Demenz bei ihr weit fortgeschritten war, gab es immer wieder Momente, in denen der Nebel sich verflüchtigte und sie sich voll und ganz in der Gegenwart befand. Oft blitzte dann etwas von ihrer Klugheit und ihrem hintergründigen Humor auf, und jedes Mal spürte Raven, dass er der alten Dame nun ganz unverfälscht begegnete. Erschreckenderweise hatte er auch jetzt dieses Gefühl.
„Frau Schubert?“ Er suchte ihren Blick, doch sie starrte an ihm vorbei auf die Wohnungstür.
Raven fuhr herum. Bildete er sich das nur ein, oder hatte da eben noch ein Schatten auf dem Türspion gelegen?
„Warten Sie hier, Frau Schubert.“ Er ging zur Tür und sah durch den Spion. „Niemand zu sehen.“
„Er ist da draußen!“, sagte die alte Frau in einem Tonfall, der Raven einen Schauer über den Rücken jagte.
Rasch öffnete er die Tür. Nichts. Da drang ein leises Geräusch an seine Ohren: das Klacken einer sich schließenden Tür. Raven schloss die Wohnungstür und ging rasch zum Fenster. Im verwilderten Vorgarten war niemand zu sehen. Wer immer das Haus verlassen hatte, er musste sich sehr beeilt haben.
Raven versuchte zu erkennen, ob sich irgendjemand hinter der wuchernden Hecke verbarg. Dann vernahm er gedämpft das Starten eines Motors. Ein weißer Lieferwagen fuhr vorbei. Saß ein bärtiger Mann am Steuer? Er war sich nicht sicher. Der Wagen bog ab.
Raven starrte ihm hinterher. Sein Herzschlag hämmerte in seinen Ohren. Seit dem Unfall war Normalität für ihn ein Fremdwort Die Angst überfiel ihn an den seltsamsten Orten und machte jeden klaren Gedanken unmöglich. Er schloss die Augen und atmete tief ein und aus, bis sein Herzschlag sich beruhigte. Was ist nur los mit dir? Eine alte, demenzkranke Frau hat einen bärtigen Mann gesehen, und ein Lieferwagen fährt vorbei. Das ist alles. Er seufzte, zog die Gardinen wieder vor das Fenster und ging zurück in den Flur.
„Frau Schubert, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Niemand hat Sie beobachtet. Das war nur irgendein Lieferant.“
Die alte Frau warf ihm einen seltsamen Blick zu. „Er beobachtet nicht mich …“, murmelte sie leise.
Raven lächelte und wollte etwas Beruhigendes hinzufügen, aber die alte Frau fuhr fort: „… er beobachtet Sie!“
Er spürte, wie ihm erneut ein Schauer über den Rücken lief. „Was meinen Sie damit?“
Die alte Frau schwieg. Dann senkte sie den Blick. „Die schöne Vase ist kaputt. Und der Teppich ist auch ganz nass.“
Raven benötigte einen Moment, um sein Lächeln wiederzufinden. „Ich bringe das in Ordnung.“
Kapitel 3
Brasilien, Bundesstaat Pará, Mai 2023
Als sich die Tür der kleinen Cessna öffnete, schlug Mirja schwülwarme Luft entgegen. Der exotische Duft des Dschungels stieg ihr in die Nase. Regen prasselte herab, und Dampf stieg von der geteerten Landebahn auf. Seltsame Laute drangen von der wogenden grünen Masse des Urwaldes zu ihr herüber. Ein Kribbeln überlief ihre Haut. Sie schulterte ihren Rucksack und ließ den Blick über das Krankenhausgelände schweifen. Neben einer alten Villa, deren Baustil an die portugiesische Kolonialzeit erinnerte, gab es einige von einer Steinmauer umgebene Baracken. Den Blickfang bildete aber ein eleganter Klinikneubau mit einem kuppelförmigen Glasdach, an den sich ein modernes Wohngebäude anschloss. Auf der Webseite der Stiftung hatte die Klinik beeindruckend ausgesehen. Hier, wo sie die wilde Natur um sich herum hören und den heißen Atem des Dschungels spüren konnte, wirkte sie geradezu surreal. Ein ganzes Semester würde sie hier verbringen. Die Vorfreude zauberte ihr ein Lächeln aufs Gesicht.
Sie sprang hinunter auf den nassen Asphalt. Wasser spritzte bis zum Saum ihrer kurzen Shorts, und der herunterprasselnde Regen durchnässte ihr dünnes Baumwollhemd. Mehrere junge Leute in Klinikkleidung eilten über das Rollfeld, um Medikamente, Lebensmittel und medizinisches Material auszuladen.
„Hallo, du musst Mirja Roth sein.“ Eine junge Frau mit kurzen roten Haaren und unzähligen Sommersprossen im Gesicht hielt einen Regenschirm über sie.
„Ja.“ Mirja war nicht undankbar, dass auf dem Gelände grundsätzlich Englisch gesprochen wurde, da die Mitglieder des Teams aus aller Herren Länder kamen. Ihr Portugiesisch reichte gerade mal für die brasilianische Version von Tom und Jerry.
Die junge Frau hakte sich bei ihr unter. Sie verließen das Rollfeld und betraten einen gepflasterten Weg. „Mein Name ist Jennifer McDowell. Wir teilen uns ein Zimmer.“
„Dein Name klingt schottisch, aber dein Akzent nicht.“
„Ich komme aus Chicago, aber mein Urgroßvater wurde in Glasgow geboren. Und woher kommst du?“
„Zurzeit studiere ich an der Ohio State University in Columbus. Aber eigentlich komme ich aus Deutschland.“
An dieser Stelle ließen es sich viele Amerikaner gewöhnlich nicht nehmen, Mirja mit den Themen „deutsche Autobahn“, „Oktoberfest“ und „Adolf Hitler“ zu konfrontieren, aber Jennifer nickte nur freundlich und eilte weiter durch den Regen.
Kurz darauf erreichten sie das große Hauptgebäude.
„Willst du erst deine Sachen wegpacken oder gleich die Klinik sehen?“
„Zuerst die Klinik!“, erwiderte Mirja.
Als sich die gläsernen Türen des Krankenhausgebäudes hinter ihnen schlossen, empfing sie eine angenehme Kühle.
„Wow!“, entfuhr es Mirja. „Ist hier alles klimatisiert?“
„Die Stiftung legt großen Wert darauf, dass die medizinische Versorgung sich an modernsten Standards orientiert“, erwiderte Jennifer. „Komm, ich zeig dir alles.“
Im Erdgeschoss lagen die Geburtshilfe- und die Kinderabteilung. Die meisten Patienten dort waren indigener Abstammung, aber es gab auch Afrobrasilianer und einige Kinder mit europäischen oder asiatischen Zügen. Ausnahmslos allen war die Armut anzusehen. Die meisten Familien der Gegend verdienten ihren Lebensunterhalt mehr schlecht als recht als Holzarbeiter oder Kleinbauern. Nur noch wenige pflegten den traditionellen Lebensstil der Ureinwohner. Einigen der kleinen Patienten schien es schon besser zu gehen. Sie tollten ausgelassen in einem eigens eingerichteten Spielzimmer. Ein kleines Mädchen starrte sie mit großen, dunklen Augen an und trat vorwitzig näher. Als Mirja niederkniete, ließ die Kleine ihre Hand vorsichtig durch die blonden Locken der jungen Frau gleiten.
Jennifer lachte. „Du solltest über eine neue Frisur nachdenken. Hier können so lange Haare irgendwann sehr lästig werden.“
Mirja warf einen knappen Blick auf die ihrer Ansicht nach äußerst kurze Kurzhaarfrisur der jungen Frau und verzog das Gesicht.
Jennifer grinste. „Warten wir ab, was du nach vier Wochen Regenwald sagen wirst.“
Mirja folgte ihr durch die weiteren Abteilungen. Die medizinische Ausstattung der Klinik war beeindruckend.
„Ich bin ehrlich begeistert von diesem Projekt. Aber es erstaunt mich, dass die ,Dr. Philip Morgenthau Stiftung‘ diese Klinik mitten in den Dschungel gesetzt hat. Allein die Logistik muss Millionen von Euro jährlich verschlingen.“
„Dr. Morgenthau hat eine besondere Verbindung zu Brasilien. Er hat viele Jahre hier gelebt.“
„Oh, das wusste ich nicht.“ Dr. Philip Morgenthau war eine weltweit anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Neurologie und Neurochirurgie. Seine bahnbrechenden Entwicklungen hatten unzählige Epileptiker von ihren Leiden befreit, und auch für Parkinsonkranke gab es neue Hoffnung. Seine Patente hatten ihn zu einem sehr reichen Mann gemacht, aber ein Großteil seines Vermögens floss in die Dr. Philip Morgenthau Stiftung, die sich ganz der humanitären Hilfe und der medizinischen Forschung widmete. Das Dschungelkrankenhaus war nur eines von Dutzenden Projekten. Zudem wurden weltweit Stipendien an begabte Studierende aus allen medizinischen Bereichen vergeben, um Entwicklung und Forschung voranzutreiben. Dabei zählten nicht nur gute Noten, sondern auch andere Kriterien, wie zum Beispiel das humanitäre Engagement. Diesem Umstand, so mutmaßte Mirja, hatte sie auch ihr Stipendium zu verdanken.
Sie trat an ein großes Panoramafenster, von dem aus man einen Teil des Geländes überblicken und weit auf den Dschungel hinausschauen konnte.
„Außerdem ist, wie bei allen Projekten der Stiftung, die medizinische Hilfe nur ein Teil des Konzepts“, fuhr Jennifer fort. „Ein weiteres Standbein ist die pharmakologische Forschung. Der Regenwald birgt noch immer eine Unmenge an bislang unbekannten Substanzen, die für die Entwicklung neuer Medikamente äußerst spannend sein könnten.“
Mirja grinste. „Du klingst wie ein wandelnder Werbeprospekt.“
„Sorry.“ Jennifer lächelte verlegen. „Bei diesem Teil des Projekts bekomme ich immer glänzende Augen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als zweites Hauptfach Biochemie studiere.“
„Wow, ganz schön anspruchsvoll.“
Jennifer winkte ab. „Reine Neugier.“ Sie führte Mirja weiter durch das hochmoderne Gebäude. Zu den Laboratorien hatten sie allerdings keinen Zutritt.
„Wir haben hier ausschließlich S3- bis S5-Labore“, erklärte Jennifer. „Laien dürfen nicht einmal in die Nähe der Sicherheitsschleusen“, fügte sie hinzu.
Überrascht hob Mirja die Brauen. „S“ stand für „Sicherheitsstufe“, so viel wusste sie. „Stufe fünf? Ich dachte, es gibt nur vier Sicherheitsstufen?“
Jennifer grinste und zuckte mit den Achseln. Offenbar wusste sie auch nicht mehr darüber zu erzählen. Stattdessen führte sie die junge Studentin in die Ambulanz.
„War Dr. Morgenthau eigentlich schon mal hier?“, erkundigte Mirja sich nach einer Weile.
„Soweit ich weiß nur zur Eröffnung des Projekts. Ich glaube auch nicht, dass er noch mal auftauchen wird. Die Reise hierher ist ja ganz schön beschwerlich.“
Mirja nickte. Dr. Morgenthau war schon ein alter Mann, inzwischen musste er weit über 80 sein. Neulich hatte sie in der Zeitung gelesen, dass er sich zur Ruhe setzen und seinem Sohn die Stiftung überlassen wollte. Das brachte die Gerüchteküche zum Brodeln, denn über diesen Sohn war bislang so gut wie nichts bekannt. Viele mutmaßten, dass er ein Karrieremacher sei, der seinem Vater nicht das Wasser reichen konnte. Es war schwer einzuschätzen, ob an diesen Gerüchten etwas dran war. Aber zumindest vom Namen her brauchte sich niemand umzustellen, denn der Sohn hieß Dr. Philip Morgenthau junior. Ein Umstand, durch den der alte Mann zumindest in Mirjas Augen einige Sympathien eingebüßt hatte. Wenn jemand seinem Kind nicht einmal einen eigenen Namen zugestand, war die Gefahr recht groß, dass er auch Schwierigkeiten hatte, ihm ein selbstständiges Leben zu gestatten.
Während Mirja gedankenversunken ihren Blick über das herrliche Panorama schweifen ließ, bemerkte sie eine Gruppe von Menschen, die sich bei einem der älteren barackenähnlichen Gebäude hinter der Villa versammelt hatten. Die Leute trugen blaue Uniformen und schienen aufgeregt miteinander zu diskutieren.
„Was ist denn da hinten los?“
Jennifer trat neben sie. „Wo?“
„Dort drüben bei den Baracken.“
Jennifer warf nur einen flüchtigen Blick in die gewiesene Richtung. „Die Gebäude gehören zum ältesten Teil der Anlage. Sie werden demnächst renoviert.“
„Die Leute sehen aber nicht wie Bauarbeiter aus!“
„Noch wird nicht gebaut. Die meisten Baracken stehen leer, einige werden als Lager genutzt und einige wenige auch als notdürftige Quarantänestationen. Die Männer dort unten gehören zum Personal. Vielleicht hat sich wieder ein Tier in die Kanalisation geschlichen.“ Sie kicherte. „Vor einigen Wochen hatte sich eine Anakonda in den Abwasserrohren versteckt. Es hat drei Tage gedauert, bis die das Biest endlich gefunden hatten. Die meisten Praktikanten fanden das allerdings gar nicht witzig. Einige meiner Kommilitoninnen hatten schon Verstopfung.“
Mirja runzelte die Stirn. „Warum befinden sich die Quarantänestationen bei den alten Baracken?“
„In der Klinik werden nur die akuten Fälle versorgt“, sagte Jennifer. „Für die chronischen Verläufe ist dort nicht genug Platz. Im Gegensatz zu den ärmlichen Hütten, in denen unsere Patienten üblicherweise hausen, sind die Baracken reinste Luxusappartements. Komm“, sie legte Mirja die Hand auf die Schulter, „ich zeige dir unsere Unterkünfte.“
Es nieselte nur noch ein wenig, als sie zu einigen Nebengebäuden gingen und diese betraten. Reggaeklänge hallten durch das Treppenhaus. Jennifer führte sie in den ersten Stock. Als sie die Tür zur ersten Wohnung öffnete, drang Mirja der Geruch von gebratenen Zwiebeln in die Nase.
„Hier ist unser Zuhause. Es gibt drei Zimmer mit jeweils zwei Bewohnern, ein Bad, eine Gemeinschaftsküche und ein Wohnzimmer.“
„Hey, das klingt ja richtig familiär!“
„Warte mal, bist du Spüldienst hattest! Wir teilen uns die Bude mit zwei Mädchen, die ich noch nie gesehen habe, weil sie sich auf einer monatelangen Projektreise befinden“, sie wies auf eine verschlossene Zimmertür, „und zwei Jungs, die ständig Hunger haben.“ Jennifer deutete auf die offene Küchentür. Am Herd stand ein dunkelhaariger junger Mann mit kurzen Shorts und nacktem Oberkörper. Er briet irgendetwas in einer riesigen Pfanne. Unter seiner braunen Haut zeichneten sich klar definierte Muskeln ab.
„Hi Manuel“, sagte Jennifer. „Das ist Mirja.“
„Hi!“, rief der junge Mann ihnen über die Schulter zu. „Appetit auf Mucequa de Peixe?“ Er hielt ihnen die riesige Pfanne entgegen.
Mirja konnte jede Menge Reis, Zwiebeln und ölige Garnelen ausmachen. „Danke. Später vielleicht.“
Sie gingen an einem weiteren Zimmer vorbei. Es stand halb offen. „Der Typ am Laptop ist Pit“, erklärte Jennifer. „Sag ,guten Tag‘, Pit!“
Mirja konnte hinter dem aufgeklappten Laptop eine hohe rötliche Stirn und dünne blonde Haare ausmachen.
„Hi, ich bin Mirja.“ Sie erntete jedoch nur Schweigen.
„Mach dir nichts draus.“ Jennifer grinste. „Sobald er am Computer sitzt, ist er nicht mehr von dieser Welt. Komm, unser Zimmer liegt am Ende des Flurs.“
„Nicht schlecht!“, kommentierte Mirja, als sie die Tür öffnete. Das Zimmer musste fast 20 Quadratmeter groß sein. Jeder hatte ein Bett, einen Schreibtisch und einen großen Schrank.
„Du hast kabellose Verbindung zum Hausnetzwerk. Internet gibt es über Satellit.“
„Unglaublich.“
„Tja, du hast Glück. Das ist das coolste Studentenwohnheim der südlichen Hemisphäre.“
„Sieht ganz danach aus.“ Mirja zog sich rasch trockene Kleidung an und begann, ihre Sachen einzuräumen.
Jennifer ließ sich aufs Sofa fallen. „Hast du eigentlich einen Freund?“
Mirja warf einen Blick über die Schulter und runzelte die Stirn. „Du bist ganz schön neugierig.“
„Hey, ich studiere Biochemie. Neugier gehört bei uns zum Job dazu“, erwiderte Jennifer und lächelte unschuldig. „Also?“
Mirja wandte sich ab und blickte aus dem Fenster hinaus zum tropischen Regenwald. „Vielleicht …“, erwiderte sie schließlich.
„,Vielleicht‘? Das klingt interessant.“
Mirja reagierte nicht auf die unausgesprochene Aufforderung.
„Hey, schon gut. Ich habe verstanden“, reagierte Jennifer, ohne im mindesten beleidigt zu klingen. „Wie auch immer.“ Die junge Frau stand auf. „Nimm dich vor Manuel in Acht.“
„Was meinst du damit?“, fragte Mirja.
„Männern, die ständig Hunger haben, kann man nicht trauen.“
„Wieso? Ist er etwa Kannibale?“
„Wer weiß?!“, erwiderte Jennifer grinsend. „Ich muss jetzt zum Dienst. Genieße den Abend. Morgen früh gibt es dann die Einführungsveranstaltung für alle Neuen.“
Mirja ließ sich aufs Bett sinken. Sie war müde und gleichzeitig viel zu aufgekratzt, um an Schlafen auch nur zu denken. Noch vor einem halben Jahr war sie fest davon ausgegangen, dass sie ihr Studium an der Humboldt-Universität in Berlin beenden würde. Doch dann war sie am Salatbüfett in der Mensa irgendwie mit einer Kommilitonin ins Gespräch gekommen, die ihr von den Stipendien der Dr. Philip Morgenthau Stiftung erzählt hatte. Mirja hatte sich beworben und ein paar Gespräche geführt. Und dann war alles plötzlich ganz schnell gegangen. Innerhalb weniger Wochen hatte sie eine Zusage erhalten.
Hast du eigentlich einen Freund? Mirja starrte an die Decke. Fast zeitgleich zu ihrer Bewerbung um ein Stipendium hatte sie Julian kennengelernt – und Raven. Julian war ein toller Typ, charmant, sportlich, gut aussehend. Sie hatten sich geküsst. Aber sein Bruder Raven war etwas ganz Besonderes. Sie hatte das Gefühl, ihm vorbehaltlos vertrauen zu können. Seltsamerweise hatte genau das sie auch verunsichert … Hatte sie einen Freund?
Ein durchdringender Signalton riss sie aus ihren Gedanken. Er schwoll langsam ab und wieder an. Dann erklang aus einem unsichtbaren Lautsprecher eine Computerdurchsage: „Feueralarm, bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude!“ Sie sprang auf und eilte aus dem Zimmer. Der Geruch von verbranntem Essen stieg ihr in die Nase. Eine dichte Qualmwolke drang aus der Küche.
„Pass doch auf!“, brüllte jemand.
Durch den dichten Rauch hindurch sah Mirja ihre beiden neuen Mitbewohner. Während Manuel hustend ein Kissen auf eine qualmende Pfanne drückte, machte sich Pit hektisch am Fenster zu schaffen. Er zerrte am Griff und brüllte dem verhinderten Koch über die Schulter hinweg zu: „Nun unternimm endlich was gegen diesen verdammten Qualm!“
„Was glaubst du, was ich hier mache?!“, schrie Manuel zurück.
„Feueralarm, bitte verlassen Sie umgehend das Gebäude“, erklang es erneut aus den Lautsprechern.
Der beißende Rauch brannte in Mirjas Augen. Sie eilte an dem hustenden Manuel vorbei und stieß Pit beiseite. „Lass mich mal!“ Sie packte den Fensterhebel, drehte ihn in die andere Richtung und riss das Fenster auf. Schwülheiße Luft drang herein. Mirja wirbelte herum, riss dem verdutzten Manuel die Pfanne aus den Händen und warf sie kurzerhand nach draußen. Die qualmenden Reste landeten auf dem Rasen. Unten sammelten sich bereits die anderen Bewohner des Hauses. Alle starrten zu ihnen herauf. Männer eilten aus dem Krankenhaus. Ein Löschfahrzeug kam angebraust.
Mirja spürte eine Hand auf ihrer Schulter. Durch den langsam abziehenden Qualm erkannte sie Manuels Gesicht. Er bedachte sie mit einem seltsamen Blick. Dann blinzelte er mehrfach und krächzte: „Komm, wir verschwinden besser.“
Hustend zogen sich die drei aus der Küche zurück.
„Wie hast du das angestellt?“, fragte Mirja, als sie die Küchentür geschlossen hatten und durch den Flur eilten. „Wolltest du die Garnelen flambieren?“
„Ich … äh, hatte einen wichtigen Anruf … und da – “
„Wichtiger Anruf!“, unterbrach Pit ihn in ätzendem Tonfall. „Wahrscheinlich hat dir deine Cheerleaderfreundin wieder ihre neueste Unterwäsche gezeigt!“
„Halt die Klappe!“, entgegnete Manuel.
Sie eilten die Treppen hinunter. Die Männer der Institutsfeuerwehr kamen ihnen entgegen. „Befindet sich der Brandherd im ersten Stock?“, rief der erste.
„Äh …“ Pit warf Manuel einen raschen Blick zu. Doch der reagierte nicht.
Der Feuerwehrmann winkte ungeduldig ab. „Treten Sie zur Seite.“
„Tut uns leid, es ist nur ein Fehlalarm“, mischte sich Mirja ein. „Uns ist das Essen angebrannt.“
Der Feuerwehrmann sah sie stirnrunzelnd an. Dann sagte er: „Gut, wir überprüfen das. Sie melden sich unten beim Einsatzleiter.“
„Warum habt ihr nichts gesagt?“, zischte Mirja den beiden zu, als die Feuerwehrleute an ihnen vorbeigeeilt waren.
Manuel zuckte die Achseln. „Ist doch irgendwie ein bisschen peinlich, oder?“
Sie traten ins Freie. Um sie herum herrschte Chaos. Aufgeregte Studenten liefen durcheinander. Es waren mittlerweile bereits zwei Löschfahrzeuge und mehrere weitere Wagen vor Ort. Dutzende von Angestellten in blauen Anzügen eilten umher.
Manuel räusperte sich und spuckte auf den Boden. „Ich hätte nie gedacht, dass mein Mucequa de Peixe so wirkungsvoll sein kann.“ Er grinste schief. „Am besten, ich rede mal mit dem Einsatzleiter.“ Der junge Mann wandte sich rasch ab und ging auf eines der Löschfahrzeuge zu.
Mirja wollte ihm folgen, aber Pit legte ihr die Hand auf die Schulter. „Lass nur, er macht das schon.“
Verwundert blickte Mirja ihn an. Sein Zorn auf Manuel schien mit einem Mal verraucht zu sein. Der blasse junge Mann wirkte angespannt.
„Was ist los?“, fragte sie ihn. „Habe ich irgendetwas verpasst?“
„Nichts außer einem zu fetten Abendessen“, erwiderte Pit. Aber sein Grinsen wollte nicht so recht zu seinen weit aufgerissenen Augen passen. „Komm, wir mischen uns unter die Leute.“
Unschlüssig blickte Mirja zu den Einsatzwagen hinüber. Manuel sprach mit einem der Feuerwehrleute. Es sah nicht so aus, als würde es Ärger geben. Als sie sich wieder umdrehte, war Pit verschwunden. Unschlüssig blieb sie einen Moment stehen, dann wandte sie sich von der aufgeregten Menge ab und schlenderte langsam über das Gelände.
Die Wege waren ordentlich geharkt, der Rasen gestutzt. Ihr Blick wanderte über das gläserne Kuppeldach der Klinik. Der moderne Bau und das parkähnliche Grundstück standen in krassem Gegensatz zur wuchernden Wildnis des Regenwaldes. Vielleicht steckte auch eine gewisse Symbolik dahinter? Die Dr. Philip Morgenthau Stiftung stand für den medizinischen Fortschritt. Einstmals tödliche Krankheiten waren nun kein unentrinnbares Schicksal mehr. Alles war machbar. Mirja runzelte die Stirn. Unwillkürlich lenkte sie ihre Schritte zu den älteren Teilen der Anlage. Alles war machbar, aber schon ein kleiner Brand konnte den perfekten Ablauf durcheinanderbringen. Mirja schmunzelte. Der Mensch würde niemals alles unter Kontrolle haben. Erstaunlicherweise hatte dieser Gedanke etwas Tröstliches.
Sie ging an der Mauer entlang, die den Barackenkomplex umgab. Die Steine waren zum Teil verwittert und moosbewachsen. In die Mauerkrone hatte man Stahlpfeiler eingesetzt, zwischen die Stacheldraht gespannt war. Alles wirkte neu. Als sie weiterging, entfernte sich der Pfad von der Mauer, und sie fand sich in dichtem Dornengestrüpp wieder.
Mirja blieb stehen. Das Buschwerk schien nicht zu der gepflegten Ordnung der restlichen Grünanlage zu passen. Es war, als hätte das dunkle Herz des Dschungels seine Finger ausgestreckt, um das ihm abgerungene Gebiet zurückzuerobern.
Ein plötzliches Geräusch ließ sie zusammenzucken. Eine Glasscheibe klirrte. Hastige Schritte erklangen. Mirja warf einen Blick über die Schulter. Niemand war in der Nähe. Das Wohngebäude verdeckte die Menschenmenge.
Vorsichtig ging sie auf die Dornenhecke zu und versuchte zu erkennen, was hinter der Mauer vor sich ging. Erneut ein Geräusch, ein dumpfer Laut, gefolgt von einem halb erstickten Gurgeln. Versuchte dort jemand, um Hilfe zu schreien?
„Hallo?“, rief Mirja halblaut.
Keine Antwort, nur so etwas wie ein leises Stöhnen.
Mirja zögerte einen Moment, dann folgte sie dem Geräusch und hielt Ausschau nach einer Lücke in der dichten Hecke. Schließlich fand sie einen niedrigen Durchgang. Sie zwängte sich gebückt hindurch. Dornen zerrten an ihren Haaren und hinterließen Schrammen auf ihrer Haut. Dann war sie endlich durch. Mirja richtete sich auf – und erstarrte.
Auf der anderen Seite des Drahtzauns befand sich eine alte Baracke, deren Tür offen stand. Davor lag ein Mann in blauer Uniform reglos auf dem Boden. Einer seiner Arme war ausgestreckt, der andere verdeckte sein Gesicht.
„Hallo?“, krächzte Mirja.
Im Halbdunkel der Türöffnung bewegte sich etwas.
„Hallo, ist da jemand? Hier liegt ein Mann. Er braucht Hilfe!“, rief Mirja nun etwas lauter.
Eine Gestalt trat aus dem Dämmerlicht der Baracke.
Mirja riss erschrocken die Augen auf.
Der barfüßige Mann trug eine weite Cordhose und ein Armeehemd. Sein Bart war ungepflegt und lange Haare hingen ihm bis auf die Schultern. In seinem Blick lag etwas Wildes, etwas, das ihr Angst machte. Seine Hände waren zu Fäusten geballt.
Unwillkürlich wich Mirja einen Schritt zurück.
Zwei Atemzüge lang starrte er sie hasserfüllt an. Dann stieß er ein schrilles, abgehaktes Lachen aus.
Mirja war wie gelähmt.
Plötzlich ging ein Ruck durch den Körper des Mannes, seine angespannte Haltung erschlaffte. Ein seltsamer Ausdruck glitt über seine Züge, als würde er aus dem Schlaf erwachen.
„Wer sind Sie?“, fragte er auf Deutsch.
Mirja schluckte. Ihr Mund fühlte sich trocken an. „Ich … bin … Mein Name ist Mirja Roth … ich bin Praktikantin hier im Institut. Sie müssen einen Arzt holen. Der Mann braucht Hilfe.“
Der Angesprochene schien durch sie hindurchzusehen. Dann senkte er den Blick. Erst jetzt schien er den Bewusstlosen zu bemerken. Wie in Trance kniete er nieder und kontrollierte den Puls des Mannes.
„Bleiben Sie ganz ruhig“, sagte er tonlos. „Ich … bin Arzt.“
Dornen kratzten ihr über ihre Wange, als Mirja durch die Hecke zurückkroch. Sie glaubte ihren wummernden Herzschlag zu hören, als sie über die gepflegten Pfade zurück zum Wohnheim eilte, um Hilfe zu holen.
Kapitel 4
Berlin, Mai 2024
Ein sanfter Wind fuhr durch die hohen Alleebäume und ließ die Schatten auf dem gepflasterten Gehweg tanzen. Raven hielt den Blick gesenkt. Er beobachtet Sie, hallte die Stimme der alten Frau in ihm wider, und er sah ihre Augen vor sich, wach und klar, wie es nur in seltenen Augenblicken vorkam.
Zorn stieg in ihm auf. Er hatte schon mit seinen eigenen Ängsten zu kämpfen. Wenn er sich jetzt noch von den Fantasien einer demenzkranken Frau aus der Fassung bringen ließ, würde er bald wieder in der Klinik landen.
Vor einem zweistöckigen Einfamilienhaus blieb Raven stehen. Er verdrängte alle Gedanken an die alte Dame.
„Rita, Julian und Raven Adam“ stand auf dem Klingelschild. Es war aus Sperrholz ausgesägt und bunt bemalt, der Lack an einigen Stellen abgeplatzt. Früher hatte auch „Jochen“ auf dem Schild gestanden. Aber Ma hatte Papas Namen schon vor zehn Jahren mit einer gelben Sonnenblume übermalt, kurz nachdem er ausgezogen war. Sonne und Regen hatten die Farben schon lange ausgebleicht. Vor mehr als zwei Monaten war Raven das letzte Mal hier gewesen. Es kam ihm so vor, als würde der Kragen seines Hemdes langsam enger werden. Er öffnete zwei Knöpfe, dann klingelte er und trat in den Vorgarten. In den Beeten blühten rote und weiße Blumen. Es war beinahe wie früher – nur das Leben hatte sich davongeschlichen.
Die Tür wurde langsam geöffnet. „Hallo, Ma.“
„Hallo.“ Ihr Gesicht war gebräunt, die Haare rot gefärbt. Sie verzog die Lippen zu einem schmalen Lächeln, doch sie sah ihn nicht an. „Das Paket steht in Julians Zimmer.“
„Okay.“ Raven wandte den Blick ab und stieg die Treppe hinauf. Julians Zimmer. Obwohl Julian der Ältere und nach Aussage aller, die er kannte, auch Reifere von beiden gewesen war, hatte er immer noch zu Hause gewohnt. Raven hingegen hatte sich schon während des Abiturs auf seinen Umzug ins Studentenwohnheim gefreut. Er hatte zunächst Jura studiert wie sein Vater, doch schon nach einem Semester war er auf Soziologie umgestiegen.
Zögerlich betrat er im ersten Stock das Zimmer seines verstorbenen Bruders. Licht fiel durch die Dachfenster. Ravens Blick huschte über die Klettergriffe an den Dachbalken und das Laufband neben dem Bett. Julian war gut gewesen, besser als Raven, vielleicht der beste Freerunner der Stadt. Seine Videos hatten in der Szene Kultstatus gehabt. So war auch die Agentur auf ihn aufmerksam geworden, die für ein groß angelegtes deutsch-amerikanisches Filmprojekt Stuntleute gesucht hatte, die in der Lage waren, atemberaubende Actionszenen zu liefern. Man wollte so weit wie möglich auf Computeranimation verzichten. Und Julian hatte zu den wenigen Auserwählten gehört, denen man diesen Job zutraute. Ein letztes spektakuläres Bewerbungsvideo sollte dafür sorgen, dass man sich für ihn entschied. Anfangs schien Julian begeistert gewesen zu sein, doch dann hatte sich etwas verändert. Er war nicht mehr bei der Sache gewesen. Raven seufzte. Wenn er sich doch nur erinnern könnte, was damals vorgefallen war!
Das Paket lag auf dem Boden. Jemand hatte es hastig neben dem Schreibtisch und der mit Fotos übersäten Wand abgestellt. Raven holte das Taschenmesser aus Julians Schublade. Er kannte sich in diesem Zimmer genauso gut aus wie in seiner eigenen Wohnung. Sie hatten fast alles miteinander geteilt – doch ihre intimsten Gedanken hatten sie einander offenbar nicht verraten. Julian hatte nie darüber gesprochen, was ihn bedrückte, und Raven? Raven hatte nie verraten, dass sie in dieselbe Frau verliebt gewesen waren.
Er öffnete das Paket und nahm das zerknüllte Papier heraus, mit dem es ausgepolstert war. Behutsam legte er die Videokamera und die alte Taschenuhr beiseite und fischte Julians Smartphone heraus. Das Display hatte einen Sprung, und die Rückwand war zum Teil zersplittert. Jemand hatte Tesafilm darum gewickelt. Als Raven ihn löste, fiel die Rückwand samt Akku zu Boden. Julian hatte sein Smartphone geliebt, die Kamera machte hervorragende Bilder, und etliche der kleinen Videos im Internet waren mit diesem Gerät aufgenommen worden.
Das Gehäuse knirschte leise. Erst jetzt fiel Raven auf, wie fest er es umklammert hielt. Er löste seinen Griff – und stutzte. Irgendetwas stimmte nicht. Zuerst kam er nicht drauf. Natürlich war das Gerät defekt, aber das war es nicht, was ihn irritierte. Auch die SIM-Karte steckte noch an Ort und Stelle, aber die Speicherkarte fehlte. Julian hatte das Gerät erst wenige Wochen vor dem Unfall aufgerüstet. War sie beim Sturz verloren gegangen? Durchaus denkbar, aber unwahrscheinlich. Julian hatte das Smartphone in der Hosentasche getragen.
Raven nahm die Liste zur Hand, die dem Paket beigefügt war. Seltsam, eine Speicherkarte war darauf nicht erwähnt. Hatte man sie übersehen? Oder hatte Julian sie zuvor selbst entfernt?
Raven nahm die Videokamera zur Hand und klappte das Display auf. Er war nicht dabei gewesen, als der Film im Gerichtssaal abgespielt worden war. Behutsam berührte sein Finger den Startknopf.
Julian grinste in die Kamera und ließ die Arme kreisen. Im Hintergrund spiegelte sich die Sonne auf der Glaskuppel des Fernsehturms. Das Licht bildete ein Kreuz.
„Bist du bereit?“, hörte Raven sich sagen.
„Immer bereit!“, alberte Julian und hob die Hand zum Pioniergruß.
„Ladies and Gentlemen, hier kommt er: der unglaubliche Ulk, Dr. Jekyll und Mr Hype, der Spiderman von Berlin!“
Julian verdrehte die Augen.
„An diesem unglaublichen Mittwoch, dem 27. September – “
„Halt endlich die Klappe!“, unterbrach Julian ihn. Er blinzelte in das Licht der tief stehenden Sonne. „Außerdem ist heute der 26. September.“
Raven hielt die Aufnahme an. Das Datum! Irgendetwas daran war wichtig! Aber was? Er presste die Finger gegen seine Schläfen. Wenn doch nur diese verdammte Leere in seinem Kopf nicht wäre! Nach kurzem Zögern drückte er erneut den Startknopf und ließ den Film weiterlaufen. Sein eigenes Lachen drang ihm aus den Lautsprechern entgegen.
„Nervös?“
Julian schüttelte stumm den Kopf und kletterte auf die Mauer, die das Parkdeck umgab. Der Sprung auf das Nachbargebäude war nicht weit, zumindest nicht für jemanden mit Julians Fähigkeiten.
„Okay, Spiderman, noch ’nen Spruch für die Leute an den Bildschirmen?“
Julian setzte zum Sprung an. Im letzten Moment wandte er sich noch einmal der Kamera zu. Es sah aus, als wolle er etwas erwidern.
Erneut drückte Raven die Pausentaste. Sein Herz hämmerte gegen seine Brust. Tausende Male hatte Raven versucht, sich in Erinnerung zu rufen, was in den wenigen Sekunden danach geschehen war. Aber er sah nur einen hellen Blitz und weißes Rauschen. Ein weiteres Mal drückte er die Playtaste.
Julian blickte ihn an, sein Gesichtsausdruck veränderte sich, dann verschwand er aus dem Bild. Die Kamera verlor den Fokus. Ein Schrei erklang: „JULIAN!“ Die Betonmauer huschte vorbei, dann schlug die Kamera auf dem kiesbedeckten Boden des Parkhausdaches auf. Der Bildschirm wurde schwarz.
Sie war immer da. Sie lauerte wie ein Dämon in seinem eigenen Schatten, und jedes Mal, wenn er versuchte, sich den schrecklichsten Sekunden seines Lebens zu nähern, sprang sie ihn an, vergiftete seine Seele und blockierte sein Denken. Ravens Herz trommelte. Er zwang sich, die Augen zu schließen und sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Tief einatmen, langsam ausatmen. Er stellte sich vor, die Luft wäre wie ein blauer Strom perlenden Wassers, das sich sanft über ihn ergoss. Ganz langsam löste sich die Panik.
Raven schlug die Augen wieder auf und legte die Kamera beiseite. Im selben Moment kam ihm ein Gedanke. Der 27. September 2023 – Julian hatte ein paar Wochen vor dem schrecklichen Unfall von diesem Termin gesprochen. Er hatte ein Flugticket für diesen Tag gebucht.
Abrupt wandte Raven sich der Fotowand zu. Auf etlichen Bildern war Raven selbst zu sehen, Arm in Arm mit seinem Bruder und Freunden aus der Freerunner-Szene. Die lächelnden Gesichter von damals waren heute nur schwer zu ertragen.
Er wusste, dass dort noch ein anderes Bild gehangen hatte. Es zeigte ein paar übernächtigte Studenten, die auf der Betonplattform des Kletterfelsens auf dem Teufelsberg saßen und den Sonnenaufgang über dem Grunewald in Berlin betrachteten. Es konnte nicht fort sein.
Raven krabbelte suchend über das unter der Pinnwand stehende Bett, zog die Decke beiseite. Schließlich hob er die Matratze an. Zwischen den Lücken des Lattenrostes sah er auf dem staubbedeckten Teppich etwas Weißes schimmern. Er hob den Sprungrahmen an und fischte ein zerknittertes Foto vom Boden. Ein paar junge Menschen lächelten müde in die Kamera. Unter ihnen ein Mädchen mit zerzausten blonden Haaren, das am eisernen Gipfelkreuz lehnte – Mirja. Vorsichtig wischte Raven den Staub von der Aufnahme. Sie hatten sich mit ein paar Freunden zum Klettern verabredet. Es war spät geworden. Aus einer Laune heraus hatten sie beschlossen, die Nacht durchzumachen. Zwei Decken und ein paar Flaschen Rotwein hatten ihnen geholfen, sich bis zum Morgen warm zu halten. Sie hatten geredet, stundenlang. In jener Nacht hatte Raven sich verliebt, und er hatte das Gefühl gehabt, als wäre es ihr ähnlich ergangen. Doch dann war alles ganz anders gekommen. Gegen Julians Charme hatte er einfach keine Chance gehabt. Er sah es heute noch vor sich, als wäre es erst gestern gewesen: Auf dem Flughafen, vor ihrer Abreise nach Amerika, hatte Julian die Arme um Mirjas Nacken geschlungen und sie geküsst.
Raven steckte das Foto in die Hosentasche.
Das Studium in Amerika hatte Mirja sehr in Anspruch genommen. Und irgendwann hatte sie sich nicht mehr gemeldet. Auch Julian hatte nur noch selten von ihr gesprochen. Es wäre nicht die erste Fernbeziehung gewesen, die kläglich scheiterte. Dann hatte Julian jedoch im August kurz erwähnt, dass er Flugtickets besorgt hatte, um Mirja zu besuchen.
Raven war über diese Entscheidung völlig verwundert gewesen. Doch Julian hatte seine Fragen nur einsilbig beantwortet. Kurz darauf war jedoch die Anfrage der Agentur erfolgt und hatte alles andere verdrängt.
Eigentlich hätte noch mindestens ein weiteres Foto von Mirja an der Wand hängen müssen. Raven suchte unter dem Bett danach, konnte es aber nicht finden. Hatte Julian es abgenommen?
Vielleicht hatte es Streit gegeben? Oder hatte Julian den Flug wegen des Filmprojekts storniert? Das wäre durchaus möglich. Doch warum konnte Raven das Gefühl nicht abschütteln, dass es ganz anders gewesen war?
Er öffnete die Schreibtischschublade und nahm den Tablet-PC seines Bruders heraus. Der Akku war leer. Er steckte das Ladekabel ein, wartete einen Augenblick und startete dann den Computer. Zuerst sah er die E-Mails und die Facebook-Kontakte seines Bruders aus dem August und September des letzten Jahres durch. Mirjas Name tauchte dabei nicht auf. Raven ging noch einige Wochen weiter zurück und fand lediglich drei E-Mails von [email protected]. In der ersten berichtete Mirja überschwänglich und fröhlich von ihrer Ankunft in Ohio. Ihre nächste E-Mail war einen Monat später eingetroffen. Sie schrieb darin, dass sie sich um Praktikumsplätze bemühen wollte. Etwa sechs Wochen später berichtete sie, dass sie einen anderen kennengelernt hatte und den Kontakt zu Julian abbrechen würde.
Seltsam, Julian hatte das Flugticket erst mehrere Wochen darauf gebucht. Aber warum? Er war nicht der Typ gewesen, der einer Frau hinterherrannte, wenn sie nichts mehr von ihm wissen wollte. Irgendwie passte das alles nicht zusammen.
„Ma?“ Raven lief die Treppe hinunter. Seine Mutter stand in der Küche, einen Lappen in der Hand, und starrte aus dem Fenster.
„Ma!“
„Der Rasen müsste mal gemäht werden.“
„Ich kann das machen“, bot Raven rasch an.
„Früher musste ich nie etwas sagen.“ Sie seufzte. „Er hat immer von selbst an solche Dinge gedacht.“
Raven spürte, wie seine Kehle sich zuschnürte. Er trat auf seine Mutter zu. Ich sollte sie trösten, irgendwie. Er hob die Hand, um sie auf die Schulter seiner Mutter zu legen, dann ließ er sie wieder sinken.
„Hat Julian dir eigentlich erzählt, warum er Mirja besuchen wollte?“
„Mirja?“, murmelte sie verständnislos.
„Seine Freundin. Die beiden haben sich ein Dreivierteljahr vor seinem … Unfall kennengelernt. Er wollte sie in Amerika besuchen …“
Abrupt wandte sie sich um. „Warum erzählst du solche Sachen?“ Sie blickte ihm forschend ins Gesicht. „Nimmst du regelmäßig deine Medikamente?“
Was sollte denn diese Frage? Raven verzog das Gesicht. „Natürlich“, erwiderte er. „In Julians Zimmer hingen Fotos von Mirja, und für den 27. September hatte er sich ein Flugticket besorgt – “
„Julian hätte mir erzählt, wenn er eine neue Freundin gehabt hätte!“, unterbrach ihn seine Mutter barsch. „Und er wollte nicht nach Amerika. Er wollte an diesem Filmprojekt teilnehmen. Das weißt du doch besser als ich. Schließlich hast du ihn dazu überredet.“
Raven starrte seine Mutter an. Ich habe ihn nicht überredet, wollte er erwidern. Aber er wusste, dass das nichts ändern würde.
„Ich mähe gleich den Rasen“, sagte er. Dann wandte er sich um und lief hinauf in Julians Zimmer. Sein Bruder hatte zu Hause nichts von Mirja erzählt – das erschien Raven nicht ungewöhnlich. Aber warum hatte er den geplanten Flug verschwiegen?
Julian hatte eine externe Festplatte besessen, auf der er alle wichtigen Daten gespeichert hatte. Raven fischte den Schlüssel aus dem Becher neben der Leselampe, um den Schreibtischcontainer aufzuschließen. Doch das war gar nicht nötig. Der kleine Schrank war offen. Etwas irritiert holte Raven die Festplatte heraus und schloss sie an. Es dauerte einen Augenblick, bis das Tablet das Gerät erkannt hatte. Schließlich meldete es, dass das Speichermedium keine Dateien enthalte, und bot an, es zu formatieren.
Verwirrt runzelte Raven die Stirn. Das konnte nicht sein. Julian hatte auf dieser Festplatte alle seine Filme und die wichtigen Daten gesichert. Er hatte sich extra ein Gerät mit Doppel-Backup besorgt, das sämtliche Daten auf einer zweiten Festplatte spiegelte, sodass selbst für den Fall, dass eine der Festplatten beschädigt wurde, nichts verloren ging. Hatte Julian die Daten selbst gelöscht? Nein, das war absurd. Selbst wenn er irgendetwas zu verbergen gehabt hätte: Auf der Festplatte hatten sich unzählige Filme befunden, die Julians Entwicklung zum besten Freerunner der Stadt dokumentierten – warum hätte Julian diese ebenfalls löschen sollen? Als Raven die Festplatte in die Schublade zurücklegen wollte, fiel ihm etwas auf: An der Stelle, an der der Riegel des einfachen Schlosses einrastete, war der Lack zerkratzt. Hatte jemand das Schränkchen mit Gewalt geöffnet?
Langsam stieg er die Stufen hinab ins Erdgeschoss. „Ma?“
„Der Rasenmäher steht im Schuppen.“
„Als die Polizei hier war … hat sie da auch Julians Schreibtischschrank geöffnet?“
„Raven, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du diese Ereignisse jetzt ruhen lassen könntest.“
„Bitte.“
Sie seufzte. „Die Polizei hat einen Blick in seinen Computer geworfen und ein paar Daten kopiert. Am Schreibtischschrank waren sie nicht.“
„Bist du sicher?“
„Ich war die ganze Zeit dabei.“ Sie sah ihn stirnrunzelnd an. „Warum willst du das wissen?“
Raven wich ihrem Blick aus. „Ich geh dann mal den Rasen mähen.“
Der Schlüssel zum Schuppen lag wie üblich auf dem Regal neben der Terrassentür. Der Geruch nach frisch gemähtem Gras stieg Raven in die Nase, als er kurz darauf seine Bahnen zog. Seit einem Dreivierteljahr versuchte er, sich einzureden, dass alles ein Unfall gewesen war, unglückliche Umstände, für die niemand etwas konnte.
Doch wenn er ehrlich war, hatte er das nie geglaubt.
Was hatte Julian dort auf dem Dach so sehr aus dem Konzept gebracht, dass er abgestürzt war?
Das Verschwinden der Speicherkarte und die gelöschte Festplatte verstärkten das Gefühl, dass Julian ein Geheimnis gehabt hatte. Möglicherweise ein Geheimnis, das ihn das Leben gekostet hatte?
Raven schaltete den Motor aus und leerte den vollen Auffangkorb des Rasenmähers. Es gab nur einen Menschen, der ihm hier weiterhelfen konnte. Es war ein alter Klassenkamerad von Julian, ein ziemlich schräger Typ. Aber vermutlich war das nicht anders zu erwarten bei jemandem, der den ganzen Tag allein vor dem Computer verbrachte.
Der Abend dämmerte bereits, als Raven die Treppe der U-Bahnstation Rathaus Neukölln nach oben stieg. Der Geruch nach Dieselabgasen und Fischbrötchen stieg ihm in die Nase, als er die Karl-Marx-Straße Richtung Rollberg-Viertel entlanglief. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit war diese Gegend für ihre kriminellen Familienclans berühmt-berüchtigt gewesen. Inzwischen hatte sich die Gegend unweit der Karl-Marx-Straße jedoch zu einem der unzähligen hippen Szenekieze Berlins entwickelt, und die stetig steigenden Mieten verdrängten viele der ursprünglichen Anwohner. Alles wurde teurer und – zumindest dem Anschein nach – friedlicher.
Michel Hainke, der im Netz nur unter dem Namen Captain Kraut bekannt war, hatte Julians Website programmiert und dafür gesorgt, dass dessen Filme im Netz kursierten. Wenn jemand mehr über die seltsamen Ereignisse vor dem Unfall wusste, dann er. Bislang hatte er allerdings auf keine von Ravens Messages geantwortet. Vielleicht hatte er Angst?
Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden: Raven musste ihm im Real Life einen Besuch abstatten.
Der schmucke Altbau war frisch saniert, und die Fassade glänzte in blendendem Weiß. Raven studierte die Namen auf den Klingelschildern. Der alte Hacker wohnte im zweiten Hinterhaus. Niemand reagierte auf sein Klingeln. Achselzuckend läutete Raven in einem der oberen Stockwerke im Vorderhaus.
„Ja, wer ist da?“, quäkte es aus dem Lautsprecher.
„Hermes-Versand!“, nuschelte Raven, und der Summer ertönte. Als er durch das Tor in den zweiten Hinterhof ging, schien er gleichzeitig in eine andere Welt zu treten. Das Pflaster im Hof stammte wahrscheinlich noch aus Kaisers Zeiten. Die Fassade des zweiten Hinterhauses war eine Katastrophe. An weiten Stellen fehlte der Putz vollständig. Hier und da entdeckte Raven Löcher im Mauerwerk, die verdächtig nach Einschusslöchern aussahen und dem Zustand des Gebäudes nach noch aus dem Zweiten Weltkrieg stammen mussten. Ein Teil des Hauses war eingerüstet. Aber den zerrissenen Plastikplanen und dem Taubendreck nach zu urteilen, schien auch dieses Gerüst schon eine ganze Weile dort zu stehen.
Raven ging zur Eingangstür. Sie war verschlossen.
„Da wernse keen Glück haben“, erklang eine heisere Stimme hinter ihm.
Er fuhr herum. Im ersten Stock lehnte eine alte Frau am Küchenfenster und betrachtete ihn interessiert. „Da is immer abjeschlossen. Wat suchen Se denn?“
„Ich möchte einen alten Freund besuchen.“
„Wenn Ihr Freund nicht gerade Rudi die Ratte ist, kommen Se zu spät.“ Die Alte grinste und zeigte dabei übergroße dritte Zähne. „Da wohnt keena mehr.“
„Sind Sie sich sicher?“
„Na ja, wenn Se jenau hinkieken, sehn Se dit selber. Dit sollte hier allet grundsaniert werden. Die meisten Mieter sind vor ’nem Jahr ausjezogen, die letzten ’n paar Monate später. Aber seitdem ist nischt passiert. Nu gammelt die Bude vor sich hin, und die Ratten tummeln sich bei uns.“ Sie winkte ab.
„Mein Freund heißt Michel Hainke …“
„Ach, so ’n Dicker mit ’ner verfilzten Haarmatte?“, unterbrach die Alte ihn.
„Ja. Hat er mal mit Ihnen gesprochen? Wissen Sie, wo er hingezogen ist?“
„Keene Ahnung, wo der hin is. War wohl einer der Letzten, der weg is.“
Vielleicht vor einem Dreivierteljahr?, ging es Raven durch den Kopf. „Im September?“, hakte er nach.
Die Frau kniff die Augen zusammen und nickte. „Könnte hinkomm.“
Raven wusste, dass all das wahrscheinlich bloß Zufall war, und dennoch … „Haben Sie denn gesehen, wie er umgezogen ist?“
„Nee.“ Die Alte schüttelte den Kopf. „Aber so wie der immer rumjelaufen is, kann er nich viel jehabt ham. Zwee T-Shirts und ’ne Hose – hat wahrscheinlich allet in eenen Karton jepasst.“ Sie grinste.
„Vielleicht“, murmelte Raven. „Wo hat er denn gewohnt?“
„Viertet OG links. Aber wat spielt dit jetz noch für ’ne Geige?“
Gute Frage, dachte Raven. Er zuckte die Achseln. „Wie es aussieht, habe ich Pech gehabt.“ Dann nickte er ihr zu und wandte sich zum Gehen. „Tschüss und vielen Dank.“
„Keen Problem“, erwiderte die Alte.
Im vorderen Hof nahm Raven einen Kiesel aus einem der Blumenkübel. Er passte genau ins Schließblech der Eingangstür. Als diese ins Schloss fiel, klackte es zwar, aber die Türfalle konnte nicht einrasten.
Raven nickte zufrieden und schlenderte gemächlich zurück in Richtung U-Bahnhof. Auch wenn seine Zeit als Freerunner inzwischen zu einem anderen Leben zu gehören schien, ein paar Tricks hatte er doch noch drauf.
Kapitel 5
Brasilien, Bundesstaat Pará, Mai 2023
Setzen Sie sich.“ Die Frau wies auf eine Sitzecke neben dem Schreibtisch. „Möchten Sie etwas trinken?“
Mirja nickte. „Ein Wasser, bitte.“
Die Frau in dem dunkelblauen Businesskostüm goss etwas Mineralwasser in ein Glas. Dann setzte sie sich Mirja gegenüber und schlug die schlanken Beine übereinander. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem strengen Knoten gebunden. Auf ihrem kleinen Namensschild mit dem Logo der Dr. Philip Morgenthau Stiftung stand E. Stone – Chief Security Officer.
„Wie geht es Ihnen, Miss Roth?“ Die Leiterin des Sicherheitsdienstes sprach reinstes Oxford-Englisch, und ihr Teint war trotz der dunklen Haare eher blass. Sie hätte auch in die Chefetage eines Londoner Bankhauses gepasst.
Mirja nahm einen Schluck Wasser. „Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, Mrs Stone.“
Die Frau lächelte. „Ich bin nicht verheiratet.“ Sie war sehr gut aussehend.
Ihr Alter war schwer zu schätzen, sie konnte genauso gut Anfang wie auch Ende dreißig sein. „Es ist Ihr erster Tag, nicht wahr?“
Mirja nickte.
„Und am ersten Tag erleben Sie gleich einen Feueralarm und einen Unfall auf der Quarantänestation – wen würde das nicht verunsichern? Wie kommt es überhaupt, dass Sie den bewusstlosen Mitarbeiter entdeckt haben?“
„Ich ging in der Nähe spazieren und hörte dann Hilferufe. Da habe ich natürlich nachgesehen.“
„Sie sind durch die Dornenhecke gekrochen?“
„Ja.“
„Wäre es nicht einfacher gewesen, gleich Hilfe zu holen?“
„Zu diesem Zeitpunkt wusste ich doch gar nicht, was vorgefallen war. Außerdem waren alle mit dem Feueralarm beschäftigt.“
„Ja, der Feueralarm …“ Die Frau machte sich eine Notiz. „Alle waren in heller Aufregung, und Sie gingen währenddessen spazieren?“
Mirja fühlte sich unbehaglich. So wie Miss Stone es formulierte, klang ihr Verhalten auf einmal verdächtig – was auch immer das in diesem Zusammenhang bedeuten mochte.
„Ich … mag große Menschenmengen nicht besonders“, erwiderte Mirja nach kurzem Zögern. „Außerdem wusste ich ja, dass der Alarm nur durch ein paar verkohlte Garnelen ausgelöst worden war.“
Die Sicherheitschefin nickte. „Richtig. Das war in Ihrer Küche passiert, nicht wahr?“
Mirja schluckte. „Einer meiner Mitbewohner hatte seine Pfanne wohl zu lange unbeaufsichtigt gelassen.“
Miss Stone sah sie schweigend an. Mirja erwiderte ihren Blick, aber irgendwann spürte sie, wie die Röte ihr ins Gesicht stieg. Dabei hatte sie doch gar nichts falsch gemacht.
Schließlich lehnte sich die Frau in ihrem Stuhl zurück. Ihr Gesichtsausdruck hatte jetzt jede Strenge verloren. „Bitte entschuldigen Sie, Miss Roth. Ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen bedankt. Der Mitarbeiter, den Sie gefunden haben, hatte einen anaphylaktischen Schock. Durch Ihr rasches Eingreifen haben Sie ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Wir konnten seinen Zustand stabilisieren, und er ist wieder bei Bewusstsein.“
„Einen anaphylaktischen Schock?“
„Vermutlich Avicularia purpurea“, erwiderte Miss Stone. „Er hatte eine Bisswunde am Unterarm.“ Als sie Mirjas fragenden Blick sah, erklärte sie: „Eine Vogelspinnenart. Die Bisse sind für den Menschen zwar schmerzhaft, aber eigentlich nicht gefährlich, es sei denn, es kommt wie bei unserem Mitarbeiter zu einer allergischen Reaktion. Das Tier hatte sich im Lager versteckt, und als der Kollege dort einen Wasserkasten holen wollte, erwischte es ihn. Er schaffte es noch bis vor die Tür, dann brach er zusammen. Hätten Sie ihn dort nicht gefunden …“ Sie ließ den Satz unbeendet.
„Da war noch ein anderer Mann …“, sagte Mirja. „Er behauptete, er sei Arzt …“
Miss Stone lächelte. „Ich fürchte, wir sind Ihnen da noch eine Erklärung schuldig. Der Mann, den Sie gesehen haben, ist tatsächlich Arzt. Oder zumindest war