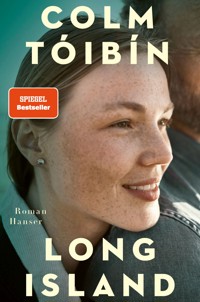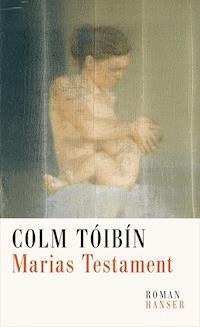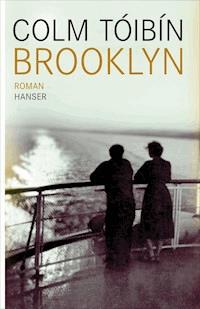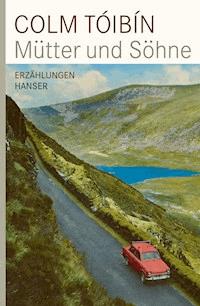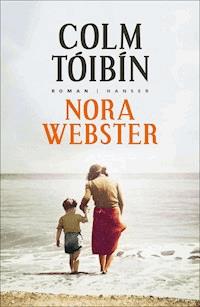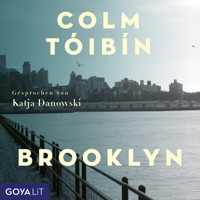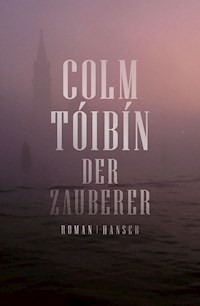
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Feinfühlig, vorurteilslos, unterhaltsam – Colm Tóibíns neuer großer Roman über Thomas Mann
Ein literarisches Ereignis. Colm Tóibín erzählt mit einmaliger Empathie das Leben von Thomas Mann als Roman. Von der Kindheit in Lübeck bis zur Heirat in München, von der Gegnerschaft gegen die Nazis bis zum amerikanischen Exil. Wie viele Gesichter hatte der weltberühmte Autor und Familienvater, der sein Gefühlsleben verborgen hielt, zerrissen zwischen homosexuellem Begehren und familiärem Pflichtgefühl, zwischen der Wonne der Bürgerlichkeit und der künstlerischen Askese? Selten wurde so feinfühlig, vorurteilslos und mit frappierender Leichtigkeit über den legendären Schriftsteller und seine schillernde Familie geschrieben. Ein Künstlerroman, wie man ihn in Deutschland noch nie gelesen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 781
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Feinfühlig, vorurteilslos, unterhaltsam — Colm Tóibíns neuer großer Roman über Thomas MannEin literarisches Ereignis. Colm Toibin erzählt mit einmaliger Empathie das Leben von Thomas Mann als Roman. Von der Kindheit in Lübeck bis zur Heirat in München, von der Gegnerschaft gegen die Nazis bis zum amerikanischen Exil. Wie viele Gesichter hatte der weltberühmte Autor und Familienvater, der sein Gefühlsleben verborgen hielt, zerrissen zwischen homosexuellem Begehren und familiärem Pflichtgefühl, zwischen der Wonne der Bürgerlichkeit und der künstlerischen Askese? Selten wurde so feinfühlig, vorurteilslos und mit frappierender Leichtigkeit über den legendären Schriftsteller und seine schillernde Familie geschrieben. Ein Künstlerroman, wie man ihn in Deutschland noch nie gelesen hat.
Colm Tóibín
Der Zauberer
Roman
Aus dem Englischen von Giovanni Bandini
Carl Hanser Verlag
Der Zauberer
Erstes Kapitel
Lübeck 1891
Seine Mutter wartete oben, während die Dienstboten den Gästen Mäntel, Shawls und Hüte abnahmen. Bis alle in den Salon geleitet worden waren, blieb Julia Mann in ihrem Zimmer. Thomas und sein älterer Bruder Heinrich und ihre Schwestern Lula und Carla sahen vom ersten Treppenabsatz aus zu. Bald, wussten sie, würde ihre Mutter erscheinen. Heinrich musste Carla ermahnen, still zu sein, andernfalls würde man sie alle ins Bett schicken, und sie würden den großen Augenblick verpassen. Ihr Brüderchen Viktor schlief in einem Zimmer im Obergeschoss.
Das Haar streng zurückgesteckt und mit einer farbigen Schleife zusammengebunden, trat Julia aus ihrem Schlafzimmer. Ihr Kleid war weiß, und ihre schwarzen Schuhe waren, eigens aus Mallorca bestellt, so schlicht wie Tanzschuhe.
Sie schloss sich der Gesellschaft gleichsam widerstrebend an, wobei sie den Eindruck vermittelte, noch vor Augenblicken ganz allein mit sich an einem Ort geweilt zu haben, der interessanter war als das festliche Lübeck.
Sobald sie den Salon betreten hatte, würde Julia, nach einem kurzen Blick in die Runde, unter den Gästen jemand Bestimmtes entdecken, gewöhnlich einen Mann, jemand so Fernliegendes wie Herrn Kellinghusen, einen weder jungen noch alten Mann, oder Franz Cadovius, der den Silberblick von seiner Mutter geerbt hatte, oder Amtsrichter August Leverkühn mit seinen schmalen Lippen und dem gestutzten Schnauzbart, und dieser Mann würde dann zum Brennpunkt ihrer Aufmerksamkeit werden.
Ihr Zauber rührte aus der Aura von Fremdartigkeit und Fragilität, die sie mit solchem Charme ausstrahlte.
Dennoch lag Freundlichkeit in ihren feurigen Augen, wenn sie ihren Gast nach seiner Arbeit und seiner Familie und nach seinen Plänen für den Sommer befragte, und apropos Sommer würde sie seine Meinung zum relativen Komfort verschiedener Hotels von Travemünde zu erfahren wünschen, um sich dann nach Grandhotels an entlegeneren Orten wie Trouville oder Collioure oder irgendeinem Badeort an der Adria zu erkundigen.
Und bald würde sie eine beunruhigende Frage stellen. Sie würde wissen wollen, was ihr Gegenüber von einer normalen, respektierlichen Frau aus ihrem gemeinsamen Bekanntenkreis hielt. Mitschwingen würde dabei die Andeutung, dass der Lebenswandel genannter Frau Gegenstand einiger Mutmaßungen und Meinungsverschiedenheiten unter den Bürgern der Hansestadt war. Die junge Frau Stavenhitter etwa oder Frau Mackenthun oder das alte Fräulein Distelmann. Oder irgendeine andere, noch unbedeutendere und zurückgezogener lebende Person. Und wenn ihr bestürzter Gast versicherte, er könne nur Gutes über diese Dame sagen, ja, er habe überhaupt nur das Allgemeinste über sie zu berichten, würde Thomas’ Mutter der Überzeugung Ausdruck verleihen, dass der Gegenstand ihres Gespräches ihrer wohlüberlegten Ansicht nach eine ganz wunderbare, schlicht entzückende Frau sei und Lübeck sich glücklich schätzen könne, sie zu ihren Bürgerinnen zu zählen. Dies würde sie im Tone einer Enthüllung sagen, wie etwas, das vorerst noch absolut vertraulich behandelt werden müsse, ja etwas, was bislang noch nicht einmal ihrem Gatten, dem Senator, mitgeteilt worden sei.
Am folgenden Tag würde sich herumsprechen, wie ihre Mutter sich verhalten und wessen sie namentlich Erwähnung getan hatte, bis schließlich Heinrich und Thomas durch ihre Schulkameraden davon erfahren würden, so als handelte es sich dabei um ein ganz modernes Theaterstück, frisch aus Hamburg, das gerade aufgeführt worden war.
An Abenden, an denen der Senator in einer Sitzung war, oder wenn Heinrich und Thomas, nach Beendigung ihrer Geigenübungen und ihrer Abendmahlzeit, schon in ihren Nachtkleidern steckten, erzählte ihre Mutter ihnen von ihrem Heimatland, Brasilien, einem so gewaltig großen Land, sagte sie, dass niemand wusste, wie viele Menschen dort lebten oder wie sie aussahen, oder welche Sprachen sie benutzten, einem Land, das viele Male größer als Deutschland war, in dem es keinen Winter gab und es niemals fror oder auch nur richtig kalt wurde, und in dem ein einziger Fluss, der Amazonas, mehr als zehnmal so lang und zehnmal so breit wie der Rhein war, mit vielen kleineren Nebenflüssen, die tief in den Urwald hineinreichten, mit Bäumen, die höher waren als irgendwo sonst auf der Welt, und Menschen, die niemand je gesehen hatte oder sehen würde, da sie den Urwald so gut wie niemand anderes kannten und sie sich deswegen vor jedem Eindringling oder Fremden verstecken konnten.
»Erzähl uns von den Sternen«, sagte Heinrich dann.
»Unser Haus in Paraty lag am Wasser«, erwiderte Julia dann. »Es gehörte beinah zum Wasser, wie ein Boot. Und wenn es Nacht wurde und wir die Sterne sehen konnten, waren sie strahlend hell und zum Greifen nah. Hier im Norden sind die Sterne weit oben und unscheinbar. In Brasilien sind sie so gut zu sehen wie die Sonne bei Tag. Sie sind kleine Sonnen, funkelnd und uns Menschen nah, besonders denen unter uns, die nicht weit vom Wasser wohnen. Manchmal, sagte meine Mutter, hätte man nachts in den Zimmern des Obergeschosses ein Buch lesen können, so klar war das Licht der Sterne auf dem Wasser. Und schlafen konnte man wegen der Helligkeit nur bei geschlossenen Fensterläden. Als ich ein Mädchen war, so alt wie eure Schwestern, glaubte ich wirklich, überall auf der Welt sei es so. Es war ein Schock, als ich in meiner ersten Nacht in Lübeck die Sterne nicht sehen konnte. Sie waren völlig von Wolken verdeckt.«
»Erzähl uns vom Schiff!«
»Ihr müsst jetzt schlafen.«
»Erzähl uns die Geschichte von dem ganzen Zucker!«
»Tommy, du kennst die Geschichte vom Zucker doch schon.«
»Bitte, nur noch mal ein kleines Stück!«
»Also, für das ganze Marzipan, das in Lübeck hergestellt wird, verwendet man Zucker, der aus Brasilien kommt. So wie Lübeck wegen des Marzipans berühmt ist, ist es Brasilien für seinen Zucker. Wenn also die guten Menschen von Lübeck an Heiligabend ihr Marzipan essen, verspeisen sie, ohne es zu wissen, ein Stück von Brasilien. Sie essen Zucker, der eigens für sie übers Meer kam.«
»Warum machen wir nicht unseren eigenen Zucker?«
»Das musst du deinen Vater fragen.«
Jahre später fragte sich Thomas, ob der Entschluss seines Vaters, statt der bräsigen Tochter eines der heimischen Schiffsmagnaten oder einer der alteingesessenen Kaufmanns- und Bankiersfamilien Julia da Silva-Bruhns zu ehelichen, deren Mutter dem Vernehmen nach Blut südamerikanischer Indianer in ihren Adern hatte, nicht der Beginn des Verfalls der Manns gewesen war, der Beweis dafür, dass in den Geist dieser Familie ein Hunger nach dem prächtig Fremdartigen eingedrungen war — einer Familie, die es bis dahin nur nach dem gelüstet hatte, was achtbar war und eine stetige Rendite versprach.
In der Stadt erinnerte man sich an Julia als an ein kleines Mädchen, das nach dem Tod seiner Mutter mit seiner Schwester und seinen drei Brüdern nach Lübeck gekommen war. Ein Onkel nahm sich ihrer an, und als sie zum ersten Mal in der Stadt auftauchten, sprachen die Kinder nicht ein einziges Wort Deutsch. Sie wurden von Persönlichkeiten wie der alten Frau Overbeck, die für ihr entschiedenes Festhalten an den Gebräuchen der Evangelisch-reformierten Kirche bekannt war, mit Argwohn betrachtet.
»Ich habe diese Kinder sich einmal, als sie an der Marienkirche vorbeikamen, bekreuzigen sehen«, sagte sie. »Es mag vielleicht notwendig sein, mit Brasilien Handel zu treiben, aber mir ist kein früherer Fall bekannt, dass ein Lübecker Bürger eine Brasilianerin geheiratet hätte, nicht ein einziger!«
Julia, zum Zeitpunkt ihrer Heirat erst siebzehn, gebar fünf Kinder, die sich zwar mit all der Würde betrugen, die von Kindern eines Senators zu erwarten war, gleichwohl aber auch mit einem Zusatz von Stolz und Selbstbewusstsein und noch etwas anderem, was einem Sinn für Zurschaustellung nahekam, den Lübeck noch nicht erlebt hatte und der, wie Frau Overbeck und ihr Kreis hofften, nicht in Mode kommen würde.
Infolge dieser Entscheidung, außerhalb des Üblichen zu heiraten, wurde der Senator, der übrigens elf Jahre älter als seine Frau war, mit einer gewissen ehrfürchtigen Scheu betrachtet, so als hätte er in italienische Gemälde oder seltene Majolika investiert, Dinge, die zur Befriedigung eines Geschmacks erworben wurden, den der Senator und seine Vorfahren bis dahin zu zügeln gewusst hatten.
Bevor sie am Sonntag zur Kirche aufbrachen, mussten sich die Kinder einer gründlichen Musterung durch den Vater unterziehen, während sie auf ihre Mutter warteten, die noch in ihrem Ankleidezimmer verweilte, um Hüte anzuprobieren oder ihre Schuhe zu wechseln. Heinrich und Thomas mussten ein gutes Beispiel abgeben, indem sie eine ernste Miene zur Schau trugen, während Lula und Carla versuchten stillzustehen.
Als Viktor geboren wurde, achtete Julia bereits weit weniger auf die strengen Regeln, die ihr Ehemann aufgestellt hatte. Es gefiel ihr, wenn die Mädchen bunte Schleifen und Strümpfe trugen, und sie gestattete den Jungen längeres Haar und eine größere Freiheit in ihrem Betragen.
Julia kleidete sich für den Kirchgang elegant, wobei sie oft nur eine einzige Farbe trug — zum Beispiel ein Grau oder ein dunkles Blau, mit passenden Strümpfen und Schuhen, und als einzige Auflockerung ein rotes oder gelbes Hutband. Ihr Gatte war für die gediegene Präzision seiner Kleidung bekannt, die er von einem Schneider in Hamburg anfertigen ließ, sowie für seine stets untadelige Erscheinung. Der Senator wechselte sein Hemd täglich, mitunter sogar zweimal am Tag, und er besaß eine umfangreiche Garderobe. Sein Schnurrbart war nach französischer Mode lang ausgezogen. Mit seinem anspruchsvollen Geschmack repräsentierte er die Firma in ihrer ganzen Solidität, hundert Jahre bürgerlicher Tugenden, aber in der Erlesenheit seiner Garderobe äußerte sich seine persönliche Überzeugung, dass ein Mann in Lübeck zu sein mehr als Geld oder kaufmännischen Erfolg bedeutete, es stand nicht nur für Gesetztheit, sondern auch für eine wohlüberlegte Stilsicherheit.
Zu seiner Bestürzung geschah es auf dem kurzen Weg vom Mann’schen Haus an der Beckergrube zur Marienkirche häufig, dass Julia Leute, vergnügt und ohne Scheu beim Namen rufend, grüßte — etwas, was in der Geschichte von Lübeck an einem Sonntag noch niemals vorgekommen war und Frau Overbeck und deren unverheiratete Tochter in ihrer Überzeugung bestärkte, dass Frau Mann, zumindest in ihrem Herzen, noch immer eine Katholikin war.
»Sie ist putzsüchtig und töricht, und das sind die Merkmale einer Katholikin«, sagte Frau Overbeck. »Und dieses Band an ihrem Hut ist die schiere Frivolität.«
Wenn sich dann in der Marienkirche die weitere Verwandtschaft versammelte, fiel auf, wie blass Julia war und wie seltsam verführerisch sich ihre Blässe von ihrem schweren kastanienbraunen Haar und ihren geheimnisvollen Augen abhob, die auf dem Prediger mit einem Ausdruck halb verhüllten Spotts ruhten, einem Spott, der dem Ernst, den die Familie ihres Gatten und deren Freunde der Religionsausübung angedeihen ließen, gänzlich fremd war.
*
Thomas begriff, dass es seinem Vater missfiel, wenn seine Gattin über ihre Kindheit in Brasilien sprach, insbesondere in Anwesenheit der Mädchen. Sein Vater freute sich allerdings, wenn Thomas ihn bat, vom alten Lübeck zu erzählen und zu schildern, wie das Familienunternehmen seit seinen bescheidenen Anfängen in Rostock stetig gewachsen war. Es schien seinem Vater Freude zu machen, wenn Thomas ihn auf dem Heimweg von der Schule im Kontor besuchte, sich setzte und sich anhörte, was es von Schiffen und Speichern und Finanzpartnern und Versicherungen zu berichten gab, und sich dann später an alles erinnerte, was man ihm erklärt hatte.
Selbst entferntere Verwandte gelangten mit der Zeit zu der Überzeugung, dass, während Heinrich verträumt und aufsässig wie seine Mutter war und einen Geschmack für Bücher entwickelte, der junge Thomas mit seiner wachen, ernsten Art derjenige war, der die Firma in das nächste Jahrhundert führen würde.
Als die Mädchen älter wurden, versammelten sich alle Kinder im Ankleidezimmer ihrer Mutter, wenn ihr Vater in seinen Klub oder zu einer Sitzung gegangen war, und Julia nahm ihre Geschichten über Brasilien wieder auf und erzählte, wie weiß die Kleidung war, die die Menschen dort trugen, und wie viel gewaschen werden musste, damit jeder schön und besonders aussah, die Männer ebenso wie die Frauen, die Schwarzen ebenso wie die Weißen.
»Es war nicht wie in Lübeck«, sagte sie. »Niemand hielt es für nötig, ernst und feierlich zu sein. Es gab keine Frau Overbeck, die die Lippen schürzte. Keine Familien, die wie die Esskuchens unentwegt Trauer trugen. Wenn man in Paraty drei Menschen sah, dann redete einer von ihnen und die beiden anderen lachten. Und sie waren alle in Weiß.«
»Lachten sie über einen Witz?«, fragte Heinrich.
»Sie lachten einfach. Das war eben das, was sie taten.«
»Aber worüber denn?«
»Liebling, ich weiß es nicht. Aber das taten sie nun einmal. Manchmal kann ich nachts noch immer dieses Lachen hören. Es kommt mit dem Wind heran.«
»Können wir einmal nach Brasilien fahren?«, fragte Lula.
»Ich glaube nicht, dass euer Vater möchte, dass ihr nach Brasilien fahrt«, sagte Julia.
»Aber wenn wir älter sind?«, fragte Heinrich.
»Wir können nie voraussehen, was passieren wird, wenn wir älter sind«, sagte sie. »Vielleicht werdet ihr dann überallhin fahren können. Überallhin!«
»Ich möchte lieber in Lübeck bleiben«, sagte Thomas.
»Es wird deinen Vater freuen, das zu hören«, erwiderte Julia.
*
Thomas lebte noch mehr in einer eigenen Traumwelt als sein Bruder Heinrich oder seine Mutter, oder auch seine Schwestern. Selbst seine Gespräche mit seinem Vater über Speicherhäuser waren lediglich weitere Facetten einer Fantasiewelt, in der er selbst oft als griechischer Gott auftrat oder auch als eine Gestalt aus einem Kindermärchen, oder als die Frau in dem Ölgemälde, das sein Vater im Treppenhaus aufgehängt hatte, mit dem glühenden, begierigen, erwartungsvollen Ausdruck im Gesicht. Mitunter fragte er sich, ob er nicht in Wirklichkeit älter und stärker als Heinrich war, oder ob er seinen Vater nicht tagtäglich als ein Ebenbürtiger zum Kontor begleitete, oder schließlich ob er nicht Matilde war, die für das Ankleidezimmer seiner Mutter verantwortliche Zofe, die darauf achtete, dass ihre Schuhe ordentlich paarweise standen und dass ihre Parfümflakons nie leer wurden und dass ihre geheimen Dinge in den dafür vorgesehenen Schubladen blieben, seinen neugierigen Blicken entzogen.
Wenn er die Leute sagen hörte, er sei derjenige, der es in der Geschäftswelt zu Ansehen bringen würde, wenn er Besucher mit seinem Wissen über anstehende Lieferungen beeindruckte und die Namen von Schiffen und entlegenen Häfen kannte, erschauderte er fast bei dem Gedanken, dass diese Menschen, wenn sie gewusst hätten, wer er wirklich war, ihn mit anderen Augen betrachtet hätten. Wenn sie in ihn hätten hineinsehen und erkennen können, wie oft er sich bei Nacht und sogar tagsüber gestattete, zur Frau in dem Gemälde im Treppenhaus zu werden, mit all ihren glühenden Begierden, oder jemand, der mit einem Schwert in der Hand oder einem Lied auf den Lippen über das Land zog — hätten sie verwundert die Köpfe darüber geschüttelt, wie geschickt er sie getäuscht und wie listenreich er seines Vaters Anerkennung gewonnen hatte, welch ein Schwindler und Hochstapler er war und wie wenig man ihm vertrauen konnte.
Heinrich wusste natürlich, wer er war, und hatte vom Traumleben seines jüngeren Bruders eine hinlänglich klare Vorstellung, nicht nur, um beurteilen zu können, dass es sein eigenes an Reichweite und Tiefe übertraf, sondern auch, um zu begreifen, dass Thomas, wie er ihn gewarnt hatte, je weiter er seine Verstellungskunst trieb, desto mehr Gefahr lief, entlarvt zu werden. Anders als sein Bruder machte Heinrich der Familie nichts vor. Die Begeisterung des Heranwachsenden für Heine und Goethe, für Bourget und Maupassant war ebenso klar und offenkundig wie seine Gleichgültigkeit gegen Schiffe und Speicher. Letztgenannte Dinge langweilten ihn, und noch so viele Ermahnungen hielten ihn nicht davon ab, seinem Vater gegenüber zu betonen, dass er mit dem Familienunternehmen nicht das Geringste zu schaffen haben wollte.
»Ich habe dich während des Mittagessens dabei beobachtet, wie du den kleinen Geschäftsmann gegeben hast«, sagte er zu Thomas. »Alle außer mir sind darauf hereingefallen. Wann wirst du ihnen endlich verraten, dass du nur Theater spielst?«
»Ich spiele nicht Theater.«
»Man wird dir auf die Schliche kommen.«
Heinrich war es mit der Zeit gelungen, sich so klar von den Familienangelegenheiten zu distanzieren, dass sein Vater lernte, ihn in Ruhe zu lassen, und sich stattdessen darauf konzentrierte, kleinere Fehler in Umgangsformen oder Betragen seines zweiten Sohnes und seiner zwei Töchter zu korrigieren. Julia versuchte, Heinrich für Musik zu interessieren, aber er weigerte sich, weiter Klavier oder Geige zu üben.
Heinrich hätte sich schon bald gänzlich von der Familie gelöst, dachte Thomas, wäre nicht seine große Anhänglichkeit an seine Schwester Carla gewesen. Da zwischen den beiden ein Unterschied von zehn Jahren bestand, war Heinrichs Verhältnis zu seiner Schwester eher väterlicher als brüderlicher Natur. Seit sie ein Säugling gewesen war, hatte Heinrich Carla im Haus umhergetragen. Und später, als sie älter wurde, lehrte er sie Kartenspiele und spielte mit ihr eine sanftere Version von Verstecken, an der nur sie beide beteiligt waren.
Seine Zuneigung für Carla gestattete es Beobachtern, seine weiche Seite, seine Rücksichtnahme zu bewundern. Obwohl er Freunde und männliche Beschäftigungen hatte, denen er sich widmen musste, ging Heinrich auf Carlas Forderungen stets liebevoll ein. Wenn Lula auf die Aufmerksamkeit, die ihre Schwester erhielt, eifersüchtig wurde, schloss Heinrich auch sie mit ein, aber ihr wurde oft langweilig dabei, da ihre Schwester und ihr älterer Bruder eine ganz eigene Art der Verständigung und wechselseitigen Erheiterung zu besitzen schienen.
»Heinrich ist herzensgut«, sagte ein Cousin. »Wäre er nur gleichermaßen praktisch veranlagt, bräuchte man um die Zukunft der Familie nicht zu bangen.«
»Es ist ja immer noch Tommy da«, sagte Tante Elisabeth, sich Thomas zuwendend. »Tommy wird die Firma in das zwanzigste Jahrhundert führen. Ist das nicht dein Plan?«
Und dann rang sich Thomas, der den leichten Spott in ihrer Stimme nicht überhört hatte, ein Lächeln ab.
Obwohl man davon überzeugt war, dass seine Widerspenstigkeit von der mütterlichen Linie herrührte, begann Heinrich mit der Zeit die Geschichten seiner Mutter langweilig zu finden, ebenso wenig schien er ihre fragile Empfindsamkeit geerbt zu haben, ihren Hang zum Gesuchten, Erlesenen. Seltsamerweise entwickelte sich Heinrich, trotz seines Geredes von Dichtung und Reisen und Kunst, mit seiner offenen und entschlossenen Art, ob er es wollte oder nicht, zunehmend zu einem reinblütigen, echten Vertreter der Familie Mann. Ja, wenn er auf den Straßen von Lübeck gesehen wurde, wies seine Tante Elisabeth gern darauf hin, wie sehr er seinem Großvater Johann Siegmund Mann ähnelte, mit diesem schweren Schritt, den sie mit dem alten Lübeck in Verbindung brachte, und ebenso mit der gewichtigen Sprechweise seiner väterlichen Vorfahren. Jammerschade, dass ihm jegliche Begeisterung für Handelsgeschäfte fehlte.
Thomas war klar, dass die Leitung der Firma zu gegebener Zeit nicht seinem älteren Bruder, sondern ihm anvertraut, dass das Haus, das seinen Großeltern gehört hatte, früher oder später zu seinem Reich werden würde. Er konnte es dann, so sagte er sich, mit Büchern füllen. Im Geiste sah er bereits, wie er die oberen Zimmer umgestalten und die Kontorräume im Parterre in irgendein anderes Haus verlegen würde. Er würde sich Bücher aus Hamburg kommen lassen, so wie sein Vater dort seine Garderobe bestellte, und aus ferneren Orten, vielleicht sogar aus Frankreich, wenn er es schaffte, Französisch zu lernen, oder aus London, sobald sein Englisch besser wäre. Er würde in Lübeck ein Leben führen wie noch niemand zuvor, mit einem Geschäft, das er insoweit konsolidiert haben würde, dass die Erträge lediglich dazu ausreichten, seine anderen Interessen zu finanzieren. Eine französische Ehefrau wäre angenehm, dachte er. Sie würde ihrem gemeinsamen Leben einen zusätzlichen Glanz verleihen.
Er stellte sich vor, dass seine Mutter in das Haus in der Mengstraße käme, um sich anzusehen, wie sie sich dort eingerichtet hatten, und ihr Werk loben würde: den neuen Flügel, den sie gekauft hatten, die Gemälde aus Paris, die französischen Möbel.
Mit zunehmendem Alter fand Heinrich deutlichere Worte, um Thomas darauf hinzuweisen, dass seine Bemühungen, wie ein echter Vertreter der Manns zu erscheinen, eine bloße Pose waren, eine Pose zudem, deren Fadenscheinigkeit immer evidenter wurde, als Thomas begann, unverhohlen Gedichte zu lesen, als er es nicht mehr vermochte, seine Begeisterung für Kultur zu verheimlichen, und als er es, zumindest sporadisch, seiner Mutter gestattete, ihn auf dem Bechstein zu begleiten, während er die Geige spielte.
Mit der Zeit büßten Thomas’ Bemühungen, Interesse an Schiffen und Handel vorzutäuschen, mehr und mehr an Glaubwürdigkeit ein. Während Heinrich seine Ambitionen inzwischen mit trotziger Offenheit kundtat, war Thomas nervös und verschlossen, konnte aber dennoch nicht verheimlichen, wie sehr er sich verändert hatte.
»Warum besuchst du deinen Vater nicht mehr im Kontor?«, fragte seine Mutter. »Er hat es mehrmals erwähnt.«
»Morgen gehe ich hin«, sagte Thomas.
Auf dem Heimweg von der Schule malte er sich dann aber aus, wie gemütlich er es sich zu Hause machen würde, irgendwo ganz für sich, allein mit seinem Buch oder auch einfach nur mit seinen Träumereien. Und verschob den Besuch des Kontors auf einen späteren Wochentag.
Thomas erinnerte sich an eine Szene in diesem Haus, seine Mutter am Flügel und er selbst an der Geige, als Heinrich unerwartet in der Tür erschienen und dort stehen geblieben war. Während er weiterspielte, wurde Thomas urplötzlich der Anwesenheit seines Bruders gewahr. Einige Jahre lang hatten sie sich ein Zimmer geteilt, doch mittlerweile nicht mehr.
Heinrich, vier Jahre älter als er, von hellerem Teint, war zu einem gutaussehenden Mann geworden: Das war, was Thomas bemerkte.
Heinrich, der damals achtzehn war, merkte offensichtlich, dass er von seinem jüngeren Bruder beobachtet wurde. Ein, zwei Sekunden lang musste er auch erkannt haben, dass dieser Blick ein Moment von unbehaglichem Begehren enthalten hatte. Das Musikstück, erinnerte sich Thomas, war langsam und technisch anspruchslos gewesen, eine von Schuberts frühen Kompositionen für Klavier und Violine, oder vielleicht sogar die Transkription eines Liedes. Die Aufmerksamkeit seiner Mutter hatte ausschließlich dem Notenblatt gegolten, weswegen sie nicht bemerkte, wie die zwei Brüder einander ansahen. Thomas hätte nicht einmal sagen können, ob ihr überhaupt bewusst war, dass Heinrich dastand. Langsam, errötend vor Verlegenheit darüber, was sein Bruder in ihm erkannt hatte, wandte Thomas den Blick ab.
Nachdem sein Bruder wieder gegangen war, bemühte sich Thomas verzweifelt, im Takt mit seiner Mutter zu spielen, als ob nichts vorgefallen wäre. Schließlich mussten sie allerdings abbrechen, da er zu viele Fehler machte.
Dergleichen kam nie wieder vor. Heinrich hatte lediglich das Bedürfnis verspürt, ihn wissen zu lassen, dass er ihn durchschaute. Das war alles. Doch die Erinnerung blieb: das Zimmer, das Licht aus dem hohen Fenster, seine Mutter am Flügel, seine eigene Einsamkeit, während er dicht bei ihr stand und zu spielen versuchte, und die Musik, die leisen Töne, die sie gemeinsam hervorbrachten. Und dann, plötzlich, der Blickkontakt. Und die Rückkehr zur Normalität, oder zu etwas, was einem Außenstehenden, wäre er ins Zimmer gekommen, wie Normalität hätte erscheinen können.
Heinrich war froh, das Gymnasium zu verlassen und bei einer Buchhandlung in Dresden eine Stelle anzunehmen. In seiner Abwesenheit wurde Thomas noch verträumter. Er schaffte es einfach nicht, sich auf den Lernstoff zu konzentrieren oder den Lehrern nennenswerte Aufmerksamkeit zu schenken. Im Hintergrund lauerte, wie ein diffuses Donnergrollen, die Überzeugung, dass er sich, wenn die Zeit für ihn käme, sich wie ein Erwachsener zu verhalten, als gänzlich untauglich erweisen würde.
Also würde er stattdessen den Verfall verkörpern. Verfall würde in den Tönen schwingen, die er spielte, wenn er auf der Geige übte, und in den Wörtern, die er in Büchern las.
Er wusste, dass er unter Beobachtung stand, und das nicht nur im Kreis der Familie, sondern auch in der Schule, in der Kirche. Er liebte es, seiner Mutter beim Klavierspielen zu lauschen und ihr zu folgen, wenn sie in ihr Boudoir ging. Aber ebenso sehr gefiel es ihm, auf der Straße bemerkt, als ein würdiger Sohn des Senators geachtet zu werden. Er hatte die Selbstgefälligkeit des Vaters in sich aufgesogen, besaß aber ebenso etwas von der künstlerischen Natur, der Wunderlichkeit seiner Mutter.
In Lübeck waren manche der Ansicht, dass die Brüder tatsächlich nicht nur Indizien eines Verfalls innerhalb ihrer eigenen Familie waren, sondern zugleich auch Vorboten einer sich ausbreitenden allgemeinen Schwäche, die in diesem Teil Deutschlands, der einst so stolz auf seine Mannhaftigkeit gewesen war, umso mehr ins Auge fiel.
Somit hing viel von ihrem jüngsten Bruder Viktor ab, geboren, als Heinrich neunzehn und Thomas fast fünfzehn war.
»Da die zwei Ältesten zu solchen Liebhabern der Poesie geworden sind«, sagte Tante Elisabeth, »wollen wir hoffen, dass der Jüngste Konten und Geschäftsbücher vorzieht.«
*
Im Sommer, sobald die Familie zu ihren vierwöchigen Ferien an der See in Travemünde eintraf, wurde jeder Gedanke an Schule und Lehrer, an Grammatik und Gleichungen und den verhassten Turnunterricht verbannt.
Im Strandhotel, einem Gebäude im Stil eines Schweizerhauses, erwachte der fünfzehnjährige Thomas in einem blitzsauberen, kleinen Zimmer mit altmodischen Möbeln zum Geräusch eines Gärtners, der unter dem strahlend weißen Himmel eines Ostseemorgens Kies harkte.
Zusammen mit seiner Mutter und Ida Buchwald, ihrer Gesellschafterin, frühstückte er auf dem Balkon des Speisesaals oder draußen unter der großen Kastanie. Hinter ihnen war der kurz gemähte Rasen, der erst dem höheren Uferbewuchs und schließlich dem Sandstrand wich.
Sein Vater schien aus den kleinen Mängeln des Hotels Befriedigung zu schöpfen. Er erklärte, die Tischdecken seien nicht ordentlich gewaschen und die Papierservietten vulgär; das ungewohnte Brot und die metallenen Eierbecher fand er schlicht unzumutbar. Und dann, nachdem sie sich seine Klagen eine Zeit lang angehört hatte, zuckte Julia irgendwann die Schultern und lächelte.
»Wenn wir wieder zu Hause sind, wird alles perfekt sein.«
Als Lula ihre Mutter fragte, warum ihr Vater sie so selten zum Strand begleitete, lächelte sie.
»Er ist gern im Hotel, und er möchte nicht an den Strand gehen. Warum sollten wir ihn also zwingen?«
Thomas und seine Geschwister gingen mit seiner Mutter und Ida an den Strand und machten es sich auf den Lehnstühlen bequem, die das Hotelpersonal für sie aufstellte. Das Summen der Unterhaltung zwischen den zwei Frauen verstummte immer nur dann, wenn jemand Neues erschien, und dann setzten sich beide auf, um zu sehen, wer es war. War dann die Neugier gestillt, nahmen sie, in einer Art von trägem Geflüster, ihr Gespräch wieder auf. Und bald ging, auf ihr Drängen hin, Thomas in seinem Badeanzug ans Wasser, watete zögernd hinein. Anfangs fürchtete er sich vor der Kälte, hüpfte mit jeder sanften Welle empor, um sich schließlich der Umarmung des Wassers zu ergeben.
An den nicht enden wollenden Nachmittagen gab es Stunden vor dem Musikpavillon, oder Zeiten, da Ida ihm unter den Bäumen hinter dem Hotel etwas vorlas, bevor sie sich in der Dämmerung ans Ende der Uferbefestigung setzten und mit einem Taschentuch den vorüberfahrenden Schiffen zuwinkten. Und dann würde es auch Zeit für das Abendessen sein, und später ging er oft ins Zimmer seiner Mutter, um ihr dabei zuzuschauen, wie sie sich für ihren Abstieg zum Speisesaal in der verglasten Veranda des Hotels zurechtmachte, wo sie und ihr Gatte, umgeben nicht nur von Hamburger, sondern auch von englischen und sogar russischen Familien, dinieren würden, während er sich selbst zum Schlafengehen fertig machte.
An regnerischen Tagen, an denen der Westwind die See zurücktrieb, verbrachte er immer einige Zeit am Klavier in der Hotelhalle. Es hatte in seinem Leben viel hämmernde Walzermusik erdulden müssen, und Thomas konnte ihm nicht die gleichen vollen Töne und Untertöne entlocken, die der Flügel zu Hause hervorbrachte, aber es hatte einen ganz eigenen komischen, gedämpft gurgelnden Klang, den er, wie er wusste, vermissen würde, wenn die Ferien erst vorbei wären und sie nach Lübeck zurückkehren müssten.
In jenem letzten Sommer kehrte sein Vater schon nach wenigen Tagen, unter dem Vorwand, dass ihn dringende Arbeit erwarte, nach Lübeck zurück. Doch als er wiederkam, ließ er sich zum Frühstück nicht blicken, und wie strahlend der Tag auch sein mochte, blieb er im Salon, wo er, ein Plaid um sich geschlagen, dasaß und las, als wäre er ein Invalide. Da er sie auf keinen ihrer Ausgänge begleitete, lebten sie weiter so fort, als wäre er noch nicht wieder zurück.
Erst als Thomas eines Abends seine Mutter suchte und schließlich im Zimmer seines Vaters fand, war er gezwungen, seinen Vater zur Kenntnis zu nehmen, der im Bett lag und mit offenem Mund an die Zimmerdecke starrte.
»Der Ärmste«, sagte seine Mutter, »die Arbeit hat ihn völlig erschöpft. Diese Ferien werden ihm guttun.«
Am nächsten Tag gingen seine Mutter und Ida ihren gewohnten Tätigkeiten nach, ohne ein Wort darüber zu verlieren, dass sie den Senator in seinem Bette liegend zurückgelassen hatten. Als Thomas seine Mutter fragte, ob sein Vater krank sei, erinnerte sie ihn daran, dass der Senator sich einige Monate zuvor einer kleineren Operation an der Blase unterzogen hatte.
»Er ist noch auf dem Wege der Genesung«, sagte seine Mutter. »Bald hält ihn nichts mehr vom Baden ab!«
Seltsam war, dachte Thomas, wie wenig er sich entsinnen konnte, dass sein Vater während früherer Sommerferien jemals geschwommen wäre oder am Strand gelegen hätte. Vielmehr erinnerte er sich an ihn, wie er in einem Liegestuhl auf der Veranda Zeitung las, seinen Vorrat an russischen Zigaretten griffbereit neben sich auf dem Tisch, oder wie er in der Stunde vor dem Diner draußen vor dem Zimmer seiner Mutter wartete, während drinnen Julia verträumt ihr Wesen trieb.
Eines Tages, als sie vom Strand zurückkehrten, bat seine Mutter ihn, den Vater in seinem Zimmer zu besuchen, ihm vielleicht sogar vorzulesen, sollte er den Wunsch äußern. Als Thomas einwandte, er wolle sich die Kurkapelle anhören, beharrte sie darauf und erklärte, sein Vater erwarte ihn.
Er saß aufrecht im Bett, ein reines weißes Tuch um den Hals, während der Hotelbarbier ihn rasierte. Er nickte Thomas zu und bedeutete ihm, sich auf den Stuhl zu setzen, der dem Fenster am nächsten stand. Thomas’ Blick fiel auf ein Buch, das bäuchlings aufgeschlagen dalag, und er blätterte ein wenig darin. Es war die Sorte Buch, dachte er, die Heinrich lesen mochte. Er hoffte, sein Vater würde ihn nicht auffordern, ihm daraus vorzulesen.
Er versenkte sich in die langsame, komplizierte Manier, in der der Barbier seinen Vater rasierte: Breite Schwünge der Messerklinge wechselten sich mit winzigen Zuckbewegungen ab. Als der Barbier mit einer Hälfte des Gesichts fertig war, trat er einen Schritt zurück, um sein Werk zu begutachten, und griff dann zu einer kleinen Schere, um Härchen um die Nase und auf der Oberlippe abzuschneiden. Sein Vater starrte geradeaus.
Dann nahm der Barbier seine Arbeit wieder auf und schabte den restlichen Schaum ab. Als er damit fertig war, holte er eine Flasche Kölnisch Wasser hervor, trug, während sein Vater zusammenzuckte, freigebig davon auf und klatschte schließlich zufrieden in die Hände.
»Das wird die Lübecker Barbiere beschämen«, sagte er, indem er das Tuch entfernte und zusammenfaltete. »Und die Herren werden für die beste Rasur nach Travemünde strömen!«
Thomas’ Vater lag auf dem Bett. Sein gestreifter Pyjama war tadellos gebügelt. Thomas sah, dass die Fußnägel seines Vaters sorgfältig geschnitten waren, mit Ausnahme der kleinen Zehe seines linken Fußes, wo der Nagel sich gleichsam um die Zehe herumgerollt hatte. Er wünschte, er hätte eine Schere gehabt, dann hätte er versucht, ihn richtig zu schneiden. Und dann ging ihm auf, welch ein absurder Einfall das war. Sein Vater würde ihm schwerlich gestatten, ihm die Fußnägel zu schneiden.
Er hatte noch immer das Buch in der Hand. Wenn er es nicht rasch beiseitelegte, bestand die Gefahr, dass sein Vater es sah und ihn bat, ihm daraus vorzulesen, oder ihm möglicherweise eine Frage dazu stellte.
Bald schloss sein Vater die Augen, als sei er eingeschlafen, doch schon kurz darauf schlug er sie wieder auf und starrte mit leerem Blick auf die gegenüberliegende Wand. Thomas fragte sich, ob dies ein geeigneter Augenblick wäre, seinem Vater Fragen über Schiffe zu stellen, welche demnächst im Hafen erwartet wurden und welche bereit zum Ablegen waren. Und vielleicht, wenn sein Vater gesprächig wurde, sich nach den Schwankungen des Getreidepreises zu erkundigen. Oder auf Preußen zu sprechen zu kommen, damit sein Vater Gelegenheit hätte, sich über die fragwürdigen Manieren und die ungehobelten Tischsitten preußischer Beamter, selbst solcher, die von sich behaupteten, aus guten Familien zu stammen, auszulassen. Er blickte wieder zu seinem Vater und sah, dass er tief und fest schlief. Kurze Zeit später schnarchte er bereits. Thomas dachte, dass er jetzt das Buch auf den Nachtschrank legen konnte. Er stand auf und trat näher ans Bett. Durch die Rasur sah das Gesicht seines Vaters nicht nur glatt aus, sondern auch blass.
Er wusste nicht, wie lange er noch bleiben sollte. Er wünschte sich, jemand vom Hotel würde mit frischem Wasser oder frischen Handtüchern kommen, aber vermutlich war schon alles parat. Mit dem Erscheinen seiner Mutter rechnete er nicht. Er wusste, dass sie ihn zu seinem Vater geschickt hatte, um selbst im Hotelgarten ausspannen oder mit Ida und seinen Schwestern oder mit Viktor und dem Kindermädchen wieder an den Strand gehen zu können. Wenn er einen Fuß vor die Tür dieses Zimmers setzte, würde sie bestimmt davon erfahren.
Er ging auf und ab, berührte die frisch gewaschenen Laken, trat dann aber aus Angst, seinen Vater zu stören, vom Bett zurück.
Als sein Vater einen Schrei ausstieß, klang er so fremd, dass Thomas im ersten Augenblick glaubte, es sei noch jemand anders im Zimmer. Dann aber begann sein Vater lauthals Worte auszustoßen, und was Thomas hörte, war die vertraute Stimme, obschon die Worte keinen Sinn ergaben. Sein Vater setzte sich aufrecht im Bett auf und hielt sich den Magen. Mit einiger Mühe schaffte er es, vom Bett aufzustehen, nur um gleich wieder kraftlos auf die Matratze zurückzufallen.
Thomas’ erste Reaktion war, erschrocken zurückzuweichen, doch als sein Vater sich stöhnend, die Hände noch immer auf seinen Magen gepresst, zurückfallen ließ, kam Thomas näher und fragte ihn, ob er seine Mutter holen sollte.
»Nichts«, sagte sein Vater.
»Was? Soll ich Mutter nicht holen?«
»Nichts«, wiederholte sein Vater. Er öffnete die Augen und sah Thomas an, das Gesicht zu einer Grimasse verzerrt.
»Du weißt nichts«, sagte sein Vater.
Thomas stürzte aus dem Zimmer. Als er auf der Treppe merkte, dass er eine Etage zu weit hinuntergelaufen war, rannte er wieder hinauf in die Halle und fand den Concierge, der sofort den Direktor herbeirief. Gerade als er beiden erklärte, was vorgefallen war, erschienen seine Mutter und Ida.
Er folgte allen hinauf auf das Zimmer, nur um feststellen zu müssen, dass sein Vater friedlich schlafend auf dem Bette lag.
Die Mutter seufzte und entschuldigte sich leise für die Aufregung. Thomas wusste, dass es vergebliche Mühe gewesen wäre, ihr erklären zu wollen, was er mitangesehen hatte.
*
Sein Vater verlor auch weiter an Kräften, als sie wieder in Lübeck waren, doch er lebte bis zum Oktober.
Er hörte seine Tante Elisabeth sich beklagen, der Senator habe, als er auf seinem Sterbebett lag, die Gebete des Pastors mit einem brüsken »Amen« unterbrochen.
»Er war nie ein guter Zuhörer«, sagte sie, »aber ich hätte eigentlich gedacht, dass er bei dem Herrn Pastor eine Ausnahme machen würde.«
In den letzten Lebenstagen ihres Vaters schien Heinrich zu wissen, wie er sich seiner Mutter gegenüber zu verhalten hatte, aber Thomas fiel beim besten Willen nichts ein, was er ihr hätte sagen können. Wenn sie ihn umarmte, drückte sie ihn zu fest an sich; er hatte das Gefühl, dass sie ihm seine angestrengten Bemühungen, sich zu befreien, übelnahm.
Als er Tante Elisabeth einer Cousine gegenüber im Flüsterton das Testament seines Vaters erwähnen hörte, entfernte er sich mit gleichgültiger Miene und schlich sich dann näher heran, nah genug, um sie sagen zu hören, dass Julia nicht zu viel Verantwortung aufgebürdet werden könne.
»Und die Jungen!«, sagte sie. »Diese zwei Jungen! Jetzt ist die Familie wirklich am Ende. Nun werden mich die Leute auf der Straße auslachen, dieselben Leute, die sich vorher immer verbeugten.«
Als sie fortfahren wollte, bemerkte die Cousine, dass Thomas lauschte, und stieß sie mit dem Ellbogen leicht an.
»Thomas, gehe und siehe zu, dass deine Schwestern ordentlich gekleidet sind«, sagte Tante Elisabeth. »Ich sah Carla mit höchst unpassenden Schuhen.«
Bei dem Begräbnis nahm Julia Mann alle Beileidsbezeugungen matt lächelnd entgegen, ermutigte jene, die sie aussprachen, jedoch nicht, auch nur ein weiteres Wort an sie zu richten. Sie zog sich, ihre Töchter dicht bei sich, in ihre eigene Welt zurück und überließ es ihren Söhnen mit denen zu sprechen, die gekommen waren, um ihnen ihr Beileid auszudrücken.
»Könntet ihr diese Leute von mir fernhalten?«, bat sie. »Und wenn sie fragen, ob sie irgendetwas für mich tun können, könntet ihr sie inständig bitten, mich nicht so kummervoll anzustarren?«
Thomas hatte sie noch nie so kunstvoll fremdartig und geheimnisvoll erlebt.
Einen Tag nach dem Begräbnis, mit ihren fünf Kindern im Salon, bemerkte Julia, dass ihre Schwägerin Elisabeth sich gerade anschickte, mit Heinrichs Hilfe das Sofa und einen der Sessel zu verrücken.
»Elisabeth, rühre die Möbel nicht an«, sagte sie. »Heinrich, stelle das Sofa dahin zurück, wo es stand.«
»Julia, ich finde, das Sofa sollte an der Wand stehen. Dort, wo es jetzt steht, ist es von zu vielen Tischen umgeben. Ihr habt immer viel zu viele Möbel. Meine Mutter pflegte immer zu sagen —«
»Rühre die Möbel nicht an!«, fiel ihr Julia ins Wort.
Elisabeth schritt würdevoll zum Kamin und nahm dort eine dramatische Pose an, wie eine Frau in einem Theaterstück, die verletzt worden ist.
*
Als Thomas sah, dass Heinrich sich bereit machte, seine Mutter aufs Gericht zu begleiten, wo das Testament verlesen werden würde, fragte er sich, warum man ihn nicht mitnahm. Seine Mutter war allerdings so aufgebracht, dass er darauf verzichtete, sich zu beklagen.
»Ich habe es schon immer verabscheut, dass hier nichts privat ist. Wie barbarisch, das Testament öffentlich zu verlesen! Ganz Lübeck wird von unseren Angelegenheiten erfahren. Und, Heinrich, wenn du deine Tante davon abhalten könntest, sich bei mir einzuhaken, wäre ich dir sehr dankbar. Und sollten sie den Wunsch haben, mich nach der Verlesung auf dem Markt zu verbrennen, sage ihnen bitte, dass drei Uhr genehm wäre!«
Thomas fragte sich, wer jetzt die Firma leiten würde. Er konnte sich vorstellen, dass sein Vater irgendeinen angesehenen Bürger dazu bestimmt hatte, ein paar Kontorschreiber zu beaufsichtigen, die den Betrieb so lange aufrechterhalten würden, bis die Familie beschlossen hätte, was weiter geschehen sollte. Beim Begräbnis hatte er das Gefühl gehabt, dass man ihn beobachtete und sich gegenseitig auf ihn aufmerksam machte als den zweiten Sohn, dem jetzt eine große Verantwortung aufgebürdet werden würde. Er begab sich in das Zimmer seiner Mutter und betrachtete sich im hohen Spiegel. Wenn er eine gestrenge Pose einnahm, konnte er sich leicht vorstellen, wie er am Morgen sein Kontor betrat und seinen Untergebenen Anweisungen erteilte. Doch als er die Stimme einer seiner Schwestern ihn von unten rufen hörte, wandte er sich vom Spiegel ab und fühlte sich augenblicklich geschmälert.
Als Heinrich und seine Mutter zurückkehrten, stand er am Kopf der Treppe und lauschte.
»Er hat das Testament geändert, damit alle Welt weiß, was er von uns allen hielt«, sagte Julia. »Und sie waren alle da, die braven Bürger von Lübeck. Da sie keine Hexen mehr verbrennen können, zerren sie die Witwen vor Gericht und demütigen sie.«
Thomas ging hinunter in die Diele; er sah, dass Heinrich blass war. Als sich ihre Blicke begegneten, begriff er, dass etwas Schlimmes und Unerwartetes geschehen war.
»Gehe mit Tommy in den Salon und schließe die Tür«, sagte Julia, »und erzähle ihm, was uns widerfahren ist. Ich würde jetzt Klavier spielen, nur würden unsere Nachbarn dann über mich klatschen. Also werde ich stattdessen in mein Zimmer gehen. Ich will nicht, dass der Inhalt dieses Testaments je wieder in meiner Gegenwart erwähnt wird. Wenn deine Tante Elisabeth die Stirn hat, sich hier blicken zu lassen, bin ich wegen plötzlicher Trauer nicht zu sprechen.«
*
Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, begannen Heinrich und Thomas, die Ausfertigung des Testaments zu lesen, die Heinrich bei Gericht erhalten hatte.
Das Dokument war, wie Thomas feststellte, drei Monate zuvor aufgesetzt worden. Es begann damit, dass es zwei Vormunde ernannte, denen er »die Einwirkung auf eine praktische Erziehung« seiner Kinder zur Pflicht machte. Dann stellte der Senator unmissverständlich klar, wie wenig er von ihnen allen hielt.
»Soweit sie es können«, hatte er geschrieben, »ist den Neigungen meines ältesten Sohnes (Heinrich) zu einer s. g. literarischen Tätigkeit entgegenzutreten.« Seiner Meinung nach fehlten »ihm die Vorbedingnisse: genügendes Studium und umfassende Kenntnisse. Der Hintergrund seiner Neigungen ist träumerisches Sichgehenlassen, vielleicht aus Mangel an Nachdenken.«
Heinrich las es zweimal vor und brach in lautes Gelächter aus.
»Und hör dir das an«, fuhr er fort. »Hier geht es um dich: ›Mein zweiter Sohn (Thomas) ist ruhigen Vorstellungen zugänglich, er hat ein gutes Gemüt und wird sich in einen praktischen Beruf hineinfinden. Von ihm darf ich erwarten, dass er seiner Mutter eine Stütze sein wird.‹ Dann lautet die Devise also ›du und deine Mutter‹. Und du wirst dich schon hineinfinden! Und wer hätte je gedacht, dass du ein gutes Gemüt hast? Das ist wieder eine deiner Masken.«
Dann las ihm Heinrich seines Vaters Warnung vor Lulas »lebhaftem Naturell« vor sowie den Ausdruck seiner Hoffnung, dass Carla »neben Thomas ein ruhiges Element« in der Familie bilden werde. Über den kleinen Viktor schrieb der Senator: »Oft gedeihen Kinder späterer Geburt geistig besonders gut — das Kind hat so gute Augen.«
»Es kommt noch schlimmer. Hör dir das an!«
In einem parodistisch hochtrabenden Ton las er vor:
»›Allen Kindern gegenüber möge meine Frau fest sich zeigen und alle immer in Abhängigkeit halten. Wenn je sie wankend würde, so lese sie König Lear.‹«
»Ich wusste, dass mein Vater engstirnig war«, sagte Heinrich, »aber ich hatte nicht gewusst, dass er rachsüchtig war.«
Dann erklärte Heinrich seinem Bruder mit amtlich strenger Stimme, welche Verfügungen ihr Vater ihretwegen getroffen hatte. Der Senator hatte die umgehende Liquidation der Firma angeordnet und festgelegt, dass auch die Häuser verkauft werden sollten. Julia sollte alles erben, aber zwei der selbstgefälligsten Figuren des öffentlichen Lebens Lübecks, Männer, die sie ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit nie für würdig erachtet hatte, sollten alle finanziellen Entscheidungen für sie treffen. Außerdem wurden zwei Vormunde eingesetzt, welche die Erziehung der Kinder überwachen sollten. Schließlich legte das Testament fest, dass Julia viermal im Jahr dem schmallippigen Amtsrichter August Leverkühn über die Fortschritte der Kinder Bericht erstatten sollte.
*
Als Elisabeth das nächste Mal zu Besuch kam, wurde sie nicht aufgefordert, Platz zu nehmen.
»Wusstest du vom Testament meines Gatten?«, fragte Julia sie.
»Ich wurde nicht um Rat ersucht«, entgegnete Elisabeth.
»Das war nicht meine Frage. Wusstest du davon?«
»Julia, nicht vor den Kindern!«
»Es gibt etwas, was ich schon immer sagen wollte«, sagte Julia, »und jetzt kann ich es sagen, jetzt, da ich frei bin. Und ich werde es vor den Kindern sagen. Ich habe dich noch nie ausstehen können. Und es ist schade, dass deine Mutter nicht mehr am Leben ist, denn ihr würde ich das Gleiche sagen.«
Heinrich versuchte, sie zu unterbrechen, aber Julia wehrte ihn mit einer Handbewegung ab.
»Der Senator machte dieses Testament, um mich zu demütigen.«
»Du hättest das Geschäft kaum selbst führen können«, sagte Elisabeth.
»Ich hätte das selbst entscheiden können. Meine Söhne und ich hätten darüber entscheiden können.«
*
Für die Bürger Lübecks, für jene, die Julia auf Gesellschaften im Hause ihres Gatten in Verlegenheit gebracht oder mit Geringschätzung behandelt hatte, Männer wie Herr Kellinghusen oder Herr Cadovius, Damen wie die junge Frau Stavenhitter oder Frau Mackenthun, oder für Damen, die sie aufmerksam beobachteten und, was sie sahen, missbilligten, wie zum Beispiel Frau Overbeck und deren Tochter, hätte Julias schon kurz nach der Verlesung des Testaments öffentlich gemachter Entschluss, mit ihren drei jüngsten Kindern nach München zu ziehen, während sie Thomas bei Dr. Timpe in Pension zurückließ, damit er sein letztes Schuljahr absolvieren könnte, und Heinrich zum Reisen ermutigte, um seine Erfolgsaussichten in der literarischen Welt zu erhöhen, nicht tadelnswürdiger sein können.
Wenn die Witwe Senator Manns beschlossen hätte, nach Lüneburg oder Hamburg umzuziehen, so wäre dies den braven Lübeckern vielleicht nur als eine weitere Facette ihrer Unzuverlässigkeit erschienen, aber in jenen Jahren, wusste Thomas, repräsentierte München für diese biederen Hanseaten den Süden, und sie hegten eine Abneigung gegen den Süden und misstrauten ihm. Die Stadt München war katholisch; sie war künstlerisch verbummelt. Sie besaß keine soliden Tugenden. Kein Lübecker hatte sich dort jemals länger als unbedingt nötig aufgehalten.
Das Augenmerk Lübecks galt Thomas’ Mutter, insbesondere seit Tante Elisabeth im Vertrauen herumerzählte, wie ungezogen sich Julia ihr gegenüber betragen und wie sehr sie das Andenken ihrer Mutter verunglimpft hatte.
Eine Zeit lang war in ihrer Welt von nichts anderem die Rede als dem Mangel an Gleichmut, den die Witwe des Senators auf der Beerdigung an den Tag gelegt hatte, und ihren törichten Plänen. Niemandem, nicht einmal Heinrich, fiel auf, wie sehr es Thomas verletzt hatte, dass die Firma nicht ihm hinterlassen worden war, und wenn auch unter der kommissarischen Leitung anderer, bis er volljährig gewesen wäre.
Thomas lebte unter dem Schock der Erkenntnis, dass er dessen beraubt werden sollte, was er, in manchen seiner Träume, für sein künftiges Eigentum gehalten hatte. Er wusste, dass die Leitung der Firma nur eine der vielen Möglichkeiten war, die er sich für seine Zukunft ausgemalt hatte, aber er zürnte seinem Vater für die Anmaßung seines Entschlusses. Ihm missfiel die Vorstellung, dass sein Vater seine Illusionen durchschaut hatte, ohne zu erkennen, wie real sie ihm häufig erschienen. Er wünschte, er hätte Gelegenheit gehabt, seinen Vater insoweit zu überzeugen, dass er ein großzügigeres Testament hinterlassen hätte.
Stattdessen hatte sein Vater der Familie ihren Halt genommen. Da dem Senator ein Weiterleben versagt war, hatte er alles unternommen, um anderen das Leben zu vergällen. Thomas verfolgte der unablässige, quälende Gedanke, dass die Leistung der Manns in Lübeck jetzt im Nichts enden würde. Die Zeit seiner Familie war vorüber.
Ganz gleich, wohin sie sich in der Welt wenden würden, die Manns von Lübeck würden nie wieder das Ansehen genießen, das sie zu Lebzeiten des Senators genossen hatten. Dies schien weder Heinrich noch seine Schwestern zu bekümmern, noch übrigens seine Mutter; sie hatten andere, konkretere Sorgen. Er wusste zwar, dass auch seine Tante Elisabeth spürte, welch eine fatale Schwächung die Stellung der Familie erlitten hatte, aber das war kaum ein Thema, das er mit ihr erörtern würde. So war er mit diesen Gedanken allein. Die Familie würde der Hansestadt entwurzelt werden. Ganz gleich, wohin er sich wandte, er würde nie wieder wichtig sein.
Zweites Kapitel
Lübeck 1892
Das Orchester spielte das Vorspiel zu Lohengrin. Es kam Thomas so vor, als hielten die Streicher sich zurück, als deuteten sie lediglich an, was aus der Melodie letztendlich werden mochte. Dann begann der dünne Klangteppich, natürlich auf und ab zu steigen, bis ein einzelner klagender Ton der Violine emporflog und innehielt; das Zusammenspiel wurde dann lauter und schwellender, heftiger.
Die Streicher waren wie etwas Sich-Ballendes, Aufschreiendes und schließlich Sich-wieder-Zurückziehendes. Der Klang tröstete ihn fast, doch dann, als er an Lautstärke zunahm, durchdringender wurde, und der dunkle Unterton der Celli einsetzte und die Violinen und Bratschen zwang, höher über sie hinaus zu steigen, vermittelte ihm das Orchester nur noch das Gefühl seiner eigenen Begrenztheit.
Und dann begannen alle Instrumente, vom Dirigenten mit weit ausholenden Armen ermutigt, mit erstaunlicher Wucht zu spielen; in den Akkorden schwang etwas Militärisches, seltsamerweise zugleich aber auch Herzzerreißendes. Und sobald die Pauken gedröhnt und die Becken geschmettert hatten, erkannte er auch schon das allmähliche Langsamer-Werden, das nahende Ende.
Als das Publikum applaudierte, schloss er sich ihm nicht an. Er saß da und betrachtete die Bühne und die Leuchten und die Musiker, die sich für die Beethoven-Sinfonie vorbereiteten, mit der der Abend ausklingen würde. Als das Konzert zu Ende war, verspürte er keinen Wunsch, hinaus in die Nacht zu gehen. Er wollte von der Musik umfangen bleiben. Er fragte sich, ob es in dieser Menschenmenge noch andere gab, die seine Empfindung teilten, doch er glaubte es nicht.
Er war schließlich in Lübeck, und die Menschen neigten hier nicht zu solchen Gefühlswallungen. Diesen Leuten, dachte er, würde es nicht schwerfallen, die Erinnerung an die Musik, die sie gehört hatten, zu vergessen oder gleichgültig abzutun.
Während er weiter sitzen blieb, ging ihm auf, dass dies seinem Vater in den letzten Tagen seines Lebens, als er schon wusste, dass der Tod nahte, ein Trost hätte sein können: diese Idee eines steigenden, flutenden Klanges, der, überwältigend, eine Macht, die über alle irdische Macht hinausging, erahnen lassend, eine Tür in ein anderes Reich auftat, in dem der Geist überleben und überdauern würde, wo, war erst der Akt des Sterbens in seiner schieren Würdelosigkeit erduldet worden, ein Zur-Ruhe-Kommen möglich sein mochte.
Er dachte an den aufgebahrten Leichnam seines Vaters, gleichsam wie ausgestellt, formell gekleidet wie die Parodie eines schlafenden Mannes des öffentlichen Lebens, bereit zur Begutachtung. Der Senator lag da, kalt, gefasst, die Lippen abwärts gebogen und fest geschlossen, das Gesicht sich ändernd mit dem Licht, die Hände aller Farbe beraubt. Er erinnerte sich an die missbilligenden Mienen der Leute, als seine Mutter sich, eine Hand vor dem Gesicht, vom Sarg abgewandt hatte.
*
Thomas war auf dem Weg zu dem Haus, in dem ihn seine Mutter, aus dem Wunsche heraus, er möge sich in geordneterer Form auf seine Studien konzentrieren, bei Dr. Timpe, einem seiner Lehrer, in Pension untergebracht hatte. Morgen würde er sich aufs Neue der stumpfen Fron des Katharineums stellen müssen; er würde Gleichungen abschreiben und Grammatikregeln pauken und Gedichte auswendig lernen. Den ganzen Tag über würde er, wie es die anderen taten, so tun, als wäre das Ganze gleichsam naturgegeben, vorherbestimmt. Es war leichter, müßig darüber zu sinnieren, wie sehr er das Klassenzimmer verabscheute, als an sein richtiges Schlafzimmer zu denken — das, in dem er geschlafen hatte, bevor seine Mutter und Lula und Carla und Viktor nach München gezogen waren. Er wusste, wenn er jetzt daran dächte, wie warm und behaglich er es da gehabt hatte, würde er zu traurig werden. Er würde versuchen müssen, sich auf etwas anderes zu konzentrieren.
Er würde an Mädchen denken. Er wusste, dass die Bemühungen seiner Mitschüler, fleißig zu erscheinen, oft genug nur den Umstand verschleiern sollten, dass sie unablässig an Mädchen dachten. Wenn sie allerdings Witze rissen oder einschlägige Bemerkungen fallen ließen, verrieten diese gewöhnlich Befangenheit oder Gehemmtheit oder bemühte Großtuerei. Aber wenn er sie manchmal beobachtete, wie sie auf der Straße miteinander rangelten oder zu zweit oder zu dritt unter grobem Gelächter dahinschritten, erkannte er die verborgenen Energien.
Trotz des Stumpfsinns der Unterrichtsstunden erfüllte eine Ahnung von berauschender Erwartung die Luft, je weiter der Nachmittag fortschritt und die Aussicht darauf, alle zusammen endlich wieder ins Freie zu kommen, näher rückte. Und obwohl es durchaus sein konnte, dass seine Mitschüler auf ihrem Heimweg niemand Besonderem begegnen würden, versetzte sie, wie er begriff, die Möglichkeit, dass ihnen eine junge Frau auf der Straße entgegenkommen oder ein Mädchen an einem Fenster erscheinen könnte, in helle Aufregung.
Während er jetzt, nach dem Konzert, heimging, dachte er an die Obergeschossfenster dieser Häuser, wo vielleicht genau in diesem Moment, da er vorüberging, ein Mädchen sich bettfertig machte, seine Oberbekleidung ablegte, die Arme in die Höhe hob, um eine Bluse auszuziehen, oder sich bückte, um das, was sie darunter trug, abzustreifen.
Er richtete den Blick nach oben und sah in einem vorhanglosen Fenster ein flackerndes Licht; er fragte sich, was für eine Szene sich wohl in der Kammer abspielen würde. Er versuchte, sich vorzustellen, wie ein Paar diesen Raum betrat, worauf der Mann die Tür schloss; er sann über das Bild des Mädchens nach, das sich entkleidete, ihre weiße Unterwäsche und ihr weiches Fleisch. Doch als es darum ging, sich auszumalen, wie es sich wohl anfühlen mochte, der Mann zu sein, der bei ihr war, hielt er inne, scheuten seine Gedanken zurück. Er merkte, dass es ihm widerstrebte, was ihm erst einen Augenblick zuvor so plastisch vor Augen gestanden hatte, weiterzuverfolgen.
Er vermutete, dass auch seine Schulkameraden, wenn sie sich eine solche Szene ausmalten, von dem, was ohnehin nur in ihren geheimsten Träumen stattfinden konnte, nur sehr unklare Vorstellungen hatten.
Er würde warten, bis er in seinem kleinen Schlafzimmer wäre, hinten im Dachgeschoss von Dr. Timpes Haus, bevor er sich seinen Träumen hingäbe. Manchmal begann er, bevor er das Licht löschte, ein Gedicht, oder fügte einem, an dem er schon arbeitete, eine Strophe hinzu. Wenn er nach passenden Metaphern für die Labyrinthe der Liebe suchte, dachte er nicht an Mädchen in halbdunklen Kammern; er beschwor nicht die Intimität von Paaren herauf.
Es gab einen Jungen in der Klasse, mit dem er auf andere Weise intim war. Dieser Junge hieß Armin Martens. Wie Thomas war er sechzehn, sah aber jünger aus. Der Vater, ein Mühlenbesitzer, hatte Thomas’ Vater gekannt, obgleich die Familie Martens weniger Geld und weniger Einfluss besaß.
Als Armin Thomas’ Interesse an seiner Person bemerkte, zeigte er sich nicht überrascht. Er fing an, mit Thomas Spaziergänge zu machen, wobei er dafür sorgte, dass sich ihnen keine anderen Klassenkameraden anschlossen. Thomas war zugleich verstört und beeindruckt von Armins Fähigkeit, mit ihm über die Seele, über die wahre Natur der Liebe, über die bleibende Bedeutung von Dichtung und Musik zu reden und sich mit anderen Klassenkameraden mit der gleichen Leichtigkeit über Mädchen oder Turnen zu unterhalten.
Armin, erkannte Thomas, war mit jedem vollkommen unbefangen, sein Lächeln stets offen und herzlich, seine Ausstrahlung reizend und unschuldig.
Wenn Thomas in einem Gedicht seinem lyrischen Du anvertraute, er wünsche sich, das Haupt an seine Brust zu betten, oder mit ihm in der dunkelnden Dämmerung an einen Ort der Schönheit zu wandeln, wo sie vollkommen allein wären, wenn er vom Drange schrieb, den er empfand, sich mit der geliebten Seele zu vereinigen, so war die Person, an die er dachte, der Gegenstand seines Begehrens, Armin Martens.
Er fragte sich, ob Armin ihm noch ein Zeichen geben würde oder ob er, während eines ihrer Spaziergänge, zulassen würde, dass das Gespräch von Dichtung und Musik zu persönlicheren Dingen, zu ihren Gefühlen füreinander, überging.
Mit der Zeit begriff er, dass diese Spaziergänge ihm mehr bedeuteten als seinem Freund. Wenn er morgens aufwachte, wusste er, dass er sein Verhalten dementsprechend mäßigen, dass er Armin erlauben sollte, Abstand zu ihm zu gewinnen, wenn es denn das war, was sein Freund wünschte. Wenn er traurig darüber grübelte, wie wenig er realistischerweise von Armin erwarten konnte, ließ die Möglichkeit einer Zurückweisung sein Blut gleichsam zusammenzucken: ein stechend schmerzhaftes, dann beinahe befriedigendes Gefühl.
Solcherlei Gedanken waren so flüchtig wie eine Veränderung des Lichts oder eine plötzliche Kälte in der Luft. Sie waren nicht leicht zu fassen oder zu verfolgen. Und wie der Tag sich in seiner ganzen Öde und Gewöhnlichkeit entrollte, schwanden sie aus seinem Bewusstsein. In seiner Schulbank verwahrte er seine Gedichte nebst einigen Liebesgedichten der großen deutschen Meister, die er auf einzelnen Blättern abgeschrieben hatte. Während der Schulstunden holte er, sobald der Lehrer an der Tafel stand, eines dieser Blätter hervor und las verstohlen ein Gedicht, wobei er häufig kurze Blicke in Armin Martens’ Richtung warf, der eine Reihe vor ihm, auf der anderen Seite des engen Mittelganges saß.
Er fragte sich, wie Armin wohl reagieren würde, wenn er ihm diese Gedichte zeigte und auf diese Weise seine Gefühle offenbarte.
Manchmal gingen sie nur schweigend nebeneinanderher, Thomas ganz beglückt von dieser Nähe. Trafen sie jemanden, den sie kannten, hatte Armin eine freundliche, aber bestimmte Art, ihm klarzumachen, dass sie auf ihrem Spaziergang keine Gesellschaft wünschten.
Meistens, besonders zu Beginn ihrer Spaziergänge, überließ es Thomas dem Freund, die Richtung des Gespräches zu bestimmen. Ihm fiel auf, dass Armin nie schlecht von ihren Mitschülern oder Lehrern redete. Seine Weltsicht war tolerant und entspannt. Fiel beispielsweise der Name ihres Mathematiklehrers, Dr. Jimmerthal, den Thomas aus tiefstem Herzen verabscheute, so entlockte dies Armin lediglich ein Lächeln.
Wenn Thomas über Poesie und Musik sprechen wollte, lagen seinem Freund oft bodenständigere Themen auf der Seele, wie beispielsweise seine Reitstunden oder irgendein Spiel, an dem er teilgenommen hatte. Schaffte es aber Thomas einmal, auf bedeutendere Gegenstände überzuleiten, so änderte sich an Armins Betrachtungsweise nichts, sie blieb unverändert unbeschwert und oberflächlich.
Es waren seine Natürlichkeit, seine Ausgeglichenheit, seine freundliche Hinnahme der Welt, sein Freisein von Nervosität, Befangenheit oder Verstellung, die Thomas zu ihm hinzogen.
Als das Jahr voranschritt, bemerkte er, dass Armin sich allmählich veränderte, dass er größer und breitschultriger wurde, sich zu rasieren begann. Sein Freund, dachte er, war halb Junge, halb Mann. Dieser Gedanke erfüllte Thomas mit größerer Zärtlichkeit. Bei Nacht gelangte er zu der Gewissheit, dass es an der Zeit war, Armin seine Gefühle für ihn zu offenbaren. In diesen Augenblicken traf er den festen Entschluss, Armin sein neues Liebesgedicht zu zeigen, ein Gedicht, das nicht mehr verschwieg, dass Armin das Objekt seiner Liebe war.
In der ersten Strophe seines Gedichtes schrieb Thomas, dass sein Geliebter mit schön gesetzten Worten über Musik sprach. Und in der nächsten Strophe beschrieb er, wie sein Geliebter über Poesie sprach. In der Schlussstrophe schrieb er, dass der Gegenstand seiner Liebe die Schönheit beider, Musik und Poesie, in seiner Stimme und in seinen Augen vereinigte.
*
Eines Wintertages hielten sie beim Gehen ihre Mützen fest und senkten die Köpfe gegen den starken feuchten Wind, der in den entlaubten Bäumen rasselte und stöhnte. Thomas hatte das neue Gedicht zwar bei sich, doch er wusste, dass es trotz seiner früheren Entschlossenheit nicht möglich sein würde, es dem Freunde zu zeigen. Armin plapperte davon, wie viel Spaß es machen würde, sobald er wieder zu Hause wäre, das Treppengeländer hinunterzurutschen. Er klang wie ein Kind. Thomas sagte sich, dass es klüger sein könnte, das Gedicht zu verbrennen.
An anderen Tagen, insbesondere wenn es in Lübeck ein Konzert gegeben oder wenn Thomas ihn auf eines von Goethes Liebesgedichten aufmerksam gemacht hatte, konnte Armins Reaktion ernsthafter und gedankenvoller ausfallen. Als Thomas versuchte zu schildern, was er beim Anhören des Vorspiels zu Lohengrin empfunden hatte, musterte Armin ihn neugierig, nickte und gab ihm zu verstehen, dass er die von Thomas beschriebenen Emotionen vollkommen nachfühlen konnte. Während sie weitergingen, war sich Thomas gewiss, dass sie in dem Moment beide die Macht der Musik in sich spürten. Jetzt hatte er den Gefährten, den er sich erträumt hatte.
Er schrieb ein Gedicht darüber, dass Liebender und Geliebter schweigend vor sich hin gingen, beide denselben Gedanken nachhängend, während nur das Getöse des Windes sie noch voneinander trennte, nur die Nacktheit der Bäume sie daran erinnerte, dass nichts von Bestand war — nichts außer ihrer Liebe. In der letzten Strophe forderte der Dichter den Geliebten auf, für immer mit ihm zu leben und so, der Zeit trotzend, vereint in die Ewigkeit einzugehen.
Thomas war bewusst, dass Armin häufig von ihren Klassenkameraden wegen ihrer Freundschaft verspottet wurde. Er, Thomas, galt als jemand, dem die edleren männlichen Tugenden ermangelten, der zu sehr von sich eingenommen und zu sehr an Poesie interessiert war, sich zu viel auf die einstige Bedeutung seiner Familie in Lübeck zugutehielt. Er wusste, dass Armin das mit einem Lachen abtat und nicht einsah, warum er Thomas nicht als Freund behalten sollte. Es war offensichtlich, dass Armin ihn aufrichtig mochte. Dann würde es ihn doch wohl auch nicht überraschen, sollte Thomas ihm die Gedichte zeigen oder ihm auf andere Weise seine Gefühle offenbaren?
Eines Tages, in der Klasse, sah sich Armin, als der Lehrer gerade vor der Tafel stand, nach ihm um und lächelte ihm zu. Sein Haar war frisch gewaschen; seine Haut wirkte rein und wie lichtdurchflutet; seine Augen leuchteten. Thomas sah, wie schön er allmählich wurde. Ihm kam der Gedanke, dass Armin ihn jetzt möglicherweise ebenso bewusst wahrnahm wie er ihn. So wie ihn lächelte er keinen anderen an.
Sie hatten sich für den folgenden Tag zu einem Spaziergang verabredet. Der Wind war mild, und die Sonne sah immer wieder hervor, während sie in Richtung des Hafens schlenderten. Armin war in Hochstimmung, erzählte aufgeregt von einer Fahrt nach Hamburg, die er und sein Vater unternehmen wollten.
Sie waren eine Zeit lang so spaziert, immer wieder Pferden und Fuhrwerken und Männern, die Holz aufluden, ausweichend, als sie neugierig stehen blieben, weil von einem kleinen Pferdewagen einige Stämme heruntergefallen waren, was den Fuhrmann gezwungen hatte, anzuhalten und die Umstehenden um Hilfe beim Wiederaufladen zu bitten. Je mehr der Fuhrmann an die Hilfsbereitschaft der Hafenarbeiter appellierte, desto launiger wurden die Schmähungen, die sie, zu Thomas’ und Armins Belustigung, auf Plattdeutsch an ihn richteten.
»Ich wünschte, ich könnte auch so reden wie sie«, sagte Armin.