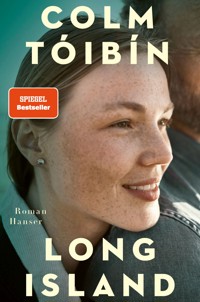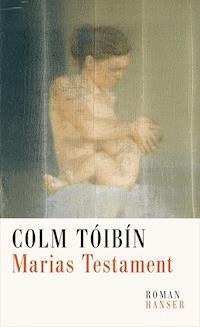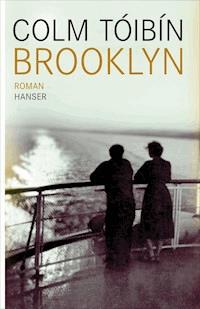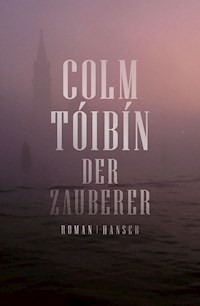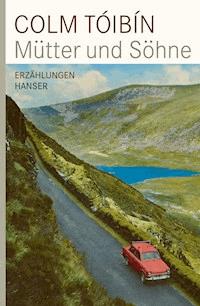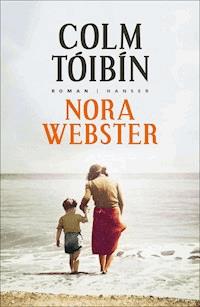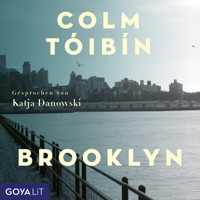Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Fesselnd, brutal und gegenwärtig: der neue Roman von Colm Toibin erzählt ein antikes Drama neu
Wieder vermag es Colm Tóibín meisterhaft einen klassischen Stoff völlig neu zu erzählen: Im geheimnisvollen Haus der Namen findet Orestes Zuflucht vor dem neuen Mann seiner Mutter. Diese hat nach der Opferung ihrer Tochter ihren Ehemann ermordet. Deswegen wird sie nun von ihrem Sohn Orestes und seiner Schwester Elektra angefeindet. Es beginnt ein blutiges Rachespiel zwischen Mutter, Tochter und zurückgekehrtem Sohn. Immer tiefer gerät Orestes zwischen die Fronten. Und dann ist da noch seine Liebe zu Leandros, die ihn vor eine Zerreißprobe stellt. „Grausam und quälend glaubhaft“ (The Guardian) zeichnet Tóibín das Porträt einer zerrissenen Familie und einer entgleisenden Mutter-Tochter-Beziehung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Fesselnd, brutal und gegenwärtig: der neue Roman von Colm Toibin erzählt ein antikes Drama neuWieder vermag es Colm Tóibín meisterhaft einen klassischen Stoff völlig neu zu erzählen: Im geheimnisvollen Haus der Namen findet Orestes Zuflucht vor dem neuen Mann seiner Mutter. Diese hat nach der Opferung ihrer Tochter ihren Ehemann ermordet. Deswegen wird sie nun von ihrem Sohn Orestes und seiner Schwester Elektra angefeindet. Es beginnt ein blutiges Rachespiel zwischen Mutter, Tochter und zurückgekehrtem Sohn. Immer tiefer gerät Orestes zwischen die Fronten. Und dann ist da noch seine Liebe zu Leandros, die ihn vor eine Zerreißprobe stellt. »Grausam und quälend glaubhaft« (The Guardian) zeichnet Tóibín das Porträt einer zerrissenen Familie und einer entgleisenden Mutter-Tochter-Beziehung.
Colm Tóibín
Haus der Namen
Roman
Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini
Carl Hanser Verlag
Für Hedi El Kholti
KLYTAIMNESTRA
ICH KENNE ihn inzwischen, den Geruch des Todes. Diesen eklig süßen Geruch, der mit dem Wind in die Zimmer des Palastes eindrang. Jetzt habe ich keine Mühe mehr, Frieden und Behagen zu empfinden. Meinen Morgen widme ich dem Himmel und dem wechselnden Licht. Sowie der Vogelgesang erklingt, füllt die Welt sich mit ihren eigenen Freuden, und dann, wenn der Tag abnimmt, nimmt auch sein Schall ab und schwindet. Ich sehe zu, wie die Schatten länger werden. So vieles ist davongeglitten, doch der Geruch des Todes bleibt. Vielleicht ist er in meinen Körper eingedrungen und dort wie ein alter Freund empfangen worden, der zu Besuch kommt. Der Geruch von Furcht und Panik. Der Geruch ist hier, so wie die Luft hier ist; er kehrt auf dieselbe Weise zurück, wie das Licht am Morgen wiederkehrt. Er ist mir ein ständiger Begleiter; er hat die Lebensgeister in meinen Augen geweckt. Augen, die vom Warten stumpf geworden waren, aber jetzt vor Lebendigkeit strahlen.
Ich befahl, dass die Leichen ein, zwei Tage lang offen in der Sonne liegen bleiben sollten, bis die Süße dem Gestank wich. Mir gefielen die heranschwirrenden Fliegen, ihre kleinen Leiber ratlos und tapfer, nach ihrem Festmahl summend und doch verstimmt durch den fortwährenden Hunger; einen Hunger, den auch ich kennen- und schätzen gelernt hatte.
Wir alle sind jetzt hungrig. Speisen wetzen lediglich den Appetit, schärfen unsere Zähne; Fleisch macht uns gierig nach mehr Fleisch, so wie der Tod weitere Tode verlangt. Mord macht uns heißhungrig, füllt die Seele mit einer Genugtuung, die erst heiß und dann saftigsüß genug ist, um ein Gelüst auf weitere Befriedigung zu zeugen.
Ein Messer sticht ins weiche Fleisch unter dem Ohr, sorgsam, intim, und zieht sich dann, so lautlos, wie die Sonne über den Himmel zieht, aber schneller, mit größerem Eifer, über die Kehle, und dann fließt sein dunkles Blut mit dem gleichen unvermeidlichen Schweigen, mit dem die dunkle Nacht Vertrautes einhüllt.
*
Sie schnitten ihr das Haar, bevor sie sie zur Opferstätte zerrten. Meiner Tochter waren die Hände fest hinter dem Rücken gebunden, die Haut an den Gelenken wund von den Stricken, und ihre Fußknöchel gefesselt. Ihr Mund war geknebelt, um sie daran zu hindern, ihren Vater weiter zu verfluchen, ihren feigen, doppelzüngigen Vater. Dennoch waren ihre erstickten Schreie zu vernehmen, als sie endlich begriff, dass ihr Vater wirklich vorhatte, sie zu ermorden, dass er ihr Leben wirklich für seine Armee opfern wollte. Sie hatten ihr das Haar hastig und nachlässig geschoren; eine der Frauen brachte es dabei fertig, mit einer rostigen Klinge in die Schädelhaut meiner Tochter zu schneiden, und als Iphigeneia zu fluchen begann, da banden sie ihr einen alten Lappen um den Mund, sodass ihre Worte nicht zu hören wären. Ich bin stolz, dass sie sich bis zum Ende wehrte, dass sie sich trotz ihrer schmeichlerischen Rede nicht ein einziges Mal, nicht einen Augenblick lang ihrem Schicksal fügte. Sie gab den Versuch nicht auf, die Schnur um ihre Fesseln zu lösen, oder das Seil um ihre Handgelenke, damit sie ihnen entfliehen könnte. Sie versuchte weiterhin, ihren Vater zu verwünschen, damit er die Wucht ihrer Verachtung spürte.
Niemand ist jetzt bereit, die Worte zu wiederholen, die sie in diesen Augenblicken sprach, bevor sie ihre Stimme erstickten, aber ich weiß, wie diese Worte lauteten. Ich hatte sie ihr beigebracht. Es waren Worte, die ich erfunden hatte, um ihren Vater und seine Gefolgsleute mit ihren albernen Zielen zunichtewerden zu lassen, es waren Worte, die verkündeten, was ihm und denen um ihn widerfahren würde, sobald sich herumgesprochen hätte, wie sie unsere Tochter, die stolze und schöne Iphigeneia, an diesen Ort zerrten, wie sie sie durch den Staub schleiften, um sie zu opfern, damit sie ihren Krieg gewännen. In jener letzten Sekunde ihres Lebens, sagte man mir, schrie sie so laut, dass ihre Stimme denen, die sie hörten, das Herz zerriss.
Ihren Schreien, als sie sie ermordeten, folgten Schweigen und Ränkeschmieden, als Agamemnon, ihr Vater, zurückkehrte und ich den Dummkopf glauben ließ, ich würde keine Rache üben. Ich wartete und hielt Ausschau nach Zeichen, lächelte, empfing ihn dann mit offenen Armen und hatte eine Tafel mit Speisen gerichtet. Nahrung für den Narren! Ich trug den besonderen Duft, der ihn erregte. Duft für den Dummkopf!
Ich war so bereit wie er unvorbereitet — er, mein Ehemann, der ruhmbedeckt-siegreich heimgekehrte Held, an den Händen das Blut seiner Tochter, doch jetzt reingewaschen, seine weißen Hände gleichsam frei von jeglichem Makel, seine Arme ausgebreitet, um seine Freunde zu umarmen, sein Gesicht ein einziges Lächeln, der große Soldat, der schon bald, wie er glaubte, zur Feier einen Becher erheben und sich nahrhafte Speisen in den Mund stecken würde. Sein klaffendes Maul! Erleichtert, wieder zu Hause zu sein!
Ich sah, wie sich seine Hände vor plötzlichem Schmerz verkrampften, wie sich seine Fäuste ballten in der grausigen, erschütterten Erkenntnis, dass es ihn am Ende doch erwischt hatte, und dazu in seinem eigenen Palast, im erschlafften Augenblick der Vorfreude auf die alte Steinwanne und das Behagen, das in ihr zu finden war.
Nur das, sagte er, hatte ihn zum Weitermachen angespornt, nur der Gedanke, was ihn dann erwartete: heilendes Wasser und Spezereien, weiche, reine Kleider und vertraute Luft und Klänge. Er war wie ein Löwe, der seine Schnauze auf die Pranken legte, sein Gebrüll verstummt, sein Körper schlaff, und jeder Gedanke an Gefahr fern und vergessen.
Ich lächelte und sagte, ja, auch ich hätte an den Empfang gedacht, den ich ihm dann bereiten würde. Er hatte mich Tag und Nacht begleitet, sagte ich ihm. Ich hatte von ihm geträumt, wie er sich durch und durch rein aus dem duftenden Wasser des Bades erhob. Ich sagte ihm, dass sein Bad vorbereitet wurde, während das Essen garte, der Tisch gedeckt wurde und seine Freunde sich versammelten. Und dorthin musste er jetzt gehen, sagte ich zu ihm, er musste in das Bad gehen. Er solle baden, im erleichterten Bewusstsein baden, wieder zu Hause zu sein. Ja, zu Hause. Genau dorthin kam der Löwe. Ich wusste, was ich mit dem Löwen machen würde, wenn er erst heimkam.
*
Ich hatte Späher, die mir melden würden, wenn er zurückkäme. Männer entzündeten ein um das andere Feuer, um die Nachricht von Hügel zu Hügel zu übermitteln und mich zu warnen. Es war das Feuer, das die Nachricht überbrachte — nicht die Götter. Unter den Göttern ist jetzt keiner, der mir Beistand böte, meine Handlungen überwachte oder mein Herz kannte. Es gibt keinen unter den Göttern, an den ich mich wenden würde. Ich lebe allein im schaudernden, einsamen Wissen darum, dass die Zeit der Götter vorbei ist.
Ich bete keine Götter an. Ich bin allein hier, weil ich als Einzige nicht bete und auch nie wieder beten werde. Stattdessen werde ich in gewöhnlichem Flüsterton sprechen. Ich werde in Worten sprechen, die ich der Welt entlehne, sie werden von Kummer erfüllt sein um das, was verloren ging. Ich werde Laute erzeugen, die wie Gebete klingen, aber Gebete, die keinen Ursprung haben und keine Bestimmung, nicht einmal eine menschliche, denn meine Tochter ist tot und kann sie nicht hören.
Ich weiß wie sonst niemand, dass die Götter uns fern sind — sie haben andere Belange. An menschlichen Wünschen und Possen nehmen sie ebenso Anteil wie ich an den Blättern eines Baumes. Ich weiß, dass die Blätter da sind, sie verdorren und wachsen wieder nach und verdorren erneut, ebenso wie Menschen kommen und leben und dann durch andere, Ähnliche ersetzt werden. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich ihnen helfen oder sie vor dem Verdorren bewahren könnte. Ich habe nichts mit ihrem Begehren zu schaffen.
Ich wünsche jetzt, hier zu stehen und zu lachen. Mich keckern und dann brüllen zu hören vor Vergnügen über die Vorstellung, die Götter hätten es meinem Ehemann gewährt, seinen Krieg zu gewinnen. Dass sie ihm jeden seiner Pläne und jeden seiner Entschlüsse eingegeben hätten, um seine trüben Launen am Morgen und die seltsame, alberne Hochgestimmtheit, die er nachts verströmen konnte, wussten, seinen flehentlichen Bitten lauschten und sie in ihren göttlichen Behausungen erörterten. Dass sie die Ermordung meiner Tochter beifällig ansähen.
Das Tauschgeschäft war simpel, glaubte er jedenfalls, oder glaubten seine Truppen. Töte das unschuldige Mädchen und erhalte im Gegenzug einen günstigen Wind. Reiße sie aus der Welt, steck ihr ein Messer ins Fleisch und stell dadurch sicher, dass sie nie wieder ein Zimmer betreten oder am Morgen aufwachen wird. Beraube die Welt ihrer Anmut. Und zur Belohnung würden die Götter ihrem Vater einen günstigen Wind senden, an dem Tag, wo er Wind bräuchte für seine Segel. An den anderen Tagen, wenn seine Feinde ihn brauchten, würden sie ihn stillen. Die Götter würden seine Männer wachsam und kühn machen und die anderen, seine Feinde, mit Furcht erfüllen. Die Götter würden seine Schwerter härten und sie flink und scharf machen.
Solange er lebte, glaubten er und seine Männer, dass die Götter ihre Schicksale verfolgten und Anteil an ihnen nahmen. An jedem einzelnen von ihnen. Aber jetzt werde ich verraten, dass es nicht so war, es nicht so ist. Unser Flehen gilt den Göttern so viel wie das Flehen, das ein Stern am Himmel über uns spricht, bevor er fällt, es ist ein Geräusch, das wir nicht einmal vernehmen können und das uns, gesetzt selbst, wir hörten es, vollkommen gleichgültig wäre.
Die Götter haben eigene, überirdische Sorgen, die wir uns nicht vorstellen können. Sie wissen bestenfalls, dass wir am Leben sind. Für sie, sollten sie jemals von uns hören, wären wir gleich dem sanften Rauschen des Windes in den Bäumen, ein fernes, unaufdringliches Geräusch.
Ich weiß, dass es nicht immer so war. Es gab eine Zeit, da uns die Götter allmorgendlich weckten, uns das Haar glätteten, unsere Münder mit der Süße der Rede füllten, unsere Wünsche erhörten und versuchten, sie uns zu erfüllen, da sie unsere Herzen kannten und uns Zeichen senden konnten. Vor gar nicht langer Zeit, noch in unserem Gedächtnis, konnte man nachts die Frauen schreien hören, kurz bevor der Tod kam. Es war eine Weise, die Sterbenden heim zu rufen, ihre Flucht zu beschleunigen, ihre schlingernde Irrfahrt zum Ruheort hin zu erleichtern. Mein Ehemann war bei mir in den Tagen, ehe meine Mutter starb, und wir beide hörten sie, und meine Mutter hörte sie ebenfalls, und es war ihr ein Trost, dass der Tod bereit war, sie mit seinen Schreien zu locken.
Dieses Geräusch ist verstummt. Kein Weinen-wie-der-Wind mehr. Die Toten gehen zu ihrer jeweils gegebenen Zeit. Niemand hilft ihnen, niemand nimmt Notiz außer denen, die ihnen während ihrer kurzen Weile auf Erden nahegestanden haben. Wenn sie von der Erde schwinden, schweben die Götter nicht mehr mit ihrem hohlen, pfeifenden Ton über den Dingen. Hier wird es mir bewusst, das Schweigen um den Tod. Sie sind fortgegangen, die Schirmherren des Todes. Sie sind fort, und sie werden nicht wiederkommen.
Mein Ehemann hatte Glück mit dem Wind, das war alles, und Glück, dass seine Männer tapfer waren, und Glück, dass er siegte. Es hätte leicht anders kommen können. Es wäre nicht nötig gewesen, unsere Tochter den Göttern zu opfern.
Meine Amme war seit meiner Geburt bei mir. In ihren letzten Tagen glaubten wir nicht, dass sie im Sterben lag. Ich saß bei ihr, und wir sprachen. Wenn der leiseste Klagelaut erklungen wäre, hätten wir ihn gehört. Da war nichts, kein Laut, der sie auf dem Weg zum Tod begleitet hätte. Nur die Stille, oder die gewohnten Geräusche aus der Küche, oder das Gebell der Hunde. Und dann starb sie, hörte auf zu atmen. Für sie war’s vorbei.
Ich ging nach draußen und sah zum Himmel hinauf. Die einzige Hilfe, die ich nun hatte, war die verbrauchte Sprache des Gebets. Was einst mächtig gewesen war und allem Sinn verlieh, war jetzt hoffnungslos, fremd, mit seiner traurigen brüchigen Macht, mit seiner in eigenen Rhythmen verschlossenen Erinnerung an eine strahlende Vergangenheit, in der unsere Worte emporstiegen und zur Erfüllung gelangten. Jetzt sind unsere Wörter zeitverhaftet, sie sind durch und durch begrenzt, sie sind schiere Ablenkungen; sie sind ebenso flüchtig und eintönig wie der Atem. Sie halten uns am Leben, und vielleicht ist das schon etwas, wofür wir, zumindest im Moment, dankbar sein sollten. Denn mehr gibt es nicht.
*
Ich habe die Leichen entfernen und begraben lassen. Der Abend dämmert. Ich kann die Läden zur Terrasse öffnen und die letzten goldenen Spuren der Sonne betrachten, und die Mauersegler, die Kurven durch die Luft reißen, wie Peitschenhiebe gegen das zähe gestrählte Licht. Während die Luft stockt, sehe ich die verschwommene Grenze dessen, was da ist. Es ist jetzt nicht die Zeit für Schärfe; ich will keine Schärfe mehr. Ich brauche keine Klarheit. Ich brauche eine Zeit wie jetzt, wo jedes Ding aufhört, es selbst zu sein, und sich dem Nächsten annähert, genauso wie jede Tat, die ich und andere verübten, aufhört, für sich selbst zu stehen, und darauf wartet, dass jemand kommt und sie beurteilt oder niederschreibt.
Nichts ist beständig, keine Farbe steht in diesem Licht still; die Schatten werden dunkler, und die Dinge auf der Erde verschmelzen miteinander, ebenso wie das, was wir alle taten, zu einer einzigen Tat verschmilzt, und all unsere Schreie und Gesten zu einem Schrei und einer Geste. Am Morgen, wenn das Licht durch die Dunkelheit reingewaschen ist, werden wir uns wieder der Klarheit und Einzigkeit stellen. Bis dahin ist der Ort, wo mein Gedächtnis wohnt, ein schattiger, zweideutiger Ort, geborgen von weichen, verwitternden Rändern, und das ist für den Augenblick genug. Ich könnte sogar schlafen. Ich weiß, dass mein Gedächtnis in der Fülle des Tageslichts sich wieder schärfen, exakt werden wird und das, was geschah, wie ein Dolch durchdringen wird, dessen Klinge für den Gebrauch gewetzt wurde.
*
Es gab eine Frau in einem der staubigen Dörfer jenseits des Flusses und weiter in Richtung der blauen Berge. Sie war alt und schwierig, aber sie verfügte über Kräfte, die mittlerweile keine andere mehr besaß. Sie setzte, wie man hörte, ihre Kräfte nicht leichtfertig ein, und meist war sie nicht bereit, sie überhaupt einzusetzen. In ihrem Dorf bezahlte sie oft Schwindlerinnen, Frauen, so alt und verhutzelt wie sie selbst, Frauen, die in offenen Türen saßen und mit schmalen Augen gegen die Sonne blickten. Die alte Frau bezahlte sie, damit sie sich für sie ausgaben und Besuchern weismachten, sie wären die mit den Kräften.
Wir hatten diese Frau beobachten lassen. Aigisthos, der Mann, der jetzt mein Lager teilt und sich gern dieses Reich mit mir teilen würde, hatte mit Hilfe von Männern, die ihm Gehorsam schuldeten, gelernt, zwischen den anderen Frauen, den Doppelgängerinnen, die keinerlei Kräfte besaßen, und der echten zu unterscheiden, die, wenn sie wollte, in jeden beliebigen Stoff Gift hineinweben konnte.
Wer diesen Stoff anlegte, erstarrte, wurde unfähig, sich zu bewegen, und verlor auch die Stimme, wurde vollkommen stumm. Wie plötzlich die Erschütterung oder heftig der Schmerz dann auch sein mochte, sie hatten nicht mehr die Fähigkeit zu schreien.
Ich plante, meinen Ehemann bei seiner Heimkehr zu überfallen. Ich würde ihn erwarten, mein Gesicht ein einziges Lächeln. Das gurgelnde Geräusch, das er erzeugen würde, wenn ich ihm die Kehle durchschnitt, wurde mir zur Besessenheit.
Die alte Frau wurde von den Wächtern hergebracht. Ich ließ sie in einen der inneren Vorratsräume sperren, eine trockene Kammer, in der Korn aufbewahrt wird. Aigisthos, dessen Überredungskünste der Fähigkeit der Frau, Tod zu verursachen, ebenbürtig waren, wusste, was er ihr sagen musste.
Aigisthos und die Alte waren gleichermaßen listig und verschlagen. Doch ich war klar. Ich lebte im Licht. Ich warf Schatten, aber ich lebte nicht im Schatten. Während ich mich auf die Tat vorbereitete, lebte ich in lauterer Helligkeit.
Was ich verlangte, war simpel. Es gab ein Gewand aus Netzgewebe, das mein Mann bisweilen trug, wenn er aus dem Bad kam. Ich wollte, dass die Alte darin Fäden einwob, Fäden, die, sobald das Netztuch seine Haut berührte, ihn unbeweglich machen würden. Die Fäden sollten so unsichtbar dünn werden, wie die Frau es nur fertigbrachte. Und Aigisthos schärfte ihr ein, dass ich nicht nur List verlangte, sondern auch Stillschweigen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand Agamemnons Schreie hörte, wenn ich ihn ermordete. Ich wollte nicht, dass man auch nur einen Ton von ihm vernahm.
Eine Zeitlang gab die Frau vor, nur eine der Schwindlerinnen zu sein. Und obwohl ich ausschließlich Aigisthos gestattete, zu ihr zu gehen und ihr Essen zu bringen, begann sie zu erraten, warum sie hier war, dass sie hierher gebracht worden war, um bei der Ermordung Agamemnons zu helfen, der Ermordung des Königs, des gewaltigen, blutdürstigen Kriegers, siegreich im Krieg, der bald in die Heimat zurückkehren würde. Die Alte glaubte, dass die Götter auf seiner Seite standen. Sie wünschte nicht, die Pläne der Götter zu durchkreuzen.
Ich hatte von Anfang an gewusst, dass sie sich sträuben würde, aber ich wusste auch aus Erfahrung, dass Leute, die am alten Glauben hingen, die glaubten, dass die Welt beständig war, letztlich leichter zu handhaben waren.
Ich übernahm es daher selbst, diese Frau gefügig zu machen. Ich hatte Zeit. Mit Agamemnons Ankunft war erst in Tagen zu rechnen, und wenn er im Anmarsch wäre, würde man mich warnen. Mittlerweile hatten wir Spione in seinem Lager und Späher auf den Hügeln. Ich überließ nichts dem Zufall. Ich plante jeden Schritt. In der Vergangenheit hatte ich allzu viel dem Glück und den Bedürfnissen und Launen anderer überlassen. Ich hatte zu vielen Leuten vertraut.
Ich befahl, die giftige Vettel zu einem der Fenster des Gangs vor ihrer Zelle zu führen. Ich ordnete an, dass man diese bösartige Kreatur hochhieve, damit sie in den ummauerten Garten spähen könnte. Ich wusste, was sie sehen würde. Sie würde ihre Enkelin sehen, ihren Goldschatz, das Licht ihres Lebens. Wir hatten das Kind aus dem Dorf entführt. Auch sie war unsere Gefangene.
Ich trug Aigisthos auf, der Alten zu sagen, dass, wenn sie das Gift einwob und es wirkte, sie und ihre Enkelin auf freien Fuß gesetzt und wieder heim gelassen werden würden. Ich befahl ihm, den nächsten Satz — den, der mit den Worten anfing: »Wenn du dich weigerst …« — unvollendet zu lassen und die Frau lediglich mit so deutlichem Vorsatz und Hass anzustarren, dass sie erzittern oder, wahrscheinlicher, sich alle Mühe geben würde, nicht die geringste Angst zu zeigen.
Es war also einfach. Das Einweben, sagte man mir, war eine Sache von Minuten. Obwohl Aigisthos der Frau bei der Arbeit zusah, konnte er, als sie fertig war, die neuen Fäden im Gewand nicht mehr finden. Als es getan war, bat sie ihn lediglich, ihre Enkelin, solange sie hier wäre, freundlich zu behandeln und dafür zu sorgen, dass, wenn sie ins Dorf zurückgebracht wurden, niemand sie kommen sah oder erfuhr, wer sie begleitet hatte oder wo sie gewesen waren. Sie starrte ihn kalt an, und er erkannte an ihrem Blick, dass die Aufgabe erfolgreich vollbracht war und dass der schöne Schadenzauber bei Agamemnon wirken würde.
*
Sein Schicksal war in Stein gemeißelt, als er Nachricht sandte, er wünsche, bevor die Schlachten begannen, die Hochzeit einer seiner Töchter auszurichten, sich mit einer Aura von Liebe und Neubeginn zu umgeben, die ihn stärker machen und seine Gefolgsleute mit sanfter Freude erfüllen sollte, ehe es ans Töten und Verwüsten ging. Unter den jungen Soldaten, sagte er, ragte Achilleus heraus, der Sohn des Peleus, ein Mann, dem es vorbestimmt war, ein noch größerer Held als sein Vater zu werden. Achilleus war gutaussehend, schrieb mein Ehemann, und selbst der Himmel würde aufleuchten, wenn er Achilleus sich, vor den ehrfurchtsvollen Blicken seiner Männer, mit unserer Tochter Iphigeneia vermählen sah.
»Komm mit dem Wagen«, lautete seine Botschaft. »Es wird drei Tage erfordern. Und geize mit nichts, wenn du ihre Hochzeit vorbereitest. Nimm Orestes mit. Er ist jetzt alt genug, sich an dem Anblick von Soldaten in den Tagen vor einer Schlacht zu ergötzen und Zeuge der Hochzeit seiner Schwester mit einem so edlen Manne wie Achilleus zu werden.
Und du sollst für die Zeit deiner Abwesenheit die Macht in die Hände Elektras legen, und ihr sagen, sie soll ihres Vaters gedenken und sie klug einsetzen. Die Männer, die ich zurückließ, die, die zu alt zum Kämpfen sind, werden sie beraten, sie mit ihrer Umsicht und Weisheit umgeben, bis ihre Mutter heimkehrt mit ihrer Schwester und ihrem Bruder. Sie muss so auf die Ältesten hören, wie ihre Mutter in meiner Abwesenheit auf sie hört.
Kehren wir dann aus dem Krieg zurück, soll die Gewalt in die rechten Hände zurückkehren. Nach dem Triumph wird Beständigkeit einkehren. Die Götter sind auf unserer Seite. Man hat mir versichert, dass sie auf unserer Seite sind.«
Ich glaubte ihm. Ich suchte Iphigeneia und eröffnete ihr, dass sie mich zum Lager ihres Vaters begleiten würde, um dort mit einem Krieger vermählt zu werden. Ich sagte ihr, die Näherinnen würden den ganzen Tag und die ganze Nacht arbeiten müssen, um die Kleider zu richten, die wir für sie mitnehmen würden. Ich fügte Agamemnons Worten meine eigenen Worte hinzu. Ich erzählte meiner Tochter, dass Achilleus, ihr Verlobter, ein Mann von sanfter Rede war. Und ich fügte noch weitere Worte hinzu, Worte, die mir jetzt bitter nachschmecken, Worte voller Schmach. Dass er tapfer war, bewundert wurde, und dass sein Zauber trotz seiner Kraft nicht verroht war.
Ich wollte noch mehr sagen, als Elektra hereinkam und fragte, worüber wir flüsterten. Ich erklärte ihr, Iphigeneia, um ein Jahr älter als sie, sollte verheiratet werden, und sie lächelte und drückte ihrer Schwester die Hände, als ich sagte, Iphigeneias Schönheit habe sich herumgesprochen, sie sei schon vielerorts bekannt und Achilleus würde sie erwarten, und ihr Vater sei sich sicher, dass man sich in fernen Zeiten Geschichten von der Braut an ihrem Hochzeitstag erzählen würde; von dem leuchtenden Himmel und der Sonne hoch am Himmel und den lächelnden Göttern und den Soldaten, die in den Tagen vor der Schlacht durch das Licht der Liebe tapfer und gestählt worden waren.
Ja, ich sagte Liebe, ich sagte Licht, ich sagte Götter, ich sagte Braut. Ich sagte Soldaten, gestählt vor der Schlacht. Ich sagte seinen Namen und ihren Namen. Iphigeneia, Achilleus. Und dann rief ich die Schneiderinnen herein, damit sie begännen, meiner Tochter eine Robe anzufertigen, die ihrer Herrlichkeit gleichkäme, welche ihrerseits am Tag ihrer Hochzeit dem Glanz der Sonne in nichts nachstehen würde. Und ich sagte zu Elektra, dass ihr Vater ihr genug vertraute, um sie hier bei den Ältesten zu lassen, dass ihr scharfer Verstand und ihr Geschick ihren Vater mit Stolz erfüllten.
Einige Wochen darauf, eines goldenen Morgens, begleitet von einigen unserer Frauen, brachen wir auf.
*
Als wir eintrafen, wartete Agamemnon schon auf uns. Er kam uns langsam entgegen, mit einer Miene, die ich noch nie gesehen hatte. Sein Gesicht, meinte ich, verriet Kummer, aber auch Überraschung und Erleichterung. Vielleicht auch noch mehr, aber das war, was mir im Augenblick auffiel. Kummer, dachte ich, weil er uns vermisst hatte, er lange fort gewesen war und er sich anschickte, seine Tochter fortzugeben; und Überraschung, weil er sich uns so lange vorgestellt hatte und wir jetzt leibhaftig da waren, und Orestes, jetzt acht, größer geworden war, als sein Vater es sich erträumt hatte, ebenso wie Iphigeneia mit sechzehn aufgeblüht war. Und er strahlte Erleichterung aus, dachte ich, weil wir unversehrt waren, und er unversehrt war, und wir beieinander sein konnten. Als er kam und mich umarmte, ging eine gequälte Wärme von ihm aus, aber als er zurücktrat und die Soldaten musterte, die mit ihm gekommen waren, sah ich die Macht in ihm, die Macht des Führers, der zum Kampf bereit war, der nur Kriegskunst, Entscheidungen im Sinn hatte. Von seinen Männern umgeben, war Agamemnon das Inbild reinen Willens. Ich erinnere mich, in unserer ersten Ehezeit wie fortgerissen gewesen zu sein von diesem Willen, dessen Bild ich an diesem Tag sogar noch intensiver sah.
Auch sah ich, dass er, anders als andere Männer seiner Art, bereit war zuzuhören — oder es sein würde, wenn ich erst allein mit ihm wäre.
Und dann nahm er Orestes hoch und lachte und trug ihn zu Iphigeneia.
Er war die Liebenswürdigkeit in Person, als er sich Iphigeneia zuwandte. Und wie ich sie ansah, war es so, als sei ein Wunder geschehen, als sei eine Frau mit einer Aura von Zärtlichkeit, gepaart mit Zurückhaltung, mit einer Distanz zu gewöhnlichen Dingen, unberufen auf die Erde herabgestiegen. Ihr Vater machte Anstalten, sie, den Jungen noch immer im Arm, zu umarmen, und hätte da jemand gefragt, wie Liebe aussah, hätte einer von denen, die in den Kampf zogen, ein Bild von der Liebe gebraucht, als Schutz und Ansporn in der Schlacht: Da war die Antwort, wie etwas Kostbares, in Stein gehauen — der Vater, der Sohn, die Tochter, die zärtlich zuschauende Mutter, die Sehnsucht im Antlitz des Vaters und das ganze Mysterium der Liebe, ihre Wärme, ihre Reinheit, als Agamemnon seinen Sohn behutsam neben sich hinunterließ, damit er seine Tochter in die Arme nehmen könnte.
Ich sah es, und ich bin mir dessen sicher. In diesen Sekunden war es da.
Aber es war nicht echt.
Doch keiner von uns Reisenden ahnte die Wahrheit auch nur eine Sekunde lang, obwohl manche der anderen Umstehenden, vielleicht sogar die meisten von ihnen, es gewusst haben mussten. Aber keiner von ihnen gab ein Zeichen, verriet auch nur das Geringste.
Der Himmel blieb blau, die Sonne heiß am Himmel, und die Götter — o ja, die Götter! —, sie schienen an diesem Tag unserer Familie zu lächeln, der künftigen Braut und ihrem kleinen Bruder, mir und ihrem Vater, wie er jetzt dastand in liebender Umarmung und wie er am Ende siegreich in der Schlacht von seinem Heer umjubelt stehen würde. Ja, die Götter lachten an jenem Tag, an dem wir in aller Unschuld eintrafen, um Agamemnon bei der Ausführung seines Plans zu helfen.
*
Am Tag nach unserer Ankunft holte mein Ehemann Orestes frühmorgens ab, um ihm ein Schwert und einen leichten Brustpanzer machen zu lassen, sodass er wie ein Krieger aussehen würde. Frauen kamen, um Iphigeneia zu sehen, und es war viel Wirbel und Erstaunen, als sie die von uns mitgebrachten Kleider bewunderten, und viel Rufen nach kalten Getränken und viel Falten und Entfalten der Gewänder. Nach einer Weile zog ich mich in die Gasse zwischen unserem Quartier und der Küche zurück, ich belauschte das müßige Geschwätz der Leute, bis eine der Frauen erwähnte, dass draußen einige Soldaten herumstanden. Einer der Namen, die sie nannte, war Achilleus.
Wie seltsam, dachte ich, dass er so in die Nähe unseres Zeltes kommt! Und dann dachte ich: Nein, es war nicht seltsam, er kam in der Hoffnung, einen Blick auf Iphigeneia zu erhaschen. Natürlich kam er! Wie begierig musste er doch sein, sie zu sehen!
Ich trat auf den Vorplatz hinaus und fragte die Soldaten, welcher von ihnen Achilleus sei. Es war der Hochgewachsene, erfuhr ich, der allein dastand. Als ich näher kam, drehte er sich um und sah mich an, und da erkannte ich etwas an seinem Blick, an dessen Unmittelbarkeit, und an dem Klang seiner Stimme, als er seinen Namen nannte, an der Ehrlichkeit, die darin mitschwang: Das wird das Ende unserer Probleme sein, dachte ich. Achilleus ist uns gesandt worden, damit er dem, was vor meiner Geburt, vor der Geburt meines Ehemannes begann, ein Ende setzt. Irgendein Gift in unserem Blut, in all unserem Blut. Alte Verbrechen und Rachegelüste. Alte Morde und Erinnerungen an Morde. Alte Kriege und alter Verrat. Alte Barbarei, alte Überfälle, Zeiten, als Männer sich wie Wölfe verhielten. Jetzt, da dieser Mann meine Tochter heiratet, wird es enden, dachte ich. Ich sah die Zukunft als einen Ort des Überflusses. Ich sah Orestes im Lichte dieses jungen Soldaten heranwachsen, der mit seiner Schwester verheiratet war. Ich sah ein Ende der Zwietracht, eine Zeit, in der Männer mit Behagen alt werden würden und Schlachten nur noch Gegenstand prahlerischer Reden wären, wenn die Nacht hereinbrach und die Erinnerungen an die zerhackten Leiber und die heulenden Stimmen, die sich meilenweit über irgendwelche blutgetränkten Ebenen erhoben, nach und nach verblassten. Dann konnten sie stattdessen über Helden reden.
Als ich Achilleus sagte, wer ich war, lächelte er und nickte, wodurch er zu verstehen gab, dass er mich schon kannte, und wandte sich dann ab. Ich rief ihn zurück und bot ihm meine Hand dar, damit er zum Zeichen dessen, was bald geschehen würde, und um künftiger Jahre willen seine Hand mit der meinigen vereinigte.
Ein Stoß durchfuhr seinen Körper, als ich sprach, und er sah sich um, vergewisserte sich, dass wir keine Zuschauer hatten. Ich verstand seine Scheu und rückte ein paar Schritte von ihm ab, bevor ich wieder sprach.
»Da du meine Tochter heiratest«, sagte ich, »wirst du doch wohl meine Hand berühren dürfen!«
»Heiraten?«, fragte er. »Mich treibt es in die Schlacht. Ich kenne deine Tochter nicht. Dein Ehemann …«
»Ich kann mir vorstellen«, unterbrach ich ihn, »dass mein Ehemann dich gebeten hat, während dieser Tage vor dem Fest Abstand zu halten — aber von meiner Tochter, nicht von mir! In den kommenden Tagen wird sich das alles ändern, aber wenn es dir unangenehm ist, vor deiner Hochzeit mit meiner Tochter im Gespräch mit mir gesehen zu werden, dann muss ich mich wieder zu den Frauen begeben und fern von dir halten.«
Ich sprach leise. Der Ausdruck in seinem Gesicht verriet Qual, Verwirrung.
»Du irrst«, sagte er. »Ich warte auf den Kampf, nicht auf eine Braut. Es wird keine Hochzeiten geben, solange wir darauf warten, dass der Wind umschlägt, darauf warten, dass unsere Schiffe nicht weiter gegen die Felsen geschleudert werden. Darauf warten …«
Er runzelte die Stirn, dann schien er sich zu zügeln, um das, was er zu sagen angefangen hatte, nicht zu vollenden.
»Vielleicht«, sagte ich, »hat mein Ehemann meine Tochter hierhergerufen, damit ihr nach der Schlacht —«
»Nach der Schlacht werde ich heimkehren«, unterbrach er. »Wenn ich die Schlacht überlebe, werde ich heimkehren.«
»Meine Tochter ist hierhergekommen, um dich zu heiraten«, sagte ich. »Sie wurde von ihrem Vater, meinem Mann, hierherbestellt.«
»Du irrst dich«, sagte er, und erneut sah ich Anmut, jetzt durch Ernst und Entschlossenheit gehärtet. Eine Sekunde lang hatte ich eine Vision der Zukunft, einer Zukunft, die Achilleus für uns ermöglichen würde, eine künftige Zeit an einem Ort voll wohlgepolsterter Winkel und behäbiger Schatten, und dort würde ich alt werden, während Achilleus reifte und meine Tochter Iphigeneia Mutter wurde und Orestes zur Weisheit erwuchs. Plötzlich ging mir auf, dass ich in dieser künftigen Welt keinen Platz für Agamemnon erkennen konnte, und Elektra konnte ich ebenfalls nicht sehen. Ich erstarrte einen Augenblick lang, und eine drohende dunkle Abwesenheit nahm mir beinahe den Atem. Ich versuchte, beide in das Bild hineinzustellen, und es misslang. Ich konnte keinen von beiden sehen, und da war noch etwas anderes, was ich nicht sehen konnte, als Achilleus seine Stimme erhob, wie um meine Aufmerksamkeit zu wecken.
»Du irrst dich«, sagte er wieder, dann sprach er leiser weiter. »Dein Ehemann muss dir doch erklärt haben, warum deine Tochter hierhergerufen wurde.«
»Mein Ehemann«, sagte ich, »hieß uns lediglich bei unserer Ankunft willkommen. Sonst sagte er nichts.«
»Dann weißt du es also nicht?«, fragte er. »Ist es denn möglich, dass du es nicht weißt?«
Seine Miene hatte sich verfinstert, seine Stimme war an der letzten Frage fast zerbrochen.
Ich krümmte meinen Rücken, als ich mich von ihm wegbewegte und dorthin zurückkehrte, wo meine Tochter und die Frauen beisammen waren. Sie nahmen mich kaum wahr, da sie gerade irgendein Stück Näharbeit bewunderten, irgendein Stück Stoff in die Höhe hielten. Ich saß allein, abseits von ihnen.
*
Ich weiß nicht, wer Iphigeneia verriet, dass sie nicht verheiratet, sondern geopfert werden sollte. Ich weiß nicht, wer ihr mitteilte, dass sie nicht Achilleus zum Ehemann, sondern die Kehle durchgeschnitten bekommen würde, mit einem dünnen scharfen Messer unter freiem Himmel, während viele Zuschauer, einschließlich ihres eigenen Vaters, sie angafften und eigens zu diesem Zweck abgestellte Figuren Bittgebete an die Götter rezitierten.
Als die Frauen gegangen waren, sprach ich mit Iphigeneia; da wusste sie es noch nicht. Aber im Verlauf der nächsten ein, zwei Stunden, während wir auf Orestes’ Rückkehr warteten, während ich wach lag und sie im Zimmer ein und aus ging, teilte es ihr jemand kurz und unzweideutig mit. Wie ich erkannte, hatte ich mir selbst vorgegaukelt, dass es eine einfache Erklärung dafür geben musste, warum Achilleus nichts von der geplanten Heirat wusste. Ein paarmal durchzuckte mich eine stechende Ahnung der Wahrheit, aber es erschien völlig abwegig, dass jemand beabsichtigen sollte, Iphigeneia ein Leid anzutun, da mein Ehemann uns doch vor den Augen seiner Gefolgsleute auf diese Weise begrüßt hatte und die Frauen aus seinem Lager so neugierig gewesen waren, die Kleider zu sehen.
Im Geiste durchlief ich noch einmal mein Gespräch mit Achilleus, erwog jedes einzelne Wort. Als Iphigeneia zu mir kam, war ich gewiss, dass ich bis zum Einbruch der Dunkelheit beruhigende Nachricht erhalten und alles sich aufklären würde. Selbst als sie zu sprechen begann, als sie mir verriet, was sie erfahren hatte, war ich mir dessen noch sicher.
»Wer hat dir das gesagt?«, fragte ich.
»Eine der Frauen kam mit dem Auftrag, es mir zu sagen.«
»Welche von ihnen?«
»Ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass sie den Auftrag erhielt, es mir zu sagen.«
»Auftrag von wem?«
»Von meinem Vater«, entgegnete sie.
»Wie können wir uns da sicher sein?«, fragte ich.
»Ich bin mir sicher«, sagte sie.
Wir saßen da und warteten, dass Orestes wiederkäme, damit wir seinen Begleiter, wer immer es wäre, anflehen könnten, uns zu Agamemnon zu führen oder uns zu gestatten, ihm eine Botschaft zu schicken, dass er kommen und mit uns sprechen möchte. Manchmal hielt Iphigeneia meine Hand, drückte sie und ließ sie dann wieder los, seufzte, kniff die Augen vor Entsetzen zu und schlug sie wieder auf, um blind in die Ferne zu starren. Auch noch während wir warteten, meinte ich, dass nichts geschehen würde, dass all dies vielleicht gar nichts war, dass die Idee, Iphigeneia den Göttern zu opfern, ein Gerücht war, das die Frauen in die Welt gesetzt hatten, und dass sich solche Gerüchte unter nervösen Soldaten und deren Gefolgsleuten in den Tagen vor einer Schlacht leicht verbreiteten.
Als meine Tochter wieder meine Hand ergriff und sie fester und heftiger drückte, schwankte ich zwischen nervöser Unsicherheit und einer Ahnung, dass es zum Schlimmsten kommen würde. Ein paarmal fragte ich mich, ob wir nicht fliehen konnten, ob wir nicht zusammen in die Nacht hinein losziehen und uns nach Hause durchschlagen konnten, oder an irgendeinen sicheren Ort, ob ich nicht jemanden suchen sollte, der Iphigeneia mitnähme, sie verkleidete, ein Versteck für sie fände. Aber ich wusste nicht, welche Richtung wir dann hätten einschlagen müssen, und ich wusste, dass man uns verfolgen und finden würde. Seit er uns hierhergelockt hatte, ließ uns Agamemnon beobachten und bewachen, dessen war ich mir sicher.
Stundenlang saßen wir schweigend beieinander. Niemand kam in unsere Nähe. Langsam begriff ich, dass wir Gefangene waren, und zwar schon seit dem Augenblick unserer Ankunft. Man hatte uns getäuscht und betrogen. Agamemnon hatte erkannt, wie sehr mich der Gedanke einer Hochzeit begeistern würde, und das war die Strategie, die er einsetzte, um uns hierherzulocken. Nichts anderes hätte funktioniert.
Als Erstes hörten wir Orestes’ Stimme, lautstark im Spiel, und dann, zu meinem Entsetzen, die seines Vaters. Als sie beide erschienen, mit leuchtenden Augen, erhitzt, standen wir auf und traten ihm entgegen. Augenblicklich erkannte Agamemnon, dass die Frau, die er geschickt hatte, Iphigeneia gemäß seinem Befehl unterrichtet hatte. Er neigte den Kopf, dann hob er ihn wieder und brach in Gelächter aus. Er befahl Orestes, uns das Schwert zu zeigen, das eigens für ihn geschmiedet und geschliffen worden war, und befahl ihm, uns die Rüstung zu zeigen, die gleichfalls für ihn angefertigt worden war. Er zog seinerseits das Schwert und hielt es in gespieltem Ernst Orestes herausfordernd entgegen, worauf der, unter der achtsamen Anleitung seines Vaters, mit diesem die Klingen kreuzte und Kampfhaltung einnahm.
»Er ist ein großer Krieger«, sagte Agamemnon.
Wir musterten ihn kalt, teilnahmslos. Einen Augenblick lang wollte ich nach Orestes’ Amme rufen, damit sie den Jungen mitnähme, ihn ins Bett steckte, aber was immer es war, was sich zwischen Agamemnon und Orestes abspielte, es hielt mich davon ab. Es war so, als spürte Agamemnon, dass er diese Rolle des Vaters mit seinem Jungen unbedingt weiterspielen musste. In der Luft, oder in unseren Mienen, lag etwas so Inständiges, dass mein Ehemann erkannt haben musste: Wenn er sich jetzt entspannte und uns zuwandte, würde das Leben umschlagen und nie wieder dasselbe sein.
Agamemnon würdigte mich jetzt keines Blickes, ebenso wenig sah er Iphigeneia an. Je länger sein Schwertspiel sich hinzog, desto klarer wurde mir, dass er Angst vor uns hatte — oder Angst vor dem, was er uns würde sagen müssen, wenn es vorbei wäre. Er wollte nicht, dass es aufhörte. Er war kein mutiger Mann, als er weiterspielte.
Ich lächelte, weil ich wusste, dass dies die letzten glücklichen Momente waren, die mir in meinem ganzen Leben je vergönnt sein würden, und dass mein Mann sie, in seiner ganzen Schwäche, so weit wie möglich in die Länge zog. Es war alles nur Theater, alles nur Schau, dieses Scheingefecht zwischen Vater und Sohn. Ich sah, wie Agamemnon es am Leben hielt, indem er Orestes’ Begeisterung wachhielt, ohne ihn zu erschöpfen, indem er ihm das Gefühl vermittelte, dass er sein Können vorführte, und den Jungen so dazu brachte, immer mehr und mehr leisten zu wollen. Er demonstrierte uns, wie er Orestes lenkte.
Einen Moment lang erkannte ich, dass es genau das war, was die Götter mit uns machten — sie lenkten uns mit Scheinkonflikten ab, mit dem Getümmel des Lebens, lenkten uns auch mit Illusionen von Liebe, Schönheit, Harmonie ab, während sie kalt, unbeteiligt zuschauten und auf den Augenblick warteten, da das Ganze endete, die Erschöpfung einsetzte. Sie hielten sich heraus, so wie wir uns heraushielten. Und wenn’s vorbei war, zuckten sie die Achseln. Es interessierte sie nicht mehr.
Orestes wollte nicht, dass das Scheingefecht endete, aber die Regeln ließen ihnen nur wenig Spielraum. Einmal kam der Junge zu dicht an seinen Vater heran und war schutzlos dessen Klinge ausgeliefert. Als Agamemnon ihn daraufhin sanft zurückstieß, wurde ihm bewusst, dass es nur ein Spiel war und dass wir das gesehen und ebenfalls bemerkt hatten. Diese Erkenntnis bewirkte, dass Orestes schnell jedes Interesse verlor und ebenso schnell müde und reizbar wurde. Trotzdem wollte er immer noch nicht, dass es endete. Als ich nach der Amme rief, brach Orestes in Tränen aus. Er wollte die Amme nicht, sagte er, als sein Vater ihn in die Arme nahm und ihn wie ein Stück Brennholz in unsere Schlafgemächer trug.
Iphigeneia sah mich nicht an, ebenso wenig ich sie. Wir blieben beide stehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging.
Als Agamemnon erschien, ging er schnell zur Tür des Zeltes und drehte sich dann um.
»Ihr wisst es also, alle beide?«, fragte er leise.
Ungläubig nickte ich.
»Es gibt nichts mehr zu sagen«, flüsterte er. »Es muss sein. Bitte glaub mir, dass es sein muss.«
Bevor er uns verließ, warf er mir einen leeren Blick zu. Dann zuckte er fast mit den Schultern und breitete die Arme aus, die Handteller nach oben gewandt. Er sah wie jemand aus, der keine Macht hatte, oder er führte mir und Iphigeneia vor, wie ein solcher Mensch aussehen würde. Geschrumpft, leicht zu täuschen oder breitzuschlagen.
Der große Agamemnon machte durch seine Haltung deutlich, dass jegliche Entscheidung, die in dieser Angelegenheit gefallen war, nicht von ihm, sondern von anderen gefällt worden war. Er ließ den Eindruck entstehen, dass die ganze Sache ihm all seine Kräfte nahm, als er hinaus in die Nacht stürzte, zu seinen wartenden Wächtern.
Dann herrschte ringsum Stille, die Stille, die nur dann entstehen kann, wenn eine Armee schläft. Iphigeneia kam zu mir, und ich nahm sie in meine Arme. Sie weinte nicht, schluchzte nicht. Es fühlte sich so an, als würde sie sich nie wieder bewegen — und dann würde man uns, wenn der Morgen käme, so zusammen finden.
*
Bei Sonnenaufgang zog ich los und suchte im Lager nach Achilleus. Als ich ihn fand, wich er vor mir zurück, aber gleichermaßen aus Stolz wie aus Furcht, aus Gründen des Anstands wie aus der Angst heraus, uns könnte jemand sehen. Ich trat dicht an ihn heran, aber ich flüsterte nicht.
»Meine Tochter wurde durch eine List hierhergelockt. In deinem Namen.«
»Auch ich nehme es ihrem Vater übel.«
»Ich falle dir zu Füßen, wenn es sein muss. Kannst du mir in meinem Unglück helfen? Kannst du dem Mädchen helfen, das hierherkam, um deine Braut zu werden? Nur deinetwegen ließen wir die Näherinnen Tag und Nacht arbeiten. Die ganze Aufregung galt nur dir. Und jetzt erfährt sie, dass sie abgeschlachtet werden soll. Was werden die Männer von dir denken, wenn sie von diesem Betrug erfahren? Ich habe sonst niemanden, den ich anflehen könnte, also flehe ich dich an. Wenn schon aus keinem anderen Grund, musst du mir um deines eigenen Namens willen helfen. Leg deine Hand auf meine, dann werde ich wissen, dass wir gerettet sind.«
»Deine Hand berühre ich nicht. Das werde ich erst dann tun, wenn ich es geschafft habe, Agamemnon umzustimmen. Dein Ehemann hätte meinen Namen nicht als Köder missbrauchen dürfen.«
»Wenn du sie nicht heiratest, wenn du versagst —«
»Dann bedeutet mein Name nichts. Mein ganzes Leben nichts. Nur Ohnmacht, nur ein Name, mit dem man ein Mädchen in die Falle lockte.«
»Ich kann meine Tochter hierherholen. Lass uns beide vor dich treten.«
»Lass sie bleiben, wo sie ist. Ich werde mit deinem Ehemann reden.«
»Mein Ehemann …«, sagte ich und verstummte.
Achilleus sah sich nach der Schar von Männern um, die uns am nächsten standen.
»Er ist unser Anführer«, sagte er.
»Wenn du Erfolg hast, sollst du belohnt werden«, sagte ich.
Er sah mich unbewegt an, hielt meinem Blick stand, bis ich mich abwandte und allein durch das Lager zurückging. Männer traten mir aus dem Weg, machten sich unsichtbar, als wäre ich in meinen Bemühungen, die Opfergabe zu verhindern, eine grässliche Seuche, die das Lager heimsuchte, schlimmer noch als der Wind, der ihre Schiffe gegen die Felsen geschmettert hatte, um dann mit noch größerem Grimm wiederaufzuleben.
Als ich unser Zelt erreichte, hörte ich Iphigeneia weinen. Das Zelt war voll von Frauen — den wenigen, die mit uns gereist waren, denen, die schon am Tag zuvor gekommen waren, und dazu noch einigen Nachzüglerinnen, die durch ihre Anwesenheit dazu beitrugen, meine Tochter mit einer Stimmung von Weltuntergang zu umgeben. Als ich schrie, sie sollten gehen, und sie mir nicht gehorchten, zerrte ich eine von ihnen beim Ohr zur Öffnung des Zeltes und ging, nachdem ich sie hinausgestoßen hatte, auf die Nächste los, bis sich alle, außer den Frauen, die mit uns gereist waren, nach draußen bequemten.
Iphigeneia hatte die Hände vors Gesicht geschlagen.
»Was ist geschehen?«, fragte ich.
Eine der Frauen erzählte uns dann, dass drei grob aussehende Männer in voller Rüstung nach mir gesucht hätten. Als man ihnen sagte, ich wäre nicht da, glaubten sie, ich hätte mich versteckt, und durchwühlten die Wohnräume, die Schlafgemächer und die Küche. Und dann gingen sie und nahmen Orestes mit. Iphigeneia fing an zu weinen, als die Frauen mir erzählten, dass man ihren Bruder mitgenommen hatte. Er trat und wand sich, sagten sie, als er fortgeschleppt wurde.
»Wer hat diese Männer geschickt?«, fragte ich.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Niemand wollte antworten, bis eine Frau schließlich doch sprach.
»Agamemnon«, sagte sie.
Ich forderte zwei der Frauen auf, mit in den Schlafraum zu kommen, um meinen Körper und meine Kleidung vorzubereiten. Sie wuschen mich, gaben Parfüm und süße Spezereien in das Wasser und halfen mir, meine Kleider auszuwählen und mein Haar zu richten. Sie fragten mich, ob sie mich begleiten sollten, aber ich entschied, dass ich mich allein auf die Suche nach meinem Ehemann machen würde, dass ich überall im Lager seinen Namen rufen, dass ich jeden bedrohen und einschüchtern würde, den ich sah und der mir nicht half, ihn zu finden.
Als ich endlich sein Zelt fand, trat mir einer seiner Männer in den Weg und fragte, was ich von ihm wollte.
Ich wollte ihn gerade beiseiteschieben, als Agamemnon herauskam.
»Wo ist Orestes?«, fragte ich.
»Er lernt, wie man ein Schwert richtig handhabt«, erwiderte er. »Man wird sich gut um ihn kümmern. Dort sind auch andere Jungen seines Alters.«
»Warum hast du Männer nach mir ausgeschickt?«
»Um dich wissen zu lassen, dass es bald geschehen wird. Zuerst werden die Färsen getötet werden. Sie sind jetzt auf dem Weg zum angesetzten Ort.«
»Und dann?«
»Und dann unsere Tochter.«
»Sag ihren Namen!«
Ich wusste nicht, dass Iphigeneia mir gefolgt war, und ich weiß noch heute nicht, wie sie sich von dem schluchzenden, furchtsamen und untröstlichen Mädchen in die gefasste junge Frau verwandelt hatte, die jetzt, einsam und ernst, auf uns zukam.
»Du brauchst meinen Namen nicht zu sagen«, unterbrach sie. »Ich kenne meinen Namen.«
»Sieh sie dir an. Sie willst du töten?«, fragte ich Agamemnon.
Er erwiderte nichts.
»Antworte auf die Frage«, sagte ich.
»Ich muss vieles erklären«, sagte er.
»Beantworte erst die Frage«, sagte ich. »Gib Antwort! Und dann kannst du erklären.«
»Ich habe von deiner Abgesandten erfahren, was du mir antun möchtest«, sagte Iphigeneia. »Du brauchst auf nichts zu antworten.«
»Warum willst du sie töten?«, fragte ich. »Was für Gebete wirst du sprechen, während sie stirbt? Welche Segnungen wirst du dir erbitten, während du deinem Kind die Kehle durchschneidest?«
»Die Götter …«, sagte er und verstummte. Er brachte es nicht über sich, eine von uns beiden anzusehen.
»Lächeln die Götter Männern, die ihre Töchter töten lassen?«, fragte ich. »Und wenn sich der Wind immer noch nicht dreht, wirst du dann auch Orestes töten? Ist er deswegen hier?«
»Orestes? Nein!«
»Soll ich auch nach Elektra schicken?«, fragte ich. »Willst du auch für sie einen Ehemann erfinden und auch sie täuschen?«
»Schweig!«, sagte er.
Als Iphigeneia auf ihn zukam, schien er sich fast vor ihr zu fürchten.