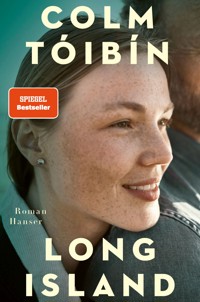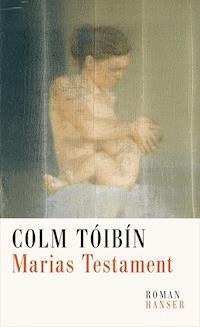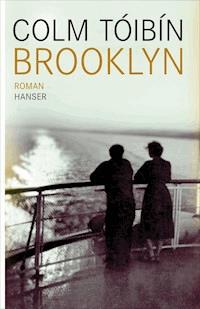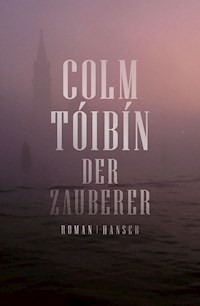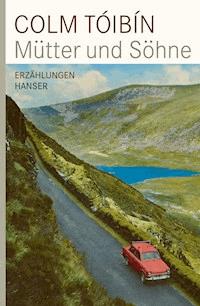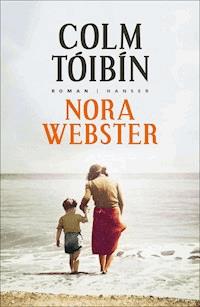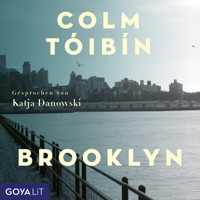Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mit großem Einfühlungsvermögen schildert Colm Toibin das Leben von Henry James: Enttäuscht vom mittelmäßigen Erfolg seiner Romane wendet er sich der Bühne zu. Ein Theaterskandal in London ist die Folge. Henry James verlässt England, geht auf Reisen und lebt in Rom, Venedig und Paris. Ein originelles Buch über die Einsamkeit und Sehnsucht eines Mannes, der Zeit seines Lebens unfähig war, seine Träume von der großen Leidenschaft mit seiner eigenen Fragilität in Einklang zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 656
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henry James, geboren Mitte des 19. Jahrhunderts in New York, Spross einer berühmten amerikanischen Intellektuellenfamilie, der vielen als der bedeutendste angloamerikanische Erzähler um die Wende zum 20. Jahrhundert gilt, ist der Held von Colm Tóibíns neuem Roman. Er beginnt mit einem Wendepunkt im Leben von James: Enttäuscht vom mittelmäßigen Erfolg seiner Romane, wendet er sich der Bühne zu, doch es kommt in London zu einem regelrechten Theaterskandal, und er geht auf Reisen, lebt in Rom, Venedig und Paris inmitten einer privilegierten internationalen Gemeinschaft. Tóibín schildert mit großer emotionaler Intensität die Einsamkeit und die Sehnsüchte eines Mannes, der sich seiner sexuellen Identität nie ganz sicher war und dessen Versuche, mit anderen Menschen zu größerer Intimität zu gelangen, regelmäßig scheiterten. Der Schriftsteller, der in seinen Werken ein unübertreffliches psychologisches Feingefühl bewies, nicht zuletzt bei seinen Frauengestalten (Bildnis einer Dame, Daisy Miller, Die Flügel der Taube), war oft blind gegenüber den Regungen seines eigenen Herzens, unfähig, seine Träume von der großen Leidenschaft mit seiner eigenen Fragilität in Einklang zu bringen.
"Colm Tóibín führt uns ganz nah heran an die Seele des großen Schriftstellers und damit auch an das Geheimnis der Kunst überhaupt. Ein bemerkenswertes, absolut originelles Buch." Michael Cunningham (Die Stunden)
Hanser E-Book
Colm Tóibín
Porträt des Meisters in mittleren Jahren
Roman
Aus dem Englischen Giovanni und Ditte Bandini
Carl Hanser Verlag
Für Bairbre Stack und Michael Stack
Inhalt
Erstes Kapitel
Januar 1895
Zweites Kapitel
Februar 1895
Drittes Kapitel
März 1895
Viertes Kapitel
April 1895
Fünftes Kapitel
Mai 1896
Sechstes Kapitel
Februar 1897
Siebtes Kapitel
April 1898
Achtes Kapitel
Juni 1898
Neuntes Kapitel
März 1899
Zehntes Kapitel
Mai 1899
Elftes Kapitel
Oktober 1899
Erstes Kapitel
Januar 1895
Manchmal träumte er nachts von den Toten – vertrauten Gesichtern und den anderen, halbvergessenen, flüchtig heraufbeschworenen. Als er jetzt aufwachte, war es nach seinem Gefühl eine Stunde oder mehr vor Morgengrauen; es würde noch einige Zeit lang kein Geräusch, keine Bewegung wahrzunehmen sein. Er betastete seine steif gewordenen Nackenmuskeln; unter den Fingern fühlten sie sich hart und fest an, ohne zu schmerzen. Als er den Kopf bewegte, knirschten die Muskeln. Ich höre mich an wie eine alte Tür, dachte er.
Er wußte, daß er unbedingt wieder einschlafen mußte. Er konnte nicht so viele Stunden wach liegen. Er wollte schlafen, in eine tröstliche Schwärze eintreten, eine dunkle, aber nicht zu dunkle Ruhestätte, gespensterleer, menschenleer, ohne schwankende Gestalten.
Als er wieder aufwachte, war er unruhig und wußte nicht gleich, wo er war. Er wachte oft so auf, verwirrt, lediglich mit einer unklaren Erinnerung an den Traum und mit dem verzweifelten Wunsch, der Tag möge endlich beginnen. Manchmal wärmte er sich im Halbschlaf im dunstigen milden Licht von Bellosguardo zu Anfang des Frühlings, wenn alles in der Ferne verschwamm und er sich, dicht bei der Wand des alten Hauses im Sessel sitzend, im Duft der Glyzinien, der frühen Rosen und des Jasmins, dem köstlichen Gefühl des Sonnenlichts auf seinem Gesicht hingab. Wenn er dann aufwachte, hoffte er, der Tag könnte wie der Traum werden; die Spur des Behagens und der Farbe und des Lichts würde die Dinge mit einem Goldrand umgeben, bis die Nacht wieder hereinbräche.
Aber dieser Traum war anders. Es war, oder es wurde gerade, irgendwo dunkel, es war eine Stadt, eine alte italienische Stadt wie Orvieto oder Siena, aber eben kein bestimmter Ort, sondern eine Traum-Stadt mit engen Straßen, die er hastig entlangging; er war nicht sicher, ob er allein oder mit jemandem zusammen war, aber er hatte es eilig, und da waren auch Studenten, die langsam den Hügel hinaufschlenderten, an erleuchteten Geschäften und Cafés und Restaurants vorbei, und er bemühte sich, sie zu überholen, sie irgendwie hinter sich zu lassen. Sosehr er sich auch zu erinnern versuchte, er war immer noch nicht sicher, ob ihn jemand begleitete; vielleicht ja, vielleicht ging aber auch lediglich jemand hinter ihm her. Es gelang ihm nicht, sich diese schattenhafte zeitweilige Präsenz genauer zu vergegenwärtigen, aber in regelmäßigen Abständen schien eine Person oder eine Stimme bei ihm zu sein, die den Grund der Dringlichkeit, der Notwendigkeit zur Eile besser als er begriff und leise murmelnd auf ihn einredete, ihn zu überzeugen suchte, schneller zu gehen, die Studenten beiseite zu drängen.
Warum träumte er das? Er erinnerte sich, daß er an jeder langen trübbeleuchteten Einmüdung in einen Platz drauf und dran gewesen war, die menschenwimmelnde Straße zu verlassen, aber dann drängte es ihn, weiterzugehen. Trug ihm sein geisterhafter Begleiter auf, weiterzugehen? Schließlich betrat er eine weite italienische Piazza, rundherum Türme und zinnenbewehrte Dächer, oben ein dunkler, fast tintenblauer Himmel, glatt und fugenlos. Er stand da und schaute, als wäre es ein gerahmtes Bild, und nahm die Symmetrie und stoffliche Beschaffenheit in sich auf. Diesmal – und ihn fröstelte, als er sich die Szene vergegenwärtigte – standen in der Mitte Gestalten, die ihm den Rücken zukehrten, im Kreis aufgestellte Gestalten, deren Gesichter er nicht sehen konnte. Er wollte schon auf sie zugehen, als sie sich umwandten. Eine der Gestalten war seine Mutter am Ende ihres Lebens, seine Mutter, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Zwischen den anderen Frauen stand, nicht weit von ihr, seine Tante Kate. Beide waren schon seit Jahren tot; sie lächelten ihm zu und näherten sich langsam. Ihre Gesichter waren wie Gesichter in einem Gemälde. Das Wort, das ihm in den Sinn kam – er war sicher, daß er das Wort ebenso geträumt hatte wie die Szene selbst –, war »flehentlich«. Sie flehten ihn oder sonst jemanden an, baten, beschworen ihn, und dann streckten sie die Hände wie Bittsteller aus, und als sie fast bei ihm waren, schreckte er in eisiger Furcht aus dem Schlaf, und er wünschte sich, sie hätten etwas gesagt oder er hätte den beiden Menschen, die er in seinem Leben am meisten geliebt hatte, etwas Trost spenden können. Der Traum hinterließ in ihm eine erschöpfende, nagende Traurigkeit und – da er wußte, daß er nicht wieder einschlafen durfte – das übermächtige Verlangen, sich ans Schreiben zu machen, sofort, bloß um sich zu betäuben, sich abzulenken von der Vision dieser beiden Frauen, die für ihn verloren waren.
Als er noch einmal an die eine Sekunde des Traums dachte, die ihn aus dem Schlaf hatte hochschrecken lassen, bedeckte er einen Augenblick lang sein Gesicht. Er hätte jetzt viel dafür gegeben, diese Sekunde vergessen zu können, sie daran zu hindern, ihm in den Tag zu folgen: Auf diesem Platz hatte er seiner Mutter unverwandt in die Augen geschaut, und ihr Blick war voller Angst gewesen, ihr Mund bereit zum Aufschrei. Es verlangte sie inbrünstig nach etwas für sie Unerreichbarem, Ungreifbarem, und er konnte ihr nicht helfen.
In den Tagen zwischen den Jahren hatte er jede Einladung abgelehnt. Er schrieb Lady Wolseley, er sehe sich den ganzen Tag Proben an in Gesellschaft mehrerer dicker Frauen, die die Kostüme schneiderten. Er war unsicher und besorgt, oft ängstlich erregt, aber manchmal riß ihn die Handlung auf der Bühne auch so mit, als wäre sie ihm völlig neu, und berührte ihn. Er bat Lady Wolseley und ihren Mann, am nicht mehr fernen Tag der Premiere seines Stücks für ihn zu beten.
Am Abend konnte er nichts tun, und sein Schlaf war unruhig. Er sah niemanden außer den Dienstboten, und die wußten, daß sie ihn nicht ansprechen oder über das absolut unvermeidliche Maß hinaus stören durften.
Sein Stück Guy Domville, die Geschichte eines reichen katholischen Erben, der sich entscheiden muß, ob er sein Geschlecht fortsetzen oder ins Kloster eintreten soll, hatte am 6. Januar Uraufführung. Alle Einladungen zur Premiere waren abgeschickt worden, und er hatte schon viele Zusagen und Dankschreiben erhalten. Alexander, der Regisseur und Hauptdarsteller, hatte eine eigene Verehrergemeinde, und die Kostüme – das Stück spielte im 18. Jahrhundert – waren prächtig. Doch trotz der Freude, die er neuerdings an der Gesellschaft von Schauspielern und an dem Glanz und den täglichen kleinen Veränderungen und Verbesserungen der Inszenierung hatte, war er, wie er es nannte, nicht für das Theater geschaffen. Mit einem Seufzer setzte er sich an seinen Schreibtisch. Er wünschte, es wäre ein gewöhnlicher Tag und er könnte die gestrigen Sätze durchlesen, einen geruhsamen Vormittag mit Korrekturen zubringen und dann aufs neue beginnen, den Nachmittag mit gewöhnlicher Arbeit ausfüllen. Und dennoch wußte er, daß seine Stimmung sich so rasch ändern konnte wie das Tageslicht im Zimmer, daß er ohne weiteres nur noch Freude an seinem Leben im Theater empfinden und die Gesellschaft seiner leeren Blätter aufs neue zu hassen beginnen konnte. Das mittlere Alter, dachte er, hatte ihn launenhaft gemacht.
Seine Besucherin war pünktlich um elf Uhr gekommen. Er hätte sich unmöglich weigern können, sie zu empfangen; ihr Brief war von einer behutsamen Hartnäckigkeit gewesen. Bald würde sie für immer von Paris wegziehen, und dies wäre ihr letzter Aufenthalt in London. Es lag etwas seltsam Endgültiges und Entsagungsvolles in ihrem Ton – einem Ton, der ihrem sonstigen Wesen so fremd war, daß er rasch den Ernst ihrer Lage erkannte. Er hatte sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, doch im Laufe dieser Jahre hatte er einige Briefe von ihr erhalten und von anderen immer wieder Neuigkeiten über sie erfahren. An diesem Morgen aber, da ihm sein Traum noch immer zusetzte und er wegen seines Stücks so besorgt war, sah er sie lediglich als einen Namen in seinem Tagebuch, der eine Erinnerung aufrührte, scharf umrissen, aber in den Details verblaßt.
Als sie ins Zimmer trat – ein warmes Lächeln im gealterten Gesicht, die Bewegungen ihrer grobknochigen Gestalt langsam und gemessen, ihre Begrüßung so fröhlich, offen und liebevoll, ihre Stimme so schön und leise, fast ein Flüstern –, fiel es ihm leicht, seine Sorgen über sein Stück und die Selbstvorwürfe wegen der Zeit, die er hier vergeudete, anstatt im Theater zu sein, hintanzustellen. Er hatte vergessen, wie gern er sie mochte und wie leicht es war, sich in jene Zeit zurückversetzen zu lassen, als er in den Zwanzigern war und sich in Paris so lange und so oft wie möglich in der Gesellschaft französischer und russischer Schriftsteller aufgehalten hatte.
In den folgenden Jahren waren ihm die dunkleren Gestalten – sei es, daß sie keine Bekanntheit erlangt hatten, daß sie gescheitert waren oder überhaupt nie Erfolg angestrebt hatten – irgendwie ebenso interessant geworden wie die berühmten. Sein Gast war mit Fürst Oblisky verheiratet gewesen. Der Fürst hatte den Ruf eines ernsten und reservierten Menschen; das Schicksal Rußlands und sein demonstrativ gewähltes Exil interessierten ihn mehr als das Amüsement eines Abends und die glänzende Gesellschaft, in der er sich befand. Die Fürstin war ebenfalls Russin, hatte jedoch den größten Teil ihres Lebens in Frankreich zugebracht. Um sie und ihren Mann rankten sich Andeutungen, Gerüchte und Vermutungen in großer Zahl. Er sagte sich, daß das der Zeit und dem Ort angemessen war. Jeder seiner Bekannten war von der Aura eines Lebens umgeben, das zur Hälfte geheim und zur Hälfte öffentlich war: man wußte davon, sprach aber nicht darüber. In jenen Jahren musterte man jedes Gesicht nach allem, was es unbeabsichtigt verraten mochte, und man achtete aufmerksam auf Nuancen und Hinweise. In New York und Boston war es nicht so gewesen, und in London – als er sich schließlich dort niederließ – gestatteten sich die Menschen zu glauben, man habe kein verborgenes und geheimes Ich, solange man nicht ausdrücklich das Gegenteil behauptete.
Er erinnerte sich an den Schock, als er Paris kennengelernt hatte, die Kultur des zwanglosen Doppelspiels, das Gefühl, das ihm diese Männer und Frauen vermittelt hatten, die von den Romanciers beobachtet wurden und das, was ihnen am meisten bedeutete, mühelos für sich behielten.
Er hatte noch nie eine Schwäche für das Intrigenspiel gehabt. Dennoch wußte er sich gern im Besitz von Geheimnissen, denn nicht Bescheid zu wissen bedeutete, fast alles zu verpassen. Er wiederum lernte, seinerseits nie irgend etwas zu verraten und niemals auch nur zu erkennen zu geben, daß er gerade etwas Neues erfahren hatte, sondern so zu tun, als wären nur Belanglosigkeiten ausgetauscht worden. Die Männer und Frauen in den Pariser literarischen Salons bewegten sich wie die Akteure in einem Spiel des Wissens und Nichtwissens, der Verstellung und Verkleidung. Er wurde ihr gelehriger Schüler.
Er half der Fürstin, Platz zu nehmen, holte ihr zusätzliche Kissen und bot ihr dann einen anderen Sessel an, besser gesagt eine Chaiselongue, die sie vielleicht bequemer fände.
»In meinem Alter«, sagte sie lächelnd, »ist nichts bequem.«
Er ging nicht länger im Zimmer umher, sondern wandte sich ihr zu. Er wußte aus Erfahrung, daß er nur seine ruhigen grauen Augen wortlos auf jemanden zu richten brauchte, damit auch der andere ruhig wurde; dann begriff sein Gegenüber, so bildete er sich jedenfalls ein, daß seine nächste Äußerung etwas Ernsthaftes beinhalten sollte, daß die Zeit für unverbindliches Geplauder zu Ende war.
»Ich muß nach Rußland zurück«, sagte sie in langsamem, sorgfältig artikuliertem Französisch. »Mir bleibt keine andere Wahl. Wenn ich ›zurück‹ sage, tue ich so, als wäre ich schon früher in Rußland gewesen, und das stimmt auch, aber nicht in dem Sinne, daß es mir das mindeste bedeuten würde. Ich habe keinerlei Verlangen, Rußland wiederzusehen, er aber besteht darauf, daß ich dort bleibe und Frankreich endgültig verlasse.«
Sie lächelte, während sie sprach, so wie sie es von jeher getan hatte, aber jetzt spiegelten sich in ihrem Gesicht Kummer und etwas wie Ratlosigkeit. Sie hatte die Vergangenheit mit ins Zimmer gebracht, und in diesen Jahren nach dem Tod seiner Eltern und seiner Schwester beinhaltete jede Erinnerung an eine Zeit, die vergangen war, eine schreckliche und lastende Melancholie. Die Zeit würde kein Erbarmen haben, und in seiner Jugend hatte er sich niemals vorgestellt, welchen Schmerz der Verlust mit sich bringen würde, einen Schmerz, den mittlerweile einzig Arbeit und Schlaf in Schach halten konnten.
Ihre leise Stimme und ihre ungezwungene Art bewiesen, daß sie sich nicht verändert hatte. Es war bekannt, daß ihr Mann sie schlecht behandelte. Er hatte Probleme mit seinen Landgütern. Jetzt sprach sie von einem entlegenen Gut, auf das sie verbannt werden sollte.
Das Januarlicht füllte den Raum wie eine seidenweiche Flüssigkeit. Er saß da und hörte ihr zu. Er wußte, daß Fürst Oblisky seinen Sohn aus erster Ehe in Rußland zurückgelassen und selbst nur wiederwillig sein Leben in Paris verbracht hatte. Er war stets von einem Hauch der politischen Intrige umweht, von der unbestimmten Ahnung, daß er in der Zukunft Rußlands eine Rolle spielen würde und auf diesen Moment wartete.
»Mein Mann hat gesagt, es sei für uns alle an der Zeit, nach Rußland zurückzukehren, in die Heimat. Er ist ein Reformer geworden. Er sagt, Rußland werde ohne Reformen zusammenbrechen. Ich erwiderte, Rußland sei schon vor langer Zeit zusammengebrochen, aber ich habe ihn nicht daran erinnert, daß ihn Reformen sehr wenig interessierten, solange er keine Schulden hatte. Die Familie seiner ersten Frau hat das Kind aufgezogen und will mit dem Vater nichts zu tun haben.«
»Wo werden Sie wohnen?« fragte er.
»Ich werde in einem zerfallenden Herrenhaus wohnen, und halbverrückte Bauern werden sich die Nasen an den Scheiben meiner Fenster platt drücken, sofern die Fenster noch Scheiben haben. Da werde ich wohnen.«
»Und Paris?«
»Ich muß alles aufgeben, das Haus, die Dienstboten, meine Freunde, mein ganzes Leben. Ich werde erfrieren oder mich zu Tode langweilen. Es wird ein Wettrennen zwischen den beiden Möglichkeiten werden.«
»Aber warum?« fragte er sanft.
»Er sagt, ich habe sein ganzes Geld vergeudet. Ich habe das Haus verkauft und tagelang nichts anderes getan, als Briefe zu verbrennen und zu weinen und Kleider wegzuwerfen. Und jetzt verabschiede ich mich von allen. Morgen verlasse ich London und werde einen Monat in Venedig verbringen. Dann fahre ich nach Rußland. Er sagt, andere würden ebenfalls zurückkehren, aber die gehen nach Sankt Petersburg. Für mich hat er einen anderen Ort vorgesehen.«
Sie sprach voller Gefühl, aber während er sie beobachtete, kam es ihm vor, als hörte er einer seiner Schauspielerinnen zu, die ihre Rolle genußvoll darstellte. Bisweilen sprach sie so, als erzählte sie eine amüsante Anekdote, die sie nicht selbst betraf.
»Ich habe jeden meiner Bekannten, der noch am Leben ist, wiedergesehen, und von all denen, die gestorben sind, habe ich die Briefe wiedergelesen. Bei manchen habe ich beides getan. Ich habe Paul Joukowskys Briefe verbrannt und ihn anschließend gesehen. Ich hatte nicht erwartet, ihn zu sehen. Er wird alt. Das hatte ich ebensowenig erwartet.«
Eine Sekunde lang kreuzten sich ihre Blicke, und es war, als wäre ein Schwall von klarem Sommerlicht ins Zimmer gefallen. Paul Joukowsky mußte mittlerweile fast fünfzig sein; sie hatten sich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Noch nie war jemand einfach so vorbeigekommen und hatte seinen Namen erwähnt.
Henry bemühte sich angelegentlich, nicht sofort etwas zu erwidern, eine Frage zu stellen oder das Thema zu wechseln. Vielleicht hatte irgend etwas in den Briefen gestanden – ein beiläufiger Satz, die Schilderung eines Gesprächs oder einer Begegnung. Aber er glaubte es nicht. Vielleicht teilte ihm die Besucherin lediglich aus nostalgischen Gründen mit, was seine Aura, sein öffentliches Ich in all den Jahren zu erkennen gegeben hatte. Seine Bemühungen um Ernst, Zurückhaltung und Höflichkeit hatten Frauen wie sie, die seinen üppigen Mund und den Ausdruck in seinen Augen bemerkten und sofort alles durchschauten, niemals getäuscht. Natürlich sagten sie nichts, ebenso wie sie jetzt nichts sagte, lediglich einen Namen aussprach, einen alten Namen, der ihm in den Ohren widerhallte. Einen Namen, der ihm einst alles bedeutet hatte.
»Aber Sie werden doch bestimmt zurückkommen …?«
»Das ist das Versprechen, das ich ihm geben mußte: niemals zurückzukehren, für immer in Rußland zu bleiben.«
Ihr Ton war dramatisch, und plötzlich sah er sie auf der Bühne stehen, sich beiläufig bewegen, so sprechen, als dächte sie sich nichts dabei, und dann einen Pfeil abschießen, eine einzelne Zeile, dazu bestimmt, ins Schwarze zu treffen. Ihre Worte ließen ihn begreifen, was geschehen war. Sie mußte einen sehr schlimmen Fehltritt begangen haben, um sich ihrem Mann wieder so zu unterwerfen. In ihren Kreisen würde man wissen und spekulieren. Manche würden Bescheid wissen, und andere würden es sich denken können. So wie es jetzt ihm überlassen war, es zu erraten.
Diese Gedanken beschäftigten ihn, und er merkte, daß er die Fürstin beobachtete, das von ihr Gesagte sorgfältig erwog und sich überlegte, wie er es verwenden könnte. Er mußte es niederschreiben, sobald sie gegangen wäre. Er hoffte, nichts weiter zu erfahren, kein konkretes Detail, aber als sie weitersprach, zeigte sich, daß sie Angst hatte, und wieder erwachte sein Mitgefühl.
»Wissen Sie, andere sind ebenfalls zurückgekehrt, und die Berichte klingen hervorragend. Sankt Petersburg ist zu neuem Leben erwacht, aber, wie ich Ihnen schon sagte, ich gehe nicht dorthin. Und Daudet, den ich auf einem Fest getroffen habe, sagte etwas ungemein Dummes zu mir. Vielleicht glaubte er, es könne mich trösten. Er sagte, daß meine Erinnerungen bleiben würden. Aber was soll ich mit Erinnerungen? Ich sagte ihm, mir sei noch nie etwas an Erinnerungen gelegen gewesen. Ich liebe das Heute und das Morgen, und wenn ich in Stimmung bin, liebe ich auch das Übermorgen. Letztes Jahr ist vergangen, wen kümmert schon letztes Jahr?«
»Anscheinend Daudet.«
»Ja, und zwar viel zu sehr.«
Sie erhob sich, und er begleitete sie zur Tür. Als er sah, daß sie eine Droschke hatte warten lassen, fragte er sich, wer dafür aufkam.
»Und Paul? Hätte ich Ihnen ein paar seiner Briefe geben sollen? Wäre Ihnen etwas daran gelegen?«
Henry reichte ihr die Hand, als hätte sie die Frage nicht gestellt. Er bewegte die Lippen, wie um etwas zu sagen, hielt aber dann inne. Er hielt ihre Hand einen Augenblick fest in seiner. Als sie auf die Droschke zuging, weinte sie beinah.
Er wohnte in diesen Zimmern in De Vere Gardens schon seit fast zehn Jahren, aber der Name Paul war hier nicht ein einziges Mal ausgesprochen worden. Seine Gegenwart war unter dem alltäglichen Geschäft des Schreibens, Erinnerns und Vorstellens begraben. Selbst in Träumen war Paul seit Jahren nicht mehr aufgetaucht.
Die schlichten Fakten, die ihm die Fürstin erzählt hatte, brauchte er jetzt nicht aufzuschreiben. Er würde sie nicht vergessen. Er wußte nicht, was er daraus machen würde, ob es ihre letzten Tage in Paris sein würden – wie sie Briefe verbrannt, Dinge verschenkt und zurückgelassen hatte –, ihr letzter Empfang oder ihr Gespräch mit ihrem Ehemann, der Augenblick, in dem sie von ihrem Schicksal erfahren hatte.
Ihren Besuch würde er in Erinnerung behalten, aber etwas anderes mußte er jetzt aufschreiben. Etwas, was er schon früher geschrieben und dann wohlweislich vernichtet hatte. Es erschien ihm seltsam, traurig beinah, daß er so viel produziert und veröffentlicht, so viel Intimes abgehandelt hatte und daß dennoch das eine, das zu schildern er sich am meisten berufen fühlte, niemals formuliert oder veröffentlicht, von niemandem jemals erfahren oder verstanden werden würde.
Er nahm die Feder auf und begann. Er hätte unleserlich schreiben oder eine Kurzschrift verwenden können, die nur er entziffern konnte. Aber er schrieb klar und deutlich, die Worte mitflüsternd. Er wußte nicht, warum es niedergeschrieben werden mußte, warum es nicht ausreichte, daß die Erinnerung wachgerufen worden war. Aber der Besuch der Fürstin und das, was sie über Verbannung und Erinnerung gesagt hatte, über Dinge, die vorbei waren und nie wiederkehren würden, und – jetzt unterbrach er sich im Schreiben und seufzte – daß sie den Namen ausgesprochen hatte, ihn so ausgesprochen hatte, als wäre er noch immer, irgendwo in greifbarer Nähe, vollkommen gegenwärtig – alle diese Dinge bestimmten während des Schreibens seinen Ton.
Er brachte zu Papier, was nach seiner Rückkehr nach Paris, als er ein paar Zeilen von Paul erhalten hatte, in jenem fast zwanzig Jahre zurückliegenden Sommer geschehen war. Er hatte in der schönen Stadt in der Dämmerung in einer schmalen Straße gestanden und emporgesehen, gewartet, darauf gelauert, daß im Fenster des dritten Stocks eine Lampe angehen würde. Als die Lampe aufflammte, hatte er sich bemüht, Paul Joukowskys Gesicht am Fenster zu sehen, sein dunkles Haar, seine lebhaften Augen, den finsteren Blick, der sich so leicht in ein Lächeln verwandeln konnte, die schmale Nase, das breite Kinn, die bleichen Lippen. Als es Nacht wurde, wußte er, daß er selbst auf der unbeleuchteten Straße nicht zu sehen war, und er wußte ebenfalls, daß er sich nicht von der Stelle bewegen konnte, sei es, um zu seiner eigenen Wohnung zurückzukehren, sei es – beim bloßen Gedanken hielt er den Atem an –, um zu versuchen, sich Zutritt zu Pauls Zimmern zu verschaffen.
Pauls wenige Zeilen waren unzweideutig gewesen: Er würde allein sein. Niemand kam oder ging, und Pauls Gesicht erschien nicht am Fenster. Er fragte sich jetzt, ob diese Stunden nicht die wahrhaftigsten seines ganzen Lebens gewesen waren. Die treffendste Metapher, die er dafür finden konnte, war eine ruhige, hoffnungsfrohe, lautlose Überfahrt, ein Zwischenspiel, aufgehoben zwischen Festland und Festland, ein Stillstand, der wie ein Schweben war, und das Wissen, daß ein einziger Schritt ein Schritt ins Unmögliche wäre, ins unermeßliche Unbekannte. Er wartete, um noch einen weiteren flüchtigen Blick von dem zu erhaschen, was da oben war, dem unnahbaren Gesicht. Und stundenlang stand er reglos da, vom Regen durchnäßt, von Passanten gestreift, und niemals war hinter der Lampe auch nur einen weiteren Augenblick lang das Gesicht zu erkennen.
Er schrieb die Geschichte jener Nacht auf und dachte dann an den Rest der Geschichte, die niemals aufgeschrieben werden durfte, wie geschickt er die Blätter auch verstecken oder wie rasch er sie verbrennen oder zerstören mochte. Der Rest der Geschichte war erfunden, und er würde sich niemals gestatten, ihn in Worte zu fassen. Darin hatte er um die Mitte seiner Nachtwache die Straße überquert. Er hatte Paul auf seine Anwesenheit aufmerksam gemacht, Paul war heruntergekommen, und sie waren schweigend zusammen die Treppe hinaufgestiegen. Und jetzt war vollkommen klar – Paul hatte daran keinen Zweifel gelassen –, was dann geschehen würde.
Er merkte, daß seine Hände zitterten. Er hatte sich niemals gestattet, über diesen Punkt hinauszuphantasieren. Weiter als bis zu diesem Punkt war er nie gekommen, aber nicht einmal so weit war er gekommen. Er blieb in jener Nacht auf seinem Posten, bis das Licht im Fenster erlosch. Dann wartete er noch eine Weile für den Fall, daß noch irgend etwas geschähe, aber die Fenster blieben dunkel und verrieten nichts. Dann ging er, langsam, nach Hause zurück. Er hatte wieder festen Boden unter den Füßen. Seine Kleider waren durchweicht, seine Schuhe waren vom Regen ruiniert.
Er genoß die Kostümproben und gönnte sich die Freude, in Gedanken auf jeden Sitz des Theaters einen potentiellen Zuschauer zu setzen. Die Beleuchtung, die luxuriösen, prächtigen Kostüme, die hallenden Stimmen erfüllten ihn mit Stolz und Vergnügen. Er hatte in all den Jahren noch niemanden eins seiner Bücher kaufen oder lesen sehen. Und selbst wenn er es gesehen hätte, wäre ihm die Wirkung seiner Sätze verschlossen geblieben. Lesen war eine ebenso stumme, einsame und private Tätigkeit wie das Schreiben. Jetzt würde er sehen, wie Zuschauer den Atem anhielten, würde sie aufschreien und verstummen hören.
Er brachte Freunde und vertraute Gesichter unter, und dann plazierte er – und das war die bedenklichste und aufregendste Vorstellung – auf allen Sitzen in seiner näheren Umgebung und auf der Galerie über sich Fremde. Er stellte sich helle, kluge Augen in einem empfindsamen Männergesicht vor, eine dünne Oberlippe, weiche helle Haut, einen massigen, aber mit unbefangener Leichtigkeit getragenen Körper. Diese Gestalt plazierte er versuchsweise in der Reihe hinter sich, nahe der Mitte, und daneben eine junge Frau, die die kleinen, zarten Hände so aneinandergelegt hielt, daß die Fingerspitzen fast ihren Mund berührten. Allein im Theater – die Kostümschneiderinnen waren noch hinter der Bühne –, beobachtete er seine imaginären zahlenden Theaterbesucher, als Alexander in der Rolle des Guy Domville auftrat. Bald war klar, worum es in dem dramatischen Konflikt gehen würde. Während das Stück seinen Fortgang nahm, behielt er das Publikum, das er hinter sich heraufbeschworen hatte, im Auge und bemerkte, wie das Gesicht der Frau aufleuchtete beim Anblick der Pracht von Mrs. Edward Sakers Kostüm, der kunstvollen Eleganz von vor hundert Jahren, bemerkte dann, wie ernst und in sich gekehrt das Gesicht seines schmallippigen Bewunderers wurde, als Guy Domville trotz seines ungeheuren Reichtums und seiner glänzenden Zukunft beschloß, der Welt zu entsagen und sich einem Leben der Kontemplation und der Andacht in einem Kloster zu verschreiben.
Guy Domville war immer noch zu lang, und er wußte, daß unter den Schauspielern wegen der Unstimmigkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Akt eine gewisse Aufregung herrschte. Alexander, sein standhafter Regisseur, riet ihm, nicht auf sie zu hören, sie seien lediglich von Miss Vetch aufgewiegelt worden, die im zweiten Akt keine nennenswerte Rolle spielte und im dritten Akt bloß einen ganz kurzen Auftritt hatte. Aber er wußte, daß man das in einem Roman nicht hätte riskieren dürfen: Eine einmal eingeführte Person mußte, sofern sie nicht eine sekundäre Rolle spielte oder vor dem Ende der Geschichte starb, in der Handlung bleiben. Was er in einem Roman niemals versucht hätte, versuchte er in einem Theaterstück. Er betete darum, daß es gutgehen würde.
Streichungen vorzunehmen war ihm verhaßt, aber er wußte, daß er sich nicht beschweren durfte. Anfangs hatte er lautstark gemurrt – ja eine gequälte Ungläubigkeit zum Ausdruck gebracht –, bis er gemerkt hatte, daß er sich bei der Regie unbeliebt zu machen begann. Es hatte keinen Sinn, darauf hinzuweisen, daß er, wenn noch Kürzungen erforderlich gewesen wären, sie schon vor Abschluß der Arbeit vorgenommen hätte. Mittlerweile strich er jeden Tag irgend etwas heraus, und er fand es seltsam, daß er schon nach wenigen Stunden der einzige war, dem die Nahtstellen, die fehlenden Augenblicke noch auffielen.
Während der Proben hatte er wenig zu tun. Er empfand die Vorstellung, daß es nur zur Hälfte sein Werk war und die andere Hälfte dem Regisseur, den Schauspielern und den Bühnenbildnern zukam, als zugleich erregend und beunruhigend. Dem Werk übergeordnet war jetzt das Element der Zeit, und das war neu für ihn. Über dem Proszeniumsbogen hing eine gigantische unsichtbare Uhr, deren Ticken sich der Stückeschreiber unterwerfen mußte, deren Zeiger sich, unerbittlich wie die Geduld des Publikums, von zwanzig Uhr dreißig an unaufhaltsam weiterbewegten. Während dieser prallvollen Zeitspanne von zwei Stunden (wenn man die Pausen mitrechnete) mußte er das Problem, das er sich selbst gestellt hatte, darlegen und zur Auflösung führen – oder sich geschlagen geben.
Je fremder und gleichzeitig realer ihm das Stück zu werden schien, während er den ersten Proben auf der Bühne und den ersten Kostümproben beiwohnte, desto stärker wurde in ihm die Gewißheit, daß er sein wahres Metier gefunden hatte, daß er nicht zu spät begonnen hatte, für das Theater zu schreiben. Er war bereit, sein Leben zu ändern. Er sah das Ende langer einsamer Tage voraus; an die Stelle der bitteren Genugtuung, die ihm die Prosa gewährte, würde ein Leben treten, in dem er für Stimmen und Bewegung und eine Unmittelbarkeit schreiben würde, die er bisher für unerreichbar gehalten hatte. Diese neue Welt war zum Greifen nah. Doch unvermittelt, besonders morgens, überkam ihn die Gewißheit, daß das Gegenteil der Fall war, daß er scheitern und, ob er wollte oder nicht, zu seinem eigentlichen Medium würde zurückkehren müssen: der gedruckten Seite. Solche Tage voll seltsamer Gemütsschwankungen und Aufregungen hatte er noch nie erlebt.
Für die Schauspieler verspürte er reine Zuneigung. Es gab Stunden, da er für sie geradezu alles getan hätte. Er ließ während der langen Proben Lunchkörbe hinter die Bühne bringen: kaltes Huhn und Roastbeef, frische Salate, Kartoffeln in Mayonnaise, frisches Brot und Butter. Er liebte es, dabei zuzuschauen, wie die Schauspieler aßen, diese Augenblicke genossen, da sie von ihren jeweiligen Rollen ins normale Leben zurückkehrten. Er freute sich auf kommende Jahre, da er weitere Rollen schreiben und den Schauspielern zusehen würde, wie sie sie zum Leben erweckten und jeden Abend spielten, bis die Spielzeit vorüber wäre und sie wieder in die farblose Außenwelt hinabsteigen würden.
Er hatte außerdem den Eindruck, daß seine gute Zeit als Romancier vorüber war: Die Anzeichen dafür, daß sich Herausgeber von Zeitschriften oder Verleger um ihn rissen, schwanden rasch dahin. Eine neue Generation von Schriftstellern, die er weder kannte noch schätzte, hatte den Markt übernommen. Das Gefühl, gewissermaßen am Ende zu sein, lastete schwer auf ihm; er hatte in letzter Zeit wenig geschrieben, und die einst so lukrative und willkommene Möglichkeit der Veröffentlichung in Zeitschriften war ihm zunehmend verschlossen.
Er fragte sich, ob das Theater mehr als eine Quelle der Freude und der Befriedigung, nämlich auch ein Rettungsseil für ihn werden könnte, ein Neuanfang zu einem Zeitpunkt, da seine Produktivität als Prosaschriftsteller nachzulassen schien. Guy Domville, das Drama über den Konflikt zwischen dem weltlichen und dem kontemplativen Leben, den Wechselfällen der menschlichen Liebe und einem dem höheren Glück geweihten Leben, war auf Publikumswirksamkeit hin konzipiert, in der Hoffnung geschrieben, die öffentliche Stimmung zu treffen, und er erwartete die Premiere mit einer Mischung aus reinem Optimismus – der absoluten Gewißheit, daß das Stück ankommen würde – und tiefer Bangigkeit, der Furcht, daß ihm der ganz große Erfolg und der Beifall der Menge auf immer versagt bleiben könnten.
Alles hing vom Abend der Premiere ab. Er hatte sich jedes Detail genau überlegt – nur nicht, was er selbst tun würde. Wenn er hinter den Kulissen bliebe, stünde er im Weg; im Zuschauerraum wäre er zu aufgeregt, allzu bereit, sich von jedem Aufstöhnen oder Seufzen oder plötzlichen Verstummen über Gebühr positiv oder negativ beeinflussen zu lassen. Er spielte mit dem Gedanken, sich im »Cap and Bells« zu verstecken, dem vom Theater aus am schnellsten zu erreichenden Wirtshaus, und Edmund Gosse, dem er absolut vertraute, hätte am Ende des zweiten Akts rasch hinüberlaufen können, um ihm anschließend zu berichten, wie die Sache stand. Doch zwei Tage vor der Premiere verwarf er den Plan als absurd.
Irgend etwas würde er tun müssen. Er konnte sich mit niemandem zum Essen treffen, da er jeden Bekannten zur Premiere eingeladen hatte, und fast alle hatten zugesagt. Er hätte in eine nahe gelegene Stadt fahren, sich die Sehenswürdigkeiten ansehen und mit einem Spätzug rechtzeitig zum Schlußapplaus zurückkehren können. Aber er wußte, daß ihn nichts von seinen Hoffnungen und Ängsten ablenken würde. Er wünschte, er steckte mitten in der Arbeit an einem Roman, ohne den Zwang, vor dem Frühling, wenn der Vorabdruck in Fortsetzungen beginnen würde, fertig zu werden. Er wünschte, er könnte in der Stille seines Arbeitszimmers schreiben, bis das quälend graue Licht eines Londoner Wintermorgens durch die Fenster hereinsickerte. Er sehnte sich nach Alleinsein und nach dem tröstlichen Wissen, daß sein Leben nicht von der Menge abhing, sondern davon, daß er er selbst blieb.
Nach vielen Abwägungen und Diskussionen mit Gosse und Alexander beschloß er, zum Haymarket Theatre zu gehen und sich Oscar Wildes neues Stück anzusehen. Dies wäre der einzige Weg, sich zwischen halb neun und Viertel vor elf zur Ruhe zu zwingen. Anschließend konnte er zum St. James’s Theatre zurückschlendern. Gosse und Alexander stimmten mit ihm überein, daß dies der beste, ja der einzig mögliche Plan war. Wenigstens würde er eine Zeitlang an etwas anderes denken, und er könnte in dem verzauberten Moment zurückkommen, in dem der Vorhang fiel – oder sein Stück kurz vor dem Ende stand.
Genauso, dachte er, während er sich für den Abend zurechtmachte, würde es die wirkliche Welt halten, die Welt, von der er sich zurückgezogen hatte, die Welt, über die er lediglich Mutmaßungen anstellte. Genauso verdient man Geld, erwirbt man sich einen Ruf: mit Risikobereitschaft und Aufregung, einem hohlen Gefühl im Magen, Herzjagen, einer sich vor Möglichkeiten überschlagenden Phantasie. Wie viele Tage seines weiteren Lebens würden so ablaufen? Wenn das hier, dieses erste Stück, von dem er sich den ganz großen Erfolg erhoffte, zu einem triumphalen Abschluß kommen sollte, würden künftige Premierenabende sanfter, weniger erregt ablaufen. Und dennoch wünschte er sich, selbst dann noch, als er auf die Droschke wartete, er hätte soeben eine neue Erzählung angefangen, die weißen Blätter lägen erwartungsvoll vor ihm, der Abend wäre leer und er hätte nichts anderes zu tun, als zu schreiben. Als er zum Haymarket aufbrach, erfüllte ihn der brennende Wunsch wegzulaufen. Er hätte jetzt alles dafür gegeben, um dreieinhalb Stunden in die Zukunft versetzt zu werden, das Ergebnis zu kennen, in der überschwenglichen Begeisterung des Publikums zu baden oder das Schlimmste zu wissen.
Während der Fahrt in der Droschke verspürte er plötzlich eine neue, seltsam grimmige Verzweiflung. Es war zuviel, dachte er, er verlangte zuviel. Er zwang sich, an das Bühnenbild zu denken, an die goldene Beleuchtung, die Kostüme und das Stück selbst – und an alle, die die Einladung angenommen hatten. Da verspürte er nur noch hoffnungsvolle Freude und Erregung. Er hatte es so gewollt, und er hatte es bekommen, also durfte er sich jetzt nicht beklagen. Er hatte Gosse die Liste der Gäste gezeigt, die im Parkett und im ersten Rang sitzen würden, und Gosse hatte gesagt, eine so erlesene Schar aristokratischer, literarischer und wissenschaftlicher Berühmtheiten, wie sie sich im St. James’s Theatre einfinden würde, sei noch in keinem anderen Londoner Theater jemals zu sehen gewesen.
Dahinter – er zögerte und lächelte, als ihm bewußt wurde, daß er beim Schreiben jetzt innehalten und sich bemühen würde, den richtigen Ton zu finden –, dahinter und darüber würden – wie sollte er es formulieren? – die Leute sitzen, die Eintritt bezahlt hatten, das richtige Publikum, dessen Unterstützung und Applaus mehr Gewicht hätten als die Zustimmung und der Applaus seiner Freunde. Es sind die Leute, sagte er fast laut, die meine Bücher nicht lesen, so wollen wir sie nennen. Die Welt – er lächelte, als ihm die nächste Redewendung durch den Sinn ging – ist voll von ihnen. Sie haben nie Schwierigkeiten damit, Gleichgesinnte zu finden. Heute abend, so hoffte er, würden diese Menschen auf seiner Seite stehen.
Augenblicklich, als er nur den Fuß auf den Bürgersteig vor dem Haymarket setzte, packte ihn die Eifersucht auf Oscar Wilde. Die Menschen, die das Theater betraten, strahlten die reine Unbeschwertheit derer aus, die sich durch und durch zu amüsieren gedenken. Er hatte das Gefühl, selbst noch nie so unbeschwert gewesen zu sein, und er wußte nicht, wie er die nächsten Stunden inmitten von Menschen überstehen sollte, die so vergnügt, so munter, so schlicht und einfach fröhlich zu sein schienen. Niemand, kein einzelner Besucher, kein Paar und keine Gruppe, sah ihm wie jemand aus, der Guy Domville zu schätzen gewußt hätte. Diesen Leuten ging es um ein Happy-End. Er zuckte zusammen, als er an die erbitterten Diskussionen dachte, die er wegen des nicht ganz so glücklichen Ausgangs von Guy Domville mit Alexander geführt hatte.
Hätte er sich doch nur einen Sitzplatz am Ende der Reihe geben lassen. Da, wo er jetzt saß, war er völlig eingekreist, und als sich der Vorhang hob und das Publikum über Sätze zu lachen begann, die er ordinär und plump fand, fühlte er sich wie belagert. Er lachte kein einziges Mal; er fand nicht einen Augenblick des Stücks komisch, aber was wichtiger war: Er fand nicht einen Augenblick wahr. Jede Zeile, jede Szene war so inszeniert, als wäre Albernheit eine höhere Manifestation von Wahrheit. Es wurde keine Gelegenheit ausgelassen, Geistlosigkeit als Geist hinzustellen; das Naheliegende, Platte, Leichtfertige riß das Publikum zu ausgelassenem Gelächter hin.
Wenn Ein idealer Gatte seicht und vulgär war, so war er selbst offensichtlich der einzige, der das erkannte, und als die erste Pause kam, wäre er am liebsten gegangen. Aber wohin hätte er gehen können? Sein einziger Trost war, daß dies kein Premierenabend war, das elegante Publikum glänzte durch Abwesenheit, es gab niemanden, den er – oder der ihn – erkannt hätte. Und am tröstlichsten überhaupt war, weder vom lauten korpulenten Iren Wilde selbst noch von seinem Gefolge etwas zu sehen.
Er fragte sich, was er mit einer solchen Geschichte angefangen hätte. Der Text war, Zeile für Zeile, ein Hohn auf die Schriftstellerei, ein einziges Heischen nach billigen Lachern, billigen Reaktionen. Die Darstellung der korrupten herrschenden Klasse war oberflächlich; der Gang der Handlung hölzern; der dramatische Aufbau plump und ungeschickt. Sobald der Vorhang gefallen war, würde sich niemand mehr an das Stück erinnern, und er würde sich daran nur wegen der Qualen, der schieren, nackten Anspannung erinnern, die er im Wissen darum ausgestanden hatte, daß nur wenige hundert Meter entfernt sein eigenes Stück uraufgeführt wurde. Sein Drama handelte vom Verzicht, und diese Menschen hatten noch nie auf irgend etwas verzichtet. Am Ende, als die Schauspieler wieder herausgeklatscht wurden, las er von den geröteten und glücklichen Gesichtern der Besucher ab, daß sie kaum beabsichtigten, sich in nächster Zeit zu bessern.
Als er den St. James’s Square überquerte, um sich seinem Schicksal zu stellen, erschien ihm der uneingeschränkte Erfolg dessen, was er gerade gesehen hatte, wie ein böses Vorzeichen dafür, daß Guy Domville durchgefallen war, und er blieb, von dieser grauenvollen Möglichkeit gelähmt, mitten auf dem Platz stehen und wagte es nicht, weiterzugehen und Näheres in Erfahrung zu bringen.
Im Laufe der Jahre reimte er sich aus Andeutungen und Gesprächsfetzen zusammen, was sich zugetragen hatte. Alles fand er nie heraus, aber soviel erfuhr er immerhin: Der Konflikt zwischen den geladenen Theatergästen und dem zahlenden Publikum war ebenso unüberbrückbar gewesen wie die Kluft zwischen ihm selbst und dem Publikum im Oscar-Wilde-Stück. Offenbar hatte das zahlenden Publikum noch vor Ende des ersten Aktes angefangen, mit den Füßen zu scharren, zu husten und zu tuscheln. Als Mrs. Edward Saker im zweiten Akt in ihrem kostspieligen historischen Kostüm auftrat, lachten die Leute. Und nachdem sie einmal angefangen hatten zu lachen, fanden sie auch zunehmend Freude daran, ausfällig zu werden. Es dauerte nicht lange, und aus dem Lachen wurde höhnisches Gejohle.
Ebenfalls später, viel später, erfuhr er, was geschehen war, als Alexander seine letzte Textzeile gesprochen hatte: »Der Letzte bin ich, Herr, der Domvilles.« Da hatte jemand von der Galerie aus gerufen: »Na, was ein Glück!« Sie johlten und buhten, und als der Vorhang fiel und das Publikum im Parkett und im ersten Rang enthusiastisch Beifall spendete, pfiffen die anderen und schrien wüste Beschimpfungen.
An jenem Abend betrat er das Theater durch den Bühneneingang und traf den Inspizienten, der ihm versicherte, alles sei gutgegangen, sein Stück sei ein Erfolg. Etwas an der Art, wie er es sagte, erweckte in Henry den Wunsch, Genaueres zu erfragen, sich nach der Größenordnung und der Art des Erfolgs zu erkundigen, aber gerade in dem Moment ertönte der erste Applaus, und er lauschte und hielt die Buhrufe irrtümlich für Begeisterungsschreie. Er sah Alexander, bemerkte, wie steif und ernst er war, als er von der Bühne zurückkam und einen Moment wartete, ehe er wieder hinausging, um sich noch einmal zu verbeugen. Er trat näher zum seitlichen Rand der Bühne, gewiß, daß Alexander und die übrigen Schauspieler wegen ihres Erfolgs triumphierten. Er war noch immer davon überzeugt, daß die Pfiffe und Schreie Ausdruck besonderer Bewunderung für den einen oder anderen Darsteller waren – darunter mit Sicherheit Alexander.
Er stand und lauschte, nah genug bei den Kulissen, um von Alexander gesehen zu werden, als er nach seinem Applaus von der Bühne abtrat. Später erzählte man ihm, seine Freunde im Publikum hätten lautstark nach dem Autor gerufen, aber offenbar nicht lautstark genug, daß er es hätte hören können. Alexander hörte die Rufe allerdings, oder jedenfalls behauptete er es später, denn als er den Blick des Autors auffing, kam er mit feierlicher, starrer Miene auf ihn zu, nahm ihn bei der Hand und führte ihn langsam und bestimmt auf die Bühne.
Da war sie, die Menschenmenge, die er sich während der langen Proben so oft vorgestellt hatte. Er hatte sie sich aufmerksam und empfänglich vorgestellt, er hatte sie sich stumm und düster vorgestellt. Aber auf dieses Chaos, dieses Lärmen und Toben, war er nicht gefaßt. Er ließ es, verwirrt, einen Augenblick lang auf sich einwirken, und dann verneigte er sich. Als er den Kopf wieder hob, begriff er, was sich da vor ihm abspielte. Das zahlende Publikum im Parkett und auf der Galerie pfiff und buhte. Er blickte in die Runde und sah nur Spott und Verachtung. Die geladenen Gäste saßen, noch immer klatschend, weiterhin auf ihren Plätzen, aber der Applaus ging mehr und mehr im Crescendo lautstarker vulgärer Mißfallensbekundungen der Leute unter, die noch nie ein Buch von ihm gelesen hatten.
Jetzt kam der schlimmste Augenblick – als er nicht wußte, was er tun sollte, als er die Kontrolle über seinen Gesichtsausdruck verlor, als sich in seiner Miene Panik abzeichnete, die er nicht zu unterdrücken vermochte. Und jetzt gelang es ihm, einige seiner Freunde zu erkennen – Sargent, Gosse, Philip Burne-Jones –, die tapfer weiter applaudierten, ohne sich allerdings gegen das Geschrei des Pöbels durchsetzen zu können. Die Situation traf ihn völlig unvorbereitet. Langsam trat er von der Bühne ab. Er hörte sich die Ansprache, mit der Alexander das Publikum zu beruhigen versuchte, nicht mehr an. Er nahm es Alexander übel, daß er ihn auf die Bühne geführt hatte, er nahm es der Menschenmenge übel, daß sie buhte, aber vor allen Dingen nahm er es sich selbst übel, daß er überhaupt da war. Jetzt hatte er keine andere Wahl, er würde das Theater durch den Bühneneingang verlassen müssen. Was hatte er sich für Augenblicke des Triumphs erträumt, sich ausgemalt, wie er zwischen den geladenen Gästen umhergehen und sich freuen würde, daß so viele alte Freunde gekommen waren, um Zeugen seines Bühnenerfolgs zu werden! Jetzt würde er gesenkten Hauptes nach Hause gehen, wie jemand, der ein Verbrechen begangen hat und jeden Augenblick mit seiner Festnahme rechnen muß.
Er wartete im Schatten hinter der Bühne, um den Schauspielern nicht über den Weg zu laufen. Ebensowenig drängte es ihn, das Haus sofort zu verlassen, wußte er doch nicht, wem er auf den Straßen am Theater begegnen könnte. Niemand hätte gewußt, was er sagen sollte: So groß und so unbestreitbar war die Niederlage. Für seine Freunde würde dieser Abend in die Annalen des unter allen Umständen zu Verschweigenden eingehen – Seiten, aus denen er seinen Namen bis dahin so gewissenhaft herauszuhalten gewußt hatte. Als einige Zeit vergangen war, begriff er allerdings, daß er die Schauspieler jetzt nicht im Stich lassen durfte. Er durfte seinem selbstquälerischen Bedürfnis nicht nachgeben, allein im Dunkeln zu sein, sich in die Nacht hinauszustehlen und fortzugehen, als hätte er nicht eine Zeile geschrieben und wäre ein Niemand. Er würde zu ihnen gehen und ihnen danken müssen; er würde darauf bestehen müssen, daß das zur Feier seines Triumphs vorgesehene Festessen stattfände. Im Dämmerlicht faßte er sich, wappnete er sich, unterdrückte er alles persönliche Streben und alle Bedürfnisse, die sich in ihm regen mochten. Er ballte die Fäuste und machte sich daran, zu lächeln und sich zu verneigen und sich vorzustellen, daß der Abend in all seinem Glanz dem Talent der Schauspieler in der großen Tradition des Londoner Theaters zu verdanken war.
Zweites Kapitel
Februar 1895
Nachdem Guy Domville durchgefallen war, kämpfte seine Entschlossenheit zu arbeiten durchaus gegen das Gefühl, besiegt und bloßgestellt worden zu sein. Er sah ein, daß es ihm nicht gelungen war, den Geschmack des breiten Publikums zu treffen, und jetzt mußte er sich der traurigen Tatsache stellen, daß keine seiner Arbeiten je populär sein oder allgemein geschätzt werden würde. Meistens schaffte er es mit einiger Mühe, seine Gedanken zu zügeln. Was er nicht zügeln konnte, war der entsetzliche Schmerz am Morgen, ein Schmerz, der sich fast bis zum Mittag hinzog und oft auch dann nicht nachließ. Eine Zeile in Oscar Wildes Stück hatte ihm gefallen – es war die Frage, ob die Traurigkeit der Londoner die Ursache des Nebels sei oder der Nebel die Ursache ihrer Traurigkeit. Seine Traurigkeit, dachte er, als das karge Licht des Wintermorgens durch das Fenster hereinlugte, war wie der Londoner Nebel. Bloß daß sie sich nie verflüchtigte und von einer Mattigkeit begleitet wurde, die ihm gänzlich neu war, von einer Lethargie, die ihn erschütterte und deprimierte.
Er fragte sich, ob er irgendwann in der Zukunft noch weiter aus der Mode kommen würde und ob, falls die Dividenden aus dem väterlichen Nachlaß irgendwann versiegen sollten, seine beschränkten Verhältnisse eine öffentliche Demütigung darstellen würden. Es war eine Frage des Geldes, der Anmut, die es der Seele verlieh. Geld war eine Form der Gnade. Wo immer er gewesen war, hatte der Besitz von Geld die Menschen von der breiten Masse unterschieden. Es schenkte Männern eine angenehme, distanzierte Macht über die Welt, und es verlieh Frauen ein gelassenes Selbstgefühl, ein inneres Licht, das selbst das Alter nicht zu tilgen vermochte.
Es war klar, daß es ihm bestimmt war, für die wenigen zu schreiben, vielleicht für die Zukunft, doch niemals den Lohn zu ernten, über den er sich jetzt gefreut hätte: ein eigenes Haus und einen schönen Garten und einen sorglosen Ausblick auf die Zukunft. Er war weiterhin stolz auf seine bisherigen Entscheidungen, auf die Tatsache, daß er niemals Kompromisse geschlossen hatte, daß ihm der Rücken weh tat und die Augen brannten, lediglich weil er weiterhin von früh bis spät im Dienst einer Kunst arbeitete, die rein und unbeeinflußt war von finanziellen Erwägungen.
Für seinen Vater und seinen Bruder – wie für so viele in London – war ein wirtschaftlicher Mißerfolg etwas wie ein Erfolg und ein wirtschaftlicher Erfolg etwas, worüber man kein Wort verlor. Kein einziges Mal hatte er bewußt das harte Los der Popularität erstrebt. Nichtsdestoweniger wünschte er sich, daß sich seine Bücher verkauften, daß er auf dem Markt glänzen und die Erträge seines Schaffens einstreichen könnte, ohne seine geheiligte Kunst in irgendeiner Weise zu kompromittieren.
Es war ihm nicht gleichgültig, wie er angesehen wurde; und es gefiel ihm, für einen Schriftsteller gehalten zu werden, der keinen Finger krumm machte, um seinen Werken Geltung zu verschaffen; und wenn man erkannte, daß er sich in Abgeschiedenheit und selbstloser Hingabe einer edlen Kunst widmete, bereitete es ihm Genugtuung. Er wußte allerdings durchaus, daß Mangel an Erfolg eine Sache war, ein kläglicher Mißerfolg jedoch eine ganz andere. So bewirkte sein – so öffentlicher, so berüchtigter und so offensichtlicher – Mißerfolg am Theater, daß er sich in Gesellschaft unbehaglich fühlte und eine Scheu davor verspürte, sich in die Welt der Londoner Society hinauszuwagen. Er fühlte sich wie ein General, der, vom Odeur der Niederlage umweht, vom Schlachtfeld zurückgekehrt war und dessen Anwesenheit in den warmen hellen Salons Londons unpassend und bedrückend gewirkt hätte.
Er kannte Militärs in London. Er hatte sich achtsam und unbefangen zwischen den Mächtigen bewegt, und er hatte mit großer Aufmerksamkeit den Engländern zugehört, wie sie über politische Intrigen und militärische Tapferkeit sprachen. Wenn er in Lord Wolseleys Haus am Portman Square inmitten der üblichen Versammlung von reichen Mittätern und alten Haudegen saß, fragte er sich oft, was seine Schwester Alice oder sein Bruder William gesagt hätten, wenn sie die stumpfsinnigen imperialistischen Kriegsgespräche, die tiefschürfenden und kernigen Diskussionen über Truppen und Attacken und Metzeleien gehört hätten, die nach dem Dinner geführt wurden. Alice war in der Familie die erbittertste Gegnerin des Empire; sie hatte sogar Parnell verehrt und war wie er für die Selbstverwaltung Irlands eingetreten. William sympathisierte ebenfalls mit der irischen Sache und machte kein Hehl aus seiner antibritischen Gesinnung.
Lord Wolseley war kultiviert, wie sie es alle waren, wohlerzogen und faszinierend mit seinen rosigen Grübchen und stechenden Augen. Henry verkehrte mit diesen Männern, weil ihre Frauen es so wünschten. Die Frauen schätzten seine Umgangsformen, seine grauen Augen und seine amerikanische Herkunft, aber mehr als alles andere gefiel ihnen, wie er zuhörte, jedes Wort in sich aufsog, ausschließlich zur Sache gehörende Fragen stellte und durch seine Gesten und Erwiderungen der Intelligenz seines Gegenübers Anerkennung zollte.
Es war leichter für ihn, wenn keine anderen Schriftsteller anwesend waren, niemand, der sein Werk kannte. Die Männer, die sich nach dem Dinner zum Austausch von Anekdoten und politischem Klatsch zusammenfanden, interessierten ihn nie so sehr wie das, was sie sagten; die Frauen hingegen interessierten ihn immer, unabhängig davon, was sie sagten. Lady Wolseley interessierte ihn ganz besonders, denn sie war die Personifizierung der Klugheit, des Einfühlungsvermögens und des Charmes und hatte die Art und die Manieren und den Geschmack einer Amerikanerin. Sie pflegte den Blick mit einem Ausdruck des Erstaunens und der unverhohlenen Bewunderung über ihre Gäste schweifen zu lassen, um dann ihr Lächeln der ihr am nächsten stehenden Person zuzuwenden und leise auf sie einzureden, als verriete sie ein Geheimnis.
Er mußte London verlassen, aber er glaubte nicht, daß er es ertragen würde, wo auch immer allein zu sein. Er wollte nicht über sein Theaterstück reden, und er fürchtete, nicht schreiben zu können. Er entschied, daß, wenn er abreiste, bei seiner Rückkehr alles anders sein müßte. Sein Kopf war voller Visionen und Ideen. Er hoffte inständig, daß die Vorstellungen, die ihm vorschwebten, sich in geschriebene Seiten würden übertragen lassen. Mehr – davon war er jetzt überzeugt – wollte er nicht.
Er reiste nach Irland, denn das Land war leicht zu erreichen, und er ging davon aus, daß der Aufenthalt seine Nerven nicht beanspruchen würde. Weder Lord Houghton, der neue Vizekönig von Irland, dessen Vater er ebenfalls gekannt hatte, noch Lord Wolseley, der zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte Ihrer Majestät in Irland ernannt worden war, hatten sein Stück gesehen; er willigte ein, bei beiden jeweils eine Woche zu verbringen. Es hatte ihn überrascht, mit welchem Nachdruck die Einladungen vorgebracht worden waren und welche Bedeutung der Frage, wieviel Zeit er bei jedem von ihnen zu verbringen gedachte, beigemessen wurde. Erst als er seine Zimmer im Dublin Castle bezogen hatte, verstand er das Problem.
In Irland herrschten Unruhen, und der Regierung Ihrer Majestät war es nicht nur nicht gelungen, diese niederzuschlagen, sondern sie hatte sich sogar zu Konzessionen bereit gefunden. Es war vergleichsweise einfach gewesen, diese dem Parlament zu erklären, jedoch unmöglich, sie den irischen Gutsherren und Garnisonschefs einsichtig zu machen, weswegen diese nun sämtliche gesellschaftlichen Ereignisse der Saison im Dublin Castle boykottierten. Lord Houghton war auf importierte Gäste angewiesen, und so war der Enthusiasmus zu erklären, mit dem er seine Einladung vorgebracht hatte.
Während der alte Lord Houghton ebenso zwanglos in seinen Umgangsformen wie anspruchslos in seinen persönlichen Angewohnheiten gewesen war und insbesondere im fortgeschrittenen Alter eine Schwäche dafür gehabt hatte, sich und andere zu amüsieren, war sein Sohn ernst und sich seiner Bedeutung bewußt. In seinem Amt als Vizekönig hatte der neue Lord Houghton seine wahre Erfüllung gefunden. Er stolzierte wie ein Pfau einher und war offenbar der einzige, der nicht begriff, daß er es zwar gut meinte, aber keinerlei Bedeutung besaß. Er repräsentierte die Königin inIrland, und er tat dies mit inbrünstiger Feierlichkeit und Detailversessenheit, wobei er seine Tage mit Inspektionen und Empfängen und Paraden und seine Abende mit Bällen und Banketten füllte. Er überwachte seinen Haushalt, als weilte die Monarchin im Schloß und könnte jeden Augenblick in all ihrer imperialen Herrlichkeit erscheinen.
Mit seiner Pomphaftigkeit erschöpfte der kleine vizekönigliche Hof Henry an Leib und Seele. Es gab in sechs Tagen vier Bälle und jeden Abend ein Bankett. Besucht wurden die Veranstaltungen lediglich von Angehörigen der Beamtenschaft und des Militärs, unterstützt von einer sehr langweiligen und zweitklassigen, wenngleich umfangreichen Schar von Hausgästen. Zum Glück hatte kaum einer der Gäste je von ihm gehört; er unternahm keinen Versuch, etwas daran zu ändern.
»Hoffentlich hat Ihnen jemand rechtzeitig geraten«, sagte eine der englischen Damen zu ihm, »sich die Nase zuzuhalten und die Augen zu schließen und sich, wenn Sie es irgendwie schaffen, auch noch die Ohren zu verstopfen. Man muß damit in dem Augenblick anfangen, in dem man in Irland ankommt, und darf nicht eher aufhören, als bis man im Schloß angelangt ist oder in der vizeköniglichen Residenz, oder wo immer man sonst wohnt.«
Die Dame strahlte vor Selbstzufriedenheit. Er wünschte, seine vor drei Jahren verstorbene Schwester Alice könnte hier sein, um sie in die Flucht zu schlagen. Er wußte, daß Alice sich eine Rede für später zurechtgelegt und in vielen Briefen die Gesichtsbehaarung der Dame, die Zähne und den Sprung, der sich in ihrer Stimme bemerkbar machte, wenn sie die höheren Tonlagen der Ermahnung erreichte, erwähnt hätte. Die Dame lächelte ihn an.
»Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt.«
Er war tatsächlich erschrocken, denn er hatte eben erst ein kleines Zimmer mit einem Schreibtisch und Papier und Tinte und ein paar Büchern entdeckt und war gerade dabei gewesen, einen Brief zu schreiben. Plötzlich kam ihm der Gedanke, die beste Methode, die Frau aus dem Zimmer zu treiben, wäre, mit beiden Händen zu wedeln und dazu scheuchende Geräusche zu machen, als sei sie eine Schar Hühner oder eine Gänseherde.
»Aber es ist schön hier«, fuhr sie fort, »und letztes Jahr waren die Bälle wahrhaft rauschende Feste, weit besser als alles, was London zu bieten hatte.«
Er starrte sie grimmig und, wie er hoffte, zugleich ausdruckslos an und sagte nichts.
»Und es gibt hier andere Leute«, fing sie wieder an, »die eine Menge von Seiner Lordschaft lernen könnten. Wissen Sie, in London werden wir regelmäßig in vornehmere Häuser eingeladen. Aber wir kennen weder Lord Wolseley noch übrigens seine Gemahlin. Lord Houghton hingegen war so liebenswürdig, uns auf dem kleinen Empfang, den er nach unserer Ankunft gab, vorzustellen, und ich wurde neben ihn gesetzt, und mein Gatte, ein sehr freundlicher und liebenswürdiger Mann, sehr reich, wenn ich das hinzufügen darf, und rechtschaffen, hatte das Unglück, neben Lady Wolseley gesetzt zu werden.«
Sie verstummte kurz, um nach Luft zu schnappen und ihre empörte Stimme in die nächsthöhere Tonlage zu versetzen.
»Und Lord Wolseley muß sich in einem seiner Kriege ein Signalsystem angeeignet haben, und er muß sie damit heimlich instruiert haben, meinen Gatten ebenso zu ignorieren, wie er mich ignoriert hat. Die Ungezogenheit von dem Menschen! Und die Ungezogenheit von ihr! Lord Houghton war es sichtlich peinlich. Ich finde, die Wolseleys sind ein sehr, sehr ungezogenes Gespann.«
Henry suchte nach einer Möglichkeit, die Konversation zu beenden, aber er merkte, daß sie scharf nach Anzeichen von Ungezogenheit Ausschau hielt. Dennoch meinte er, daß Ungezogenheit jetzt nichts gewesen wäre gemessen an der Aussicht, noch länger ihren Äußerungen lauschen zu müssen.
»Es tut mir sehr leid, aber ich muß dringend in meine Zimmer zurück«, sagte er.
»Ach«, entgegnete sie und versperrte die Tür.
Als er auf sie zuging, wich sie nicht von der Stelle. Ihre Miene war zu einem ärgerlichen Lächeln erstarrt.
»Und natürlich wird man uns nicht ins Royal Hospital einladen. Mein Mann sagt, wir würden ohnehin nicht hingehen, aber ich persönlich würde es gern sehen, und die Abende dort sollen glänzend sein, trotz der Ungezogenheit der Gastgeber. Und der junge Mr. Webster, der Abgeordnete, von dem mein Mann sagt, er sei der kommende Mann und werde eines Tages noch Premierminister, wird da sein.«
Sie verstummte, musterte kurz seinen Scheitel und zwickte sich in die Wange. Dann fuhr sie fort.
»Aber wir sind nicht gut genug, das habe ich meinem Mann gesagt. Sie haben allerdings einen großen Vorteil. Sie sind Amerikaner, und kein Mensch weiß, wer Ihr Vater oder wer Ihr Großvater war. Sie könnten sonstwer sein.«
Er stand da und musterte sie kalt über die Breite des Zimmers hinweg.
»Ich meine es nicht in beleidigendem Sinne«, sagte sie. Er blieb weiterhin stumm.
»Ich meinte, daß Amerika eine sehr schöne Demokratie zu sein scheint.«
»Sie wären dort herzlich willkommen«, sagte er und verneigte sich.
Zwei Tage später fuhr er von Dublin Castle quer durch die Stadt nach Kilmainham zum Royal Hospital. Er kannte Irland bereits von einer früheren Reise her, von Queenstown in Cork nach Dublin, und er hatte sich auch kurze Zeit in Kingstown aufgehalten. Kingstown hatte ihm gefallen mit seinem Licht vom Meer her und dem Gefühl von Ruhe und Ordnung. Doch diese Fahrt erinnerte ihn an seine Reise quer durch das Land, während deren er Zeuge des allgegenwärtigen tiefsten Elends geworden war. Zu manchen Gelegenheiten hatte er sich gefragt, ob eine Kate eingerissen worden war oder noch immer bewohnt wurde. Alles wirkte ganz oder teilweise verfallen. Rauch quoll aus zerbröckelnden Schornsteinen, und niemand, der aus diesen Katen trat, unterließ es, einer vorüberfahrenden Kutsche hinterherzuschreien oder, wenn sie ihre Fahrt verlangsamte, mit böswilliger Miene auf sie zuzugehen. Nicht einen Augenblick lang fühlte er sich von ihren starren, feindseligen Blicken und dunklen vorwurfsvollen Augen unbehelligt.
Dublin war in mancherlei Hinsicht anders. Hier war die Trennung zwischen der Bettlerschicht und der Schicht, die über Geld und Lebensart verfügte, weniger stark ausgeprägt. Aber dennoch reichte das Elend Irlands bis ans Schloßtor und machte ihn mutlos und rastlos. Jetzt, als ihn die Staatskarosse vom Schloß zum Royal Hospital fuhr, fiel ihm vor allem die Verdrießlichkeit der Iren auf. Er bemühte sich, nicht darauf zu achten, aber es gelang ihm nicht. Die letzten Straßen waren zu eng, als daß er es hätte vermeiden können, die Armut in den Gesichtern und an den Gebäuden und das Gefühl, jeden Augenblick könnten ihm bettelnde Frauen und Kinder in den Weg treten, zu bemerken. Wäre William bei ihm gewesen, so hätte der Bruder scharfe Worte für diesen vernachlässigten und ärmlichen Hinterhof gefunden.
Er war erleichtert, als die Kutsche in die Allee zum Royal Hospital einbog, und nahm die Stattlichkeit des Gebäudes, die Anmut, Symmetrie und Würde der es umgebenden Gartenanlage mit Verwunderung zur Kenntnis. Es war, wie er sich mit einem Lächeln sagte, als beträte man nach einer beschwerlichen Reise durch die Niederungen der Welt das Himmelreich. Selbst die Bediensteten, die an den Wagen traten, um ihn zu begrüßen und sein Gepäck in Empfang zu nehmen, wirkten anders, gleichsam von himmlischer Wesensart. Am liebsten hätte er sie aufgefordert, das Tor zu schließen und ihn, wenn es nicht absolut unumgänglich wäre, davor zu bewahren, der Armut der Stadt ins Gesicht zu sehen.
Er wußte, daß das Hospital im siebzehnten Jahrhundert für alte Soldaten erbaut worden war, und anläßlich seiner ersten Besichtigung des Gebäudes erfuhr er, daß in den Räumen entlang der langen Korridore, die auf einen großen quadratischen Innenhof gingen, hundertfünfzig von ihnen wohnten und in prächtiger Umgebung fröhlich älter wurden. Als Lady Wolseley sich für deren Nähe entschuldigte, ließ er sie wissen, daß er in gewisser Weise ebenfalls ein alter – oder zumindest ein alternder – Soldat sei und daß er sich hier, wenn sich nur irgendein Bett für ihn fände, gewiß zu Hause fühlen würde.
Sein Zimmer blickte, vom Innenhof und dem Hospital abgewandt, auf den Fluß und den Park. Am Morgen, als er früh erwachte, lag ein weißer Nebel über dem Rasen. Er schlief weiter, diesmal tief und ruhig, und wurde von jemandem geweckt, der sich auf Zehenspitzen im Schatten bewegte.
»Ich habe Ihnen warmes Wasser zum Waschen hingestellt, Sir, und lasse Ihnen, wann immer Sie es wünschen, ein Bad ein.«
Es war die Stimme eines Mannes, ein englischer Akzent, weich und beruhigend.
»Ihre Ladyschaft sagte, Sie könnten sich, wenn Sie es wünschen, das Frühstück im Zimmer servieren lassen.«