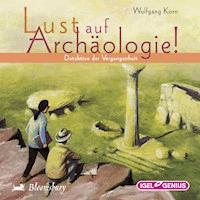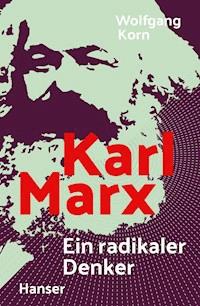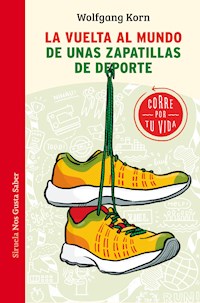Detektive der Vergangenheit. Expeditionen in die Welt der Archäologie. Von Pompeji bis Nebra E-Book
Wolfgang Korn
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In detektivischer Kleinstarbeit legen Archäologen Schicht um Schicht die Hinterlassenschaften vergangener Zeiten frei. Sie öffnen damit ein Fenster zu unseren Vorfahren und helfen uns, unsere Geschichte und uns selbst besser zu verstehen. Von Babylon über Pompeji bis Haithabu begibt sich Wolfgang Korn auf eine Expedition zu einst verborgenen Schätzen, wiederentdeckten Stätten und untergegangenen Kulturen. Er gibt Einblicke in die Geschichte dieser noch recht jungen Wissenschaft, begleitet Grabräuber ins alte Ägypten, schaut dem windigen Geschäftsmann Schliemann bei seiner Troja-Entdeckung über die Schulter, forscht nach der versunkenen Nordseestadt Rungholt und erörtert die Frage, wie es um die Rückgabe der Kulturgüter in den großen europäischen Museen steht. Nie wurde die Geschichte der Archäologie aufregender und spannender erzählt!
- Vollständig aktualisierte und erweiterte Neuausgabe!
- Früher 256 jetzt 320 reich illustrierte Seiten!
- Faszinierende Archäologie-Fibel für alle: Mythen, Methoden, Objekte und Storys spannend erzählt von Wissenschaftsjournalist Wolfgang Korn
- Wie entdeckt man versunkene Städte, welche Kniffe kannten Grabräuber und wem gehören eigentlich die Funde?
- Von Pompeji, Troja, Angkor Wat, ägyptischen Tresoren, mittelalterliche Marmorlager bis zur Himmelsscheibe von Nebra
- Verschüttete Schätze der Vergangenheit finden und entschlüsseln - das kann Archäologie! Und Wolfgang Korn kann super davon erzählen
- Durchgängig mit zahlreichen s/w-Illustrationen, Karten und Fotos: Auf jeder zweiten Seite was zu Gucken
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfgang Korn
Detektive der Vergangenheit
Expeditionen in die Welt der Archäologie
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jeglicheunbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Texte dieser Ausgabe erschienen erstmals in: Wolfgang Korn,Detektive der Vergangenheit. Expeditionen in die Welt der Archäologie,Berlin 2007 und Wolfgang Korn, Das große Buch der Archäologie.Unter Schatzjägern, verwegenen Forschern und wagemutigen Entdeckern,Köln 2014. Alle Texte wurden sorgfältig überarbeitet, aktualisiert und erweitert.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen
der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: »Forum Romanum, Rom«, akg-images / Erich Lessing
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32435-3V001
www.anacondaverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Teil I
Was mit antiken Ruinen vor der Archäologie geschah
KAPITEL 1
Schlamm drüber oder einfach zumüllen!
Wie Gräber, Tempel sowie Siedlungen unter die Erde gerieten
KAPITEL 2
Wer hat diese Riesensteine angeschleppt?
Was mit den antiken Bauwerken geschah, die weithin sichtbar blieben
Teil II
Die goldenen Zeiten derArchäologie und ihre größten Legenden
KAPITEL 3
Wer verdient die Auszeichnung?»Erster Archäologe«?
Verheerende Griechenlandliebe von den Römern bis zu den Päpsten des 18. Jahrhunderts
KAPITEL 4
Morgens Beamter, abends Schatzsucher – waren die größten Archäologen Außenseiter?
Außenseiter, Abenteurer und exzentrische Ausgräber erkundeten Ninive, Babylon und Ur
KAPITEL 5
»Haltet den Dieb« oder »Ein Hoch auf den Retter« – wurden die bedeutenden Antiken geraubt oder gerettet?
Wie ganze Grabkammern und Altäre in die Museen von London, Paris und Berlin wanderten
KAPITEL 6
Megacooler Ausgräber oder schlitzohriger Schwindler?
Die Wahrheit über den berühmtesten Archäologen aller Zeiten
KAPITEL 7
Von Angkor Wat bis zu den Maya-Tempeln von Palenque
Dem Dschungel entrissen, vor dem Vergessen bewahrt?
Teil III
High-Tech-Methoden undspektakuläre Funde: die moderneArchäologie
KAPITEL 8
Schichten, Scherben und ein wenig Technik
Von den Pharaonengräbern zum Alltag der alten Ägypter
KAPITEL 9
Findet die Unterstadt unter der Unterstadt!
TROIA-VIIa war kein kleines Piratennest, aber zu welchem Kulturkreis gehörte die Bronzezeit-Stadt?
KAPITEL 10
Von der ersten Bronze zur Himmelsscheibe von Nebra
Eine eurasische Spurensuche nach dem ersten globalen Handel
KAPITEL 11
Vom versunkenen Rungholt bis zur Gletschermumie Ötzi
Watt, Moor und Eis als nordische Fundstellen
KAPITEL 12
Barbarische Piraten oder kulturbringende Kaufleute?
Wie neue Funde und intensive Forschung unser Bild der Wikinger ändern
Teil IV
Blick zurück in die Zukunft – der Kampf um die Deutung der Vergangenheit
KAPITEL 13
Vom nordischen Atlantis zu »Pompeji – Made in Hollywood«
Neue Mythen überlagern antike Stätten
KAPITEL 14
Verlandung in Ephesos, Klimawandel in Mittelamerika und Nordeuropa
Die Entdeckung der ökologischen Dimension
KAPITEL 15
Antike Funde und Fundorte: Was soll zurück, was muss besser geschützt werden, was kann im Boden bleiben?
Die archäologische Forschung wird immer virtueller
Literatur- und Quellenverzeichnis
Register
Bildnachweis
Teilzerstörte Pharaonen-Statue (vermutlich Ramses II.) vor einem mit Hieroglyphen versehenen Obelisken im Tempel von Karnak.
Einleitung
Abenteurer mit Indiana-Jones-Hut oder Detektive mit Sherlock-Holmes-Lupe?
Archäologen zwischen Nervenkitzel und schweißtreibender Routinearbeit, zwischenspektakulären Funden, großer Politik und noch größeren Touristenströmen
Zufällig gefundene Silberhorte der Wikinger, die Entdeckung von Sarkophagen mit Mumien aus der Pharaonenzeit oder die Freilegung bisher verborgener Tempel im Dschungel von Guatemala oder Mexiko – immer wieder sorgen Ausgrabungen für Schlagzeilen in den Medien. Und wir fragen uns: Steckt nicht in jedem Archäologen ein Abenteurer, ein kleiner »Indiana Jones«?
Tatsächlich haben die »Spaten-Wissenschaftler« in den vergangenen zwei Jahrhunderten versunkene Städte wie Troja oder Babylon wiederentdeckt. Sie haben vergessene Pharaonengräber wie das von Tutanchamun freigelegt und zahlreiche auf den Weltmeeren verschollene Schiffswracks wie beispielsweise die Titanic geortet. Auch heutzutage graben noch etliche von ihnen in lebensfeindlichen Wüsten oder in Ländern, in denen mehr Anarchie als Ordnung herrscht. Andere durchstreifen unzugängliche Regenwälder – immer auf der Suche nach übersehenen Resten untergegangener Kulturen. Denn man geht davon aus, dass ein großer Teil der Maya-Stätten Mittelamerikas noch immer unentdeckt in den Regenwäldern von Guatemala, Honduras und Belize schlummert.
Der Mythos des Archäologen als verwegenen Abenteurer hält sich hartnäckig. Dabei ist der vergleichsweise junge Wissenschaftszweig der Archäologie vor allem eines: akribische Kleinstarbeit unter nicht selten widrigen Umständen.
Doch heutige Archäologen suchen nicht in erster Linie nach kostbaren Goldschätzen, Gräbern oder Tempeln. »Wie wir Archäologen denken und arbeiten, das hat viel gemeinsam mit der Art, wie gute Detektive denken und arbeiten, um ihre Kriminalfälle zu lösen«, schrieb Robert Brainwood, Entdecker einer der ältesten Siedlungen der Menschheit, in seinem kleinen Führer »Archeologists and what they do«. Archäologen sind seiner Meinung nach »Detektive der Vergangenheit«: Sie interessieren sich jedoch nicht nur für Verbrechen, sondern für wirklich alle Spuren menschlicher Existenz – sie verschmähen dabei nicht einmal eine Mistkuhle. Daher entpuppen sich auch die größten Abenteuer bei näherem Hinsehen als schweißtreibende Fleißarbeit. Ein Ausgrabungsteam verbringt Monate damit, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang Schicht für Schicht einer Fundstelle sorgfältig und behutsam freizulegen. Jede Fundsituation muss genauestens in Zeichnungen erfasst und dann möglichst schnell digitalisiert werden – Details, die in dem Augenblick kaum interessieren, können später den Schlüssel zu einem Rätsel darstellen. Schließlich bürsten die Ausgräber mit Pinseln in der Größe von Zahnbürsten vorsichtig die Verunreinigungen von möglichen Funden. Geborgen werden so vor allem ehemalige Alltagsgegenstände: Nicht Hunderte oder Tausende, sondern Zehn- bis Hunderttausende von Keramikscherben, die vermessen und bestimmt werden müssen. Anhand all dieser Indizien versuchen sie zu rekonstruieren, was einst geschah: Wie lebten die Menschen – in Zelten, Hütten oder Häusern? Wovon lebten sie – von der Jagd, vom Ackerbau oder fertigten sie Keramikwaren oder Metallgegenstände, die sie gegen Lebensmittel eintauschten? Welche Rituale vollzogen, welche Götter verehrten sie?
Archäologen sind die Detektive weit zurückliegender Ereignisse: Sie sichten die freigelegten Spuren und versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Dabei wägen sie fortwährend ab: Das ist höchst wahrscheinlich, dieses ist fragwürdig und jenes ganz unmöglich. Und immer wieder stellen sie sich die Frage: Kann alles nicht auch ganz anders gewesen sein? Denn schließlich entwickeln sie Theorien über historische Ereignisse, für die es keine Augenzeugen mehr geben kann. Die Grabungen und ihre Auswertung stellen jedoch nur einen kleinen Teil der Tätigkeit eines Archäologen dar – deren Sahnehäubchen sozusagen. Die Forscher müssen sich außerdem um Grabungslizenzen bewerben und Gelder für die Ausgrabungen beschaffen, die Grabungsexpeditionen von A bis Z planen und ihren Ablauf managen, Medienvertreter und Besuchergruppen über die laufenden Arbeiten informieren und ihre Ergebnisse möglichst bald in Fachpublikationen und über das Internet öffentlich zugänglich machen. All dies unter den Augen der kritischen, manchmal auch neidischen Kollegen.
Außerdem sehen sich Archäologen zunehmend mit folgenden Fragen konfrontiert:
Wie lange können wir graben, bevor der Bau der Autobahn-Strecke fortgesetzt wird? Verkehr hat auch in unserer Zeit Vorrang vor Vergangenheit. Lohnen sich die großen Grabungen überhaupt noch, wenn alle Funde vor Ort bleiben? Wie können die antiken Stätten in Krisengebieten wie dem Irak oder Syrien vor Raubgrabungen und Zerstörung besser geschützt werden? Müssen die großen Funde wie der Pergamonaltar in Berlin, die Elgin-Marbles in London oder die Sarkophage im Louvre an ihre Herkunftsländer zurückgegeben werden? Und wie lassen sich antike Stätten für künftige Forschungen, die über heute ungeahnte Möglichkeiten verfügen werden, bewahren? So viele Fragen, so viele Herausforderungen. Trotzdem möchte keiner der Vergangenheitsforscher seinen Job gegen einen anderen tauschen, denn den immensen Aufgaben stehen reichliche Belohnungen gegenüber – oder?
Große Aufmerksamkeit – aber nur für wenige
Es scheint so, als seien Archäologen heutzutage allgegenwärtig: kein Hausbau, keine Straßenerweiterung, kein U-Bahnbau, auch kein Braunkohleabbau, ohne dass sie vorher das Gelände sondiert haben auf der Suche nach Artefakten vergangener Zeiten. Darüber hinaus schätzen und schützen wir heute unsere historischen Denkmäler auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene – letzteres mit der begehrten Auszeichnung »UNESCO-Weltkulturerbe«. Trotzdem sieht die gegenwärtige Situation der Archäologie, zum Erstaunen vieler, gar nicht so rosig aus. Dem Überfluss auf der einen Seite – ständiger Nachschub an Funden und viel Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit – stehen gewaltige Mängel gegenüber: Den Museen und Forschungseinrichtungen werden die Mittel gekürzt, trotz der enormen Touristenströme fehlen selbst den klassischen antiken Stätten Gelder für die nötige Instandhaltung und die Raubgräberei nimmt vor allem in Krisengebieten wie Syrien oder dem Irak, aber auch in Ägypten zu.
Obwohl inzwischen überall auf der Welt nach den Relikten vergangener Kulturen und Völker gefahndet wird, gibt es zu viele ausgebildete Archäologen. Allein an deutschen Universitäten und Hochschulen werden 52 Studiengänge angeboten: Von der klassischen über die vorderasiatische und die frühgeschichtliche bis zur naturwissenschaftlichen Archäologie sowie Grabungstechnik und Archäobio- und Archäozoologie. Angesichts dieser Schwemme an nachrückenden Forscherinnen und Forschern sind gut bezahlte und dauerhafte Stellen eher Mangelware. Außerdem ist die Aufmerksamkeit, die den archäologischen Entdeckungen gewidmet wird, extrem zweigeteilt: Ein Großteil der Forschungserkenntnisse verbleibt in der Community, denn die meisten Funde interessieren nur die Wissenschaftler und einige Lokalpatrioten. Das Interesse der durch Medien gesteuerten Öffentlichkeit folgt anderen Regeln.
Über die Opferkulte der Inkas oder die Himmelsscheibe von Nebra wird viel spekuliert, aber nicht über das griechische Stratos oder das römische Aquileia oder einen mittelalterlichen Brunnen unter einem geplanten Neubau. Warum?
Nur wenn die Mischung aus Abenteuer, Ausgrabung und Mythen stimmt, schaffen es einzelne Funde oder Ausgrabungen in die Medien und werden zu viel diskutierten Phänomenen. Doch auch die Entstehung der Spatenwissenschaft ist von Mythen durchzogen.
Doch bis die Archäologie sich zu der heutigen Wissenschaft entwickelt hat, die Antworten auf unsere Fragen liefern kann, war es ein weiter Weg. Lange Zeit hatte die Menschheit kein Interesse an den Zeugnissen ihrer Vorfahren. Daher verschwanden bis vor rund 100 Jahren über 90 Prozent der Hünengräber in Nordeuropa. Noch während der Renaissance ließ das Abendland, das sich die antike Kultur zum Vorbild nahm, dessen Überreste bedenkenlos plündern, um damit die Fassaden seiner eigenen Prachtbauten zu errichten oder auszuschmücken. Die Archäologie begann vor rund 400 Jahren weder als Detektivgeschichte noch als Projekt zur Erforschung und Rettung bedrohter Denkmäler – zunächst waren schlichtweg Plünderer der antiken Stätten am Werk. So sind viele Ausgräbergeschichten schlicht und einfach Legenden – wie die von Heinrich Schliemann, der nur reich geworden sei, um seinen Kindheitstraum von Troja zu verwirklichen. Deshalb fragen wir: Waren die größten Ausgräber wirkliche Außenseiter, die keine Ahnung von der Archäologie hatten? Und haben sie ihre antiken Funde gerettet oder geraubt? Anschließend verfolgen wir wie die Archäologie zu einer strengen Wissenschaft wurde, die mit Detektivmethoden vergangene Spuren enträtselt: Woher stammt die erste Bronze der Menschheit? Konnten die Wikinger mit ihren offenen Booten tatsächlich über den Atlantik segeln? Und schließlich ist die Geschichte der Archäologie, obwohl sie zunehmend wissenschaftlicher betrieben wird, keine des kontinuierlichen Anstiegs ihres Wissens. Das liegt vor allem an zwei Dingen: Neue zufällige Funde können bewährte Ansichten über Nacht widerlegen. Gleichzeitig wandelt sich die Archäologie: Neue Fragen, neue Methoden und neue Sichtweisen lassen vergangene Kulturen immer wieder in einem anderen Licht erscheinen. Deshalb werden wir die Erforschung untergegangener Kulturen nie als abgeschlossen betrachten können. Zudem hat jede Epoche ihr eigenes Verhältnis zur Vergangenheit. Früher spielten Herrschergestalten und kriegerische Auseinandersetzungen die zentrale Rolle, heute sind es die Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen und ihre ökologische Interpretation: Ging die Kultur der Maya unter, weil sie ihre Umwelt zerstörten oder lag der Grund in einem unvermeidlichen Klimawandel?
Mitten in Mexiko-City wird seit den 1970er-Jahren der Azteken-Tempel Templo Mayor unter den Augen der Öffentlichkeit freigelegt.
Botschaften aus der Vergangenheit?
Und an Hand spektakulärer Fälle der letzten Jahrzehnte begleiten wir die Archäologen bei ihrer High-Tech-Spurensuche: Wie findet man versunkene Städte im Dschungel oder im Wattboden der Nordsee? Nicht selten stoßen die Forscher bei ihrer Arbeit auf Hinweise von lange zurückliegenden Verbrechen: Wer hat Ötzi die schweren Wunden beigebracht, an denen der Steinzeitmann schließlich in eisiger Höhe verstarb? Abschließend wagen wir noch einen Ausblick in die Zukunft: Wird die archäologische Forschung schon bald nur noch in den Labors und Rechenzentren der Wissenschaftler stattfinden? Wie werden angesichts steigender Touristenströme und sinkenden Etats für Forschung und Restaurierung archäologische Stätten wie Pompeji in der Zukunft aussehen? Werden in den Museen bald nur noch virtuelle Ausstellungsobjekte zu sehen sein, weil die Originale wieder an ihre Fundorte zurückgegeben werden müssen?
Archäologie bietet die einmalige Chance, unsere gegenwärtigen Kulturen mit denjenigen früherer Völker objektiv zu vergleichen. Wie gingen frühere Gesellschaften mit der Natur und den angehäuften Reichtümern um? »Langfristig kommt es uns viel billiger zu stehen,« erklärt der interdisziplinär arbeitende Anthropologe und Archäologe Jared Diamond, »wenn wir Archäologen damit beauftragen, herauszufinden, was beim letzten Mal geschah, als wenn wir die gleichen Fehler wiederholen.« Da die Archäologie gern als Spatenwissenschaft bezeichnet wird, weil Archäologen ihre Funde in der Regel erst freilegen müssen, beginnen wir unsere Suche jedoch, indem wir das scheinbar Normalste von der Welt in Frage stellen: Warum landen Zeugnisse alter Kulturen eigentlich unter der Erde?
Unter dickem Uferschlamm und städtischen Schutt suchen die Archäologen in Dublin nach den Resten der einstigen Wikinger-Siedlung auf dem Stadtgebiet.
Teil I
Was mit antiken Ruinen vor der Archäologie geschah
KAPITEL 1
Schlamm drüber oder einfach zumüllen!
Wie Gräber, Tempel sowie Siedlungen unter die Erde gerieten
Pompeji – 24. August 79 n. Chr. Ein heftiger Erdstoß erschütterte die reiche Römerstadt südöstlich des Vesuvs, es folgte ein gewaltiger Knall. Die Menschen sahen besorgt zum Vulkankegel: Dessen Spitze hatte sich gespalten, ein feuriger Steinhagel prasselte auf die Stadt, Ascheregen und giftige Gase füllten Augen, Mund und Lungen der Bewohner und begruben die Stadt unter einer dicken Schicht. Über 19 Stunden lang soll diese Phase – die von Vulkanologen nach dem Augenzeugenbericht Plinius des Älteren heute »plinianische« genannt wird – gedauert haben. Als sicherster Beweis galten den Archäologen freigelegte Abdrücke von menschlichen Körpern, die in schutzsuchender Haltung erstarrt waren.
Ältere Pompejibücher stellen diesen Verlauf der Katastrophe als unumstößliche Tatsache dar. Doch ein Team italienischer Wissenschaftler, die Anfang der 1990er-Jahre in einem bis dahin unberührten Areal des Wohnviertels Insula dei Casti amanti (Quartier des züchtigen Liebespaares) einen 30 Meter langen und drei Meter tiefen Grabungsschnitt anlegten, stießen auf eine andere Spur. »Oberhalb der Bims- und der dünnen Ascheschicht liegen Ablagerungen, die charakteristisch für pyroklastische Ströme sind und von sechs verschiedenen Eruptionen herrühren«, erläutert der Vulkanologe Aldo Marturano. Pyroklastische Ströme – also Lavaströme – und nicht nur Bimsstein- und Ascheregen überfluteten die Stadt. Die Wissenschaftler konnten sogar die Geschwindigkeit der Lavawellen bestimmen. Von einem zwei Stockwerke hohen Gebäude im südlichen Teil der Insula stand nur noch die Basis, die Außenwand war in einem Stück weggedrückt worden. »Ihr Fall dürfte etwa 0,4 bis 0,5 Sekunden gedauert haben, daraus ergibt sich eine Geschwindigkeit der vulkanischen Lawine von 65 bis 80 Kilometern pro Stunde«, so Marturano. Auch stimmt es nicht, dass die Menschen sogleich von einer Giftgaswolke überrascht wurden. Wie Plinius sind viele ans Meer geflohen, doch der weitere Fluchtweg war ihnen durch die Eruptionen verstellt. Andere haben versucht sich zu schützen. Fenster und Tür eines kleinen Raumes, in dem die Wissenschaftler drei menschliche Skelette fanden, waren abgedichtet worden. Aus den neuen Erkenntnissen, die mit Berichten von Augenzeugen verglichen wurden, ergibt sich folgende Chronologie des Untergangs: Vor dem eigentlichen Ausbruch ereigneten sich am 24. August ab vier Uhr morgens heftige Erdbeben. Daran waren die Pompejianer gewöhnt. Deshalb flohen sie nicht, sondern begannen unverzüglich mit Aufräumarbeiten. Die erste Phase des Vulkanausbruchs setzte mittags ein. Während rund vier Stunden lang weißer und grauer Bimsstein auf Pompeji hinabregnete, verlief der Hauptausstoß in östliche Richtung. Das haben auch neue Untersuchungen an 80 Skeletten bestätigt, die vor kurzem am Strand von Herculaneum (14 Kilometer nordwestlich von Pompeji) freigelegt wurden. Die Opfer hatten nicht einmal Zeit, eine schützende Körperhaltung einzunehmen, so der neapolitanische Archäologe Alberto Incoronato: »Die Hitzewelle eines Stromes aus Gas und vulkanischer Asche, der sich über die 20 Meter hohe Felsküste ergoss, tötete die Menschen praktisch sofort; in Bruchteilen von Sekunden versagten die lebenswichtigen Organe.«
Jederzeit kann der Vesuv (im Hintergrund) wieder ausbrechen und Pompeji erneut unter seiner Lava verschütten.
In einer anschließenden Übergangsphase ereigneten sich erneut starke Erdbeben. Erst in den frühen Morgenstunden des 25. August erreichten pyroklastische Ströme und Giftgaswolken Pompeji. Plinius der Ältere starb am Strand und wo bisher Pompeji lag, breitet sich nun eine leblose Lava-Wüste aus. Die Stadt geriet in Vergessenheit und wurde erst 1700 Jahre später, nach einer erneuten Vesuv-Erschütterung, beim Aushub eingefallener Wassergräben zusammen mit der Nachbarstadt Herculaneum wiederentdeckt.
Seit rund 250 Jahren sind Forscher damit beschäftigt, die beiden Städte mit dem Spaten Haus für Haus, Straße für Straße von der bis zu 12 m dicken Schicht aus Asche und Bims zu befreien. Deshalb wird die Archäologie immer wieder auch (besonders in Zeitungen und im Fernsehen) Spatenwissenschaften genannt – doch trägt sie dieses Pseudonym zu Recht? Auf den ersten Blick schon. Was die Archäologen finden, müssen sie in den allermeisten Fällen dem Boden oder dem Meeresgrund entreißen. Denn was auf der Erdoberfläche einfach so herumlag oder sich ganz dicht unter der Oberfläche befand, das wurde schon vor langer Zeit zerstört. Oder wenn es wertvoll war, haben es andere längst mitgenommen. Für die Archäologen ist nur übrig geblieben, was tiefer unter der Erde liegt. Soweit, so gut. Doch sogleich taucht die Frage auf: Warum geraten denn Dinge überhaupt unter die Erde? Und wovon hängt es ab, das einiges unter die Erde gerät und anderes nicht?
Die Kunst, zu verschwinden
Nur sehr selten ist es ein so spektakuläres Ereignis wie ein Vulkanausbruch, das eine ganze Siedlung mit einem Mal verschwinden lässt und das noch auf eine Art und Weise, die sie nahezu vollständig für spätere Entdecker konserviert. Tatsache ist vielmehr: In den allermeisten Fällen werden die Überbleibsel menschlicher Kultur entweder durch Feinde, spätere Bewohner dieser Region oder durch Naturgewalten weitgehend vernichtet. Warum also geraten einige Menschenwerke wenig oder gar nicht zerstört unter die Erde? Vieles wofür sich Archäologen interessieren, wurde von den Menschen vergangener Zeiten bewusst im Boden deponiert. Einiges davon wollten sie selbst später wiederfinden, am spektakulärsten sind sogenannte »Schatzfunde«, Depots mit wertvollen Gegenstände wie Edelmetalle, die von den Archäologen lieber als »Horte« bezeichnet werden. So haben die Wikinger die Beute ihrer Plünderzüge in zahllosen Horten über ganz Nordeuropa verteilt. Viele davon ließen sie zurück, weil sie sie nicht mehr wiederfanden, fliehen mussten oder nicht mehr von ihrem Raubzug zurückkehrten. Allein in Schleswig-Holstein wurden in den letzten 200 Jahren rund 50 solcher Edelmetalldepots entdeckt.
Wie Horte muten auch etliche Opferfelder der Germanen und ihrer Vorgänger an, wo sie seit der späten Steinzeit (um 10 000 v. Chr.) anfangs einen Teil ihrer Nahrungsmittel, Felle und Feuersteine, dann eigene oder erbeuteten Waffen sowie hin und wieder auch jemanden aus den eigenen Reihen in Seen, Flüsse und Moore warfen. Ein Großteil der Kultgegenstände, die nicht gefunden werden sollten, befand sich in Gräbern in Form von kostbaren Beigaben. Sie sollten dem Verstorbenen die Reise ins Jenseits erleichtern und wurden zusammen mit den Leichnamen in Großsteingräbern unter tonnenschweren Steinen oder in Grabkammern unter gewaltigen Hügeln aus Steinhaufen und Erdreich verborgen.
Mit besonderer Akribie wurden Gräber der Pharaonen im ägyptischen Tal der Könige versteckt: Der Eingang wurde verschüttet, Labyrinthe angelegt, Statuen des furchteinflößenden Grabwächters Anubis (einer Gottheit in Menschengestalt mit Hundekopf) flankierten den Zugang und Formeln am Eingang verfluchten mögliche Grabräuber. Trotzdem wurden die meisten Pharaonengräber schon bald nach ihrer Versiegelung geplündert, oft von den nachfolgenden Pharaonen mithilfe der Graberbauer.
Ehemalige Siedlungen aus Lehmhäusern hinterlassen meterdicke Schichten, durch die sich die Archäologen nur mühsam vorarbeiten.
Doch der größte Teil menschlicher Bauwerke befindet sich heute unbeabsichtigt unter der Erde: Tempel, die für die Ewigkeit errichtet wurden, und ganze Siedlungen, in denen die Ausgräber noch die Alltagsgegenstände der damaligen Bewohner finden. Um solche Stätten wiederzufinden, fragen sich die Archäologen: Wie tief können alte Siedlungen heute begraben liegen, wenn sie zum Beispiel vor 3000 Jahren aufgegeben wurde? Zehn, fünf oder nur einen Meter tief?
Drei oder vier Spatenstiche bis zur Bronzezeit
Kreta im Jahre 1878. Der Kaufmann Minos Kalokerinos besaß eine Olivenbaum-Plantage, die sich über den Kephala-Hügel fünf Kilometer südöstlich der Inselhauptstadt Iraklion erstreckte. Wenn er sie besichtigte fielen ihm immer wieder Strukturen im Boden auf: lange gerade Streifen, die Rechtecke bildeten. Dies deute auf eine Ruinenstätte hin, erklärten ihm Bekannte. Also ließ er einen Graben anlegen und fand keinen halben Meter tief Mauerwerk und Steine mit eingeritzten Doppeläxten. Da Kreta noch unter osmanischer Herrschaft stand, ließ er die Arbeit wieder einstellen und wartete ab. Doch 1886 kam der reiche Händler und Troja-Ausgräber Heinrich Schliemann nach Kreta, hörte von dem Fund, besichtigte den Hügel und wollte sofort den Palast des Minos ausgraben. Denn um nichts anderes konnte es sich Schliemanns Meinung nach bei dieser Ruine handeln (mehr zu Schliemanns vorschnelle Schlussfolgerungen im Kapitel 7). Doch war ihm der Preis des Grundstückes, das er hätte erwerben müssen, zu hoch. Außerdem zählte er genau nach: Statt der zugesicherten 2500 Olivenbäume standen nur 889 auf dem Gelände! Erbost reiste er ab.
Die Minoer: Geheimnisvolle Zeichen, labyrinthische Paläste
Kreta wurde im 6. Jahrtausend v. Chr. von Menschen aus Kleinasien besiedelt, die zunächst in Höhlen und rechteckigen Lehmbauten wohnten, Gerste und Weizen, Oliven und Wein anbauten und Viehzucht betrieben. Zwischen 3100 und 2100 v. Chr., in der sogenannten »Vorpalastzeit«, entwickelte sich langsam die minoische Kultur mit Straßen und Wasserleitungen, verschachtelten Gebäudekomplexen, schlanken Gefäßen, Schmuck, Vasenmalereien, Siegeln und der ersten europäischen Schrift (diese Linear-A-Hieroglyphen sind übrigens bis heute nicht entziffert).
In der anschließenden, sogenannten »Alten Palastzeit« (zwischen 2100 und 1700 v. Chr.) existierten auf der Insel eine Reihe gleichrangiger Fürstentümer, deren Mittelpunkte Paläste waren: Knossos, Phaistos, Malia und Kato Zarkros. Diese clusterförmigen Anlagen bestanden aus Magazinen, Heiligtümern, Festsälen, Werkstätten und verstreuten Wohnräumen. Um 1700 v. Chr. kam es zu einer Katastrophe, deren Ursachen trotz intensiver Forschung bis heute nicht geklärt sind, und die Paläste fanden durch Feuersbrünste ein jähes Ende.
Die Minoer begannen sogleich mit dem Wiederaufbau, doch nun geriet der Großteil Kretas in Abhängigkeit von einem Herrscher, der im Palast von Knossos residierte. Die um 1700 v. Chr. errichteten Anlage, heute »Neuer Palast« genannt, mit ihren über 1000 Räumen auf rund 20 000 Quadratmetern, wies keine zentralen Achsen oder Fluchten auf, sondern breitete sich mäandernd wie ein eigenständiger Organismus aus. Es liegt auf der Hand, dass die Festlandsgriechen nach einem Besuch vom »Labyrinth in Knossos« erzählten; die überall verwendeten Stierkopfmotive in Fresken und als Statuen haben dabei sicherlich den Anstoß zur Minotaurus-Legende geliefert.
Ihr Ende fand die minoischen Kultur, als nach zwei kurz aufeinanderfolgenden Feuerkatastrophen (um 1450 und um 1380 v. Chr.) der Palast von Knossos und weitere Palastzentren auf der Insel endgültig untergingen. Neueste Forschungen machen ein Erdbeben für die Feuerkatastrophen verantwortlich. Nach den Zerstörungen übernahmen Mykener die Herrschaft auf Kreta. Das beweisen die Einführung der Linear-B-Schrift und Gräber mit üppiger Waffenausstattung – beides mykenische Merkmale.
So ist die Entdeckung von Knossos und die Erforschung der minoischen Kultur aufs Engste mit dem Lebensweg des vermögenden englischen Gelehrten Arthur Evans verbunden. Evans hatte 1884 einen Siegelstein mit Linear-B-Zeichen zugeschickt bekommen und als er 1894 ähnliche Zeichen in den freigelegten Funden des Kephala-Hügels erblickte, war sein Interesse geweckt und er erwarb das Gelände. Schon kurz nach 1900 begann er mit den Grabungen, nur wenig unter der Oberfläche kam der Palast zum Vorschein. Unter verkohlten Holzsäulen und Balken legten die bis zu 120 Arbeiter Wände mit zum Teil gut erhaltenen Fresken frei. Der Neue Palast verfügte schon über komplexe Be- und Entwässerungssysteme. Mit seinen Rekonstruktionen schoss Evans jedoch über das Ziel hinaus. So gibt es keine gesicherten baulichen Hinweise für eine Freitreppe. Evans nahm nur an, dass sich hinter der großen Toranlage eine befunden haben müsse, passen will sie jedoch nicht zur bisher bekannten minoischen Architektur. Handelt es sich bei dem großen Raum im Westflügel tatsächlich um den »Thronsaal«? Indizien wie Naturdarstellungen sowie die Lage zwischen Heiligtümern sprechen eher für einen weiteren sakralen Raum. Und beim »Megaron der Königin« waren niedrige Sitzbänke der einzige Hinweis, der Evans zu dieser Interpretation veranlasste. Doch die Rekonstruktionen mit Beton haben auch einen Vorteil. Verglichen mit anderen Ausgrabungsstätten tragen sie wesentlich zur dauerhaften Konservierung der Gebäudekomplexe bei. Außerdem verfasste Evans ein vierbändiges Monumentalwerk »The Palace of Minos at Knossos«, das sämtliche Bereiche der minoischen Kultur abhandelt. Darüber hinaus regten Evans’ Arbeiten weitere Grabungen an vielen Orten Kretas an. Funde und Forschungen bestätigen: Die Hochkultur der Neuen Palastzeit fand durch zwei aufeinander folgende Katastrophen um 1450 v. Chr. und um 1380 v. Chr. ein jähes Ende. Die meisten Orte auf Kreta wurden durch Feuer zerstört. Lange Zeit glaubte die Forschung, dieses stünde in Zusammenhang mit dem Vulkanausbruch auf Thera/Santorin. Doch mittlerweile wurde mit exakten Methoden – unter anderem einer Bohrkern-Analyse des Grönlandeises – der Vulkanausbrauch auf den Zeitpunkt 1644 v. Chr. datiert. Grabungen in minoischen Siedlungen zeigen, dass über der Vulkanasche weiter gesiedelt wurde. Diese bildet nur eine bis zu 10 Zentimeter dicke Schicht, darüber noch etwas im Laufe der Jahrtausende abgelagerter Mutterboden: drei bis vier Spatenaushube reichen meist, um an die minoischen Mauerwerke zu gelangen.
Auch die slowakische Grabungsstätte Nizna Mysla (Bronzezeit – 1400 v. Chr.) liegt nur 25 Zentimeter unter der Erde. Die Archäologen geben noch einmal 30 Zentimeter dazu, um einen Hausgrundriss zu finden. Und noch einmal 80 Zentimeter, um auf den Grund der Pfostenlöcher zu kommen. Zusammen gerade einmal einen Meter und 35 Zentimeter – darunter sind keine Spuren von der zivilisierten Menschheit mehr zu finden.
Auch in Nordeuropa liegen die Siedlungen der Zeit, als die Menschen hier sesshaft wurden (6000–4000 v. Chr. – in der Jungsteinzeit) nur einige Dezimeter unter der Erde. Auf genaue Zentimeter-Zahlen wollen sich die Archäologen aber nicht festnageln lassen, denn wo genau verläuft in einer Kulturlandschaft mit Ackerböden und Gärten, Straßen und Häusern die natürliche Erdoberfläche? Die Spuren liegen allerdings so dicht unter der Oberfläche, dass die mysteriösen kreis- und ellipsenförmigen Erdwerke der Jungsteinzeit unter Ackerflächen aus der Luft als Bodenprofile zu erkennen sind. Warum liegen die meisten archäologischen Stätten weit weniger tief unter der Erde, als die meisten Menschen erwarten würden?
Mithilfe von viel Beton wurde der Nordeingang so rekonstruiert, dass der Besucher eine Vorstellung vom Palast von Knossos bekommt – aber ist sie auch die richtige?
Schlamm drüber – die Erosionskraft
Hitze und Kälte, Wind und Regen – kurz: die Erosionsprozesse wirken sich in den einzelnen Regionen der Erde sehr unterschiedlich aus. Mitten in der Wüste beispielsweise gibt es kaum Erosion. So bildete Palmyra, eine Oase in der Syrischen Wüste, einst als Handelszentrum das westliche Ende der Seidenstraße – die Säulen der einstigen Tempel und Arkaden stehen heute noch frei in der Landschaft. Antike Ruinen werden in diesen Landschaften nur dort bedeckt, wo es starke Sandstürme gibt oder wenn sie mitten in einem Wadi (einem trockenen Flussbett) liegen, der nach einem der seltenen Regenfälle schlammiges Wasser transportiert.
Auf Berggipfeln wiederum ist ein Bauwerk den Naturgewalten ausgesetzt: Der Wind schleift an den Mauern von Höhenfestungen und große Temperaturunterschiede sprengen einzelne Gesteinsbrocken aus Burg und Berg. Das Regenwasser spült sie dann, der Schwerkraft folgend, zusammen mit ausgeschwemmten Teilchen bergab. Deshalb sind die Erosionskräfte besonders an den Berghängen zu spüren – Siedlungen können hier über Nacht lawinenartig verschüttet werden. Trotzdem siedelten die Menschen in der Vergangenheit häufig an Hängen und in Flusstälern, denn Erosion und Überschwemmungen lagern hier fruchtbare Böden ab. Aber das Risiko ist hoch, Opfer der Schlammfluten zu werden, wie das griechische Olympia zeigt.
1875 reiste der Archäologe Ernst Curtius mit seinen Mitarbeitern in den Südwesten der Peloponnes, um den antiken Ort freizulegen. Doch ihnen bot sich folgendes Bild: Felder und Weinberge breiteten sich zwischen dem Fluss Alphaios und dem Kronos-Hügel aus, nur eine klitzekleine Ruine aus Ziegelstein am Fuße des Hügels gab einen zarten Hinweis darauf, dass hier die berühmteste Wettkampfstätte aller Zeiten gelegen hat. Alles andere hatten Erdbeben und Überschwemmungen des Alphaio unter einer bis zu fünf Meter dicken Schlammschicht begraben. Die Archäologen wollten Olympia ausgraben, doch wo sollten sie anfangen zu suchen? Es gibt Regionen, in denen die Erosion durch einen wilden Pflanzenwuchs noch verstärkt wird: In den Dschungeln Südostasiens und Mittel- und Südamerikas werden antike Stätten in wenigen Jahren von Pflanzen überwuchert, während sich die sich verzweigenden Wurzeln ihren Weg durch das Mauerwerk bahnen und es dabei häufig einfach aufsprengen.
Die Natur kann jedoch auch über Nacht zuschlagen, denn nicht nur das eingangs erwähnte Pompeji, ganze Kulturen wurden durch Naturkatastrophen vernichtet. So streiten die Forscher noch darüber, ob der Vulkanausbruch auf der griechischen Insel Thera/Santorin oder ein Erdbeben für den Untergang der minoischen Kultur auf Kreta (Mitte des 2. Jahrtausend v. Chr.) verantwortlich ist. Auch Ötzi blieb uns als Eismumie nur deshalb erhalten, weil er nach seinem Tod in kürzester Zeit von einem sich ausbreitenden Gletscher überdeckt wurde. Unter noch dickeren Schichten – die bis zu 20, 30 Meter erreichen können – ruhen etliche ehemalige Siedlungen und Städte. Das liegt daran, dass die größten Ablagerungen, unter denen archäologische Stätten liegen, meistens von den Bewohnern selbst stammen.
So wurde zum Beispiel der Siedlungshügel Tall Chuera, der im heutigen Nordsyrien liegt, im 3. Jahrtausend v. Chr. von seinen Bewohnern regelrecht zugemüllt. Das entdeckte der Tübinger Archäologe Peter Pfälzner mit seinem Team, als er den Tall Chuera von 1995 bis 1997 untersuchte. Die mittelgroße Stadt, die damals rund 50 000 Einwohner hatte, fiel ihnen durch ihre strenge Bauordnung auf: Alle Reihen-Wohnhäuser waren gleichbreit und identisch aufgebaut. Doch der Zentralplatz dieser politisch und ökonomisch blühenden Musterstadt versank im Lauf der Zeit unter einer 12 Meter dicken Müllschicht aus Asche, Tierknochen und zerbrochenem Geschirr – bis die Stadt daran regelrecht erstickte. Die Archäologen stehen vor einem Rätsel.
Aber auch normaler Siedlungsschutt kann sich zu ganzen Hügeln auftürmen. Das liegt vor allem daran, dass Siedlungen und Städte im Laufe der Jahrtausende immer wieder an den gleichen bevorzugten Stellen errichtet werden – natürliche Hafenbuchten, Flussmündungen und Hügelkuppen beispielsweise. So liegen in Köln die Bauelemente der rund 2000 Jahre alten römischen Stadt »Colonia Claudia Ara Agrippinensium« unter bis zu sieben Meter dickem Bau- und Erosionsschutt. Der Baubeginn einer neuen U-Bahnstrecke öffnete den Archäologen im Jahr 2003 einen wunderbaren Schnitt durch diese Schichten. Ein Projekt, das sich über zehn Jahre hinzog und sich zur größten Ausgrabung der Stadtgeschichte entwickelte. Mithilfe alter Karten, Fotografien und früherer Fundberichte hatten die Archäologen vorher recherchiert, um die zehn besonders ergiebigsten Untersuchungsgebiete von insgesamt 30 000 Quadratmetern Fläche ausfindig zu machen. Das Ergebnis: 2,5 Millionen große und kleine Fundstücke aus 2000 Jahren Stadtgeschichte, darunter Bestandteile des römischen Hafens sowie mehrerer Tempelanlagen, die direkt am Rheinufer gelegen haben müssen, Festungswerken aus dem Mittelalter und preußischen Grabenwerken. Außerdem eine komplette Bergkristallwerkstatt aus dem 12. Jahrhundert n. Chr., die aus 25 000 einzelnen Teilen besteht und der Schädel eines Wollnashorns, das um 37 000 v. Chr. gelebt hat und von einem Römer als Werkbank benutzt wurde.
Noch gewaltiger werden diese Siedlungsschichten dort, wo Lehm für den Hausbau benutzt wurde. Häuser aus Lehm werden nach 20 bis 25 Jahren brüchig. Und da der Baustoff nicht recycelbar ist, wird er einfach einplaniert und das neue Haus darüber errichtet. Im Laufe der Jahrhunderte wächst auf diese Weise Schicht auf Schicht eine Hügelkuppel, die zwanzig bis dreißig Meter hoch werden kann. Solche künstlichen Hügel, die Tepe oder Tell genannt werden, finden sich noch heute vor allem in den Regionen rund um das Mittelmeer und im Nahen Osten. Auf die prominentesten Beispiele wie Troja, Uruk und Babylon kommen wir natürlich immer wieder zurück.
Eine Zeitreise ins Erdinnere auf den Spuren der Archäologen gleicht deshalb keiner ruhigen Fahrt mit der Rolltreppe durch regelmäßige Schichten, sondern eher einer Fahrt mit der Achterbahn rauf und runter: Neolithische Erdwerke (6000 v. Chr.) 20 cm tief – Babylon (2200 v. Chr.) 2000 cm tief – bronzezeitliches Nizna Mysla (1400 v. Chr.) 25 cm tief – Olympia (4. Jh. n. Chr.) 500 cm tief … All diese Beispiele bezogen sich auf die letzten 13 000 Jahre, denn bei noch älteren Funden, kommt in Nordeuropa die Eiszeit ins Spiel.
Stein, Bronze, Eisen – die Epochen der Menschheitsgeschichte
Als das Dänische Nationalmuseum zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Frühgeschichte Nordeuropas in einer großen Ausstellung präsentieren wollte, bekam Museumsmitarbeiter Christian J. Thomsen ein Problem. Denn die Exponate bestanden aus einem ungeordneten Berg aus Faustkeilen, Messern und Schwertern, Gürtelschnallen, Sicheln, Axtscheiden, Pflügen, steinernen Pfeilspitzen und noch mehr Faustkeilen. Thomsen sortierte alle Steinwerkzeuge auf einen Haufen, die Bronzegegenstände auf den nächsten und die aus Eisen auf einen dritten. Er ging einfach davon aus, dass die Steinwerkzeuge älter als die aus Bronze und Eisen waren, und sortierte sie unter der Bezeichnung »Steinzeit«. Bronzegegenstände waren seiner Meinung nach auch älter als die aus Eisen – denn wer einmal ein Eisenschwert herstellen kann, nimmt freiwillig keine weichere Bronze mehr für diesen Zweck – und gehörten deshalb zur »Bronzezeit«. Blieben schließlich noch die Funde der »Eisenzeit« übrig.
Dieses 3-Perioden-System hat sich in der Folgezeit bis heute bewährt – allerdings wurde es immer weiter untergliedert: Die Steinzeit reicht von den ersten Frühmenschen (Hominiden) mit Steinwerkzeugen vor ca. 2,5 Millionen Jahren bis vor ca. 5000 Jahren. Da lernten die Menschen mit Metallen so gut umzugehen, dass sie die ersten Werkzeuge und Waffen aus Bronze herstellen konnten. Die Eisenzeit breitete sich um 500 v. Chr. aus Norditalien (die Etrusker waren die ersten Eisenschmiede dort) Richtung Nordeuropa aus und hält im Prinzip bis heute an – unser Zeitalter wird wohl erst von künftigen Archäologen definiert.
Mit dem Abraumbagger in die Urgeschichte
Vor ungefähr 2 Millionen Jahren kühlte es auf der Erde erheblich ab, deshalb wird diese Klimaepoche Eiszeitalter oder Quartär genannt. Es blieb jedoch nicht durchgehend kalt, immer wieder wurden die Eiszeiten (Glazial) von kleinen Warmzeiten (Interglazial) unterbrochen – und die letzte Eiszeit ist auch noch nicht vorbei, vor rund 13 000 Jahren begann nur eine besonders lange Warmzeit.
Obwohl der Unterschied zwischen Warm- und Kaltzeit im Durchschnitt nur vier Grad ausmachte, war die Wirkung gewaltig. Über Nordeuropa bildete sich eine bis zu 3000 Meter dicke Eisdecke, die auf ihrem Weg nach Süden ganze Bergspitzen abtrug und riesige Mengen an Steinen, Sanden und Lößboden bis nach Mitteldeutschland hinein schob. Die in den Warmzeiten entstandenen üppigen Schichten aus Tier- und Pflanzenresten wurden auf diese Weise von den Gletschern der nächsten Eiszeit wieder bedeckt. So entstanden beispielsweise dicke Moorschichten, die sich im Laufe der Jahrtausende zu Torf wandelten. Falls es irgendwo dazwischen auch Spuren menschlichen Lebens gab, konnten die Archäologen in diesen Tiefen mit ihren Spaten jedenfalls nichts ausrichten. Wo und wie sollten sie an mögliche Funde in fünf, zehn oder 15 Metern Tiefe gelangen? Sie konnten sich nur Grabenden anschließen – die beispielsweise Bagger benutzen, die Ausmaße von Parkhäusern haben.
Nach 400 000 Jahren freigelegt – die Holzspeere des Jagdlagers von Schöningen.
Mit seinem sieben Meter breiten und fünf Meter langen Deckstein erinnert der »Heidenopfertisch« bei Wildeshausen tatsächlich an einen von Tragsteinen gestützten Tisch.
»Schachtgräberrund A« – so nüchtern benannten Archäologen das auffällige Bauwerk in Mykene, in dessen Tiefen Schliemann seine »Maske des Agamemnon« fand.
Herrschersitz im Zeichen der Löwen
Auf der Atlas-Karte scheint die zerklüftete Peloponnes-Halbinsel wie ein großes tropfendes Dreieck unter dem griechischen Festland zu hängen. Ganz im Südwesten dieses gebirgigen Dreiecks hat sich ein besonders breites Tal zwischen die Berge geschoben, das sich trichterförmig zum Meer hin öffnet. Am Ausgangspunkt dieses Trichter-Tals thront auf einem Felsvorsprung die Festung von Mykene. Dreimal war ich bisher in Mykene und jedes Mal imponierte mir diese Stätte aufs Neue. Selbst beim ersten Mal, als ich über das sture Fakten-Nachbeten meiner Lehrer so erbost war. Dieses Gefühl des Überwältigt-Seins kam vielleicht schon daher, dass wir alle kurz vor einem Sonnenstich standen, als wir den steilen Weg zur Festung in der heißen Mittagszeit erklommen. In allen Reiseführern steht dick und fett: Kommen Sie nur morgens oder abends! Doch fast immer steht man mittags oder nachmittags dort in der mörderischen Hitze ohne die geringste Aussicht auf Schatten. Morgens schafft man es nicht, weil sich die Anreise über die gewundenen Bergstraßen immer länger hinzieht, als man denkt. Und abends kommt man nicht herein, weil die letzte Einlasszeit für die griechischen Antiken Staaten auch in der Sommerzeit 19 Uhr beträgt.
Heute wie einst erstreckt sich diese Festungsanlage über eine Fläche, die mit rund 30 000 Quadratmeter größer ist als 4 Fußballfelder, und wird von einer an abschüssigen Stellen bis zu 17 Meter hohen Mauer aus gewaltigen Kalksteinblöcken umgeben. Tonnen von Gestein – wie mit einer maschinellen Steinsäge in Quader zerschnitten und wie mit einem Schwerkran auf den Berg und an die richtigen Stellen platziert. Doch wie konnten Menschen ohne unsere heutigen Hilfsmittel ein solches Bauwerk hoch oben auf einer Berghöhe errichten? Der Zugang zur Burganlage erfolgt immer noch durch das berühmte »Löwentor«, das in die hohe Festungsmauer eingelassen ist. Zwei riesige Steinquader an den Seiten stützen einen über 20 Tonnen schweren Querbalken, in dem zwei Löwen, die sich zur Rechten und Linken einer Säule aufrichten, eingemeißelt sind. Gleich hinter dem Tor liegt auf der rechten Seite das bemerkenswerteste Bauwerk der mykenischen Burg, das den höchst nüchternen Namen »Schachtgräberrund A« trägt. Es handelt sich um einen 27,5 Meter breiten Kreis, der von zwei Ringen aus geglätteten Sandsteinen umrandet ist. Hier fand Heinrich Schliemann 1876 unter sieben Metern Schutt Gräber mit wertvollsten Beigaben – darunter ein ovales Goldblech, das einem Gesicht nachgeformt wurde. Schliemann erklärte es sofort zur Totenmaske des legendären Agamemnon, der die griechischen Schiffe gegen Troia geführt hatte – seitdem hat die Totenmaske ihren Namen, als wäre er eingebrannt. Obwohl immer wieder daran gezweifelt wird, ob Agamemnon tatsächlich gelebt hat.
Mykenische Kultur