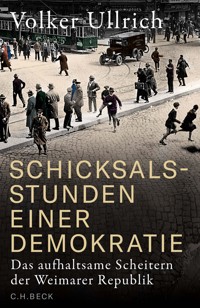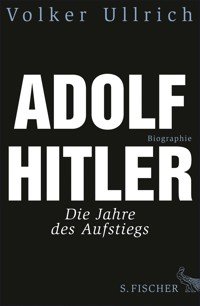21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen ‹1923›-Erlebnis entspricht», schrieb Sebastian Haffner im englischen Exil, und Stefan Zweig befand, dass die Geschichte noch «nie eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen produziert» habe. Volker Ullrich erzählt auf breiter Quellenbasis die Geschichte dieses Jahrs am Abgrund, das in manchem auf fatale Weise an die heutige Gegenwart erinnert. Nach der vielgerühmten Hitler-Biografie und dem Bestseller «Acht Tage im Mai» legt der renommierte Journalist und Historiker nun das Panorama einer aus den Fugen geratenen Zeit vor, die Chronik eines in jeder Hinsicht extremen Jahres. 1923 erlebt Deutschland einen Sturz ins Bodenlose. Französische und belgische Truppen marschieren ins Ruhrgebiet ein. Die Hyperinflation erreicht ihren bizarren Höhepunkt und stürzt breite Bevölkerungsschichten ins Elend. Während die Vergnügungsindustrie boomt, herrscht politisch der Ausnahmezustand. Separatistische Bewegungen bedrohen den Bestand des Reiches, rechte und linke Extremisten setzen zum Sturm auf die Republik an, und in München bereitet ein Mann einen Putschversuch vor, dessen Name sich der Welt noch einprägen wird: Adolf Hitler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Volker Ullrich
Deutschland 1923
Das Jahr am Abgrund
C.H.Beck
Zum Buch
«Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe, niemand weiß, was wird.»
Victor Klemperer
«Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen ‹1923›-Erlebnis entspricht», schrieb Sebastian Haffner im englischen Exil, und Stefan Zweig befand, dass die Geschichte noch «nie eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen produziert» habe. Volker Ullrich erzählt auf breiter Quellenbasis die Geschichte dieses Jahrs am Abgrund, das in manchem auf fatale Weise an die heutige Gegenwart erinnert. Nach der vielgerühmten Hitler-Biografie und dem Bestseller «Acht Tage im Mai» legt der renommierte Journalist und Historiker nun das Panorama einer aus den Fugen geratenen Zeit vor, die Chronik eines in jeder Hinsicht extremen Jahres.
1923 erlebt Deutschland einen Sturz ins Bodenlose. Französische und belgische Truppen marschieren ins Ruhrgebiet ein. Die Hyperinflation erreicht ihren bizarren Höhepunkt und stürzt breite Bevölkerungsschichten ins Elend. Während die Vergnügungsindustrie boomt, herrscht politisch der Ausnahmezustand. Separatistische Bewegungen bedrohen den Bestand des Reiches, rechte und linke Extremisten setzen zum Sturm auf die Republik an, und in München bereitet ein Mann einen Putschversuch vor, dessen Name sich der Welt noch einprägen wird: Adolf Hitler.
Über den Autor
Volker Ullrich ist Historiker und leitete von 1990 bis 2009 bei der Wochenzeitung «Die Zeit» das Ressort «Politisches Buch». Zu seinen Werken gehören die zweibändige Biografie «Adolf Hitler» (2013 und 2018) sowie der Bestseller «Acht Tage im Mai» (62020 und C.H.Beck Paperback 22021).
Inhalt
Vorwort
I. Ruhrbesetzung und Ruhrkampf
II. Von der Inflation zur Hyperinflation
III. Versuche einer Krisenlösung: die Große Koalition unter Stresemann
IV. Deutscher Oktober
V. Der Ruf nach der Diktatur
VI. «Los von Berlin»: Separatistische Bewegungen im Rheinland und in der Pfalz
VII. Auf dem Weg zur Stabilisierung: Von Stresemann zu Marx
VIII. Kultur im Schatten der Krise
IX. Ausblick
Anhang
Dank
Anmerkungen
Vorwort
I. Ruhrbesetzung und Ruhrkampf
II. Von der Inflation zur Hyperinflation
III. Versuche einer Krisenlösung: die Große Koalition unter Stresemann
IV. Deutscher Oktober
V. Der Ruf nach der Diktatur
VI. «Los von Berlin»: Separatistische Bewegungen im Rheinland und in der Pfalz
VII. Auf dem Weg zur Stabilisierung: Von Stresemann zu Marx
VIII. Kultur im Schatten der Krise
IX. Ausblick
Quellen und Literatur
1. Quellen
1.1 Archivalische Quellen
1.2. Zeitungen und Zeitschriften
1.3. Gedruckte Quellen
2. Tagebücher, Briefe, Erinnerungen
3. Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Vorwort
«Möge 1923 besser werden, als dies nach jeder Richtung schlimmste 1922. Amen!» Mit diesen Worten beendete Hedwig Pringsheim, die Schwiegermutter Thomas Manns, ihren Tagebucheintrag am Silvesterabend 1922.[1] Sie dürfte kaum geahnt haben, wie schlimm es tatsächlich kommen würde. 1923 wurde zur größten Bewährungsprobe der noch jungen Weimarer Republik. «Kein Volk der Welt hat erlebt, was dem deutschen ‹1923›-Erlebnis entspricht», erinnerte sich der Journalist Sebastian Haffner 1939 im englischen Exil.[2] Und der Schriftsteller Stefan Zweig schrieb in seiner ebenfalls im Exil verfassten Autobiographie «Die Welt von gestern», er glaube, Geschichte gründlich zu kennen, doch seines Wissens habe sie «nie eine ähnliche Tollhauszeit in solchen riesigen Proportionen produziert».[3]
Von dieser «Tollhauszeit» handelt dieses Buch. Es war ein Jahr, in dem die Geldentwertung schwindelerregende Ausmaße annahm, in dem faktisch ein Ausnahmezustand in Permanenz herrschte, das politische System dem Kollaps nahe war, rechte und linke Extremisten zum Sturm auf die Republik ansetzten und separatistische Bewegungen den Bestand des Reiches bedrohten. Hinzu kam massiver Druck von außen. Der Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Ruhrgebiet im Januar und die sich daran anschließenden Auseinandersetzungen wirkten in hohem Maße krisenverschärfend. Im Herbst 1923 stand das Land buchstäblich am Abgrund. Schon Zeitgenossen erschien es fast wie ein Wunder, dass die erste deutsche Demokratie diese existenzielle Gefährdung überlebte.
«The Great Disorder» – «Die große Unordnung» – hat der amerikanische Historiker Gerald D. Feldman seine voluminöse Darstellung des Inflationsjahrzehnts 1914 bis 1924 genannt.[4] Krieg, militärische Niederlage und Revolution hatten das scheinbar unerschütterliche monarchische System des Kaiserreichs hinweggefegt. Die neue, 1918/19 errichtete demokratische Ordnung kam aus dem nach-revolutionären Krisenmodus nicht heraus. Auch nach dem Abschluss des Friedensvertrages von Versailles und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung blieb die Lage prekär. Die alten wilhelminischen Eliten aus Großindustrie, Großlandwirtschaft, Militär und Bürokratie verharrten in Fundamentalopposition gegen das «System von Weimar». Umsturzversuche von rechts und links erschütterten das Land. Politische Morde, verübt von rechten Terroristen an Repräsentanten der Republik, waren an der Tagesordnung. «Die Sicherheit für politisch Missliebige ist gegenwärtig in Deutschland geringer als in den verrufensten südamerikanischen Republiken oder im Rom der Borgia», konstatierte der Diplomat und Kunstmäzen Harry Graf Kessler im Mai 1920.[5]
Ihren bizarren Höhepunkt erreichte die krisenhafte Entwicklung mit der Hyperinflation 1923. Ganz Deutschland schien wie von einem Fieberwahn erfasst. «Die Zeit ist allzusehr aus den Fugen», klagte der in Dresden lehrende Romanist jüdischer Herkunft Victor Klemperer Ende Mai 1923, und Anfang September notierte er: «Jeder fühlt etwas Bedrohlichstes in nächster Nähe, niemand weiß, was wird.»[6] Dass alles wankte, es keine Sicherheiten mehr gab und auf nichts mehr Verlass war – das war das Grundgefühl dieser Monate. Nicht nur verlor das Geld seinen Wert als Tauschmittel; im Wirbel der Inflation lösten sich auch die überkommenen Wertvorstellungen und Normen auf. Von einer «doppelten Entwertung» hat der Schriftsteller Elias Canetti zu Recht gesprochen.[7] Damit verbunden war ein fundamentaler Verlust des Vertrauens in die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen. Eine «Art Alltagsanarchismus», ein Kampf aller gegen alle war die Folge.[8]
Der Sturz ins Bodenlose, den Deutschland im Herbst 1923 erlebte, entzog sich jeder rationalen Erklärung. Er machte buchstäblich fassungslos. «Oft erscheint mir alles, was ich damals sah und erlebte, wie ein phantastischer Traum», erinnerte sich der Maler George Grosz, und er fügte hinzu: «Aber komisch: je höher die Preise stiegen, umso höher stieg die Lebenslust. Heißa, war das Leben schön!»[9] Das war die paradoxe Kehrseite jenes Elends, in das breite Bevölkerungsschichten durch den schlagartigen Verlust ihrer Ersparnisse gestürzt wurden. Eine unbändige Lust nach Zerstreuung, nach Räuschen aller Art griff um sich. Die Vergnügungsindustrie boomte wie nie zuvor. «Der Amüsierrummel erreichte Ausmaße, denen gegenüber die panisch enthemmten Gelage in den Pestjahren des Mittelalters wie schlichte Veranstaltungen gesitteter Gesangsvereine anmuteten», hat der DDR-Historiker Wolfgang Ruge pointiert geurteilt.[10]
Wer sich als Historiker mit dem Irrwitz dieser Zeit beschäftigt, sieht sich mit einem geradezu atemlosen Ablauf des Geschehens konfrontiert. Die sich überstürzenden Ereignisse und Entwicklungen folgten nicht einem zeitlichen Nacheinander, sondern liefen zum Teil parallel ab, überlagerten und verstärkten sich. Das hat Konsequenzen für die Darstellung. Die Geschichte des extremen Jahres 1923 sperrt sich gegen eine rein chronologische Erzählung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich daher versucht, das verwickelte Knäuel der Krisenphänomene zu entwirren und die Fäden unter thematischen Gesichtspunkten neu zu ordnen. Daraus ergibt sich eine die Chronologie immer wieder durchbrechende Kapitelfolge.
Das erste Kapitel behandelt die Besetzung des Ruhrgebiets durch Franzosen und Belgier im Januar, mit der das Krisenjahr eröffnet wurde. Es schildert die ruinösen Folgen des von der deutschen Regierung proklamierten passiven Widerstands, die letztlich zum Sturz des Reichskanzlers Wilhelm Cuno im August führten.
Das zweite Kapitel geht den Ursachen von Inflation und Hyperinflation nach und ermittelt, wer davon profitierte und wer dabei auf der Strecke blieb. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die deutsche Gesellschaft die rasante Entwertung der Mark erlebte und wie sich dadurch der Alltag der Menschen veränderte.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Bildung der Regierung der Großen Koalition unter Reichskanzler Gustav Stresemann und deren Versuchen, Wege aus der Krise zu finden. Dazu gehörten sowohl der Abbruch des passiven Widerstands im September als auch die Einleitung einer Währungsreform durch Gründung der «Rentenbank» Mitte Oktober.
Das vierte Kapitel berichtet von den Plänen der Moskauer Zentrale der Bolschewiki, das Chaos der Hyperinflation auszunutzen, um in Deutschland eine revolutionäre Situation herbeizuführen. Die Initialzündung sollte der Eintritt der KPD in die SPD-geführten Regierungen in Sachsen und Thüringen sein. Der «deutsche Oktober» fand nicht statt – ein Aufstand in Hamburg wurde rasch niedergeschlagen –, doch die Folgen der gescheiterten Aktion waren gravierend. Denn das scharfe Vorgehen der Reichswehr gegen Sachsen und Thüringen, das in deutlichem Kontrast stand zur Nachsicht gegenüber dem abtrünnigen Bayern, führte zum Ausscheiden der SPD aus der Regierung und damit zum Ende der Großen Koalition.
Das fünfte Kapitel lenkt den Blick auf die andere Seite des politischen Spektrums: auf die von der radikalen Rechten im Herbst 1923 verfolgten Pläne zur Etablierung einer «nationalen Diktatur», in deren Mittelpunkt der Chef der Reichswehr, General Hans von Seeckt, stand. In diesem Kontext wird auch noch einmal ausführlich auf Vorgeschichte, Verlauf und Wirkungen von Hitlers Putsch in München am 8./9. November eingegangen. Er war, so zeigt sich, kein isoliertes Unternehmen, sondern ordnet sich ein in die Bestrebungen von maßgeblichen Kreisen in Industrie, Reichswehr und auf der politischen Rechten, das parlamentarische System von Weimar zu Fall zu bringen und eine autoritäre Ordnung zu errichten.
Im sechsten Kapitel geht es um die von Frankreich unterstützten separatistischen Strömungen im Rheinland und in der Pfalz, die im Herbst 1923 in der Proklamation autonomer Republiken kulminierten. Auch wenn diesen nur eine kurze Lebensdauer beschieden war, galten sie doch als Symptom für die Auflösung staatlicher Autorität im Westen des Reiches.
Das siebte Kapitel steht im Zeichen der Stabilisierung, die mit dem «Wunder» der am 15. November eingeführten «Rentenmark» ihren signifikantesten Ausdruck fand. Unter Stresemanns Nachfolger, dem Zentrumspolitiker Wilhelm Marx, wurden die eingeleiteten Schritte zur Sanierung der Finanzen entschlossen fortgesetzt. Eine Tour d’horizon über Kommentare zum Jahresende macht deutlich, dass auch im Bewusstsein der Zeitgenossen das Gröbste überstanden war.
Das achte Kapitel fällt in gewisser Weise aus dem Rahmen des bislang skizzierten Krisentableaus. Denn im Unterschied zu den Zerfallserscheinungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik zeichnete sich die Kultur von Weimar auch schon in den frühen zwanziger Jahren durch eine bemerkenswerte Blüte aus. Anhand von Beispielen aus Film, Theater, Literatur, bildender Kunst und Architektur wird gezeigt, zu welchen Leistungen avantgardistische Künstler und Kulturschaffende gerade in den schweren Zeiten der Inflation imstande waren, aber auch, mit welchen Widerständen aus kulturkonservativen Kreisen sie zu kämpfen hatten.
Das neunte und letzte Kapitel unternimmt einen Ausblick auf das Jahr 1924, das mit der Annahme des Dawes-Plans Ende August eine vorläufige einvernehmliche Regelung der Reparationsfrage brachte. Der Weg zur Entspannung auch in der Außenpolitik war damit frei, die Nachkriegszeit definitiv beendet. Vor allem ist hier von Interesse, inwieweit die innen- und außenpolitische Konsolidierung der Republik nachhaltig war – oder ob sich hinter der Fassade einer scheinbar gefestigten parlamentarischen Demokratie neues Unheil ankündigte.
In den Forschungen zur Geschichte der Weimarer Republik stand – angefangen von der bahnbrechenden Studie von Karl Dietrich Bracher (1955) bis hin zu den großen Gesamtdarstellungen von Hans Mommsen (1989) und Heinrich August Winkler (1993) – die Frage im Vordergrund, warum die erste deutsche Demokratie bereits nach vierzehn Jahren unterging, um der verbrecherischen Diktatur des Nationalsozialismus Platz zu machen.[11] Seit Ende der 1990er Jahre sind demgegenüber verstärkt Tendenzen zu beobachten, die Republik nicht von ihrem Ende, unter der Perspektive ihres Scheiterns, darzustellen und zu deuten. Statt die Epoche zwischen 1918 und 1933 auf die Rolle eines bloßen Vorspiels des «Dritten Reiches» zu reduzieren, sollte sie, so lautet die Forderung, in ihrem «Eigenrecht» betrachtet werden, und das heißt, dass neben den belastenden Faktoren verstärkt auch nach den zukunftsfähigen Elementen zu fragen sei.[12] Gerade unter dieser Perspektive stellt sich 1923 als ein Schlüsseljahr dar. Denn an ihm lassen sich sowohl das Ausmaß der Gefährdungen als auch die Chancen einer Stabilisierung ablesen. Dass sich die Weimarer Republik auch unter den extremen Belastungen dieses Jahres behauptete, ist in jedem Fall ein starkes Argument gegen die Annahme, sie sei von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen.[13]
Die Exzesse der Inflationsperiode haben sich tief ins kollektive Gedächtnis der Nation eingebrannt. Die kalte Enteignung weiter Schichten der Bevölkerung – laut dem Urteil des linkssozialistischen Historikers Arthur Rosenberg «eine der größten Räubereien der Weltgeschichte»[14] – sorgte für eine ungeheure Verbitterung. Für viele Deutsche war die plötzliche Entwertung ihrer Vermögen und Ersparnisse eine traumatische Erfahrung, von der sie sich niemals ganz erholen sollten. Die Angst vor einer neuen Inflation wurde an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Sie ist in Deutschland bis heute viel virulenter als in anderen europäischen Ländern.[15] So erklärt sich auch, dass, als im Zuge der Corona-Pandemie die Preise stark anstiegen, sofort das Schreckgespenst der Hyperinflation von 1923 beschworen wurde. Man tut allerdings gut daran, die Unterschiede zwischen den heutigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen und der damaligen singulären Konstellation nicht aus den Augen zu verlieren. Die vorliegende Darstellung soll auch dafür den Blick schärfen.
Dieses Buch musste unter den erschwerenden Bedingungen der Corona-Pandemie geschrieben werden. Meine ursprüngliche Absicht, umfangreiche Archivrecherchen vorzunehmen, wurde dadurch vereitelt. Allerdings konnte ich besonders für Kapitel 5 auf Archivalien zurückgreifen, die ich im Zusammenhang mit meiner Hitler-Biographie gesammelt hatte. Wichtig war es mir wiederum, die Zeitgenossen in Tagebüchern, Briefen und Erinnerungen ausführlich zu Worte kommen zu lassen. Darin spiegeln sich, so eindrücklich wie in keiner anderen Quelle, die alltäglichen Erlebnisse und Erfahrungen der Menschen in jenem Hexenkessel der großen Inflation vor hundert Jahren.
I.
Ruhrbesetzung und Ruhrkampf
Kurz nach der Besetzung des Ruhrgebiets am 11. Januar fährt ein französischer Panzerwagen durch die Straßen von Essen.
Das Jahr 1923 begann mit einem Paukenschlag: Am 11. Januar marschierten französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet ein. Zur Begründung wurde angeführt, dass Deutschland bei den vereinbarten Sachlieferungen zum Wiederaufbau der im Ersten Weltkrieg zerstörten Gebiete in Frankreich und Belgien in Rückstand geraten war. Ganz überraschend kam die spektakuläre Aktion nicht. Bereits in den Jahren zuvor hatten die Siegermächte immer wieder mit Sanktionen gedroht für den Fall, dass die deutsche Regierung ihren Reparationsverpflichtungen nicht nachkommen würde.[1] Dabei war auch von einer Besetzung über die linksrheinischen Gebiete hinaus die Rede gewesen, die nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages für fünfzehn Jahre entmilitarisiert bleiben sollten. Nachdem am 4. Januar eine Reparationskonferenz in Paris ergebnislos auseinandergegangen war, hatte sich die Situation rasch zugespitzt. «Die politische Lage ist jetzt wieder so, dass sie sogar stumpfe Nerven bedrückt: Franzosen-Einmarsch nach gescheiterter Reparations-Conferenz bevorstehend», notierte Victor Klemperer am 5. Januar in sein Tagebuch.[2]
Seit Kriegsende hatte der Streit um die Reparationen die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen dem besiegten Reich und den Alliierten dauerhaft belastet. Bereits im Waffenstillstandsabkommen vom 11. November 1918 hatte Deutschland sich zur Abgabe von 5000 Lokomotiven, 150.000 Eisenbahnwagen und 5000 Lastkraftwagen verpflichten müssen. Im Versailler Vertrag, den die deutsche Delegation am 28. Juni 1919 im Spiegelsaal von Versailles hatte unterzeichnen müssen, wurde der Anspruch auf Wiedergutmachung begründet mit dem Artikel 231, der die alleinige Verantwortung des Kaiserreichs und seiner Verbündeten für den Kriegsausbruch festgestellt und sie für alle daraus resultierenden Verluste und Schäden haftbar gemacht hatte. Allerdings wurde die Höhe der Summe, die Deutschland aufbringen musste, noch offengehalten. Artikel 233 bestimmte die Einsetzung einer Kommission, die bis zum 1. Mai 1921 den Gesamtbetrag der Reparationen festlegen sollte. Bis dahin sollten 20 Milliarden Goldmark an Devisen und Sachwerten gezahlt werden.[3]
Die ungelöste Reparationsfrage blieb das beherrschende außenpolitische Problem der Nachkriegsära. Kompliziert wurde es dadurch, dass sich Frankreich, Belgien und auch England während des Krieges bei den Vereinigten Staaten von Amerika hoch verschuldet hatten. Solange die USA auf die vollständige Rückzahlung ihrer Kredite bestanden, musste ihren europäischen Partnern daran gelegen sein, von den Deutschen möglichst umfangreiche Reparationen zu bekommen.[4] Für die französische und belgische Regierung stellte sich diese Notwendigkeit umso dringlicher, als weite Gebiete von den deutschen Truppen bei ihren Rückzügen mutwillig zerstört worden waren – eine Tatsache, die ohne Wenn und Aber anzuerkennen sich alle deutschen Regierungen und weite Teile der deutschen Öffentlichkeit nach dem Krieg beharrlich weigerten. Als Harry Graf Kessler im August 1922 durch Nordfrankreich reiste, war er erschüttert über das Bild, das sich ihm vier Jahre nach Kriegsende immer noch bot: «Große unkultivierte Flächen, die von blühendem Unkraut überwachsen sind, und auch zwischen bestellten Feldern auffallend viele unbestellte. Zerschossene Häuser, eingestürzte Dächer, kleine Barackendörfer, neue Landhäuschen von trostloser Scheußlichkeit. St. Quentin ist nicht vollkommen zerstört, wie man gesagt hat, aber die Bahnhofstraße und viele Häuser sind noch immer, nach vier Jahren, Trümmerhaufen, und die Kathedrale thront fensterlos, unter einem Wellblechschutzdach als erhabene, weithin sichtbare Ruine über der zerschossenen Stadt. Chauny, Noyon sind im selben traurigen Zustand. Die Kathedrale von Noyon macht einen besonders erschütternden u(nd) großartigen Eindruck mit ihren beiden massigen, zerschossenen, von Gerüsten umgebenen Türmen.»[5]
Hinzu kam, dass in der französischen Regierung und Gesellschaft die Furcht vor einer deutschen Revanche allgegenwärtig war. Daraus erwuchs ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, das sich durch die Besetzung der linksrheinischen Gebiete noch nicht hinreichend befriedigt sah. Die Reparationsfrage bot in den Augen französischer Politiker und Militärs einen geeigneten Hebel, um nicht nur ein Wiedererstarken Deutschlands zu verhindern, sondern sich auch Eingriffsmöglichkeiten offenzuhalten.
Die britische Regierung unter Premierminister David Lloyd George hingegen war angesichts wachsender Schwierigkeiten mit ihrem Empire an einer Stabilisierung der Verhältnisse in Mitteleuropa interessiert. Das hieß aber auch, dass Deutschland ökonomisch nicht so weit geschwächt werden durfte, dass dadurch die wirtschaftliche Erholung des europäischen Kontinents beeinträchtigt wurde. Aus diesem Grund war man in London eher geneigt, der deutschen Regierung in der Reparationsfrage entgegenzukommen, was wiederum zu Spannungen mit dem Hauptverbündeten Frankreich führen musste. Für die britische Politik der Nachkriegszeit stellte sich so die doppelte Aufgabe, es einerseits nicht auf einen Bruch der Entente ankommen, andererseits aber auch Frankreich nicht zu mächtig werden zu lassen.[6]
In einer Serie von Konferenzen suchten sich die Alliierten auf eine gemeinsame Linie gegenüber Deutschland zu verständigen. Auf der Konferenz im belgischen Spa im Juli 1920 stand die Frage der Reparationszahlungen noch nicht auf der Tagesordnung. Vielmehr konzentrierten sich die Debatten auf die deutschen Kohlelieferungen. Am Ende gelang es Lloyd George, den Franzosen die Zustimmung zur Reduzierung der Forderung von 2,4 auf 2 Millionen Tonnen für zunächst 6 Monate abzuringen. Der Gegenwert sollte zum Inlandspreis auf das Reparationskonto gutgeschrieben werden. Es war das erste Abkommen nach dem Krieg, das nicht durch Diktat, sondern durch Verhandlungen mit den Deutschen zustande kam.[7]
Erst auf einer Konferenz des Obersten Rats der Alliierten in Paris Ende Januar 1921 verständigten sich Briten und Franzosen auf einen gemeinsamen Reparationsplan. Danach sollte Deutschland insgesamt 226 Milliarden Goldmark innerhalb von 42 Jahren zahlen, wobei die Jahresraten mit 2 Milliarden Goldmark beginnen und nach und nach auf 6 Milliarden Goldmark ansteigen sollten. Außerdem sollte jährlich ein Betrag im Wert von 12 % des deutschen Exports abgeführt werden.[8] Diese Forderung sorgte in der deutschen Öffentlichkeit für ein böses Erwachen. «42 Jahre unendliche Milliarden zu zahlen», hielt Victor Klemperer in seinem Tagebuch fest. «Es ist so Kongo-artig, so bitter, so märchenhaft – wenn man an das denkt, was wir 1914 waren –, dass ich mich bemühe, erfolgreich bemühe, möglichst gar nicht daran zu denken.»[9] Reichspräsident Friedrich Ebert vertraute einem Brief an den ehemaligen preußischen Kriegsminister Walther Reinhardt von Anfang Februar 1921 an, es habe «Toren» gegeben, die geglaubt hätten, «das Schlimmste liege schon hinter uns»: «Umso niederschmetternder wirkten auf sie die letzten Ereignisse. Die Situation ist sehr ernst. Ob sich ein Ausweg findet, ist sehr zweifelhaft.»[10]
Auf der Londoner Konferenz von Anfang März 1921 wies Reichsaußenminister Walter Simons den Pariser Zahlungsplan als unannehmbar zurück, weil er die wirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands bei weitem übersteige. Stattdessen präsentierte er einen Gegenvorschlag: Die Reichsregierung erklärte sich zu einer Zahlung von 50 Milliarden Goldmark bereit, von der allerdings noch einmal 20 Milliarden, die bereits als Sachlieferungen geleistet worden seien, abgezogen werden sollten. Dieses Angebot betrachteten wiederum die Alliierten als völlig unzureichend. Nachdem Berlin eine Frist für die Annahme des Reparationsplans hatte verstreichen lassen, machten sie ihre Sanktionsdrohung wahr und besetzten Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort. Im gesamten besetzten Gebiet übernahm die Interalliierte Rheinlandkommission die Zollverwaltung.[11]
Ende April 1921 legte die alliierte Reparationskommission ihre Reparationsrechnung vor. Sie belief sich auf 132 Milliarden Goldmark – gegenüber den ursprünglich geforderten 226 Milliarden Goldmark bedeutete das eine erhebliche Reduzierung. Dennoch löste auch dieser Vorschlag in Deutschland Empörung aus. Von einer künftige Generationen belastenden «Schuldknechtschaft» war die Rede. Am 5. Mai 1921 bestellte Lloyd George den deutschen Botschafter in London ein und überreichte ihm ein Ultimatum: Blieben die Deutschen bei ihrer Verweigerungshaltung, kündigten die Alliierten für den 12. Mai die Besetzung des Ruhrgebiets an.
Der neue Zahlungsplan teilte die deutschen Verbindlichkeiten in drei Serien von Schuldverschreibungen (Bonds): Die «A»- und «B»-Bonds in Höhe von 50 Milliarden Goldmark sollten ab 1921 getilgt und verzinst werden. Die Bedienung der «C»-Bonds, die mit 82 Milliarden den größten Teil der Reparationen ausmachten, wurde auf eine unbestimmte Zukunft verschoben. Außerdem sollten 26 % des Wertes der deutschen Ausfuhr transferiert werden. Insgesamt ergaben sich daraus jährliche Zahlungen von rund 3 Milliarden Goldmark – zweifellos immer noch eine erhebliche Belastung, die aber gar nicht so weit von dem Angebot der Reichsregierung vom März entfernt lag und bei einer normalen Wirtschaftsentwicklung wohl auch hätte verkraftet werden können.[12]
Bereits einen Tag vor Eintreffen des Londoner Ultimatums war die Regierung unter dem Zentrumspolitiker Konstantin Fehrenbach, der seit Juni 1920 einem bürgerlichen Minderheitskabinett aus Zentrum, Deutscher Demokratischer Partei (DDP) und Deutscher Volkspartei (DVP) vorgestanden hatte, zurückgetreten, nachdem der Versuch gescheitert war, die Vereinigten Staaten für eine Vermittlerrolle zu gewinnen. Reichspräsident Ebert ernannte den badischen Zentrumspolitiker Joseph Wirth, zuvor Finanzminister im Kabinett Fehrenbach, zum neuen Reichskanzler. Er bildete ein Kabinett aus Zentrum, DDP und SPD. Es handelte sich also um eine Neuauflage der Weimarer Koalition von 1919/20; allerdings besaß sie im Unterschied zu damals keine parlamentarische Mehrheit mehr. Dennoch konnte der Reichstag am 10. Mai 1921 die Annahme des Londoner Ultimatums beschließen, weil auch die USPD und einige Abgeordnete der DVP zustimmten. Die Regierung Wirth hatte ihre erste Kraftprobe bestanden.[13] «Die Annahme des Ultimatums bedeutet keine Niederlage», kommentierte der radikaldemokratische Journalist und Pazifist Carl von Ossietzky in der «Berliner Volkszeitung», «sie kann eine neue und bessere Ära eröffnen, wenn man endlich von der Politik des Sich-Treibenlassens, die seit Versailles leider vorherrschte, zu eigener Aktivität übergeht. Im vergangenen Jahr lebte man allzu gern von der faulen Hoffnung, sich schließlich doch um die eine oder andere der auferlegten Verpflichtungen drücken zu können, und die Handlung war allein auf der anderen Seite; man ließ sich stoßen und drängen, und die Faust peinlich im Rücken spürend protestierte man. Das war unwürdig, unwürdig eines großen Volkes, das immerhin genügend Köpfe aufweisen sollte, die imstande sind, die Konsequenzen eines verlorenen Krieges zu erfassen.»[14]
Eben darum war es Wirth zu tun. Er wollte seinen guten Willen demonstrieren, indem er äußerste Anstrengungen unternahm, um die Reparationsverpflichtungen zu erfüllen – dies allerdings mit dem Hintergedanken, gerade dadurch ihre Undurchführbarkeit unter Beweis zu stellen und sie in Verhandlungen mit den Alliierten auf ein für Deutschland akzeptables Maß zurückzuführen. Sein Ziel sei nicht, erklärte der Reichskanzler im Reichstag, «Erfüllungspolitik um ihrer selbst willen zu treiben, sondern der Welt durch die Erfüllung im Rahmen des Möglichen den praktischen Nachweis zu erbringen, wo die Grenze des Erfüllbaren liegt und wo sie nicht überschritten werden kann».[15]
Mit dieser Strategie verfolgten Wirth und seine Mitstreiter noch eine weitere Absicht, nämlich die noch ausstehende Entscheidung über den Status Oberschlesiens zu Deutschlands Gunsten zu beeinflussen. Obwohl sich in einer Abstimmung im März 1921 eine deutliche Mehrheit für den Verbleib bei Deutschland ausgesprochen hatte, beschloss der Oberste Rat der Alliierten am 20. Oktober 1921, der Empfehlung des Völkerbunds zu folgen und Oberschlesien zu teilen. Rund 25 % des Gebiets mit fast dem gesamten Industrierevier fielen an Polen. Aus Enttäuschung über diese Entscheidung erklärte Wirth am 22. Oktober seinen Rücktritt, wurde aber von Ebert erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Die parlamentarische Basis seines zweiten Kabinetts war noch schmaler als die erste, weil sich die DDP diesmal verweigerte.[16]
Ein weiterer Umstand stellte Wirths «Erfüllungspolitik» vor scheinbar unüberwindliche Probleme: der rapide Kursverfall der Mark (auf dessen Ursachen im folgenden Kapitel eingegangen wird). Die Flucht ausländischen Kapitals setzte sich fort; Devisenüberschüsse für den Reparationstransfer zu erwirtschaften, erwies sich als immer schwieriger. Nur mit Mühe gelang es der deutschen Regierung, die erste Rate von 1 Milliarde Goldmark pünktlich zum 31. August 1921 zu überweisen. Aber es war absehbar, dass sich für die im Januar und Februar 1922 fälligen Raten die notwendigen Mittel nur schwer würden auftreiben lassen.[17]
Der Plan, eine große Anleihe auf den internationalen Devisenmärkten aufzunehmen, scheiterte angesichts des schwindenden Vertrauens in die deutsche Zahlungsfähigkeit. Und auch der Versuch, durch einen von der deutschen Industrie im Ausland aufzunehmenden Kredit zu einer gemeinsamen Lösung des Reparationsproblems beizutragen, schlug fehl, weil die der DVP nahestehende Schwerindustrie, allen voran Hugo Stinnes, eine solche Aktion mit unannehmbaren Forderungen, unter anderem die Privatisierung der Reichsbahn, verband. Im Dezember 1921 musste die Regierung Wirth um einen Zahlungsaufschub bitten.[18]
Auf einer Tagung des Obersten Alliierten Rates in Cannes im Januar 1922 wurde den Deutschen ein vorläufiges Moratorium für die Januar- und Februarrate in Aussicht gestellt unter der Auflage, einen Plan zur Sanierung des Staatshaushalts vorzulegen. Dem kam die deutsche Regierung nach. Doch die Antwortnote der Reparationskommission vom 21. März 1922 war wiederum eine Enttäuschung. Zwar wurde ein partieller Zahlungsaufschub für das Jahr 1922 gewährt – Deutschland sollte nur 720 Millionen Goldmark in bar und zusätzliche Sachlieferungen entrichten –, doch wurde das Zugeständnis mit weitreichenden Bedingungen verknüpft, unter anderem durchgreifende Maßnahmen gegen die Kapitalflucht, eine von der Reichsregierung unabhängige Stellung der Reichsbank und eine Kontrolle des Haushalts durch die Kommission. Diese Forderungen wies die deutsche Regierung in ihrer Antwortnote vom 7. April zurück.[19]
Seit Jahresbeginn 1922 hatten sich die Aussichten auf ein einvernehmliches Reparationsabkommen weiter verschlechtert. Noch während der Konferenz in Cannes war der französische Ministerpräsident Aristide Briand zurückgetreten. In der nationalistisch erregten französischen Öffentlichkeit war ihm eine allzu nachgiebige Haltung gegen Deutschland vorgeworfen worden. Sein Nachfolger wurde Raymond Poincaré, der eine kompromisslose Linie in der Reparationsfrage vertrat. Poincaré hatte als Zehnjähriger 1870 den Einmarsch preußischer Truppen in seine Heimatstadt Bar-le-Duc im Département Meuse erlebt – eine Erfahrung, die seine Einstellung zu den Deutschen prägen sollte. Nach einer brillanten Karriere als Anwalt hatte er sich der Politik zugewandt und in mehreren Kabinetten der Dritten Republik den Posten eines Unterrichts- und Finanzministers bekleidet. Als Ministerpräsident und Außenminister hatte er vor 1914 eine wichtige Rolle bei der Festigung des Bündnisses zwischen Frankreich und dem Zarenreich gespielt. Im Januar 1913 zum Präsidenten der Republik gewählt, war er in der Julikrise 1914 nach St. Petersburg gereist und hatte der russischen Regierung im Konflikt mit Österreich-Ungarn und dem deutschen Kaiserreich den Rücken gestärkt. Während des Krieges war er von seinem Gegenspieler, Ministerpräsident Georges Clemenceau, an den Rand gedrängt worden. Dennoch war er es, der am 18. Januar 1919 die Friedenskonferenz in Paris mit einer großen Rede eröffnen durfte, in der er Deutschlands Kriegsschuld brandmarkte, die besonderen Opfer Frankreichs herausstrich und daraus das Recht auf umfassende Wiedergutmachung ableitete.[20]
Poincaré bestand auf einer buchstabengetreuen Erfüllung des Versailler Vertrages und der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen. Er war der Auffassung, dass die deutsche Regierung die Währung bewusst verfallen ließ, um sich vor ihren Reparationsverpflichtungen zu drücken. Angesichts der vermeintlichen deutschen Zahlungsunwilligkeit entwickelte er die Idee der «produktiven Pfänder», das heißt, ein Zahlungsaufschub kam für ihn überhaupt nur in Frage, wenn Frankreich dafür umfassende Sicherheiten und Garantien erhielt. Dabei dachte er in erster Linie an einen Zugriff auf die Kohlevorkommen des Ruhrgebiets. Letztlich zielte der Plan darauf ab, den potenziell gefährlichen Nachbarn im Osten in seiner Wirtschaftskraft nachhaltig zu schwächen, um dadurch die Machtverhältnisse auf dem Kontinent dauerhaft zugunsten Frankreichs zu wenden.[21] Die Frage war allerdings, wie man jemals hohe Reparationszahlungen erzwingen wollte, wenn gleichzeitig die ökonomischen Möglichkeiten Deutschlands, sie zu leisten, radikal beschnitten wurden.
So stand denn auch die Konferenz in Genua, die auf Wunsch der britischen Regierung im April 1922 einberufen wurde, von vornherein unter einem ungünstigen Stern. An ihr nahmen die deutschen Delegierten – an ihrer Spitze Reichskanzler Wirth und der Industrielle Walther Rathenau, seit dem 31. Januar 1922 deutscher Außenminister – erstmals als gleichberechtigte Partner teil. In der Reparationsfrage wurden keine entscheidenden Fortschritte erzielt, weil Poincaré die französische Delegation unter Louis Barthou auf eine unnachgiebige Haltung festgelegt hatte. Das wichtigste Ereignis war nicht die Konferenz selbst, sondern das, was sich an ihrem Rand abspielte: Am 16. April unterzeichneten Rathenau und der russische Volkskommissar des Äußeren, Georgi W. Tschitscherin, im nahebei gelegenen Badeort Rapallo einen Vertrag. In ihm verzichteten die einstigen Kriegsgegner gegenseitig auf Reparationen und vereinbarten die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen sowie eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit.[22]
Unter den Westmächten löste der überraschende Vertragsabschluss erhebliche Irritationen aus. Der britische Premier Lloyd George, der mit großen Hoffnungen nach Genua gereist war, fühlte sich düpiert, und die französische Regierung sah sich in ihrem grundsätzlichen Misstrauen gegen Deutschland bestätigt. In einer Rede in Bar-le-Duc am 24. April bezeichnete Poincaré den Rapallo-Vertrag als einen feindseligen Akt und schloss die Möglichkeit einer militärischen Intervention Frankreichs nicht aus, sollte Deutschland weiterhin seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Auf ein substanzielles Entgegenkommen in der Reparationsfrage konnte die Regierung Wirth kaum noch hoffen. Harry Graf Kessler, der als Beobachter an der Konferenz teilnahm, stellte enttäuscht fest, dass die für Rapallo Verantwortlichen «die kostbare u(nd) mühsam wieder zusammengeleimte Vase des europäischen Vertrauens fallen lassen und von Neuem zerschmissen» hätten.[23] Eben diese Wirkung hatte Reichspräsident Ebert befürchtet. Er war von Wirth über den bevorstehenden Vertrag mit Sowjetrussland nicht unterrichtet worden und erfuhr vom Abschluss erst aus der Presse. Das vergaß er dem Reichskanzler nicht. Seit Rapallo war ihr Verhältnis zerrüttet.[24]
Unterdessen hatte die radikale Rechte in Deutschland eine wüste Kampagne gegen die «Erfüllungspolitiker» entfesselt. Zielscheibe war wegen seiner jüdischen Herkunft besonders Außenminister Rathenau. Seit Frühjahr 1922 steigerte sich die Hetze zur offenen Morddrohung. «Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverdammte Judensau», lautete die Schlusszeile eines an völkisch-antisemitischen Stammtischen gern angestimmten Liedes.[25] Rathenau wusste um die Gefährdung. Die Belastung durch das Amt sei an sich schon auf die Dauer physisch kaum auszuhalten, klagte er in einem Gespräch mit Harry Graf Kessler. «Aber das Schlimmste sei doch die bösartige Gegnerschaft in Deutschland selbst. Jeden Tag bekomme er nicht bloß Drohbriefe, sondern auch ernstzunehmende Polizei-Anzeigen.»[26] Dennoch verzichtete Rathenau auf besondere Schutzmaßnahmen. Am 24. Juni 1922 wurde er auf dem Weg ins Auswärtige Amt von Mitgliedern der «Organisation Consul» ermordet – eines Geheimbunds, der auch schon für den Mord an dem Zentrumspolitiker und ehemaligen Finanzminister Matthias Erzberger am 26. August 1921 und das Blausäureattentat auf den ersten Ministerpräsidenten der Republik und Kasseler Oberbürgermeister, den SPD-Politiker Philipp Scheidemann, am 4. Juni 1922 verantwortlich war. «Mit grenzenloser Niedrigkeit, mit unergründlicher Gemeinheit ist Rathenau in den deutschnationalen und deutschvölkischen Versammlungen und in den meisten Blättern dieser Richtungen verleumdet und beschmutzt worden», schrieb der Chefredakteur des liberalen «Berliner Tageblatts», Theodor Wolff, in einem Leitartikel, «und diese geistige Vorbereitung hat die Tat möglich, hat sie unvermeidlich gemacht.»[27]
Außenminister Walther Rathenau auf dem Weg in den Reichstag. Am 24. Juni 1922 wurde der wegen seiner jüdischen Herkunft besonders verhasste Industrielle von Mitgliedern der rechtsradikalen «Organisation Consul» ermordet.
Die unmittelbare Folge der Ermordung Rathenaus war ein beschleunigter Verfall der Mark. Die Reichsregierung war nicht mehr in der Lage, die im Moratorium vereinbarten Beträge zu zahlen und sah sich gezwungen, in zwei Noten vom 12. und 14. Juli 1922 um eine Befreiung von allen Zahlungen – die Sachleistungen ausgenommen – bis Ende 1924 zu bitten. Damit war Wirths «Erfüllungspolitik» an ein Ende gelangt. Poincaré glaubte seinem Ziel, «produktive Pfänder» einzufordern, näher gekommen zu sein. Zwar gewährten die Alliierten Ende August 1922 noch einmal einen Zahlungsaufschub von sechs Monaten, gleichzeitig aber erhöhte die französische Regierung ihren Druck auf Deutschland, eine Reform der öffentlichen Finanzen in Angriff zu nehmen, wobei die Drohung mit einer Besetzung des Ruhrgebiets im Hintergrund mitschwang.[28] Für einen nüchternen Beobachter wie den britischen Botschafter in Berlin, Edgar Vincent D’Abernon, stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass Deutschland aufgrund seiner desaströsen Finanzlage Reparationen zu zahlen nicht mehr in der Lage war. Ehe nicht die Notenpresse zum Stillstand gebracht und die Währung stabilisiert worden sei, gebe es «keine feste Basis für irgendwelche Zahlungsversprechungen». In einer Unterredung mit Reichskanzler Wirth Ende August 1922 eröffnete ihm dieser, es sei zweifelhaft, ob Deutschland angesichts des «katastrophalen Sturzes der Mark» die Bevölkerung im kommenden Winter überhaupt noch mit genügend Lebensmitteln versorgen könne. «Brot komme vor Reparationen – er habe es bereits gesagt und halte daran fest.» Es müsse «ein vollkommenes Moratorium oder eine Atempause eingeräumt werden».[29]
In einer Note an die Reparationskonferenz vom 14. November 1922 bat die Regierung Wirth um ein Moratorium für alle Barzahlungen und Sachleistungen für drei bis vier Jahre sowie um eine Rückführung der im Londoner Ultimatum festgelegten Gesamtschuld auf ein für die deutsche Leistungsfähigkeit tragbares Maß. Als Sofortmaßnahme wurde eine großangelegte Stützungsaktion der Reichsbank angekündigt, um die Währung zu stabilisieren und den Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen.[30]
Diese Note war die letzte Amtshandlung Wirths. Noch am selben Tag trat er zurück, nachdem sein Versuch fehlgeschlagen war, die parlamentarische Basis seiner Regierung zu verbreitern. Im September 1922 hatte sich die SPD mit dem Rest der USPD zusammengeschlossen. (Die Mehrheit der USPD war nach der Spaltung der Partei im Oktober 1920 der Kommunistischen Partei beigetreten.) Das Ergebnis war ein entschiedener Ruck nach links. Für eine Zusammenarbeit mit der DVP, die unter Führung ihres Vorsitzenden Gustav Stresemann vor allem großindustrielle Interessen vertrat, war die «Vereinigte Sozialdemokratische Partei» vorerst nicht zu haben. Wirth aber hatte sein politisches Schicksal an die Bildung einer Großen Koalition gebunden, und Reichspräsident Ebert, bei dem der Stachel der Enttäuschung über die Rapallo-Politik tief saß, tat nichts, um den Reichskanzler zu halten.[31]
Zum Nachfolger Wirths ernannte Ebert am 22. November einen Mann der Wirtschaft, den Generaldirektor der Hamburger Großreederei Hapag Wilhelm Cuno. Der 1876 im thüringischen Suhl geborene promovierte Jurist hatte im Weltkrieg die Reichsgetreidestelle geleitet und war Ende 1917 als Geheimer Oberregierungsrat aus dem Staatsdienst ausgeschieden, um einem Ruf des mächtigen Reeders Albert Ballin ins Direktorium der Hapag zu folgen. Nach dem Selbstmord Ballins Anfang November 1918 übernahm er die Leitung des Unternehmens und erwarb sich einige Meriten beim Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte. Der erfolgreiche Manager gehörte keiner Partei an, stand aber der DVP nahe. Politisch war Cuno kein unbeschriebenes Blatt – er tauchte nicht «plötzlich wie Lohengrin mitten im politischen Betrieb auf», wie Botschafter D’Abernon meinte.[32] Mehrfach war er bereits als Minister gehandelt worden, und er hatte als Sachverständiger an der Konferenz von Genua teilgenommen. Damals hatte Rathenau, die Ambitionen des Wirtschaftsführers richtig einschätzend, sarkastisch bemerkt, Cuno sei «eine dicke Zigarre; man werde sie wegen ihrer schönen Bauchbinde doch einmal rauchen müssen».[33]
«Cuno baumlang, jünglinghaft, fast feminin, scheint ganz aus Grazie zu bestehen; blond bis zur Farblosigkeit», so charakterisierte ihn Harry Graf Kessler.[34] Seine Berufung zum Reichskanzler verdankte Cuno vor allem der Wertschätzung Eberts. Der Generaldirektor verfügte über gute Geschäftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Von seinem Verhandlungsgeschick und seinem gewandten Auftreten versprach sich der Reichspräsident Fortschritte bei der Lösung der Reparationsfrage. Außerdem erschien ihm der parteilich nicht gebundene Wirtschaftsexperte besonders geeignet, innenpolitisch als ein Mann des Ausgleichs zu wirken und die der Republik reserviert bis feindlich gegenüberstehende deutsche Unternehmerschaft mit der neuen demokratischen Ordnung zu versöhnen.[35]
Auch Cuno scheiterte bei dem Versuch, eine Große Koalition unter Einschluss der DVP und der wiedervereinigten Sozialdemokratie zustande zu bringen. So bildete er, ein Novum in der jungen Geschichte der Republik, ein sogenanntes «Geschäftsministerium», dem außer ihm selbst vier parteilose Fachminister angehörten: der bisherige Gesandte in Kopenhagen Frederic von Rosenberg als Außenminister; der Oberbürgermeister von Essen Hans Luther als Ernährungs- und Landwirtschaftsminister; der frühere Generalquartiermeister Wilhelm Groener als Verkehrsminister – ein Amt, das er auch schon unter Fehrenbach und Wirth bekleidet hatte; der ehemalige Staatssekretär in der Reichskanzlei Heinrich Albert als Schatzminister. Die übrigen Ressorts verteilten sich auf die bürgerlichen Parteien. Der DVP gehörten Johann Becker als Wirtschaftsminister und Rudolf Heinze als Justizminister an. Das Zentrum stellte mit Andreas Hermes den Finanzminister und mit Heinrich Brauns den Arbeitsminister. Die DDP war mit dem bisherigen Wehrminister Otto Geßler und Innenminister Rudolf Oeser vertreten. Postminister wurde Karl Stingl von der Bayerischen Volkspartei (BVP). Das wichtige Amt des Staatssekretärs in der Reichskanzlei übertrug Cuno dem DDP-Politiker Eduard Hamm. Insgesamt handelte es sich bei diesem «Kabinett der Persönlichkeiten» um eine bürgerliche Minderheitsregierung, die ohne förmliche Koalitionsvereinbarung zustande gekommen war und auf Unterstützung oder zumindest Duldung der SPD oder der rechtskonservativen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) angewiesen war.[36]
In seiner Regierungserklärung vom 24. November 1922 stellte sich Cuno «ohne Einschränkung» auf den Boden der deutschen Note vom 14. November und richtete an die Reparationskommission die Bitte, dem darin enthaltenen Antrag auf einen drei- bis vierjährigen Zahlungsaufschub im Hinblick auf die schlechte wirtschaftliche und finanzielle Lage Deutschlands möglichst rasch stattzugeben.[37] Die Reaktion aus Paris kam prompt: Am 27. November ließ die französische Regierung über die Presse eine Erklärung verbreiten, in der sie die deutsche Bitte mit aller Schärfe zurückwies und nun offen die Besetzung von Zweidritteln des Ruhrgebiets, einschließlich Essens und Bochums, androhte.[38]
Im Grunde war die Entscheidung bereits gefallen. Poincaré und seine Ratgeber waren überzeugt, dass die Regierung Cuno – wie ihre Vorgänger – auf Zeit spielte und ebenso wenig gewillt war, die Reparationslasten zu tragen. Am 27. November beschloss der Ministerrat unter der Leitung des Präsidenten der Republik, Alexandre Millerand, die Besetzung des Ruhrgebiets.[39] Der neue britische Premierminister Andrew Bonar Law, der Ende Oktober 1922 Lloyd George abgelöst hatte, ließ bei einem Treffen mit Poincaré unmissverständlich durchblicken, dass er eine Ruhrbesetzung für verfehlt hielt, doch war er ebenso wenig wie sein Vorgänger bereit, der französischen Politik in den Arm zu fallen. In einem Gespräch mit Botschafter D’Abernon äußerte er am 15. Dezember die Hoffnung, nur ein «energisches Vorgehen» der Vereinigten Staaten könne Poincaré von seinem Vorhaben abbringen.[40]
Tatsächlich meldete sich am Ende des Jahres 1922 der amerikanische Außenminister Charles Hughes zu Wort: In einer Rede vor der amerikanischen Historikergesellschaft in New Haven erteilte er der französischen Sanktionspolitik eine Absage und regte die Einberufung einer unparteiischen internationalen Sachverständigenkommission an, welche die deutsche Leistungsfähigkeit überprüfen und danach die Reparationssumme bestimmen sollte. Doch auch diese Initiative stieß in Paris auf taube Ohren.[41] Die Eskalation nahm ihren Lauf. Man trete «jetzt in die schwierigste Periode der Reparationsfrage ein», ließ der deutsche Botschafter in Paris, Wilhelm Mayer, Harry Graf Kessler am 2. Januar 1923 wissen: «Frankreich könne die ungeheure Enttäuschung über die Reparationen nicht ohne Explosion hinnehmen.»[42]
Poincaré benötigte nur noch einen Vorwand für die geplante Ruhrinvasion. Den lieferte die Reparationskommission: Nachdem sie bereits am 26. Dezember, gegen die Stimme des britischen Vertreters John Bradbury, Versäumnisse bei der Lieferung von Schnittholz und Telegrafenstangen festgestellt hatte, folgte am 9. Januar 1923, wiederum gegen das Votum Bradburys, eine Verurteilung Deutschlands wegen zu geringer Kohlelieferungen. Zwei Tage später begann die Besetzung.[43]
Laut offizieller Begründung, die Poincaré am 10. Januar dem deutschen Botschafter überreichte, handelte es sich bei dem Einmarsch nicht um eine militärische Operation. Vielmehr sollten die entsandten Truppen lediglich den Schutz einer Kommission aus französischen und belgischen Ingenieuren übernehmen. Dieser «Mission interallié de controle des usines et de mines» (Interalliierte Kommission zur Kontrolle der Fabriken und Kohlegruben – MICUM) sei die Aufgabe zugedacht, «die strikte Ausführung der auf die Reparationen bezüglichen Bestimmungen des Vertrages von Versailles sicherzustellen».[44] In Wirklichkeit trug die Invasion durchaus einen kriegerischen Charakter. Der Sonderkorrespondent des «Berliner Tageblatts» berichtete am Nachmittag des 11. Januar aus Essen: «Gegen 2 Uhr erfolgte der Einmarsch der Franzosen in die Stadt. Voran einige Radfahrer, ihnen folgend Infanterie und anschließend einige tausend Mann Kavallerie im Trab. Langsam ratterten drei schwere Panzerautos durch die Straßen, ihnen folgte Infanterie und Artillerie, auch Maschinengewehre sah man. Den Schluss bildeten mehrere Lastautos mit Mannschaften. Sämtliche öffentliche Gebäude und der Bahnhof wurden ebenso wie sämtliche Straßenkreuzungen durch Posten mit aufgepflanztem Bajonett besetzt.»[45]
Noch am selben Tag verhängte der Befehlshaber der französischen Besatzungstruppen, General Jean-Marie Joseph Degoutte, den Belagerungszustand.[46] Innerhalb weniger Tage besetzte das Militär auch Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen, Hattingen, Dortmund und weitere Orte zwischen der Ruhr im Süden und der Lippe im Norden. Bis März 1923 wurden zwischen 70.000 und 100.000 Besatzungstruppen stationiert. Das relativ kleine belgische Kontingent von 8000 Mann unterstand dem Oberkommando Degouttes.[47]
In der deutschen Öffentlichkeit schlugen die Wogen der Erregung hoch. «Der Rubikon ist überschritten», empörte sich die «Vossische Zeitung». Die Note, mit der das Vorgehen gerechtfertigt werde, verrate «deutlich die Unsicherheit einer Politik, die nicht vorwärts und nicht zurück kann». Poincaré mache «den Eindruck eines Mannes, der weiß, dass er und sein Land in die größte Dummheit hineinschliddert».[48] Ähnlich lautete der Kommentar des «Berliner Tageblatts»: Franzosen und Belgier hätten die Sprache der Diplomatie um eine neue Formel bereichert – «die militärische Besetzung in friedlicher Absicht». Mit einem Schlage zerreiße der Einmarsch «wie Spinnenweben alle juristischen Verkleidungen, durch die der Advokat an der Spitze Frankreichs den brutalen Gewaltakt zu verschleiern sucht».[49] Durch den Überfall sei «eine gänzlich veränderte politische Situation für Deutschland und Europa geschaffen» worden, konstatierte die «Deutsche Allgemeine Zeitung», das publizistische Sprachrohr des Ruhrindustriellen Hugo Stinnes, unter der Schlagzeile «Landgraf werde hart!». Nun gelte es, «die Nerven zusammenzureißen und ungebeugt zu Volk und Vaterland zu stehen». Die ganze Nation müsse sich vereinigen in der «heiligen Überzeugung, dass die gute Sache siegen wird».[50]
Tatsächlich löste die Okkupation des Ruhrgebiets zunächst eine starke Welle nationaler Solidarität aus. Manche Beobachter fühlten sich an den August 1914 erinnert, als zwischen den sich bislang heftig befehdenden Interessengruppen ein «Burgfrieden» geschlossen worden war. «Die Franzosen haben durch die Ruhrbesetzung (…) mehr für den Zusammenschluss aller Parteien und Klassen getan, als es sich durch andere Mittel hätte bewerkstelligen lassen», bemerkte der britische Botschafter D’Abernon. «Im Augenblick ist jeder Klassenhass der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber durch die patriotische Welle hinweggeschwemmt worden. Das ganze Land scheint zu einer Einheit verschmolzen.»[51]
Charakteristisch für die antifranzösischen Emotionen, die in diesen Tagen hochkochten, war eine Rede, die der Historiker und Kriegsfreiwillige von 1914, Gerhard Ritter – damals Privatdozent in Heidelberg – anlässlich der Reichsgründungsfeier am 20. Januar 1923 hielt. Eigentlich, so begann er, sei ja niemandem zum Feiern zumute, um dann fortzufahren: «Nicht feiern – handeln möchten wir dürfen – den Säbel und das alte Kriegspistol von der Wand reißen, den Stahlhelm aufstülpen und das feige Diebesgesindel herauswerfen, das sich in unserem Hause herumtreibt.»[52]
In der bayerischen Festung Niederschönenfeld, wo er seit Oktober 1920 einsaß, notierte der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam, der wegen Beteiligung an der Münchener Räterepublik zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt worden war: «Ganz Deutschland treibt schon wieder im Strom nationalistischer Wallungen.»[53] Doch so einmütig war die Stimmung nicht. Es gab auch Zeitgenossen, die direkt abgestoßen waren vom hemmungslosen Chauvinismus, der an den antifranzösischen Furor aus den Zeiten der «Befreiungskriege» 1813 und der «Rheinkrise» von 1840 anknüpfte. «Die französische Besetzung des Ruhrgebiets macht, dass das patriotische Deutschland, wo es nur geht, seinen Hass austobt», beobachtete Thea Sternheim, die Frau des Dramatikers Carl Sternheim, bei einem Kinobesuch in Dresden. «In einem Film, der den Rhein in Vergangenheit und Gegenwart zeigt, werden unter donnerndem Applaus aufputschende und sentimentale Gesangseinlagen gebracht, eine Nymphe spricht zur Jugend gewendet den Prolog der Rache. Erscheint Blücher auf der Leinwand, rast der Saal vollends.»[54] Angewidert konstatierte auch der Dichter Rainer Maria Rilke, der seit Juli 1921 in einem Chateau im schweizerischen Wallis lebte, dass viele deutsche Zeitungen «sofort wieder in den Ton der Kriegsjahre verfallen» seien: «Ihr Papier verursacht schon ein hetzerisches Geräusch, wenn man’s aufblättert.»[55]
Hin- und hergerissen zeigte sich Victor Klemperer. Als national empfindender deutscher Jude lehnte er das Ruhrabenteuer Poincarés ab; als Professor für Romanistik, der mit der französischen Sprache und Kultur eng verbunden war, betrachtete er das «Aufzüngeln der Revanchestimmung» mit gemischten Gefühlen: «Ich kann mir nicht vorstellen, wann u(nd) wie wir den Befreiungskrieg führen sollen (…) – die Ruhrsache u(nd) die ganze jetzige Lage ist zu grässlich.»[56]
Ähnlich empfand es der in München lebende Schriftsteller Thomas Mann. Die Franzosen schienen «es sich in den Kopf gesetzt zu haben, jedem das Konzept zu verderben, der in Deutschland zum Guten redet», schrieb er an seinen Bruder, den Schriftsteller Heinrich Mann, Mitte Februar 1923. Der «Ingrimm» über ihr Vorgehen sei «fürchterlich – tiefer und einheitlicher, als der, der Napoleon zu Fall brachte». Man sehe nicht, wo das enden solle, und «das Schlimmste» sei, «dass ein französisches Fiasko, so sehr es zu begrüßen wäre, innenpolitisch den Triumph des Nationalismus bedeuten würde».[57]
Auch Heinrich Mann sagte in einem Brief an den französischen Germanisten Félix Bertaux «eine scharfe Radikalisierung der inneren Politik» voraus. Allerdings schien ihm der hochschäumende Nationalismus nicht mehr «die Furchtbarkeit von 1914» zu besitzen. Er wirke «unsicher, überanstrengt, bedauernswert». So müsse man sich in Geduld fassen, «bis das Unheil sich abgenützt» habe. Weiterhin bleibe der Gedanke einer Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland eine «unbedingte Lebensnotwendigkeit».[58]
Was die Franzosen mit ihrem Vorgehen bewirkten, sei «eine Vergiftung Europas für hundert Jahre», beklagte «Das Tage-Buch», die von den linksliberalen Publizisten Stefan Großmann und Leopold Schwarzschild herausgegebene Berliner Wochenschrift.[59] Und auch die ebenfalls in Berlin erscheinende «Weltbühne», das Organ der kritischen Linksintellektuellen, fand scharfe Worte der Verurteilung: «Vier Jahre nach einem – immerhin – nach einem Friedensschluss rücken fremde Soldaten, feldmarschmäßig, mit Artillerie und allen Mitteln des modernen Krieges ins Land (…) und spielen, wenn schon nicht Krieg, so doch Etappe. Das ist und bleibt eine Ungeheuerlichkeit.» Doch zugleich fragte die Zeitschrift, ob die deutsche Regierung durch ihre Verweigerungshaltung nicht zu dem Desaster beigetragen habe: «War wirklich nötig, bei allen Lieferungen zu protestieren und abzuhandeln und im Rückstand zu bleiben? (…) War die Methode des ständigen Querulierens (…) wirklich die richtige?»[60]
Der französische Schritt scheine ihm «höchst verfehlt», rief Außenminister Frederic von Rosenberg dem britischen Botschafter D’Abernon zu. Aber er sei «soweit ganz ruhig, da jetzt nicht nur das Schicksal Deutschlands, sondern ganz Europas – ja, der ganzen Welt auf dem Spiele steht».[61] Tatsächlich wurde die Cuno-Regierung durch die Ruhrbesetzung weitgehend unvorbereitet getroffen, obwohl es Poincaré an Drohungen nicht hatte fehlen lassen. Erst am Abend des 9. Januar 1923, unter dem Eindruck des unmittelbar bevorstehenden Einmarsches, berief Ebert die Mitglieder des Kabinetts zu einer Besprechung in seinen Amtssitz in der Wilhelmstraße. Es komme nun darauf an, «mit Klarheit, festem Willen, ruhiger Einsicht und völliger Einigkeit den kommenden Ereignissen entgegenzusehen». In diesem Sinne hatte der Reichspräsident bereits am Nachmittag einen Aufruf an die Ruhrbevölkerung gerichtet, den er nun den Ministern zur Kenntnis gab. Der Reichskanzler kündigte als erste Gegenmaßnahme die Abberufung des deutschen Botschafters in Paris, Wilhelm Mayer, an. Allerdings sollten die Beziehungen zu Frankreich nicht abgebrochen, sondern die Geschäfte durch Botschaftsrat Leopold von Hoesch weitergeführt werden. Wie Ebert war auch Cuno davon überzeugt, dass, sollten die Franzosen ihre Drohung wahrmachen, es zu einer «starken nationalen Welle» kommen würde. Diese müsse «dem Staate dienstbar» gemacht werden.[62]
Was das hieß, ließ bereits die gemeinsame Proklamation des Reichspräsidenten und der Reichsregierung «An das deutsche Volk!» vom 11. Januar erahnen. In markigen Worten geißelte sie den «neuen Gewaltstreich» als eine «Tat der Verblendung», die sich gegen «den unbeschützten Lebenspunkt der deutschen Wirtschaft» richte. Vom passiven Widerstand, der die Politik der Regierung in den folgenden Wochen und Monaten bestimmen sollte, war noch nicht ausdrücklich die Rede; allerdings wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in «eiserner Selbstbeherrschung» zu üben und alles zu unterlassen, was der «gerechten Sache» schaden könne.[63] Deutlicher wurde die deutsche Regierung in ihrer Protestnote vom 12. Januar. Darin bezeichnete sie den Einmarsch als «denkbar schwerste Verletzung der deutschen Hoheitsrechte». Gegen den völkerrechtlich nicht legitimierten Gewaltakt könne Deutschland sich nicht gewaltsam zur Wehr setzen. Andererseits sei man aber auch nicht gewillt, sich dem Rechtsbruch zu fügen und womöglich sogar bei der Durchführung der französischen Absichten mitzuwirken. Solange der vertragswidrige Zustand anhalte, sehe sich die Regierung außerstande, weiterhin irgendwelche Reparationsleistungen zu erbringen.[64]
Am 13. Januar trat der Reichstag zu einer Sondersitzung zusammen. Vor dem Parlamentsgebäude wehten die Flaggen auf halbmast. Zahlreiche Abgeordnete trugen Trauer. Auf der Regierungsbank hatten sämtliche Minister und Staatssekretäre Platz genommen. Die Zuschauertribünen waren bis auf den letzten Platz besetzt. Nach dem Reichstagspräsidenten, dem Sozialdemokraten Paul Löbe, ergriff Cuno das Wort: Es handle sich bei der französischen Aggression, erklärte er, nicht um die Eintreibung von Reparationen, sondern um die Verwirklichung eines «alten Ziels», das die französische Politik seit den Tagen Ludwigs XIV. und Napoleons verfolgt und das auch noch den Beschlüssen von Versailles zugrunde gelegen habe: nämlich Frankreichs Macht auf Kosten Deutschlands auszudehnen. Dieser Politik müsse man mit Entschiedenheit, aber auch Besonnenheit entgegentreten. «Dazu lassen Sie uns alle Kraft der Herzen und der Hände unserem Volk und Vaterland zuwenden, allen müßigen Streit begraben (…).»[65] Die Rede fand, obwohl in geschäftsmäßig-kühlem Ton vom Blatt abgelesen, stürmische Zustimmung. Eine vom Zentrum eingebrachte Resolution, die der Regierung die volle Unterstützung des Hauses zusicherte, wurde mit 283 gegen 12 Stimmen der KPD und 6 Enthaltungen der SPD angenommen. Allerdings war das Bild einer fast geschlossenen Einheitsfront auch hier trügerisch. Denn immerhin hatten 49 Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion, überwiegend wohl ehemalige USPD-Vertreter, ihre Ablehnung dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie der Abstimmung fernblieben.[66]
Für Sonntag, den 14. Januar, hatte die Regierung zu Protestkundgebungen im ganzen Land aufgerufen. «Wie sich der Reichstag hinter die Regierung gestellt hatte, so bekräftigten die Massen wiederum die Haltung des Parlaments», schrieb die «Vossische Zeitung». «Seit langem sind nicht so viele Hochrufe auf eine deutsche Regierung ausgebracht und zustimmend aufgenommen worden wie gestern. (…) Wenn etwas an den Erlebnissen dieser Tage tröstlich ist, so ist es dieser Zusammenschluss, der durch Druck von außen doch noch einmal zustande gekommen ist, trotz aller deprimierenden und zersplitternden Erlebnisse der letzten Jahre.»[67] Allein auf dem Königsplatz in Berlin drängten sich Hunderttausende. «Wer diese geschlossene Masse entblößten Hauptes vor den Stufen des Reichstags, rings um das Bismarckdenkmal und die Siegessäule, stehen und schwören und beten sah, der vergisst es nie», wusste der euphorisierte Reporter der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» zu berichten. Vor dem Brandenburger Tor hatte eine starke Abteilung Schutzpolizei Stellung bezogen, um die am Pariser Platz gelegene französische Botschaft vor Übergriffen aufgebrachter Demonstranten zu schützen.[68]
Ein passiver Widerstand gegen die Ruhrbesetzung war nur möglich, wenn sich die Gewerkschaften zur Kooperation bereitfanden. Denn ohne die Unterstützung der Arbeitnehmerorganisationen ließ sich eine wirkungsvolle Abwehr im besetzten Gebiet nicht organisieren. Am 8. Januar 1923 hatten Reichspräsident Ebert und nach ihm auch Reichskanzler Cuno Spitzenleute des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) zu sich gebeten, um zu erkunden, welche Gegenmaßnahmen die Gewerkschaften im Falle eines Einmarsches planten. Einen Generalstreik zu proklamieren, lehnten die Gewerkschaftsvertreter als «unzweckmäßig» ab, weil er «unter Umständen den Franzosen willkommen sein könnte»: «Zweifellos würde durch den Einmarsch ein wirtschaftliches Durcheinander entstehen, und die Franzosen würden selbstverständlich, wenn zur gleichen Zeit die Arbeiterschaft in den Streik trete, die Schuld daran auf die Arbeiterschaft abwälzen.» Andererseits war man sich einig, dass man die Besetzung des Ruhrgebiets nicht unbeantwortet lassen dürfe. Unter anderem wurde der Gedanke eines kurzfristigen Demonstrationsstreiks erörtert, ein konkreter Beschluss aber noch nicht gefasst.[69]
In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten ADGB, der Allgemeine Freie Angestelltenbund (Afa-Bund) und der Allgemeine Deutsche Beamtenbund am 11. Januar den Ruhreinmarsch als «Ausdruck schlimmster imperialistischer Gewaltpolitik, die von den organisierten deutschen Arbeitnehmern stets bekämpft worden» sei. Arbeiter, Angestellte und Beamte wurden aufgefordert, «alles Trennende in ihren Reihen zurückzustellen und den ihnen aufgezwungenen Kampf gegen den unersättlichen und kriegerischen Imperialismus geschlossen zu führen».[70] Wie dieser Kampf geführt werden sollte, erläuterte der Vorsitzende des ADGB, Theodor Leipart, auf einer Sitzung des Bundesausschusses am 24. Januar: Mit «möglichst geringem Kräfteaufwand» sollte der größtmögliche Effekt erzielt werden. Das hieß, dass sich die Freien Gewerkschaften auf das Konzept des passiven Widerstands festlegten, wobei sie gleichzeitig den Willen zur Wiedergutmachung betonten und sich von nationalistischen Exzessen distanzierten. In den Worten des Sitzungsprotokolls: «Lediglich passive Resistenz soll Anwendung finden unter Aufrechterhaltung des Erfüllungswillens und unter Ablehnung jedes nationalistischen Einschlags.»[71]
Zwischen Gewerkschaften und Unternehmern herrschte in der Anfangsphase der Ruhrbesetzung eine seltene Einmütigkeit. Bereits am 9. Januar hatte Stinnes die ADBG-Vertreter über die beabsichtigte Verlegung des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats, der wirtschaftlichen Schaltstelle des Ruhrbergbaus, von Essen nach Hamburg informiert. Damit wurden den Besatzern die Unterlagen über Förderverhältnisse, Förderanlagen und Absatzmengen entzogen, die sie benötigten, um direkt auf die Kohle zugreifen zu können. Nach Auffassung der «Deutschen Allgemeinen Zeitung» war dieser Schritt nicht nur von großer wirtschaftlicher, sondern auch politisch-psychologischer Bedeutung: «Indem er den einbrechenden Landesfeind um seine gierigsten Erwartungen mit einem Schlage prellte, erfüllte er die gesamte politische Atmosphäre Deutschlands sofort mit Hochspannung.»[72]
Hugo Stinnes hatte zwar die Ruhrbesetzung lange kommen sehen, dennoch war er, als sie eintrat, ebenso überrascht wie die Reichsregierung. Von der Woge antifranzösischer Emotionen ließ auch er sich mitreißen. In einem Brief an Emil Kirdorf, den Generaldirektor der Gelsenkirchner Bergwerks-AG, vom 17. Januar nannte er die patriotische Erregung über den Einmarsch «ein Glück für unser Land»: «Wie vor hundert Jahren» beginne «sich nunmehr das Volk zusammenzuschließen im gemeinsamen Leid und im gemeinsamen Hass.»[73] Auch bei den meisten anderen Unternehmern an Rhein und Ruhr stieß der von der Regierung Cuno in Absprache mit den Gewerkschaften verkündete passive Widerstand auf große Sympathien: «Es freut mich übrigens, dass unsere Regierung fest geblieben ist und Widerstand leistet», schrieb Carl Duisberg, der Generaldirektor und Aufsichtsratsvorsitzende der Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. «Endlich einmal Taten statt Worte, selbst auf die Gefahr hin, dass dadurch auch für unsere Wirtschaft ein Durcheinander entsteht.»[74]
Reichspräsident Friedrich Ebert spricht in Hamm vor Delegierten aus dem besetzten Ruhrgebiet und sichert ihnen die Solidarität des Reiches zu (18. März 1923).
Einer der rührigsten Befürworter des passiven Widerstands unter den Ruhrindustriellen war Paul Reusch, der Generaldirektor der Gutehoffnungshütte in Oberhausen. Unmittelbar bevor die Franzosen am 11. Januar die Stadt besetzten, verlegte er den Firmensitz nach Nürnberg und entzog ihn so dem Zugriff der Besatzungsmacht. In den folgenden Wochen war der Konzernherr im ganzen Land unterwegs, um die antifranzösische Stimmung zu schüren und den Widerstandsgeist anzustacheln.[75]
Wie zwischen Gewerkschaften und Unternehmern gab es auch unter den Parteien ein hohes Maß an Übereinstimmung. In seinem Aufruf an die Mitglieder vom 11. Januar lehnte es der Vorstand der Vereinigten Sozialdemokratischen Partei zwar ab, sich an den für den 14. Januar geplanten öffentlichen Kundgebungen zu beteiligen – stattdessen wollte man in geschlossenen Versammlungen den Protest zum Ausdruck bringen. Im Ton aber unterschied sich der Appell kaum vom nationalen Pathos der bürgerlichen Parteien. Der Einmarsch ins Ruhrgebiet wurde als ein eklatanter Bruch des Völkerrechts gebrandmarkt. Er beweise, «dass auch vier Jahre nach dem Kriegsende der französische Militarismus, gefolgt von belgischen Hilfstruppen, noch mit den Mitteln des Krieges arbeitet».[76] In der Reichstagsdebatte vom 13. Januar bezeichnete Hermann Müller, Mitglied des SPD-Parteivorstands und vom März bis Juni 1920 Reichskanzler der Weimarer Koalition, den Weg, den Poincaré eingeschlagen habe, als «imperialistisches Abenteuer» und Ausfluss einer brutalen Machtpolitik, die gänzlich ungeeignet sei, die Mittel zu beschaffen, die Frankreich für seine notleidenden Staatsfinanzen benötige. «Bajonette sind keine Wünschelruten, die anzeigen, wo Goldmilliarden im Boden zu haben sind.»[77]
In derselben Reichstagssitzung gab Gustav Stresemann im Namen der bürgerlichen Fraktionen – DDP, DVP, BVP und DNVP – eine Erklärung ab, die in schärfsten Worten Protest einlegte gegen «die Vergewaltigung des deutschen Volkes». Keine äußere Bedrohung gebe Frankreich «einen Entschuldigungsgrund für diesen Überfall und diesen Raubzug im deutschen Lande». Letztlich ziele die Politik Poincarés auf «die Vernichtung Deutschlands». Dagegen gelte es, fest zusammenzustehen und alle innenpolitischen Gegensätze zurückzustellen. «Jede Hoffnung auf Deutschlands Uneinigkeit muss zerschellen am einheitlichen deutschen Willen und Wollen.» Auch in den folgenden Wochen spielte der DVP-Vorsitzende eine wichtige Rolle unter den Befürwortern einer harten Haltung gegenüber Frankreich, wobei er seine Funktion als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Reichstags nutzen konnte.[78] Dass sich hinter der Fassade der Einigkeit Risse auftaten, zeigte sich aber bereits wenige Tage später im Reichstag, als der prominente Abgeordnete der DNVP, Karl Helfferich, die Regierung Cuno kritisierte, weil sie die diplomatischen Beziehungen zu Frankreich nicht gänzlich abgebrochen und den Vertrag von Versailles für null und nichtig erklärt habe. Denn mit der völkerrechtswidrigen Besetzung deutschen Territoriums habe Frankreich selbst «den ganzen sogenannten Friedensvertrag in Stücke gerissen».[79]
Von Anfang an aus der nationalen «Einheitsfront» gegen die Ruhrbesetzung ausgeschert war der aufstrebende Lokalmatador der völkischen Rechten in München, der Vorsitzende der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), Adolf Hitler. Am Abend des 11. Januar 1923 hielt er eine Rede im Zirkus Krone, in der er nicht etwa gegen Frankreich, sondern gegen die sogenannten «Novemberverbrecher» – gemeint waren Demokraten und Juden – vom Leder zog. Durch ihren «Dolchstoß» in den Rücken des deutschen Heeres hätten sie Deutschland wehrlos gemacht und der «völligen Versklavung» anheimgegeben. Eine «deutsche Wiedergeburt nach außen» könne es erst geben, «wenn die Verbrecher zur Verantwortung gezogen und ihrem gerechten Schicksal überliefert» würden. Das «Geschwätz von der Einheitsfront» sei nur geeignet, die Bevölkerung von dieser Aufgabe abzulenken.[80] Folgerichtig verweigerte Hitler auch die Teilnahme an einer Kundgebung gegen den «Erbfeind» Frankreich, zu der die «vaterländischen Verbände» am 14. Januar in München aufriefen.
Für Theodor Wolff, den Chefredakteur des «Berliner Tageblatts», lautete die Parole der Stunde: «Ruhe, Ordnung, Einigkeit und Disziplin», und zwar «bis zu dem Augenblick, wo der französische Imperialismus seinen Raub wieder herausgeben wird». Gegen dieses Gebot verstieß seiner Ansicht nach nicht nur die radikale Rechte, sondern auch die radikale Linke: «Wenn ein rechtsradikaler Volkstribun, ohne Widerspruch in den eigenen Reihen hervorzurufen, in solcher Zeit erklären darf, es gelte nicht den Kampf gegen Frankreich, sondern den Kampf gegen die deutschen Novemberrevolutionäre, so genieren sich die Kommunisten erst recht nicht zu verkünden, die ‹Bourgeoisie› sei der Feind. Wobei sie wenigstens auch die französische Bourgeoisie in ihre Ablehnung einschließen (…).»[81]
Tatsächlich waren die deutschen Kommunisten der Überzeugung, dass der Kampf an zwei Fronten geführt werden müsse: gegen die französische und die deutsche Bourgeoisie. Deshalb setzte die Zentrale der KPD in einem Aufruf an das deutsche Proletariat vom 22. Januar der Aufforderung zum passiven Widerstand die Parole entgegen: «Schlagt Poincaré und Cuno an der Ruhr und an der Spree!» Die französischen Kapitalisten seien «um keinen Deut besser als die deutschen, und die Bajonette der französischen Besatzungstruppen (…) nicht weniger scharf als die der Reichswehr», hieß es. Dementsprechend wurden die Arbeiter des Ruhrgebiets aufgefordert, «den Abwehrkampf gegen die französischen Besatzungsbehörden mit voller Energie zu führen», aber nur dort, wo Arbeiterrechte auf dem Spiel stünden. Nur wenn die Arbeiterschaft als «selbständige Kraft», getrennt von der deutschen Bourgeoisie, auftrete, könne sie der Gefahr entgehen, dem «nationalistischen Taumel» zu erliegen, und nur dadurch könne sie auch die Unterstützung der internationalen Arbeiterklasse, vor allem der französischen Arbeiter, gewinnen.[82]
Allerdings hielt sich die Solidarität der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) mit den deutschen Klassenbrüdern in Grenzen. Zu einer wirkungsvollen Aktion gegen die Ruhrbesetzung vermochte sie die französische Arbeiterschaft nicht zu mobilisieren. Und auch die deutschen Kommunisten mussten sehr bald die Erfahrung machen, dass der von ihnen propagierte revolutionäre Kampf nach zwei Seiten unter der Arbeiterschaft im besetzten Gebiet weitgehend ungehört verhallte. In der Konsequenz sollte die KPD-Führung ihre Propaganda bald in erster Linie gegen die fremde Besatzungsmacht richten.[83]
Manche Beobachter sahen in den ersten Wochen der Ruhrbesetzung bereits einen neuen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland heraufziehen. Und der Chef der Heeresleitung, General Hans von Seeckt, tat einiges, um Öl ins Feuer zu gießen. Durch seinen «frechen Einfall» habe Frankreich «das Friedensdiktat zerrissen und uns in den Befreiungskrieg hineingezwungen», erklärte er am 15. Januar in einem Aufruf im «Militärwochenblatt».[84] Freilich wusste Seeckt nur zu gut, dass er mit der auf 100.000 Mann reduzierten Reichswehr einen militärischen Konflikt mit dem westlichen Nachbarn nicht riskieren konnte. In der «Vossischen Zeitung» mahnte auch Chefredakteur Georg Bernhard zur Zurückhaltung: Niemand zweifle daran, dass, wenn das Volk zu den Waffen gerufen werde, «der Strom der Begeisterung Millionen Männer aller Lebensalter zu den Werbeplätzen führen» würde. Aber so leichtfertig dürfe keine deutsche Regierung sein: «Wie will jetzt das entwaffnete, von höchster Finanznot heimgesuchte deutsche Volk einen Krieg gegen die intakte Kampfmaschine seiner Gegner führen?»[85]
War also im Westen an eine offene Gegenwehr nicht zu denken, so galt das nicht für die Grenze im Osten. Sollte Polen die Ruhrokkupation nutzen, um seinerseits deutsche Gebiete zu besetzen, dann – darin waren sich Regierung und Öffentlichkeit einig – sollte Deutschland sich auch militärisch zur Wehr setzen. «Wenn das Reich im Westen nicht Widerstand leisten kann, so ist damit nicht auch gesagt, dass wir den Osten einem Einbruch schutzlos preisgeben würden», verkündete Reichskanzler Cuno in einer Rede vor den Ministerpräsidenten der Länder am 12. Januar.[86] Eine ähnliche Versicherung gab Seeckt dem deutschen Botschafter in Warschau, Ulrich von Rauscher: Sollte Frankreich Polen drängen, in Ostpreußen und Oberschlesien einzufallen, dann würde eine solche Aggression mit allen Mitteln abgewehrt werden.[87]
Insgeheim betrieb die militärische Führung sehr zielstrebig den Aufbau einer illegalen «Schwarzen Reichswehr», unter anderem durch Rekrutierung von Zeitfreiwilligen und durch eine Zusammenarbeit mit den formell aufgelösten, faktisch aber vielerorts weiterexistierenden Wehrverbänden der Rechten. Am 30. Januar 1923 schloss das Reichswehrministerium eine förmliche Vereinbarung mit dem preußischen Innenminister, dem SPD-Politiker Carl Severing, in dem dieser die Unterstützung der preußischen Verwaltungsstellen in Fragen des «Landesschutzes» zusagte. Die Hoffnung Severings, die Reichswehr mit diesem Abkommen daran zu hindern, weiterhin gemeinsame Sache mit den paramilitärischen Verbänden der Rechten zu machen, sollte sich allerdings nicht erfüllen.[88