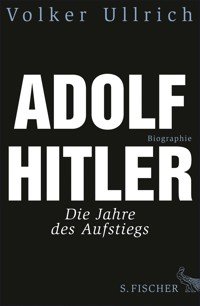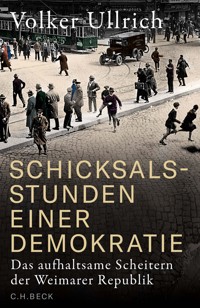
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratien sind fragil. Freiheiten, die fest errungen scheinen, können verspielt werden. Wenige historische Ereignisse verdeutlichen dies so eindringlich wie das Scheitern der Weimarer Republik. Volker Ullrich erzählt eines der größten Dramen der Weltgeschichte – anschaulich, spannend und nahe an den handelnden Personen. Chancen blieben ungenutzt, Alternativen wurden verspielt. Nichts war zwangsläufig oder unvermeidbar. Die Schicksalsstunden einer Demokratie, es gab sie von den Anfängen in der Revolution von 1918 bis zu den verhängnisvollen Tagen im Januar 1933. Es kommt auf die konkreten Handlungen einzelner Personen an – damals wie heute. Eine Lektüre, die beklemmende Parallelen zur Gegenwart zeigt. Die Geburt der Weimarer Republik stand unter einem denkbar ungünstigen Stern. Das deutsche Kaiserreich hatte den Weltkrieg krachend verloren. Der Versailler Vertrag legte dem besiegten Land harte Bedingungen auf. Eine nicht abreißende Kette von Krisen – unterbrochen nur durch eine Phase scheinbarer Stabilisierung Mitte der 20er Jahre – erschütterte die Republik. Doch trotz aller Belastungen – das Experiment der ersten deutschen Demokratie war nicht von allem Anfang an auf ein ruhmloses Ende angelegt. In seinem packenden Buch zeigt der renommierte Historiker und Publizist Volker Ullrich, dass es immer wieder Gelegenheiten gab, die Weichen anders zu stellen, von der Gründungsphase der Republik bis zum Januar 1933. So ist Ullrichs Buch auch eine eindringliche Mahnung: Wir haben es in der Hand, ob die Demokratie siegt oder scheitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Volker Ullrich
Schicksalsstunden einer Demokratie
Das aufhaltsame Scheitern der Weimarer Republik
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Einleitung
Kapitel I: Der Zauber des Anfangs – Die Revolution von 1918/19
Kapitel II: Marsch auf Berlin – Der Kapp-Lüttwitz-Putsch
Kapitel III: «Der Feind steht rechts» – Der Mord an Walther Rathenau
Kapitel IV: Tollhauszeit – Ruhrbesetzung und Hyperinflation
Kapitel V: Konservative Wende – Der Tod Eberts und die Wahl Hindenburgs
Kapitel VI: Ein schwarzer Tag – Der Bruch der letzten Großen Koalition
Kapitel VII: Modell Thüringen – Wilhelm Fricks braune Kulturrevolution
Kapitel VIII: Anfang vom Ende – Der Sturz Brünings
Kapitel IX: Die Stunde der Barone – Papens Staatsstreich gegen Preußen
Kapitel X: Am Ziel – Die Machtübertragung an Hitler
Kapitel XI: Ruhig abwarten – Reaktionen auf den 30. Januar 1933
Nachwort und Dank
Anmerkungen
Einleitung
Kapitel I: Der Zauber des Anfangs.
Die Revolution von 1918/19
Kapitel II: Marsch auf Berlin.
Der Kapp-Lüttwitz-Putsch
Kapitel III: «Der Feind steht rechts».
Der Mord an Walther Rathenau
Kapitel IV: Tollhauszeit.
Ruhrbesetzung und Hyperinflation
Kapitel V: Konservative Wende.
Der Tod Eberts und die Wahl Hindenburgs
Kapitel VI: Ein schwarzer Tag.
Der Bruch der letzten Großen Koalition
Kapitel VII: Modell Thüringen.
Wilhelm Fricks braune Kulturrevolution
Kapitel VIII: Anfang vom Ende.
Der Sturz Brünings
Kapitel IX: Die Stunde der Barone.
Papens Staatsstreich gegen Preußen
Kapitel X: Am Ziel.
Die Machtübertragung an Hitler
Kapitel XI: Ruhig abwarten.
Reaktionen auf den 30. Januar 1933
Bibliographie
Gedruckte Quellen
Tagebücher, Briefe, Erinnerungen
Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Zum Buch
Vita
Impressum
Einleitung
Demokratien sind fragil. Sie können in eine Diktatur umschlagen. Freiheiten, die fest errungen scheinen, können verspielt werden.
Nach dem Ende des Kalten Krieges trat das Wissen um die Gefährdung der Demokratie zunächst in den Hintergrund. Francis Fukuyamas Diktum vom «Ende der Geschichte» meinte genau dies: dass es in Zukunft keine ernsthafte Herausforderung der liberalen Demokratie mehr geben würde. Dass sie alternativlos geworden sei. Auch wenn nur wenige es so zugespitzt vertraten wie Fukuyama, so wurde doch das Vertrauen in die Überlegenheit der Demokratie zum Kennzeichen einer ganzen Epoche. Die Frage war eher, wie lange es dauern würde, bis sie sich über die ganze Welt ausgebreitet hätte, und wie hartnäckig der Widerstand einiger dem Fortschritt entgegen stehender Diktaturen ausfallen würde.
Von dieser Gewissheit ist heute nicht mehr viel übrig. Die Demokratie steht weltweit unter Druck, von außen wie von innen. Autoritäre Staaten wie China und Russland fordern die westlichen Demokratien machtpolitisch heraus und attackieren sie auch von innen. In den USA hat die erste Präsidentschaft Donald Trumps einen Vorgeschmack darauf geliefert, was unter einer zweiten kommen könnte. In fast allen europäischen Ländern befinden sich rechtspopulistische Parteien und Bewegungen im Aufwind. Und in der Bundesrepublik erfreut sich die «Alternative für Deutschland» (AfD), eine in Teilen rechtsextreme Partei, erheblicher Zustimmung, insbesondere, aber keineswegs allein in den neuen Bundesländern. Die Sorge um die Demokratie ist zum Kennzeichen einer neuen historischen Ära geworden.
Das Scheitern der Weimarer Republik führte zum Dritten Reich. Die erste deutsche Demokratie endete mit der Machtübertragung an Hitler. Wer immer sich mit der Frage beschäftigt, wie und warum Demokratien sterben, kommt daher an Weimar nicht vorbei. Die deutsche Republik ist Menetekel und Lehrbeispiel zugleich – weltweit, aber insbesondere in der Bundesrepublik, die sich seit ihrer Gründung in der gescheiterten Vorgängerin spiegelte und die Stabilität ihrer Verhältnisse am Vergleich mit Weimar maß.[1] «Bonn ist nicht Weimar» – dieser Buchtitel des Schweizer Journalisten Fritz René Allemann aus dem Jahr 1956 wurde zur Chiffre der Selbstgewissheit, dass sich die Geschichte nicht wiederholen würde und die bundesrepublikanische Demokratie stabil sei. Doch diese Selbstdeutung wurde in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder infrage gestellt. Neu ist also nicht die Warnung vor einer Wiederkehr «Weimarer Verhältnisse». Neu ist vielmehr die globale Fragilität der Demokratie, die an die Zwischenkriegszeit erinnert. Grund genug, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, was in Weimar wirklich geschah.
Die Geschichte der Weimarer Republik fasziniert bis heute. Das liegt nicht zuletzt an den frappierenden Widersprüchen, die diese nur vierzehn Jahre umspannende Epoche in sich vereinigte. Es war eine Zeit der Aufbrüche, der Experimentierfreude und Innovationsbereitschaft auf vielen Gebieten, ein Laboratorium der Moderne mit einem vibrierenden Kulturbetrieb vor allem, aber nicht nur in der Metropole Berlin; eine Zeit der Auflösung traditioneller Geschlechterrollen und eines freieren Umgangs mit Sexualität. Es war aber auch die Zeit einer schier endlosen Abfolge von krisenhaften Erschütterungen, kulminierend in der Hyperinflation des Jahres 1923 und der Weltwirtschaftskrise seit 1929/30; eine Zeit der politischen Instabilität mit häufig wechselnden Regierungen und einem hohen Maß an Gewaltbereitschaft und Militanz bis hin zu den bürgerkriegsähnlichen Kämpfen in der Agonie der Republik.
Zu Recht ist gefordert worden, die Geschichte Weimars nicht nur von ihrem Ende her, als bloße Vorgeschichte der nationalsozialistischen Diktatur zu betrachten, sondern als eine Epoche aus eigenem Recht mit all ihren Ambivalenzen und Widersprüchen.[2] Zwar bleibt angesichts der katastrophalen Folgen, die die Machtübertragung an Hitler nach sich zog, die Frage nach den Gründen für das Scheitern der Republik unverzichtbar. «Niemand kann an die Republik von Weimar denken, ohne deren Scheitern mitzudenken», hat Hagen Schulze angemerkt.[3] Und wegen der globalen Krise der Demokratie ist die Frage nach den Ursachen für 1933 von neuem, drängendem Interesse. Aber gerade deshalb ist es wichtig, die Offenheit der Situation zu betonen. Denn sonst fragt man nicht nach den Handlungsspielräumen und Alternativen – und droht etwas zu übersehen, was für die Beantwortung der Frage unverzichtbar ist.
An Erklärungsversuchen der Historiker hat es nicht gemangelt. So hat man auf die Erblast des Obrigkeitsstaates verwiesen, auf die Kontinuität vordemokratischer Eliten in Schwerindustrie, ostelbischem Großgrundbesitz, Armee, Bürokratie und Justiz, deren angestammte Machtpositionen auch unter den neuen demokratischen Verhältnissen im Wesentlichen unangetastet blieben. Man hat die Belastungen hervorgehoben, die der Republik aus den Folgen der militärischen Niederlage im Weltkrieg und den harten Bedingungen des Versailler Vertrages erwuchsen. Man hat auf die Strukturmängel der Weimarer Verfassung aufmerksam gemacht, die den Reichspräsidenten als eine Art «Ersatzkaiser» mit weitreichenden Befugnissen ausstattete und ihm mit dem Notverordnungsartikel 48 ein Instrument zur Hand gab, das in Krisenzeiten geradezu zum Missbrauch einlud. Oder man hat die Parteien verantwortlich gemacht, die in ihren ideologischen Gräben befangen blieben und es an Kompromissbereitschaft fehlen ließen – eine der Ursachen für die chronische Schwäche der parlamentarischen Demokratie. Doch so schwer auch die Vorbelastungen wogen, die vor allem aus den Versäumnissen der Gründungsphase der Republik resultierten – das Experiment der ersten deutschen Demokratie war damit nicht von allem Anfang an auf Untergang angelegt. Es gab Alternativen, und es gab Gründe, warum sie nicht oder nur unzureichend genutzt wurden. Der Ausgang war offener, als es eine auf den Untergang fixierte Perspektive nahelegen möchte.
An Gelegenheiten, die Weichen anders zu stellen und umzusteuern, hat es nicht gefehlt. In der Revolution von 1918/19 hätten die regierenden Sozialdemokraten mehr an gesellschaftlichen Veränderungen durchsetzen können und weniger an Altem bewahren müssen. Die Niederschlagung des Kapp-Putsches im März 1920 und die große prorepublikanische Solidaritätswelle nach dem Mord an Reichsaußenminister Walther Rathenau im Juni 1922 boten die Chance, gegen das republikfeindliche Lager in die Offensive zu gehen. Sie blieb ungenutzt.
In der Hyperinflation von 1923, als die Republik buchstäblich am Abgrund stand, zeigte sich, dass die Selbstbehauptungskräfte der Demokraten stärker waren als von vielen angenommen. Die Wahl des überzeugten Monarchisten Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten im April 1925 stellte allerdings eine Zäsur dar. Sie hätte verhindert werden können, wenn die Kommunisten über ihren Schatten gesprungen wären. Auch der Bruch der Großen Koalition im März 1930, der faktisch das Ende der parlamentarischen Demokratie markierte, hätte sich vermeiden lassen, wenn es auf Seiten der Parteien eine größere Bereitschaft zum Kompromiss gegeben hätte. Niemand zwang die bürgerlichen Parteien in Thüringen 1930, die Nationalsozialisten in die Landesregierung aufzunehmen. Sie taten es aus freien Stücken und gaben ihnen damit die Gelegenheit vorzuexerzieren, wie sie sich eine Machtübernahme auch auf Reichsebene vorstellten. Ohne Not entließ Hindenburg Ende Mai 1932 auf Drängen seiner Ratgeber Reichskanzler Heinrich Brüning und beendete so die noch gemäßigte Phase der Präsidialregierungen. Mit Brüning im Amt hätte der Staatsstreich in Preußen im Juli 1932 nicht stattfinden können, den sein Nachfolger Franz von Papen inszenierte. Eines der letzten Bollwerke der Republik wurde auf diese Weise geschleift.
Doch selbst noch im Januar 1933 war der Triumph Hitlers nicht unvermeidlich, gab es immer noch Möglichkeiten, ihn von der Macht fernzuhalten. Es gehört zur bitteren Ironie der deutschen Geschichte, dass der «Führer» der NSDAP dank eines finsteren Intrigenspiels in einem Augenblick ins Reichskanzleramt einziehen konnte, als seine Bewegung im Niedergang begriffen war und viele kluge Zeitgenossen ihn bereits abgeschrieben hatten.
Geschichte ist immer offen. Das Einzige, was die Geschichtswissenschaft über die Zukunft sicher sagen kann, ist, dass sie anders ausfallen wird, als die Zeitgenossen sie sich vorstellen. Es kommt entscheidend darauf an, wie sich einzelne Menschen in konkreten Situationen verhalten. Das war zur Zeit der Weimarer Republik so, und das ist auch heute noch so. Wir haben es in der Hand, ob unsere Demokratie scheitert oder überlebt. Das deutlich zu machen, ist das eigentliche Ziel dieses Buches.
Dabei sollte bedacht werden, dass die Weimarer Republik nicht mit einem Knall zugrunde ging, sondern in einem schleichenden Prozess der Erosion, durch die schrittweise Aushöhlung der Verfassung und demokratischer Verfahrensweisen. Eben ein solcher «leiser Tod» könnte eine Art Blaupause werden für den Niedergang auch traditionsreicher westlicher Demokratien wie den Vereinigten Staaten, deren Stabilität lange Zeit unerschütterbar schien.[4] Das Scheitern der Weimarer Republik bleibt ein Lehrstück, wie zerbrechlich eine Demokratie ist, und wie rasch die Freiheit verspielt werden kann, wenn die demokratischen Institutionen versagen und die zivilgesellschaftlichen Kräfte zu schwach sind, um den Verächtern der Demokratie Einhalt zu gebieten.
Kapitel I
Der Zauber des Anfangs
Die Revolution von 1918/19
9. November 1918 in Berlin: Vor der Garde-Ulanen-Kaserne solidarisieren sich Soldaten mit den streikenden Arbeitern.
Es ist der 9. November 1918. In Berlin herrscht eine fieberhafte Spannung. Schon seit Tagen wird die Reichshauptstadt durch Gerüchte über einen Matrosenaufstand in Kiel und die rasche Ausbreitung der revolutionären Bewegung in Atem gehalten. «Die Nervosität und Erwartung, dass etwas Ungewöhnliches geschehen werde, ist in allen Kreisen groß», notiert der Kunstmäzen und Diplomat Harry Graf Kessler.[1] Der Oberbefehlshaber in den Marken, General Alexander von Linsingen, hat Bahnlinien unterbrechen lassen und zusätzliche Truppen angefordert, um Berlin vor den Aufständischen zu schützen. Doch alle Gegenmaßnahmen erweisen sich schnell als wirkungslos.
Am Morgen des 9. November treten die Arbeiter der Berliner Großbetriebe in den Generalstreik. Die Naumburger Jäger, eine als besonders zuverlässig geltende Truppe, solidarisiert sich mit den Streikenden. Von den Außenbezirken bewegen sich lange Demonstrationszüge zum Regierungsviertel in der Wilhelmstraße, bewaffnete Arbeiter und Soldaten an der Spitze. Theodor Wolff, der Chefredakteur des liberalen «Berliner Tageblatts», hält in seinem Tagebuch fest: «Aus dem Redaktionsfenster sehe ich, dass durch die Leipziger Straße sich große Menschenmassen mit roten Fahnen in Zügen vorwärts bewegen. Meine Mitarbeiter kommen und erzählen, überall risse man den Offizieren die Kokarden ab, Schutzleute seien nicht mehr vorhanden, die Stadt sei mit einem Schlage völlig verändert, die Straßenbahn habe den Verkehr eingestellt, das Wolffsche Telegraphenbureau sei von den Revolutionären besetzt, am Brandenburger Tor wehe die rote Fahne.»[2]
In pausenlosen Telefongesprächen versucht der Reichskanzler, Prinz Max von Baden, vergeblich, den im Hauptquartier im belgischen Spa weilenden Kaiser Wilhelm II. noch in letzter Minute zur Abdankung zu bewegen. So entschließt er sich, auf eigene Verantwortung zu handeln. Gegen 12 Uhr mittags lässt er über das «Wolffsche Telegraphenbureau» die Nachricht verbreiten, dass Wilhelm II. seinem Thron entsagt habe. Kurze Zeit später überträgt er dem Vorsitzenden des Mehrheitsflügels der Sozialdemokratie, Friedrich Ebert, die Reichskanzlerschaft. Auf die Frage, ob er bereit sei, das Amt «auch innerhalb der monarchischen Verfassung» zu führen, antwortet Ebert ausweichend: «Gestern hätte ich diese Frage unbedingt bejaht, heute muss ich mich erst mit meinen Freunden beraten.» Als Prinz Max daraufhin die Frage einer möglichen Regentschaft für die Hohenzollern anschneidet, erklärt Ebert: «Es ist zu spät», und hinter ihm wiederholt der Chor seiner Parteigenossen: «Zu spät, zu spät!»[3]
Um zwei Uhr nachmittags ruft der zweite Vorsitzende der Mehrheitssozialdemokratie, Philipp Scheidemann, von einem Balkon des Reichstags die «deutsche Republik» aus: «Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte, Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt!»[4] Nur zwei Stunden später proklamiert Karl Liebknecht vom Balkon des Berliner Schlosses aus die «freie sozialistische Republik Deutschlands». Der führende Kopf der Spartakusgruppe, für den sich erst am 23. Oktober die Tore des Zuchthauses Luckau geöffnet hatten, macht in seiner Rede deutlich, dass das eigentliche Werk der revolutionären Umwälzung erst noch bevorstehe: «Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu schaffen, eine Ordnung des Friedens, des Glücks und der Freiheit unserer deutschen Brüder und unserer Brüder in der ganzen Welt.»[5]
An eben diesem Nachmittag begibt sich der Historiker Gustav Mayer in die Berliner Innenstadt. «Welch verändertes Bild springt mir entgegen!», notiert er. «Überall Soldaten ohne Kokarden. Herumstehende, schlendernde, diskutierende (aber keine singenden) Menschen am Potsdamer Platz. Fortwährend kommen Lastautos und graue Militärautos, voll besetzt (auch die Dächer) mit Soldaten mit aufgeknöpften Jacken und zwischen ihnen, die Flinte um die Schulter, zahlreiche Arbeiter und Halbwüchsige. Auf jedem Auto einer, der die rote Fahne schwenkt.»[6] Die rote Fahne – sie wird zum Symbol der Revolution. «Roter Stoff scheint von irgendwelchen Ausgabestellen aus unter die Vertrauensleute der Bewegung verteilt zu werden, und so tragen sie alle das noch vor kurzem so verpönte Abzeichen des Umsturzes», wundert sich der Reporter der «Deutschen Zeitung», eines Sprachrohrs des radikalnationalistischen Alldeutschen Verbandes.[7]
Am Abend schreibt Theodor Wolff seinen Leitartikel, der am nächsten Morgen erscheinen wird. In bewegten Worten feiert er den vollzogenen Umsturz: «Die größte aller Revolutionen hat wie ein plötzlich losbrechender Sturmwind das kaiserliche Regime mit allem, was oben und unten dazu gehörte, gestürzt. Man kann sie die größte aller Revolutionen nennen, weil niemals eine so fest gebaute, mit soliden Mauern umgebene Bastille so in einem Anlauf genommen worden ist.»[8] Zu demselben Urteil gelangt Harry Graf Kessler, als er am 10. November auf die Ereignisse des Vortages zurückblickt: «Die Revolution hat vor wenig mehr als 24 Stunden in Berlin begonnen; und schon ist von der alten Ordnung und Armee nichts mehr übrig. Nie ist das ganze innere Gerüst einer Großmacht in so kurzer Zeit so vollkommen zerstäubt.»[9]
Doch so plötzlich, wie viele meinten, war die Revolution nicht ausgebrochen, und es hatte auch mehr als eines Anlaufs bedurft, um die scheinbar so festgefügte Ordnung der Hohenzollernmonarchie zum Einsturz zu bringen. Die Umwälzung vom November 1918 war nicht nur eine Folge der militärischen Niederlage und der dadurch ausgelösten Schockreaktion in der deutschen Bevölkerung. Sie war lange im Schoße der wilhelminischen Gesellschaft herangereift. Unter der Hülle des «Burgfriedens», der im August 1914 proklamiert worden war, hatten sich die gesellschaftlichen Spannungen im Laufe des Ersten Weltkrieges außerordentlich verschärft. Nicht nur für Arbeiter, sondern auch für Angestellte und Beamte verschlechterte sich die materielle Situation drastisch, während Rüstungsindustrielle Riesenprofite machten.
Besonders die völlig unzureichende Versorgung mit Lebensmitteln schürte Unzufriedenheit. «Alles wird für die Reichen, für die Besitzenden reserviert. Sobald es heißt, Entbehrungen mitmachen zu müssen, dann wollen die Herrschaften keine Brüder und Schwestern mehr von der arbeitenden Klasse sein. Die schönen Reden vom ‹Durchhalten› gelten nur für die arbeitende Klasse, die herrschende Klasse hat sich mit ihrem Geldsack schon genügend versorgt», klagte eine Hamburger Arbeiterin im Winter 1916/17, der als «Steckrübenwinter» in die Geschichtsbücher eingegangen ist.[10]
Mehr noch als der Mangel selbst wirkte die ungerechte Verteilung provozierend und verbitternd. In zahllosen Hungerunruhen und Streiks machte sich der angestaute Unmut seit 1916 Luft. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr verband sich die Empörung über die wirtschaftliche Not mit dem Verlangen nach Frieden. Mobilisierend wirkte hier das Beispiel der russischen Februarrevolution 1917. «Wir müssen es nur machen wie in Russland, dann wird es auch bald anders werden» – solche Äußerungen verzweifelter Frauen fingen die Spitzel der Politischen Polizei auf, die sich unter die Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften mischten.[11] Zum Sammelbecken des Antikriegsprotests wurde die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), die sich im April 1917 als oppositionelle Kraft formierte, während die Mehrheitsrichtung der Sozialdemokratie (MSPD) nach wie vor die Kriegsanstrengungen des kaiserlichen Deutschlands unterstützte.
Ende Januar 1918 traten in Berlin und anderen Städten Hunderttausende Rüstungsarbeiter in den Ausstand, um für «Frieden, Freiheit und Brot» zu demonstrieren. Zwar gelang es den Zivil- und Militärbehörden noch einmal, die Bewegung niederzuschlagen, doch war deutlich geworden, wie brüchig die Fundamente des wilhelminischen Herrschaftssystems inzwischen waren. «Es waren die ersten züngelnden Flammen aus dem glimmenden Feuer», zog eine Hamburger Sozialdemokratin Bilanz.[12]
Auch an den Fronten sammelte sich viel sozialer Zündstoff an. «Für die verdammten Preußen und Großkapitalisten halte ich meinen Schädel nicht länger hin», schrieb ein Soldat aus München in einem Feldpostbrief vom August 1917.[13] Das war keine Einzelstimme. «Gleiche Löhnung, gleiches Fressen, wär’ der Krieg schon längst vergessen!», lautete ein beliebter Spruch in den Schützengräben.[14] Nach dem Scheitern der letzten deutschen Großoffensive im Westen im Frühjahr 1918 häuften sich die Meldungen über Disziplinverstöße und Befehlsverweigerungen. Immer mehr Soldaten versuchten, sich dem Kriegsdienst zu entziehen, sei es, dass sie Krankheiten vortäuschten, in der Etappe untertauchten oder zum Gegner überliefen. «Dreiviertel der Mannschaften hier will Schluss. Wie ist ihnen ganz egal», hieß es in einem Feldpostbrief vom August 1918.[15]
Ende September 1918 musste die Oberste Heeresleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff eingestehen, dass der Krieg verloren war. Sie drängte auf den unverzüglichen Abschluss eines Waffenstillstands und, damit verbunden, auf eine «Parlamentarisierung» der Reichsverfassung. Das heißt, im Angesicht der Niederlage waren die maßgeblichen Männer in der Führung des Kaiserreichs bereit, das zu gewähren, was sie bislang strikt verweigert hatten: die Bildung einer nicht mehr vom Vertrauen des Monarchen, sondern einer Parlamentsmehrheit abhängigen Regierung, an der, nach Lage der Dinge, auch die Sozialdemokraten, seit 1912 stärkste Partei des Reichstags, beteiligt werden mussten. Am 26. Oktober verabschiedete der Reichstag Gesetze, die den Übergang zur parlamentarischen Monarchie besiegelten. Artikel 15 der Reichsverfassung wurde um die Bestimmung ergänzt: «Der Reichskanzler bedarf zu seiner Amtsführung des Vertrauens des Reichstags.» Außerdem wurde die kaiserliche Kommandogewalt der parlamentarischen Kontrolle unterstellt. Die Sonderstellung der Armee, ein Kernstück der Bismarckschen Verfassungskonstruktion, war damit beseitigt.[16] Die Reform «von oben» sollte der Revolution «von unten» zuvorkommen – das war der Grundgedanke der im Oktober 1918 eingeleiteten Wende.
Doch dieses Manöver kam zu spät. In geradezu atemraubendem Tempo beschleunigte sich der Autoritätsverfall der Regierenden. Der Wunsch, den sinnlos gewordenen Krieg unter allen Umständen so rasch wie möglich zu beenden, erfasste über die Arbeiterschaft hinaus weite Kreise der Bevölkerung. Die Antworten des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson auf das Waffenstillstandsangebot der neuen, parlamentarisch gestützten Regierung des Prinzen Max von Baden machten allerdings rasch deutlich, dass ohne eine Abdankung Wilhelms II. der Friede nicht zu haben war. Doch der Kaiser dachte gar nicht daran, freiwillig auf den Thron zu verzichten. «Ein Nachfolger Friedrichs des Großen dankt nicht ab», erklärte er großspurig – und reiste am 29. Oktober ins Hauptquartier nach Spa, dessen Kasinoatmosphäre ihm besser behagte als die zunehmend unsichere Lage in der Reichshauptstadt.[17] So richtete sich die Massenbewegung schließlich auch gegen den Träger der Krone selbst. «Hier in Berlin ist die Stimmung über die Maßen schlecht: man spricht in den Volksmassen fast von nichts als von der notwendigen Abdankung des Kaisers und des Kronprinzen und gibt sich einer völligen Friedenspsychose hin», berichtete der Historiker Friedrich Thimme.[18]
Dass der revolutionäre Funke auf den Großkampfschiffen der kaiserlichen Marine zündete, war kein Zufall. Denn hier, wo Mannschaften und Offiziere auf engstem Raum zusammenlebten, hatten soziale Ungleichheit und militaristische Willkür besonders empörende Ausmaße angenommen. Als die Marineleitung Ende Oktober 1918 den Befehl gab, die Hochseeflotte zu einem letzten Gefecht gegen England auslaufen zu lassen, verweigerten die Matrosen den Gehorsam.[19] In Kiel griff die Rebellion Anfang November aufs Land über, und von hier aus breitete sie sich in den folgenden Tagen auf ganz Deutschland aus. Überall bildeten sich – nach Kieler Vorbild – Arbeiter- und Soldatenräte. Fast widerstandslos brach die alte Ordnung zusammen. «Die Physiognomie der Revolution beginnt, sich abzuzeichnen», notierte Harry Graf Kessler am 7. November. «Allmähliche Inbesitznahme, Ölfleck, durch die meuternden Matrosen, von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Umgekehrt wie in Frankreich revolutioniert die Provinz die Hauptstadt, die See das Land. Wikinger-Strategie.»[20]
Noch glaubten die führenden Vertreter der MSPD, die Monarchie erhalten zu können, wenn der Kaiser sofort abdanke. Tue er dies nicht, bekannte Friedrich Ebert im Gespräch mit dem Reichskanzler, dann allerdings sei «die soziale Revolution unvermeidlich». Er aber wolle diese nicht, vielmehr hasse er sie «wie die Sünde».[21] Ob Ebert sich tatsächlich so unverblümt geäußert hat, wie es Prinz Max in seinen Erinnerungen überlieferte, ist strittig. Sicher aber ist, dass sich der MSPD-Vorsitzende mit dem Übergang zur parlamentarischen Monarchie bereits am Ziel seiner Wünsche wähnte und eine Revolution im Grunde für überflüssig hielt. Dabei war nicht zu verkennen, dass die Verfassungsreformen von Ende Oktober mehr ein Versprechen waren als politische Realität. Die Macht des Militärs war immer noch allgegenwärtig. Es bedurfte der gemeinsamen Aktion der revolutionären Matrosen, Arbeiter und Soldaten, um den Systemwechsel tatsächlich unumkehrbar zu machen.
Auch noch am 8. November scheiterten alle Versuche, den Kaiser zu einem freiwilligen Thronverzicht zu bewegen. Ja, Wilhelm II. drohte dem Reichskanzler direkt mit einer militärischen Besetzung der Reichshauptstadt: «Werdet ihr in Berlin nicht anderen Sinnes, so komme ich nach Abschluss des Waffenstillstandes mit meinen Truppen nach Berlin und schieße die Stadt zusammen, wenn es sein muss!»[22] So nahmen die Dinge am 9. November in der Hauptstadt den geschilderten Lauf.
Die Führer der Mehrheitssozialdemokratie befanden sich in einer schwierigen Situation. Sie hatten die Revolution nicht gewollt, ja sie nach Kräften zu verhindern gesucht, und konnten sich doch nach dem vollzogenen Umsturz nicht abseits halten, wenn sie sich nicht um jeden Einfluss auf den Gang der Ereignisse bringen wollten. Noch am Nachmittag des 9. November vollzog Ebert eine abrupte Wende. Er bot der USPD an, eine gemeinsame Revolutionsregierung zu bilden, die sich zu gleichen Teilen aus Vertretern beider Parteien zusammensetzen sollte. Dabei stellte er keine personellen Bedingungen. Auf Nachfrage des USPD-Angeordneten Oskar Cohn erklärte er sich sogar bereit, Karl Liebknecht, seinen schärfsten Widersacher, zu akzeptieren, falls die Unabhängigen ihn entsenden wollten.[23] Die USPD legte ihrerseits Bedingungen für einen Eintritt in die Regierung vor. Dem ersten Punkt: «Deutschland soll eine soziale Republik sein», stimmte die MSPD-Führung zu, allerdings mit dem Vorbehalt, dass darüber «das Volk durch die konstituierende Versammlung zu entscheiden» habe. Gegen die zweite Forderung, dass die gesamte exekutive, legislative und rechtsprechende Macht «ausschließlich in den Händen von gewählten Vertrauensmännern der gesamten werktätigen Bevölkerung und der Soldaten» liegen müsse, erhob sie jedoch Einspruch: «Ist mit diesem Verlangen die Diktatur eines Teils einer Klasse gemeint, hinter dem nicht die Volksmehrheit steht, so müssen wir diese Forderung ablehnen, weil sie unseren demokratischen Grundsätzen widerspricht.»[24]
Die Regierung der Volksbeauftragten. Links von oben nach unten: Hugo Haase, Otto Landsberg, Wilhelm Dittmann. Rechts von oben nach unten: Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Emil Barth. In der Mitte: Scheidemann ruft am 9. November die Republik aus.
Am Mittag des 10. November war die Koalitionsvereinbarung perfekt. Ein «Rat der Volksbeauftragten», wie sich das neue Kabinett nannte, trat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Ihm gehörten jeweils drei Mitglieder der Mehrheitssozialdemokraten und der Unabhängigen an: Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und der Rechtsanwalt und Reichstagsabgeordnete Otto Landsberg vertraten die MSPD. Die USPD entsandte ihren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Hugo Haase, ihren Parteisekretär Wilhelm Dittmann, der wegen führender Beteiligung am Januarstreik 1918 zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt worden war, und Emil Barth, einen Vertrauensmann der Revolutionären Obleute, die in den Berliner Großbetrieben einen starken Einfluss ausübten. Karl Liebknecht hatte es abgelehnt, in die Revolutionsregierung einzutreten, weil er nicht mit den in seinen Augen durch ihre Haltung im Krieg kompromittierten Führern der Mehrheitssozialdemokratie zusammenarbeiten wollte. Nominell teilten sich Ebert und Haase den Vorsitz; faktisch aber nahm Ebert, der am 9. November am Schreibtisch des Reichskanzlers Platz genommen hatte, von Anfang an für sich die Rolle des eigentlichen Regierungschefs in Anspruch.[25]
Dass sich MSPD und USPD auf eine Koalition einigten, war keineswegs selbstverständlich. Denn seit der Spaltung der Sozialdemokratie im Frühjahr 1917 hatten sich nicht nur die sachlichen Differenzen, sondern auch die gegenseitigen persönlichen Animositäten noch verschärft. Wenn die zerstrittenen Genossen jetzt wieder zusammenfanden, war dies vor allem auf den Druck von unten zurückzuführen. Nach dem Sturz der Hohenzollernherrschaft brach sich der Wunsch nach einem Ende des «Bruderkampfes» mit geradezu elementarer Wucht Bahn. Das zeigte sich bereits in einer Versammlung von rund 3000 Delegierten der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte, die am Nachmittag des 10. November im Zirkus Busch zusammentrat. Als Karl Liebknecht, die Symbolfigur des Widerstands gegen den Krieg, ans Rednerpult trat und, auf die Mehrheitssozialdemokraten weisend, vor jenen warnte, «die heute mit der Revolution gehen und vorgestern noch Feinde der Revolution waren», wurde er durch stürmische Rufe unterbrochen: «Einigkeit, Einigkeit!»[26] Das war eine schwere persönliche Niederlage für Liebknecht, der seinen Einfluss auf die Massen offensichtlich überschätzt hatte.
Die Versammlung wählte einen «Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates Großberlin», der tags darauf unter dem Vorsitz Richard Müllers, des Sprechers der Revolutionären Obleute, zusammentrat. Ihm gehörten 14 Vertreter der Soldaten und 14 Vertreter der Arbeiter an, wiederum paritätisch mit jeweils 7 Mitgliedern der MSPD und USPD. Aufgabe des Vollzugsrates sollte es sein, die Arbeit des Rates der Volksbeauftragten zu kontrollieren. Allerdings waren seine Kompetenzen nicht klar festgelegt worden, so dass die Regierung hoffen konnte, sich im Konfliktfall auch gegen dessen Votum durchsetzen zu können.[27] Die Führer der Mehrheitssozialdemokratie konnten mit dem Verlauf der ersten beiden Revolutionstage zufrieden sein. Sie hatten Anschluss an die revolutionäre Bewegung gefunden und bereiteten sich nun zielstrebig darauf vor, ihre Macht Schritt um Schritt auszubauen. Dabei kam ihnen zugute, dass die Mehrheit der Soldatenräte ihren Positionen zuneigte und auch unter den Arbeiterräten eher gemäßigte Auffassungen vorherrschten.
Am 12. November 1918 trat der Rat der Volksbeauftragten mit einer Proklamation an die Öffentlichkeit, die zu Recht als die «Magna Charta» der Revolution bezeichnet worden ist.[28] Der einleitende Satz lautete: «Die aus der Revolution hervorgegangene Regierung, deren politische Leitung rein sozialistisch ist, setzt sich die Aufgabe, das sozialistische Programm zu verwirklichen.» Mit einem Federstrich wurden alle kriegsbedingten Altlasten des Obrigkeitsstaates beseitigt: Der Belagerungszustand, die Einschränkungen des Vereins- und Versammlungsrechts, die Zensur wurden aufgehoben; Meinungsfreiheit und die Freiheit der Religionsausübung gewährt, politische Gefangene amnestiert und das Gesetz über den «Vaterländischen Hilfsdienst» von 1916 außer Kraft gesetzt. Darüber hinaus versprach die Regierung, vom 1. Januar 1919 an den achtstündigen Arbeitstag einzuführen und künftig alle Wahlen zu den Parlamenten nach dem gleichen, geheimen, direkten, allgemeinen Wahlrecht für alle, auch für Frauen, ab dem 20. Lebensjahr stattfinden zu lassen. Damit waren zwei wesentliche Forderungen der alten Sozialdemokratie erfüllt. Nach dem neuen Wahlrecht sollte auch die konstituierende Nationalversammlung gewählt werden, deren Zusammentreten in nicht allzu ferner Zeit in Aussicht gestellt wurde. Von einer Vergesellschaftung der Produktionsmittel war nicht die Rede. Stattdessen sagte die Regierung zu, «die geordnete Produktion aufrechterhalten» und «das Eigentum gegen Eingriffe» schützen zu wollen.[29] Zufrieden zeigte sich das MSPD-Blatt «Vorwärts»: «Das Programm ist ausgezeichnet, es wird der Welt zeigen, dass die neue Macht in Deutschland eine Ordnung der Freiheit will und nicht die Gewaltherrschaft, nicht die Anarchie und das Chaos.»[30] Der Verlauf der russischen Revolution stand der Mehrheits-SPD als warnendes Beispiel vor Augen.
Nach der Bildung des Rates der Volksbeauftragten und der Wahl des Vollzugsrats der Arbeiter- und Soldatenräte Groß-Berlins trat eine gewisse Beruhigung ein. Der Umsturz war überwiegend friedlich verlaufen. Es hatte nur wenige Tote gegeben. Der Waffenstillstand wurde am 11. November im Wald von Compiègne vom führenden Politiker der Zentrumspartei, Matthias Erzberger, unterzeichnet. Die neue Regierung schien entschlossen, für Ordnung zu sorgen und das Eigentum zu schützen. Nichts von dem, was man gewöhnlich mit dem Begriff Revolution verbinde, sei eingetreten, stellte die «Berliner Volkszeitung» bereits am 10. November fest: «Wer sich die Mühe eines Rundgangs durch die Straßen bei dem Schneetreiben nicht verdrießen ließ, der wird den Eindruck mit nach Hause genommen haben, dass es des Eingreifens der grünen Sicherheitspolizisten gar nicht bedurft hätte, um Zusammenstöße oder Radau zu vermeiden. Den mit Regenschirmen bewaffneten und in dicke Wolltücher und saubere Wintersonntagsanzüge gehüllten Versammlungsbesuchern war nicht anzusehen, dass sie noch irgendwelche Vorliebe für Handgranaten und Infanteriegewehre besäßen.»[31] Bei einem Sonntagsspaziergang durch den Grunewald am 10. November fiel dem Theologen und Philosophen Ernst Troeltsch auf, dass die Stimmung zwar etwas «gedämpft» war, man sich aber auch «beruhigt und behaglich» fühlte, dass alles «so gut abgegangen war»: «Auf allen Gesichtern stand geschrieben: Die Gehälter werden weiterbezahlt.»[32] Eine ähnliche Beobachtung machte der Schriftsteller Thomas Mann in München, wo die Revolution unter Führung des USPD-Politikers Kurt Eisner bereits am 7. November gesiegt hatte: «Ich bin befriedigt von der relativen Ruhe u(nd) Ordnung, mit der vorderhand wenigstens alles sich abspielt. Die deutsche Revolution ist eben die deutsche, keine russisch-kommunistische Trunkenheit.»[33]
Überraschend schnell kehrte das Leben in Berlin zur Normalität zurück. Die Straßenbahnen fuhren bald wieder regelmäßig; das Telefon funktionierte, ebenso die Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Die Geschäfte blieben geöffnet, und die Theater setzten ihren Spielbetrieb fort. Der Alltag schien durch das revolutionäre Geschehen nur wenig berührt worden zu sein. «Die Revolution hat nie mehr als kleine Strudel im gewöhnlichen Leben der Stadt gebildet, das ruhig in seinen gewohnten Bahnen drum herumfloss (…)», notierte Harry Graf Kessler am 12. November. «Die ungeheure welterschütternde Umwälzung ist durch das Alltagsleben Berlins kaum anders als ein Detektiv-Film hindurchgeflitzt.»[34] Das galt noch mehr für die ländlichen Regionen. «Hier geht das Leben seinen üblichen Gang, trotz der gewaltigen vulkanischen Eruption, die stattgefunden hat», schrieb Dorothy von Moltke, die Frau des Gutsherrn im schlesischen Kreisau, am 19. November an ihre in Südafrika lebenden Eltern.[35]
Das Bürgertum bewies, nachdem es sich von der ersten Schockstarre erholt hatte, eine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Binnen kurzem übernahmen bürgerliche Gruppierungen die proletarische Organisationsform der Räte. «Man überbietet sich allenthalben in Gründungen von allen möglichen Räten: Bauernräte, Bürgerräte, geistige Räte, Kunsträte, Theaterräte. Die deutsche Vereinsmeierei ist in die Arme der Revolution geflüchtet», stellte der Heidelberger Mittelalterhistoriker Karl Hampe Mitte November sarkastisch fest. Für ihn, wie für nicht wenige Vertreter des konservativen, kaisertreuen Bürgertums, markierte der 9. November 1918 den «elendsten Tag» seines Lebens.[36]
Wie sollte es nun weitergehen nach dem verheißungsvollen Auftakt der ersten Tage? Die Repräsentanten der Mehrheitssozialdemokratie verfolgten eine klar umrissene Agenda. Ihnen ging es zuallererst um die Bewältigung der drängenden Tagesprobleme: Sicherung der Lebensmittelversorgung, Umstellung der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft, Demobilisierung der Truppen, Durchführung des Waffenstillstands und Vorbereitung der Friedensverhandlungen. «Unsere nächsten Aufgaben müssen sein, die schnelle Herbeiführung des Friedens und die Sicherung unseres Wirtschaftslebens», erklärte Ebert auf der Reichskonferenz der Regierung der Volksbeauftragten mit den Vertretern der Länder am 25. November.[37] Die Arbeiter- und Soldatenräte waren in seinen Augen eher Störfaktoren, bestenfalls Notbehelfe für eine Übergangszeit; sie sollten möglichst rasch einer demokratisch legitimierten Nationalversammlung Platz machen. Diesem frei gewählten Parlament sollten dann alle wesentlichen Entscheidungen über die gesellschaftliche und politische Zukunft vorbehalten bleiben.
Die USPD war sich in der Frage der künftigen Neuordnung nicht einig. Der rechte Flügel hatte zwar gegen die Einberufung einer Nationalversammlung nichts einzuwenden, wollte aber den Wahltermin möglichst weit hinausschieben, um in der Zwischenzeit durch gesellschaftliche Strukturreformen der parlamentarischen Demokratie eine feste Grundlage zu geben. «Die Demokratie muss so verankert werden, dass eine Reaktion unmöglich wird», forderte Rudolf Hilferding, der führende Parteitheoretiker, Mitte November.[38]
Der Vertreter des linken Parteiflügels lehnten hingegen die Nationalversammlung ab und sprachen sich für die Einführung eines Rätesystems aus. Auf einer Vollversammlung der Groß-Berliner Arbeiterräte im Zirkus Busch am 19. November warnte Richard Müller, der Vorsitzende des Vollzugsrats: «Die Nationalversammlung ist der Weg zur Herrschaft der Bourgeoisie (…); der Weg zur Nationalversammlung geht über meine Leiche.»[39] Dieser Spruch sollte ihm den Spitznamen «Leichenmüller» eintragen. Mit ihrer rigorosen Ablehnung der Nationalversammlung näherten sich die linken Unabhängigen dem Spartakusbund (wie sich die Spartakusgruppe seit dem 11. November nannte), der zwar formal noch der USPD angehörte, faktisch aber eine von ihr unabhängige Politik betrieb. Unter der Parole «Alle Macht den Räten!» entfaltete er eine rege Propaganda für das Weitertreiben der Revolution. «Scheidemann-Ebert sind die berufene Regierung der deutschen Revolution in ihrem heutigen Stadium», schrieb Rosa Luxemburg Mitte November in der «Roten Fahne», deren redaktionelle Leitung sie nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in Breslau und ihrer Rückkehr nach Berlin am 10. November übernommen hatte. «Aber die Revolutionen stehen nicht still. Ihr Lebensgesetz ist rasches Vorwärtsschreiten, über sich selbst Hinauswachsen.» Wer für die Nationalversammlung eintrete, schraube die Revolution «bewusst oder unbewusst auf das historische Stadium bürgerlicher Revolutionen zurück». Die von der Geschichte auf die Tagesordnung gesetzte Frage laute vielmehr: «bürgerliche Demokratie oder sozialistische Demokratie».[40]
Allerdings war der Wirkungskreis des Spartakusbundes nur sehr begrenzt. Die Zahl seiner Mitglieder war überschaubar, und die Organisation befand sich erst im Aufbau. Liebknecht und Luxemburg «wüssten ganz genau, dass mit den Mittelchen, über die man jetzt verfüge, sich eine wirklich sozialistische Republik nicht herstellen lasse», teilte der Schriftsteller Eduard Fuchs, der sich dem Spartakusbund angeschlossen hatte, dem Historiker Gustav Mayer Mitte November mit.[41] Auf die Arbeiter- und Soldatenräte übte die radikale Linke keinen bestimmenden Einfluss aus. Hier besaßen die Vertreter der MSPD und des gemäßigten Flügels der USPD vielmehr ein erdrückendes Übergewicht. Von einer Rätediktatur nach bolschewistischem Muster war Deutschland im Herbst 1918 weit entfernt. Dennoch wurde diese Gefahr in bürgerlichen Kreisen bewusst dramatisiert. «Spartakus» wurde zu einem Kampfbegriff und mit «Bolschewismus» gleichgesetzt. Damit ließen sich Ängste schüren vor Chaos, Terror und Bürgerkrieg.[42]
Wie wirksam dieses Schreckensszenario war, zeigt sich daran, dass selbst ein so scharfsinniger Beobachter wie Theodor Wolff bereits am 12. November davon überzeugt war, «dass die Spartakusleute und sehr viel Gesindel bewaffnet auf eine Gelegenheit zu putschen lauern und keine genügend organisierte Schutzmacht mehr da ist».[43] Ängste und Hassgefühle fokussierten sich vor allem auf die Person Karl Liebknechts. Er habe den Eindruck, notierte Gustav Mayer am 11. November, dass der Spartakusführer «in seinem monomanischen Ehrgeiz» darauf aus sei, «der Lenin der deutschen Revolution zu werden». Und elf Tage später hielt er in seinem Tagebuch fest: «Man hört nur pessimistische Stimmen: in Berlin sei der Sieg des Bolschewismus nicht mehr aufzuhalten; Liebknecht zahle den ihm anhängenden Soldaten zehn Mark täglich.»[44] Bereits Anfang Dezember 1918 wurden an Berliner Litfasssäulen Plakate geklebt mit der Aufforderung, die Wortführer des Spartakusbundes umzubringen: «Schlagt ihre Führer tot! Tötet Liebknecht! Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben.»[45]
Auch die Führer der Mehrheitssozialdemokratie hatten das antibolschewistische Feindbild in starkem Maße verinnerlicht und scheuten nicht davor zurück, die damit verbundenen Bedrohungsängste in den innenpolitischen Auseinandersetzungen zu instrumentalisieren. Dabei konnten sie darauf verweisen, dass «Die Rote Fahne» sich in ihrer Berichterstattung einer äußerst aggressiven Sprache bediente, die den Eindruck erweckte, als arbeiteten Liebknecht und Luxemburg tatsächlich auf eine gewaltsame Übernahme der Macht hin. Eine übertriebene Sorge vor «russischen Verhältnissen» paarte sich bei Ebert und Scheidemann mit einem ausgeprägten Abscheu vor Unordnung und Anarchie. Diesen «Anti-Chaos Reflex» teilten sie mit weiten Kreisen des Bürgertums und vor allem mit den führenden Militärs. In deren Augen verkörperten die beiden MSPD-Führer, wie Oberst Ernst van den Bergh, ein Offizier im preußischen Kriegsministerium, bemerkte, «die Richtung, die alle Vernünftigen aus voller Überzeugung unterstützen müssen».[46]
Bereits am 10. November hatte Wilhelm Groener, der Nachfolger Ludendorffs in der Obersten Heeresleitung, Ebert in einem Telefongespräch eine Zusammenarbeit angeboten: «Das Offizierskorps verlange von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Ebert ging auf meinen Bündnisvorschlag ein», so hat Groener in seinen Erinnerungen ausgeführt. «Von da ab besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt.»[47] Ein förmliches «Bündnis» war damit noch nicht besiegelt, wohl aber eine Kooperation vereinbart, die für den weiteren Verlauf der Revolution von großer Bedeutung werden sollte.
Festlicher Empfang: Friedrich Ebert begrüßt am 10. Dezember 1918 am Brandenburger Tor die heimkehrenden Gardetruppen.
Am 11. November kam der Rat der Volksbeauftragten einer Bitte Hindenburgs nach und ersuchte die Heeresleitung in einem Telegramm, «für das gesamte Feldheer anzuordnen, dass die militärische Disziplin, Ruhe und straffe Ordnung im Heer unter allen Umständen aufrechtzuerhalten sind». Den Befehlen der Vorgesetzten sei bis zur Entlassung «unbedingt zu gehorchen». Außerdem sollten diese ihre Waffen und Rangabzeichen behalten dürfen. Den Soldatenräten wurde die Aufgabe zugewiesen, die Offiziere bei der «Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung» rückhaltlos zu unterstützen.[48] Damit war die Befehlsgewalt des Offizierskorps im Wesentlichen wiederhergestellt worden; unversehens sahen sich die Soldatenräte auf eine untergeordnete Rolle zurückgeworfen.
Für die MSPD-Volksbeauftragten war, als sie der OHL die Hand zur Zusammenarbeit boten, die Überlegung ausschlaggebend, dass ohne eine Mitwirkung der alten Militärführung eine geordnete Demobilisierung der acht Millionen Soldaten kaum möglich sein würde. Dabei vertrauten sie darauf, dass sich die Heeresleitung auf den Boden der vollzogenen Tatsachen stellen und sich der Revolutionsregierung gegenüber loyal verhalten würde. Als Emil Barth am 20. November im Kabinett forderte, Hindenburg zu entlassen, um die Behauptung der Entente vom «Fortbestehen des deutschen Militarismus» zu widerlegen, entgegnete Ebert, Hindenburg habe «auf Ehrenwort versichert, hinter der neuen Regierung zu stehen». Es liege daher «kein triftiger Grund vor, an Hindenburgs Stellung zu rütteln».[49] Die Folge dieser Vertrauensseligkeit war, dass sich die OHL wieder als innenpolitischer Machtfaktor etablieren konnte. Auch in der Öffentlichkeit demonstrierten die Offiziere schon bald wieder ein neues Selbstbewusstsein. Mitte Dezember, als die zurückkehrenden Gardetruppen in Berlin festlich empfangen wurden, beobachtete Harry Graf Kessler: «Auffallend, dass keine rote Fahne mehr zu sehen ist. Alles nur schwarz-weiß-rot, schwarz-weiß und vereinzelt schwarz-rot-gold. Mannschaften und Offiziere gehen meistens wieder mit Kokarden und Achselstücken. Der Unterschied gegen Mitte November ist groß.»[50] Der Schriftsteller Gerhart Hauptmann jedoch zeigte sich angetan: «Sturmhelme, Maschinengewehre, Feldküchen, Fähnchen. Alles soldatisch in guter Ordnung. Die eingewurzelte Popularität der Armee wurde wieder klar. Prachtvolle Truppen. Keine roten Abzeichen. (…) Ich rief Bravo.»[51]
Auch was die zivile Verwaltung betraf, scheuten die Volksbeauftragten vor rigorosen Eingriffen zurück, weil sie glaubten, ohne den Sachverstand des alten Beamtenapparats nicht auskommen zu können. Bereits in ihren ersten Aufrufen appellierten sie an die Beamten, sich in ihren Dienst zu stellen. Gustav Mayer begrüßte es am 11. November als «ein beruhigendes Symptom», «dass ein großer Teil der Beamtenschaft sich nicht in den Schmollwinkel zurückziehen will und dass die neuen Männer bereit sind, sich die ‹technische› Mitarbeit eingearbeiteter Kräfte gern gefallen zu lassen».[52] Die Staatssekretäre in den Reichsbehörden blieben im Amt. Ihnen wurden zwar jeweils zwei «Beigeordnete» von MSPD und USPD an die Seite gestellt, doch blieben deren Kontrollmöglichkeiten relativ gering, weil sie von der Bereitschaft der Ministerialbürokratie abhängig waren, ihnen die wichtigen Informationen zukommen zu lassen.[53] Auch hohe Beamte wie die Landräte in Preußen verblieben auf ihren Posten, obwohl sie aus ihren Sympathien für den untergegangenen Obrigkeitsstaat und ihrer Abneigung gegen die neue Ordnung keinen Hehl machten. Kein einziger hoher Funktionsträger des alten Systems wurde entlassen. Auf der Reichskonferenz mit den Vertretern der deutschen Einzelstaaten am 25. November rechtfertigte Ebert den Verzicht auf ein personelles Revirement: «Wir mussten, nachdem wir die politische Macht in die Hand genommen hatten, dafür Sorge tragen, dass die Reichsmaschine nicht zusammenbricht (…). Das konnten wir sechs Mann allein nicht machen; dazu brauchten wir die erfahrene Mitarbeit der Fachleute.»[54]
Zurückhaltung übten die MSPD-Volksbeauftragten auch in der Frage der wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse. Eine durchgreifende Agrarreform unterblieb, nicht zuletzt aus Sorge davor, dass dadurch die ohnehin angespannte Lebensmittelversorgung gefährdet werden könnte. Am 11. November gab der Rat der Volksbeauftragten den Interessenvertretern der Landwirtschaft die Zusicherung, «dass die Reichsregierung sie nachdrücklich schützen wird vor allen Eingriffen Unbefugter in ihre Eigentums- und Produktionsverhältnisse».[55] Diese Erklärung richtete sich vor allem an die Adresse der ostelbischen Rittergutsbesitzer, die durch die Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts und damit dem Verlust ihrer politischen Vorherrschaft im größten deutschen Einzelstaat ohnehin aufs äußerste beunruhigt waren. In den meisten Bauernräten, deren Bildung der Rat der Volksbeauftragten am 21. November befürwortete, dominierten die Interessen des Großgrundbesitzes, jedenfalls spielten sie eher eine die Verhältnisse auf dem Land stabilisierende als demokratisierende oder gar revolutionierende Rolle. Als Fortschritt konnte immerhin verbucht werden, dass die «Vorläufige Landarbeitsordnung» vom 24. Januar 1919 die diskriminierenden Ausnahmeregelungen für Landarbeiter aus der Zeit des Kaiserreichs außer Kraft setzte und diesen ermöglichte, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Schwerer aber wog, dass die ökonomische Macht der Junker und damit ein wesentliches Element agrarkonservativer Herrschaft in Preußen unangetastet blieb.[56]
Neben den ostelbischen Gutsbesitzern zählten die rheinisch-westfälischen Schwerindustriellen zu den Eliten, die sich vor 1918 am heftigsten gegen jede Demokratisierung des Systems und für weitreichende Annexionen ausgesprochen hatten. Auch sie mussten nach dem Umsturz vom November einen Verlust ihrer bisherigen Machtposition befürchten, da die Forderung nach Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien zu einem Kernelement des sozialdemokratischen Programms gehörte. Im Rat der Volksbeauftragten drängten die Vertreter der USPD darauf, diese Forderung möglichst rasch in die Tat umzusetzen. Ihre MSPD-Kollegen waren dagegen geneigt, die Frage der Sozialisierung zu vertagen, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg nicht durch überstürzte Experimente zu gefährden. Der Beschluss, den das Kabinett am 18. November fasste, stellte einen Kompromiss dar: Danach sollten «diejenigen Industriezweige, die nach ihrer Entwicklung zur Sozialisierung reif sind, sofort sozialisiert werden». Doch besonders eilig war es der Regierung mit der Umsetzung des Beschlusses nicht, denn gleichzeitig wurde entschieden, «eine Kommission namhafter Nationalökonomen» einzusetzen, zu der auch «Praktiker aus den Reihen der Arbeiter und Unternehmer» herangezogen werden sollten.[57] Die Kommission trat erst am 5. Dezember unter dem Vorsitz von Karl Kautsky, dem Cheftheoretiker der SPD vor 1914, der im Krieg zur USPD gewechselt war, zusammen, und ihre Beratungen schleppten sich wochenlang ergebnislos dahin.
Allerdings war zuvor bereits eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Am 15. November hatten Unternehmer und Gewerkschaften eine förmliche Vereinbarung unterzeichnet, das Stinnes-Legien-Abkommen – so benannt nach den beiden Verhandlungsführern, dem Ruhrindustriellen Hugo Stinnes und dem Vorsitzenden der Generalkommission der Gewerkschaften, Carl Legien. Darin wurden die Gewerkschaften als «berufene Vertreter der Arbeiterschaft» anerkannt und alle Beschränkungen der Koalitionsfreiheit für unzulässig erklärt. Die Arbeitgeber erkannten den Anspruch der aus dem Krieg zurückkehrenden Arbeiter auf ihren früheren Arbeitsplatz an, und sie erklärten sich auch mit der Festsetzung der täglichen Arbeitszeit auf maximal acht Stunden bei vollem Lohnausgleich einverstanden. Außerdem wurden die Regelung der Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge, die Bildung von Arbeiterausschüssen in allen Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten sowie die Einsetzung paritätischer Schlichtungsinstanzen vereinbart. Die Durchführung lag in den Händen einer «Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände Deutschlands» (ZAG).
Die Gewerkschaften feierten das Abkommen als großen Erfolg, und tatsächlich stellte es im Vergleich zu ihrer Lage im Kaiserreich einen bedeutenden sozialpolitischen Fortschritt dar. Doch der größere Nutzen lag auf Seiten der Unternehmer. Denn indem die Gewerkschaftsführer sich auf die Beibehaltung der bestehenden Wirtschaftsordnung einschließlich der privaten Verfügungsmacht über die Produktionsmittel verpflichteten, war der Forderung nach Sozialisierung der Schlüsselindustrien ein mächtiger Riegel vorgeschoben worden. In einem Rundschreiben an seine Mitglieder vom 18. November rechtfertigte der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände die Zugeständnisse an die Gewerkschaften damit, dass immer noch «in höchstem Maße zu befürchten» sei, dass die Regierung Beschlüsse zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel fassen könne. Deshalb hätte «die Stellung der Gewerkschaften, die zur Zeit den gemäßigten Flügel der Regierung vertreten, mit allen Mitteln gefestigt werden» müssen.[58]
Vom 16. bis 21. Dezember tagte in Berlin der Erste Allgemeine Kongress der Arbeiter- und Soldatenräte aus ganz Deutschland. Dazu aufgerufen hatte der Vollzugsrat am 17. November. Der Kongress sollte einerseits die Frage Nationalversammlung oder Rätesystem entscheiden und andererseits einen Zentralrat als neues oberstes Vollzugsorgan wählen.[59] Mit dem Ergebnis der Delegiertenwahlen konnten die MSPD-Volksbeauftragten zufrieden sein. Unter den 514 Abgesandten, die sich am Vormittag des 16. Dezember im Preußischen Abgeordnetenhaus versammelten, waren rund 300 der MSPD und nur gut 100 der USPD zuzurechnen, neben den übrigen – darunter Parteilose und linke Bürgerliche – stellte der Spartakusbund nur eine verschwindend kleine Zahl dar. Ein Antrag, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, «die sich um die Revolution so außerordentlich verdient gemacht haben», als «Gäste mit beratender Stimme» zuzulassen, wurde gleich zu Beginn abgelehnt.[60] Angesichts der Zusammensetzung des Kongresses stand die Entscheidung in der wichtigsten Frage von vornherein fest: Mit großer Mehrheit lehnten die Teilnehmer den Antrag ab, «an dem Rätesystem als Grundlage der Verfassung der sozialistischen Republik» festzuhalten und den Arbeiter- und Soldatenräten die höchste gesetzgebende und vollziehende Gewalt zu übertragen. Stattdessen wurde beschlossen, die Wahlen zur Nationalversammlung bereits am 19. Januar 1919 stattfinden zu lassen.[61] Das war sogar noch ein früherer Termin als der 16. Februar, auf den sich der Rat der Volksbeauftragten schließlich geeinigt hatte.
Für den Sprecher des linken USPD-Flügels, Ernst Däumig, war die «jubelnde Zustimmung zur Nationalversammlung» gleichbedeutend mit einem «Todesurteil» für das Rätesystem, und er warf den Delegierten vor, sich in einen «politischen Selbstmörderklub» verwandelt zu haben.[62] Doch war die Einführung eines «reinen» Rätesystems, wie es den linken Unabhängigen und den Anhängern des Spartakusbundes vorschwebte, von vornherein eine Chimäre. Denn die meisten lokalen Arbeiter- und Soldatenräte verstanden sich gar nicht als Alternative zu einem frei gewählten Parlament, sondern als zeitlich befristete provisorische Organe, die dazu beitragen wollten, in der Übergangszeit bis zum Zusammentritt der Nationalversammlung für geordnete Verhältnisse zu sorgen.
Bei der Wahl des Zentralrats versagten die USPD-Delegierten ihrem Parteivorstand die Gefolgschaft. Sie brachten am 19. Dezember einen Antrag ein: «Der Zentralrat hat das volle Recht der Zustimmung oder Ablehnung von Gesetzen vor ihrer Verkündung.» Damit gingen sie über einen Vorschlag Haases hinaus, der nur von einer gemeinsamen Beratung wichtiger Gesetzesvorlagen gesprochen hatte. Nachdem Ebert sich nachdrücklich dagegen ausgesprochen hatte, die Handlungsfreiheit der Regierung so weitgehend zu beschränken, wurde der USPD-Antrag abgelehnt. Daraufhin erklärten die USPD-Vertreter sich nicht an der Wahl zum Zentralrat beteiligen zu wollen. Das 27-köpfige Gremium wurde folglich ausschließlich von Vertretern der Mehrheitssozialdemokratie besetzt. Freiwillig hatte die USPD auf einen wichtigen Teil der Anfang November errungenen Macht verzichtet.[63]
Allerdings blieb die Genugtuung Eberts und seiner Mitstreiter über den Verlauf des Rätekongresses nicht ungetrübt. Denn zugleich fassten die Delegierten zwei Beschlüsse, die ihnen überhaupt nicht ins Konzept passten: Zum einen wurde die Regierung aufgefordert, «mit der Sozialisierung aller hierzu reifen Industrien, insbesondere des Bergbaus, unverzüglich zu beginnen».[64] Zum anderen wurde eine durchgreifende Militärreform verlangt, die sich an die vom Hamburger Soldatenrat Anfang Dezember verabschiedeten «Sieben Punkte» anlehnte: Die oberste Kommandogewalt sollte durch die Volksbeauftragten unter Kontrolle des Vollzugsrats ausgeübt, alle Rangzeichen – «als Symbol der Zertrümmerung des Militarismus und der Abschaffung des Kadavergehorsams» – beseitigt und die Offiziere durch die Soldaten gewählt werden.[65]
Beide Beschlüsse zeigten, dass der Wunsch nach gesellschaftlichen Strukturreformen auch unter den mehrheitlich sozialdemokratisch orientierten Delegierten lebendig war. Und sie bedeuteten zugleich eine unüberhörbare Kritik am Rat der Volksbeauftragten, der in dieser Hinsicht bislang energische Schritte hatte vermissen lassen. Die Frage der Sozialisierung war mit der Einsetzung einer Kommission zunächst einmal auf die lange Bank geschoben worden. Und in der Militärpolitik hatte Ebert von Anfang an auf die Zusammenarbeit mit der Obersten Heeresleitung gesetzt.
Der Protest der Militärführung folgte auf dem Fuße. Auf einer gemeinsamen Sitzung von Kabinett und dem neugewählten Zentralrat am 20. Dezember warnte Groener vor den «schweren Gefahren», die von den Beschlüssen des Rätekongresses drohten. Das Band zwischen Mannschaften und Offizieren würde zerrissen, die Offiziere würden «nicht mehr mitmachen wollen», eine «vollkommene Auflösung des Heeres» sei die Folge: «Ich sehe da die allerschwersten Zeiten voraus für unser Volk.» Ebert schloss sich den Bedenken an: Bei der ganzen Angelegenheit sei «etwas überstürzt und etwas übereilt gehandelt» worden. Er schlug vor, dass der Beschluss des Kongresses nur für das Heimatheer und nicht für das Feldheer gelten sollte, und dass, bevor er umgesetzt werde, «Ausführungsbestimmungen» erlassen werden müssten.[66] Wieder einmal scheuten die MSPD-Führer vor einer offenen Kraftprobe mit dem alten Offizierskorps zurück, indem sie die Entscheidung vertagten. In den «Ausführungsbestimmungen» zu den «Hamburger Punkten», die das preußische Kriegsministerium am 19. Januar 1919 erließ, sollten die beiden wichtigsten Punkte, die Frage der Kommandogewalt und der Offizierswahl, nicht mehr enthalten sein.
In den Weihnachtstagen spitzte sich die Lage in Berlin zu. Hintergrund war ein schon seit Längerem schwelender Konflikt zwischen dem Berliner Stadtkommandanten, dem MSPD-Politiker Otto Wels, und der Volksmarinedivision, einer zur radikalen Linken neigenden Truppe von 1800 Matrosen, die sich in Schloss und Marstall einquartiert hatten. Angeblich war es dort zu Plünderungen gekommen. Wels forderte den Führer der Volksmarinedivision, Heinrich Dorrenbach, auf, das Schloss zu räumen und seine Truppe auf 600 Mann zu reduzieren. Als Druckmittel behielt er die Soldzahlungen zurück, obwohl diese bereits vom Rat der Volksbeauftragten zugesagt worden waren. Das sorgte bei den Matrosen für Erbitterung. Am 23. Dezember besetzte eine bewaffnete Einheit der Volksmarinedivision vorübergehend die Reichskanzlei und kappte die Telefonleitungen. Eine andere Gruppe zog unter Führung des Kommandanten Dorrenbach zum Stadtschloss und verhaftete Wels.
In der Nacht zum 24. Dezember wurden die MSPD-Volksbeauftragten durch die Nachricht aufgeschreckt, dass Wels misshandelt werde und sein Leben bedroht sei. Daraufhin forderte Ebert vom preußischen Kriegsministerium militärische Hilfe an. Noch in der Nacht ging der Befehl an das Kommando Lequis hinaus, Schloss und Marstall zu stürmen. Jetzt sei die Situation «reif für eine große Entscheidung», notierte Harry Graf Kessler. «Wenn die Regierung Energie hat, wird sie sie benutzen, um die ganz radikalisierte Matrosendivision aus Berlin hinaus zu bringen.»[67] Doch der Angriff misslang, weil die Matrosen Unterstützung erhielten durch die Sicherheitswehr des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn und durch bewaffnete Arbeiter. Das Kommando Lequis musste den Rückzug antreten, und der Regierung blieb nichts anderes übrig, als den Konflikt mit der Volksmarinedivision durch Verhandlungen beizulegen. Insgesamt waren bei den Kämpfen um das Schloss 11 Matrosen und 56 Soldaten des Kommandos Lequis ums Leben gekommen. Die Schuld an dem Blutbad gaben die radikalen Kräfte in der Berliner Arbeiterschaft den MSPD-Volksbeauftragten. Bei der Beerdigung der gefallenen Matrosen trugen Demonstranten Schilder mit der Aufschrift: «Des Matrosenmordes klagen wir an Ebert, Landsberg und Scheidemann.»[68] Das Leichenbegräbnis sei «über Erwarten großartig» gewesen, beobachtete Harry Graf Kessler. «So weit man sehen konnte eine ungeheure Menschenmenge (…). Voran auf sieben von Kutschern des Marstalls gefahrenen kaiserlichen Wagen die sieben ganz gleichen schwarzsilbernen Särge, jeder mit Kränzen aus roten und weißen Blumen. (…) Dahinter Kränze und Blumen, alle rot oder rot gemischt mit Weiß, von Deputationen getragen in solcher Fülle, wie ich sie noch nie gesehen habe.»[69]
Die unmittelbare Folge der Berliner Weihnachtskämpfe war der Bruch der Regierungskoalition. Was die USPD-Volksbeauftragten besonders aufbrachte, war, dass ihr Koalitionspartner sie nicht einmal über den Beschluss, Militär gegen die Matrosen einzusetzen, informiert hatte. In ihren Augen hatten sich die MSDP-Führer damit endgültig in die Abhängigkeit von der Heeresleitung begeben. Die Vorgänge zeigten, so kritisierte Wilhelm Dittmann in der Sitzung von Kabinett und Zentralrat am 28. Dezember, «wie gefährlich es ist, mit einer Militärmacht arbeiten zu wollen, die aufgebaut ist auf die alte Generalität und das alte Heer (…)». Und Emil Barth fragte: «Kann eine sozialistische Regierung sich überhaupt auf die Macht der Bajonette stützen? Muss sie sich nicht auf das Vertrauen des Volkes stützen?»[70] Nachdem der Zentralrat die Frage der Unabhängigen, ob er die Weisung der drei MSPD-Volksbeauftragten an den Kriegsminister billige, bejaht hatte, erklärten Haase, Dittmann und Barth am 29. Dezember ihren Austritt aus der Regierung.
Die MSPD-Führung hatte nun freie Hand, um ihre politischen Vorstellungen durchzusetzen. «Die lähmende Zwiespältigkeit ist überwunden», hieß es in einem Aufruf der Regierung vom selben Tag.[71] An die Stelle der drei ausgeschiedenen USPD-Volksbeauftragten rückten zwei Vertreter der MSPD nach: der Gewerkschaftssekretär Rudolf Wissell, zuständig für Sozial- und Wirtschaftspolitik, und der Militärexperte Gustav Noske, der das Ressort «Militär und Marine» übernahm. Noske war in den ersten Novembertagen nach Kiel entsandt worden, und er hatte hier mit großer Energie dafür gesorgt, die Revolution in ein ruhiges Fahrwasser zu lenken. Der neue Mann müsse «ein Fell wie ein Rhinozeros haben» erklärte Scheidemann in der nächtlichen Sitzung von Kabinett und Zentralrat am 28./29. Dezember.[72] Offensichtlich erfüllte Noske in den Augen seiner MSPD-Kollegen dieses Anforderungsprofil.
«Die Luft ist wie elektrisch geladen, eine politische Hochspannung ohnegleichen. Der Boden von Berlin glüht. So ist das alte Jahr zu Ende gegangen: in fiebernder Erregung», schilderte der Berichterstatter des «Berliner Tageblatts» am Silvesterabend die Stimmung in der Reichshauptstadt. Gleichzeitig aber konstatierte er verwundert die Ausbrüche einer ungehemmten Vergnügungssucht. «Aber schon zieht das Konfetti sorgloser Silvesterbrüder seine Schlangen, und lebenshungrige Männer und Mädchen tanzen in das neue Jahr. Die Musik spielt in hunderten von Lokalen. Tänze über Tänze, Walzer, Foxtrott, Onestep, Twostep, und die Beine rasen wie verhext über die Diele, die Röcke fliegen, der Atem jagt, Sektpfropfen knallen (…). Nie ist in Berlin so viel, so rasend getanzt worden.»[73]
Die Tanzwut grassierte auch in der Provinz. «Die breite Masse hat doch entsetzlich wenig Gefühl für das, was wir erleben. Man beginnt, die Nächte durchzutanzen, als sei nichts geschehen», klagte Karl Hampe, und er beschloss seinen Tagebucheintrag am Silvesterabend: «In so trüber Stimmung hat man noch nie den Wechsel des Jahres begangen.»[74] «Letzter Tag dieses furchtbaren Jahres», notierte Harry Graf Kessler. «1918 wird wohl ewig die schrecklichste Jahreszahl der deutschen Geschichte bleiben.»[75] So wie er empfanden viele Vertreter des Bildungsbürgertums, die nicht verwinden konnten, wie rasch und widerstandslos der alte monarchische Obrigkeitsstaat zusammengebrochen war, und die der neuen demokratischen Ordnung noch mit Skepsis begegneten. «Der ungeheuren Umwälzung stehe ich halb stumpf, halb angeekelt gegenüber, demokratisch nicht im entferntesten», zog der in München (ab 1920 in Dresden) lehrende Romanist Victor Klemperer am Jahresende Bilanz.[76] Ähnlich lautete das Resümee des Historikers Gustav Mayer, der der Mehrheitssozialdemokratie nahestand: «Dieser Zusammenbruch ist ja nicht nur der einer herrschenden Schicht, eines politischen Systems, er ist zugleich der moralische Zusammenbruch eines ganzen Volkes, ein Schwanken aller seiner Maßstäbe, eine Erschütterung aller seiner Werte, eine Infragestellung aller sittlichen Beziehungen, aller Pflichtenverknüpfung; wir leben am Tage nach einem beispiellosen Erdbeben, ungewiss, ob der letzte Stoß schon der schwerste war, ob es also einen Sinn hat, an den Wiederaufbau der Trümmer zu gehen.»[77] Hedwig Pringsheim, die Schwiegermutter Thomas Manns, beschloss ihren Tagebucheintrag am Silvesterabend 1918: «Wir treten ein ins neue Jahr, in allen Grundfesten unsrer Existenz erschüttert, ungewiss und ratlos: nach dem verlorenen Krieg das Chaos.»[78] Vom Zauber des Anfangs war wenig übriggeblieben.
Einen anderen Anfang wagten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Am 30. Dezember begann im Festsaal des Preußischen Abgeordnetenhauses der Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands. 127 Delegierte aus 56 Orten Deutschlands kamen zusammen – davon mehr als ein Drittel Mitglieder des Spartakusbundes und knapp ein Drittel Mitglieder der Internationalen Kommunisten Deutschlands, die aus der Gruppe der Hamburger und Bremer Linksradikalen im Ersten Weltkrieg hervorgegangen waren.[79] Die Zusammensetzung der Delegierten war recht heterogen. Neben älteren Funktionären, die noch aus der Tradition der Vorkriegssozialdemokratie kamen, saßen junge Arbeiter und Arbeiterinnen sowie Intellektuelle, die erst durch das Erlebnis des Krieges und der Revolution radikalisiert worden waren. Ihnen fehlte es nicht an revolutionärem Schwung, wohl aber an einer nüchternen Einschätzung der politischen Möglichkeiten. Das zeigte sich bereits in der Frage, ob sich die Kommunisten an den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar beteiligen sollten. Die Stimmung in der Versammlung war deutlich für eine Nichtbeteiligung.
Mit ihrer ganzen Autorität stemmte sich Rosa Luxemburg dagegen. «Ich habe die Überzeugung», rief sie den Delegierten zu, «Ihr wollt Euch Euren Radikalismus ein bisschen bequem und rasch machen.» Die Massen müssten erst noch geschult werden, bevor man an den Sieg des Sozialismus denken könne. «Das wollen wir durch den Parlamentarismus erreichen.» [80] Ihre Kampfgefährtin Käte Duncker unterstützte sie: Man müsse doch auch daran denken, dass die Hälfte der Wähler Frauen sei, die zum ersten Mal ihr Wahlrecht ausüben könnten. «Glauben Sie, dass die Frauen, nachdem man ihnen Jahrzehnte hindurch gesagt hat, ihr müsst dieses Recht erkämpfen, dass sie uns jetzt folgen werden, wenn wir ihnen sagen, benutzt es nicht?»[81] Es half alles nichts: Am Ende beschloss der Parteitag mit 62 gegen 23 Stimmen, die Empfehlung der Spartakus-Führung zurückzuweisen und die Wahl zur Nationalversammlung zu boykottieren. Ihre Freundin Clara Zetkin, die sich über den Beschluss entsetzt zeigte, beruhigte Rosa Luxemburg: «Unsere ‹Niederlage› war nur der Triumph eines etwas kindischen, unausgegorenen, gradlinigen Radikalismus. (…) Vergiss nicht, dass die ‹Spartakisten› zu einem großen Teil eine frische Generation sind, frei von den verblödeten Traditionen der ‹alten bewährten› Partei – und das muss mit Licht- und Schattenseiten genommen werden.»[82]
Ahnungsvoll hatte Karl Liebknecht auf dem Parteitag davon gesprochen, dass schon die nächsten Tage «Überraschungen bringen» und die Ereignisse «über die Köpfe der sogenannten Führer hinweg» gehen könnten.[83] Eben das passierte mit den Berliner Januarunruhen 1919, die fälschlicherweise als «Spartakusaufstand» in die Geschichtsbücher eingegangen sind.[84] Auslöser war die Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn am 4. Januar. Eichhorn gehörte dem linken USPD-Flügel an, und er besetzte eine der letzten Positionen, welche die MSPD-Führung noch nicht unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Hier verübelte man ihm besonders, dass er bei den Weihnachtskämpfen um das Stadtschloss seine Sicherheitswehr zugunsten der Volksmarinedivision eingesetzt hatte. Für die radikalen Kräfte in der Berliner Arbeiterschaft war die Entlassung Eichhorns eine Provokation. Gemeinsam riefen der USPD-Vorstand, die Revolutionären Obleute und die KPD-Führung zu einer Protestkundgebung am 5. Januar auf. Es kamen mehr Menschen, als die Veranstalter erwartet hatten. Die «Rote Fahne» sprach vom «gewaltigsten Massenaufgebot, das das Berliner Proletariat bis jetzt auf die Beine gebracht hat».[85]
Doch noch während der Demonstration gerieten die Ereignisse außer Kontrolle. Gruppen bewaffneter Revolutionäre besetzten die Druckereien des «Vorwärts» und des «Berliner Tageblatts» sowie die Verlagshäuser von Mosse, Scherl und Ullstein im Berliner Zeitungsviertel. Dieser ungeplanten Aktion schloss sich am Abend die improvisierte Bildung eines «Revolutionsausschusses» an, in dem Georg Ledebour für die USPD-Linke, Karl Liebknecht für die KPD und Georg Scholze für die Revolutionären Obleute den Vorsitz übernahmen. Unter dem Eindruck der aufgewühlten Stimmung beschloss eine Mehrheit, die Berliner Arbeiter zum Generalstreik aufzurufen und den Kampf bis zum Sturz der Regierung voranzutreiben. Darüber, wie dieser Beschluss in die Tat umzusetzen sei, herrschte jedoch vollkommene Unklarheit. Das ganze Unternehmen war ein gefährliches Abenteuer, an dessen Scheitern es von Anfang an keinen Zweifel geben konnte. Selbst Rosa Luxemburg, die putschistische Aktionen grundsätzlich ablehnte, ließ sich von der Euphorie anstecken und drängte auf energisches Handeln.[86]
Am 6. Januar waren noch mehr Menschen auf den Straßen als zuvor. Doch an diesem Tag hatte auch die Regierung ihre Anhänger mobilisiert, und auch diese Demonstration wies eine Massenbeteiligung auf. Als der Revolutionsausschuss am Abend zusammenkam, war die euphorische Stimmung des Vortags bereits verflogen. Selbst die Volksmarinedivision hatte inzwischen ihre Unterstützung zurückgezogen. Die meisten Initiatoren des Aufstands waren nur noch darauf aus, sich einigermaßen glimpflich aus der Affäre zu ziehen, ohne dass es zur gewaltsamen Konfrontation kam.
Doch die Regierung war entschlossen, die Herausforderung anzunehmen und ihr mit aller Härte zu begegnen. Diesmal sollte ein Exempel statuiert und mit allen verfügbaren militärischen Mitteln «Ruhe und Ordnung» in Berlin wiederhergestellt werden. «Meinetwegen! Einer muss der Bluthund werden, ich aber scheue die Verantwortung nicht!», mit diesen Worten übernahm Noske den Oberbefehl über die Regierungstruppen in und um Berlin.[87] Er schlug sein Hauptquartier in einem leerstehenden Mädchenpensionat in Berlin-Dahlem auf und sammelte hier Formationen von Freiwilligen, die sogenannten Freikorps, mit deren Aufstellung bereits am 3. Januar, also noch vor Beginn des Aufstands, begonnen worden war. «Wir sind dabei, die Kräfte zu schaffen, die zur Herstellung der Ordnung ausreichen», gab Ebert am 7. Januar im Kabinett bekannt.[88] Ein am gleichen Tag von führenden USPD-Persönlichkeiten wie Karl Kautsky unternommener Versuch zu vermitteln, scheiterte an der Bedingung der MSPD-Volksbeauftragten, dass vor allen Verhandlungen die besetzten Pressehäuser geräumt werden müssten.
Januarunruhen 1919 in Berlin: Aufständische verschanzen sich im Berliner Zeitungsviertel hinter Barrikaden aus Papierrollen und Zeitungspaketen.
Am 11. Januar begannen Regierungstruppen den Sturm auf das «Vorwärts»-Gebäude. Fünf Besetzer, die als Parlamentäre über die Bedingungen eines Abzugs verhandeln wollten, wurden festgenommen und zusammen mit zwei weiteren Gefangenen erschossen – die erste in einer Reihe von Gräueltaten, die ungesühnt blieben.[89] Noch am selben Tag marschierte Noske an der Spitze von 3000 Soldaten durch die Innenstadt zur Wilhelmstraße, um zu demonstrieren, dass die Regierung Herr der Lage war. Am 12. Januar wurden auch die übrigen besetzten Gebäude zurückerobert. Der dilettantisch begonnene und nur halbherzig durchgeführte Aufstand fand ein blutiges Ende. «Heute Vormittag sieht der Potsdamer Platz aus wie an einem Friedenssonntag», konstatierte Harry Graf Kessler. «Von Revolution keine Spur. Berlin erwacht aus einem hitzigen Fieber zur Wirklichkeit, die traurig ist.»[90]