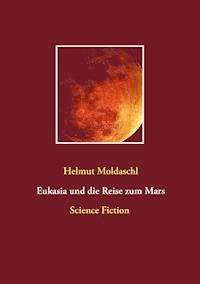Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Am Freitag, dem 10. September 2004 hatte ich es erfahren. Nun begann ein monatelanges Ringen um das Leben. Die Operation im Oktober und eine direkt nachfolgende Chemotherapie. Im September aber hatte ich mich bereits auf die Normalität ausgerichtet. Mit alltäglicher Ernährung, langen Radreisen, aber auch konsequenten medizinischen Untersuchungen, deren Ergebnisse freilich nicht immer ganz zufriedenstellend waren. Wenn Sie oder Freunde betroffen sind, dann rate ich ihnen, keine Zeit zu verlieren mit nutzlosen Versuchen. Vergessen Sie alle Homöopathen, vergessen Sie Mistel-Therapien oder Selen-Tabletten, sondern suchen Sie einen hervorragenden Chirurgen auf, den besten den Sie kriegen können. Dann werden Sie es schaffen. Andernfalls werden Sie sterben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinem Professor Werner Hohenberger
Meiner Tochter Caroline
Meinem Freund Axel + 2018
Inhalt
Geleitwort
Danksagung
Die Krankheit
Das Buch als Hilfe
An der Donau im Sommer 1946
Wieso gerade ich?
Für Vorzeichen keine Zeit
Mein Magen wird rabiater
Schlimm und schlimmer
Der Besuch beim Hausarzt
Mein zehnter September
Am Großglockner
Nach dem Todesurteil
Konfusion
Ein Engel reist an
Die Audienz
Vorbereitung auf die Klinik
Es geht los: Chirurgie Teil I
Die Weinfahrt durch Franken
Die ersten Untersuchungen
Zurück auf die Station
Der erste Morgen im Krankenhaus
Die Visite
Vorbereitung auf die erste Operation
Ausflug in die Freiheit
Ein Besuchssonntag
Begegnung der dritten Art
Der Anästhesist
Die Bauchspiegelung
Die Diagnose
Gegenwind am Altrhein
Staging nach Diagnose Nr 2
Neuer Anlauf
Die Stewardessen der Klinik
Der Versuch mit dem Stent
Begegnung mit meinem Onkologen
Der neue Anlauf der Onkologen
Das Venöse Portsystem
Die Ernährungsberaterin
Radfahrt Nürnberg - Cannes
Vor dem Zweiten Akt
Das Einsetzen des Venösen Portsystems
Die Chemotherapie Teil I
Ein schlimmer Rückschlag
Die Klebung der Magenblutung
Die künstliche Ernährung
Joyce und Mozart
Der Maurer – Ein Zimmerkollege
Eine Lichtgestalt
Ordnung Zeit Kausalität
Der Besuch eines Freundes
Chirurgie Teil II
Die Frau des Polizisten
Der Direktor – Ein Zimmerkollege
Die Operation
Ein Ausflug in die Ferne
Die Rückkehr ins Leben
Der Projektfortschritt
Der Stapellauf
Der gute Rat des Professors
Chemotherapie Teil II
Der Professor und ich
Medizinisches Glossar
Geleitwort
Der Magenkrebs stellt trotz generell abnehmender Anzahl der Neuerkrankungen, allerdings bei relativer Zunahme der Tumorlokalisation im oberen Magendrittel, weltweit weiterhin eine der häufigsten Todesursachen unter den bösartigen Tumoren dar.
Somit hat sich in den letzten 20 Jahren die Gesamtprognose trotz Steigerung der kompletten Tumorentfernung (Ro-Resektion) bei gleichzeitiger Senkung der postoperativen Sterblichkeit nicht entscheidend verbessern lassen. Vor allem ist diese Tatsache darauf zurückzuführen, dass in der westlichen Welt auch bei allen Fortschritten in der modernen Medizin mit Einsatz erweiterter diagnostischer Maßnahmen zum Zeitpunkt des Therapiebeginns etwa zwei Drittel der Patienten ein lokal fortgeschrittenes bzw. metastasiertes Tumorstadium aufweisen. Im Gegensatz dazu werden z. B. in Japan in mehr als 60 Prozent der Fälle Magenfrühkarzinome nachgewiesen.
Trotzdem ist die Diagnose Magenkarzinom nicht zwangsläufig mit einem Todesurteil zu vergleichen, wie es der Autor dieses Buches als direkt Betroffener beschreibt. Sicherlich sind die Sorgen und Ängste eines Patienten und der direkten Angehörigen in einer solchen Ausnahmesituation nur zu verständlich, um so mehr, wenn man sich bei einer sehr differenzierten Persönlichkeitsstruktur in den modernen Medien entsprechend weiter informiert und logischerweise die Angaben zu dieser Erkrankung als Nichtmediziner in Relation zu den eigenen Erfahrungen aus den Naturwissenschaften setzt.
Solche Schlussfolgerungen sind aber äußerst problematisch bzw. zu pessimistisch, da sich die Behandlung des Magenkarzinoms in einem Umbruch befindet, mit dem Ziel, den Patienten möglichst individuell optimale Therapieverfahren anbieten zu können. Dieses gilt sowohl für die lokal kurativen Maßnahmen in frühen Tumorstadien als auch für die mehrschichtigen Behandlungsansätze (Chemotherapie, ggf. Strahlentherapie einschließlich Operation) bei fortgeschrittenen Tumoren. Grundvoraussetzung für eine solche maßgeschneiderte Behandlung ist die möglichst exakte Erfassung des jeweiligen Krankheitsstadiums durch eine erweiterte Diagnostik, z. B. der vorgeschalteten Bauchspiegelung. Durch eine solche Untersuchung kann auch die Indikation zum Einsatz einer präoperativen (Neoadjuvanten) Chemotherapie gestellt werden. Angestrebt wird dabei eine Verkleinerung des Magenkrebses, damit eine vollständige Entfernung des Tumors möglich wird. Bisher vorliegende Ergebnisse zu diesem Vorgehen haben gezeigt, dass bei effektiver lokaler Tumorkontrolle – dies beinhaltet unverändert die Durchführung einer Ro-Resektion – und gleichzeitiger Kontrolle okkulter (verborgener) Tumorabsiedlungen die Prognose verbessert werden kann. Diesen Prozeduren hat sich der Autor unter Toleranz aller Nebenwirkungen unterzogen und erfreulicherweise konnte der Magenkrebs komplett operativ entfernt werden.
Helmut Moldaschl beschreibt in außerordentlich eindrucksvoller Weise die persönlichen Empfindungen und das Wechselbad zwischen Ängsten und Hoffnungen bei Konfrontation mit der Diagnose Magenkarzinom. Imponierend ist dabei die Darstellung zur Aufnahme des Kampfes gegen den Krebs („Sparringspartner“), gestärkt durch die Unterstützung der Familie und enger Freunde.
Der Wille zur Bewältigung der Erkrankung und Wiedererlangung der Leistungsfähigkeit hat siegen können: Der beste Beweis sind die Fotografien der postoperativ durchgeführten Fahrradtouren.
Nicht nur die in der Onkologie tätigen Ärzte, sondern auch andere Betroffene und deren Angehörige werden sich von den Aufzeichnungen im vorliegenden Buch angesprochen fühlen; besonders von der Tatsache, dass es sich zweifelsohne lohnt, den Willen aufzubringen, mit entschlossener Konsequenz gegen die Erkrankung Magenkrebs zu kämpfen, um dann auch eine entsprechende Lebensqualität, vor allem mit dem Grundbedürfnis einer oralen Nahrungsaufnahme, wiedererlangen zu können.
Hans-Joachim Meyer
Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. H.-J. Meyer war langjähriger Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Städtischen Klinikum Solingen. Seit August 2012 ist er Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin.
E-Mail: [email protected]
Internet:www.dgch.de
Danksagung
Viele Personen, auch viele unbekannte, haben dazu beigetragen, dass ich nun, fast vierzehn Jahre nach der verheerenden Diagnose wieder fit bin und ein normales Leben führen kann.
Ihnen allen bin ich unendlich dankbar:
Meiner Tochter, die in der kritischsten Phase Ruhe bewahrt, meine nervlich zerrüttete Frau aufgerichtet und mich dem alles entscheidenden Chirurgen zugeführt hat. Hätte sie das nicht getan, wäre ich nicht mehr am Leben,
Florian, einem Freund meiner Tochter, der mir in den ersten Tagen und auch später mit Rat und Tat beigestanden hat,
meiner lieben Frau, die das alles viele Wochen ertragen und mir selbstlos beigestanden hat. Für sie und meinen Sohn muss es unendlich schwer gewesen sein, in meiner Gegenwart ruhig zu wirken, kräftezehrende Ereignisse von mir fern zu halten und mich zu unterstützen, ohne die weitere Entwicklung der Situation und ihren Ausgang zu kennen,
meinen Onkologen, die mit ihrer Einschätzung, dass eine weitere medizinische Behandlung ohne eine Operation chancenlos sein würde, diesen lebensrettenden Eingriff durchgesetzt und mir während der Zeit der Chemotherapie mit Sachverstand und Ruhe geholfen haben. Mit ihnen habe ich bis jetzt sehr persönlichen Kontakt,
den Schwestern, Helfern und Assistenzärzten von Chirurgie und Innerer Medizin, die mich in dieser Zeit betreut und mir stets Hoffnung signalisiert haben.
Ich danke Ludwig Köppen, dem Autor des Buches ‚Mozarts Tod’, der mich bis zu seinem Tod oft in der Klinik angerufen und mir stets Hoffnung gemacht hat,
meinem Freund Max, der mich in besonders hoffnungslosen Zeiten besucht und mich beraten hat. Meinem Jugendfreund Heinz, dem ich mich in einer schweren Stunde anvertraut habe und der mir Hoffnung zugesprochen hat,
meinem Schwiegervater, der mit seinen damals 95 Jahren seine Tochter jeden Tag aus Österreich angerufen und sie immer wieder aufgerichtet hat,
allen, die gedanklich bei uns waren, meine Angehörigen unterstützt und ihnen Last von ihren Schultern genommen haben.
Ich danke meinem Freund Axel, der sich ungemein geduldig die fortwährende Schilderung meiner Befindlichkeit angehört und mich nach meiner Krankheit auf unseren Radtouren durch Deutschland, die Schweiz, Italien und Frankreich begleitet hat. Er ist vor kurzem durch einen überaus tragischen Vorfall gestorben.
Und da ist, vor allen, mein Chirurg, Professor Hohenberger.
Mit seinen überragenden Fähigkeiten hat er mein Leben gerettet. Wohl kaum jemand auf der Welt außer ihm, es wurde mir mehrfach bestätigt, wäre in meinem schrecklich fortgeschrittenen Zustand noch erfolgreich gewesen. Man kann heute sagen, dass er mich geheilt hat, auch wenn man bei Krebs mit einer solchen Feststellung nicht hoffärtig umgehen sollte.
Es war mir stets ein Bedürfnis, ihm von jeder meiner Radreisen eine Karte zu schreiben. In persönlichen Sprechstunden haben wir einiges voneinander erfahren und mittlerweile arbeiten wir an einem gemeinsamen Buch, das die Ansichten von Ärzten und Patienten beschreiben wird.
Die Krankheit
2004 erhielt ich die Diagnose: Magenkrebs.
Es gibt keine Verniedlichung dieser Krankheit, denn das Leben hat damit eine neue, bisher nicht gekannte Wendung erhalten.
In jedem Fall werden Sie bilanzieren. Wie lange wird es noch dauern. Wie wird es zu Ende gehen. Was und wie wird es geschehen. Was wird mit den Angehörigen sein. Habe ich noch eine Chance.
Es wird eine direkte Auseinandersetzung mit dem Tod werden. Fragen über Fragen werden kommen. Unsicherheit. Angst. Der Boden wird Ihnen unter den Füßen weggezogen. Sie werden feststellen, dass alles auf dieser Welt nur geliehen ist, werden alles hinterlassen müssen, von dem Sie gemeint haben, sich niemals davon trennen zu können.
Ab jetzt ist die Frage nicht mehr ob, sondern wann wir sterben müssen. Auch Axel musste es völlig überraschend vor einigen Wochen.
Doch selbst wenn Ihre Chancen noch so gering scheinen, vielleicht als miserabel eingeschätzt werden, durch Verwandte, Bekannte, Besserwisser, Fachleute – niemand von ihnen weiß wirklich, was geschehen wird.
Chancen wird es immer geben, auch wenn die Sache noch so trist aussieht. Sonst würde ich nicht mehr leben.
Das Buch als Hilfe
Krebs ist schrecklich. Man nimmt ihn als existentielle Bedrohung wahr. Als Todesurteil. Man spürt sofort, dass es jetzt ums Ganze geht. Geist und Körper laufen Gefahr, völlig unterminiert zu werden. Und doch wird manches anders sein, als gemeinhin dargestellt. Es wird über diese Krankheit so viel geredet und so wenig gesagt.
Die meisten möchten damit nichts zu tun haben, möchten nicht einmal darüber sprechen, denn sie wollen sich nicht anstecken. Krebs aber ist eine ansteckende Krankheit, denn Angst ist ansteckend.
Es gibt zahllose wissenschaftliche Abhandlungen, mit denen ein verschreckter, eingeschüchterter, demoralisierter Patient nur wenig anfangen kann. Es ist schwierig, kompetente Ansprechpartner zu finden, kaum welche, die Ihnen nach ihrer Krankheit oder währenddessen etwas erzählen möchten. Sie ziehen sich lieber in ihr Gehäuse zurück.
Für mich hingegen war es wichtig über meine Befindlichkeiten erzählen zu können. Diese Haltung hat mir geholfen, die vielen kritischen Phasen psychisch unbeschadet zu überstehen. Auch wenn ich Naturwissenschaftler bin, meine ich, dass wir viele Dinge nicht rational erklären können. Die Psyche muss deshalb in diesem Fall besonders gestützt werden.
Ich werde also frank und frei erzählen. Das Buch beschreibt, wie ich erkennbare Chancen ergriffen habe, es enthält natürlich auch persönliche Details. Ohne solche Freiheiten wäre eine authentische Beschreibung der Ereignisse nicht möglich. Um die persönliche Sphäre von Dritten zu wahren, habe ich Beteiligte und Orte so weit es möglich und nötig war anonymisiert und einige Erfahrungen und Begegnungen sogar weggelassen, weil sie zu persönlich gewesen wären. Damit wollte ich verhindern, dass Erfolge oder Misserfolge, Vorteilhaftes oder weniger Vorteilhaftes aus dem Zusammenhang gerissen oder gar falsch interpretiert werden.
Jeder Krebsfall sei anders wurde mir von erfahrenen Leuten bedeutet, deshalb könne meine Geschichte grundsätzlich nur eine Singularität in der Dimension des unerfreulichen, aber durchaus interessanten medizinischen Gebietes sein. Das ist richtig, und wahrscheinlich wird mein Fall mit Ihrem Anliegen, Ihrer konkreten Situation, Ihrer Krankheit nicht in allen Belangen übereinstimmen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es viele allgemeine und vor allem wichtige Elemente gibt, deren Beschreibungen auch auf Sie zutreffen.
Ich kann mir gut vorstellen, wie es Ihnen geht. Jetzt, wo Sie Ihre Diagnose haben. Nur jemand, der das selbst erlebt hat, kann es verstehen. Kein Arzt. Kein Psychiater. Kein Freund. Nicht der Partner. Niemand. Vielleicht die eigene Mutter. Aber auch da bin ich mir nicht mehr sicher. Darum will ich Ihnen nichts vorjammern, denn es gibt genügend Jammerliteratur. Sie sollen sich auch nicht durch viele Seiten hindurchquälen müssen, um letztendlich das Ergebnis zu erfahren. Da eine solche Krankheit die Bedeutung der Lebensereignisse und die Zeit, in der sie stattgefunden haben, in hohem Maße verwischt, werde ich den Verlauf der Krankheit nicht durchgehend chronologisch beschreiben. Die Hoffnungslosigkeit mancher Situationen wird in einer solchen Darstellung durch die positiven Ergebnisse der tatsächlichen Entwicklung relativiert, die Hoffnung gestärkt, und sie ist in allen ernsten Krankheitszuständen ein wichtiges Element zur deren Bewältigung und Heilung.
Sie sollen also schon vorher erfahren, dass es gut ausgegangen ist. Damit soll Ihre Hoffnung gestärkt werden, dass es auch bei Ihnen durchaus so sein kann.
Zu Ihrer Orientierung: Am Beginn jedes Kapitels wird ein ungefährer Zeitpunkt des Ereignisses stehen. Manche Zeitangaben sind genauer, andere vage, denn ich habe kein Tagebuch geführt, sondern mir nur gelegentlich Notizen gemacht, vor allem um keine wichtigen Termine zu vergessen. Ich habe mit dem Buch unmittelbar nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus begonnen. Im Februar 2007 war ich damit schon fast fertig, dann habe ich es ein Jahr liegen lassen. Warum weiß ich heute nicht mehr. Während es entstanden ist, habe ich bereits intensiv Sport betrieben, Wanderungen und unter anderem mehrere lange Reisen mit dem Rad unternommen. Dabei ist der Gedanke gereift, dem Leser zu zeigen, was er neben den Schrecknissen einer solchen Krankheit später auch an Positivem erwarten kann.
Heute geht es mir sehr gut. Ich bin fit, dreifacher Großvater, die Enkelkinder gehen zur Schule. Die ehemaligen Reflux-Erscheinungen, eine Folge des massiven Eingriffs am Bauchfell, sind nach Jahren praktisch verschwunden und ich brauche auch keine Medikamente mehr.
Doch überall Menschen sind zugange und daher kann für keine medizinische Aktion eine Erfolgsgarantie gegeben werden. Der Erfolg, den alle Beteiligten mit ihrer Arbeit, ihrem Wissen und ihrer Einsatzbereitschaft bei mir erreicht haben, spricht uneingeschränkt für sie.
An der Donau im Sommer 1946
Als ich noch klein war, ist meine Großmutter manchmal mit mir an die Donau gegangen.
Wir haben auf der linken Seite des Stromes gewohnt. Das Stadtzentrum Wiens mit dem Stephansdom, dem Parlament, der Universität, der Oper und dem Burgtheater und vor allem dem Riesenrad befinden sich auf seiner rechten Seite. Die Donau in Wien ist ein eindrucksvoller Strom – breit und schnell und unbezwingbar. Wir sind fast immer in der Nähe des Ufers gelaufen. Großmutter hat mir dabei eingeschärft, niemals zu nahe ans Wasser zu gehen: „Wenn du hineinfällst, bist du verloren“, hat sie gesagt.
Die Leben der Donau hat mir Respekt eingeflößt. Man hörte den Lärm der zahllosen Steine, die sie auch heute noch vor sich hertreibt. Ich hatte selbst welche hineingeworfen und beobachtet, wie sie verschwanden. Was würde ihr Schicksal sein? Würden sie bis ins Schwarze Meer geschoben, das doch unendlich weit weg war und über das mir mein Vater oft erzählte? Ich hatte mir also viele Gedanken über diese Steine am Grund der Donau und ihren Weg gemacht. Wie lange würde es wohl dauern bis so ein Stein das Schwarze Meer erreichte?
Ich habe zugeschaut, wie die Boote am Ufer ihre Netze in das Wasser gesenkt und sie nach einiger Zeit herausgezogen haben. Man musste geduldig warten, bis die Netze wieder an die Oberfläche kamen. Für einen kleinen Jungen waren einige Minuten eine lange Zeit. Manchmal waren dann Fische im Netz. Sie sprangen wild herum, um wieder ins Wasser zu kommen und taten mir dabei sehr leid. Es musste ein großes Unglück für einen so kleinen Fisch sein, aus diesem riesigen Strom mit einem Netz herausgefischt zu werden.
Warum gerade ich, musste sich der gefangene Fisch fragen, warum wurde gerade ich herausgefischt? Aber es hatte ihm selten geholfen. Er hatte sich einfach seinem Schicksal zu fügen.
Ich war schon einige Male mit meiner Mutter auf der anderen Seite der Donau in der großen Stadt gewesen, aber noch nie auf dem Ufer direkt gegenüber.
Dieses andere Ufer des Stromes war für geheimnisvoll. Man sah den Leopoldsberg mit seiner Kirche, die Hügelkette vom Kahlenberg bis zum Anninger und wenn schlechtes Wetter im Anzug war sah man sogar den Schneeberg. Da waren aber auch dieses große Haus da drüben und eine kleine Siedlung, das Kahlenbergerdörfl, eine Straße auf der Leute gingen und manchmal Autos fuhren. Dieses andere Ufer schien mir unerreichbar weit weg, und es hatte mich immer eine merkwürdige Sehnsucht danach erfasst. Dort drüben war eine andere, unbekannte, unerreichbare Welt. Ob ich jemals diese Welt erreichen würde, dachte ich mir.
Während der Zeit im Krankenhaus musste ich oft an die Donau und an meine Großmutter denken. Irgendwie war ich auf diesem anderen Ufer gelandet. Wie interessant war die Sicht aus dieser völlig anderen Welt auf meine gewöhnliche. Bevor ich dieses andere Ufer betreten hatte, war mir vieles entgangen.
Nun kann ich über dieses andere Ufer erzählen. Die Menschen haben Angst vor diesem Ufer, weil sie sich vor allem fürchten, was sie nicht kennen. Dieses jenseitige Ufer ist nicht schrecklich. Es ist nur ungewöhnlich und es ist sehr interessant.
Wieso gerade ich?
Es gab keinen eigentlichen Beginn meiner Krankheit. Oder vielleicht doch und ich habe ihn nur nicht wahrgenommen. Vielleicht wollte oder konnte ich ihn auch nicht bemerken. Vielleicht waren es zunächst zu kleine Veränderungen, auf die ich hätte achten sollen. Vielleicht haben andere es mitbekommen, es mir aber nicht gesagt. Vielleicht waren es der Beruf, das Essen, das Umfeld, vielleicht nur nebensächliche, alltägliche Gewohnheiten. Stress. Ärger. Vielleicht hätte man, hätte man sollen, hätte man nicht dürfen, hätte man müssen ...
Vielleicht hätte man alles auch vermeiden können, indem man zur sogenannten Vorsorge ging. Ich war niemals bei der Vorsorge. Vor-Sorge war für mich stets gleichbedeutend mit Sorge, um die eigene scheinbar unverbrüchliche Gesundheit, die gar nicht das war, für das man sie stets gehalten hatte.
Und nun hatte ich mir zunächst natürlich Vorwürfe gemacht. Andererseits hatte man mir später versichert, dass eine Vorsorge damals auch nichts geholfen hätte, weil sie die Situation eben nicht rechtzeitig zutage gefördert hätte, denn der Tumor hatte sich schließlich schon ansehnlich entwickelt.
Vielleicht wäre ich gar nicht mehr am Leben, wenn ich zur Vorsorge gegangen wäre, denn letztendlich hatte sich ja ohnedies alles nahtlos zum Guten gefügt. Und wäre es mit der Vorsorge abgelaufen?! Wer weiß das schon. Niemand konnte es wissen, denn niemand kann zweimal dasselbe Leben leben.
Einerseits war da also der Schleier der Ungewissheit, der sich über die Versäumnisse der Vergangenheit gelegt hatte, andererseits die Gewissheit dieser schrecklichen Krankheit und eines zweifelsfrei lebensbedrohlichen Zustands.
Dazu gab es keine Ausrede mehr, keine Ausflucht. Der Zustand war respektlos definitiv, verbunden mit der ebenso respektlosdefinitiven Aussicht, dass nun alles bald zu Ende sein könnte oder sogar sein würde.
Verbunden mit Unsicherheit und Angst, ob und wie man mit all dem fertig würde, was nun auf einen zukäme, wo man doch schon so viel Fürchterliches darüber gehört hatte. Verbunden mit der Furcht vor diesen vielen unbekannten Maßnahmen, die auf einen warteten, der Furcht vor dem Krankenhaus, der Operation, der Chemotherapie – den Torturen. Verbunden mit der Frage, wie lange der Todeskampf dauern würde. Jahre, Monate, Wochen? Und was dann mit den Angehörigen würde. Mit der Frau, den Kindern.
Es war wie die Begegnung mit einem Raubtier im ruhigduftenden Wald scheinbar immerwährender Gesundheit, und die Ungewissheit, was alles in der unmittelbaren und in der ferneren Zukunft sein würde. Das alles war für mich zunächst mindestens genau so belastend wie die Krankheit selbst.
Ich hatte demzufolge beschlossen, alle kräftezehrenden Einflüsse so weit wie möglich zu identifizieren, zu analysieren und zu eliminieren und alle meine physischen und psychischen Kräfte für den Ringkampf mit meinem neuen, ungebetenen Gast Krebs einzusetzen.
Diesen ungewollten Besucher habe ich damals bewusst nicht Feind genannt, ich habe ihn offiziell als Sparringspartner bezeichnet, auch in meinen zahlreichen Diskussionen mit den Ärzten. Ich habe mich als Projekt definiert, was die Leute zu verlegenem Schmunzeln bewogen hat, aber damit habe ich diesen Gast gedanklich von Anfang an personifiziert und aus meinem Körper verbannt.
Er durfte nicht ein Teil von mir werden. Er war und blieb ein Unerwünschter. Nicht mehr, aber leider auch nicht weniger.
Er sollte mich nicht einschüchtern. Mein primäres Ziel war, mit jeder Form von Angst fertig zu werden. Denn Angst könnte ein unangenehmer Begleiter der Krankheit werden. Angst würde auszehren, würde einen Großteil meiner Kräfte rauben.
Ich habe ohnedies immer Sport getrieben, bin in den Alpen gewandert, mit dem Rad gefahren. Wir haben über viele Jahre einen Hund gehabt, der uns bei gutem und schlechtem Wetter auf Trab gehalten hat, sind also sehr viel an der frischen Luft. Eigentlich durfte ich darüber gar nicht krank geworden sein.
Mein Leben hat sich bisher nicht großartig vom Dasein der meisten Menschen unterschieden. Ich habe in Wien Physik, Mathematik, Psychologie und Violine studiert, bin nach dem Studium in ein großes Unternehmen in Deutschland eingetreten und habe dorthin mein Wissen verkauft, bin über Jahrzehnte einem normalen Beruf nachgegangen. Die Arbeit hat die meiste Zeit Spaß gemacht. Die Violine hat mich mein ganzes Leben begleitet und mir besonders in anstrengenden Zeiten Entspannung und Freude bereitet.
Es gab in der Zeit vor der Krankheit keine von mir als außergewöhnlich empfundenen Spannungen, aus denen ich irgendetwas hätte ableiten können. Oder vielleicht doch … Im Nachhinein erinnerte ich welche, sogar regelmäßige. Aber ich wollte doch eigentlich nichts ableiten. Es hatte gelegentlich Ärger gegeben, wie es eben überall Ärger gibt. Besonders, wenn meine Identifikation mit einer Sache außergewöhnlich intensiv und ich der Meinung war, etwas durchsetzen zu müssen. Dann hatte ich schon gespürt, dass dafür Ressourcen der besonderen Art einzusetzen waren. Auch familiäre Spannungen hatten zu meiner Gesundheit nicht gerade positiv beigetragen.
Jedenfalls habe ich faktisch nicht geraucht, in der Jugend, vielleicht insgesamt eine Schachtel Zigaretten, habe kaum scharfe Alkoholika getrunken, höchstens ab und zu ein Glas Wein und auch sonst habe ich nicht über die Stränge geschlagen.
Schon sagen einige Leute: Und? Was hast du jetzt davon! Hättest du gequalmt und gesoffen, dann hättest du wenigstens vorher etwas vom Leben gehabt.
Jedenfalls war ich vor dieser Sache nicht ernsthaft krank gewesen. Probleme mit meinen Zähnen hatte ich allemal und ich hatte sie bis zur Operation. Sie haben mich aufgrund einer Zahnfehlstellung seit meiner Jugend fortwährend gepeinigt und auch viel Geld gekostet. Ich bin bei vielen Zahnärzten und Österreich und Deutschland ein- und ausgegangen.
Es war aber niemals etwas wirklich Ernstes. Ich konnte immer normal essen. Ein selbst behandelter Furunkel an einem Oberschenkel hat mich vor vielleicht zehn, fünfzehn Jahren unglaublich lange dreizehn Wochen vorübergehend in einen akut lebensgefährlichen Zustand gebracht. Daran erinnere ich mich noch gut. Wie gesagt, das war der ‚Erfolg’ meiner Selbstbehandlung. Aber von solch läppischen Dingen habe ich mich immer distanziert. Sonst war außer leichten Erkältungen praktisch nichts. Oder?
Eine Pilzerkrankung an einem Zehennagel vor etwa fünf Jahren. War das schon ein Hinweis auf etwas Außergewöhnliches? Ich habe sie einige Wochen lang etwas lässig mit Nageltropfen behandelt. Das hat nichts gefruchtet, also war ich in der Hautklinik, hatte mich dort untersuchen lassen, mich informiert und auf eigenes Risiko eine Anti-Pilz-Kur durchgeführt. Nach jeder Etappe wurde eine Blutuntersuchung vorgenommen und bei negativem Befund, also bei keiner krankhaften Veränderung eines Blutwertes, die Heilbehandlung nach einer Pause von 14 Tagen wieder fortgesetzt. Das Ergebnis dieser Untersuchung war schon nach der ersten Etappe angeblich bestens. Ihr Blut möchten wir haben, hatten die Ärzte der Hautklinik gesagt.
An eine geringfügige Irritation des Magens nach der zweiten Etappe allerdings kann ich mich heute noch erinnern. Diese Verstimmung habe ich während des Verfahrens in der Klinik zu Protokoll gegeben. Eine ärztliche Reaktion in Richtung Abbruch der Behandlung erfolgte nicht und war nach meiner Einschätzung auch nicht erforderlich. Dennoch habe ich selbst die Behandlung nach diesen beiden Etappen mit Einverständnis der Ärzte abgebrochen, da der Nagel schon scheinbar gesund nachgewachsen war.
Die Ärzte behaupteten damals und verschiedene andere Ärzte meinen auch heute noch unabhängig voneinander, dass die erwähnte Irritation nicht vom Medikament gekommen sei. Eine allgemeine gesundheitliche Beeinträchtigung war jedenfalls vorhanden und ich habe sie weder ganz ignoriert noch vollständig verdrängt. Sonst hätte ich die Behandlung nicht nach einiger Zeit aus freien Stücken abgebrochen.
Und dann war da die Geschichte mit der Synkope einige Jahre vor der Krebsdiagnose. Damit bezeichnet man einen mehr oder weniger spontanen Schwächeanfall mit gegebenenfalls kurzzeitiger Bewusstlosigkeit. Meine Frau war für einige Tage verreist gewesen, und ich hatte diese Zeit verwendet, um daheim wichtige Dinge zu erledigen, hatte einen leichten grippalen Infekt, war den ganzen Tag vor dem Computer gesessen, ohne etwas gegessen zu haben. Die Synkope war just an diesem Tag in einem Restaurant aufgetreten, das ich mit meinem Freund Axel besuchte. Schon vor dem Restaurantbesuch war mir nicht ganz wohl. Es geschah dann während des Essens. Die Töne im Lokal wurden immer dumpfer, ich verstand meinen Freund immer weniger und war so lange tapfer, bis ich letztendlich für etwa eine Minute das Bewusstsein verloren hatte und erst aufwachte, als die Türen im Lokal durch ein Notarztteam aufgestoßen wurden.
Mit ihm war Frischluft hereingekommen. Die allgemeine Aufregung hielt sich in Grenzen, zumal der Ober – offensichtlich geschult im Umgang mit synkopierenden Kunden - einen in Essiglappen brachte, ihn mir unter die Nase hielt und von ähnlichen Ereignissen in seinem Lokal berichtete. Bald danach war es geschlossen, was aber nichts bedeuten mag.
Die Notärztetruppe jedenfalls hatte Blutdruck und Blutzucker gemessen, mich gefragt, ob sie mich mitnehmen sollten, aber ich bestand auf der Heimfahrt mit dem eigenen PKW, mein Zustand war wieder völlig stabil. War das schon wieder ein Hinweis?
Meiner Frau wollte ich diese Begebenheit zunächst verschweigen, um sie nicht zu verunsichern. Ich habe es ihr dann aber einige Tage nach ihrer Rückkehr berichtet. Mit unglaublichen Folgen. Sie bestand auf einer umfassenden Untersuchung. Erst Neuro-Untersuchung mit Ultraschall – alles o. k. Verengungen der Kopfarterien konnten nicht festgestellt werden. Der Neurologe lachte über meinen Hinweis, man könne die Carotis, eine Kopfarterie, doch ohne weiteres durch einen Plastikschlauch ersetzen und beruhigte mich der Bemerkung, ich hätte Arterien wie ein Fünfzehnjähriger. Nun gut.
Die Computertomographie – kurz CT – des Kopfes hatte auch einen negativen Befund ergeben. Negativ heißt ja medizinisch: Es ist alles in Ordnung. Hier lautete der Bescheid, man hätte ‚keine auffälligen Verdrängungen’ feststellen können – eine wertneutrale Umschreibung von möglichen Tumoren. Und es war interessant, dass einige meiner Gesprächspartner, denen ich von diesem Ereignis erzählte, auch Ähnliches erlebt hatten oder jemanden kannten, dem so etwas widerfahren war. Meine Offenheit löste bereits zu dieser Zeit bei den Leuten die Hemmungen, etwas über sich selbst zu erzählen.
Die internistische Untersuchung stellte eine leichte Hypertonie fest, Bluthochdruck mit 150/95 mmHG. Dem Ratschlag meines Arztes, dies mit Medikamenten zu verbessern, wollte ich nicht ohne weiteres folgen, denn ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nahezu ohne Arzneimittel gelebt – bei gelegentlichen Kopfschmerzen nichts genommen, bei meinen ständigen Zahnschmerzen auch keine schmerzstillenden Tabletten. Aber waren die in der letzten Zeit immer häufiger auftretenden Kopfschmerzen und das nächtliche Schwitzen nicht doch ein Hinweis auf eine Anomalie?
Als er etwa 45 Jahre alt war wurde bei meinem Vater ein Magengeschwür diagnostiziert und in einer sogenannten Billroth I-Operation entfernt. Dabei werden die unteren Abschnitte des Magens entfernt und der Restmagen direkt mit dem Zwölffingerdarm verbunden.
Mein Vater starb mit 75 Jahren an einem Herzinfarkt, vermutlich an den Spätfolgen seiner Raucherei, die er trotz seiner Magenoperation niemals ganz aufgegeben hatte. Ob sein Magengeschwür bösartig war, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass damals auch über seine Bauchspeicheldrüse (Pankreas) diskutiert worden war. Ein Pankreas-Karzinom hatte er wohl nicht gehabt, sonst hätte er wahrscheinlich nur mehr sehr kurz gelebt.
Meine Mutter hatte einmal ein Zwölffingerdarm-Geschwür. Die Gründe dafür blieben unbekannt, psychische Faktoren könnten eine Rolle gespielt haben. Es wurde mit Tabletten viele Monate behandelt und letztlich auskuriert. Sie ist 2007 im 90. Lebensjahr an einer Krankheit gestorben, die man früher Altersschwäche nannte.
Mein Großvater mütterlicherseits war mit 74 Jahren an einem Mastdarmkarzinom gestorben. Er hatte allerdings die während des Krieges und in der Nachkriegszeit beliebten Virginia-Zigarren geradezu zwanghaft verzehrt. Meine Großmutter mütterlicherseits starb mit 82 Jahren. Angeblich an einer Leberzirrhose, obohl sie nie getrunken hatte. Sie hatte aber lebenslang massiven Bluthochdruck und mit 77 Jahren einen Schlaganfall, von dem sie sich recht gut erholte und noch fünf Jahre lebte.
Über die Krankheiten meiner Großeltern väterlicherseits ist mir nichts Genaues bekannt.
Es gibt also eine gewisse genetische Vorbelastung in unserer Familie. Sie ist zwar meiner Erkrankung nicht eindeutig zuordenbar, hätte mich aber schon viel früher sensibilisieren können. Nur was hätte das schon genützt.
Für Vorzeichen keine Zeit
April 2004: Fünf Monate vor der Diagnose
Die Jahre bis zu meiner Krebsdiagnose sind also bis auf die wenigen geschilderten Ereignisse eher unauffällig, und diese kurz geschilderten Ereignisse haben nach Ansicht meiner Ärzte nichts mit der darauf folgenden Krebserkrankung zu tun.
Dann kam das Jahr 2004, in dem ich mich heute noch genau an das erste bemerkenswerte Ereignis erinnere.
Es ist der 16. April und ich habe geschäftlichen Kontakt mit einem namhaften Automobilunternehmen. Das Datum ist mir deswegen so genau in Erinnerung, weil die Verständigung mit den Repräsentanten dieses Unternehmens so spontan und erfreulich ist und weil auch die weiteren direkten Kontakte vor Ort angenehm sind. Allerdings ist die Zeit unmittelbar nach dem 16. April geprägt von der Ankündigung eines großen Arbeitspensums, das mit diesem Auftrag verbunden sein wird. Und diese latente Belastung verursacht spontan Magenbeschwerden. Ich sage nach dem Telefongespräch mit der verantwortlichen Vertreterin des Unternehmens zu meiner Frau:
„Wenn ich daran denke, wie viel Arbeit ich bis zu diesem Termin habe, dann dreht sich mir der Magen um.“
Was hätten Sie denn in einer solchen Situation getan? Geben Sie doch zu, Sie hätten den Auftrag auch angenommen, denn wir haben verlernt Nein zu sagen. Jetzt, wo ich weiß, was in diesem nachfolgenden Jahr geschehen ist, weiß ich auch, dass ich hätte ablehnen sollen. Aber nennen Sie mir jemanden, der wegen ein bisschen Magenschmerzen auf eine wichtige Sache verzichtet.
Die Belastung war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache der folgenden Ereignisse, aber sie hat diese vielleicht beschleunigt oder sogar ausgelöst. Heute würde ich jeden Auftrag ablehnen, wenn ich ähnliche Beschwerden bemerkte, denn Gesundheit ist unbezahlbar.
Und so habe ich mich an die Arbeit gemacht.
Sie gefällt mir, aber es sind da ständig die Gedanken, ob ich die Anforderungen in dieser kurzen Zeit werde erfüllen können. Andererseits freue ich mich auf die Kurse, die damit verbunden sind.
Bei den ersten Vorbesprechungen vor Ort – bereits wenige Wochen nach der ersten Kontaktaufnahme – stelle ich plötzlich fest, dass ich massive Probleme mit dem Essen habe. Das ist mir daheim bisher noch nicht aufgefallen, denn hier ist mir das Umfeld vertraut, der Stress deshalb nicht so groß. In der fremden Umgebung ist das anders. Wenn ich etwas gegessen habe, wird mir einige Stunden später davon schlecht. Ich ignoriere diese Warnsignale einfach, verdränge sie, interpretiere sie in meinem Sinn. Vielleicht sind sie zu schwach. Vielleicht bin ich durch das Ziel der Arbeit zu sehr abgelenkt. Vielleicht bestanden diese Signale schon einige Zeit vorher. Wer weiß das nachher schon? Jedoch kann ich aus heutiger Sicht nicht abschätzen, was gewesen wäre, wenn ich die Vorzeichen schon sehr viel früher wahrgenommen hätte und in irgendeine Klinik gegangen wäre. Vielleicht wäre ich heute nicht mehr am Leben. Denn alle nachfolgenden Ereignisse passen ganz einfach so perfekt zusammen, dass sie mich letztlich retten.
Ich arbeite also mit hohem Tempo weiter, bemerke meine steigende Nervosität und kann mich nachträglich auch an besondere Symptome erinnern – an die Schmerzen in der Magengegend, an den schlechten Stuhlgang, an die Unpässlichkeiten einige Stunden nach jedem Essen. Nicht aber an irgendein Nachlassen der Leistungsfähigkeit.
Mein Magen wird rabiater
Juni 2004: Drei Monate vor der Diagnose
In der Zwischenzeit habe ich mich schon fast daran gewöhnt immer weniger essen zu können, obwohl der Appetit nach wie vor gut ist. Ich beginne mir sozusagen das Essen abzugewöhnen, esse mehr Traubenzucker und fahre nach wie vor mit dem Rad auf die Berge, kann keinen Leistungsverlust erkennen, habe aber gleichzeitig immer häufigere und stärkere Magenbeschwerden.
Eines Morgens stelle ich mich nach längerer Zeit wieder auf die Waage und merke, dass ich fast fünf Kilo weniger wiege als noch vor einigen Monaten. Habe sofort ein halbes Dutzend Gründe parat, warum das so sein muss. Keiner davon ist der Verdacht auf Krebs. Der Gewichtsverlust aber ist bereits ein wesentliches Indiz dafür. Alle Onkologen fragen nachher sofort nach dem Verlauf des Gewichtes.
Trotz des massiven Drängens meiner Frau gehe ich nicht zum Arzt. Es ist wohl die Furcht vor einem schlechten Befund, die mich abhält.
Ich erinnere mich an Vorkommnisse, bei denen sich mein Magen immer rabiater meldet. Auf einer Reise, auf der Hochzeitsfeier meiner Tochter, dem Geburtstag meiner Frau, wo ich einige Stunden nach dem Essen mit massivem Brechreiz kämpfe.
Schlimm und schlimmer
August 2004: Ein Monat vor der Diagnose
Während der langen Heimfahrt mit dem Auto von Stuttgart nach Salzburg muss ich eine Notübernachtung in Erwägung ziehen, so schlecht fühle ich mich. Ich bin nicht einmal mehr imstande zu tanken, obwohl der Tank nahezu leer ist, als ich nach Hause komme.
Das Tückische daran ist, dass der Spuk am nächsten Morgen vorbei ist. Ich fahre also an den Wolfgangsee, um dort zu schwimmen. Der Tag ist herrlich, die Sonne scheint, es ist warm. Aber mir ist kalt. Unheimlich kalt, wie bei einer Erkältung, die ich aber nicht habe. Im Normalfall gehe ich bei fast jeder Temperatur ins Wasser. Ich liebe das frische Wasser, es kann mir nicht zu kalt sein. Hier allerdings kommt in mir plötzlich eine unerklärliche Endzeitstimmung auf und die Frage, ob ich dort jemals in meinem Leben wieder schwimmen werde.
Das ist das erste Mal, wo mir der Ernst der Situation so richtig bewusst wird. Ich fühle instinktiv, dass ich ernsthaft krank bin. Aber was sollte das für eine Krankheit sein?
In der Pause eines Konzerts meiner Tochter im Schloss Goldegg muss ich mich auf einem Parkplatz übergeben. Es ist der 19. August 2004.
Ich interpretiere mein Unwohlsein nun als Gastritis und setze mich mit dem Gedanken auseinander, irgendwann doch meinen Hausarzt in Deutschland aufzusuchen. Der würde mir vermutlich ein paar Tabletten verschreiben, und die Sache wäre in einigen Tagen wieder im Lot. Das sind meine Gedanken und ab nun meine stille Hoffnung. So kann ich mich wieder um die von mir so gefürchtete Magenspiegelung drücken. Meine Frau bereitet diesem Zustand ein Ende, indem sie mich ganz einfach bei meinem Hausarzt anmeldet und auf einem Besuch besteht.
Der Besuch beim Hausarzt
31. August 2004
Ich schildere meinem Hausarzt meine Situation und meine Beschwerden. Als Naturwissenschaftler ist man geschult, so etwas ganz genau zu tun.
Auf meine mehrfachen Fragen, was seine Meinung dazu ist, gibt er mir, ohne mir etwas über einen Verdacht zu sagen, ein Medikament. Es ist ein Protonenpumpenhemmer, der die Magensäureproduktion verringert. Er schärft mir ein, nach zwei Tagen wieder zu kommen und ihm zu berichten, ob sich die Beschwerden verringert haben. Wenn sie in dieser Zeit verschwunden wären, so sei das Problem offensichtlich gelöst.
Ich habe ihn verstanden. Und ich will ihn einfach so und nicht anders verstehen. Die Beschwerden werden verschwinden, denn ich kann ja nicht krank sein.
Nach diesen zwei Tagen fühle ich mich daher schon etwas besser, zumindest interpretiere ich es so. Ich komme also wie versprochen in die Praxis und berichte ihm darüber.
Nach einigen Tagen ist diese sogenannte Besserung aber wieder dahin. Ich habe auf meinen Wanderungen mit dem Hund gelegentlich spontane und bisher niemals beobachtete Anfälle von extremem Speichelfluss, so als ob die Speicheldrüsen eine besondere Leistung erbringen müssten. Auch habe ich immer wieder solche Magenbeschwerden, dass ich mich fast übergeben muss.
Der Hausarzt untersucht mich wieder und nach einigen Tagen erhalte ich einen Blutbefund, der ohne Auffälligkeiten ist. Auch eine Ultraschalldiagnose erbringt nichts Besonderes. Einer seiner Assistenzärzte erklärt mir das Ultraschallsignal meines Herzens, deutet auf eine leichte, seiner Einschätzung nach unbedeutende Verdickung einer Herzwand, mit 62 sei das wohl keine Ausnahme, und rät mir zur Einnahme von Blutdrucksenkern.
Sein Chef verdreht auf meine insistierenden Fragen nach seiner Einschätzung die Augen und diagnostiziert ein Magengeschwür, was ich daheim meiner Frau mit „Nonsens!“ kommentiere. Denn ich kann ja nicht krank sein.
Ich hätte aufmerksam werden sollen bei den immer öfter und immer heftiger werdenden Symptomen des Aufstoßens, den permanenten Blähungen, bei dem außerordentlich spontan einsetzenden und extrem starken Speichelfluss und den Stauungsbeschwerden einige Stunden nach jeder Mahlzeit.