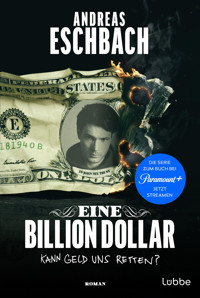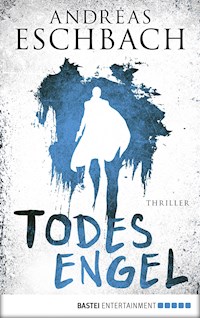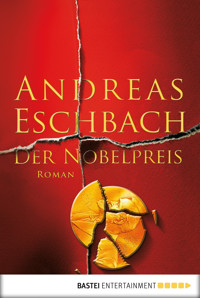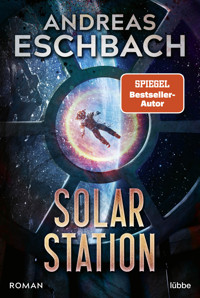19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus.
»Der Tod löscht alles aus. Der Tod ist barbarisch. Und jetzt sagen Sie mir, warum sollten wir das dulden?«
Drei hochkarätige Unternehmer aus dem Silicon Valley wollen ein zweites 'Manhattan Projekt' ins Leben rufen. Nur ist das Ziel noch ehrgeiziger als damals die Entwicklung der Atombombe: Sie wollen den Tod abschaffen. Der Journalist James Windover entdeckt jedoch, dass die Unternehmer, während sie von Investoren Milliarden sammeln, insgeheim versuchen, einen Schriftsteller zum Schweigen zu bringen - weil sie eine Story fürchten, die er geschrieben hat. Was steht darin, das das Projekt gefährden könnte? James begibt sich auf die Suche nach dem Mann und gerät rasch selbst in tödliche Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Drei hochkarätige Unternehmer aus dem Silicon Valley wollen ein zweites ›Manhattan Projekt‹ ins Leben rufen. Nur ist das Ziel noch ehrgeiziger als damals die Entwicklung der Atombombe: Sie wollen den Tod abschaffen. Der Journalist James Windover entdeckt jedoch, dass die Unternehmer, während sie von Investoren Milliarden sammeln, insgeheim versuchen, einen Schriftsteller zum Schweigen zu bringen – weil sie eine Story fürchten, die er geschrieben hat. Was steht darin, das das Projekt gefährden könnte? James begibt sich auf die Suche nach dem Mann und gerät rasch selbst in tödliche Gefahr …
Über den Autor
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet, hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr.
Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller DAS JESUS-VIDEO, gefolgt von Bestsellern wie EINE BILLION DOLLAR und AUSGEBRANNT, mit denen er endgültig in die Top-Riege der deutschen Autoren aufgestiegen ist.
Sein Roman NSA – NATIONALES-SICHERHEITS-AMT befasst sich mit der brisanten Frage: Was wäre, wenn es im dritten Reich bereits Computer, das Internet und Soziale Medien gegeben hätte – und deren totale Überwachung? In dem Kriminalroman FREIHEITSGELD zeigt er eine nicht allzu ferne Zukunft, in der Automatisierung, Klimawandel und die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens das Leben der Menschen entschieden verändert hat. Andreas Eschbach lebt mit seiner Familie seit 2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne.
THRILLER
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Copyright © 2024 by Andreas Eschbach
Diese Ausgabe 2024 by Bastei Lübbe AG,Schanzenstraße 6–20, Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text-und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Lektorat: Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © paul_craft – stock.adobe.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-6090-4
luebbe.de
lesejury.de
Die teuerste Tageszeitung der Welt heißt The Windover View, und höchstwahrscheinlich haben Sie noch nie von ihr gehört.
Alles andere wäre höchst verwunderlich, denn diese Zeitung hat nur 49 Abonnenten, die jeweils eine Million Euro im Jahr bezahlen für das Privileg, jeden Morgen zu erhalten, was sie nirgendwo sonst bekommen: einen nüchternen, leidenschaftslosen und einzigartig präzisen Überblick über den Zustand der Welt. Diese Zeitung bringt keine sensationsverheißenden Schlagzeilen, keine Nachrichten über Mord und Totschlag und keine Berichte über sogenannte Prominente und ihre Eskapaden. Sie finden darin keine Kreuzworträtsel, keine Comics, kein Tageshoroskop, rein gar nichts, was der Unterhaltung dient. Kein Sportteil, keine Leserbriefe, keine Kleinanzeigen – überhaupt keine Anzeigen. Nur Fakten, auf den Punkt gebracht mit sorgfältig ermittelten Zahlen und straffen, schnörkellosen Analysen. Schon nach der Lektüre der Titelseite haben Sie ein klares, wenn auch grobes Bild dessen, was in der Welt gerade vor sich geht. Sie sehen, wo sich Entwicklungen anbahnen und welche Trends morgen oder übermorgen wichtig werden. Bei den Themen, die Sie interessieren, können Sie weiter in die Tiefe gehen zu noch mehr und detaillierteren Informationen, zu feiner aufgeschlüsselten Zahlen und Statistiken, veranschaulicht in Grafiken, deren Optik mit Bedacht so gewählt ist, dass kein falscher Eindruck entstehen kann.
Mein Name ist übrigens James Henry Windover. Ich bin, wie Sie sich jetzt vermutlich schon denken können, der Gründer und Chefredakteur dieser Zeitung.
Wir sind ein reines Informationsmedium. Wir versuchen nie, Ihnen zu sagen, was Sie denken oder was Sie von dem, was wir berichten, halten sollen. Wir dokumentieren nur, so korrekt und objektiv wie möglich und unabhängig davon, ob das, was passiert, uns persönlich gefällt oder nicht. Wir schildern, was sich auf der Welt an Wesentlichem ereignet, legen dar, welche Hintergründe wie plausibel sind und welche Gefahren drohen. Und dann überlassen wir es unseren Leserinnen und Lesern, sich ihre eigene Meinung zu bilden.
Streng genommen sind wir keine Zeitung im klassischen Sinne, denn es gab noch nie eine gedruckte Fassung der Windover View, und es wird auch nie eine geben. Stattdessen hat jeder Abonnent einen speziellen Tabletcomputer, auf dem morgens um sechs Uhr mitteleuropäischer Zeit die aktuelle Ausgabe erscheint. Sie kommt per Internet, verschlüsselt und überdies personalisiert, was bedeutet, dass die Reihenfolge der Themen sich nach den Interessen des betreffenden Abonnenten richtet, wie er sie bei uns hinterlegt hat: Angaben, die wir selbstverständlich hüten wie unsere Augäpfel.
Und – ja, der Name der Zeitung ist ein Wortspiel. Keineswegs bedeutet er jedoch, dass es um meine Sicht auf die Welt geht. Im Gegenteil: Mich um äußerste Neutralität zu bemühen ist meine oberste und heiligste Maxime. Höchstmögliche Objektivität ist der Raison d’être unserer Publikation.
Falls Sie jetzt denken sollten, ›oh, das interessiert mich, und eine Million pro Jahr wäre mir das wert, wo kann ich abonnieren?‹, muss ich Sie enttäuschen: Nirgends. Es handelt sich bei unserer Leserschaft um einen äußerst exklusiven Club, dem man nur mit der Empfehlung eines Mitglieds beitreten kann und auch nur, wenn keiner der bisherigen Abonnenten Einwände erhebt. Was durchaus schon vorgekommen ist.
Wie aber passt nun dazu ein Buch wie das vorliegende? Eine berechtigte Frage. Aus dem, was ich über das Konzept unserer Zeitung angedeutet habe, schlussfolgern Sie zweifellos, dass wir gewöhnlich eher die kurze Form pflegen. Aussagekräftige Überschriften, die sich auf ein Antippen hin zu knappen Abhandlungen erweitern, in denen man dort, wo es einen interessiert, weiter in die Details gehen kann, zu Erklärungen, Grafiken, Zahlen: So sieht ein typischer Artikel der Windover View aus.
Doch ab und zu ereignen sich Dinge, die zu schildern einer anderen Textform bedürfen, und dies ist so ein Fall. Ich habe eine Geschichte zu erzählen, die zu lang ist, um sie in meiner Zeitung unterzubringen, und zu wichtig, als dass ich sie dem Rest der Welt vorenthalten dürfte – deswegen war es nötig, ein Buch zu schreiben.
Wozu brauchen wir Nachrichten? Wir brauchen sie, weil wir wissen wollen, was von dem, was in der Welt vor sich geht, uns betreffen oder gar gefährden könnte. Wir brauchen sie, weil das Leben inhärent unsicher ist und im Prinzip jedes einzelne Lebewesen an jedem einzelnen Tag darum kämpft, ihn nicht zu seinem Todestag werden zu lassen.
Sicherheit, das lernen wir früh, ist eine Illusion.
Die einzige Sicherheit ist die, dass jeder von uns eines Tages sterben wird.
Doch selbst diese Gewissheit könnte ins Wanken geraten. Es gibt Menschen, die daran rütteln.
Und genau darum wird es im Folgenden gehen.
* * *
Auf Anraten unseres Firmenanwalts werde ich absichtlich vage bleiben, was den Zeitrahmen der nachfolgend zu schildernden Ereignisse anbelangt. Auch habe ich etliche Namen verändert und mir hinsichtlich der Schauplätze gewisse Freiheiten erlaubt. Es ist mir schwergefallen, das zu tun, denn ich bin, was unsere Zeitung anbelangt, stolz auf die Präzision unserer Angaben und Zahlen. Unser Rechtsbeistand hat mich jedoch davon überzeugt, dass es so für alle besser ist.
Am besten, Sie lesen dieses Buch, als sei es ein Roman.
IDIE EINLADUNG
Kapitel 1
Montags Punkt zehn Uhr findet bei uns immer die sogenannte »große« Redaktionssitzung statt. Es ist der einzige Termin, der feststeht, die Konstante unseres Lebens, seit unsere Zeitung existiert. Wir treffen uns, um gemeinsam die Leitlinien für die vor uns liegende Woche herauszuarbeiten, zusammenzutragen, was sich momentan an großen Trends in der Welt abzeichnet und was wir tun müssen, um sie adäquat zu beschreiben.
Wenn es im Lauf der Woche notwendig werden sollte, über Details zu diskutieren – was für gewöhnlich der Fall ist –, erledigen wir das mithilfe moderner Bürokommunikationssysteme. Mit anderen Worten, dann erscheinen Texte auf Bildschirmen, werden gelesen, kommentiert und überarbeitet, oft gleichzeitig von mehreren Personen und oft über Kontinente hinweg. Wo nötig, telefonieren wir oder starten eine Ad-hoc-Videokonferenz. Hausintern klären wir vieles einfach im direkten Gespräch, bei einer Tasse Tee oder Kaffee. In den Redaktionskonferenzen jedoch liegt nur ein großes Notizbuch vor mir, blanke Seiten im Format A4, in Leder gebunden. Ich bin überzeugt, dass sich in dem, was ich darin an Fragen und Stichworten notiere, ergänze oder durchstreiche, der Zustand der Welt im Grunde am besten abbildet, zumindest, was mich betrifft.
In diesem Notizbuch könnte ich nachsehen, welche Themen, Trends und Entwicklungen wir an jenem Montag im Oktober diskutiert haben, an dem alles begann, aber ich tue es nicht. Absichtlich, denn, wie gesagt, ich möchte die nachfolgend zu schildernden Ereignisse zeitlich lieber nicht allzu klar einordnen. Ich kann so viel sagen, dass nichts »Großes« darunter war, und den Rest kann man sich denken – im Nahen Osten kriselt es immer, in Brüssel wird immer an irgendwelchen weitreichenden Plänen gebrütet, immer werden neue Firmen gegründet und geraten andere in Schieflage, und immer wird viel über die Umwelt geredet und wenig für sie getan.
Unser Konferenzraum befindet sich im zweiten Stock unseres im Herzen Amsterdams gelegenen Redaktionsgebäudes, direkt über unserer Cafeteria, auf derselben Etage wie die Büros unserer Statistikabteilung und die des halben Rechercheteams. Die andere Hälfte der Rechercheure haust unterm Dach, und das ist ein Bereich des Hauses, den zu betreten ich lieber vermeide, denn unsere Rechercheure sind, sagen wir mal … speziell. Und ich will, dass sie das bleiben, denn sie leisten hervorragende Arbeit.
Die Fenster des Konferenzraums weisen nach Norden. Dadurch ist der Raum zwar hell, aber nicht zu hell, denn es sind mindestens unsere Büros in Paris, Singapur und Los Angeles per Video zugeschaltet. In Singapur ist es dann siebzehn Uhr abends, und Yu Chow, der Leiter unserer dortigen Niederlassung, beschließt seinen Arbeitstag mit dieser Konferenz. Greg Scott in L. A. dagegen, wo es erst ein Uhr früh ist, muss seinen Sonntagabend opfern. Doch er ist ohnehin eine Nachteule, unverheiratet und kinderlos; man kriegt ihn um diese Zeit auch unter der Woche zuverlässig ans Telefon. Eine Konferenz hingegen, für die er morgens um neun Uhr wach sein müsste, wäre eine Herausforderung für ihn, die wir ihm lieber ersparen.
Wir sprechen bei diesen Treffen natürlich auch über Internes. Marta Udenthal, die kaufmännische Geschäftsführerin und meine Stellvertreterin, legte gerade unsere momentane finanzielle Situation dar – wir nehmen viel Geld ein, gewiss, aber wir geben auch unglaublich viel wieder aus –, als es an der Tür klopfte und Octavia Gabriel hereinkam, unsere Sekretärin.
»Ich störe ungern«, erklärte sie mit sanftem Lächeln in das abrupte Schweigen hinein, »aber ich glaube, es ist wirklich dringend.«
Damit legte sie einen zusammengefalteten Zettel vor mich hin, bedachte die Runde noch einmal mit einem Blick aus ihren leuchtend blauen Augen und entschwand wieder.
Ich lugte in den Falz des Zettels. Frau Lestari bittet um SOFORTIGEN!!! Rückruf stand da und eine Telefonnummer in London.
Eine Nummer, die Octavia gar nicht hätte aufschreiben müssen, denn ich kannte sie auswendig.
Ich holte tief Luft, schob den Zettel in die Tasche und sagte: »Leute, ich fürchte, ihr müsst mich kurz entschuldigen. Das hier ist tatsächlich dringend.«
»Wir unterbrechen«, bestimmte Marta.
* * *
Marta folgte mir die Treppe hinab in den ersten Stock, aber nicht, um in die Cafeteria oder in ihr Büro zu gehen, sondern um mir in meines zu folgen.
»James – was ist los?«, wollte sie wissen. »Was ist so wichtig, dass du eine Redaktionskonferenz unterbrichst?«
Ich verstand ihre Beunruhigung: Das hatte ich noch nie zuvor gemacht. Im Gegenteil, ich predigte immer, der Montagstermin sei unantastbar. Heilig. Unterbrechungen nur, falls ein Atomkrieg ausbrach oder Aliens landeten.
»Ich erklär’s dir«, sagte ich, »aber nicht jetzt. Jetzt muss ich telefonieren.«
Marta ist eine patente, fröhliche Frau, die mit sich und ihrem Leben im Reinen ist und für jeden stets ein Lächeln und ein freundliches Wort übrig hat. Doch es gibt Momente, in denen es in ihr brodelt und man meinen könnte, ihre rötlich-braunen Haare würden sich gleich in flammende Feuerzungen verwandeln, und dies war so ein Moment.
Doch bevor Schlimmeres passierte, wandte sie sich ab, verließ mein Büro und zog die Tür hinter sich zu.
Mir tat das sehr leid. Marta ist meine Geschäftspartnerin, ja, meine Vertraute. Ich habe mit ihr zusammen diese Firma aufgebaut und hatte keine Geheimnisse vor ihr – keine, bis auf dieses.
Heute, dämmerte mir, ging eine schöne, glückliche Epoche zu Ende, und eine neue begann.
Hoffentlich.
Ich nahm den Hörer ab und wählte die Nummer auf dem Zettel.
»Lestari – James Windover hier«, sagte ich, als sich eine helle, junge Frauenstimme meldete. »Ist etwas mit Ihrer Mutter?«
»Nein, mit ihr ist alles in Ordnung«, antwortete sie fröhlich. »Aber sie will Sie dringend sprechen. Persönlich. Heute noch.«
»Heute noch? Wieso das denn?«
»Das weiß ich nicht. Aber sie hat gesagt, wenn Sie nicht so schnell wie möglich kommen, werden Sie es bestimmt sehr bedauern.«
Das ist nicht unbedingt das, was man hören will zu Beginn einer Woche, die gerade noch so friedlich vor einem gelegen hat. Ich weckte den Computer auf und betrachtete meinen Terminkalender.
»Hören Sie, wie wäre es etwas später in der Woche? Sagen wir, am Donnerstag?«
»Mutter hat gesagt, heute.«
»Lestari – wie soll ich das denn machen? Wir haben gerade Redaktionssitzung. Die geht mindestens bis dreizehn Uhr. Und heute Nachmittag muss ich –«
»Ein Flugzeug braucht von Amsterdam bis London eine Stunde und fünfzehn Minuten«, unterbrach sie mich freundlich. »Sie können heute Nachmittag hier sein und abends wieder zurück.«
»Ich weiß.« Die Sache ist die: Ich hasse es, zu fliegen. Nicht aus Flugangst, sondern weil man als Fluggast heutzutage behandelt wird wie zu transportierendes Vieh. Ganz davon abgesehen war Lestaris Rechnung sehr theoretisch, denn in der Praxis muss man bei Flügen mindestens ein bis zwei Stunden vor dem Abflug antanzen, sich unsinnig oft kontrollieren und durchleuchten lassen, dann warten, warten und nochmals warten, und selbst wenn der Flug keine Verspätung hat, landet man am Ende ja nicht in London, sondern fünfzig Kilometer davon entfernt, was auf noch gut eine weitere Stunde Fahrzeit hinausläuft.
»Heute Abend, achtzehn Uhr«, sagte ich. »Wäre das schnell genug?«
»Das wäre großartig«, erwiderte sie. »Tatsächlich hat Mutter mit genau diesem Termin gerechnet. Ich sage ihr Bescheid, dass Sie kommen.«
»Ja, sagen Sie ihr Bescheid«, meinte ich seufzend.
Dann legte ich auf, ging hinüber in unser Sekretariat und sagte: »Octavia, ich brauche einen Platz im Eurostar um dreizehn Uhr. Egal, welche Klasse.«
Und zu Marta, die in der Tür ihres eigenen Büros lehnte, die Arme vor der Brust verschränkt und die Brauen argwöhnisch gefurcht, sagte ich: »Du hast jetzt das Kommando.«
»Willst du mir nicht erklären, was das alles zu bedeuten hat?«
»Doch«, sagte ich. »Aber es ist eine lange Geschichte, und ich muss los. Ich erzähl sie dir, wenn ich zurück bin.«
* * *
Über unser Redaktionsgebäude sei so viel verraten, dass es sich, wie erwähnt, im malerischen Zentrum Amsterdams befindet, nahe der Grachten, aber abseits aller touristischen Trampelpfade. Die alten Häuser Amsterdams sind bekanntlich sehr schmal gebaut, weil man zu der Zeit nach der Breite seiner Straßenfassade besteuert wurde, deswegen mussten wir zwei direkt nebeneinanderliegende Häuser kaufen und mit allerlei Durchbrüchen und anderen Umbauten zu einer Einheit verbinden. Von außen erkennt man das nicht, weil die zuständige Behörde eine Veränderung der Fassade nicht genehmigt und wir das ohnehin nicht gewollt hätten. Von der Straße aus sieht man zwei getrennte Haustüren und ein Hoftor aus dunkelgrünem Holz. Auf einem winzigen Klingelschild steht »Wind. View«. Das ist alles.
Im Erdgeschoss befinden sich Lagerräume für Büromaterial, eine Waschküche, ein Hauswirtschaftsraum, Stellplätze für Fahrräder (es gibt auch Stellplätze auf der Straße, aber wir wollen nicht, dass man sieht, wie viele Leute bei uns kommen und gehen), Serverräume, Umkleiden und sogar zwei Duschen: Die waren schon da, als wir das Haus übernommen haben, und haben sich als nützlich erwiesen, wenn man im Sommer verschwitzt mit dem Rad ankommt. Praktisch jeder von uns hat einen beträchtlichen Teil seiner Garderobe in einem Spind untergebracht. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, hier eine fertig gepackte Reisetasche zu deponieren, für alle Fälle, doch wie das so ist mit guten Vorsätzen, ich hatte es immer vor mir hergeschoben, und deswegen musste ich jetzt nach Hause düsen, um zu packen.
Man fährt viel Rad in Amsterdam, vor allem, wenn das Wetter gut ist. Fahrräder haben zudem immer Vorfahrt, außer vor der Straßenbahn. In der Theorie. In der Praxis können Sie als Radfahrer so gut wie alles machen und kommen damit durch, nur mit einem nicht: Ihr Rad an einem Platz abzustellen, wo es nicht erlaubt ist. Ach ja, und wenn Sie Ihr Rad auf der Straße stehen lassen, sichern Sie es mit mindestens zwei verschiedenen Schlössern. Es hat mich meine ersten beiden Fahrräder gekostet, das zu lernen; sparen Sie sich dieses Lehrgeld.
An diesem Montag war es für Oktober sensationell schön, deswegen war ich mit dem Rad ins Büro gekommen. Das kam mir nun zugute: Rad aus dem Hoftor rollen, zuschließen, aufsitzen und ab durch die Mitte. Ich wohne in der Nähe des Slotersees; das sind zwanzig Minuten mit dem Rad. Mit der Linie 17 dauert es etwa genauso lange, aber auf die Straßenbahn hätte ich warten müssen.
Lestari ist die Adoptivtochter von Anahit Kevorkian, einer britischen Milliardärin, die es irgendwie schafft, der Aufmerksamkeit all jener Business-Magazine zu entgehen, die sich regelmäßig bemüßigt fühlen, Ranglisten der fünfzig oder hundert reichsten Menschen der Welt aufzustellen. Sie würde fraglos auf eine solche Liste gehören, aber sie legt keinen Wert darauf.
Anahit ist ungefähr Mitte fünfzig und sitzt seit einem schweren Verkehrsunfall vor über zwanzig Jahren im Rollstuhl. Nach allem, was ich gehört habe, hat das ihrer Neigung, Dinge unverblümt beim Namen zu nennen, keinerlei Abbruch getan, eher im Gegenteil. Sie ist grantig und verbreitet mit Vorliebe schlechte Laune um sich herum, und ihr mitleidloser Blick und ihre spitze Zunge können verletzen. Trotzdem mag ich sie irgendwie gut leiden. Ihr Mann Edvard, Gründer und Inhaber von Kevorkian Investments, war ein vorsichtiger Investor, aber ein risikofreudiger Autofahrer – er ist bei dem Unfall damals ums Leben gekommen. Bei seiner Frau verhält es sich genau umgekehrt. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie die bis dahin eher bescheidene Firma mit einer Reihe von waghalsigen Manövern zu einem Imperium ausgebaut, das den halben Erdball umspannt. Vielleicht auch den ganzen, so genau weiß ich das gar nicht.
Was mich betrifft, war sie vor allem diejenige, auf deren Initiative die Gründung von The Windover View rund sieben Jahre zuvor zurückging. Sie hat mich zu diesem Projekt überredet, mich mit einer großzügigen Anschubfinanzierung versehen und mir später auch die ersten Kunden verschafft – aber sie hatte, typisch für sie, darauf bestanden, dass das alles unter uns blieb.
Das war mit dem heutigen Alarm hinfällig geworden. Ich würde Marta alles erzählen müssen. Und ob sie mir verzeihen würde, sie nicht eingeweiht zu haben, stand in den Sternen.
* * *
Ich wohne in Nieuw-West, im ersten Stock eines hübschen Ziegelbaus, ungefähr hundert Meter von der nächsten Haltestelle entfernt. Vielleicht sind es auch zweihundert Meter, ich habe es nicht gemessen. Nah jedenfalls, was nützlich ist, wenn es regnet. Und es regnet oft in Amsterdam.
Als ich ankam, verstaute ich das Fahrrad hastig im gemeinsamen Radkeller, eilte dann die Treppe hinauf und zog unterwegs mein Telefon aus der Tasche. Das elektronische Ticket für den Eurostar war bereits angekommen; ich würde Business Premier fahren – sehr angenehm also.
Und die zugehörige Message von Octavia lautete: Ich habe Fragen.
Hastig schloss ich meine Wohnungstür auf, tippte auf dem Kästchen im Flur den Code ein, der die Alarmanlage abschaltete, dann rief ich Octavia zurück.
»Wegen Ihrer Rückfahrt morgen«, sagte sie ohne Begrüßung. »Wenn ich unterstelle, dass Sie zu einer menschlichen Zeit aufstehen wollen, dann würde sich der 11 Uhr 04 anbieten. Sie wären dann um 16 Uhr 11 wieder in Amsterdam.«
»Das klingt gut«, sagte ich, »aber die Sache ist die, dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Bis wann müsste ich Ihnen Bescheid geben?«
»Zwei Stunden vorher reicht.«
»Gut, dann melde ich mich rechtzeitig.«
»Die zweite Frage betrifft Ihren Aufenthalt. Werden Sie bei Ihrer Freundin unterkommen, oder brauchen Sie ein Hotelzimmer?«
»Das muss ich jetzt gleich klären, aber ich denke, ich komme zurecht.«
»Das wäre zu empfehlen«, meinte sie, »denn in London ist gerade Messe, und ich habe nachgeschaut – was Hotelzimmer anbelangt, gibt es praktisch nur noch übelste Absteigen. Zu Irrsinnspreisen, versteht sich.«
»Gut, ich betrachte mich als gewarnt«, sagte ich.
»Das wäre dann alles. Gute Fahrt.«
»Danke.« Ich beendete das Gespräch und sah, dass mein Anrufbeantworter blinkte. Ich besitze noch eines dieser guten, alten Geräte, die Anrufe tatsächlich noch selber speichern und sie nicht irgendwelchen Servern der Telefongesellschaft überlassen.
Es war ein Anruf meines Vaters, der erst mal knurrig bemäkelte, dass ich ja wohl nie zu Hause sei, und dann meinte: »Wenn du irgendwann nach London kommen solltest … na ja … vielleicht besuchst du deinen alten Herrn mal wieder, hm?«
Das hatte ich allerdings nicht vor, schon gar nicht heute.
Es stimmte, dass meine Besuche selten geworden waren in den letzten Jahren. Aber das lag nicht daran, dass ich so viel zu tun hatte; das schützte ich nur vor. Es lag daran, dass solche Besuche nie so verliefen, dass ich hinterher Lust auf eine Wiederholung hatte. Im besten Fall verbrachten wir einen langen Abend in einem stinkenden Pub und tranken Ale aus verschmierten Gläsern, während rings um uns herum laut gegrölt und geschimpft wurde, auf die Regierung, das Wetter und auf Dartpfeile, die nicht so trafen, wie sie sollten.
In der Regel aber endeten meine Besuche im Streit, weil es meinem Vater, dem alten Gewerkschaftler, gegen den Strich ging, dass ich für den ›Feind‹ arbeitete, wie er es immer nannte. »Ich habe einen Verräter an unserer Klasse großgezogen«, sagte er meistens irgendwann, und wenn ich ihn dann daran erinnerte, dass es in der Hauptsache meine Mutter gewesen ist, die mich großgezogen hat, war für gewöhnlich nichts mehr zu retten.
Wohlgemerkt, ich habe nichts gegen Gewerkschaften. Sie sind ein notwendiges Gegengewicht zur Macht der Besitzenden. Aber mein Vater hat eine Religion daraus gemacht, und das geht mir gegen den Strich.
Ich löschte den Anruf und rief stattdessen Joan an, meine Freundin. Frau Doktor Joan Hayward ist knapp fünf Jahre jünger als ich und Ärztin am St. Mary’s Hospital in London. Entsprechend schwierig ist es, sie telefonisch zu erreichen. Auf ihrem Mobiltelefon klappte es schon mal gar nicht; ich hätte ihr zwar eine Nachricht hinterlassen können, aber das verbot sich meiner Ansicht nach.
Ihrem Schichtplan, den sie mir regelmäßig schickt und den ich im Telefon stets bei mir habe, entnahm ich, dass heute ohnehin ein denkbar ungeeigneter Tag für einen Spontanbesuch war. Sie hatte Spätschicht, mit anderen Worten, je nachdem, wie lange ich bei Anahit Kevorkian sein würde, kam ich womöglich vor ihr in ihrer Wohnung an, sie würde total erledigt sein, und obendrein musste sie am nächsten Tag früher raus wegen einer Fortbildung.
Das nunmehr grüne Auge meines Anrufbeantworters schien mir spöttisch zuzublinzeln. Ja, bei meinem Vater konnte ich zur Not auch unterkommen. Aber ich richtete ein stummes Bittgebet an eventuelle höhere Mächte, dass sie mir dies ersparen mochten, und telefonierte dann ein paar andere Anschlüsse im Krankenhaus ab.
Endlich bekam ich Joan an den Apparat. Sie klang, wie meistens, erschöpft, und sie war auch nicht besonders begeistert, als ich ihr sagte, dass ich käme.
»James, mir geht’s heute nicht so gut«, meinte sie seufzend. »Ich freu mich, dich zu sehen, ja, aber … erwarte nichts, okay?«
»Ein warmes Plätzchen am Ofen, mehr brauch ich nicht«, versprach ich. »Ich werde dich sanft küssen, dir den Rücken massieren und dir die neuesten Geschichten aus der Welt der Nachrichten erzählen, bis du eingeschlafen bist.«
Mit einer Rückenmassage kriegte ich sie normalerweise immer. Doch diesmal sagte sie: »Ach, ich weiß nicht … kann ich mir grade nicht so recht vorstellen …« Im Hintergrund rief jemand etwas, das ich nicht verstand, und ein Gerät fing an, nervtötend zu piepsen. »Du, ich muss«, sagte sie.
»Okay, dann bis heute Abend«, rief ich, aber da war die Leitung schon tot.
Nun, in der Regel sind unsere Telefongespräche mit mehr Begeisterung verbunden, aber immerhin, es war ausgemacht, und alles Weitere würde sich finden. Ich sah auf die Uhr: Keine Zeit zu verlieren. Hurtig holte ich mein handliches Rollköfferchen aus dem Schrank und packte. Das geht bei mir schnell, denn in besagtem Köfferchen steckt eine schon fertig gepackte Kulturtasche mit einem zweiten Rasierapparat, und da ich meine Garderobe stets peinlich in Ordnung halte, brauche ich alles Übrige – Unterwäsche, Schlafanzug, frische Hemden und so weiter – nur aus dem Schrank zu nehmen. Auf der Innenseite der Tür hängt eine Checkliste, damit ich nichts vergesse. Eine Sache von Minuten also. Ein letzter Blick in die Runde: Alles in Ordnung. Ich löschte das Licht im Flur, nahm mein Köfferchen, schaltete die Alarmanlage wieder ein und machte mich auf den Weg. Bei meiner Wohnungssuche ist die Nähe zu einer Straßenbahnhaltestelle ein wesentliches Kriterium gewesen: Zu Fuß bin ich in weniger als fünf Minuten an der Station Meer en Vart, von wo aus mich die Linie 17 normalerweise bis zur Haltestelle Rozengracht bringt, was nur noch ein paar Schritte von unserem Redaktionsgebäude entfernt ist. Doch praktischerweise fährt die Linie 17 auch durch bis Amsterdam Centraal, wo das gelb-blaue Geschoss auf mich wartete, der Eurostar.
* * *
An diesem Tag hatte der Eurostar nur ein paar Minuten Verspätung, und so kam ich kurz nach siebzehn Uhr Ortszeit im Bahnhof London St Pancras an. Ich fahre diese Strecke oft, aber meistens entweder ganz früh, damit Joan und ich etwas vom Tag haben, oder spät am Abend, nach der Arbeit. Um diese Tageszeit bin ich noch selten angekommen, und der Anblick des Glasdachs über der Halle, das im Licht der späten Nachmittagssonne leuchtete, kam mir ganz fremd vor.
Die Taxis setzen einen an der Ostseite des Bahnhofs ab und warten an der Westseite auf neue Fahrgäste. Ich nannte dem Fahrer eine Adresse in Kensington, allerdings nicht die des Kevorkian-Anwesens, sondern die eines Hauses, in dem Eric Clapton mal gewohnt hat. In meiner Zeit beim Musikmagazin Hard’n Heavy durfte ich ihn dort einmal interviewen, was mich jungen Kerl damals ziemlich beeindruckt hat und mir unvergessen geblieben ist.
Der Gitarrist wohnt da längst nicht mehr, aber Anahit Kevorkian hat es lieber, wenn ich mich nicht direkt zu ihrem Haus bringen lasse. Wie gesagt, sie ist sehr auf Verschwiegenheit bedacht.
Nachdem ich den Fahrer bezahlt hatte, war es nicht mehr weit, zweihundert Meter vielleicht, und es gibt Schlimmeres, als an einem schönen Oktoberabend durch eine der prachtvollen Straßen Kensingtons zu spazieren.
Die Häuser in dieser Straße, deren Name ich aus den schon genannten Gründen verschweigen muss, ähneln einander: Fast alle sind drei Stockwerke hoch und aus gelbbraunen Ziegeln erbaut, alle haben prachtvolle, weiß gerahmte Fenster und stellen jeweils einen Wert von zwanzig bis dreißig Millionen Pfund dar. Von der Straße aus sieht man nur große, meist etwas mitgenommen wirkende Eschen – Stadtbäume eben –, hinter denen die Häuser wie versteckt wirken, und hinter schmiedeeisernen Gartentoren stehen teure Autos geparkt. Vor dem Kevorkian-Anwesen war es ein grauer Mercedes S 600: Anahit Kevorkian ist britische Patriotin durch und durch, aber nicht, wenn es um Autos geht.
Der Türsummer ertönte, noch ehe ich die Treppe ganz genommen hatte. Ich betrat den lichtdurchfluteten Flur dahinter, dessen Boden mit schwarz-weißem Marmor ausgelegt ist. Alles atmet Eleganz und Geld, und es riecht auch so, ohne dass ich sagen könnte, was genau für ein Duft diesen Eindruck erweckt.
»Hallo, Mister Windover.« Lestari kam aus ihrem kleinen Büro. Sie ist ein rundliches Mädchen mit John-Lennon-Brille und der einzige Mensch, den ich kenne, der immerzu von strahlend-heiterer Lebensfreude erfüllt zu sein scheint. »Mutter hat noch Besuch. Wollen Sie vielleicht einen Tee, solange Sie warten?«
»Gern«, sagte ich.
Ich folgte ihr in einen kleinen Salon auf der ihrem Büro gegenüberliegenden Seite des Flurs, dessen Wände mit bedrückend viel moderner Kunst vollgehängt sind und in dem ich schon oft gewartet und mich gefragt habe, was die Künstler mit diesen Werken wohl sagen wollten.
»Das Treffen jetzt gerade wurde ganz kurzfristig nötig«, erklärte Lestari, während sie mir Tee eingoss. »Etwas Politisches.«
»Kein Problem, ich bin ja auch viel zu früh dran«, meinte ich und nahm die hauchdünne Porzellantasse entgegen, gefüllt mit einer hellgoldenen, nach Kindheit duftenden Flüssigkeit.
Noch ehe wir uns in Konversation ergehen konnten, hörte man, wie sich eine Tür öffnete und jemand eiligen Schrittes den Flur entlangkam. »Guten Abend«, rief er Lestari zu und drehte sich rasch wieder weg, als er mich sah. Was ihm nichts nützte, denn ich hatte ihn sofort erkannt; es handelte sich um einen jungen, aufstrebenden Politiker, dem viele eine große Zukunft voraussagten.
»Auf Wiedersehen«, rief Lestari ihm nach. Man hörte ihn noch etwas murmeln, dann schlug die Haustür hinter ihm zu.
Lestari sah mich strahlend an. »Jetzt können Sie zu Mutter hineingehen.«
Kapitel 2
Ich klopfte an, drückte die schwere Holztür auf, die aus irgendeinem Tropenholz besteht, das man heutzutage nicht mehr kaufen kann, und sagte im Eintreten: »Guten Abend, Anna.«
Anahit Kevorkians Arbeitszimmer ist der größte und hellste Raum des Hauses, soweit ich es kenne. Am einen Ende steht ein Schreibtisch, der aussieht wie eine unwesentlich verkleinerte schottische Burg, am anderen Ende führen drei nebeneinanderliegende Fenstertüren auf den Garten hinaus. Im Sommer steht immer eine Tür offen, die so gebaut ist, dass Anna problemlos hinaus auf die Terrasse rollen kann, wo sie gern im Schatten eines Sonnenschirms arbeitet und nebenher den Gärtnern auf die Nerven geht.
Dafür war es heute zu spät im Jahr und zu spät am Tag. Sie saß hinter der Burgwehr ihres Schreibtisches, schrieb hastig irgendetwas auf und meinte nebenher: »James. Schön, dass Sie es einrichten konnten.«
Ich breitete die Arme aus. »Sie haben gerufen – hier bin ich. Allerdings haben Sie, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, zur Unzeit gerufen und mich zu dem Sakrileg gezwungen, unsere Redaktionskonferenz abzubrechen. Wenn ich zurück bin, werde ich nicht umhinkommen, meiner Geschäftspartnerin zu erklären, wer Sie sind und welche Rolle Sie spielen.«
»Haben Sie das denn noch nicht getan?«, fragte sie mit offenbar aufrichtiger Verwunderung.
»Natürlich nicht. Sie hatten mir schließlich absolute Verschwiegenheit abverlangt.«
»Ja, aber doch nicht sieben Jahre lang! Inzwischen sollten Sie doch wissen, ob auf Marta Verlass ist.«
»Absolut. Ich würde ihr bedenkenlos mein Leben anvertrauen.«
»Gut. Dann vertrauen Sie ihr auch unser kleines Geheimnis an.« Sie warf den Stift aufs Papier und kam hinter ihrem hölzernen Ungetüm hervorgerollt. »Sagen Sie, wie gefällt Ihnen mein neuer Ferrari?«
Sie meinte ihren Rollstuhl. Es war ein neues Modell, das auf erstaunliche Weise nicht mehr wie eine Prothese aussah, sondern so, als hätte Apple den Rollstuhl neu erfunden.
Bis auf die knallrote Farbe allerdings.
»Schick«, sagte ich. »Man ist in Versuchung, sich die Beine zu brechen, nur um in so einem Ding fahren zu dürfen.«
»Nicht wahr?« Sie grinste schief. »Ich habe mir gesagt, wenn Leute, die nicht gut sehen können, ihre Brillen zu Modeaccessoires veredeln, warum sollten Leute, die nicht gut laufen können, mit ihren Rollstühlen nicht das Gleiche machen? Vielleicht bringe ich zusammen mit irgendeiner hochkarätigen Modekette eine ganze Serie davon auf den Markt, was halten Sie davon?«
»Ich werde mich hüten, Ihre Geschäftsideen zu kritisieren. Sie sind die Milliardärin, nicht ich. Allerdings …«
»Was?«
»Die Farbe. Ein Ferrari ist dezent im Vergleich, möchte ich meinen.«
Sie schnaubte. »Das ist doch gerade der Witz dabei! Ich habe die Nase voll davon, meinen fahrbaren Untersatz schamhaft zu verstecken, nur damit die Leute sich in meiner Gegenwart nicht unwohl fühlen. Volle Kraft voraus, sage ich! Ich lass mir einen in jeder Farbe machen, passend zu meiner Garderobe. Und vielleicht noch einen in Neon, oder selbstleuchtend. Der Designer, der das hier gebaut hat, ist für meine Anregungen erfreulich aufgeschlossen. Nur meinen Wunsch, ein Maschinengewehr in die Armlehne einzubauen, hat er abgelehnt.«
»Was hält er von Giftstacheln?«, schlug ich vor.
Sie musterte mich befremdet. »Wozu sollte ich die brauchen? Giftig bin ich auch so.«
Ich räusperte mich. »Aber deswegen haben Sie mich nicht hergebeten, oder?«
»Nein, natürlich nicht.« Sie wies auf die Sitzgruppe vor dem Kamin, in dem immer verkohltes Holz liegt, obwohl ich noch nie ein Feuer darin habe brennen sehen. »Setzen Sie sich.«
Ich nahm auf dem beigebraunen Sofa Platz und sah zu, wie sie sich mit sichtlicher Begeisterung für die Steuerung ihres Rollstuhls auf die andere Seite des Couchtischs manövrierte. Anahit Kevorkian ist Mitte fünfzig, aber wenn ich das nicht wüsste, würde ich sie wesentlich jünger schätzen. Was sie vielleicht ihren Ahnen verdankt; ich habe oft den Eindruck, dass armenische Frauen langsamer altern als andere. Sie hat nahezu schwarze Haare, die sie nackenlang und gescheitelt trägt, und ebenso schwarze, unergründlich wirkende Augen. Doch das beherrschende Element ihres Gesichts ist ihre kühne Nase, die mitunter an den Bug eines Eisbrechers denken lässt.
Im selben Moment, in dem Anna ihre Endposition erreicht hatte, öffnete sich die Tür, und Lestari brachte ein Tablett mit Teegeschirr, einer Kanne und Keksen herein. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie die beiden sich verständigen, aber ich vermute, telepathisch.
Und wie immer, wenn sie mit ihrer Tochter sprach, verwandelte sich Annas ganze Haltung und Ausstrahlung völlig. Alles Kratzbürstige verschwand wie nie gewesen, stattdessen strahlte sie das Mädchen an und sagte sanft: »Danke, Liebes. Du bist ein Schatz.«
Worauf Lestari ebenso strahlend Tassen und Untertassen verteilte, eingoss und mit einem Lächeln wieder entschwand.
Einen Schluck später war die Anna wieder da, die ich kannte. »Kommen wir zur Sache«, sagte sie. »Was wissen Sie über die Firma Youvatar?«
»Youvatar?« Ich nahm einen Schluck Tee, um nachzudenken. »Ein Start-up, das vor, na, sieben oder acht Monaten gegründet worden ist. Typisches Silicon-Valley-Gewächs. Es ist uns aufgefallen, weil der Investor Peter Young mit eingestiegen ist. Was trotz allem, was man ihm nachsagen kann, ja tatsächlich so etwas wie eine Erfolgsgarantie ist. Normalerweise jedenfalls. In diesem Fall aber hat man seither nichts mehr von der Firma gehört – keine Produktankündigung, keine Werbekampagne, nichts über einen geplanten Börsengang und auch sonst nichts.«
Ich staune manchmal selber, was für ein Gedächtnis ich für derlei Dinge habe. Aber natürlich hätte sie mir diese Frage besser gestellt – oder von ihrer Tochter stellen lassen –, als ich noch im Büro war, dann hätte ich alle Unterlagen mitbringen können, die sich in unseren Datenbanken finden ließen. Und in unseren Datenbanken findet sich fast immer eine Menge.
Vor allem über Peter Young. Der Investor war eine schillernde Gestalt und ein Liebling der Medien. Gern wurde über ihn kolportiert, dass er es liebte, schnelle Motorräder zu fahren, immer noch und zum Entsetzen seiner Geschäftspartner. Weniger bekannt war, dass er in jungen Jahren der amerikanischen Fechtmannschaft angehört und an einer Olympiade teilgenommen hatte, allerdings ohne eine Medaille nach Hause zu bringen.
Ja, und vor allem galt er eben als jemand, der eine Nase für gute Geschäfte hatte und dann auch vor keinem Risiko zurückschreckte.
»Hm«, machte Anna. »Und weiter?«
Noch etwas mehr Tee half meinem Gedächtnis weiter auf die Sprünge. Wenn man erst einmal einen Faden hat, an dem man ziehen kann, führt er einen ja oft zu vergessen geglaubten Dingen. »Die Gründer der Firma sind zum einen Victoria Watson, eine ziemlich bekannte Gentechnik-Unternehmerin und so etwas wie das Covergirl des Silicon Valley, zum anderen Ralph Arnesen, ein als genial geltender Erfinder. Wir vermuten, dass er die eigentliche Schlüsselfigur ist. Victoria Watson ist CEO von Forgenetics, einer Firma, die glänzend dasteht und stetig expandiert. Sie ist rund achtzig Millionen Dollar wert, wobei sie viel von ihrem Geld in eine Stiftung gesteckt hat – zu welchem Zweck, das müsste ich nachsehen. Wir denken, dass sie hier einen ersten Versuch als Venture Capitalist macht und dass eine noch unbekannte Erfindung von Arnesen die Geschäftsgrundlage von Youvatar sein soll. Der Firmenname lässt vermuten, dass es auf irgendeine Weise um Computerspiele geht, womöglich mit besonderem Schwerpunkt auf Virtual Reality.«
Anna musterte mich wie eine strenge Lehrerin, die mit einer Antwort unzufrieden ist. »Das schließen Sie aus dem Firmennamen?«, fragte sie, als könne sie es nicht fassen.
»Nun ja«, sagte ich. »Youvatar – das erinnert vom Klang her an das Wort Avatar, und das wiederum bezeichnet das virtuelle Selbst in einem Computerspiel. Also, die Figur, die jemand darstellt und steuert, meine ich. Und man hat auch die Assoziation YouTube – Youvatar, was irgendwie in dieselbe Richtung geht. Natürlich ist das geraten, aber mehr haben wir nicht. Die Firma wurde gegründet, hat ein Firmengebäude angemietet, vierzig Leute eingestellt – doch es ist nicht zu erfahren, was sie eigentlich vorhat, der Welt anzubieten.«
Sie schnaubte. »Haben Sie sich mal das Firmenlogo angeschaut?«
»Das Firmenlogo?« Es schien an diesem Abend mein Schicksal zu sein, ihre Fragen zu wiederholen. Ich versuchte, mich an das Logo zu erinnern. »Ja, ich meine, das habe ich gesehen. Aber es ist nichts Besonderes. Einfach der Name in Großbuchstaben. In einer serifenlosen Schrift, schätzungsweise in der Avenir.«
»Also haben Sie es sich nicht angeschaut«, urteilte Anna, packte ihren Steuerhebel und sauste zu ihrem Schreibtisch. Gleich darauf kehrte sie mit einem an ihr Büro adressierten Briefumschlag zurück, auf den in der linken oberen Ecke das Logo von Youvatar aufgedruckt war, und drückte ihn mir in die Hand.
Es war der Name. In Großbuchstaben. In einer serifenlosen Schrift. So, wie ich es gesagt hatte.
»Und?«, fragte ich. »Was hätte mir auffallen sollen?«
»Das V«, sagte sie. »Schauen Sie mal genau hin.«
Ich sah genau hin. Der Buchstabe V sah aus, als werfe er einen Schatten, während alle anderen Buchstaben das nicht taten. »Er wirft einen Schatten. Der einzige grafische Effekt an der Sache.«
»Aber angenommen, es ist kein Schatten. Dann wäre das kein V, sondern ein W. Und nun unterteilen Sie den Namen mal so …«
Sie hatte einen Bleistift mitgebracht, beugte sich vor und zeichnete zwei Striche ein, sodass der Firmenname so aussah:
YOU | WAT | AR
»Die Anfangsbuchstaben der Namen!«, erkannte ich und ärgerte mich nicht schlecht, dass ich da nicht selber drauf gekommen war. »YOU für Young, WAT für Watson und AR für Arnesen!«
»Genau. Und jetzt sag ich Ihnen mal, was ich über diese Firma denke.« Sie zupfte mir den Briefumschlag wieder aus der Hand und surrte zurück zu ihrer Teetasse. »Victoria Watson ist nicht einfach nur irgendeine Gründerin, die halt eine Marktlücke entdeckt hat und damit erfolgreich ist, sondern eine wirklich innovative Forscherin. Die Grundlage von Forgenetics ist das Cotteril-Watson-Verfahren, das sie zusammen mit Joy Cotteril entwickelt hat, mit der sie in ihrem ersten Jahr in Harvard im selben Zimmer war. Mir gehören zwei pharmazeutische Werke, ich habe mit den Laborleitern dort telefoniert, und beide sagen, ohne die Produkte von Forgenetics könnten sie zumachen.«
»Verstehe«, murmelte ich und wunderte mich einmal mehr, wie gut Anahit Kevorkian informiert war: Als hätte sie außer meiner Zeitung noch einen geheimen Nachrichtendienst.
»Dann Ralph Christian Arnesen. Ein anerkanntes technisches Genie, das sich zwar, da haben Sie recht, schon auf vielen Gebieten betätigt hat – Sie könnten übrigens mal rausfinden, wie viele Patente dem Mann eigentlich gehören –, aber sein Hauptgebiet ist die Nanotechnologie. Er hat das Standardwerk dazu geschrieben, berät den Präsidenten in allen Fragen dazu, hat mehr Ehrendoktorhüte, als auf einen Kopf passen … und dabei ist der Kerl erst siebenunddreißig! Da kann also noch viel kommen.«
»Und was«, fragte ich, »denken Sie, dass da noch kommt?«
»Logischerweise irgendwas, bei dem Gentechnik – oder Biologie – und Nanotechnik miteinander kombiniert werden.«
»Und wie passt Peter Young da hinein?«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Er wittert ein großes Geschäft, was sonst? Was anderes macht der Mann ja nicht. Außer Geld und großen Sprüchen, was er alles viel, viel besser machen würde, wenn er nur Präsident wäre.«
»Was er nicht werden kann, weil er nicht in den USA geboren ist.«
Anna grinste haifischartig. »Das grämt ihn unglaublich.«
Ich nahm einen Keks und deutete damit, ehe ich ihn seiner Bestimmung zuführte, auf den Umschlag in ihrer Hand. »Wie kommt es überhaupt, dass Sie einen Briefumschlag von der Firma Youvatar besitzen?«
»Endlich stellen Sie mal die wirklich relevanten Fragen«, erwiderte sie und hob den Umschlag hoch, als wäre er eine Trophäe. »Die haben mir geschrieben, ganz einfach. Und zwar haben sie mir eine Einladung geschickt zu einem Investorentreffen, bei dem sie … wie haben die das formuliert?« Sie blickte zu ihrer Schreibtischfestung hinüber, schien aber dann doch keine Lust zu haben, den Brief zu suchen und nachzuschauen. »Na, jedenfalls laden sie einen ausgewählten Kreis von Besitzern dicker Brieftaschen ein, um ihnen ihre Firma vorzustellen und dabei Geld einzusammeln, darauf läuft’s hinaus. Und alles supergeheim, weil alles derart superinnovativ ist, dass sie damit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Irgendwie so.«
»Klingt … dubios«, sagte ich.
»Extrem dubios«, pflichtete sie mir bei. »Ich war dicht davor, den Brief wegzuwerfen. Aber dann hab ich’s doch nicht getan, und zwar, ehrlich gesagt, weil Peter Young dabei ist. Der Mann hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Der würde sich nie im Leben an einem Schwindelunternehmen beteiligen.«
Ich nickte. »Sehe ich auch so.«
»Also habe ich die anderen beiden Namen in der Wikipedia nachgeschlagen und gedacht, hm, vielleicht ist ja doch was dran. Bloß was?«
»Und?«, fragte ich. »Gehen Sie hin?«
Sie kaute ein bisschen auf der Antwort herum. »Bis gestern war ich mir unschlüssig. Einerseits, andererseits. Sie kennen das bestimmt.«
Ja, dachte ich, aber nicht von Anahit Kevorkian.
»Bis mir«, fuhr sie fort, »gestern Abend ein Gedanke kam.«
»Aha?«, machte ich.
Sie beugte sich vor und stützte die Ellbogen auf die Armlehnen. »Es ist natürlich nur eine Vermutung. Aber was könnte man erreichen, wenn man Genetik und Nanotechnik miteinander kombiniert?«
»Puh«, meinte ich. »Da dürften die Möglichkeiten endlos sein.«
»Ja, aber was davon verspräche, so lukrativ zu sein, dass ein Peter Young einsteigt?«
»Das«, gab ich zu, »schränkt die Bandbreite schon etwas ein.«
Sie führte die Fingerspitzen ihrer Hände zusammen und sagte ahnungsvoll: »Mir fallen zwei Möglichkeiten ein, mit denen sich jeweils unermesslich viel Geld verdienen ließe … und die mir beide sehr gefallen. Die eine wäre, den Alterungsprozess des Körpers zu stoppen oder sogar wieder rückgängig zu machen – also eine Verjüngungskur. Reichlich utopisch, zugegeben. Die andere, eher in Reichweite: die Heilung von Querschnittslähmung. Nanoroboter, die durchtrennte Nervenbahnen im Rückenmark wieder verbinden, und Gentechnik, die sie dazu anregt, zusammenzuwachsen und zu funktionieren wie vorher. Und die Lahmen erheben sich und gehen wieder. Wie klingt das für Sie?«
Mir war, ich gestehe es, ein Schauer über den Rücken gelaufen, als sie das gesagt hatte. Sie hatte recht, erkannte ich. Die Kombination der Talente hinter dieser Firma mochte tatsächlich geradezu Phantastisches in den Bereich des Machbaren rücken.
»Absolut plausibel«, sagte ich. »Und ich schätze, die zweite Möglichkeit gefällt Ihnen noch viel mehr als mir.«
»Darauf können Sie einen lassen«, erwiderte sie. »Und deshalb möchte ich, dass Sie an meiner Stelle zu diesem Investorentreffen gehen, sich alles ganz genau anschauen und mir hinterher raten, ob ich in diese Firma investieren soll oder nicht.«
Mir fiel fast die Tasse aus der Hand. »Ich?«
»Sie. Ja.«
»Warum denn das?«
»Weil ich zu befangen wäre!« Sie schnaubte. »Das ist mir heute früh beim Aufwachen klar geworden. Deswegen habe ich Sie doch gleich hergebeten! Mir könnten die alles versprechen, ich würde es glauben. Ich brauche jemand, der einen neutralen Standpunkt hat. Der imstande ist, die Sache nüchtern zu betrachten. Also Sie. Es ist dasselbe wie bei Ihrer Zeitung. Wir haben viel darüber gesprochen, erinnern Sie sich? Darüber, wie man überhaupt so etwas wie einen einigermaßen objektiven Standpunkt, eine objektive Sicht auf die Dinge gewinnen kann?«
Ich nickte langsam. Natürlich erinnerte ich mich, gut sogar. »Man muss sich beim Berichten über eine Sache darüber klar sein, was man sich wünscht, dass es wahr wäre. Nur dann hat man eine Chance, zu berichten, ohne dass der Bericht durch diesen Wunsch gefärbt wird.«
»Genau. Und mein Wunsch ist so stark, dass ich ihn schon in die bloße Kombination dieser drei Leute hineinprojiziere!«, rief sie aus, hieb dann auf ihren Steuerhebel und schoss davon, damit ich ihre Tränen nicht sehen konnte. Die ich aber trotzdem gesehen hatte.
Sie rollte zu einem gedrechselten Tischchen, auf dem ein Rahmen mit einem Foto ihres Mannes stand. »Ich würde ohne Bedenken die Hälfte meines Vermögens hergeben, wenn ich dann wieder gehen könnte wie früher«, stieß sie hervor, den Blick auf das Bild gerichtet, als rede sie gar nicht mit mir. »Und … und den Rest auch noch, alles, bis auf den letzten Penny, wenn sie mich wieder jünger machen würden und ich die Chance hätte, zwanzig Jahre Sex nachzuholen!«
Ich schwieg betreten, wie es sich für einen Engländer bei diesem Thema gehört.
»Wissen Sie, James«, sagte sie nach einer Weile mit ungewöhnlich sanfter Stimme, indem sie das gerahmte Foto an sich nahm und es sehnsuchtsvoll betrachtete, »wenn Edvard als Investor nur halb so wagemutig und phantasievoll gewesen wäre, wie er im Bett war, dann wäre er der reichste Mann der Welt geworden.« Sie lachte auf, und nun hörte man ihre Tränen. »Oder der ärmste, wer weiß das schon. Aber dann hätte er sich wenigstens keine schnellen Autos leisten können, und wir hätten immer noch das herrlichste Leben.«
Eine Weile saß sie so da, in Erinnerungen versunken, und streichelte den schweren Silberrahmen.
Dann stellte sie das Bild wieder an seinen Platz, drehte ihren Rollstuhl in meine Richtung und sagte: »So, genug Sentimentalität für heute. Das ist meine Bitte an Sie, James: Gehen Sie zu diesem Investorentreffen bei Youvatar und finden Sie heraus, ob das, was die vorhaben, Hand und Fuß hat.«
Ich unterdrückte ein Seufzen und fragte gefasst: »Wann findet dieses Treffen denn statt?«
»Am kommenden Wochenende.«
»Am kommenden Wochenende?«, rief ich entsetzt aus.
»Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag«, sagte Anna und fügte hinzu: »Sie kriegen mein Privatflugzeug, um nach Kalifornien zu fliegen. Damit Sie wenigstens unterwegs nicht leiden müssen.«
»Aber, Anna, das ist … Heute ist Montag. Morgen bin ich erst am Nachmittag wieder in der Redaktion. Dann bleiben der Mittwoch, der Donnerstag und vielleicht noch der Freitag für Recherchen … Das ist zu kurz! Viel zu kurz!«
»Ich weiß. Hätte mir alles viel früher einfallen sollen. Ist aber halt nicht so gewesen.«
Ich hatte Mühe, mich wieder zu fassen, doch da mir klar war, dass ich diese Bitte unmöglich abschlagen konnte, sagte ich: »In Ordnung. Ich tue, was ich kann.«
Mir blieb die Hoffnung, dass sich in unseren Datenbanken mehr Informationen über Youvatar befanden, als ich kannte, als Beifang von Recherchen zu anderen Themen vielleicht. Derlei kam häufig vor, weil es leicht ist, etwas abzuspeichern, aber aufwendig, es auszuwerten.
»Ich danke Ihnen, James«, sagte Anahit Kevorkian und wirkte einen Moment lang auf eine Weise erschöpft, wie ich sie gar nicht kannte. Dann lächelte sie wieder schelmisch. »Hatte ich recht, als ich gesagt habe, Sie würden es bedauern, nicht so schnell wie möglich zu kommen?«
Ich erhob mich zum Gehen. »Sie haben doch immer recht, Anna.«
* * *
Lestari bestellte mir ein Taxi an die nächstgelegene Straßenecke und verabschiedete mich so fröhlich, dass mir erst draußen auf der Straße allmählich aufging, worauf ich mich da eingelassen hatte.
Nicht, dass ich wirklich eine Wahl gehabt hätte.
In diesen reichen Vierteln ist so gut wie nie jemand zu Fuß unterwegs; ich stand ganz allein da, als ich die Kreuzung erreicht hatte. Also wagte ich es, mein Telefon zu zücken und in der Redaktion anzurufen.
Ich bekam Rens Reijnders an den Apparat. Rens ist ein drahtiger, topfitter Mann, der allerlei Extremsportarten wie Freeclimbing oder Basejumping betreibt und bisher auch überlebt hat, und er ist vier Jahre älter als ich – verglichen mit ihm bin ich ein Couch-Potato. Leicht befremdet, weil es nicht zu meinen Gewohnheiten gehört, von unterwegs anzurufen, klärte er mich darüber auf, dass Marta schon nach Hause gegangen war und er nur noch die Stellung hielt, bis Gilbert Le Bras, der diese Woche Nachtdienst hatte, vom Zigarettenholen zurück war.
»Ich kann Sie mit Octavia verbinden, die ist noch da«, bot er in seiner typisch brummigen Art an.
»Nein, nein, Sie sind schon der Richtige«, sagte ich. Das mit Octavia wunderte mich nicht, irgendwie scheint sie immer da zu sein. »Schauen Sie mal bitte im System nach, es müsste einen offenen Vorgang geben unter dem Stichwort Youvatar. Mit Ypsilon. Angelegt vor, na, acht, neun Monaten etwa.«
Anders als normale Zeitungen, die gern Sensationsmeldungen über irgendeine Sache bringen und sich dann, getreu dem Motto »Nichts ist so alt wie die Zeitung vom Vortag«, nicht weiter darum kümmern, verfolgen wir alle Themen so lange, bis wir abschließend wissen, was daraus geworden ist.
»Youvatar«, las er mir vor. »Start-up, Kalifornien, Gründer Victoria Watson –«
»Ja, das ist es«, unterbrach ich ihn. »Setzen Sie das bitte auf höchste Priorität.«
»Ernsthaft? Auf A plus?«
»Ja. Und schreiben Sie eine Rundmail an alle, damit es auch jeder mitkriegt. Schreiben Sie dazu, dass ich morgen Nachmittag zurückkomme, so gegen siebzehn Uhr, und dass wir dann eine Sonderbesprechung machen. Ich will alles wissen, was wir über diese Firma haben.«
»Okay. Mach ich.«
Dann rief ich Marta an. Ich kenne ihre Mobilnummer, auswendig sogar, aber sie hat es sich streng verbeten, dass diese Nummer in beruflichen Angelegenheiten verwendet wird. »Höchstens, wenn die Firma brennt«, hat sie es formuliert. »Alles andere kann warten.«
Deswegen rief ich bei ihr zu Hause an.
Während es klingelte, machte ich mich auf Vorwürfe gefasst, aber dann ging Theo ran, ihr Ehemann. »Marta ist beim Frauenabend der Kirchengemeinde«, sagte er. »Soll ich ihr was ausrichten?«
Im Hintergrund hörte man Kinder ausgelassen kichern.
Theo Udenthal hat damals, als ich in der Gründungsphase war und eine Software für die sichere Verteilung meiner geplanten Zeitung suchte, bei einer niederländischen Computerfirma gearbeitet, die mir empfohlen worden war. Er hat mich gründlich beraten, aber letztlich ist aus der Zusammenarbeit mit seiner Firma nichts geworden. Doch im Lauf der Gespräche habe ich seine Frau Marta kennengelernt, die Betriebswirtschaft studiert hat, mit einem glänzenden Abschluss überdies. Nach allerlei Hin und Her fanden wir die Lösung, dass Theo sich den lang gehegten Wunsch erfüllte, selbstständig von zu Hause aus zu arbeiten (und sich um die vier Kinder zu kümmern), während Marta bei The Windover View einstieg und das Organisatorische übernahm.
Und heute wüsste ich offen gestanden nicht, wie ich ohne sie zurechtkäme. »Ja, richte ihr bitte aus«, sagte ich, »dass ich Rens gebeten habe, einen bestimmten Vorgang auf höchste Priorität hochzustufen. Sie soll sich das anschauen und dahinter her sein, dass es auch alle mitkriegen. Alles Weitere erkläre ich ihr morgen, wenn ich zurück bin.«
»Rens … Vorgang A plus anschauen …«, murmelte Theo, während er eine Notiz schrieb. »Wo bist du denn grade?«
»In London.«
»Die alte Heimat, verstehe. Okay, hab’s notiert.« Er räusperte sich. »Sag mal, ist ansonsten alles in Ordnung? Mit der Firma und so?«
»Ja, doch, alles gut«, sagte ich so automatisch, wie man so etwas eben sagt. »Wieso fragst du?«
»Weil Marta ziemlich, hm … angesäuert war, als sie heimgekommen ist. Gar nicht ihre Art, wenn du verstehst, was ich meine.«
Das verstand ich nur zu gut.
»Wir haben gerade ein wenig Stress«, behauptete ich. »Und wir hatten noch keine Zeit, in Ruhe darüber zu reden. Aber das machen wir morgen Nachmittag, sobald ich zurück bin.«
Dann kam mein Taxi. Ich winkte dem Fahrer, verabschiedete mich rasch, nahm mein Köfferchen auf und versuchte, das Ganze für den Rest des Abends zu vergessen.
Kapitel 3
Joan und ich hatten uns etwa vier Jahre zuvor kennengelernt, und zwar ausgerechnet in Notting Hill und auf ganz ähnliche Weise, wie sich in dem gleichnamigen Film die von Julia Roberts und Hugh Grant gespielten Figuren begegnen – nur mit vertauschten Rollen: In unserem Fall war es Joan, die mich aus Versehen mit dem Inhalt ihres Bechers übergossen hat, und es war kein Orangensaft, sondern frischer Kaffee. Heiß also. Ich hatte bis dahin nicht gewusst, wie unangenehm heißer Kaffee auf einem Hemd sein kann.
Ich assoziiere das deshalb mit diesem Film, weil ich als Fünfzehnjähriger die Dreharbeiten verfolgt habe. Von meinem Elternhaus in Harlesden war es etwa eine Viertelstunde mit dem Fahrrad zu den Drehorten gewesen, und ich weiß nicht mehr, wie oft ich diese Strecke damals, im Mai 1998, gefahren bin in der Hoffnung, Julia Roberts zu sehen oder sogar mit ihr zu sprechen. Gesehen habe ich sie, aber mehr habe ich mich dann doch nicht getraut, ganz davon abgesehen, dass es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. (Falls Sie sich die Drehorte einmal selber anschauen wollen: Das Haus mit der blauen Tür befindet sich in 280 Westbourne Park Road, hat in der Zwischenzeit aber mehrmals den Besitzer gewechselt, und die Tür war lange Zeit nicht mehr blau, weil einfach zu viele Touristen kamen. Und der Laden, der im Film Wills Bookshop ist, hat die Adresse 142 Portobello Road.)
In ebenjener Portobello Road findet der gleichnamige Straßenmarkt statt, der insbesondere samstags ein wunderbares Spektakel ist, das jede Menge Touristen anzieht und von dem auch ich mich immer wieder anziehen lasse, wenn ich in London bin und sich die Gelegenheit bietet. Nicht, weil mich Antiquitäten übermäßig interessieren oder ich Kleidung von fliegenden Händlern kaufen will, sondern einfach, um mich treiben zu lassen und die Atmosphäre zu genießen. Obwohl sich viel verändert hat in all den Jahren, ruft der Portobello Road Market immer noch Erinnerungen an das London meiner Kindheit wach.
Nun, und bei einem dieser Bummel passierte es. Ich hatte an einem Stand alte Stempel befingert, wollte mich umdrehen und weitergehen – wurde aber von einem heißen Schwall auf der Brust gestoppt.
Joan war an diesem Tag zum ersten Mal auf dem Markt gewesen, zusammen mit ihrer Freundin Bethany. Sie hatte zwei Becher Kaffee gekauft, sich unterwegs von einem antiken, in Silber gerahmten Spiegel ablenken lassen, und als sie sich hastig nach ihrer Freundin umdrehte, tat sie es im selben Moment, in dem ich mich von der Stempelsammlung losriss.
Offen gestanden habe ich den Schmerz des heißen Kaffees im ersten Moment kaum wahrgenommen, so hingerissen war ich von ihrem Anblick. Sie war die schönste Frau, die mir je begegnet war, und ich begriff erst gar nicht, warum sie mich so bestürzt ansah und mit einem Taschentuch auf meinem Hemd herumtupfte … aber ich genoss es.
Wie sie das wiedergutmachen könne, fragte sie ganz aufgelöst, und ich hatte zum Glück die Geistesgegenwart, zu erwidern: »Indem Sie heute Abend mit mir essen gehen.«
Am selben Abend ließ es sich dann zwar nicht einrichten, aber wir verabredeten uns für den nächsten. Das gab mir Gelegenheit, einen Tisch im damals angesagtesten Restaurant Londons zu reservieren, im Palomar in Soho, unweit des Piccadilly Circus.
Ich weiß nicht mehr genau, was wir an diesem Abend aßen. Ich erinnere mich an eine lange Bartheke, an eng gestellte Tische, an mit schwarzem Leder überzogene Sitzbänke, an eigenwillige Tischlampen, an den Geschmack von Lammfleisch, gebratenen Auberginen, heißem Fladenbrot und Polenta. Vor allem aber erinnere ich mich daran, dass wir in einem fort lachten, was mir weiß Gott selten mit jemandem passiert. Und daran, dass sie geistreich war und klug und schön, umwerfend schön.
Tatsächlich war ich überzeugt gewesen, sie müsse von Beruf Fotomodell oder dergleichen sein, doch nein, sie war Ärztin im St. Mary’s Hospital, wirklich und wahrhaftig. Ich hingegen musste ihr gestehen, dass ich zwar in London geboren, aber nicht mehr dort wohnhaft war. Im Hinblick auf das von Premierminister Cameron angekündigte Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU hatte ich meine Zeitung vorsichtshalber in den Niederlanden gegründet. Mit anderen Worten, vernünftigerweise durfte ich von dieser Verabredung nicht mehr erwarten als eben einen angenehmen Abend mit einer faszinierenden Frau, und das genoss ich, so gut ich konnte.
Wir waren unter den letzten Gästen, die das Lokal verließen. Ich begleitete sie nach Shoreditch, wo sie ein Apartment in einem der besseren Hochhäuser besaß. Vor ihrer Haustür tauschten wir Telefonnummern aus, für alle Fälle, versprachen einander, uns irgendwann wiederzusehen, ich bekam einen Abschiedskuss auf die Wange gehaucht, und damit war es vorbei.
Zumindest sah es so aus. Ich wollte noch am Straßenrand ausharren, bis sie sicher im Haus war, sie kramte in ihrer Tasche nach dem Hausschlüssel, hielt plötzlich inne und meinte: »Wozu auf ein nächstes Mal warten? Das Leben ist so kurz … Wenn dir das Chaos in meiner Wohnung nichts ausmacht, in der Küche kann man auf jeden Fall gut sitzen. Hast du vielleicht noch Lust, auf einen Tee mit hochzukommen?«
Natürlich hatte ich das.
Natürlich war das mit dem Chaos in ihrer Wohnung glatt gelogen.
Und natürlich blieb es nicht bei einem Tee.
* * *
Inzwischen habe ich einen Schlüssel zu ihrer Wohnung (und sie einen zu meiner, versteht sich), aber sie hat sich ausbedungen, dass sie mich nie überraschend vorfinden wird, wenn sie nach Hause kommt; sie will immer vorgewarnt sein.
Was an diesem Abend ja der Fall war. Ich kam vor ihr an, räumte rasch ein wenig auf, leerte die Geschirrspülmaschine und dergleichen mehr. In Haushaltsdingen, um das an dieser Stelle anzumerken, bin ich durchaus erfahren. Notgedrungen, denn ich könnte mir zwar problemlos eine Haushaltshilfe leisten, aber mir missfällt die Vorstellung, dass jemand Fremdes sich in meiner Abwesenheit in meiner Wohnung betätigt. Lieber mache ich es selber. Nur meine Hemden bringe ich zu einem Wäschereiservice, der sie wäscht und bügelt und mir wieder nach Hause liefert: Gegen Outsourcing habe ich nichts.
Ich bereitete aus dem, was ich unterwegs rasch eingekauft hatte, und dem, was ich in ihrem Kühlschrank vorfand, ein kleines Abendessen, deckte schon mal den Tisch und stellte den Wein bereit. Das Essen würde nicht mit dem an unserem ersten Abend mithalten können, aber das machte ja nichts.
So sieht unsere Beziehung aus: Wann immer ich nach London komme, besuche ich sie, vorausgesetzt, es lässt sich mit ihrem Schichtplan und anderweitigen Verpflichtungen oder Terminen vereinbaren. Manchmal verabreden wir uns auch, zum Beispiel, wenn Joan ein paar freie Tage hat und wir etwas unternehmen können. Und wenn sie gar Urlaub hat – was selbst beim NHS bisweilen vorkommt –, fährt Joan zu mir nach Amsterdam, der bewährten Strategie aller im Gesundheitswesen Beschäftigten folgend, im Urlaub nur ja nicht zu Hause und »im Notfall verfügbar« zu bleiben. In dieser Zeit leben wir dann in meiner Wohnung wie Mann und Frau zusammen, unternehmen Ausflüge oder genießen einfach nur unser Beisammensein. Sogar zwei »richtige« Urlaubsreisen haben wir schon gemacht, und alles in allem liegt unser Rekord bei fünfzehn Tagen Gemeinsamkeit. Wobei ich glaube, dass wir es auch länger miteinander aushalten würden, aber nach einer gewissen Zeit ruft eben die Pflicht, und das ist ein Ruf, auf den Joan unbedingt hört; sie ist eine geradezu leidenschaftliche Ärztin.
Tatsächlich war die Distanz zwischen unseren Wohnorten und Lebensmittelpunkten kein Hindernis für unsere Beziehung, sondern hat sie im Gegenteil erst möglich gemacht: Es war nämlich gerade der Umstand, dass auf absehbare Zeit keiner von uns beiden seinen Wohnsitz wechseln würde, der Joan bewogen hat, mir eine Chance zu geben.
Das hat, wie ich später erfahren habe, eine traurige Vorgeschichte: Und zwar hat sich die Beziehung mit ihrem ersten Freund, ihrer ersten großen Liebe, die während ihres Studiums begann, nach einiger Zeit in einen Albtraum aus Besitzansprüchen und Gewalttätigkeiten aller Art verwandelt. Nachdem sie endlich Schluss gemacht hatte, mutierte der Betreffende zum Stalker. Als sie eines Abends nach Hause kam, erwartete er sie schon in ihrer Wohnung, aus tiefen Schnitten in die Pulsadern beider Handgelenke blutend. Es bedurfte mehrerer Polizeieinsätze und eines langwierigen Gerichtsverfahrens, ehe sie ihn los war; er lebt heute in einer psychiatrischen Anstalt.
Als Joan an diesem Abend eintrudelte, sah sie so blass und müde aus, als hätte sie gerade ein vergleichbares Drama hinter sich. »Frag nicht«, sagte sie, als ich sie ansah, also fragte ich nicht, sondern schickte sie unter die Dusche. Während das Wasser rauschte, sorgte ich dafür, dass das Essen auf den Tisch kam.
Frisch geduscht und in gemütlicher Kleidung wirkte sie schon etwas entspannter, klagte aber immer noch, sie wisse nicht, was mit ihr los sei.
»Das ist doch nicht schwer zu erraten«, meinte ich. »Es ist Herbst, die Leute werden krank, und ihr habt zu wenig Personal – das ist los.«