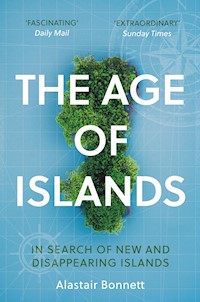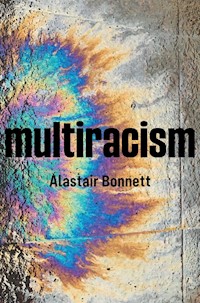9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Arktis gibt das zurückweichende Eis nie von Menschen betretene Inseln frei, der Likouala-Sumpf im Kongo wartet bis heute auf seine geographische Erfassung, Städte wie Hong Kong oder São Paulo verlieren buchstäblich ihre Bodenhaftung. Doch das Allersonderbarste, so die feste Überzeugung des Autors, ist fast immer vor der eigenen Haustür zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alastair Bonnett
Die allerseltsamsten Orte der Welt
Aufsteigende Inseln, bodenlose Städte, abseitige Paradiese
Aus dem Englischenvon Andreas Wirthensohn
C.H.Beck
Zum Buch
Nach dem großen Erfolg der «Seltsamsten Orte der Welt» nimmt uns Alastair Bonnett zu 39 weiteren Exkursionen mit: Wir erkunden mehr oder auch weniger paradiesische Archipele, betrachten sehr gegenwärtige Versuche, ein Utopia oder eine Mauer zu errichten, und begegnen in entlegenen Gebirgstälern einer alten Sprache, die andernorts längst verschwunden ist. Doch das Allersonderbarste, so die feste Überzeugung des Autors, ist fast immer vor der eigenen Haustür zu finden.
Eines haben die sehr verschiedenen Orte, von denen Bonnett berichtet, gemeinsam: Sie lassen uns darüber staunen, welche Geheimnisse in unserer durchkartierten Welt noch zu entdecken sind. In der Arktis gibt das zurückweichende Eis nie von Menschen betretene Inseln frei, der Likouala-Sumpf im Kongo wartet bis heute auf seine geographische Erfassung, Städte wie Hongkong oder Săo Paulo verlieren buchstäblich ihre Bodenhaftung. Alastair Bonnett erkundet Geisterstädte, inspiziert die Behausungen moderner Nomaden und versucht sich, ausgestattet mit einer digitalen Erntekarte, als Wildbeuter in Helsinki. Dieses hinreißende Buch ist eine Einladung, der Magie von Orten nachzuspüren und die Welt im Großen wie im Kleinen neu zu entdecken.
Über den Autor
Alastair Bonnett lebt in Newcastle upon Tyne und ist dort Professor für Sozialgeographie. Seine Leidenschaft ist das Reisen – im Kopf, auf der Landkarte und in der Realität. Bei C. H.Beck erschien 2015 sein Bestseller «Die seltsamsten Orte der Welt» (Hardcover 82017; Paperback 52018)
Inhalt
Einleitung
I.: Ungebärdige Inseln
Les Minquiers – 48° 57ʹ 01.6ʺ nördlicher Breite; 2° 07ʹ 58.5ʺ westlicher Länge
Kleinere entlegene Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten und Vereinte Mikronationen Multiozeanischer Inselgruppe – 19° 27ʹ 20.1ʺ nördlicher Breite; 179° 53ʹ 54.1ʺ westlicher Länge
Die neuen Spratly-Inseln – 10° 43ʹ 41.7ʺ nördlicher Breite; 115° 49ʹ 56.1ʺ östlicher Länge
Die sich hebenden Inseln im Bottnischen Meerbusen – 62° 07ʹ 38.1ʺ nördlicher Breite; 19° 24ʹ 37.8ʺ östlicher Länge
534 Entdeckungen auf den Philippinen
Wilde Erdbeeren: Verkehrsinsel – 54° 58ʹ 53.1ʺ nördlicher Breite; 1° 36ʹ 26.5ʺ westlicher Länge
II.: Enklaven und unsichere Nationen
Die ladinischen Täler – 46° 17ʹ 59.3ʺ nördlicher Breite; 12° 13ʹ 41.0ʺ östlicher Länge
Der Eruv am Bondi Beach – 33° 53ʹ 28.9ʺ südlicher Breite; 151° 16ʹ 36.6ʺ östlicher Länge
Das Ferghanatal – 40° 44ʹ 23.9ʺ nördlicher Breite; 71° 34ʹ 20.5ʺ östlicher Länge
Der Sandwall in der Sahara – 24° 06ʹ 03.9ʺ nördlicher Breite; 13° 17ʹ 42.8ʺ westlicher Länge
Neurussland
Der Souveräne Malteserorden – 41° 54ʹ 19.1ʺ nördlicher Breite; 12° 28ʹ 50.9ʺ östlicher Länge
Die Republik Stratford – 54° 58ʹ 50.3ʺ nördlicher Breite; 1° 35ʹ 30.3ʺ westlicher Länge
III.: Utopische Orte
Der Islamische Staat
Cybertopia
Die neuen Nomaden
Nek Chands Felsengarten – 30° 45ʹ 10.2ʺ nördlicher Breite; 76° 48ʹ 35.1ʺ östlicher Länge
Christiania – 55° 40ʹ 34.5ʺ nördlicher Breite; 12° 36ʹ 30.5ʺ östlicher Länge
Wilde Ernte in Helsinki – 60° 10ʹ 11.6ʺ nördlicher Breite; 24° 56ʹ 18.3ʺ östlicher Länge
Die Helikopterstadt – 23° 33ʹ 13.2ʺ südlicher Breite; 46° 37ʹ 32.7ʺ westlicher Länge
Die bodenlose Stadt – 22° 19ʹ 35.5ʺ nördlicher Breite; 114° 10ʹ 17.8ʺ östlicher Länge
IV.: Gespenstische Orte
Der Phantomtunnel im Bahnhof Shinjuku – 35° 41ʹ 22.7ʺ nördlicher Breite;139° 42ʹ 01.6ʺ östlicher Länge
Fußgängerbrücken – 54° 58ʹ 20.0ʺ nördlicher Breite; 1° 36ʹ 29.5ʺ westlicher Länge
Boys’ Village – 51° 23ʹ 54.0ʺ nördlicher Breite; 3° 24ʹ 14.6ʺ westlicher Länge
Der britische Friedhof in Shimla – 31° 05ʹ 42.1ʺ nördlicher Breite; 77° 09ʹ 50.6ʺ östlicher Länge
Der Drehort des Films Dau – 49° 59ʹ 29.1ʺ nördlicher Breite; 36° 13ʹ 57.3ʺ östlicher Länge
Magisches London – 51° 31ʹ 55.3ʺ nördlicher Breite; 0° 09ʹ 15.4ʺ westlicher Länge
Tsunami-Steine und Atom-Markierungen
V.: Versteckte Orte
Die Müllstadt in Kairo – 30° 01ʹ 20.1ʺ nördlicher Breite; 31° 18ʹ 12.2ʺ östlicher Länge
Jenseits von Street View: Hidden Hills und die Slums von Wanathamulla – 34° 09ʹ 37.5ʺ nördlicher Breite; 118° 39ʹ 09.0ʺ westlicher Länge6° 55ʹ 35.6ʺ nördlicher Breite; 79° 52ʹ 52.5ʺ östlicher Länge
Trap Streets
Der unkartierte Kongo – 1° 16ʹ 44.5ʺ nördlicher Breite; 17° 05ʹ 11.0ʺ östlicher Länge
Flat 2, 18 Royston Mains Street, Edinburgh – 55° 58ʹ 35.1ʺ nördlicher Breite; 3° 14ʹ 11.8ʺ westlicher Länge
Dornenlandschaft
Der Marinestützpunkt Yulin auf der Insel Hainan – 18° 14ʹ 44.1ʺ nördlicher Breite; 109° 31ʹ 59.7ʺ östlicher Länge
Unter Jerusalem – 31° 46ʹ 39.8ʺ nördlicher Breite; 35° 13ʹ 57.0ʺ östlicher Länge
Doggerland – 52° 22ʹ 36.3ʺ nördlicher Breite; 1° 42ʹ 12.3ʺ östlicher Länge
Die neue Arktis
Die Unterwasserstation Conshelf – 19° 56ʹ 40.2ʺ nördlicher Breite; 37° 24ʹ 30.1ʺ östlicher Länge
Epilog
Dank
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Geografie wird immer seltsamer: Neue Inseln entstehen, vertraute Gebiete zerfallen und Türen zu bislang verborgenen Territorien öffnen sich. Die wilden Zonen auf dieser Welt werden immer mehr und verändern sich rasch.
Im Folgenden erzähle ich 39 Geschichten von 39 außergewöhnlichen Orten, die uns alle etwas darüber verraten, wie Orte sich wandeln und die Entstehung von Orten sich verändert. Wir stoßen auf kriegführende Enklaven und gegenwärtige Utopias, auf geografische Sonderfälle und Außenseiter. Sie alle sind einzigartig, weisen aber auch Gemeinsamkeiten auf: Die unheimlichen Ruinen, die unnatürlichen Orte, die Fluchtzonen und die Dazwischenräume sind Stätten der Überraschung, aber auch des Befremdens und Unbehagens. Die Kompassnadel zappelt hin und her. Das Abenteuer, das vor Ihnen liegt, ist die Folge eines neuen geografischen Schwindelgefühls. Die irritierende Fragmentierung von Gebieten, die Überlappung und Verschiebung von Grenzen, die wir in so vielen Teilen dieser Welt erleben, macht uns deutlich, dass Geografie kein verschmockter, verstaubter Gegenstand ist, sondern eine spannende, oft auch alarmierende Angelegenheit.
Ich habe Orte mit faszinierenden Geschichten ausgewählt, die uns etwas über die gegenwärtigen geografischen Turbulenzen verraten. Einige wie die Trap Streets oder das Ferghanatal gehen auf Vorschläge von Lesern meiner früheren Bücher zurück, andere sind die Früchte meiner «abseitigen» Reisen und Forschungsvorlieben.
Beginnen will ich mit ungebärdigen Inseln: mit umstrittenen, fantastischen und nicht zu zählenden Eilanden, die überall auf der Welt en vogue sind, vom kühlen Ärmelkanal bis zu den warmen Gewässern der Philippinen. Anschließend erkunden wir einige alte Verbündete der Insel: Enklaven und neue Länder. In den tiefen Tälern der Dolomiten und hinter einer Mauer, die quer durch die Sahara verläuft, werden ganz unterschiedliche Formen des Überlebenskampfs praktiziert. Diese eigenartigen, oft auch unsicheren Territorien strotzen nur so vor kühnen Ambitionen. Von dort ist es nur ein kleiner Sprung zu unserem nächsten Ziel: utopischen Orten. Das Zerfasern traditioneller geografischer Grenzen und Loyalitäten setzt utopische Energien ganz unterschiedlicher Couleur frei, ziemlich düstere, aber auch sehr verspielte. Die radikalen Islamisten in Syrien und im Irak zerfetzen nicht nur die Landkarte, sondern zeigen uns auch eine erschreckende Ausgeburt utopischen Denkens – sie sind ein brutales, mörderisches Beispiel für den Wunsch nach einem reinen Territorium. Zum Glück gibt es viele andere Möglichkeiten, nach Vollkommenheit zu streben: etwa das wunderbare Christiania mit all seinen kunterbunten Eigenbauten oder die beweglichen Behausungen und Kapseln der «neuen Nomaden», eines wohlhabenden, exklusiven Völkchens permanent Reisender. Auch wenn in der Kulturwelt Dystopien alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, so arbeiten doch an vielen Orten im wirklichen Leben, oft sogar gleich um die Ecke, Menschen eifrig an funktionierenden Alternativen.
In «Die seltsamsten Orte der Welt» habe ich zu zeigen versucht, warum Orte für mich zu einer Obsession geworden sind. Ganz bestimmt nicht nur deshalb, weil ich Professor für Geografie bin. Offen gestanden hat diese Besessenheit überhaupt nichts mit dem Verstand zu tun, sondern mit Freude und Drama, Liebe und Abscheu – mit all den mächtigen Gefühlen, die sich mit Orten verbinden. Doch auch das ist noch nicht alles: Ich leide an einer nostalgischen Sehnsucht nach verlorenen Orten. Diese Sehnsucht nach dem Verschwundenen lenkt diese meine 39 Schritte. In der zweiten Hälfte des Buches nehme ich Sie mit an geisterhafte und verborgene Orte: auf einen aufgelassenen britischen Friedhof in Indien und zur Müllstadt in Kairo, in die versteckten Zonen außerhalb des Blickfelds von Google Street View und zu den Mysterien des Tokioter U-Bahn-Systems. All diese Orte sorgen für eine verstörende Desorientierung.
Ich glaube, ich fühle mich deshalb so sehr zu Verborgenem und Gespenstischem hingezogen, weil unsere Umwelt so flüchtig und unbeständig ist. Solange ich zurückdenken kann, ähnelt ein Großteil der Landschaft, die mich umgibt, einer Baustelle und fühlt sich auch so an. Auf meinen langen Fahrten zur Arbeit stoße ich links und rechts des Weges allerorten auf Straßen, die aufgerissen und umgegraben werden, auf immer komplexere Verkehrssysteme und auf billige, barackenartige Gebäude, die einem die Sicht versperren. Als Reaktion darauf gewinnen zaghafte Spuren der Vergangenheit, Überbleibsel und Relikte geradezu totemistische Kraft.
Warum ist das so? Es sind ganz gewöhnliche Gründe, doch sie haben alle mit mir zu tun. Wenn ich als kleiner Junge meine Großmutter in ihrem schlichten Häuschen umgeben von üppig blühenden Feldern besuchte, rümpfte ich die Nase ob des durchdringenden Geruchs nach Teerseife, Mottenkugeln und den muffigen Türdecken. Ich hörte die Uhr über den knisternden Kohlen im Kamin ticken. Ich war förmlich durchdrungen von Vergangenheit. Auf dem Weg zu ihrem abgelegenen Dorf in Suffolk fuhren wir durch sandige Heidelandschaften und vorbei an hübschen neuen Reihenhaussiedlungen hinter dem hohen Stacheldrahtzaun der angrenzenden US-Luftwaffenbasis. So wie die wie auf einer Schnur aufgereihten Grillplätze in den rückwärtigen Gärten schienen auch die «freifallenden Atombomben», die auf der Basis in beträchtlicher Menge gelagert wurden, nur auf den Startschuss für ihren Einsatz zu warten. Der Kontrast zwischen der miefigen Behaglichkeit im Haus meiner Großmutter und der Aussicht auf Armageddon, zwischen dem Niedergang des dörflichen Lebens und der protzenden Zurschaustellung weltbestimmender Macht hat sich tief in meinem Herzen und meiner geografischen Fantasie eingegraben.
Das ist fünfzig Jahre her, aber ich glaube, daher kommt es, dass ich mich zu Orten hingezogen fühle, an denen Vergangenheit und Gegenwart auf oft etwas unbehagliche Weise präsent sind. Viele der Orte, die ich in diesem Buch erkunde, weisen eine ähnliche Schichtung auf. Moderne Orte mögen sich mitunter wie Sprünge in herrlich leerer Luft anfühlen, aber auch dort lassen die Geister sich nicht vertreiben. Ich habe sie inzwischen als notwendige, ja sogar hoffnungsvolle Existenzen anerkannt. Als ich durch die Ruinen von Boys’ Village kletterte, das im Schatten eines Elektrizitätswerks in Südwales liegt, eine Feriensiedlung für die Bergarbeitersöhne aus den umliegenden Gemeinden, die nun unter der Last des Gestrüpps zerfällt und über und über mit Graffiti verziert ist, suchte ich unwillkürlich nach den Feuerstellen und rechnete fest mit dem anheimelnden Geruch von Mottenkugeln, den Zeichen von Behaglichkeit in einer ungeliebten Landschaft.
Ein Ort ist eine von Geschichten eingesponnene Landschaft, ein Irgendwo, das eine menschliche Bedeutung hat. Inzwischen haben wir aber auch oder wieder gelernt, dass es bei Orten nicht nur um Menschen geht, sondern auch darum, das Nicht-Menschliche zu erfassen und zu verstehen: die Landschaft und ihre vielen Bewohner, die schon immer um uns und jenseits von uns dort sind. Das kann ein nervenaufreibender Austausch sein, insbesondere wenn wir etwas ganz Natürliches zu entdecken hoffen und stattdessen auf unser eigenes Spiegelbild stoßen. Die Küstenlinien nehmen mit wachsender Geschwindigkeit zu und wieder ab, alte Königreiche wie Doggerland, aber auch neue in der einst unzugänglichen Arktis kommen zutage und verlangen von uns, dass wir die Landschaft – und die Karte – auf neue Weise betrachten: als etwas, das in Bewegung ist und sich von der Tradition losgemacht hat.
Die immer ungebärdigeren Karten menschlicher und physischer Geografie können etwas Überwältigendes an sich haben. Vielleicht ist das der Grund, warum kleine Orte – die kleinen Geheimnisse, die versteckten Überraschungen – sich oft so bedeutsam anfühlen. Einige dieser Rückzugsorte sind das reine Vergnügen, etwa Nek Chands Felsengarten, ein Labyrinth aus Pfaden, Wasserfällen und Zehntausenden Skulpturen von Menschen mit großen Augen und tänzelnden Tieren, die allesamt aus den Abfällen der verkehrsgeplagten neuen Stadt ringsum gestaltet wurden. Andere sind weniger erfreulich, etwa die fußgängerfeindlichen Zwischenräume zwischen vielbefahrenen Straßen. Doch ihnen allen ist eine widerspenstige Autonomie eigen, als seien sie dem eisernen Käfig des Gewöhnlichen entkommen. Diese Fragmente sind auf ihre ganz eigene, seltsame Weise Versuche einer Utopie. Das vorliegende Buch beginnt mit «Ungebärdigen Inseln», und am Ende dieses ersten Teils steht wieder die einsame Verkehrsinsel, das Stückchen namenlosen Landes inmitten von Schnellstraßen, dem ich schon in Die seltsamsten Orte der Welt ein Kapitel gewidmet habe. Dieses Mal schleppe ich einen Sack Erde und ein paar Obstpflanzen dorthin. Es ist mein kleines Stückchen Eden, meine törichte Geste gegen das Verkehrsgetöse. Mir gefällt die Vorstellung, eines nicht allzu fernen Tages einen flüchtigen Blick auf wilde Erdbeeren zu erhaschen, die sich trotz des Chaos um sie herum dort auf dem kargen Boden ausbreiten.
I.
Ungebärdige Inseln
Im Folgenden geht es um sechs der ungewöhnlichsten Inseln auf dieser Welt und um sechs ungewöhnliche Geschichten. Jede Insel (oder Inselgruppe) erschüttert die Selbstzufriedenheit des Festlands. Das gilt nicht zuletzt für die Inseln Les Minquiers gleich neben Jersey, die man als südlichsten Ausläufer Großbritanniens betrachten könnte, und für den unsicheren, sagenhaft entlegenen und disparaten Archipel der amerikanischen Minor Outlying Islands, der Kleineren entlegenen Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten. Bei kleinen Inseln kann der Grat zwischen Fakten und Fiktion sehr schmal sein; das gilt ganz besonders dann, wenn Inseln neu geschaffen werden. So wurden die Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer, einst eine verstreute Ansammlung ehemaliger Riffe, in den letzten Jahren in waffenstarrende und für Angriffszwecke geeignete Festungen verwandelt. Gerade bei sehr fragilen Inseln zeigt sich die menschliche Hybris oft besonders deutlich, weshalb daran erinnert sei, dass sich die grundlegenden planetarischen Kräfte völlig unserer Kontrolle entziehen. Die postglaziale «Erholung» oder Landhebung, wie man sie in den Gebieten des hohen Nordens erleben kann, etwa bei den sich hebenden Inseln im Bottnischen Meerbusen, lässt unzählige neue Gestade aus dem Meer sprießen, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist nicht einmal klar, ob wir sie überhaupt alle zählen können. Diesem Problem der Inselzählung wende ich mich am Beispiel der 534 «neuen Inseln» zu, die jüngst vor der Küste der Philippinen entdeckt wurden. Inseln erweisen sich, kartografisch gesehen, als schwerer fassbar, als man annehmen könnte; das gilt ganz besonders für jene, die in den gleichgültigen Armen alles zermalmender Straßen «gewiegt» werden, wie die Verkehrsinsel, die ich am Ende dieses ersten Teils besuche, mit ein paar wilden Erdbeerpflanzen im Gepäck.
Les Minquiers
48° 57ʹ 01.6ʺ nördlicher Breite; 2° 07ʹ 58.5ʺ westlicher Länge
Auf einem sanft schwankenden Ponton warte ich zusammen mit einem Grüppchen lebhaft schwatzender Urlauber, die ebenfalls leuchtende Schwimmwesten tragen, auf ein Motorboot, das uns zum südlichsten Teil der Britischen Inseln bringen soll, an einen Ort, dessen Souveränität erst seit 2004 abschließend geklärt ist. Es ist Anfang April, keine Wolke am Himmel, und schon bald halten wir uns angestrengt fest, während das Schlauchboot fern jeglicher Küste, rund 20 Kilometer südlich der Hauptstadt von Jersey, tosend über das helle Wasser hüpft. Nach gut 25 Minuten zeigt sich am Horizont eine ganze Galaxie schroffer Felsen. Les Minquiers, von den Menschen auf Jersey «the Minkies» genannt, erstrecken sich über eine Fläche, die bedeutend größer ist als Jersey selbst; bei Ebbe werden 199 Quadratkilometer Sand und Fels sichtbar (Jersey ist nur 119 Quadratkilometer groß).
Mich fasziniert vor allem die unbestimmte Größe von Les Minquiers. Ein paar Mal am Tag handelt es sich um einen riesigen Ort, doch bei Flut sind lediglich neun Inselchen sichtbar, und nur eine von ihnen ist von nennenswerter Größe. La Maîtresse Île, so ihr Name, ist gerade einmal 100 Meter lang und 50 Meter breit. In diesem Teil des Ärmelkanals sind die Gezeitenunterschiede enorm, sie betragen bis zu zwölf Meter. Die Minkies tauchen auf, als würde irgendetwas sie aus dem Nichts hervorziehen, und verschwinden wieder: ein magischer Archipel.
Als der sonnengegerbte, leutselige Bootsführer den Motor drosselt, umgibt uns eine plätschernde Stille. Wir haben La Maîtresse Île umkreist. Auf der einzigen Erhebung drängt sich eine Reihe einstöckiger Häuser aus Stein, sie schmiegen sich eng aneinander, als wollten sie um keinen Preis mit den Wellen in Berührung kommen. Vorsichtig taste ich mich über den rutschigen, mit Seetang bedeckten Pier und suche als Erstes die Außentoilette der Insel auf. Kühn thront sie über dem Meer und bildet das südlichste Gebäude Großbritanniens; ein Schild an der Tür kündet stolz von diesem ganz besonderen Rang. Wer das Klo benutzen will, muss einen Eimer Meerwasser hochziehen, um damit die Schüssel zu spülen. Viel Zeit habe ich ohnehin nicht: Die Ebbe hat eingesetzt, und schon bald wird das Boot es nicht mehr bis zur Anlegestelle schaffen.
Die leeren Steinhütten sind über und über von weißem Vogeldreck zugeschissen. Es sind insgesamt zwölf, zehn gehören Familien aus Jersey und werden gelegentlich fürs Wochenende vermietet; die beiden anderen sind im Besitz des Staates Jersey. Eines davon ist das Zollhaus, erkennbar an einem überproportional großen Stein, in den die drei Löwen Jerseys sowie die Wörter «Étates de Jersey» und «Empôts» eingemeißelt sind. Drüben auf der anderen Seite der Insel befindet sich ein verwitterter Hubschrauberlandeplatz. Doch ich halte meinen Blick weiter gesenkt. Die Felsen und das den Boden umarmende, großblättrige Gestrüpp sind mit schwarzen und roten Feuerwanzen bedeckt. Sie rennen wie wild hin und her, als suchten sie nach etwas Verlorenem.
Zurück im Boot erzählt uns der Kapitän, es handle sich hier um die «größte unkartierte Gegend der westlichen Welt»; die enormen Unterschiede zwischen den Gezeiten bedeuten, dass man nur mit guter Ortskenntnis einen Weg durch die Inselchen jenseits von La Maîtresse Isle findet, eine Zone, die auch als «Wildnis» bezeichnet wird. Ich bin glücklich. Das Wetter hier kann richtig übel sein, aber jetzt ist das Meer voller Farben: ein durchscheinendes Azur und sanfte Grüntöne, anmutige Schatten, die sich rings um die Inselchen und weißen Sandbänke scharen. An einem warmen, sonnigen Vormittag ist dies ein verführerischer Ort, kein Wunder, dass die Bewohner Jerseys mit ihren Motor- oder auch Ruderbooten hier herausfahren zu ihren Lieblingsstellen, wo sie eine Insel ganz für sich haben können.
Das Wasser zieht sich so schnell zurück, dass sich das, was zunächst wie eine einsam aus dem Meer ragende Felslandschaft wirkte, in einen Ort voller Lagunen und kleiner Felsenhügel verwandelt, die durch mächtige Dünen miteinander verbunden sind. Unser Schlauchboot setzt sanft auf einer Sandbank auf, und wir springen hinaus in den jungfräulichen Sand. Angesichts der gleißenden Sonne auf dieser glitzernden flüchtigen Insel kneife ich die Augen zusammen. Seltsam, dass ein so verlorenes Irgendwo eine so lange und so umkämpfte Geschichte haben kann.
1792 begann man damit, am Riff Granit abzubauen, der dann mit dem Schiff nach Saint Helier, der Hauptstadt Jerseys, gebracht wurde. Die steinernen Hütten auf der Hauptinsel stammen noch aus dieser Zeit. Fischer aus Jersey, die die reichen Fanggründe der Gegend schätzten und die Insel als Stützpunkt nutzten, sorgten offenbar für ein Ende des Granitabbaus, indem sie die Werkzeuge der Arbeiter einfach ins Wasser warfen. Die dauerhafteste Konfliktursache war freilich dem Umstand geschuldet, dass Les Minquiers an einer unbestimmten Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien liegen. Da sie Frankreich fast so nahe sind wie Jersey, das seinerseits Frankreich näher liegt als England, überrascht es nicht, dass die Franzosen das Riff lange Zeit für sich beanspruchten. Im April 1938 hielt der französische Premierminister Édouard Daladier diese Angelegenheit für so wichtig, dass er auf La Maîtresse Île landete, um den französischen Anspruch zu untermauern.
Größere geopolitische Fragen ließen die Herrschaft über die Minkies auf der Agenda allerdings schon bald nach hinten rücken. Während des Zweiten Weltkriegs betrieben die Deutschen einen Beobachtungsposten auf La Maîtresse Île. Dort draußen stationiert zu sein, muss sich angefühlt haben, als habe man den Planeten verlassen. Die paar deutschen Soldaten, die auf diesem windumtosten Punkt ausgesetzt worden waren, gerieten in Vergessenheit, und der Krieg ging an ihnen vorüber. In The End of War, Europe: April 15–May 23, 1945 berichtet der Historiker Charles Whiting, am 23. Mai 1945, also mehr als zwei Wochen nach Kriegsende in Europa, habe Lucian Marie, Kapitän des Fischerboots Les Trois Frères, «als er auf der Brücke Ausschau hielt, plötzlich bemerkt, dass die Insel – eine Ansammlung seichter Riffe – bewohnt war». Ein bewaffneter deutscher Soldat tauchte auf. «Hör zu, Franzose», sagte der Deutsche, «die Briten haben uns vergessen. Vielleicht hat ihnen in Jersey niemand gesagt, dass wir hier waren. Aber jetzt reicht’s uns. Langsam gehen uns Wasser und Lebensmittel aus. Du musst uns helfen.» «Und wie?», fragte Lucian Marie. «Ganz einfach, ich will, dass du uns rüber nach England bringst», lautete die Antwort. «Wir wollen uns ergeben.»
Der Krieg war damit auch für diese vergessenen Soldaten endlich vorbei, die zweifellos aus tiefstem Herzen hofften, die Minkies niemals wiederzusehen. Schon bald nach Kriegsende meldeten die Franzosen wieder Ansprüche auf diesen einsamen Archipel an. 1953 wurde der Fall von Les Minquiers und einer ähnlichen Inselgruppe nördlich von Jersey namens Les Écréhous vor den kurz zuvor gegründeten Internationalen Strafgerichtshof gebracht, der entscheiden sollte. Frankreich brachte seine geografische Nähe und die Tradition, in beiden Gebieten zu fischen, vor. Großbritannien machte geltend, man habe die Steinhütten errichtet und bewohnt. Letzteres überzeugte die Richter, die verkündeten, die Souveränität über beide Riffe «gehört dem Vereinigten Königreich».
Jeder Besucher Jerseys erfährt allerdings als Erstes, dass die Insel nicht zum Vereinigten Königreich gehört und der Internationale Strafgerichtshof die Grenzen der entlegenen Riffe nicht festgelegt hat, weshalb das Urteil von 1953 den Streit nicht beigelegt habe. Jedenfalls hat es manche Kritiker in Frankreich nicht überzeugt. Zu ihnen gehörte auch der Schriftsteller Jean Raspail, ein Exzentriker und überzeugter Nationalist, dessen bekanntestes Werk Das Heerlager der Heiligen ist, ein Roman, der die Invasion von Migranten aus dem «Süden» prophezeit, die die westliche Zivilisation überfluten und zerstören. 1984 segelte Raspail nach Les Minquiers und hisste eine patagonische Flagge, eine ironische Geste gegen Großbritanniens damaligen Versuch, die Falkland-Inseln von Argentinien zurückzuerobern. Zwölf Jahre später kehrte Raspail nach La Maîtresse Île zurück und nahm von dort die britische Fahne mit, die er anschließend dem britischen Botschafter in Paris überreichte. Im Norden, bei den Schwesterinseln von Les Minquiers, kam es zu ähnlichen symbolischen Aneignungen. 1993 und 1994 hissten französische «Invasoren» auf Les Écréhous normannische Flaggen.
Schließlich wurde beschlossen, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs von 1953 zu revidieren, nicht wegen all der Flaggenhisserei, sondern weil die heikle Topografie der Riffe, bei der täglich sehr unterschiedliche Mengen Land über und unter Wasser sind, eine weitaus detailliertere Abgrenzung erforderte. 13 Jahre dauerten die Gespräche zwischen Frankreich und Großbritannien, bis man zu einer Einigung kam. Ein an den Verhandlungen beteiligter Politiker aus Jersey sprach davon, man habe tatsächlich die Minquiers und Écréhous «Felsen für Felsen» gezählt. Im Jahr 2000 konnten dann neue politische Karten ausgegeben werden, die jetzt, so hoffte man, die endgültige Seegrenze zwischen Frankreich und Großbritannien anzeigten. Diese Vereinbarung trat am 1. Januar 2004 in Kraft, zusammen mit einem Dokument, das den Besitz der Fischgründe im Detail regelt. Kurz darauf wurden Bojen verankert, um die verschiedenen Linien im Wasser, die nun rechtsgültig Großbritannien von Frankreich trennen, auch physisch zu markieren.
All diese geopolitischen Manöver wirken ewig weit entfernt von der stillen Sandbank, auf der ich mich befinde. Mit jeder Minute entsteht eine neue Uferlinie. Der seidig feuchte Sand ist durchzogen von einem Geflecht von Rinnsalen, die aus dem gekrümmten goldenen Rücken der Insel strömen. Ich bin ein wenig schläfrig; lege mich hin; mir ist in der heißen Sonne, als könnte ich jeden Augenblick einschlafen. Alles Wasser dieser Welt rinnt in ein Abflussloch und wird schon bald ganz verschwunden sein. Doch diese Träumerei provoziert sogleich ihr alarmierendes Gegenteil: Schon bald wird die Flut einsetzen, ich muss sofort aufwachen und mich an einen sicheren, gesicherten Ort begeben. Ich recke den Hals und versichere mich: Dort, am Ende dieser namenslosen Insel, liegt das Boot, das mich nach Hause bringt. Ich weiß schon jetzt, dass ich die Erinnerung an Les Minquiers als ein Mittelding zwischen Traum und Vorahnung mit mir tragen werde.
Kleinere entlegene Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten und Vereinte Mikronationen Multiozeanischer Inselgruppe
19° 27ʹ 20.1ʺ nördlicher Breite; 179° 53ʹ 54.1ʺ westlicher Länge
Diese Geschichte beginnt an unbekannten Orten und endet an einem ausgefallenen Ort. Die United States Minor Outlying Islands sind die am wenigsten bekannten Flecken Land der USA. Insgesamt umfassen diese winzigen, völlig entlegenen Inseln gerade einmal 33 Quadratkilometer. Es gibt insgesamt neun davon, acht im Pazifik (Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston-Atoll, Kingman Reef, Midway-Atoll, Palmyra-Atoll und Wake Island) und eine in der Karibik (Navassa Island). Sie sind eine Ansammlung von Reststücken. Die Sammelbezeichnung «United States Minor Outlying Islands», Kleinere entlegene Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten, ist eine passende Etikettierung, denn die Inseln haben keine Regierung. Sie sind vom US Fish and Wildlife Service verwaltete Naturschutzgebiete, mit Ausnahme von Wake Island, das der US-Luftwaffe untersteht.
Außer Wake Island wurden alle im Zuge des Guano Islands Act von 1856 in Besitz genommen. Dieses selbstherrliche Stück amerikanischer Gesetzgebung verkündet:
«Wann immer ein Bürger der Vereinigten Staaten das Vorkommen von Guano auf irgendeiner Insel, einem Felsen oder einem Korallenriff entdeckt, die nicht der Rechtsprechung einer anderen Regierung unterliegen und nicht von den Bürgern einer anderen Regierung bewohnt werden, und friedlich Besitz davon ergreift und sie besetzt, dann gilt eine solche Insel, ein solcher Felsen oder ein solches Korallenriff nach Ermessen des Präsidenten als den Vereinigten Staaten zugehörig.»
Guano ist Quechua und bedeutet übersetzt Dünger. Der Kot (Guano) von Seevögeln, auf den die Inseljäger im Zuge des Guano Islands Act aus waren, enthält sehr viel Stickstoff, Phosphat und Kalium und ist der weltweit begehrteste natürliche Dünger. Das Gesetz, das noch immer in Kraft ist, führte zu Ansprüchen auf rund einhundert Inseln überall auf der Welt. Die meisten dieser Ansprüche wurden nicht aktiv verfochten, nachdem das Guano abgetragen war, sondern entweder widerrufen oder ruhend gestellt. Ein Beispiel für einen widerrufenen Anspruch sind die Schwaneninseln, drei Inseln vor der Küste Mittelamerikas, die 1972 an Honduras abgetreten wurden. Ruhende Ansprüche bestehen im Fall von Ducie Island, einer Gruppe unbewohnter Inselchen, die 70 Hektar Fläche umfassen und gut 530 Kilometer östlich der Pitcairninseln liegen, dem letzten verbliebenen britischen Überseeterritorium im Pazifik. Seit 1902 wird Ducie von den Briten formell als Teil der Pitcairninseln beansprucht.
Frankreich und Großbritannien verfügen ebenfalls über Ansammlungen kleiner, weit verstreuter Inseln. Doch die Minor Outlying Islands der USA sind in ihrer rechtlichen Kuriosität einzigartig. Christina Duffy Burnett, Juraprofessorin an der Columbia University, beschäftigt sich seit langem mit dem unbestimmten Status dieser verstreuten Fleckchen Amerika. Es handle sich «aus verfassungsrechtlicher Sicht um eine bizarre Form von Nicht-Orten». Denn, so legt sie dar, diese Inseln «‹gehören› den USA, sind aber nicht wirklich ‹Teil› der Vereinigten Staaten», und so fragt sie: «Welches Recht gilt dort? Das ist nicht wirklich eindeutig geregelt.»
Es wäre ein Fehler zu glauben, weil diese Inseln entlegen und winzig sind, seien sie unbedeutend. Jede von ihnen erlaubt es den USA, große Zonen der Weltmeere als Teil der «Ausschließlichen Wirtschaftszone» für sich zu reklamieren: von jeder Küste aus 200 Seemeilen ins Meer hinein. Zudem hat jede der Inseln ihre eigene Geschichte. Insbesondere zwei Namen in der Liste der Outlying Islands werden denen, die sich für die Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts interessieren, etwas sagen: das Johnston-Atoll und Wake Island.
Als einzige dieser Inseln verfügt Wake Island über eine Wohnbevölkerung, die aus 49 US-Militärangehörigen besteht. Das u-förmige Korallenriff wurde von den Japanern am gleichen Tag wie Pearl Harbor angegriffen und fiel am 23. Dezember 1941 nach heftigen Kämpfen, die fast tausend Tote forderten. Sobald Wake Island 1945 wieder unter amerikanischer Kontrolle war, bekam es auch wieder seine militärische Funktion. Heute dient es als Raketentestgelände und als Zwischenstopp für Flugzeuge, um aufzutanken.
Das Johnston-Atoll besteht aus vier flachen, sandigen Inseln, von denen die größte Johnston Island ist. Sie wurde künstlich aufgeschüttet und wuchs von 18 auf 241 Hektar Fläche an, damit vor allem eine längere Landebahn darauf Platz hatte. Heute handelt es sich um ein langgestrecktes, unnatürlich aussehendes Rechteck. Auf dem Höhepunkt der Nutzung waren dort rund tausend Mann stationiert. 1962 wurden auf dem Atoll Atomwaffentests durchgeführt, später Raketentests, es beherbergt zudem eine zehn Hektar große Giftmülldeponie, auf der unter anderem Fässer mit Agent Orange aus dem Vietnamkrieg lagern. In den neunziger Jahren wurde auf der Insel überdies eine Verbrennungsanlage für chemische Kampfstoffe betrieben, darunter das Nervengas Sarin.
Der letzte Soldat verließ das Johnston-Atoll am 17. August 2001. Bedenkt man, dass Johnston Island kaum mehr als eine Giftmüllhalde ist, überrascht es ein wenig, dass die Insel im Juli 2006 von der General Services Administration der US-Regierung (GSA) als «Wohnort oder Urlaubsziel» annonciert wurde, geeignet für eine potenzielle «ökotouristische» Nutzung. Vielleicht hat man ja bei der GSA einen Sinn für Ironie. Jedenfalls wurde diese Ausschreibung später als «Lockangebot» für kommerzielle Interessenten bezeichnet.
Zu diesen Inseln gibt es noch eine weitere, weniger bekannte Geschichte. Im Schularchiv der Kamekahema Schools auf Hawaii finden sich Schilderungen überraschend engagierter Versuche der Schüler, die Inseln Howland, Jarvis und Baker zu kolonisieren. Dieser Besiedlungsprozess begann 1935, die Berichte darüber verströmen eine große Frische und enorm viel Optimismus: Auf Fotos und in Zeitungsartikeln werden uns fröhliche junge Abenteurer präsentiert. Leider endete das Abenteuer in einer Tragödie. Ein Tagebucheintrag der Jungs auf Howland vom Dezember 1941 schildert, was geschah:
Plötzlich blickte Joe Keliihananui hinauf in den Himmel und sah hoch oben 14 zweimotorige Bomber aus Nordwesten näherkommen …
Aus rund drei Kilometern Höhe gaben uns die Bomber Zunder. Sie ließen rund 20 Sprengkörper fallen, drehten ab, kamen über die Inseln wieder zurück und warfen noch einmal zehn Stück ab. Die Explosionen ließen den Boden unter unseren Füßen erzittern, und der Rauch nahm uns fast vollständig die Sicht.
Als die Maschinen endlich davonflogen, gingen Mattson und ich dort hinüber, wo Dick und Joe lagen. Es hatte beide schwer erwischt. Sie waren an den Beinen verletzt, einer hatte eine Wunde in der Brust und ein Loch im Rücken. Wir machten uns daran, einen Platz herzurichten, wo wir sie hinbringen konnten, aber bis wir das geschafft hatten, waren beide tot.
Am 1. Januar 1942, fast einen Monat nach dem ersten Angriff, waren die Jungs überzeugt, dass «wir uns mitten im Niemandsland dieses Krieges befinden und vermutlich so lange hier bleiben müssen, wie er dauert». Zu ihrem Glück wurden sie am 31. Januar von einem amerikanischen Zerstörer gerettet.
Der Guano Islands Act ist eine juristische Kuriosität, die Menschen noch heute zu den wildesten Fantasien animiert. Im Internet finden sich jede Menge Geschichten à la «Dank eines Gesetzes aus dem 19. Jahrhundert können Amerikaner jede unbewohnte Insel mit Vogelscheiße drauf für sich beanspruchen». In den zugehörigen Chatforen wird die anfänglich optimistische Aufregung schnell gedämpft mit dem Hinweis, es gebe da draußen keine unbekannten, herrenlosen und leeren Inseln, die auf neue Bewohner warteten. Ich bin mir da nicht so sicher, aber genauso sehr interessiert mich die Frage, warum man überhaupt die Ansprüche irgendeines Landes respektieren sollte. Der amerikanische Guano Islands Act ist nicht internationales Recht, seine Rechtsgültigkeit ist zweifelhaft.
Wenn die USA zahlreiche unbewohnte Inseln für sich reklamieren und dann zu einer lockeren Föderation von «Outlying Islands» zusammenfügen können, was sollte jemand anderen dann davon abhalten, dasselbe zu tun? Diese Frage bringt uns von den «Kleineren Inselbesitzungen» zu einer reichlich ausgefallenen Erfindung, die behauptet, diese Inseln und zahlreiche andere entlegene Punkte annektiert zu haben, nämlich zum United Micronations Multi-Oceanic Archipelago (UMMOA), der auf deutsch als Vereinte Mikronationen Multiozeanischer Inselgruppe (VMMOI) firmiert. Um eine Ahnung von diesem Gebilde zu bekommen, sei gesagt, dass es am 19. Januar 2008 von Hochwürden Dr. Cesidio Tallini gegründet wurde, einem «unabhängigen Gelehrten», der reihenweise Mikronationen ins Leben ruft. Der UMMOA hinterlässt in der virtuellen Welt der Mikrostaaten eine deutlich sichtbare Spur, was in erster Linie mit seinen Ambitionen zu tun hat. Ihm reicht es nicht, all die Minor Outlying Islands für sich zu beanspruchen, sondern er umfasst 29 Gebiete, überwiegend zerklüftete Riffe und Inselchen, die über keine «indigene Bevölkerung» verfügen, sowie ein Stück der Antarktis.
Der UMMOA, der behauptet, 68 «Staatsangehörige» zu haben, hält sich mit einigen provokativen Behauptungen seine globalen Ambitionen betreffend über Wasser. Dazu gehört, dass er seine Ansprüche auf ungewollte oder geplünderte Bereiche ausdehnen will, etwa auf ein «Stück des Great Pacific Garbage Patch» wie auch auf Weltraumschrott und mehrere Inseln, die wegen steigenden Meeresspiegels verschwinden. Der UMMOA hat zudem erfolglos versucht, eine mikronationale Variante der Olympischen Spiele ins Leben zu rufen. Dr. Tallini musste einräumen: «Leider erwiesen sich die anderen Leute als zu wenig aktiv oder zuverlässig.»