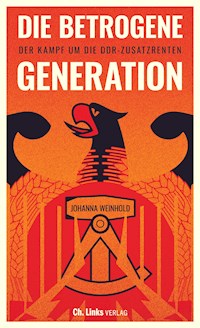
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Etwa 1,3 Millionen Menschen haben in der DDR einen Anspruch auf eine Zusatz- oder Sonderrente erworben. Mit dem Beitritt zur Bundesrepublik wurde auch das DDR-Rentenrecht in bundesdeutsches Recht überführt. Die Folge: Die zusätzlichen Ansprüche wurden nach einer kurzen Übergangsfrist gekürzt oder gestrichen. Von den sogenannten Überführungslücken waren 27 Berufsgruppen - Bergleute, Ingenieure, Ärzte, Lehrer, Eisenbahner, Balletttänzerinnen - betroffen. 1998 begann am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Mammutprozess. Es folgten Klagen bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Zehn Berufsgruppen erzielten Erfolge.
Bei weiteren 17 Gruppen steht eine Lösung bis heute aus. 30 Jahre kämpfen die Betroffenen inzwischen um Gerechtigkeit. Die Verweigerung von Zusatz- und Sonderrenten bedeutet nicht nur eine Geringschätzung der Lebensleistung von Ostdeutschen, sondern führt auch zu Altersarmut. Daraus resultieren Frust und Verbitterung auf »die Politik«.
Johanna Weinhold erzählt die Biografien von Betroffenen, erklärt Hintergründe der Rententhematik, und sie lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Nicht zuletzt erklärt sie, warum Ungerechtigkeitsempfindungen sich auch auf jüngere Generationen auswirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Johanna Weinhold
Die betrogene Generation
Johanna Weinhold
Die betrogene Generation
Der Kampf um die DDR-Zusatzrenten
Ch.LinksVERLAG
Für Ralle, einen der klügsten und aufrichtigsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Du fehlst.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Marke
der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2021
entspricht der 1. Druckauflage von 2021
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
Umschlaggestaltung: Kuzin & Kolling, Büro für Gestaltung, Hamburg, Kamil Kuzin
Satz: Britta Dieterle, Satz und Gestaltung Berlin
ISBN 978-3-96289-125-1
eISBN 978-3-86284-502-6
Inhalt
Einleitung
Es geht um Gerechtigkeit nach 30 Jahren deutsche Einheit
1 Die Balletttänzerin
»Die Gerichte wollten einfach nicht positiv entscheiden«
2 Der Diplom-Chemiker – Technische Intelligenz I
»Wir werden bestraft dafür, dass wir aus der DDR kommen«
3 Der Ingenieur – Technische Intelligenz II
»Durch den jahrelangen Kampf vor den Gerichten habe ich mich selbst besser kennengelernt«
4 In der DDR geschiedene Frauen und die Menschenrechte
»Das war eine reine Machtdemonstration des Patriarchats«
5 Die in der DDR geschiedene Frau
»Erst als ich ein eigenes Einkommen hatte, konnte ich mich scheiden lassen«
6 Die Krankenschwestern
»Es kann nicht sein, dass die uns so belogen und betrogen haben«
7 Exkurs zu Renten in der DDR und in der Bundesrepublik nach 1990
»Rentner in der DDR führten ein Schattendasein. Immer an der Grenze zur Armut«
8 Der Reichsbahner
»Die Ungerechtigkeit wird in die nächsten Generationen übertragen«
9 Die (verfassungsrechtlichen) Probleme mit dem Rentenüberleitungsgesetz
»Das trägt zum Rechtsfrieden im wiedervereinigten Deutschland nicht bei«
10 Der Mitarbeiter des MfS
»Ich empfinde weder besonderen Stolz noch Scham«
11 Die Anspruchsberechtigte nach Fremdrentengesetz
»Man muss aufpassen, dass man nicht verbittert«
12 Exkurs zur Gerechtigkeit
»Es gibt Ungerechtigkeiten, die sind schlicht eingeredet«
13 Die Bergmänner von Espenhain und Borna
»Das Aussitzen ist eine Schande«
14 Die Lücke-Professoren
»Ich kann diese entwürdigende Behandlung einfach nicht verkraften«
15 Der Härtefallfonds
Das letzte Rentenkapitel?
Anhang
Anmerkungen
Übersicht über die Zusatzversorgungssysteme in der DDR
Leitsätze des Bundesverfassungsgerichts
Abkürzungen
Die Autorin
»Wer weiß, wie Gesetze und Würste zustandekommen, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen.« Otto Fürst von Bismarck
Einleitung
Es geht um Gerechtigkeit nach 30 Jahren deutsche Einheit
Während sich am 9. November 1989 Ost- und Westdeutsche in dem lange geteilten Land in die Arme schlossen, verabschiedete der Bundestag in Bonn eine neue Rentenreform. Das Gesetz sollte aber erst ab dem 1. Januar 1992 wirksam werden und das Sozialgesetzbuch VI auch für die neuen Bundesländer gelten. Doch das wussten die Macher des RRG 1992 damals noch nicht. Während die Menschen am Brandenburger Tor jubelnd auf die Mauer kletterten, unterbrachen die Politiker ihre Sitzung, verfolgten auf den Bildschirmen die Öffnung der Mauer, tranken ein Glas darauf und setzten sich wieder zusammen, um in »breitem Konsens«1 die Rentenreform zu verabschieden.
»Wohl niemand hat damals jedoch daran gedacht, daß man nach so kurzer Zeit bereits wieder über die Renten reden muß«,2 sagte ein CDU-Abgeordneter im Juni 1991 im Bundestag. Denn in einem nicht zu stoppenden Prozess folgte nicht einmal zwölf Monate nach der Maueröffnung die deutsche Einheit. Und noch als die Menschen versuchten, sich nach 1990 in dem physisch geeinten Deutschland neu zu finden, versuchten die Politiker zwei Teile eines Landes, die sich sozial- und wirtschaftspolitisch 40 Jahre lang völlig unterschiedlich entwickelt hatten, zusammenzubringen. Bei der Frage der Rentenpolitik ein Balanceakt. Denn welches System sollte in Zukunft gelten? Das Rentensystem der DDR mit seinen Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, einer Mindestrente und einer frauenfreundlichen Sozial- und Rentenpolitik? Oder das westdeutsche Rentensystem mit seiner leistungsbezogenen, dynamischen Alterssicherung? Oder gar eine Mischung?
Der Einigungsvertrag war dahingehend nicht richtig konkret geworden. Der Zeitdruck war zu groß, um alle sozialpolitischen Details bis ins Kleinste zu besprechen. Daher einigte man sich vor dem 3. Oktober 1990 erst einmal darauf, dass bis zu einer endgültigen Lösung die Renten in den neuen Bundesländern nach DDR-Recht gezahlt werden. Alles Weitere sollte der Gesetzgeber in einem Bundesgesetz regeln. Und der verabschiedete am 25. Juli 1991 das Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) mit dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG). Das Gesetz regelte die Schließung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR und deren Überführung in die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Der damalige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm (CDU) kündigte dieses 1991 mit den Worten an: »Wir übertragen ein Alterssicherungssystem auf die neuen Bundesländer, das in der Welt seinesgleichen sucht.«3 Für die meisten Mitglieder der DDR-Sozialversicherung und der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung (FZR) wirkte sich die Übertragung der gesetzlichen West-Rentenversicherung durchaus günstig aus. Die Rentenumwertung führte dank Bestandsgarantie und Auffüllbeträgen für weniger als zehn Prozent der Betroffenen zu niedrigeren und für mehr als 90 Prozent zu höheren Rentenzahlbeträgen. Doch was – und das war die alles entscheidende Frage vor der Verabschiedung des RÜG – sollte mit denjenigen passieren, die nicht schablonenartig ins bundesdeutsche Rentensystem passten? Mit den Menschen, die Anwärter oder Bezieher von Zusatz- und Sonderversorgungssystemen waren?
Die letzte Volkskammer der DDR hatte bereits im Juni 1990 im Zuge der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion per Rentenangleichungsgesetz dafür gesorgt, dass in der DDR eine Angleichung der Bestandsrenten an das Nettorentenniveau der Bundesrepublik erfolgen sollte. Der Höchstbetrag aus Zusatzversorgungssystemen sollte für Mitarbeiter des Staatsapparates, Leiter im Wirtschaftsbereich, Generaldirektoren, Kombinatsleiter und Mitarbeiter von gesellschaftlichen Organisationen sowie der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) bei 2010 DM gedeckelt werden, die Bezüge aus den Sonderversorgungssystemen bei 990 DM. Eine erste Begrenzung von Renten aus »systemnahen« Versorgungssystemen erfolgte also schon ab dem 1. Juli 1990, also noch vor dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik.
Doch das Ziel der Volkskammer war es, ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen. Später präzisierte man im Einigungsvertrag, dass Leistungen zu kürzen oder abzuerkennen seien, wenn Personen gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hatten. Systemnähe sollte nicht noch mit hohen Renten belohnt werden. Doch neben den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen für Führungskräfte oder Stasi-Mitarbeiter gab es Systeme für andere Berufsgruppen. So war das erste Zusatzversorgungssystem 1951 für die technische und wissenschaftliche Intelligenz in den Betrieben eingerichtet worden. Die Intelligenzler wurden zum Aufbau des Arbeiter-und-Bauern-Staates benötigt und sollten durch ökonomische Anreize und eine möglichst große Bindung an ihren Betrieb von einer Abwanderung in den Westen abgehalten werden. So setzte sich Walter Ulbricht »besonders [für die] Förderung von leitenden Angehörigen der Intelligenz […] durch eine zusätzliche Altersversorgung […]«4 ein. Ende der 50er-Jahre hielt man es angesichts der noch durchlässigen Grenzen für erforderlich, Zusatzversorgungen für Ärzte einzurichten, weil es auch bei diesen starke Abwanderungstendenzen gab. In den Folgejahren wurden nach und nach auch für Mitarbeiter künstlerischer, pädagogischer und medizinischer Einrichtungen sowie für Wissenschaftler an den Akademien zusätzliche Altersversorgungssysteme eingerichtet. Erst ab 1970 wurde die Sonderversorgung für die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), der Zollverwaltung, Feuerwehr, von Nationaler Volksarmee (NVA) und Volkspolizei sowie des Strafvollzugs eingeführt.
Doch ab 1990 wurden im Zuge der Ausgestaltung des Rentenüberleitungsgesetzes die Zusatzversorgungssysteme von politischer Seite pauschal als begünstigende Regelungen für staatsnahe, systemtreue Personen hingestellt. Dabei wies bereits 1991 ein fünfköpfiges Juristengremium nicht nur darauf hin, dass das Gesetz verfassungsrechtlich bedenklich und zu beanstanden sei, man warnte auch, dass es in der vorliegenden Form noch in 30 Jahren für Probleme sorgen würde und nicht zum Rechtsfrieden im wiedervereinigten Deutschland beitrage. Das Gremium sollte recht behalten. Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem passten, begann mit Inkrafttreten des RÜG eine bis heute fortwirkende Benachteiligung. Anders als im Staatsund im Einigungsvertrag zugesichert, wurden DDR-spezifische Rentenelemente modifiziert oder gestrichen oder andere Personengruppen »vergessen«. Wortlaute wurden falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung ausgehebelt, nicht systemnahe DDR-Renten gedeckelt und hohe Renten abgeschmolzen, sodass viele Ostrentner über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen. Zu den von Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören unter anderen in der DDR geschiedene Frauen, ehemalige Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post, Krankenschwestern, Angehörige der technischen Intelligenz, Bergmänner und Balletttänzerinnen, aber auch Anspruchsberechtigte von sogenannten Fremdrenten.
Jede Gruppe reichte Klagen ein. Teilweise über mehrere Jahrzehnte. Für zehn Gruppen wurden Lösungen gefunden. 17 Gruppen gingen leer aus. Von den Arbeits- und Sozialgerichten auf Landesebene ging es weiter an das Bundesozialgericht. Das entschied, worüber es im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten entscheiden konnte. Alles andere ging weiter ans Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Auch das entschied im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Alle anderen Klagen und Beschwerden wurden abgelehnt oder nicht zur Entscheidung angenommen. Vielmehr verwies das BverfG darauf, dass der Gesetzgeber dringend den gesetzlichen Rahmen schaffen müsse, in dem die Gerichte agieren können. Mehrmals musste das Rentenüberleitungsgesetz korrigiert werden. Der Gesetzgeber kam jeweils nur den Forderungen nach, die das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich als verfassungswidrig bezeichnet hatte. Nach einer erneuten Änderung des Gesetzes 2001 schrieb der Gesetzgeber, er werde »[z]ur Vermeidung erneuter ideologisch geführter Diskussionen […] grundsätzlich nicht über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinaus[gehen und] nicht allen Forderungen des Bundesverfassungsgerichtes nach[kommen]«.5 Nachdem alle juristischen Mittel in Deutschland ausgeschöpft waren, zogen Gruppen wie die Balletttänzerinnen oder die in der DDR geschiedenen Frauen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser verwies darauf, dass es sich um eine »innerdeutsche Angelegenheit« handele.
2018 wurde im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD eine politische Lösung in Form eines Härtefallfonds im Bereich der Grundsicherung verankert. 2019 gründete sich zudem ein Runder Tisch mit den Vertretern der 17 Berufs- und Personengruppen, deren Zusatzrentenansprüche bislang nicht anerkannt worden waren. Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe von Politikern und Betroffenen erzielte im Spätherbst 2019 einen Kompromiss. Plötzlich sprach man nicht mehr von einem Härtefall-, sondern von einem Gerechtigkeitsfonds. Es sollte Einmalzahlungen von 15 000 bis 20 000 Euro pro Person geben. Als Anerkennung der Lebensleistung. Doch es folgte: nichts. 2020 verkündete das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales, man wolle sich doch wieder strikt an den Koalitionsvertrag halten, und der sehe eine an der Grundsicherung orientierte Lösung vor. Diese würde etwa zwei Prozent der 500 000 vom Runden Tisch vertretenen Personen betreffen. Doch auch die bekämen keine 15 000 Euro, sondern, zumindest ist das der Stand im Juli 2021, rund 2556,46 Euro Einmalzahlung.
Für die, die es betrifft, ist die Regelung »ein Schlag ins Gesicht«. Der Sprecher des Runden Tisches und ehemalige Reichsbahner Dietmar Polster sagt, dass diese Lösung »nicht zum sozialen Frieden in Deutschland« beitrage. »Die Gesellschaft steht in diesem Wahljahr 2021 auf der Kippe. Wir können uns keine weitere Politikverdrossenheit mehr leisten in diesem Land.« Der Chemiker Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle (Saale), der seit Jahren um die Anerkennung seiner Intelligenzrente kämpft, spricht von einer »Mogelpackung«, die Krankenschwestern aus Thüringen von »moral-ethischem Sozialbetrug«. Besonders wütend sind die Bergmänner aus Espenhain und Borna, die inzwischen »völlig den Glauben an die Politik verloren« haben. Und am härtesten betroffen sind wohl die in der DDR geschiedenen Frauen. Hier herrscht Sprachlosigkeit. Nach 30 Jahren deutscher Einheit kämpfen die Betroffenen immer noch um Anerkennung ihrer Zusatzrentenansprüche. Und um Gerechtigkeit.
1 Die Balletttänzerin
»Die Gerichte wollten einfach nicht positiv entscheiden«
Hadmut Fritsche machte zu DDR-Zeiten Karriere als Tänzerin beim Fernsehballett. Eine Karriere, die von vornherein zeitlich begrenzt war. Denn nach 20 Jahren täglichen Trainings und Auftritten kommen die Körper von Tänzerinnen und Tänzern an ihre Grenze. Eine gesonderte Versorgung nach Beendigung des Tänzerberufs sollte finanzielle Sicherheit geben. Doch 1992 wurde die »berufsbezogene Zuwendung« für Balletttänzerinnen gestrichen.
Im Haus hängen keine Fotos. Es gibt Bücher über Bücher, Landschaftsgemälde, Spiegel, aber kein überlebensgroßes Porträt im Tutu. Das überrascht mich. Immerhin ist Hadmut Fritsche eine ehemalige Balletttänzerin und nicht irgendeine »Hupfdohle« – wie sie selbst sagt –, sie war die erste Tänzerin des DDR-Fernsehballetts. Doch sowohl Haus als auch Besitzerin sind sehr bescheiden. Es gibt nichts, was überflüssig wäre. Außer ich: Denn während ich mich umschaue, fällt mir auf, dass ich wohl im Wohnzimmer vergessen wurde, und mache mich auf die Suche. Ich finde Hadmut Fritsche in der Garage, wo sie kopfüber in der Tiefkühltruhe hängt und kramt. Es ist einer der ersten heißen Tage im Sommer 2020, und es soll Eiskaffee geben. Den Kaffee dafür habe sie gestern schon gekocht. Aber das Eis müsse sie noch suchen, das müsse hier irgendwo sein.
Die Garage übrigens ist gar nicht so unbedeutend für Fritsche. »Als ich Probleme mit der Hüfte hatte, da kam ich nicht mehr aus dem Auto. Ich konnte das Bein nicht mehr richtig anwinkeln, und die Garage war zu schmal, um mit einem steifen Bein ein- und auszusteigen«, erzählt sie. »Ich habe dann einige Handwerker angerufen, ob die mir die Garage breiter bauen können. Die Gauner verlangten ein Vermögen. Da habe ich mir lieber die Hüfte operieren lassen, obwohl ich das erst gar nicht wollte.« Die Garage blieb, wie sie war. Die Hüfte ist wieder ganz, und die ehemalige Balletttänzerin scheint eher zu schweben, als dass sie läuft.
Wie man an der Geschichte mit der Garage sieht: Hadmut Fritsche kann durchaus bockig sein. Sie lacht und sagt: »Ja, bockig, das kann man so sagen. Früher wurde das aufmüpfig genannt.« Aber die Bockigkeit sei einer der Gründe dafür, dass sie bis heute bei »dieser Rentensache so dabei« ist. Seit fast 30 Jahren kämpft Hadmut Fritsche gemeinsam mit Monika Ehrhardt-Lakomy für die Weiterzahlung der berufsbezogenen Zuwendung (bbZ) für die ehemaligen Balletttänzerinnen und -tänzer der DDR. Diese wurde 1976 eingeführt und sollte später die schmale Tänzerrente aufstocken. Denn das Arbeitsleben von Balletttänzerinnen war zeitlich begrenzt.
»Es ist ein Ost-West-Thema«
Sieben bis neun Jahre Ausbildung, tägliches Training und mit Mitte 30 schon wieder raus aus dem Beruf: Balletttänzerin ist und war ein Ausnahmeberuf. Neben der hohen physischen und psychischen Belastung brachte der Beruf wenig Freizeit und viele Einschränkungen des Familienlebens mit sich. Die Gagen standen dem Ganzen diametral entgegen: Tänzerinnen und Tänzer verdienten monatlich rund 600 Mark, Spitzentänzerinnen in Ausnahmefällen bis zu 1000 Mark. Und im Schnitt war nach 15 bis 20 Arbeitsjahren die Karriere vorbei. Im Westen federte ein Versorgungswerk die schmalen Renten ab, in der DDR gab es ab 1976 eine staatliche Ballettrente. Bis zu 400 Mark monatlich bekamen diejenigen zusätzlich, die bis zu 15 Jahre durchgetanzt hatten. Dazu garantierte die gesetzliche Rentenversicherung je nach Anzahl der Berufsjahre eine Mindestrente zwischen 330 und 470 Mark, der Höchstsatz lag bei 510 Mark. Dass die soziale Absicherung für die Tänzerinnen nicht ausreichend war, erkannte auch der Ministerrat der DDR und erließ 1976 die »berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR«. Diese betrug 50 Prozent der monatlichen Vergütung von fünf zusammenhängenden verdienstgünstigsten Jahren.
Und diese Regelung wurde 1992 von der Bundesregierung gestrichen, obwohl im Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 und auch im Einigungsvertrag vom 31. August 1990 den Mitgliedern des staatlichen Balletts die Ansprüche auf Zahlung aus der berufsbezogenen Zuwendung »ohne Schmälerung« garantiert worden waren. Die Streichung der Tänzerrenten basierte, so erzählen es Fritsche und ihre Tänzerkolleginnen und -kollegen, auf einer Fehlinterpretation der im Einigungsvertrag enthaltenen Passage: »Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen vom Juni 1983 mit folgenden Maßgaben: Die Anordnung ist bis zum 31. Dezember 1991 anzuwenden.«1 Allerdings findet sich im Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) keine Regelung für die Zeit ab 1. Januar 1992 – was bei Gerichtsverhandlungen immer wieder die Frage aufwarf: Was galt nach dem Stichtag? Denn die Tänzerinnen, die danach in den Ruhestand gingen, erhielten keine berufsbezogene Zuwendung. Das machte sie oft genug zum Sozialfall. Wenn man davon ausgeht, dass einer Tänzerin ab 1992 ihre berufsbezogene Zuwendung zustand, wären das bis 2021 etwa 71 000 Euro gewesen. Mehr als 700 Tänzerinnen klagten ab 1993 gegen die Liquidierung ihrer Ansprüche und zogen bis weit in die 2000er-Jahre vor die Arbeits- und Sozialgerichte auf Landes- wie auch auf Bundesebene.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) nahm 2002 die Klage nicht zur Entscheidung an, es bestätigte aber immerhin: Die Formulierung des Einigungsvertrages »noch nicht geschlossene Versorgungssysteme [sind] bis 31. Dezember 1991 zu schließen«, bedeutet nicht, dass »die in diesem Versorgungssystem erworbenen Ansprüche und Anwartschaften […] zum Erlöschen gebracht werden«.2 Ein Minierfolg. Allerdings wies das Gericht darauf hin, dass eine entsprechende Andersregelung durch die Bundesregierung geschaffen werden müsse. Was bis zum Frühjahr 2021 nicht geschehen ist. In der Nichtannahmeerklärung des BVerfG heißt es, »die Beendigung der bbZ an Ballettmitglieder der DDR [verletzt] weder das Grundrecht auf Eigentum, auf Gleichheit noch die Grundsätze rechtsstaatlichen Vertrauensschutzes«.3
Die Tänzerinnen zogen weiter bis vor den Europäischen Gerichtshof. Der wies die Klage 2007 ab, weil es sich um eine »innerdeutsche Angelegenheit« handele. »Und damit haben sie recht. Es ist ein Ost-West-Thema«, sagt Tänzerin Fritsche. Nicht nur das. Es gebe eine ganz klare Haltung, die Fritsche und ihre Mitklägerinnen immer wieder zu spüren bekommen: Warum sollten denn die Ossis eine Extrarente bekommen? Doch darum geht es in Fritsches Augen gar nicht, denn zum einen erhalten die Westtänzer ebenfalls einen Versorgungsausgleich im Alter, zum anderen: »Es geht einfach darum, dass es nicht einmal den Versuch seitens Politik oder Justiz gab, einen Fehler einzugestehen. Nach drei Jahrzehnten sitzen die immer noch das Problem aus.«
Nachkriegskindheit
Wer in der DDR beim Ballett war, gehörte zu einer Elite. Den Beruf konnten nur die ergreifen, die einen Platz bekamen und auch die körperlichen Voraussetzungen erfüllten. Der Tanz nahm »im ostdeutschen Prozess der Nationenbildung eine umstrittene Position ein. […] Als eine Kunstform, die nicht auf gesprochener oder geschriebener Sprache aufbaute, wurde er als vieldeutig und somit als nicht unbedingt für die didaktische Propaganda geeignet betrachtet. Dennoch wurde er zu einem besonderen Anliegen der DDR-Regierung, da er in zahlreiche Ebenen des sozialen Lebens hineinreichte.«4 Die Ausbildung an einer der staatlichen Ballettschulen in Dresden, Leipzig und Ost-Berlin dauerte zunächst fünf Jahre, ab 1963 sieben und später sogar neun Jahre.
»Ich wollte als Kind eigentlich Artistin werden«, erzählt Hadmut Fritsche. »Aber meiner Mutter war das zu gefährlich. Das sei ein halsbrecherischer Beruf, sagte sie.« Ein Schlüsselerlebnis für Hadmut Fritsche war, dass sie nach dem Krieg in Berlin-Karow Camilio Mayer und seine Artistentruppe mit der Camilio-Mayer-Stratosphären-Schau sah. »Da ist einer auf dem Seil bis in den Kirchturm balanciert. Das fand ich sehr irre«, erinnert sich Fritsche, als wir im Garten sitzen. »Ich sagte zu Mutti: ›Ich will Artistin werden.‹ Und die sagte: ›Nein, aber Ballettunterricht geht.‹«
Die berühmte Tatjana Gsovsky war von 1945 bis 1952 Ballettmeisterin an der Berliner Staatsoper und betrieb eine Kinderballettschule am Kurfürstendamm. »Die hat meine Beine genommen und mir das Bein vorne an den Kopf gedrückt, seitlich und hinten. Das ging prima. ›Die ist begabt‹, sagte sie und wollte mich übernehmen. Aber als wir zurückfuhren, sagte Mutti: ›Hadmut, 50 Mark kann ich nicht zahlen.‹« Fritsches Vater war drei Wochen nach Kriegsende gestorben, nachdem er todkrank heimgekehrt war. Um über die Runden zu kommen – die Witwenrente war schmal –, nähte die Mutter aus drei alten Kleidern ein neues. Für das neue Kleid gab es im Tausch ein Brot.
Als Hadmut Fritsche acht Jahre alt war, tat sich eine neue Gelegenheit auf: Jean Weidt, der »rote Tänzer«, hatte 1948 eine Ballettschule mit Schwerpunkt »dramatisches Ballett« gegründet. Hier wurde Fritsche aufgenommen, tanzte, bis sie 14 Jahre alt war. Nach der achten Klasse hätte sie gern Ballett studiert. Der Mangel an Ausbildungsplätzen machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Außerdem wurde das Schulgesetz damals novelliert, sodass nun alle Schüler in Berlin neun Jahre zur Schule gehen mussten. »Ich hatte so eine Wut, und die habe ich auch offen ausgelebt. Ich musste jeden Tag zum Direktor. Ich war damals richtig aufmüpfig. Ich weiß noch, Stalin starb in der Zeit. Die ganze Klasse musste fünf Minuten stillstehen und ruhig sein – und ich kicherte in der hintersten Reihe. Das hallte über den ganzen Schulhof – und gab richtig Ärger.«
Doch im Herbst 1953 konnte Fritsche ihre Ausbildung an der Ballettschule in Berlin beginnen. Monatlich bekamen alle Tänzerinnen und Tänzer 150 Mark Stipendium. 50 Mark wurden für die Verpflegung abgezogen. Die Ausbildung war sehr streng. Denn durch gut ausgebildete Tänzer wollte die DDR dem »kapitalistischen Westen vor Augen führen, wie leistungsstark und erfolgreich das Ballett und die Institutionen der Tanzausbildung in der DDR waren«.5 Fritsche hielt die fünf Jahre durch und war gut. Am Ende des Studiums kamen die Meister aus Dresden und Leipzig und sahen sich die Tänzerinnen und Tänzer an, um sie an ihre Häuser zu holen. »Ich tanzte damals, 1958, bei der Staatsoper vor. Die Tänzerinnen der Staatsoper waren immer ein Team. Da kamen welche aus West-Berlin und manche aus Ost-Berlin. Aber es war für unsere Arbeit nie wichtig, wer woher kam.«
»Es wird niemandem schlechter gehen …«
Vor dem Mauerbau war es weitgehend egal, aus welcher Besatzungszone man kam. Später, erinnert sich Fritsche, verglich man sich immer mit dem Westen und versuchte sich abzugrenzen. Und nach dem Mauerfall war es plötzlich nicht mehr egal, woher man kam. Plötzlich sei man als Ossi in eine Bittstellerposition geraten, weil man um den Erhalt und die Wahrung seiner bekannten Lebenswelt und seine Ansprüche – wie im konkreten Fall der Renten – kämpfte. Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) erklärte am Tag der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1990: »Den Deutschen in der DDR kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Maizière betont hat: Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser.«6 Und er verkündete, dass Verlässlichkeit und Worthalten einen hohen Stellenwert haben. Das wiederholte Bundesarbeits- und -sozialminister Norbert Blüm (CDU) nach dem 3. Oktober 1990 und ging davon aus, dass der Angleichungsprozess der Lebensverhältnisse binnen fünf Jahren vollzogen sei. Dass nicht nur er, sondern auch alle anderen politischen Akteure sich irrten und aus dieser falschen Annahme heraus Entscheidungen getroffen wurden, die den Menschen, die bis heute um die Anerkennung und Auszahlung ihrer Zusatzrente kämpfen, immer noch Unrecht tun, schrieb er 2003 an Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) mit den Worten: »Wir [sind] seinerzeit davon ausgegangen, dass die Rentenangleichung Ost und West in 5 Jahren abgeschlossen sein würde.«7
Unser Eiskaffee ist inzwischen ausgetrunken. Fritsche, die aufgehört hat zu rauchen, als das Westgeld kam (»Ich werde nicht eine Westmark in Zigaretten stecken, habe ich mir geschworen«), raucht nun doch eine, »aber nur weil Besuch da ist«. Ihr Haus ist nur wenige Meter entfernt von dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Was heute kaum noch bezahlbar ist, war in den 70er-Jahren für wenig Geld zu haben. Das Haus habe ihr Mann so gestaltet und renoviert, wie es heute noch sei. Auf dem Weg zur Toilette gehe ich durchs Wohnzimmer und entdecke doch ein Foto auf einem kleinen Tisch: ihr Mann. Er trägt eine Baskenmütze, hat einen Bart und lacht. Auf dem Foto ist er bestimmt schon 60. Inzwischen lebt er nicht mehr.
Anders als anderen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geht es Hadmut Fritsche gut. Das liegt auch daran, dass sie nach ihrer aktiven Tänzerkarriere direkt eine Anstellung als Leiterin des Klubs des Deutschen Fernsehballetts fand, für das sie viele Jahre getanzt hatte. Sie setzt sich für ihren Berufsstand und die Auszahlung der bbZ ein, weil sie weiß, dass nicht alle ehemaligen Tänzerinnen und Tänzer so viel Glück hatten. Denn nach dem Karriereende mit Mitte 30, Anfang 40 fanden nicht alle eine neue Anstellung. Nur die wenigsten werden Ausbilder oder Lehrer.
Die berufsbezogene Zuwendung ist aus Fritsches Sicht unerlässlich für eine würdige Altersversorgung. »Das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun«, sagt sie. Für die Tänzerinnen gibt es die vom Ministerrat erlassene Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen in der DDR (bbZ-AO) vom 1. September 1976. Sie gilt für »alle Tänzerinnen und Tänzer […], die ihre Tätigkeit aus alters-, berufsbedingten oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können und die sich in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zu einem Theater, staatlichen Ensemble bzw. zum Fernsehen der DDR befinden«.8 Da die gesonderte Versorgung nicht über Sozialabgaben der DDR-Tänzerinnen erfolgen konnte, deren Gagen 600 bis 1000 DDR-Mark betrugen, sodass – in Kombination mit wenigen aktiven Arbeitsjahren – nur Mindestrenten erreicht wurden, regelte § 4 Satz 4, dass »die weitere Zahlung der berufsbezogenen Zuwendung die Staatliche Versicherung der DDR« übernimmt. Damit handele es sich – zumindest nahmen die Tänzerinnen das an – bei der bbZ um eine sozialstaatliche Leistung. Doch das Bundessozialgericht wies die eingereichte Klage 1994 zurück an die Arbeitsgerichte der Länder, »da es sich [bei der bbZ] nur um Ansprüche aus der Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses handeln könne«.9 Doch die konnten nirgendwo mehr geltend gemacht werden, weil es die DDR-Betriebe nicht mehr gab. Theoretisch. Doch im Fall der Balletttänzerin gab es sie noch: das Fernsehballett und die Staatsoper.
Ein Leben für den Tanz
Drei Jahre bevor Hadmut Fritsche 1958 an der Staatsoper vortanzte, hatte Lieselotte Gruber als Ballettmeisterin und Choreografin hier angefangen. »Die hat sich einen großen Teil der Tänzer aus Leipzig mitgenommen. In der Staatsoper brodelte es. Sie war da nicht unbedingt willkommen.« Die Antipathie beruhte offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Lilo Gruber hielt wohl nicht viel von Hadmut Fritsche. »Ich habe vorgetanzt und war mir sicher, dass ich eine Stelle bekomme. Drei andere aus meiner Klasse wurden ja genommen. Da sagt sie zu mir: ›Hadmut, wir können dich nicht nehmen.‹ – ›Warum?‹, frage ich. – ›Du passt figürlich nicht in unsere Gruppe.‹ Das war Unsinn. Die Gruber wollte mich einfach nicht. Ich bin wieder nach Hause, und in dem Moment klingelt das Telefon und die Staatsoper ist dran: Ich könne doch dort anfangen, wenn ich will. Die Gruber habe es sich doch anders überlegt.«
Das Ballett von damals, erzählt Fritsche, sei in ihren Augen wie die Gemäldegalerie: beachtenswert, gut – aber nicht Ausdruck der gegenwärtigen Zeit. »Ich bin der Meinung, dass die Staatsoper Ende der 50er-Jahre einfach nicht zeitgemäß getanzt hat. Also bin ich zur Gruber und hab gesagt: ›Können wir nicht mal was Modernes machen?‹ Die hat geantwortet: ›Hadmut, wir sind das erste Haus am Platz und kein Experimentiertheater.‹« Das Verhältnis zwischen der Chefchoreografin Gruber und der Elevin Fritsche wurde nie ein gutes.
»Dass ich von der Oper weggegangen bin, hatte was mit dem 13. August 1961 zu tun. Im Herbst 1960 wurde ich schwanger. Bis zum fünften Monat habe ich Schwanensee getanzt, dann bekamen die wohl Angst, dass ich das Kind auf der Bühne bekomme, und legten mir nahe, nicht mehr zu arbeiten«, erzählt Fritsche. Ihr Sohn kam im Juli 1961 auf die Welt. Hadmut Fritsche hatte nicht genügend Milch und ging zur Kinderfürsorge, weil dort, aber nur im Westteil der Stadt, die Säuglingsnahrung Humana ausgegeben wurde. Dann kam der 13. August, ein Sonntag. »Wir hörten vom Mauerbau früh im Radio. Und wie so viele Berliner meinte ich nur: Das geht doch gar nicht. Da fährt doch die S-Bahn durch. Der nächste Gedanke war dann: Die Milchnahrung reicht nur bis morgen früh. Montag früh bin ich dann gleich zur Kinderfürsorge in Ost-Berlin, und die meinten: ›Ach du lieber Gott, Frau Fritsche. Ich kann Ihnen keine Scheine mehr für Humana-Milch geben. Sie müssen Ihrem Kind jetzt Brei geben.‹ Ich hatte bei jedem Löffel Angst, der Kleine erstickt.«
Noch am 13. August bekam Fritsche ein Telegramm aus der Staatsoper, ob sie nicht doch schon wieder tanzen könne. »Da habe ich gedacht: Sind die bescheuert? Normalerweise blieben die Tänzerinnen mit Kind ein halbes Jahr zu Hause.«10 Drei Tage später fuhr sie in die Staatsoper, die nicht spielfähig war. Nach dem Mauerbau fehlte die Hälfte des Tanzensembles, beim Orchester waren es zwei Drittel, beim Chor etwa 60 Prozent. Um die Künstler zu halten oder in den Ostsektor zu holen, wurde ihnen versprochen: »Wenn Sie in die DDR ziehen, bekommen Sie sofort eine Wohnung.« Da also Notstand herrschte, fing Fritsche vier Wochen nach der Entbindung wieder an zu tanzen. Die Stimmung im Haus war angespannt. Lilo Gruber war nervös. Sie musste ein Tanzensemble leiten, das teilweise aus Tänzerinnen bestand, die noch in Ausbildung waren, und dieses zu einer Ballettkompanie aufbauen, die das gewohnte hohe Niveau auf die Bühne brachte.
Bei einer Probe 1962 krachte es zwischen Gruber und Fritsche endgültig: »Die Gruber saß im Zuschauerraum und brüllte: ›Hadmut, so geht das nicht.‹ Da habe ich gedacht: Du dumme Kuh, bin vor an den Rand der Bühne und habe in den Zuschauerraum gesagt: ›Frau Gruber, Sie konnten mich noch nie leiden. Ich gehe jetzt nach Hause.‹« Von dort schickte sie ihre Kündigung an die Oper.
Von der Staatsoper zum Fernsehballett
Inzwischen ist es 17 Uhr, aber die Sonne prasselt immer noch. Zu zweit versuchen wir den Sonnenschirm, der in einem schweren Betonständer steht, zu verrücken. Hadmut Fritsche steht auf und meint, sie mache jetzt mal Mittagessen. Es gibt Kartoffeln und Tsatsiki – oder wie sie sagt: Kartoffeln und Sirtaki. Die Küche ist ein Traum für Nostalgiker. Überall stehen rote Emaillekannen und -becher, die Kaffeemaschine ist rot, der Wasserkocher. Selbst der Mülleimer ist rot. Während sie Kartoffeln aufsetzt, frage ich nach ihrem Namen: Ob sie eigentlich ein Junge werden sollte, weil mich der Name an Hartmut erinnert. »Ich? Ich sollte gar nichts werden. Passen Sie auf, ich erzähle Ihnen die Geschichte.« Als ihre Mutter 1937 schwanger wurde, passte das nicht. Sie hatte bereits einen zehnjährigen Sohn. Und da sie in dieser Zeit sehr mit sich geHADert habe, aber trotzdem den MUT fand, das Kind zu behalten, bekam Klein Hadmut ebenjenen Namen. Mir geht die Geschichte sehr nah. Im Nachgang recherchiere ich und finde dazu, dass der Name germanischen Ursprungs ist und sich aus hadu für Kampf und muot für Geist zusammensetzt. Das passt: Hadmut Fritsche hat wirklich Kampfgeist. Das zeigt auch ihre Kündigung an der Staatsoper. Ein unglaublicher Schritt zur damaligen Zeit. Und Fritsche fragt sich heute, fast 60 Jahre später, was sie da geritten hat.
Zu dieser Zeit, 1962, bekam ein Solist aus Weimar den staatlichen Auftrag, ein Fernsehballett zu gründen: Günter Jätzlau. Er wusste nicht so recht, wo er Tänzerinnen und Tänzer herbekommen sollte, und hörte sich um. Ein Kollege von Fritsche sagte zu ihm: »Bei uns hört eine auf, die ist genau richtig dafür.« Als sie in Adlershof anfing, war sie offiziell die erste Tänzerin des Fernsehballetts. Mit 750 Mark Gage. »Meine Vorstellung von Fernsehballett war natürlich eine ganz andere. Wir haben ja die ganze Bandbreite bestückt: Revue, Kammertanz, Klassik … Aber ich fand’s okay. Anfangs waren wir acht Frauen. Ich konnte nicht meckern, bekam ich doch in jeder Sendung ein Solo. Und das wurde auch noch extra bezahlt. Ich habe sehr gut verdient.«
1963 kam Emöke Pöstenyi, Susan Baker kurze Zeit später zum DFF-Ballett. Die Ungarin und die Halbamerikanerin wurden als Pendant zu den westdeutschen Kessler-Zwillingen ins Fernsehen geholt und genossen in der DDR Starstatus. Gemeinsam mit den beiden trat das Ensemble oft bei Ein Kessel Buntes auf. Insgesamt 15 Jahre war Hadmut Fritsche beim Fernsehballett. Wer so lange tanzte, gehörte zur Oberliga. Länger hält ein Körper das straffe Training und die permanente Belastung nicht aus. Doch Fritsche tanzte sogar 20 Jahre. Eine Ausnahme. »Ein Tänzer lebt im Moment, es gibt kein ›Nach dem Tanzen‹. Aber mit Mitte 30, Anfang 40 ist die Tänzerkarriere definitiv vorbei.«
Tanz um die Renten
Als 1991 klar wurde: Die Tänzerinnen erhalten ihre berufsbezogene Zuwendung nicht, fanden sich Hadmut Fritsche, Monika Ehrhardt-Lakomy und andere Kolleginnen zusammen, um ihre Möglichkeiten zu besprechen. Fritsche erinnert sich an eine der ersten Sitzungen in der Staatsoper: »Das wurde damals alles sehr kontrovers diskutiert. Die Kollegen aus Westdeutschland sagten: ›Das könnt ihr lassen mit den Klagen. Ihr habt keine Chance.‹ Und wir, die Ossis, haben gesagt: ›Jetzt erst recht. Wir klagen.‹« 1993 wurde eine Musterklage beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingereicht. Daran hingen etwa 100 Einzelklagen, aber nur zwei Personen sollten stellvertretend prozessieren. Doch das BVerfG lehnte die Sammelklage als unzulässig ab: Jede Person müsse einzeln klagen. Aus Fritsches Sicht ein geschickter Schachzug, denn wer hat schon Geld und Nerven dafür? Doch sie und andere gingen diesen Weg: über die Landesarbeitsgerichte (LAG) bis zum Bundesarbeitsgericht (BAG). Wo sie verloren. Weiter zum Bundessozialgericht. Wo sie zurück zu den Arbeitsgerichten der jeweils zuständigen Länder geschickt wurden.
Ende der 90er-Jahre reichten sie eine Klage beim BVerfG ein, die erst 2002 bearbeitet wurde. »Wir haben uns immer gewundert, warum das so lange dauert. Aber das Bundesverfassungsgericht ist das einzige Gericht, das selber entscheidet, wann was verhandelt wird. Alle anderen Gerichte sind an Fristen gebunden«, erklärt Fritsche. Als das Gericht die Klage nicht zur Entscheidung annahm und auf eine Regelung seitens der Politik verwies, reichten die ehemaligen Tänzerinnen Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein. Dieser rügte zwar die lange Wartezeit des BVerfG, vertrat aber die Auffassung, dass es sich um eine »innerdeutsche Angelegenheit« handele. »Die ganzen Gerichte waren in erster Linie mit Westrichtern besetzt. Die hatten kein Interesse, dem Staat vorzugeben, wie er das entscheiden sollte«, meint Fritsche. Die Prozesse beschreibt sie als streckenweise furchtbar. Als demütigend.
Sehr genau erinnert sie sich an eines der größten Verfahren in der Causa der DDR-Zusatz- und auch Sonderrenten 1998 vorm Bundesverfassungsgericht. Den Vorsitz hatte Richter Dieter Grimm, anwesend war unter anderen ein Vertreter der Bundesregierung. Grimm fragte ihn: Wenn ein DDR-Bürger am 2. Oktober 1990 Eigentümer eines Trabis gewesen ist: War dieser nach dem 3. Oktober 1990 weiterhin sein Eigentum? Und weiter: Und wie verhält sich diese Causa mit den rechtmäßig erworbenen Renten- und Versorgungsansprüchen? Der Regierungsvertreter soll geantwortet haben, dass der Trabi selbstverständlich Eigentum des Bürgers geblieben sei, allerdings müsse man auch beachten, was die DDR mit in die Bundesrepublik eingebracht habe. »Nichts. Denn die DDR ist nichts weiter als eine verölte Immobilie.« Die Sitzung, erzählt Fritsche, musste unterbrochen werden, obwohl keine Pause anberaumt war. »Die Stimmung war richtig aufgeheizt. Das war eine Frechheit, so was zu sagen.«
1998 schrieb Lothar de Maizière an die Tänzerinnen, was er auch in einer Bundestagsrede öffentlich wiederholte, dass »in Rechtsvorschriften, die im Zusammenhang mit der Herstellung der deutschen Einheit gesetzt wurden, eine Frist zum 31. Dezember 1991 genannt wurde, […] diesseits davon ausgegangen [wurde], daß dies der Zeitraum sein sollte, innerhalb dessen die Neuregelung gefunden und beschlossen sein sollte. Nicht gemeint war mit einer solchen Fristsetzung, daß die entsprechenden Leistungen zu diesem Zeitpunkt auslaufen oder ersatzlos gestrichen sein sollten.«11 Weiterhin bestätigte de Maizière, dass bereits die Volkskammer der DDR die bbZ als »sicherungswürdig ansah« und daher im Rentenangleichungsgesetz vom 28. Juni 199012 »ausdrücklich die berufsbezogenen Zuwendungen für Ballettmitglieder sowie andere aus betrieblichen Mitteln gezahlte Renten oder Pensionen genannt« und im »Einigungsvertrag ins fortgeltende Recht der Bundesrepublik Deutschland übernommen« wurden. Das sahen die Gerichte anders. 2002 vertrat das BVerfG die Auffassung, dass die berufsbezogene Zuwendung für Tänzerinnen keinen Eigentumsschutz genieße, weil sie nicht als »Rechtsposition der gesamtdeutschen Rechtsordnung« anerkannt sei. Doch der Einigungsvertrag zog nicht nur Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch »aus anderen öffentlichen Versorgungssystemen« heran.13
Weiterhin konstatierte das hohe Gericht, dass sich die Kläger nicht auf den bei Renten üblichen Vertrauensschutz berufen dürften, da diese Zuwendung durch einen »Unrechtsstaat etabliert« worden sei. Und die Liquidierung der Zuwendung sei auch kein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 3 des Grundgesetzes. Allerdings werden westdeutsche Tänzerinnen im Alter durch Zahlungen aus der Pflichtversicherung der Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen unterstützt. Und das ist das gleiche Prinzip wie bei den Reichsbahnern (siehe Kapitel 8): Den westdeutschen Bahnern werden ihre höheren Altersbezüge ausbezahlt, den Ostdeutschen nicht.
Ein weiteres Argument des Gerichtes: Diese Versorgung sei ein systemfremdes Element. Im Rentenüberleitungsgesetz vom Juni 1991 wurde festgelegt, dass dem bundesdeutschen System rentenrechtlich unbekannte Elemente nicht anerkannt werden. Welche das sind und inwiefern sich diese von den im Einigungsvertrag erwähnten Versorgungssystemen aus öffentlicher Hand unterscheiden, wurde nicht ausgeführt. Doch bei der bbZ handelt es sich keinesfalls um ein systemfremdes Element, denn in der Bundesrepublik gibt es wie bereits erwähnt mit der (Pflicht-)Versicherung für Tänzerinnen und Tänzer sehr wohl eine Versorgung. Ein Wechsel in diese (westdeutsche) Versicherung des damals bereits vereinten Deutschlands war nicht möglich. Im Einigungsvertrag wurde ein rückwirkender Eintritt der DDR-Tänzerinnen in die Versicherung Deutsche Bühnen München ausgeschlossen.14 Die Osttänzerinnen konnten ab diesem Zeitpunkt nichts weiter tun, als zu klagen. Ohne Erfolg.
Seit 2018 plädieren die ehemaligen Tänzerinnen und andere Berufsgruppen für eine neue, eine politische Lösung: 15 000 bis 20 000 Euro Einmalzahlung. Und zwar nicht nur für die Härtefälle, wie es der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 2018 vereinbarte gleichnamige Fonds vorsieht, sondern für alle Anspruchsberechtigten von Zusatzrenten in Form eines Fonds zur Anerkennung von Lebensleistung: »20 000 Euro klingt viel, ist es aber nicht. Hätte ich die Zusatzversorgung ausgezahlt bekommen, dann wären das inzwischen um die 70 000 Euro«, sagt Fritsche. Das erste Mal in unserem Gespräch macht sie eine nachdenkliche Pause. Dann sagt sie: »Die Gerichte wollten nicht. Die wollten einfach nicht positiv entscheiden … Aber was sollten die auch entscheiden? Es gab kein Gesetz nach der Wiedervereinigung für uns, das ganz klar den Erhalt unserer Tänzerrente formuliert hätte. Aber das hätte man schaffen können. Es werden doch auch sonst Gesetze geschaffen, wenn es notwendig ist. Aber es hat keiner für notwendig erachtet, für die Auszahlung der Zusatzrenten – und damit meine ich nicht nur unsere – ein Gesetz zu schaffen.«
Als ich gegen 20 Uhr meinen Zug nehmen muss, will Hadmut Fritsche mich unbedingt zum S-Bahnhof fahren. Ins Auto in der Garage kann sie ja nun wieder einsteigen. Mit gemütlichen 25 Stundenkilometern fahren wir im zweiten Gang durch Berlin-Karow. Fritsche ist jemand, den man einfach als Berliner Original bezeichnen muss. Unterwegs moniert sie im Berliner Dialekt völlig banale Dinge wie den Verkehr oder einzelne Personen. Nie böse – aber eben typisch Berlinerin. Ihr geht es gut. Ja. Sie leidet keinen Hunger, lebt in einem eigenen Haus. Aber das Gefühl, nicht gerecht behandelt zu werden, macht sie unruhig. »Es ist an manchen Tagen kein innerer Frieden da«, sagt Hadmut Fritsche.
2 Der Diplom-Chemiker – Technische Intelligenz I
»Wir werden bestraft dafür, dass wir aus der DDR kommen«
Klaus-Dieter Weißenborn arbeitete ab 1967 als Diplom-Chemiker in den Bunawerken Schkopau, war Abteilungsleiter und machte durch seine Forschungen das PVC aus der DDR weltmarktfähig. Nach der Wende übernahm ihn das amerikanische Unternehmen Dow Chemical, wo er im Bereich Nachhaltigkeit arbeitete. Doch die Forschungsstelle lief aus, und so ging er früher in den Ruhestand als geplant. Weißenborn gehört zur technischen Intelligenz, der Gruppe, wegen der das Zusatzrentensystem in der DDR überhaupt eingeführt worden war. Doch bis heute sieht Weißenborn, wie viele seiner Berufskollegen, davon keinen Cent.
Er überlegt ein wenig, ob er mir sagt, wie einige seiner Kollegen ihn anfangs nach seinem Einstieg in Buna scherzhaft nannten: »Qualmende Socke«. Während ich Klaus-Dieter Weißenborn gegenübersitze, merke ich schnell: Die Kollegen hatten recht mit dem Spitznamen. Der ehemalige Diplom-Chemiker im VEB Chemische Werke Buna, Jahrgang 1942, ist flink. Physisch wie psychisch. »Ich habe ja morgen wieder was vor, davon weiß meine Frau aber noch gar nichts«, sagt er schelmisch. Er wolle den Kanonenweg abfahren. Mein fragender Blick lässt ihn ein wenig tadelnd hinzufügen: Das ist ein Stück der alten Bahnstrecke, die einst Kaiser Wilhelm zwischen Berlin und Metz plante. Einen Teil davon im Eichsfeld kann man heute mit dem Rad befahren. Das sind hin und zurück 60 Kilometer.« Ob er das mit dem Auto abfahren wolle. »Mit dem Auto? Mit dem Fahrrad selbstverständlich.«
Selbstverständlich ist für Weißenborn nicht nur ein solcher Tagesausflug mit dem Rad, sondern auch der Kampf um die Anerkennung der Zusatzrenten für seine Berufsgruppe: die (Diplom-)Chemiker. Die Frage, um die es geht, lautet: Gehörten Diplom-Chemiker in der DDR zur »technischen Intelligenz«, und haben sie als solche Anspruch auf die Auszahlung ihrer Zusatzrente? Weißenborn sagt: Ja! Denn die Ansprüche dieser Gruppe sind im Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)1 anerkannt worden. Trotzdem bekommt er keinen Cent Ingenieurrente. Warum? Laut Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) von 2001 sind »die Angehörigen der Berufsgruppe der [DDR-]Diplom-Chemiker nicht […] den Ingenieuren zuzurechnen«.2





























