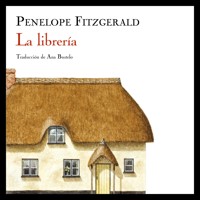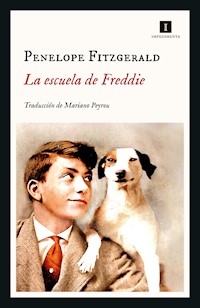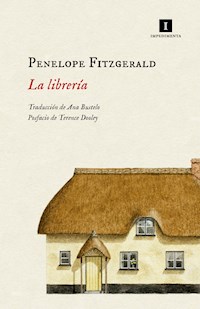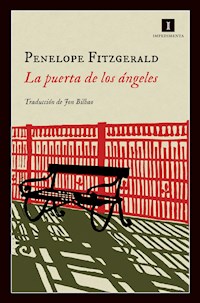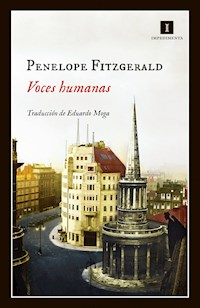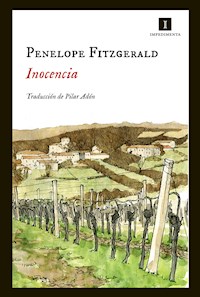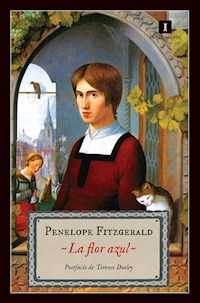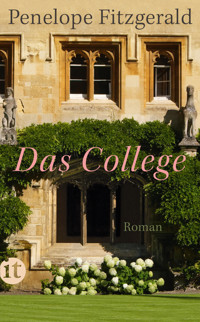9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Was ich gesucht, habe ich gefunden, / Was ich fand, das fand auch mich. «
Friedrich von Hardenberg, besser bekannt als Novalis, ist 22, als er Sophie von Kühn erstmals trifft – eine Viertelstunde, die über sein Leben entschieden hat, wie er später seinem Bruder gestehen wird. Hals über Kopf hat er sich verliebt und verlobt sich schon bald mit »Söphgen«.
Für den romantischen Dichter ist die viel Jüngere seine blaue Blume, die Verkörperung seiner Poesie und all seiner Sehnsucht. Doch das Glück steht unter keinem guten Stern: Sophie erkrankt an Tuberkulose ...
Penelope Fitzgerald erzählt die dramatische Liebesgeschichte des Paares, dessen Schicksal bis heute berührt, und sie zeigt Novalis in einem neuen Licht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Penelope Fitzgerald
Die blaue Blume
Roman
Mit einem Nachwort von Candia McWilliam
Aus dem Englischen von Christa Krüger
Insel Verlag
»Der Roman ist aus Mangel der Geschichte entstanden.«
F. von Hardenberg
1. Kapitel
Waschtag
Ganz dumm und weltfremd war Jakob Dietmahler nicht: Er sah sehr wohl, daß sie ausgerechnet am Tag der großen Wäsche im Elternhaus seines Freundes ankamen. Ein denkbar unpassender Zeitpunkt für einen Besuch, und ganz besonders in diesem vornehmen Haus, dem drittgrößten in Weißenfels. Dietmahlers Mutter hielt dreimal im Jahr große Wäsche, deshalb besaß ihr Haushalt nur für vier Monate Leinen und Weißzeug. Es gab neunundachtzig Hemden, mehr nicht. Aber hier, im Hardenbergschen Haus in der Klostergasse, war offenbar nur einmal im Jahr Waschtag; das schloß er aus dem schmuddeligen Schneegestöber von Laken, Bettbezügen, Kissenbezügen, Unterhemden, Leibchen, Unterhosen, die durch die oberen Fenster in den Hof hinunterflatterten und dort von finster blickenden männlichen und weiblichen Dienstboten in großen Körben aufgefangen wurden. Das mußte kein Zeichen für Reichtum sein; er wußte sogar, daß es in diesem Fall keines war, aber es deutete auf eine alteingesessene, sehr angesehene Familie hin. Auch auf eine zahlreiche Familie. Die Unterwäsche von Kindern und Jugendlichen und Stücke in Erwachsenengrößen segelten durch die blaue Luft, als ob die Kinder selbst fliegen gelernt hätten.
»Fritz, ich fürchte, du hast mich in einem unpassenden Moment hergebracht. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Nun stehe ich da, für deine verehrte Familie ein Fremder, und wate knietief in eurer Unterwäsche.«
»Woher soll ich wissen, wann sie Wäsche waschen?« sagte Fritz. »Und wenn schon, du bist jederzeit tausendmal willkommen.«
»Der junge Herr trampelt auf den unsortierten Kleidern herum«, rief die Wirtschafterin aus einem Fenster im ersten Stock.
»Fritz, wie viele seid ihr in der Familie?« fragte Dietmahler. »So viele Dinge?« Dann brüllte er plötzlich: »Ein Ding an sich ist nicht vorstellbar!«
Fritz, der vor ihm her über den Hof ging, blieb stehen, blickte um sich und brüllte dann mit Autorität zurück: »Meine Herren! Sehen Sie den Wäschekorb an! Denken Sie den Wäschekorb! Und nun denken Sie den, der den Wäschekorb gedacht hat!«
Im Inneren des Hauses fingen die Hunde an zu bellen. Fritz rief einem der Dienstboten an den Körben zu: »Sind mein Vater und meine Mutter zu Hause?« Aber das war eine unnötige Frage, denn die Mutter war immer da. Nun kamen ein untersetzter, unfertig aussehender junger Mann, noch jünger als Fritz, und ein blondes Mädchen in den Hof hinunter. »Hier sind jedenfalls mein Bruder Erasmus und meine Schwester Sidonie. So lange sie da sind, braucht man nicht mehr.« Beide umarmten Fritz stürmisch.
»Wie viele seid ihr denn im ganzen?« fragte Dietmahler noch einmal. Sidonie gab ihm die Hand und lächelte.
»Hier zwischen den Tischtüchern bringt mich Fritz Hardenbergs kleine Schwester durcheinander«, dachte Dietmahler. »Genau das wollte ich vermeiden.«
Sie sagte: »Karl wird irgendwo sein, und Anton auch und Bernhard, aber wir sind natürlich noch mehr.« Im Haus war Freifrau von Hardenberg, sie wirkte wesenslos und schattenhafter als ein Schatten. »Mutter«, sagte Fritz, »dies ist Jakob Dietmahler; er hat zur selben Zeit wie Erasmus und ich in Jena studiert und ist nun Hilfsassistent des Professors für Medizin.«
»Noch nicht ganz«, sagte Dietmahler, »aber eines Tages hoffentlich.«
»Du weißt ja, ich war in Jena, um meine Freunde zu besuchen«, fuhr Fritz fort, »da habe ich ihn gebeten, ein paar Tage mit zu uns zu kommen.«
Die Freifrau sah ihn an, und in ihrem Blick glomm Entsetzen, die Angst eines Hasen in Panik. »Dietmahler braucht einen Schluck Branntwein, damit er noch ein paar Stunden am Leben bleibt.«
»Ist ihm nicht wohl?« fragte die Freifrau bestürzt. »Ich schicke nach der Wirtschafterin.« – »Aber die brauchen wir doch nicht«, sagte Erasmus. »Du hast bestimmt selbst Schlüssel zum Eßzimmer.« – »Ja, bestimmt«, sagte sie und sah ihn flehend an. »Nein, ich habe die Schlüssel«, sagte Sidonie, »immer schon, seit meine Schwester geheiratet hat. Ich werde euch in die Speisekammer führen, seid unbesorgt.« Die Freifrau faßte sich wieder und hieß den Freund ihres Sohnes willkommen. »Mein Mann kann Sie jetzt nicht empfangen, er hält seine Andacht.« Erleichtert, daß die Tortur vorüber war, begleitete sie die jungen Leute nicht durch die schäbigen Zimmer und die noch schäbigeren Flure voller schlichter, solide gearbeiteter alter Möbel. An den pflaumenblauen Wänden sah man andersfarbige Rechtecke, wo früher Bilder gehangen haben mußten. In der Speisekammer schenkte Sidonie Branntwein ein, und Erasmus brachte einen Toast auf Jena aus: »Stoßt an! Jena lebe hoch! Hurra!«
»Was das Hurra soll, weiß ich nicht«, sagte Sidonie. »Jena ist ein Ort, an dem Fritz und Asmus Geld verschwendet, Läuse bekommen und Unsinn redenden Philosophen zugehört haben.« Sie gab ihren Brüdern die Speisekammerschlüssel und ging wieder zu der Mutter, die sich nicht von der Stelle gerührt hatte, seit man sie stehengelassen hatte, und auf die Vorbereitungen zur großen Wäsche hinunterstarrte. »Mutter, ich möchte, daß du mir etwas Geld anvertraust, fünf oder sechs Thaler vielleicht, damit ich einiges für unseren Gast herrichten kann.« – »Was denn herrichten, mein Liebes? In dem Zimmer, das er haben soll, steht doch schon ein Bett.« – »Ja, aber die Dienstboten verwahren dort die Kerzen und halten ihre Bibelstunde ab.« – »Aber, mein Liebes, was will dieser Mann denn tagsüber in seinem Zimmer?« Sidonie meinte, er würde vielleicht etwas schreiben wollen. »Etwas schreiben!« wiederholte die Mutter in höchster Verwunderung. »Ja, und dafür braucht er einen Tisch.« Sidonie nutzte die Gunst des Augenblicks, »und falls er sich waschen möchte, einen Krug Wasser und eine Schüssel, ja, und einen Eimer für das schmutzige Wasser.« – »Aber Sidonie, weiß er denn nicht, wie man sich unter der Pumpe wäscht? Deine Brüder machen es alle so.« – »Und in dem Zimmer ist auch kein Stuhl, auf dem er nachts seine Kleider ablegen kann.« »Seine Kleider! Es ist noch viel zu kalt, als daß man sich nachts entkleiden könnte. Ich glaube, ich habe mich seit zwölf Jahren nicht mehr nachts entkleidet, nicht einmal im Sommer.« – »Und trotzdem hast du uns zur Welt gebracht, elf Kinder!« rief Sidonie. »Der Himmel schütze mich vor einer Ehe wie deiner!«
Die Freifrau hörte ihr kaum zu. »Und dann ist da noch etwas, woran du nicht gedacht hast – der Vater könnte seine Stimme erheben.« Das beeindruckte Sidonie nicht. »Dieser Dietmahler muß sich an den Vater und an unsere Art gewöhnen, und wenn er dazu nicht bereit ist, dann soll er seine Sachen packen und schleunigst heimgehen.«
»Aber wenn das so ist, kann er sich dann nicht auch an unsere Gästezimmer gewöhnen? Fritz hätte ihm erklären sollen, daß wir ein einfaches gottesfürchtiges Leben führen.«
»Warum ist es gottesfürchtig, keinen Eimer für schmutziges Wasser zu haben?« fragte Sidonie.
»Was sind das für Reden? Schämst du dich deines Heims, Sidonie?«
»Ja, ich schäme mich.« Sie war sechzehn und loderte wie eine Flamme. Ungeduld, in geistige Energie übersetzt, trieb alle jungen Hardenbergs um. Fritz wollte nun mit seinem Freund zum Fluß hinuntergehen, den Treidelpfad entlangspazieren und über Dichtung und die Berufung des Menschen sprechen. »Das hätten wir überall tun können«, sagte Dietmahler. »Aber ich möchte, daß du meine Heimat siehst«, erklärte ihm Fritz. »Es ist altmodisch hier, wir sind altmodisch in Weißenfels, aber wir haben unseren Frieden, wir fühlen uns heimisch hier.« Einer der Dienstboten, der im Hof gewesen war, erschien, jetzt im schwarzen Tuchrock, in der Tür und sagte, der Herr würde sich freuen, den Gast seines Sohnes vor dem Essen im Studierzimmer begrüßen zu können.
»Der altböse Feind liegt in seiner Höhle«, rief Erasmus. Dietmahler fühlte sich einigermaßen unbehaglich. »Es ist mir eine Ehre, deinen Vater kennenzulernen«, sagte er zu Fritz.
2. Kapitel
Das Studierzimmer
Erasmus mußte der Sohn sein, der die Statur vom Vater hatte, denn der Freiherr, der sich jetzt im Halbdunkel seines Studierzimmers höflich erhob, war gegen Dietmahlers Erwartung ein kleiner, untersetzter Mann; er trug eine Nachtmütze aus Flanell zum Schutz vor der Zugluft. Woher hatte dann Fritz – da die Mutter nur ein Strich war – seine hochaufgeschossene hagere Gestalt? Eine Gemeinsamkeit aber hatten der Freiherr von Hardenberg und sein ältester Sohn: Auch er fing sofort an zu reden, seine Gedanken drängten sich danach, zu Worten zu werden.
»Gnädiger Herr, ich bin in Ihr Haus gekommen«, begann Dietmahler nervös, doch Hardenberg unterbrach ihn: »Dies ist nicht mein Haus. Wohl wahr, ich habe es der Witwe von Pilsach abgekauft, um meine Familie unterzubringen, als ich zum Direktor der kursächsischen Salinen ernannt wurde und deshalb in Weißenfels Wohnung nehmen mußte. Aber der Stammsitz der Hardenbergs, unser Heim und unser Boden, das ist Oberwiederstedt in der Grafschaft Mansfeld.« Dietmahler erwiderte höflich, er könne sich das Glück, Oberwiederstedt kennengelernt zu haben, nur wünschen. »Da hätten Sie nichts als Ruinen gesehen«, sagte der Freiherr, »und unterernährtes Vieh. Aber es ist alter Adelsbesitz, und aus diesem Grund ist es mir wichtig zu wissen, und ich ergreife die Gelegenheit, Sie zu fragen, ob es wahr ist, daß mein ältester Sohn Friedrich sich mit einer bürgerlichen jungen Frau eingelassen hat.«
»Mir ist nicht zu Ohren gekommen, daß er sich mit irgend jemanden eingelassen hätte«, sagte Dietmahler ärgerlich, »doch ich bezweifle in jedem Fall, daß man ihn mit normalen Maßstäben messen kann, er ist ein Dichter und ein Philosoph.«
»Seinen Lebensunterhalt wird er als Akzessist des Direktors der Salinen verdienen«, sagte der Freiherr, »aber es ist nicht rechtens, Sie auszufragen. Ich heiße Sie als Gast willkommen, wie einen Sohn also, und Sie werden nichts dagegen haben, daß ich ein wenig mehr über Sie erfahren möchte. Wie alt sind Sie, und was ist Ihr Ziel im Leben?«
»Ich bin zweiundzwanzig, und ich befinde mich in der Ausbildung zum Chirurgen.«
»Und sind Sie Ihrem Vater gehorsam?«
»Mein Vater ist tot, Herr Baron. Er war Stukkateur.«
»Danach habe ich Sie nicht gefragt. Haben Sie den Verlust von Familienangehörigen zu beklagen?«
»Ja, Herr Baron, zwei kleine Brüder sind an Scharlach gestorben und eine Schwester an der Auszehrung, ich habe sie alle im selben Jahr verloren.«
Der Freiherr nahm seine Nachtmütze ab, offensichtlich aus Ehrfurcht vor dem Tod. »Ein guter Rat: Wenn Sie, ein junger Mann, ein Student, von der Begierde nach Frauen gequält werden, dann hilft dagegen am besten möglichst viel Bewegung an der frischen Luft.« Er machte einen Rundgang durch die Stube, an deren Wänden überall Bücherregale standen, manche mit leeren Brettern. »Übrigens, wieviel Geld pro Woche würden Sie für geistige Getränke ausgeben, was schätzen Sie, he? Wieviel für Bücher – keine erbaulichen Schriften, versteht sich? Wieviel für einen neuen schwarzen Rock, ohne jede Erklärung, wieso der alte nicht mehr tragbar ist? Nun, wieviel?«
»Herr Baron, mit diesen Fragen üben Sie Kritik an Ihrem Sohn. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten mich nicht ausfragen.« Hardenberg war eigentlich kein alter Mann – er war zwischen fünfzig und sechzig –, aber als er Jakob Dietmahler jetzt anstarrte, hatte er den gekrümmten Hals und gesenkten Kopf eines Greises. »Sie haben Recht, völlig Recht. Ich habe die Gelegenheit ausgenutzt. Gelegenheit ist schließlich nur ein anderes Wort für Versuchung.«
Er legte dem Gast die Hand auf die Schulter. Dietmahler erschrak und wußte nicht, ob er auf die Knie gedrückt werden sollte, ob der Freiherr sich auf ihn stützen wollte oder ob beides der Fall war. Er mußte es jedenfalls gewohnt sein, sein Gewicht einem Standfesteren anzuvertrauen, vielleicht seinen kräftigen Söhnen, vielleicht sogar seiner Tochter. Dietmahler spürte, wie sein Schlüsselbein nachgab. Ich mache eine schlechte Figur, dachte er, aber wenigstens lag er auf den Knien, während Hardenberg, ärgerlich über seine eigene Schwäche, sich im Umsinken festhielt, zuerst an der Platte des schweren Eichentisches, dann an einem Tischbein. Die Tür öffnete sich, und derselbe Diener kam wieder, diesmal allerdings in Pantoffeln.
»Wünschen gnädiger Herr, daß der Ofen angezündet wird?«
»Knie mit uns nieder, Gottfried.«
Mit knirschenden Knochen ging der alte Dienstmann neben dem Herrn in die Knie. Sie sahen wie ein altes Ehepaar aus, das die wackelnden Köpfe über dem Haushaltsbuch zusammensteckt – erst recht, als der Freiherr rief: »Wo sind denn die Kleinen?«
»Die Kinder der Dienstboten, Euer Exzellenz?«
»Sicher, und der Bernhard.«
3. Kapitel
Der Bernhard
Im Hause Hardenberg gab es einen Engel, den weizenblonden August Wilhelm Bernhard. Nach der ältesten, der unscheinbaren, mütterlichen Caroline, nach Fritz mit den großen Augen, dem stämmigen kleinen Erasmus, dem leichtlebigen Karl, der offenherzigen Sidonie, dem gewissenhaften Anton und der zarten Auguste kam der blonde Bernhard. Der Tag, an dem man ihm lange Hosen anziehen mußte, war schrecklich für seine Mutter. Sie, die so gut wie nie etwas für sich verlangte, bat Fritz inständig: »Geh zu ihm, geh zu deinem Vater, bitte ihn, flehe ihn an, daß mein Bernhard noch eine kleine Weile in Röckchen herumlaufen darf.« – »Mutter, was soll ich sagen, ich meine, Bernhard ist sechs Jahre alt.«
Inzwischen, fand Sidonie, war er mehr als alt genug, um zu verstehen, was Höflichkeit gegenüber einem Gast bedeutet. »Ich weiß nicht, wie lange er bleiben will, Bernhard. Er kam mit einem ziemlich großen Koffer.«
»Der Koffer ist voll mit Büchern«, sagte Bernhard, »und eine Flasche Schnaps hat er auch mitgebracht. Weißt du was? Er hat bestimmt gedacht, so was gibt es in unserem Haus nicht.« »Bernhard, du bist in seinem Zimmer gewesen.«
»Ja, stimmt.«
»Du hast seinen Koffer aufgemacht.«
»Ja; aber ich wollte nur mal sehen, was drin ist.«
»Hast du den Koffer offengelassen oder wieder zugemacht?«
Bernhard zögerte mit der Antwort. Er wußte es nicht mehr.
»Das ist auch nicht so wichtig«, sagte Sidonie. »Du mußt Herrn Dietmahler natürlich gestehen, was du getan hast, und ihn um Verzeihung bitten.«
»Wann?«
»Bevor es Nacht wird, sollte es schon sein. Je eher, desto besser.«
»Ich habe ihm nichts zu sagen!« rief Bernhard. »Ich habe nichts kaputtgemacht.«
»Du weißt, daß Vater dich sehr milde straft«, sagte Sidonie beruhigend. »Nicht so, wie wir gestraft wurden. Vielleicht trägt er dir auf, deine Jacke ein paar Tage lang verkehrt herum anzuziehen, nur damit du dich erinnerst. Vor dem Abendessen werden wir etwas Musik hören, und danach gehe ich dann mit dir zum Gast hinauf, und du kannst ihn bei der Hand fassen und in Ruhe mit ihm sprechen.«
»Ich bin dieses Haus leid!« schrie Bernhard und rannte davon.
Fritz ging im Küchengarten zwischen den Gemüsebeeten auf und ab, sog den Duft der dicken Bohnenblüten ein und rezitierte mit schallender Stimme.
»Fritz«, rief Sidonie ihn, »ich habe den Bernhard verloren.«
»Oh, das kann nicht sein.«
»Ich habe ihn im Frühstückszimmer ausgeschimpft, und er ist mir entschlüpft und durchs Fenster in den Garten gesprungen.«
»Hast du ihm einen von den Dienstboten nachgeschickt?«
»Oh Fritz, lieber nicht, sie erzählen es der Mutter.«
Fritz sah sie an, klappte sein Buch zu und sagte, er werde seinem Bruder nachgehen und ihn finden. »Und wenn es sein muß, zerre ich ihn an den Haaren her, aber du und Asmus, ihr müßt inzwischen meinen Freund unterhalten.«
»Wo ist er jetzt?«
»In seinem Zimmer; er ruht sich aus. Vater hat ihn zermürbt. In seinem Zimmer ist übrigens das Unterste zuoberst gekehrt, und sein Koffer steht offen.«
»Ist er ärgerlich?«
»Gar nicht. Vielleicht denkt er, das sei bei uns in Weißenfels so Sitte.«
Fritz zog seine Friesjacke an und ging ohne Zögern zum Fluß hinunter. In Weißenfels wußte jeder, daß der junge Bernhard nie ertrinken würde; er war eine Wasserratte. Schwimmen konnte er nicht, so wenig wie sein Vater. Während seiner sechs Dienstjahre in der Hannoveraner Armee hatte der Freiherr zwar wiederholt Kampfhandlungen gesehen und viele Flüsse überquert, aber schwimmend hatte er sich nie über Wasser halten müssen. Bernhard dagegen hatte immer nahe am Wasser gelebt und schien ohne Wasser nicht leben zu können. Er trieb sich ständig an der Anlegestelle der Fähre herum, in der Hoffnung, unbemerkt an Bord schlüpfen zu können, ohne die drei Pfennig für die Überfahrt bezahlen zu müssen. Die Eltern wußten das nicht. In der Stadt gab es so etwas wie eine menschenfreundliche Verschwörung, den Freiherrn mit vielen Dingen zu verschonen, einmal, um ihm seinen frommen Sinn zu erhalten, zum anderen aber, um nicht seinen wilden Jähzorn zu wecken.
Die Sonne war untergegangen, nur der Himmel über dem Horizont glühte rot. Der Nebel hing über dem Wasser. Der kleine Junge war nicht bei der Fähre. Ein paar Schweine und eine Herde Gänse, die nicht über die stattliche Brücke von Weißenfels getrieben werden durften, warteten auf die letzte Überfahrt.
4. Kapitel
Bernhards rote Mütze
Zum erstenmal hatte Fritz Angst.
Seine Phantasie eilte ihm voraus, zur Klostergasse zurück, begegnete der Wirtschafterin an der Haustür – aber junger Herr, was ist das für eine Last, die Sie da ins Haus tragen? Es tropft ja überall, ach meine Fußböden, für die bin ich verantwortlich. Seine Mutter hatte immer geglaubt, Bernhard sei zum Pagen bestimmt, wenn schon nicht am Hof des Sächsischen Kurfürsten, dann doch wenigstens beim Grafen von Mansfeld oder dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel. In nicht allzu ferner Zeit würde es zu Fritzens Pflichten gehören, den kleinen Bruder von einem Hof zum anderen zu schleppen, in der Hoffnung, ihn zufriedenstellend unterzubringen.
Die Flöße lagen unter der Brücke, dicht am Ufer, neben aneinandergeketteten, sanft schaukelnden Kiefernstämmen, die auf den nächsten Abschnitt ihrer Reise warteten. Ein Wächter probierte ein Bund Schlüssel am Türschloß einer Hütte aus. »Wächter, haben Sie einen kleinen Jungen hier entlanglaufen sehen?«
Ein Junge hätte ihm sein Essen bringen sollen, sagte der Wächter, aber der Schlingel sei nicht gekommen. »Sehen Sie, der Treidelpfad ist menschenleer.«
Die leeren Kähne, die überholt werden mußten, waren an ihrem Liegeplatz am anderen Ufer vertäut. Fritz stürmte über die Brücke. Jedermann sah ihn und seine flatternden Rockschöße. Hatte der Freiherr keine Diener, die er ausschicken konnte? Die Kähne schwankten an ihren Tauen, stießen knarrend gegeneinander, Bootswand gegen Bootswand. Fritz sprang vom Kai herunter auf das nächstgelegene Deck. Er hörte ein Getrappel, wie von einem Tier, das größer als ein Hund sein mußte.
»Bernhard!«
»Ich komm' nie wieder«, rief Bernhard.
Das Kind lief übers Deck, kletterte dann, weil es den Sprung auf das Nachbarboot nicht wagte, über das Schandeck und versuchte, sich von dort aus herunterzulassen, hielt sich mit beiden Händen fest und tastete mit den Stiefeln nach einem Halt. Fritz ergriff ihn an den Handgelenken, und im selben Augenblick geriet die gesamte Bootsreihe in eine ihrer unberechenbaren Bewegungen, die Kähne prallten heftig gegeneinander, so daß Bernhard, der immer noch außen an der Bootswand hing, gefangen und eingeklemmt wurde. Er hustete mitleiderregend, und ein Schwall Tränen und Blut strömte aus ihm heraus wie Luft aus einem Ballon.
»Wie soll ich dich da wieder herausziehen?« wollte Fritz wissen. »Was bist du für eine Pest, eine Pest bist du.«
»Laß mich los, laß mich sterben«, heulte Bernhard.
»Wir müssen uns nach vorn arbeiten, dann kann ich dich hochziehen.« Aber der Überlebenstrieb schien das Kind für den Augenblick im Stich gelassen zu haben, Fritz mußte alles allein machen, mußte den Bruder, der sich heftig wehrte, immer weiter zwischen den beiden Bootswänden nach vorn zerren und schieben. Wenn sie näher am Ufer gewesen wären, hätten Vorbeigehende zur Hilfe kommen können, aber dann, meinte Fritz, würden sie wahrscheinlich glauben, hier gehe es um Mord und Totschlag. Zum Vordersteven hin wurden die Boote schmaler, er sah das Wasser zwischen ihnen schimmern und hievte das Kind hoch wie einen nassen Sack. Sein Gesicht war nicht bleich, sondern glühte hochrot.
»Hilf doch mit, willst du denn ertrinken?«
»Und wenn schon?« schrie Bernhard. »Du hast selbst mal gesagt, daß der Tod nichts Wichtiges ist, sondern nur die Verwandlung in einen anderen Zustand.«
»Du Lausejunge du, das war nicht für dich bestimmt«, brüllte ihm Fritz ins Ohr.
»Meine Mütze!«
Das Kind hing sehr an seiner roten Mütze; jetzt war sie verlorengegangen, ebenso wie einer seiner Vorderzähne und seine Hose. Er hatte nur noch lange, mit Bändern zusammengeschnürte Baumwollunterhosen an. Wie die meisten Lebensretter war Fritz plötzlich wütend auf den geliebten Geretteten. »Deine Mütze ist dahin, wahrscheinlich schwimmt sie der Elbe entgegen.«
Dann, beschämt über seine Wut, hob er den kleinen Jungen hoch und trug ihn auf den Schultern heimwärts. Als er so hoch oben thronte, belebte sich Bernhard wieder ein wenig. »Kann ich den Leuten zuwinken?«
Fritz mußte sich bis zum Ende der Bootsreihe vorarbeiten, um die senkrecht nach oben führenden eisernen Stufen zu erreichen, die in die Kaimauer gebaut waren und die er hinaufsteigen konnte, ohne den Bernhard abzusetzen.
Wie schwer ein Kind ist, wenn es die Verantwortung abgibt.
So konnte er nicht schnurstracks zur Klostergasse zurückgehen. Aber Sidonie und Asmus zusammen würden sich wohl bei der Musik vor dem Essen eine passende Erklärung einfallen lassen. Unterdessen mußte er samt Bernhard erst einmal trocken werden; er wußte viele Orte in Weißenfels, wo das möglich war. Nachdem er die Brücke wieder überquert hatte, ging er eine kurze Strecke an der Saale entlang, wendete sich dann zweimal nach links und einmal nach rechts und hielt auf die Lichter von Severins Buchhandlung zu.
Im Laden waren keine Kunden. Der blasse Severin in seinem langen Kittel studierte beim Licht einer Kerze mit Reflektor eine der zerfledderten Listen, die Buchhändler lieber als alles andere lesen.
»Lieber Hardenberg! Sie habe ich nicht erwartet. Stellen Sie den kleinen Bruder doch bitte auf ein Stück Zeitung. Hier ist die Leipziger von gestern.«
Ihn überraschte nichts.
»Der kleine Bruder macht großen Ärger«, sagte Fritz, indem er den Bernhard absetzte. »Er ist zu den Kähnen hinuntergelaufen. Warum er so naß geworden ist, weiß ich nicht.«
»Kinderleicht, kinderleicht«, sagte Severin nachsichtig, aber seine Nachsicht galt Fritz. Für Kinder konnte er sich nicht erwärmen. Er ging in die hinterste Ecke seines Ladens, zog eine hölzerne Schublade auf und nahm einen großen bäuerlichen Strickschal heraus.
»Zieh das Hemd aus, ich wickle dich in den Schal«, sagte er. »Dein Bruder braucht ihn mir nicht wiederzubringen. Warum hast du den ganzen Kummer angerichtet? Hast du gehofft, du könntest davonsegeln und Vater und Mutter hinter dir lassen?«
»Natürlich nicht«, sagte Bernhard empört. »Alle Boote auf diesem Ankerplatz müssen repariert werden, sie könnten nicht segeln, sie haben kein Segeltuch. Ich wollte nicht wegfahren, ertrinken wollte ich.«
»Das glaube ich nicht«, entgegnete Severin, »und das solltest du lieber nicht sagen.«
»Er liebt das Wasser«, sagte Fritz, der meinte, sein eigen Fleisch und Blut verteidigen zu müssen.
»Offensichtlich.«
»Und mir geht es genauso«, rief Fritz aus. »Wasser ist das wunderbarste Element. Schon die Berührung ist Wollust.«
Vielleicht empfand Severin keine Wollust beim Anblick von so viel Wasser auf dem Fußboden seiner Buchhandlung. Er war ein Mann von fünfundvierzig, für Fritz der »alte« Severin, ein Mensch mit sehr klarem Verstand, die Wechselfälle des Lebens konnten ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Er war arm und erfolglos gewesen, hatte sich tapfer durchgeschlagen, sehr hart gegen geringen Lohn beim Eigentümer der Buchhandlung gearbeitet und dann, als der Eigentümer gestorben war, dessen Witwe geheiratet und den gesamten Besitz übernommen. Natürlich wußte ganz Weißenfels das, und alle fanden es in Ordnung. Genauso stellte man sich Weisheit vor.
Dichtung bedeutete Severin viel – fast so viel wie seine Listen. Er hätte es gern gesehen, wenn sein junger Freund Hardenberg ein Dichter hätte bleiben können, ohne als Akzessist in der Salinenverwaltung arbeiten zu müssen.
Auf dem letzten Stück des Heimwegs jammerte Bernhard über den Verlust der roten Mütze. Sie war das einzige Stück in seinem Besitz gewesen, das seine Sympathien für die Revolution kundtat. »Ich weiß nicht, wie du an die Mütze gekommen bist«, sagte Fritz. »Und hätte der Vater sie gesehen, dann hätte er den Dienstboten sowieso befohlen, sie auf den Misthaufen zu werfen. Laß dir das Ganze eine Lehre sein, daß du nie mehr im Privateigentum von Gästen herumschnüffelst.«
»In einer Republik würde es kein Privateigentum geben«, sagte Bernhard.
5. Kapitel
Die Geschichte des Freiherrn Heinrich von Hardenberg
Der Freiherr von Hardenberg wurde 1738 geboren und kam noch als Knabe in den Besitz des Schlosses Oberwiederstedt an der Wipper in der Grafschaft Mansfeld und des Landgutes Schlöben bei Jena. Im Siebenjährigen Krieg leistete er als treuer Untertan Militärdienst bei den hannoverschen Truppen der preußischen Armee. Nach dem Frieden von Hubertusburg quittierte er den Dienst. Und er heiratete, doch brach 1769 eine Blatternepidemie in den Städten an der Wipper aus, und seine junge Frau starb. Der Freiherr pflegte die Kranken und die Sterbenden; und die Toten, deren Familie sich kein Grab leisten konnten, wurden auf dem Gelände von Oberwiederstedt beerdigt, das als ehemaliges Kloster noch immer geweihte Erde besaß. Er hatte eine tiefe religiöse Bekehrung und Erweckung erfahren – aber ich doch nicht! sagte Erasmus, sobald er alt genug war, sich zu erkundigen, was es mit den Reihen grüner Hügel so nahe am Haus auf sich habe. »Ich nicht – denkt er eigentlich auch mal daran?«
Auf jedem Grab stand ein schlichter Stein, in den die Worte eingemeißelt waren: Er oder Sie wurde am – geboren – und am – heimgeholt.
Das war die Inschrift, die von den mährischen Brüdern bevorzugt wurde. Der Freiherr hatte sich der Gemeine der mährischen Brüder angeschlossen, die den Glauben hatten, daß jede Seele entweder tot, erweckt oder bekehrt sei. Eine Menschenseele ist bekehrt, sobald sie erkennt, daß sie sich in Gefahr befindet, sobald sie weiß, worin diese Gefahr besteht, und sobald sie sich selbst laut rufen hört: Er ist mein Herr.
Ein gutes Jahr nach dem Tod seiner Frau heiratete der Freiherr seine junge Base Bernhardine von Böltzig. »Bernhardine, so ein absurder Name. Hast du nicht noch einen anderen?« Ja, ihr zweiter Name sei Auguste. »Gut, dann werde ich dich von nun an Auguste nennen.« In seinen zärtlichen Momenten war sie Gustel. Auguste war zwar furchtsam, erwies sich aber als fruchtbar. Nach zwölf Monaten wurde die erste Tochter geboren, Caroline, und ein Jahr danach kam Fritz zur Welt. Der Freiherr verfügte: »Wenn sie alt genug für die Schule sind, werden wir die beiden zu den Brüdern nach Neudietendorf schicken.«
Neudietendorf, zwischen Gotha und Erfurt gelegen, war eine Kolonie der Herrnhuter. In Herrnhut hatten die mährischen Brüder fünfzig Jahre zuvor, als sie sich durch Flucht der Verfolgung entziehen mußten, Aufnahme und Frieden gefunden. Nach Meinung der Herrnhuter wird ein Kind in eine geordnete Welt hinein geboren, in der es seinen Platz finden muß. Erziehung hilft dem Kind, seine Stelle im Reich Gottes zu finden.
Neudietendorf war wie Herrnhut ein Ort der beschaulichen Ruhe. Statt Glocken riefen Flöten die Kinder in ihre Klassen. Es war auch ein Ort des absoluten Gehorsams: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sie mußten immer in Dreiergruppen umhergehen, damit der Dritte dem Prediger weitersagen konnte, was den beiden anderen zur Unterhaltung eingefallen war. Andererseits durfte kein Lehrer strafen, solange er noch zornig war, da eine ungerechte Strafe niemals vergessen wird.
Die Kinder fegten die Fußböden, versorgten die Tiere und halfen bei der Heumahd, durften aber nie miteinander streiten oder sich in Wettspielen messen. Sie hatten dreißig Wochenstunden Unterricht und Religionslehre. Bei Sonnenuntergang mußten alle im Bett liegen und Ruhe halten bis zum Aufstehen um fünf Uhr morgens. Immer wenn eine gemeinsame Aufgabe erfüllt war – zum Beispiel das Tünchen der Hühnerställe –, wurden die langen Tischplatten auf Böcken im Freien aufgestellt, und alle setzten sich zu einem »Fest der Liebe« zusammen; man sang geistliche Lieder, und jeder, auch die Jüngsten, bekam ein kleines Glas hausgemachten Likör. Die Internatskosten betrugen acht Thaler für ein Mädchen und zehn Thaler für einen Knaben (denn der aß mehr und brauchte eine lateinische und eine hebräische Grammatik).
Caroline von Hardenberg, die Älteste, die ihrer Mutter nachschlug, machte ihre Sache im Haus der Mägde sehr gut. Fritz war als verträumtes, dem Anschein nach zurückgebliebenes Kind zur Welt gekommen. Nachdem er als Neunjähriger eine schwere Krankheit überstanden hatte, wurde er intelligent und kam noch im selben Jahr nach Neudietendorf. »Aber woran hat er es denn fehlen lassen?« fragte der Freiherr, als er ein paar Monate später vom Prediger im Auftrag der Ältesten gebeten wurde, seinen Sohn aus der Lehranstalt zu entfernen. Der Prediger, der höchst ungern ein Kind ganz und gar verdammte, erklärte, Fritz stelle dauernd Fragen, sei aber nicht willig, Antworten hinzunehmen. Zum Beispiel der »Kinderkatechismus«, sagte der Prediger. Da fragt der Lehrer: »Was bist du?«
Antwort: Ich bin ein menschliches Wesen.
Frage: Spürst du es, wenn ich dich anfasse?
A. Ich spüre es sehr gut.
F. Was ist das, ist das nicht Fleisch?
A. Das ist Fleisch.
F. All dies Fleisch an dir heißt der Körper.
Wie heißt es?
A. Der Körper.
F. Woran erkennst du, daß Menschen gestorben sind?
A. Sie können nicht sprechen, sie können sich nicht mehr bewegen.
F. Weißt du, warum nicht?
A. Ich weiß nicht, warum nicht.
»Diese Fragen konnte er nicht beantworten?« rief der Freiherr.
»Er hätte es möglicherweise gekonnt, aber die Antworten, die er wirklich gab, waren nicht richtig. Er ist ein Kind, noch nicht einmal zehn Jahre alt, und er besteht darauf, daß der Körper nicht Fleisch sei, sondern aus demselben Stoff wie die Seele.«
»Aber das ist nur ein einziges Beispiel.«
»Ich könnte Ihnen noch viele aufzählen.«
»Er hat es noch nicht gelernt.«
»Er verträumt seine Gelegenheiten. Er wird nie ein annehmbares Mitglied von Neudietendorf sein.«
Der Freiherr fragte, ob man kein einziges Anzeichen sittlicher Grazie an seinem Sohn bemerkt habe. Der Prediger antwortete ausweichend.
Die Mutter, die arme Auguste, die bald anfing zu kränkeln (obwohl sie zehn ihrer elf Kinder überlebte) und immer jemanden zu suchen schien, bei dem sie sich entschuldigen konnte, bat inständig, ihren Sohn selbst unterrichten zu dürfen. Aber was hätte sie ihn lehren können? Allenfalls ein wenig Musik. Man ließ einen Hofmeister aus Leipzig kommen.
6. Kapitel
Der Onkel Wilhelm
Während ihrer Zeit in Oberwiederstedt luden die Hardenbergs ihre Nachbarn nicht ein und nahmen keine Einladungen an, denn sie wußten, daß daraus Weltlichkeit werden konnte. Geselligkeit war auch eine Frage des Geldes; und sie mußten sich einschränken. Der Siebenjährige Krieg war teuer – Friedrich II. sah sich gezwungen, eine staatliche Lotterie einzurichten, um für die Kosten aufkommen zu können –, und für manche seiner treuen Landjunker bedeutete er den finanziellen Ruin. 1780 mußten vier der kleineren Hardenbergschen Güter verkauft und die gesamte bewegliche Habe eines weiteren, des Gutes Möckritz, versteigert werden. Nun stand es da ohne Geschirr, ohne Vorhänge und ohne Vieh. Bis zum Horizont hin lagen die Felder brach. In Oberwiederstedt sah man durch die schmalen altmodischen Fenster reihenweise leere Taubenschläge und einen Gutshof, der früher einmal die Klosterkirche gewesen und viel zu weiträumig war, um ganz oder auch nur halb bewirtschaftet zu werden. Das Haupthaus mit den fehlenden Ziegeln, geflickt, verwittert, voller Wasserflecken, weil die Regenrinnen seit Jahren nicht mehr dicht waren, bot einen beklagenswerten Anblick. Die Weide über den alten Grabsteinen aus der Zeit der Blatternepidemie war vertrocknet. Die Felder lagen verdorrt. Das Vieh weidete am Boden der Wassergräben, wo es feucht war und ein wenig Gras wachsen konnte.
Kleiner und erfreulicher war Schlöben bei Jena; manchmal machte die Familie einen Ausflug dorthin. In Schlöben mit dem Mühlbach und den bemoosten Eichen »kann das Herz Frieden finden«, sagte Auguste scheu. Aber Schlöben steckte fast genauso tief in Schulden wie die anderen Güter. Der Freiherr erklärte ihr, ein Kredit, der nicht prolongiert werde, habe nichts Friedvolles an sich.
Dem Adel, also auch dem Freiherrn von Hardenberg, waren die meisten Wege zum Geldverdienen versperrt, aber er hatte das Recht, in die Dienste seines Fürsten zu treten. 1784 (sobald der amtierende Direktor gestorben war) wurde Hardenberg zum Direktor der kursächsischen Salinen Dürrenberg, Kösen und Artern ernannt. Sein Gehalt betrug 650 Thaler und ein bestimmtes Kontingent Feuerholz. Die Hauptverwaltung der Salinen befand sich in Weißenfels, und 1786 kaufte der Freiherr das Haus in der Klostergasse. Es war nicht wie Schlöben, aber als sie die frostige Einsamkeit und die schrecklich veraltete Haushaltseinrichtung von Oberwiederstedt verlassen konnte, weinte Auguste vor Erleichterung und betete, daß ihre Tränen kein Zeichen von Undankbarkeit sein möchten. Weißenfels hatte zweitausend Einwohner – zweitausend lebende Seelen –, gepflasterte Höfe, ein Gefängnis, ein Armenhaus, das alte ehemalige Palais, einen Schweinemarkt, den Bootsverkehr auf dem Fluß und die dicken Wolken, die sich auf der schimmernden Wasserfläche spiegelten, es hatte eine Brücke, ein Hospital, einen Dienstagsmarkt, Bleichen und viele, viele Geschäfte, ungefähr dreißig. Die Freifrau hatte kein Taschengeld und war noch nie zum Einkaufen gegangen, verließ das Haus überhaupt kaum, außer an Sonntagen; trotzdem huschte ein flüchtiges Leuchten wie eine ungewisse Stunde Wintersonne über ihr Gesicht, wenn sie sich nur vorstellte, daß so viele Dinge und so viele Menschen ganz nah waren.
In Weißenfels wurde dann im bitteren Februar 1787 Bernhard geboren. Fritz war damals fast fünfzehn und zu diesem Zeitpunkt nicht in Weißenfels, sondern noch bei seinem Onkel Wilhelm in Lucklum im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel. Der Junge war seinem Hofmeister über den Kopf gewachsen, der bis spät in die Nacht über Mathematik- und Physiologiebüchern hatte brüten müssen, um mit seinem Schüler Schritt halten zu können, »aber das ist weiter kein Wunder«, schrieb der Onkel. »Hofmeister sind eine Menschenklasse von geistiger Armut, und diese ganze Herrnhuterei besteht nur im Singen frommer Lieder und häuslicher Arbeit, ganz unpassend für einen von Hardenberg. Schicke Fritz wenigstens für eine Weile zu mir. Er ist fünfzehn oder sechzehn, ich weiß es nicht genau, und er muß lernen, etwas von Wein zu verstehen, was in Weißenfels nicht möglich ist, denn die Trauben dort kann man nur zu Branntwein und Essig verarbeiten; er muß auch erfahren, worüber Männer reden, wenn sie in anständiger Gesellschaft sind.« Der Freiherr war wie üblich wütend über die Bemerkungen seines Bruders und noch mehr über den Ton, in dem sie vorgebracht wurden. Wilhelm war zehn Jahre älter als er und offenbar in erster Linie auf die Welt gekommen, um ihn zu ärgern. Er war ein Mann von hohem Ansehen – »in seinen eigenen Augen«, fügte der Freiherr hinzu –, Statthalter und Landkomtur der Deutschordensballei Sachsen (Sitz Lucklum). Zu sehr vielen Anlässen trug er um den Hals das blitzende Kreuz des Malteserordens, das auch in prunkvoller Goldlitze auf seinem Umhang aufgestickt war. Die Hardenberg-Kinder kannten ihn unter dem Namen ›der Großkreuz‹ und ›Seine Herrlichkeit‹. Er hatte nicht geheiratet und empfing nicht nur andere Landedelleute mit großzügiger Gastfreundlichkeit, sondern auch Musiker, Politiker und Philosophen – Menschen, die sich an der Tafel eines großen Herren sehen lassen sollten, um ihm ihre Meinungen vorzutragen und den seinen beizupflichten.
Nach einem Aufenthalt von einigen wenigen Monaten kam Fritz wieder nach Weißenfels zu seinem Vater und brachte ihm einen Brief vom Onkel mit.
Lucklum, Oktober 1787
Es ist mir lieb, daß Fritz sich wieder findet und ins Gleis kömmt, aus welchem ich ihn gewiß nicht wieder herausnehmen will. Mein Haus ist für seinen jungen Kopf zu hoch gespannt, er wird zu sehr verwöhnt, und ich sehe zu viele fremde Leute und kann nicht verhindern, daß an meinem Tische viel gesprochen wird, was ihm nicht dienlich und heilsam ist.
Der Freiherr schrieb seinem Bruder, er danke ihm für die Gastfreundschaft und bedauere es, ihm nicht mehr danken zu können. Die weiße Weste, die Hose und der Tuchrock, die der Onkel für Fritz haben nähen lassen, offenbar weil ihm die mitgebrachten Kleider nicht elegant genug für seine abendliche Tafel gewesen seien, würden nun als Spende für die Armen an die Herrnhuter Brüdergemeine geschickt. In Weißenfels, wo man ein einfaches Leben führe, werde Fritz keine Gelegenheit haben, sie zu tragen.
»Bester Fritz, du hattest Glück«, sagte der dreizehnjährige Erasmus.
»Das weiß ich nicht«, sagte Fritz. »Das Glück hat seine Regeln, man muß sie nur verstehen können, und dann ist es kaum noch Glück.«
»Ja, aber jeden Abend beim Essen sitzen, während all die bedeutenden Menschen sich einen Spaß daraus machten, dir zu viel zu trinken zu geben, und dein Glas immer wieder mit guten Weinen nachfüllen ließen, und was weiß ich … Worüber haben sie geredet?«
»Über Naturphilosophie, Galvanismus, tierischen Magnetismus und Freimaurerei«, sagte Fritz.